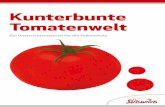Elias KATZ - Ein MINI - SIDUR (Ein Miniaturgebetbuch und seine Miniaturen)
(2014): „‘Goldland Kolumbien‘ – ein Eldorado!?“. En: Amerindian Research 9/1, 31, pp....
Transcript of (2014): „‘Goldland Kolumbien‘ – ein Eldorado!?“. En: Amerindian Research 9/1, 31, pp....
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 20
"Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
Ursula Thiemer-Sachse
Kolumbien, eines der großen Länder Südamerikas, seit mehr als 60 Jahren von blutigen Auseinanderset-zungen um die Macht zerrissen, wo die einfache ländli-che Bevölkerung aus manchen Regionen verdrängt wird, weil sich verschiedene bewaffnete Kräfte um die Macht gegen das etablierte Regime wenden, weil Fra-gen von Drogengewinnung und Drogenhandel vielen Bauern die Lebensgrundlage entziehen, Kolumbien, das mit seiner Biodiversität im Bereich der sogenann-ten grünen Anden einen gewaltigen natürlichen Reich-tum zu bieten hätte, Kolumbien ist immer wieder als reiches Land, um dessen Reichtümer gestritten wird, in die Schlagzeilen geraten. Aus Kolumbien ist das Phä-nomen des "Vergoldeten" = El Dorado erstmalig in das Bewusstsein der Menschen gelangt, hat die Ge-schichte der Suche nach einem Land "Eldorado" ihren Anfang genommen. Wie sieht es nun mit der Ge-schichte dieses heute als Eldorado problematischen Kolumbien aus?
In Kolumbien verzweigt sich das Faltengebirge der Anden in drei große Stränge. Nach ihrer Lage zueinan-der werden sie als West-, Zentral- und Ostkordillere bezeichnet. Eingeschlossen sind Hochbecken und Hochebenen unterschiedlichen Charakters. Dazwi-schen befinden sich die gewaltigen Fluss-Senken des Río Cauca und des Río Magdalena. Die beiden Ströme fließen weite Strecken parallel. Sie sind durch die Hö-hen der Zentralkordillere getrennt. Nach Norden hin entwässern sie das Land. In der Küstenebene vereini-gen sie sich und münden als ein großer Strom in die Karibische See. Östlich davon liegt das isolierte Hoch-gebirge der Sierra Nevada de Santa Marta. In unmittel-barer Nachbarschaft des Meeres erhebt sich dieses Massiv bis über 5000 m. Mit dem schneebedeckten Pico Cristóbal Colón (5808 m) hat es den höchsten Gipfel des Landes.
Nach dem "Entdecker Amerikas" Christoph Ko-lumbus ist nicht nur dieser höchste Berg Kolumbiens benannt. Seit der Unabhängigkeitsbewegung zu Beginn des 19. Jahrhunderts trägt das gesamte Land seinen Namen: Colombia. Damit wollte der Libertador Simón Bolívar, der Befreier Südamerikas, im Bemühen um eine Vereinigung aller Kräfte gegen das spanische Ko-lonialregime ein Groß-Kolumbien schaffen. Allerdings sollte es noch Gebiete der heutigen Nachbarländer umfassen, was nicht gelang.
Die spanischen Konquistadoren hatten die von ihnen zuerst entdeckten Küstenregionen an der Karibi-schen See wegen der dort erbeuteten Goldreichtümer als Castilla de Oro, Goldkastilien, bezeichnet. Später nannte man das gesamte Territorium des spanischen
Vizekönigreichs Nueva Granada, Neu-Granada. Die Befreiung vom spanischen Kolonialregime führte dann schließlich zur Gründung der Republik Kolumbien.
Die langen Meeresküsten an der Karibischen See und am Pazifik sowie die unterschiedlichen Höhenla-gen bestimmten die vielfältigen Klimata. Hinzu kommt, dass vorrangig durch die Zerklüftung der Anden und die Isolierung von Tälern und Hochebenen durch die Gebirgsketten ein buntes Mosaik ökologischer Nischen entstanden ist.
Die tropische Üppigkeit der vielfältigen Vegetati-on, die Gewalt der wasserreichen Flüsse in den Schluchten seiner Hochgebirge und in den küstenna-hen Sumpflandschaften, die Páramos, die kalten Feuchtgebiete der Hochebenen wie die heißen der Küstenzonen, die Täler, Hügel und Höhenrücken in den Gebirgsgebieten bildeten seit mehreren Jahrtau-senden die vielgestaltige Lebensumwelt der Ureinwoh-ner. Sie beeinflussten die Auseinandersetzung der Men-schen mit der Natur und ihre soziale Formierung in unterschiedlicher Art.
Über den Isthmus von Darién im Nordwesten Ko-lumbiens, das sich auf dem Territorium des heutigen mittelamerikanischen Staates Panamá fortsetzt, bildete das Land das Einzugsgebiet für die Besiedlung des südamerikanischen Subkontinents. Von Zentralamerika her eroberten sich die Menschen über diese Landbrü-cke den gewaltigen neuen Lebensraum, dessen Dimen-sionen sie selbstverständlich keinesfalls zu erfassen vermochten. Es sind gewiss mehrere Einwanderungs-wellen gewesen. Abgesehen davon wechselten im Laufe der Jahrtausende die Völker, die auf dem Territorium des heutigen Kolumbien lebten, offensichtlich auch mehrfach. Archäologische Hinterlassenschaften spre-chen für sehr unterschiedliche Kulturen, die sich dort neben- und nacheinander entfalteten.
Kolumbien war jedoch nicht nur das Einfallstor des südamerikanischen Kontinents. Es blieb auch spä-terhin ein Zwischenglied in der gegenseitigen Beein-flussung der großen Kulturzentren, die sich im mittle-ren Andenraum, d. h. dem Gebiet des heutigen Ekua-dor, Peru und Bolivien, und Mesoamerika, d. h. dem nördlichen Mittelamerika und Mexiko, herausbildeten. Kolumbien war dabei jedoch nicht nur ein vermitteln-des Bindeglied oder auch zeitweilig eine isolierende Barriere zwischen den großen Kulturzonen des Nor-dens und des Südens. Die autochthonen Völker Ko-lumbiens erwiesen sich immer erneut als nehmender und gebender Teil. Im Austausch von kulturellen Er-rungenschaften, Erfahrungen und Fertigkeiten gingen von Kolumbien auch wichtige Impulse aus.
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 21
Die enorme Aufsplitterung in regionale Kulturen ist zum Teil auf die bereits erwähnten natürlichen Um-weltbedingungen, teilweise aber auch auf starke Wan-derbewegungen zurückzuführen. Eine Folge davon war, dass Kolumbiens autochthone Völker im Ver-gleich zur gesellschaftlichen Entwicklung im perua-nisch-bolivianischen Raum auf der einen Seite und dem mexikanischen auf der anderen zurückblieben bzw. andere Gesellschaftsmodelle favorisierten. Dennoch hatte die soziale Differenzierung einen bemerkenswer-ten Grad erreicht. Sie hatte zur Herausbildung von sozial stratifizierten Gesellschaften geführt. Einzelne Kazikate, Häuptlingstümer, hatten bereits durchaus den Charakter von kleinen Despotien angenommen. Auch gab es Gebilde mit theokratischer Herrschaftsform, als diese Gruppen zu Beginn des 16. Jahrhunderts in das Blickfeld der spanischen Eroberer und deren Berichter-stattung gerieten.
Jedoch war es bis zur spanischen Eroberung im kolumbianischen Raum nirgends zur Herausbildung größerer einheitlicher Herrschaftsstrukturen gekom-men. Die in diese Richtung tendierenden Machtkämpfe wurden durch das gewaltsame Eindringen der hellhäu-tigen Fremden abgebrochen. So hatten die meisten Siedlungen ihren dörflichen Charakter bewahrt. Aber es gab bereits in den Zentren politischer Macht der einzelnen Herrscher Ansätze zur Herausbildung städti-scher Siedlungen. Zeremonialzentren waren Kristallisa-tionspunkte solcher entstehender Städte. Sie existierten aber auch als Integrationszentren für die Bevölkerung, welche in Streusiedlungen lebte. Als größte soziopoliti-sche Einheiten bildeten sich regionale Kleinstaaten heraus.
Die ökonomische Grundlage war der Bodenbau mit Maniok in den feucht-heißen Tiefländern und sonst Mais als Hauptnahrungspflanze. Kolumbien war höchstwahrscheinlich eines der Gebiete, in denen das äußerst produktive Getreide Mais erstmalig kultiviert worden ist. Je nach den klimatischen und topogra-fisch-hydrologischen Gegebenheiten wendete man den einfachen Brandrodungsfeldbau und Formen intensiver Landwirtschaft an. Es wurden besondere Bodenbau-methoden wie die Anlage von Feldbauterrassen und künstlichen Be- und Entwässerungsanlagen entwickelt. Teilweise gab es einen intensiven Gartenbau auf Hochbeeten in Sumpflandschaften.
Die Landwirtschaft sicherte auf dieser Basis einen solchen Überschuss, dass sich einige Bereiche der Ge-sellschaft von der unmittelbaren Nahrungsmittelpro-duktion lösen konnten. Es entstand eine gesellschaftli-che Arbeitsteilung: Zumindest in einigen Gebieten bildeten sich Zweige handwerklicher Produktion her-aus, die nicht mehr von Spezialisten in den Dorfge-meinden ausgeübt wurden, sondern von richtigen Handwerkergruppen. Die Gewinnung und Verarbei-tung von Edelmetallen, vor allem Gold und Kupfer,
gehörten offensichtlich dazu. Fest steht, dass sich auf dem Territorium des heutigen Kolumbien die Metal-lurgie in einigen Gebieten sehr früh entwickelt hatte; ob sie sich jedoch sehr bald von der landwirtschaftli-chen Produktion trennte, was auf Grund der notweni-gen Kenntnisse und Fertigkeiten anzunehmen ist, bleibt ungeklärt.
Eine Reihe von Gemeinsamkeiten kultureller Merkmale kennzeichnen die kolumbianischen Gesell-schaften in vorspanischer Zeit: Sie variieren nach Regi-on und Zeitraum entsprechend den unterschiedlichen Faktoren, die auf die Gemeinschaften wirkten. So lässt sich anhand archäologischer Hinterlassenschaften fest-stellen, dass in Kolumbien Häuser aus organischen Materialien bevorzugt wurden. Steinbauten hat es nicht gegeben; allerdings setzten die Tairona im Nordosten Kolumbiens ihre Behausungen und Zeremonialgebäu-de auf sorgfältig gearbeitete Fundamente aus Steinkrei-sen, legten im hügeligen Gelände innerhalb ihrer Sied-lungen Steinwege mit Treppen an und schlugen Brü-cken über die sorgsam aus Steinplatten gefügten Be-wässerungskanäle.
Die Quimbaya im zentralkolumbianischen Gebirge umgaben ihre Dörfer aus Kegeldachhütten von Holz und Bambus mit Palisaden. Auch die Muisca in den Hochebenen der Ostkordillere legten ihre Siedlungen teilweise wie Festungen mit mehreren Palisadenzäunen an. All dies kennzeichnet den latenten Kriegszustand, der bei diesen Gruppen existierte.
Hausfassaden und vor allem die Wände ihrer Tempel schmückten sie mit Gold. Monumentale Stein-arbeiten waren vor allem reliefierte Platten und säulen-förmige Statuen. Besonders die Stelen der südkolumbi-anischen San-Agustín-Kultur haben Berühmtheit er-langt.
In ganz Kolumbien waren die Bestattungsbräuche und die damit in Zusammenhang stehenden künstleri-schen Aktivitäten sehr entwickelt. Es gab sowohl Grä-ber hervorragender Einzelpersönlichkeiten mit reicher Ausstattung als auch Grabanlagen für ganze Gruppen, wahrscheinlich Familienverbände. Sie alle verraten Vorstellungen vom Weiterleben im Jenseits. Die Toten wurden mit vielen unterschiedlichen Grabbeigaben ausgestattet. Darunter nahmen Goldschmuck und gol-dene Würdezeichen sowie Smaragde einen bevorzugten Platz ein. Opferung von den Toten begleitenden Ge-folgsleuten und Frauen weisen auf das Prestige des Bestatteten hin.
Für Kolumbien sind speziell Schachtgräber zum Teil erstaunlicher Tiefe kennzeichnend. Sie können sowohl Mumien als auch Urnenbestattungen enthalten. Manche dieser Schachtgräber haben seitliche Nischen bemerkenswerter Größe. Darin sind Mehrfachbestat-tungen möglich gewesen, wie beispielsweise in der Tierradentro-Kultur Südkolumbiens. Künstliche Erd-hügel sind oft über derartigen Gräbern aufgeschüttet
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 22
worden. Zuweilen kennzeichnet auch der Aushub die unterirdischen Grabanlagen.
Die Verbindung von Steinsetzungen und halb un-terirdischen Tempelchen mit menschlichen und dämo-nischen Steinfiguren zu Grabanlagen mit Steinsarko-phagen oder Urnenbestattungen in Steinkisten ist für die San-Agustín-Kultur am oberen Río Magdalena typisch gewesen. Grabhügel mit ovalem Grundriss und von der Ausdehnung bis zu 60 mal 40 m kommen in der Sinú-Kultur der nordkolumbianischen Küstenebe-ne vor.
Jedoch nicht nur die Ausstattung für das Jenseits hob die politischen und religiösen Würdenträger von der einfachen Bevölkerung ab. Dies war nur eine auf das zukünftige Leben übertragene Fortsetzung der Privilegien des Adels und vor allem der Kaziken. Dem gewöhnlichen Volk waren beispielsweise bei den Muis-ca bestimmte Schmuckformen wie Diademe und Ohr-pflöcke verboten.
Insgesamt lässt sich aus den erhaltenen Kleinodien feststellen, dass in Kolumbien die besondere Vorliebe für Nasen-, Ohr- und Brustschmuck bei vielen Völkern im Prinzip gleich war. Dies lässt auf einen regen Aus-tausch von Vorstellungen und deren Materialisierung in der kunsthandwerklichen Produktion schließen. Eine besondere Rolle spielte bei den kolumbianischen Au-tochthonen auch die Verwendung von Drogen, um mit übernatürlichen Wesen in Kontakt zu kommen. Koka-Kauen und Schnupfen der halluzinogenen Droge Yopo führten zu Orakelbefragungen im Rauschzustand. Sie standen mit den Opfern für die außermenschlichen Wesen in Zusammenhang. Unterschiedliche Votivga-ben wurden sowohl in den Tempeln als auch auf Ber-gen und in Höhlen niedergelegt und in Seen versenkt.
Zur Zeit der spanischen Eroberung gab es in Ko-lumbien Völker, die den Sprachfamilien zuzurechnen sind, die als Chibcha, Macrokaribisch und Paez (oder Chocó) bekannt sind. Ob die Träger der archäologi-schen Kulturen auch zu diesen verhältnismäßig einheit-lichen Gruppen zu zählen sind, muss ungeklärt bleiben. Die Archäologie Kolumbiens hat noch viele Probleme der vorspanischen Vergangenheit seiner autochthonen Völker aufzuhellen.
Jedenfalls besaßen die Ureinwohner Gold zum Zeichen ihrer Würde. Objekte aus Metall hatten für sie vorrangig kultische Bedeutung. Für sie war es nicht von Belang, ob etwas aus feinem Gold oder aus der Gold-Kupfer-Legierung bestand, die von den spanischen Eindringlingen dann abwertend als oro bajo, schlechtes Gold geringen Wertes, bezeichnet wurde. Zur Herstel-lung von Schmuck und Amuletten, Würdezeichen und Machtsymbolen, Gegenständen hohen Wertes für reli-giöse Zeremonien und vor allem Opfergaben wurde Metall verwendet. Aber es war nicht Äquivalent für die Beschaffung anderer materieller Güter und ideeller Werte wie in Europa.
Die Gier der spanischen Eroberer nach dem Edelmetall
Vorrangig die Gier nach Gold trieb die spanischen Konquistadoren zur intensiven Erkundung neu ent-deckter Gebiete auf dem amerikanischen Doppelkonti-nent. Von der Karibik her stießen sie nach dem Fest-land vor, der Tierra firme Zentralamerikas und der Nordküste Südamerikas. Die Ureinwohner dieser Ge-genden trugen in weit reichlicherem Maße Gold-schmuck als die Bewohner der westindischen Inselwelt. Von sagenhaften Goldschätzen, die es landeinwärts geben sollte, wurde den Spaniern immer wieder berich-tet. Zumindest verstanden sie ihre Gesprächspartner so. Das stachelte ihr Bemühen an, weiter ins Landesin-nere vorzudringen. Schon Kolumbus hatte in seinem Schiffstagebuch über die Rolle gesprochen, die das Edelmetall im Leben der Spanier und in der gesell-schaftlichen Wirklichkeit Europas überhaupt spielte. Er meinte, dass Gold das kostbarste aller Güter sei. Wer immer Gold besäße, könne alles erreichen, was er in dieser Welt begehre. Er glaubte wahrhaftig, dass man für Gold seiner Seele den Zugang zum Paradies erkau-fen könne.
Die spanischen Konquistadoren gründeten zu Be-ginn des 16. Jahrhunderts an der kolumbianischen Karibikküste Städte. Das sollten vor allem Ausgangsba-sen für ihre Expeditionen ins Landesinnere werden. Jahre vorher schon hatten die Spanier im Gebiet von Daríen bemerkenswerte Mengen an Goldschmuck erlangt. Einen Teil davon hatten sie gegen billigen Tand von der einheimischen Bevölkerung erhandeln können. Nun richtete sich ihr Interesse auf die Bevöl-kerung in den Küstenebenen das Río Sinú. Da die dor-tigen Indigenen Widerstand leisteten, wurden sie als Kannibalen diffamiert, mit Billigung der spanischen Krone bekriegt und zum Teil versklavt oder ausgerot-tet. Im Gebiet des Sinú erlebten die Spanier 1534 den ersten Goldrausch. Sie begannen, die Gräber indiani-scher Würdenträger systematisch auszuplündern. Kenntlich waren die Grabstätten an den darüber aufge-schütteten Hügeln und den goldenen Schellen, die als Opfergaben in die Zweige der Bäume gehängt waren, die darauf wuchsen. Die Spanier erbeuteten Hunderte Kilo Gold, das überwiegend Feingold war. Innerhalb weniger Jahre entrissen sie der Erde so die meisten Schätze altindianischen Goldhandwerks.
Verrat und Streitigkeiten waren dabei an der Ta-gesordnung. Die Goldgier bestimmte das Handeln der Spanier; Ansprüche der spanischen Krone auf den gesetzlichen Anteil eines Fünftels an der Beute führten zu ersten Verordnungen und Festlegungen der Koloni-alverwaltung. Die spanischen Eroberer suchten daher nach Möglichkeiten, das begehrte Edelmetall auf ande-re Weise und möglichst unkontrolliert zu erlangen. Mit den Tairona, verschiedenen Völkern der Sierra Nevada
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 23
Übersichtskarte: Archäologische Kulturen Kolumbiens.
Goldfigur eines sitzenden Kaziken als Kalkgefäß, zum Drogenritual gebraucht. (Ethnologisches Museum PK Berlin).
Heutige Berg-bauernhütte mit Maismahl-stein davor in der Region von Villa de Leyva, hat sich gegen-über den vor-spanischen Hüten im Prinzip nicht weiterentwi-ckelt.
Wasserfall eines der Ne-benflüsse im Quellgebiet des Río Magdalena.
Sogenanntes dreieckiges Gesicht auf der Mesita B vor dem Hügelgrab mit Steinsetzung (San Agustín).
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 24
Anthropomor-phe Stele mit Trophäenkopf (San Agustín).
Ganggrab mit Dämonen als Wächtern (San Agustín).
Templete im Hügelgrab mit Steinsetzungen und Alter-Ego-Wächtern (San Agustín).
Reliefstein von Adler mit Schlange im Schnabel vor dem Hügelgrab auf der Mesita B (San Agustín).
Anthropomor-phe Stele im sogenannten archäologi-schen Wald (San Agustín).
Anthropomorphe Stele mit Keule und "Puppenkopf" (San Agustín)
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 25
Anthropomorphe Stele mit sogenannter "Puppe" (SanAgustín)
Steinkistengrab (San Agustín)
Steinsarkophag mit Deckel in Kaiman-Form (San Agustín)
Grabungsgelände von Infiernillo (Cundinamarca) mit phal-lusartigen Steinen
Stele mit auf-hockendem Tier als Alter Ego (San Agustín).
Goldene Figur, vielleicht San-Agustín-Stil, Sammlung Martin, Muse-um für Völ-kerkunde Dresden.
Tunjo, Muisca, Sammlung Martin, Muse-um für Völ-kerkunde Dresden.
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 26
Kette aus roten Steinen und goldenen Jagu-arkrallen (Tairona) Mu-seo de Oro, Bogotá.
Ohrringe aus Tumbaga (Tairona) Museo de Oro, Bogotá.
Winzige Jaguarfigur (Quimbaya), Sammlung Martin, Ursula Thiemer-Sachse.
Rollstempel für die Musterung von Kleidung oder Haut (Tairona) Museo de Oro, Bogotá.
Goldener Knauf eines Stabes in Form eines Kaimans (Río Sinú) Museo de Oro, Bogotá.
Pektoral (Tairona) Museo de Oro, Bogotá.
Goldene Nachbil-dung des Floßes von El Dorado auf dem Guatavita-See (Post-karte des Museo de Oro, Bo-gotá)
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 27
"Die Art, wie die Goldschmiede bei der Arbeit sind und Gold und Silber schmelzen", Darstellung in "La Historia del Mondo Nuovo" von Girolamo Benzoni, 1572. (Collection of the John Carter Brown Library at Brown University)
de Santa Marta, gestalteten sich jedoch die Beziehun-gen kompliziert. Die Sammelbezeichnung Tairona bedeutet bemerkenswerter Weise Goldbearbeiter. Bei ihnen vermochten die Konquistadoren hauptsächlich Objekte aus Tumbaga zu erbeuten, jener Gold-Kupfer-Legierung, die sie als minderwertiges Gold bezeichne-ten. Sie mussten mehr Metallgegenstände einschmel-zen, wollten sie im Endergebnis auf eine entsprechende Menge Feingold kommen. Der reine Metallwert aber war für die spanischen Eroberer ausschlaggebend. In einer Reihe von Aufständen setzten sich die Tairona gegen die fremden Eindringlinge zur Wehr. Erst um 1600 gelang es den Spaniern, auch die letzte dieser ethnischen Gruppen zu unterwerfen.
Das Zusammentreffen von drei goldgierigen Er-oberertrupps
1536 drängte Gonzalo Jiménez de Quesada zu ei-ner Expedition ins Innere des Kontinents. Er war der stellvertretende Gouverneur der Stadt Santa Marta, die 1526 nahe der Mündung des Río Magdalena gegründet worden war. Erklärtes Ziel der Expedition war die Erkundung des gewaltigen Stroms bis zu seinen Quel-len. Man vermutete, dass der Río Magdalea im goldrei-chen Peru der Inka entsprang. Quesada beabsichtigte, sich dabei gleichzeitig der Smaragdminen im Landesin-neren zu bemächtigen. Die Tairona und andere Küs-tenindianer bezogen von dort die Edelsteine für die
Anfertigung ihrer Schmuckstücke. Man konnte die Ergiebigkeit der Vorkommen daraus erahnen.
Fünf Boote mit Vorräten sandte Quesada strom-auf. Er selbst zog mit seinem Trupp durch die sumpfi-gen Urwälder den Río Magdalena entlang aufwärts. Zu Anfang verfügten die 600 spanischen Soldaten über 85 Pferde und viele indigene Träger. Hunger, Krankhei-ten, der Kampf mit der wilden Naturumwelt und den Autochthonen setzten ihnen sehr zu. Nichts konnte sie jedoch am Vorwärtsdrängen hindern als der Tod, der manchen von ihnen auf diesem Marsch ereilte.
Quesada gelangte bis zum Río Opón, der aus den östlichen Bergen dem Río Magdalena zuströmt. Die Bewohner dieser Gegend verließen fluchtartig ihre Dörfer, sobald sie das Herannahen der Fremden be-merkten. In ihren Häusern fanden die Spanier Baum-wolle, Salz von der Küste und auch Gegenstände aus Gold. Quesada beachtete diese Anzeichen reger Han-delstätigkeit. Er beschloss, dorthin vorzudringen, wo-her ihn die Kunde großer Goldschätze erreichte. Dabei benutzte er einen der alten Handelswege, die Hochland und Küste verbanden.
Nach einem verlustreichen Aufstieg gelangte er mit 176 Soldaten und 59 Pferden schließlich auf die Hoch-ebenen von Cundinamarca. Es war das Siedlungsgebiet de chibcha-sprachigen Muisca. Im Wesentlichen ist das Gebiet, das die Einheimischen Muikitá nannten, über 2500 m hoch gelegen und erstreckt sich zwischen den Hochrücken der Ostkordillere.
Muisca ist die Selbstbezeichnung der dort lebenden Indianer. Sie bedeutet soviel wie Mann, Mensch(en). Politisch waren die Muisca stark zersplittert. Dazu trug die Isolierung der einzelnen Hochtäler voneinander bei. Das spiegelte sich auch in einer Vielzahl von Dialekten wider. Über ihre vorspanische Geschichte ist wenig bekannt. Als die spanischen Eroberer in ihr Gebiet einbrachen, gab es dort eine Art Konföderation zwi-schen den Herrschern von Tunja und Bacatá. Doch hatte wohl gerade damals der Kampf um die Vor-machtstellung zwischen dem Zaque, dem Herrn von Tunja und irdischen Repräsentanten des Sonnengottes Sué, sowie dem Zipa, demjenigen von Bacatá und Ver-körperung der Mondgöttin Chía, seinen Höhepunkt erreicht. Er stand vor einer Entscheidung, die aber wegen der militärischen Unterwerfung unter die Macht der Spanier aufgehoben wurde.
In Tunja erbeutete Quesada einen gewaltigen Schatz. Mehr als 670 Kilo Gold und 230 Smaragde fielen ihm in die Hände. Höchstwahrscheinlich hörten die Spanier dort auch erstmalig etwas Konkretes über El Dorado, den "Vergoldeten", und die Zeremonien auf dem nicht allzu weit entfernten Hochlandsee von Guatavita. Erst einmal jedoch gingen die Spanier die-sen Hinweisen nicht nach. Quesada drängte an dem Tal mit der Laguna vorbei in die Hochsavanne von Bacatá; dort unterwarf er den Zipa.
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 28
Im August 1538 gründete Quesada Santa Fé de Bogotá, die Hauptstadt des Landes, das er Nueva Gra-nada nannte, am Fuße der Höhen der Ostkordillere.
Im Frühjahr 1539 erreichte ein weiterer Eroberer-trupp, über eben diese Höhen kommend, das Kernland der Muisca. Die völlig erschöpfte und dezimierte Truppe wurde von Nikolaus Federmann angeführt. Er vertrat die Interessen der Welser, seit der großen finan-ziellen Unterstützung, die jenes deutsche Handelshaus dem spanischen König 1519 zur Vorbereitung seiner Wahl zum deutschen Kaiser Karl V. gewährt hatte, besaß es ein verbrieftes Recht auf die Erschließung des nördlichen Südamerika. 1537 war Federmann aufge-brochen und auf der Suche nach Reichtümern durch die Llanos östlich der Anden gezogen. Nun hatte er in ungefähr sechs Wochen den Aufstieg ins Gebirge ge-wagt. Der Trupp war dem Río Ariari gefolgt und hatte die Ostkordillere über Pässe in 3500 m Höhe bezwun-gen. Vor allem die ungewohnte Kälte nach den gewal-tigen Anstrengungen des Aufstiegs machte den Leuten zu schaffen.
Quesada begrüßte die neue Gruppe als Verbündete gegen einen weiteren Trupp, der sich von Süden her näherte. Es waren Konquistadoren, die man als Perule-ros bezeichnete. Sie hatten an der Eroberung Perus teilgenommen und drängten nun nach Norden vor in die Gebiete sagenhaften Goldreichtums. Angeführt wurde dieser Trupp, der ausgezeichnet bewaffnet war und über gute Pferde verfügte, von Sebastián de Belal-cázar, dem Gründer der spanischen Stadt Quito in Ekuador. Dort hatte Belalcázar von Indianern gehört, dass es im Norden einen König geben sollte, der unbe-kleidet und vollkommen mit Gold überzogen ein Floß besteige, um auf einem See Opfer darzubringen. Diese ungewöhnliche Nachricht reizte ihn; 1538 brach er auf. Unter anderem führte sein Trupp eine Herde von 300 Schweinen als Proviant mit sich. Belalcázar drang bis in das Quellgebiet des Río Cauca vor. Er gelangte nach Popayán, überquerte die Zentralkordillere und zog durch das Tal des oberen Río Magdalena. Als er das Gebiet der Muisca erreichte, meldete er sogleich seinen Anspruch auf Rechte an diesem Landstrich an. Doch gab es ein gewisses Gleichgewicht zwischen den Kon-quistadorentrupps. So kam es zu keiner militärischen Auseinandersetzung, wie Belalcázar sie von Peru her gewöhnt war.
Noch im gleichen Jahre äußerte man sich in Spa-nisch-Amerika verwundert dazu. Über dieses außerge-wöhnliche Zusammentreffen hieß es in einem Brief an den spanischen König, dass alle darüber staunten, die davon Kenntnis hätten, wie sich Männer aus den drei Provinzen – Peru, Venezuela und Santa Marta – an einem Ort treffen könnten, der so weit vom Meer ent-fernt liege, so weit vom südlichen wie vom nördlichen Meere.
Gemeint waren Pazifik und Karibische See. Die Konquistadorenführer waren alle den Berichten vom Goldreichtum der Region gefolgt und deshalb dort schließlich zusammengetroffen. Die Entscheidung, wer nun Statthalter werden sollte, mussten die drei Anfüh-rer der Krone überlassen, da sie sich nicht zu einigen vermochten. Deshalb begaben sich im Mai 1539 alle drei Konquistadorenführer den Río Magdalena abwärts an die Küste und schifften sich von dort aus gemein-sam nach Spanien ein. Jedoch sollte keiner von ihnen schließlich Gouverneur von Nueva Granada werden. Die Vision von Eldorado
Wer nun aber war El Dorado, der "Vergoldete", dessen sagenhafter Reichtum den spanischen Kon-quistadoren zu Ohren gekommen war? Die vagen Be-richte hatten die Spanier nach Cundinamarca gelockt. Bald mussten sie aber feststellen, dass die Muisca ihr Gold anderswoher erhandelt hatten und ihnen nicht unerschöpfliche Reichtümer zugänglich waren. So ver-suchten die Spanier, den Hinweisen intensiver nachzu-gehen.
Alte Muisca hatten die letzte Opferzeremonie am Guatavita-See noch miterlebt. Den detailliertesten Be-richt zeichnete Rodríguez Freyle auf. Er berief sich auf einen Neffen des letzten Herrschers von Guatavita als Gewährsmann. Die Zeremonie hatte als Amtseinfüh-rung des neuen Herrschers gegolten. Bevor der Auser-wählte seine Herrschaft hatte antreten dürfen, musste er sich einige Zeit in eine Höhle zurückziehen und dort fasten. Er durfte sich nicht dem Tageslicht aussetzen und musste sich seiner Frauen enthalten. Nur Speisen ohne Salz und Gewürze durfte er verzehren. So berei-tete sich der Erbe der Herrscherwürde auf die große Zeremonie seiner Amtseinführung vor. Die erste Reise, die er unternehmen durfte, führte zur Lagune von Gu-atavita, damit er dort dem Dämon, den sie als ihren Herrn und Gott verehrten, Opfer und Geschenke dar-brächte, heißt es in dem alten Bericht. Während der Zeremonie, die am Ufer des Sees stattfand, baute man ein Floß aus Bambus, das man mit den schönsten Din-gen verzierte und schmückte, die man hatte, heißt es dort weiter. Man stellte vier Schalen mit brennender Holzkohle darauf, in denen viel Weihrauch und andere Duftstoffe verbrannten. Die Lagune ist groß und tief, so dass ein hoch gebautes Schiff mit vielen Männern und Frauen an Bord sie befahren könnte, wird in dem Bericht weiterhin erwähnt. Alle, die den Thronfolger begleiteten, hätten sich mit schönen Federn, goldenen Reifen und Diademen geschmückt. Und weiter heißt es: sobald der Weihrauch entzündet worden war, ge-schah am Ufer das gleiche, so dass der Rauch das Son-nenlicht verschleierte. Nun zog man den Erben nackt aus und rieb ihn mit klebrigem Schlamm ein, auf den
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 29
man Goldstaub auftrug, so dass er vollständig in dieses Metall gehüllt war. Sie brachten ihn auf das Floß, auf dem er unbeweglich stehen blieb. Zu seinen Füßen häuften sie einen großen Berg Gold und Smaragde, die er seinem Gott darbringen sollte. Bei ihm auf dem Floß befanden sich vier der obersten Kaziken, die mit Fe-dern, Diademen, Armbändern, Gehängen und Ohr-pflöcken aus Gold geschmückt waren. Auch sie waren unbekleidet, wurde berichtet, und jeder trug seine eige-nen Opfergaben. Als das Floß vom Ufer abstieß, be-gann eine Musik mit Trompeten, Flöten und anderen Instrumenten, wahrscheinlich Schellen und Rasseln, sowie Gesang, der das Tal füllte und von den Berghän-gen widerhallte. Als dann das Floß die Mitte der Lagu-ne erreicht hatte, errichtete man ein Banner als Signal, dass nun Stille eintreten sollte.
Dann brachte der Vergoldete seine Gaben dar; er warf den Haufen Gold inmitten der Lagune ins Wasser. Die ihn begleitenden Kaziken taten es ihm mit ihren Gaben nach. Darauf wurde das Banner gesenkt, und als sich das Floß dem Ufer näherte, begann der Gesang erneut, ertönten Pfeifen und Flöten, und die versam-melten Augenzeugen der Zeremonie tanzten und san-gen in großen Gruppen. Damit begrüßten sie den neu-en Herrscher als den von ihnen anerkannten Herrn. Es heißt, dass von dieser Zeremonie der berühmte Name "El Dorado" hergeleitet war, der, wie Rodríguez Freyle meinte, so viele Menschenleben gekostet habe.
Die Zeremonie mag sich ungefähr in dieser Art vollzogen haben. Goldene Modelle des "El-Dorado"-Floßes fanden sich unter den Opfergaben der Muisca. Als archäologische Zeugnisse belegen sie, dass es mehr als nur eine Sage war, was den Spaniern berichtet wur-de.
Aber die Fantasie der goldgierigen Europäer ließ El Dorado zu einem Mythos werden, zu einem Traum von einer Person, meist aber einer Stadt oder gar einem ganzen Reich mit unermesslichen Goldschätzen, die in den bisher unerreichten, unergründeten und uner-forschten Teilen Südamerikas – zum Teil noch bis heute - gesucht werden.
Der Mythos vom "Vergoldeten" verwandelte sich in Ideen von einem durch Goldreichtum gekennzeich-neten irdischen Paradies. Er sollte über die Jahrhunder-te die Gedanken und Kräfte vieler Abenteurer fesseln und Tausende verlocken, ihr Leben zu wagen.
Bei Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, dem Chronisten des spanischen Hofes, der seine Informati-onen wenige Jahre nach der Eroberung Zentralkolum-biens aufschrieb, hieß es vom "Vergoldeten” noch folgendermaßen: Er sei über und über mit Goldstaub bedeckt umher gegangen, so selbstverständlich, als wäre es Salz. Denn für ihn hätte jeder andere Schmuck als hässlich gegolten. Schmuck oder Waffen aus ge-hämmertem oder anders bearbeitetem Gold zu tragen,
wäre etwas zu Allgemeines und Gewöhnliches gewe-sen.
Der "Vergoldete" wurde also als eine außerge-wöhnliche indigene Persönlichkeit hervorgehoben, wobei die Begleitumstände schon außer Acht gelassen wurden.
Knapp achtzig Jahre später wurden nur noch ge-wisse Teile des Gesamtgeschehens wirklichkeitsnah wiedergegeben. Das betraf noch das Bestäuben mit Gold. Die Zusammenhänge, unter denen dies geschah, waren jedoch völlig vergessen und den verworrenen Ideen des jeweiligen europäischen Berichterstatters über die Lebensweise der Ureinwohner angepasst. So folgte dem Bericht des englischen Piraten Walter Raleigh derjenige des Mainzer Kompilators Theodor de Bry, der vor allem in Mitteleuropa erfundene bildliche Darstellungen von Geschehnissen bei der Eroberung und Erkundung der Neuen Welt mit zusammengesuch-ten fantasievollen Texten kombinierte. Dort heißt es, die Einwohner der Landschaft Guayana wie auch alle ihre Nachbarn seien der Trunkenheit sehr ergeben und überträfen alle anderen Nationen im Zechen. Wenn der dortige Kaiser seinen Beamten und Adligen ein Bankett gäbe, würden alle diejenigen, die dazu eingeladen seien, von seinen Dienern nackt ausgezogen und mit einem weißen Balsam vom Haupt bis zu den Füßen bestri-chen, danach durch Röhrchen mit reinem Goldstaub angeblasen, der auf dem Balsam kleben bliebe, so dass der Mensch aussehe, als wäre er ganz golden. So wür-den sie sich zu fünfzig und hundert zusammensetzen und sieben oder acht Tage hintereinander zechen, bis sie nicht mehr könnten.
Solche und andere Vorstellungen über El Dorado, den "Vergoldeten", mündeten in Ideen ein, die schließ-lich nur noch auf Eldorado, das irdische Paradies, ge-richtet waren. Bergbau und Goldhandwerk der Ureinwohner Kolumbiens in vorspanischer Zeit
Vor allem aus archäologischen Erkundungen, aber auch aus einzelnen Berichten haben wir Kenntnis von der Goldgewinnung und der Nutzung des Edelmetalls in Kolumbien in vorspanischer Zeit. Damals wurde das Material in Amerika zumeist aus den Sekundärlagerstät-ten der sogenannten Goldseifen gewonnen. Das war auch in Kolumbien so. Die goldhaltigen Sande der Flüsse der West- und Zentralkordillere wurden zu die-sem Zweck gewaschen. Goldkörner und Goldstaub wurden herausgelesen. Dazu benötigten die Indianer nur sehr einfache Werkzeuge: Grabstöcke mit feuerge-härteter Spitze zum Losbrechen von Sandklumpen und flache hölzerne Waschtröge. Folgt man den Hinweisen des Chronisten Fernández de Oviedo y Valdés, so wu-schen Männer und Frauen Gold. Gleichsam im Tage-
Ursula Thiemer-Sachse "Goldland Kolumbien" – ein Eldorado!?
AmerIndian Research, Bd. 9/1 (2014), Nr. 31 30
bau brachen sie goldhaltige Sandbänke auf und trugen das Material zu den Waschplätzen. Es kam sogar vor, dass man Wasserläufe umleitete. Auf diese Art hoffte man, besser an die goldhaltigen Flusskiese heranzu-kommen. Offensichtlich war das Goldwaschen eine zeitweilige Arbeit der bäuerlichen Bevölkerung wäh-rend der trockenen Zeit, wenn Sandbänke und Ufer-zonen der Flüsse zugänglich waren.
Um goldhaltige Quarzadern abzubauen, kannte man in Kolumbien jedoch auch die Anlage von Schächten. Sie reichten bis 36 m tief in die Erde und hatten einen Neigungswinkel von 30 bis 40 Grad. Die einzelnen Gruben lagen rund 4 m voneinander ent-fernt, Gewöhnlich hatten sie nur einen Durchmesser von ungefähr einem Meter. Nur ein einzelner Berg-mann konnte jeweils darin arbeiten. Keiner konnte sich in diesen Gruben umdrehen. Ohne Seitengänge, Ab-stützung oder Ventilation waren sie primitivste Anla-gen, in denen zu arbeiten sehr qualvoll gewesen sein muss. Ihre Werkzeuge waren Steinhämmer und Stein-meißel. Spanische Berichte lassen vermuten, dass sol-che Arbeiten häufig von kriegsgefangenen Sklaven unter Anleitung spezialisierter Bergleute verrichtet werden mussten. Der Kupferbergbau mag sich in ganz ähnlicher Weise vollzogen haben.
Ein Zentrum der Goldverarbeitung war Buriticá in der Zentralkordillere nördlich der heutigen kolumbiani-schen Stadt Antioquia. Dort wurde Gold sowohl aus Seifen gewonnen als auch geschürft. Es gab in Buriticá offenbar hauptberuflich tätige Bergleute und Gold-handwerker. Sie wohnten auf einem befestigten Hügel in einer stadtartigen Siedlung zusammen. Der spani-sche Chronist Pedro de Cieza de León erwähnte über Buriticá, dass dort ein Ort mit großen, eng aneinander gereihten Häusern existierte, die alle von Bergleuten bewohnt gewesen seien, die dort Gold schürften. Kazi-ken hätten dort ebenfalls ihre Häuser gehabt, und de-ren Leute hätten dort jede Menge Gold für sie gewon-nen.
Diese Stadt beherrschte eine Region, in der es wei-tere Bergwerkssiedlungen und Metall verarbeitende Orte gab. Noch zur Zeit der spanischen Eroberung funktionierten dort die Gewinnung und Verarbeitung von Gold. Es gab regelrechte Werkstätten. Zum Gold-schmelzen benutzte man tönerne Tiegel. Man hatte Becken für Holzkohle und verwendete Waagen für die Vorbereitung der Legierungen. Buriticá führte sowohl Rohmaterial zur Weiterverarbeitung als auch Fertig-produkte aus. Einen Teil lieferten die dortigen Hand-werker bzw. ihre Kaziken an die Muisca und Quim-baya, die Einwohner des Zentralgebietes. Das meiste jedoch verhandelten sie nach dem Norden ins Gebiet
von Dabeiba. Dort arbeiteten Goldhandwerker als Spezialisten mit diesem importierten Material und ver-sorgten die gesamte nördliche Küstenregion. Da man Dabeiba bis heute nicht lokalisieren kann, wird zuwei-len angenommen, dass es sich nur um einen mythi-schen Ort gehandelt habe.
Es gab ein System von Handelswegen. Marktfle-cken existierten, in denen die Goldhandwerker Le-bensmittel, Salz, Baumwollkleidung und andere lebens-notwendige Waren gegen die Produkte ihrer Kunstfer-tigkeit eintauschten. Sowohl der Bergbau als auch die Aufbereitung und Verarbeitung des Edelmetalls be-durften besonderer Fertigkeiten und Erfahrungen. Die Vorstellung von der Existenz des Verarbeitungszent-rums Dabeiba zeigt, wie weit die Spezialisierung bereits fortgeschritten war. Denn es handelte sich dabei um einen Ort der Schmuckherstellung ohne eigene Gold-vorkommen. Spezialisierung und Handelsbeziehungen brachten aber auch die Verbreitung besonderer Stiltra-ditionen mit sich.
Im Gebiet der Muisca gab es ebenfalls offenbar ein ausgeprägtes Spezialistentum für die Herstellung von Goldgegenständen. Es befand sich im Herrschaftsbe-reich des Kaziken von Guatavita. Überliefert ist, dass der dortige Herrscher so weit über die Goldhandwer-ker verfügen konnte, dass er sie den benachbarten Oberhäuptern im Austausch gegen die doppelte An-zahl anderer Arbeitskräfte "lieh". Derartige Hinweise sprechen zumindest für die hohe Wertschätzung, die man diesen spezialisierten Handwerkern zollte. Auch gab es ganz offensichtlich Produktionszentren, eine Art Wanderhandwerk sowie einen entwickelten Handel. Gold war jedoch Schmuck zur Kennzeichnung der sozialen Position der Herrschenden und Adligen und Opfergabe an die außermenschlichen Wesen, um deren Zuwendung man sich bemühte. Gold wurde jedoch nicht zur Akkumulierung von Reichtum benutzt, wie ihn sich die Spanier erträumten. Literatur zu weiterer Information
El Dorado. Das Gold der Fürstengräber (Eine Ausstel-lung des Museums für Völkerkunde) Reimer Berlin 1994. Historia General de América Latina, vol. 1: Las sociedades originarias; vol. 2: El primer contacto y la formación de nuevas sociedades. Ediciones UNESCO 1999, 2000.
(außer der Postkarte und der Abbildung aus Benzoni sind alle Fotos von Ursula Thiemer-Sachse)