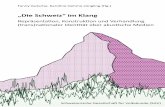"Von der Konstruktion der Stille zur Konstruktion der Intimität"
Wiese, Heike (ersch.): Die Konstruktion sozialer Gruppen: Fallbeispiel Kiezdeutsch
Transcript of Wiese, Heike (ersch.): Die Konstruktion sozialer Gruppen: Fallbeispiel Kiezdeutsch
1
Heike Wiese Die Konstruktion sozialer Gruppen: Fallbeispiel Kiezdeutsch
Sprache ist eine wesentliche Domäne zur Aushandlung sozialer Klassifikationen und Legitimationen und der Zuschreibung unterschiedlicher Gruppenzugehörig-keiten. Der Beitrag untersucht Prozesse in der sprachlichen Konstruktion sozialer Gruppen an einem spezifischen Fallbeispiel, nämlich der öffentlichen Diskussion zu Kiezdeutsch. Diese Diskussion liefert durch ihre vielfältigen Bezüge zur deut-schen Sprache, zum Status deutscher Dialekte und der mit ihnen verbundenen Sprechergemeinschaften eine besonders interessante empirische Domäne für eine solche Untersuchung. Die Basis für die Untersuchung bildet ein Korpus, das Le-serkommentare zu Medienberichten und Emails, die in Reaktion auf solche Be-richte eingegangen sind, versammelt. Der Beitrag analysiert die unterschiedlichen Prozesse der Aushandlung und Zuschreibung von Gruppenidentitäten, die hier deutlich werden, und untersucht ihre sprachideologische Basis. Die Analyse weist auf eine spezifische Konstruktion von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n als die „An-deren“, die sie von der „wir-Gruppe“ ausschließt, und deckt zwei zentrale wir/sie-Dichotomien auf, die hierbei wirksam werden: eine Abwertung auf der Basis sozialer Hierarchisierung und eine Ausgrenzung auf der Basis ethnischer Zu-schreibungen. Im ersten Fall werden Kiezdeutsch-Sprecher/innen in einer niedri-geren sozialen Schicht verortet und so von einer in der Selbstwahrnehmung höher stehenden wir-Gruppe unterschieden. Im zweiten Fall werden Kiezdeutsch-Sprecher/innen als nicht-deutsch konstruiert und damit von einer wir-Gruppe ausgeschlossen, die die alleinige Eigentümerschaft für deutsche Dialekte für sich beansprucht. Gliederung
1. Einleitung 2. Kiezdeutsch und seine Sprecher/innen 3. Kontext: Dialekte als Besitz der wir-Gruppe 4. wir/sie-Dichotomien im Diskurs zu Kiezdeutsch 5. Fazit: Kiezdeutsch-Sprecher/innen als die „Anderen“ 6. Literatur
Stichpunkte: wir/sie-Dichotomien Kiezdeutsch Ethnizität Dialektsprecher Einstellungen Sprachideologien Sprachliche Eigentümerschaft Mehrsprachigkeit Migrati-onshintergrund „Hochdeutsch“
Preliminary version, author’s manuscript; final version to appear in:
Neuland, Eva, & Schlobinsky, Peter (Hg.), Sprache in sozialen Gruppen. Berlin, New York: de Gruyter [Hand-buchreihe Sprachwissen, Band 9]. Kap.V.2.
2
1 Einleitung
Ein interessanter Aspekt von Sprache in sozialen Gruppen ist die Konstruktion sozialer Gruppen über die Domäne der Sprache. Der vorliegende Beitrag behan-delt diesen Aspekt und stellt an einem Fallbeispiel dar, wie sich die Wahrneh-mung, Einordnung und Bewertung von Sprache und die Abgrenzung von Spre-chergruppen gegenseitig beeinflussen.
Als Fallbeispiel hierfür fungiert Kiezdeutsch, eine neue Variante des Deut-schen, die sich im sprachlich besonders dynamischen Kontext des mehrsprachig geprägten urbanen Raums entwickelt hat. Die öffentliche Diskussion zu Kiez-deutsch liefert durch ihre vielschichtigen kontrastiven Bezüge zum Standarddeut-schen und seinen Dialekten samt den zugehörigen „Hochdeutsch“- und Dialekt-sprecher/inne/n besonders interessante Daten zur diskursiven Aushandlung von Gruppenidentitäten und den hiermit verbundenen An- und Aberkennungsprozes-sen sprachlicher Eigentümerschaft und Legitimation (vgl. auch Eisewicht / Hitz-ler, in diesem Band, I.3, zu Gruppe und sozialer Identität).
Ich werde im Folgenden zunächst zusammenstellen, welche Befunde zur Sprechergemeinschaft von Kiezdeutsch bislang aus sprachwissenschaftlichen Untersuchungen vorliegen und dann die Wahrnehmung dieser Sprechergemein-schaft analysieren. Als empirische Grundlage dienen Daten aus einer Debatte zu Kiezdeutsch als neuem Dialekt, die medial breit geführt wurde (und wird) und interessante Daten zu wir/sie-Dichotomien und der Konstruktion des ‚Anderen‘ im Konnex von Sprache und Identität liefert.
Solche Dichotomien sind auch aus ähnlichen Debatten zu vergleichbaren sprachlichen Entwicklungen in anderen europäischen Ländern und den USA be-kannt (vgl. Wiese 2015). In der Soziolinguistik wurden die entstehenden Varian-ten unter anderem als Multiethnolekte (Quist 2008), neue Dialekte (Cheshire et al. 2011, Wiese 2012) oder neue urbane Umgangssprachen (Rampton 2013, 2014) charakterisiert. Während ihr Status als systematische Varietäten, als sprachliche Stile oder als Cluster linguistischer Ressourcen in kommunikativen Praktiken kontrovers ist, besteht eine weitgehende Übereinstimmung, dass wir es hier mit einem kreativen neuen Sprachgebrauch zu tun haben, der Sprecherentscheidungen in bestimmten kommunikativen und sozialen Kontexten reflektiert, und nicht mit einem Zeichen für sprachliche Verarmung oder gar Sprachverfall. Im Gegensatz dazu sind öffentliche Debatten solcher neuen sprachliche Praktiken überwiegend negativ und von Ablehnung gekennzeichnet.
In Deutschland führte die ‚Dialekt‘-Rahmung der Debatte zu einer Schärfung der Frage, was als zugehörig zum Deutschen anerkannt wird und wer Teil der entsprechenden Sprechergemeinschaft sein darf, und lieferte damit soziolinguis-tisch besonders interessante Daten: Wer wird als legitime/r Sprecher/in eines deutschen Dialekts akzeptiert und wer nicht, und welches Verständnis der ent-
3
sprechenden Sprechergemeinschaften wird hierbei deutlich? Diese Debatte ist daher besonders geeignet, aufzudecken, wie sprachliche Wertsysteme mit sozialer Inklusion und Exklusion interagieren und zur Definition sozialer Gruppen beitra-gen.
2 KiezdeutschundseineSprecher/innen
Kiezdeutsch ist, ebenso wie seine Pendants in anderen europäischen Ländern, ein Sprachgebrauch, der sich in Wohngebieten mit einem hohen Anteil mehrsprachi-ger Sprecher/innen entwickelt hat. Solche Wohngebiete bilden durch die große Bandbreite unterschiedlicher Herkunftssprachen, Dialekte und Stile und das Zu-sammentreffen ein- und mehrsprachiger Sprecher/innen der Majoritätssprache einen sprachlich hochdiversen Kontext (Vertovec 2007 spricht in diesem Zusam-menhang von „Superdiversity“; vgl. hierzu auch Blommaert et al., Hg., 2011). Sie liefern dadurch einen besonders fruchtbaren Boden für neue sprachliche Entwick-lungen auf lexikalischer ebenso wie auf grammatischer Ebene. In Kiezdeutsch zeigt sich dies beispielsweise durch die Integration neuer Fremdwörter, aus Her-kunftssprachen wie dem Türkischen und Arabischen, aber auch aus dem US-amerikanischem Englisch, durch phonologische Entwicklungen wie die Koronali-sierung des palatalen Frikativs [ç], durch die Entwicklung neuer Partikeln, durch neue Wortstellungsoptionen und durch neue Kontexte für bloße NPs, etwa in Lokalangaben und produktiven Funktionsverbgefügen (vgl. Keim 2010 für einen Überblick; Wiese 2012 für detailliertere Analysen zu Kiezdeutsch).
Auf Sprecherebene ist Kiezdeutsch, ebenso wie seine europäischen Pendants, dabei Teil eines größeren sprachlichen Repertoires, das daneben auch formellere Register umfasst (vgl. Wiese ersch. für einen Überblick). Die skizzierten gram-matischen Charakteristika treten insbesondere in informellen, Peer-Group-Situationen auf, legen also einen Act of Identity nahe, der auf eine Bindung an eine bestimmte soziale Gruppe deuten könnte. Diese Bindung ist jedoch nicht so spezifisch, wie dies in der öffentlichen Diskussion oft angenommen wird: Wäh-rend in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung dominiert, die den „typischen“ Kiezdeutschsprecher als männlichen, eher bildungsfernen Jugendlichen mit Zu-wanderungsgeschichte aus dem türkischen oder arabischen Raum charakterisiert, legen die bisherigen linguistischen Befunde zu Kiezdeutsch ein sehr viel differen-zierteres Bild nahe. Die folgende Aufstellung skizziert dies für zentrale für Kiez-deutsch in Frage kommende Kategorien.
Alter. Insbesondere im lexikalischen Bereich zeigt Kiezdeutsch deutliche ju-gendsprachliche Charakteristika, etwa durch neue evaluative Ausdrücke, Anrede-formen u.a. Wie Rampton (2014) für Großbritannien zeigte, können charakteristi-sche sprachliche Merkmale aus jugendlichen Multiethnolekten aber grundsätzlich
4
auch in späterem Alter noch in Peer-Group-Gesprächen verfügbar sein (vgl. auch ähnlich Cheshire et al. 2011 zur Dialektbildung im urbanen Raum). Insbesondere im Bereich der Grammatik sind auch für Kiezdeutsch manche Phänomene alters-gruppenübergreifend zu beobachten: So liefern Wiese / Duda (2012) Belege für die Verwendung einer neuen Existenzpartikel gibs in Kiezdeutsch nicht nur unter Jugendlichen, sondern auch bei jüngeren und älteren Sprecher/inne/n. Die bishe-rigen Befunde weisen damit zwar auf jugendsprachliche Aspekte, aber, abgesehen von jugendsprachlicher Lexik, nicht auf eine strikte, kategoriale Beschränkung von Kiezdeutsch auf diese Altersgruppe. Die sprachlich besonders dynamische Altersgruppe der Jugendlichen ist sicher eine für Kiezdeutsch zentrale Gruppe, und es ist anzunehmen, dass sie eine wesentliche Grundlage nicht nur für lexikali-sche, sondern gerade auch für grammatische Innovationen bildet. Zum einen sind diese jedoch, insoweit sie generelle Sprachwandeltendenzen oder laufende Ent-wicklungen des Deutschen aufnehmen, vermutlich schon im Erst- oder Zweit-spracherwerb des Deutschen angelegt und daher z.T. auch bei jüngeren Spre-cher/inne/n in multiethnischen Wohngebieten zu finden. Zum anderen bleiben sie nach ihrem Ausbau im Jugendalter grundsätzlich auch in späteren Altersstufen verfügbar. Die Verwendung grammatischer Neuerungen ist daher vermutlich eher generationen- als altersspezifisch: Es ist davon auszugehen, dass sie für die Grup-pe der in den 1960/70ern geborenen Sprecher/innen zwar noch keine Rolle spielt, jedoch für die in den 1980/90ern Geborenen, die jetzt dem Jugendalter bereits entwachsen sind, weiterhin grundsätzlich zum sprachlichen Repertoire gehört, das in informellen Peer-Group-Situationen unter Gleichaltrigen noch aktiviert werden kann. Um hierzu gesicherte Aussagen zu treffen, liegen zur Zeit jedoch noch keine ausreichenden empirischen Daten vor.
Geschlecht. In der Wahrnehmung von Kiezdeutsch stehen oft primär junge Männer im Fokus. Eine zentrale Rolle männlicher Sprecher für diesen Sprachge-brauch ist jedoch fraglich, möglicherweise sind diese nur salienter, etwa durch eine stärkere Präsenz im öffentlichen Bereich (auf Straßen, in Jugendeinrichtun-gen). Die Studien von Kern / Selting (2006a,b), Selting (2011), bei denen ein großer Teil weiblicher Sprecherinnen einbezogen wurde, scheinen keine Unter-schiede zwischen den Geschlechtern aufzuzeigen. Auch Dirim / Auer (2004, 215) konstatieren, dass der entsprechende Sprachgebrauch nicht als Genderlect ab-grenzbar ist, sondern auch bei Mädchen und Frauen auftritt. „Geschlecht“ erweist sich somit nicht als zentrale Kategorie für Kiezdeutsch.
Mehrsprachigkeit / Migrationshintergrund / Deutsch als Zweitsprache. Wie nicht nur für Kiezdeutsch, sondern ebenso für vergleichbare neue urbane Dialekte in anderen europäischen Ländern festgestellt, sind an diesen neuen sprachlichen Praktiken grundsätzlich auch einsprachige Sprecher/innen der Majo-ritätssprache beteiligt. In der öffentlichen Wahrnehmung von Kiezdeutsch und z.T. aber auch in sprachwissenschaftlichen Arbeiten wird die Beteiligung dieser Sprecher/innen oft als sekundäres Phänomen verstanden, als eine Übernahme
5
sprachlicher Charakteristika, die primär von Sprecher/inne/n mit Migrationshin-tergrund entwickelt und gebraucht wurden. Auf der Basis der bisher verfügbaren Befunde ist ein solches Primat bestimmter, mehrsprachiger Sprechergruppen jedoch eine offene Frage.
Auer (2003) etwa geht für Deutschland von einem „primären Ethnolekt“ aus, der vor allem (männliche) Sprecher mit türkischem Hintergrund charakterisiere und sich erst später, als „sekundärer Ethnolekt“, auf andere Sprechergruppen ausbreite, weist aber auch bei diesem mutmaßlich primären Ethnolekt bereits auf eine Beteiligung einsprachig deutscher Sprecher/innen in multiethnischen Wohn-gebieten hin. Bei einer homogeneren Sprechergruppe mit derselben Herkunfts-sprache, etwa dem Türkischen, wäre zudem auch eine stärker durch Code-Switching und Sprachmischung charakterisierte Sprechweise zu erwarten als die neue Variante des Deutschen, die wir mit Kiezdeutsch vorfinden.
Die heute verfügbaren Daten dokumentieren, dass zumindest aktuell ein- und mehrsprachige Sprecher/innen gleichermaßen in solche neuen urbanen Dialekte involviert sind. So weisen Freywald et al. (2011) signifikante Unterschiede zwi-schen Sprecher/inne/n aus multiethnischen und monoethnischen Wohngebieten nach, finden jedoch keine Unterschiede zwischen solchen deutscher vs. nichtdeut-scher Herkunft im multiethnischen Wohngebiet.
Grundsätzlich sind zudem im sprachlich diversen urbanen Raum – in Deutschland ebenso wie in anderen europäischen Ländern – ein- und mehrspra-chige Sprecher/innen heute nicht mehr als „native“ vs. „non-native speakers“ der Majoritätssprache zu differenzieren: Muttersprachliche Kompetenzen finden sich ebenso in der Gruppe der mehrsprachigen Sprecher/innen, die im Land der Majo-ritätssprache aufgewachsen sind. So stellen Fraurud / Boyd (2011:72) fest (in ähnlichem Sinne auch Rothman / Leffers 2014):
„No one acquainted with current multilingual settings can have failed to meet individuals whose linguistic background and practices challenge the binary NS/NNS [native speaker / non-native speaker; H.W] distinction.“
Entsprechend sind Erst- und Zweitsprache in solchen, von vielfältiger Mehrspra-chigkeit geprägten Kontexten nicht immer deutlich von einander unterschieden. Eine klare Abgrenzung, ob Deutsch als Erst- oder Zweitsprache zu gelten hat, ist bei mehrsprachigen Sprecher/inne/n oft nicht zu leisten und auch nicht sinnvoll. So charakterisiert etwa Pfaff (2009) bei den von ihr untersuchten Sprecher/inne/n türkischen Hintergrunds, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, Deutsch nicht als L1 oder L2, sondern als „L 1,5“.
Soziale Schicht / Bildung. Da in Deutschland, wie etwa die PISA-Studien deutlich machten, Bildungserfolg und berufliche Chancen immer noch stark an soziale und ethnische Herkunft geknüpft sind, sind Wohngebiete mit hohem An-teil von Einwohner/inne/n mit Zuwanderungsgeschichte typischerweise auch sozial benachteiligte Gebiete, mit relativ niedrigem Durchschnitteinkommen,
6
hoher Arbeitslosigkeit und niedrigem Bildungserfolg. Dies bedeutet jedoch nicht, dass der Gebrauch von Kiezdeutsch ein Hinweis auf niedrige soziale Schicht oder Bildungsferne ist. Kiezdeutsch wird übergreifend in den betreffenden Wohnge-bieten verwendet, unabhängig von der sozialen Schicht der einzelnen Sprecherin oder des einzelnen Sprechers. So stammen Daten zum Kiezdeutschgebrauch von Gymnasialschüler/inne/n ebenso wie von solchen aus anderen Schulformen, und beispielsweise auch bei Linguistikstudierenden und -doktorand/inn/en kann, wenn sie aus mehrsprachig geprägten Wohngebieten stammen, Kiezdeutsch Teil der eigenen Sprachbiographie aus Peer-Group-Kontexten sein.
Zusammengenommen lässt sich somit für Kiezdeutsch eine Sprechergemein-schaft charakterisieren, die einen Erwerbs- und Entwicklungsschwerpunkt in der Altersgruppe der Jugendlichen hat, aber nicht strikt an diese gebunden ist und sich nicht durch weitere Kategorien wie Geschlecht, Migrationshinter-grund/Mehrsprachigkeit/DaZ, soziale Schicht und/oder Bildung fassen lässt. Kiezdeutsch ist nach den bisherigen Befunden an soziale Gruppen gebunden, die durch eine sprachliche und kulturelle Mischung geprägt sind, wie sie urbane Wohngebiete heute charakterisiert. Ein charakteristisches Merkmal solcher Wohngebiete ist der hohe Anteil mehrsprachiger Sprecher/innen. Diese Spre-cher/innen begründen eine sprachliche Vielfalt, die wesentlich für die besondere sprachliche Dynamik ist, die die Entwicklung neuer urbaner Dialekte wie Kiez-deutsch kennzeichnet. Es ist diese sprachliche Vielfalt als Merkmal der Gruppe insgesamt, die ausschlaggebend für Kiezdeutsch ist, nicht so sehr mehrsprachige Kompetenzen, Zuwanderungsgeschichte oder die oft damit verknüpfte soziale Schicht einzelner Sprecher/innen: Innerhalb der Gruppe finden sich einsprachige ebenso wie mehrsprachige Sprecher/innen, solche mit und ohne Zuwanderungs-geschichte, aus sozial benachteiligten ebenso wie privilegierten Familien.
Wie sich im folgenden zeigen wird, kontrastiert dies scharf mit der Konstruk-tion der Sprechergemeinschaft von Kiezdeutsch in der öffentlichen Diskussion. Hier werden Kiezdeutsch-Sprecher/innen als Mitglieder einer homogenen out-Group definiert und von der in-Group deutscher Sprecher/innen ausgegrenzt – eine Abgrenzung, die sich gerade im Zusammenhang mit einer möglichen Ein-ordnung von Kiezdeutsch als deutschen Dialekt offenbart und diese Debatte da-mit besonders geeignet für eine Fallstudie zur sprachlichen Konstruktion sozialer Gruppen macht. Im Folgenden skizziere ich zunächst den sprachideologischen Kontext hierfür, der durch einen spezifischen Dialektbegriff in Deutschland etab-liert wird, bevor ich auf die verschiedenen wir/sie-Dichotomien und die Kon-struktion des „Anderen“, wie sie in der Debatte deutlich werden, eingehe.
7
3 Kontext:DialektealsBesitzderwir‐Gruppe
In der internationalen sprachwissenschaftlichen Diskussion wird der englische Ausdruck „dialect“ meist mit einem weiten Dialektbegriff verbunden, wie er seit den 1980ern insbesondere in Soziolinguistik und Variationslinguistik entwickelt wurde. Diese weite Auffassung subsumiert generell sozial oder geographisch assoziierte Varietäten innerhalb einer Sprachgemeinschaft (vgl. etwa einschlägige Definitionen in Trudgill 1992, Chambers / Trudgill 1998). In der deutschen Philo-logie, ebenso wie im öffentlichen Diskurs in Deutschland, wird der Begriff „Dia-lekt“ dagegen oft enger verstanden und auf die regionalen Varietäten begrenzt, die die historische Basis für die Entstehung des Standarddeutschen bildeten. So schlägt beispielsweise Auer (2011) in einem Überblick zu Dialekt- vs. Stan-dardszenarien in Europa vor,
“to reserve the term ‘(traditional) dialects’ for the varieties under the roof […] of a stand-ard variety which preceded the standard languages and provided the linguistic material out of which the endoglossic standard varieties developed”. (Auer 2011, 487)
In gewisser Hinsicht widerspricht dies jedoch dem tatsächlichen Gebrauch dieses Begriffs auch in der traditionellen deutschen Dialektologie, nämlich dort, wo es um deutsche Sprachinselvarietäten geht, die sich außerhalb Deutschlands in Folge von Kolonialisierung und Emigration entwickelt haben. Solche Varietäten sind nicht notwendigerweise dem Standarddeutschen vorausgegangen, sondern haben sich oft erst später entwickelt, auf einer Basis, die die Standardsprache ebenso wie unterschiedliche traditionelle Dialekte umfassen konnte. Nichtsdestotrotz werden sie üblicherweise als „deutsche Dialekte im Ausland“ in der Dialektologie des Deutschen berücksichtigt (vgl. etwa Besch et al., Hg., 1982).
Ganz ähnlich werden auch im öffentlichen Diskurs solche Varietäten prob-lemlos als deutsche Dialekte akzeptiert. So konnte etwa ein Artikel im Spiegel das Texasdeutsche als relativ jungen deutschen Dialekt porträtieren, der durch neue grammatische und lexikalische Charakteristika und einige Sprachmischungen charakterisiert sei, ohne dass dies eine erregte öffentliche Debatte oder irgendwie gearteten Widerspruch auslöste (Spiegel Online / UniSPIEGEL, 14.4.2008, „Man spricht Texas-Deutsch“). Hans Boas, auf dessen Forschung sich der Bericht be-zog (vgl. Boas 2003; 2009), beschreibt die Reaktionen auf den Artikel vielmehr als „durchweg positive Kommentare“ (p.c.), und es gab sogar ein (positives) Vollzitat des Artikels im online-Forum des „Verein Deutsche Sprache“.
Wie unten noch deutlicher wird, steht dies in scharfem Kontrast zu den star-ken und überwiegend negativen Reaktionen, die ein Artikel im selben Magazin hervorrief, der in ganz ähnlicher Weise Kiezdeutsch als neuen Dialekt des Deut-schen, ebenfalls mit neuen grammatischen und lexikalischen Charakteristika und einigen Sprachmischungen, beschrieb. Die Dialekteinordnung von Kiezdeutsch
8
löste massiven Widerspruch in der öffentlichen Diskussion aus, häufig unter Verweis darauf, dass Kiezdeutsch keinen historischen Beitrag zur Entwicklung des „Hochdeutschen“ geleistet habe. Die Tatsache, dass das Texasdeutsche, das ebenso wenig eine Basis für die Entstehung des Standarddeutschen lieferte, dage-gen problemlos als Dialekt des Deutschen akzeptiert wird, wird noch bemerkens-werter, wenn man sich vor Augen führt, dass das Texasdeutsche von Entwicklun-gen in Deutschland vergleichweise losgelöst ist, während Kiezdeutsch eng an den aktuellen Sprachgebrauch im Deutschen angebunden ist.
Dies weist darauf hin, dass in der öffentlichen Debatte in Deutschland nicht so sehr die tatsächliche historische Beziehung als Vorläufer und sprachliche Quel-le für das Standarddeutsche wesentlich für die Einordnung als Dialekt ist, sondern vielmehr eine empfundene kulturelle Assoziation mit der deutschen Tradition, die eine Art Ius sanguinis-Beziehung involviert, basierend auf einer wahrgenomme-nen ethnischen Gemeinsamkeit mit den Sprecher/inne/n. Diese Konstruktion von Dialekten zeigt sich unter anderem auch in verbreiteten Reaktionen der Verblüf-fung, wenn jemand, der als „Anderer“, als Mitglied einer nichtdeutschen out-Group wahrgenommen wird (etwa auf Grund bestimmter Körpermerkmale wie Haut- oder Haarfarbe), einen traditionellen regionalen deutschen Dialekt spricht. Dies ist immer wieder Thema populärer Erlebniserzählungen oder auch von Film-szenen (etwa im Kinderfilm „Das kleine Gespenst“, Universum Film, Deutsch-land 2013) und wird typischerweise als äußerst komisch wahrgenommen, ein Hinweis auf starke kognitive Dissonanzen. Im Fall von Kiezdeutsch zeigte sich eine ähnliche Dissonanz in der oft mit massiver Erregung und Empörung verbun-denen Ablehnung dieser Varietät als Dialekt und entsprechend ihrer Sprecherge-meinschaft als deutsche Dialektsprecher/innen.
Die Debatte um Kiezdeutsch konzentrierte sich zunächst auf eine sprachwis-senschaftliche Einordnung als Dialekt (vgl. hierzu Wiese 2010, 2012, 2013). In Konsens mit Ramptons (2013) Argument für eine „Rückeroberung“ (‚reclaim‘) des englischen Ausdrucks „vernacular“ trägt der deutsche Begriff „Dialekt“ eben-so dazu bei,
„to normalise the kind of urban speech we are examining, moving it out of the “marked” margins, not just in sociolinguistic study but maybe also in normative public discourse.“ (Rampton 2013:78)
Die öffentliche Diskussion, die sich in Folge des Vorschlags, Kiezdeutsch als Dialekt anzusehen, entspann, lieferte vielfältige Evidenz für eine Konstruktion deutscher Dialekte und des Standarddeutschen als „Hochdeutsch“, die eng mit wir/sie-Dichotomien verflochten ist, die Mitglieder einer vermeintlichen in-Group von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n abgrenzt. Die folgenden Zitate, aus ei-nem Leserkommentar zu einem online-Artikel einer regionalen Tageszeitung und zwei Emails, illustrieren dies und geben einen ersten Eindruck der Ethnisierung
9
und Ausgrenzung von Kiezdeutsch und seinen Sprecher/inne/n, die hiermit ver-bunden ist:
(1) „Über allen Dialekten „thront“ hochdeutsch als verbindende, gemeinsame Sprache. In den Schulen wird hochdeutsch gelehrt, evtl. mit einem örtlich unterschiedlichen Akzent. Bei „Kanak-Sprak“ gibt es kein übergeordnetes hochdeutsch sondern „migrantisch“. Während ein Sachse oder Bayer oder... sich mit Ihnen auf hochdeutsch mit dem entsprechenden Akzent unterhalten kann, können dies die „Kanak-Sprak“-Artisten nicht.“ Leserbrief, Schleswig-Holsteinische Zeitung, 27/03/2012
(2) „Ich dachte ich höre nicht richtig, wie Sie diesem Kauderwelsch huldigten, dieses Ge-brabbel adelten und es tatsächlich der deutschen Sprache anverwandt anerkannten. Sicher kann man damit in Anatolien Ziegen vom Berg holen oder in Arabien Kamele einparken. Dieses aber einen deutschen Dialekt zu nennen halte ich für völlig abwegig!“ Email, 21/02/2012
(3) „Ihre Feststellung „Bayerisch wird auch nicht als der gescheiterte Versuch angesehen, Hochdeutsch zu sprechen“, ist ein dreister Versuch, ein Stück deutscher Kultur mit Ihrem so heiß geliebten „Kiezdeutsch“ zu vermischen. Der Bayrische, Hessische oder Schwäbische Dialekt entwickelte sich auf deutschem Boden und wurde von Menschen eines Kulturkreises gepflegt. Das so genannte „Kiezdeutsch“ wird von Ausländern wie Türken und anderen Menschen aus dem arabischen-vorderasiatischen Kulturraum nach Deutschland hereingetragen und hier verbreitet. Ihre Anbiederei bei Türken und sonstigen Moslems in Berlin wollen wir Deutsche nicht mittragen und ich bitte Sie, dieses von Ihnen so hoch geschätzte Kulturgut mit dem Namen „Kiezdeutsch“ nicht weiterhin als deutsches Sprachgut zu verbreiten.“ Email, 19/02/2012
4 wir/sie‐DichotomienimDiskurszuKiez‐deutsch
Die im Vorangegangenen zitierten Äußerungen aus der öffentlichen Diskussion um Kiezdeutsch weisen auf zwei zentrale Mechanismen von Gruppenkonstituie-rung, wie sie etwa Schmidt / Deppermann (in diesem Band, Kap. IV-3) identifi-zieren, nämlich Außenabgrenzung und Wir-Bewusstseins-Bildung. Diese Mecha-nismen und die mit ihnen verbundenen Dichotomien untersuche ich im Folgenden in Form einer Fallstudie an Daten aus dem öffentlichen Diskurs, die in Form ei-nes Korpus vorliegen, aus dem auch die obigen Beispiele stammen. Ich stelle im vorliegenden Abschnitt zunächst kurz das Korpus vor, zeige dann zentrale Topoi im Diskurs auf und analysiere auf dieser Basis die verschiedenen Dichotomien, die hier für die Konstruktion des ‚Anderen‘ bei der diskursiven Aushandlung sozialer Gruppen wirksam werden.
10
4.1 Datenbasis
Die empirische Basis für die vorliegende Untersuchung liefert das mit dem Kiez-DeutschKorpus (KiDKo) assoziierte Korpus KiDKo/E (KiDKo/Einstellungen), das Daten zu Einstellungen, Wahrnehmungen und Sprachideologien aus der öf-fentlichen Diskussion zu Kiezdeutsch erfasst. Das Korpus ist anonymisiert und für korpuslinguistische Untersuchungen aufbereitet und über die KiDKo-Website (www.kiezdeutschkorpus.de) allgemein zugänglich. KiDKo/E erfasst Spontanda-ten aus der öffentlichen Diskussion zu Kiezdeutsch: Das Korpus versammelt Email-Zuschriften und Leserbriefe, die in Reaktion auf Medienberichte zu Kiez-deutsch verfasst wurden. Es umfasst 64 Emails, die im wesentlichen in zwei grö-ßeren Wellen, 2009 und 2012, eingingen, und 1.362 Leserkommentare, die von Januar bis April 2012 auf online-Medienseiten erschienen. Bis auf einen Fall (The Economist, UK) handelt es sich dabei um Medien aus Deutschland, die zusam-men einen breiten Querschnitt liefern, der Printmedien, internet-basierte Nach-richtenseiten und Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens berücksich-tigt, mit der entsprechend breiten Spanne an Zielpublikum, von der generellen Öffentlichkeit über Studierende und über türkisch-deutsche Leser/innen bis zu politisch stark rechtslastigen Gruppierungen und selbsternannten „Sprachschüt-zern“ (für Details siehe Informationen auf der Korpus-Website).
Im Vergleich zu Daten aus Medienberichten selbst, wie sie bislang meist die empirische Basis für Untersuchungen zum öffentlichen Diskurs bilden, sind die in KiDKo/E versammelten Belege informeller und weniger kontrolliert. Sie bieten Meinungsäußerungen, die auf den Medienseiten nur marginal editiert werden und, da sie meist anonym verfasst sind, auch nicht der Art sozialer Kontrolle unterlie-gen, wie sie in offener Kommunikation, etwa im direkten Gespräch oder in sig-nierten Leserbriefen in der Druckversion von Zeitungen, zu erwarten wäre. Diese vergleichsweise geringe interne und externe Kontrolle macht solche Spontandaten für soziolinguistische Analysen besonders geeignet; sie eröffnen dardurch einen direkteren Zugang zu Anschauungen und Meinungen über sprachbezogene The-men (vgl. hierzu auch Wiese 2015, zur Internet-Kommunikation exemplarisch Yus 2011). Dabei sollte man jedoch zugleich im Blick behalten, dass hier Produk-tionen einer selbst-seligierten Gruppe vorliegen, die nicht notwendigerweise re-präsentativ für die Diskussion insgesamt sein muss – ein Umstand, der selbstver-ständlich auf Medienberichte als empirische Basis ebenso zutrifft.
4.2 2x2Topoi
Die Einstellungen, die gegenüber Kiezdeutsch und seinen Sprecher/inne/n in den Beiträgen ausgedrückt werden, sind überwiegend negativ; Äußerungen, die neut-rale oder positive Einstellungen transportieren, machen demgegenüber nur einen
11
kleinen Anteil aus (insgesamt lag dieser Anteil bei 8,7%, mit niedrigeren Zahlen für Emails aus dem früheren Erfassungszeitraum (2009; 0%) und Kommentaren in rechtslastigen Medien (0,7%) und Boulevardzeitungen (3,2%) und höheren Zahlen für universitätsorientierte Medien (20,2%) und Emails aus dem späteren Erfassungszeitraum (2012; 23,5%).
Für die negativen Beiträge lassen sich eine Reihe wiederkehrender Themen identifizieren, die über die verschiedenen Kategorien von Kommentaren und Emails hinweg auftreten und sich um vier zentrale Topoi gruppieren:
Gebrochene Sprache – „Kiezdeutsch ist eine defizitäre Version des Deutschen.“
Sprachverfall – „Es bedroht daher die Integrität der deutschen Sprache.“
Integrationsverweigerung – „Kiezdeutsch-Sprecher/innen integrieren sich nicht in die Mehrheitsgesellschaft.“
Gesellschaftliche Auflösung – „Sie bedrohen daher den sozialen Zusammenhalt.“
Diese Topoi liegen auf zwei Ebenen und bilden dort zwei parallele Paare. Das erste Paar, „Gebrochene Sprache“ und „Sprachverfall“, zielt auf die sprachliche Ebene selbst und reflektiert eine negative Bewertung von Kiezdeutsch und seiner Wirkung auf das Deutsche, während das zweite Paar, „Integrationsverweigerung“ und „Gesellschaftliche Auflösung“, auf eine allgemeinere soziale Ebene zielt und die Abwertung des Sprachgebrauchs mit Aspekten gesellschaftlicher Integration verbindet. Die folgenden Zitate aus einem Leserkommentar und einer Email il-lustrieren typische Verbindungen der verschiedenen Topoi (Belege aus KiDKo/E; jeweils mit Datum und bei Kommentaren mit Angabe der Medienseite, auf der kommentiert wurde):
(4) „Das ist kein Dialekt, sondern lediglich die Unlust sich zu integrieren oder (noch schlimmer) die Faulheit die eigene Sprache richtig zu lernen.“ Leserbrief, Bild, 17/02/2012
(5) „Dieses Assigestammel als Sprache zu bezeichnen ist eine absolute Disqualifikation als Wissenschaftler […]. Ich habe beruflich sehr viel mit (gestrauchelten) jugendlichen Mig-ranten und auch deutschstämmigen Jugendlichen zu tun und sehe jeden Tag, wie sich die Deutschen an die Arab-Türk-Kurdensprache anpassen. Teilweise sind gar keine „norma-len“ Dialoge mehr möglich, weil der grundlegende Sprachschatz schon gelöscht ist.“ Email, 29/02/2012
Der Kontrast, der in der Email zwischen „Migranten“ und „deutschstämmigen Jugendlichen“ konstruiert wird, und die Beschreibung einer Anpassung der „Deutschen“ an die „Arab-Türk-Kurdensprache“ impliziert eine Konzeptualisie-rung von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n als nicht-deutsch und illustriert damit be-reits eine soziale und sprachliche Dichotomie, auf die ich unten noch genauer eingehe.
12
Der Topos des „Sprachverfalls“ ist in den Daten mit wiederkehrenden Cha-rakterisierungen von Kiezdeutsch als „reduziert“ und „primitiv“ assoziiert, die diesem Sprachgebrauch den Status echter Sprache absprechen. Kiezdeutsch wird in diesem Zusammenhang energisch als Teil des Deutschen abgelehnt, und seine Charakterisierung als deutscher Dialekt wird mitunter als Angriff auf die deutsche Sprache insgesamt oder auf „Hochdeutsch“ im Speziellen angesehen. (6) gibt ein Beispiel:
(6) „diese Gossensätze als neuen Dialekt zu bezeichnen ist eine Beleidigung der deutschen Sprache ohne gleichen.“ Leserbrief, shortnews, 09/02/2012
Als Gründe für den Gebrauch von Kiezdeutsch wird neben mangelnder Sprachfä-higkeit häufig angeführt, dass die Sprecher/innen „schlampig“ oder „faul“ seien oder nicht bereit, die Zeit und Mühe aufzuwänden, „ordentlich“ zu sprechen. Eine Verbindung, die in diesem Zusammenhang häufig gemacht wird, ist die zwischen Sprache und Kultur. Schreiber/innen werten Kiezdeutsch hier als eine Sprachform ab, die früheren Stufen der menschlichen Evolution angehört, mit Verweisen auf „Steinzeit“ und „Neanderthaler“, im Gegensatz zum „Hochdeutschen“, das als „Hochsprache“ eine entsprechende höhere Kultur anzeige.
Die Abwertung von Kiezdeutsch als kulturell niedriger stehend begründet die Sorge vor einer negativen Wirkung auf die Kultur in Deutschland; in diesem Zu-sammenhang tritt dann häufig das Motiv vom „Land der Dichter und Denker“ auf, das ein positives Selbstbild einer Kulturnation mit entsprechender „Hoch-sprache“ transportiert.
Eine wiederkehrende Annahme ist die, dass der Gebrauch von Kiezdeutsch ein Zeichen für die Unfähigkeit oder aber Unwilligkeit der Sprecher/innen sei, sich in die Mehrheitsgesellschaft zu integrieren. Im zweiten Fall erscheint Kiez-deutsch als eine Ablehnung des „Hochdeutschen“ und der Wertschätzung, die es erhält. Die vorgebliche mangelnde Integration wird als Bedrohung für die Gesell-schaft insgesamt angesehen, wobei in einer Reihe von Belegen das Motiv „Armes Deutschland“ auftritt, das populär Anzeichen für einen vermeintlichen nationalen Niedergang beklagt.
Der Topos der „Gesellschaftlichen Auflösung“ begründet in einigen Fällen ein Bild einer feindlichen Übernahme der deutschen „Hochsprache“, nationaler Werte oder Deutschlands als Ganzes. Dieses Bild knüpft an eine bestimmte Kon-struktion von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n als „Andere“ an, eine soziale Aus-grenzung, die auf spezifischen wir-sie-Dichotomien basiert und auch bei den anderen Topoi, die hier identifiziert wurden, involviert ist. Der vielleicht interes-santeste Aspekt der hier analysierten Debatte ist die Weise, wie sie diese Dicho-tomien aufdeckt und aufzeigt, wie sie zu einer gemeinsamen sprachideologischen Basis der verschiedenen Topoi beitragen.
13
Die betreffenden Dichotomien operieren auf zwei Ebenen: (1) auf der gene-rellen Ebene sozialer Schichten, auf der Kiezdeutsch-Sprecher/innen als sozial niedriger stehend konstruiert werden, und (2) auf einer spezifischeren Ebene von „Ethnizität“, auf der sie als Mitglieder einer alloethnischen out-Group augegrenzt werden. Auf beiden Ebenen wird Kiezdeutsch als indexikalisch für eine soziale Gruppe wahrgenommen, die als „Andere“ konstruiert und als niedriger stehend abgewertet werden. Die folgenden Belege geben verschiedene Beispiele hierfür:
(7) „Womit ich „Kiezdeutsch“ assoziiere: – Ungebildete, primitive männliche Jugendliche – Gewaltbereitschaft, Aggressivität, Pöbelei – düstere, grimmige Visagen – Machotum, Frauenverachtung – Protzerei mit Äußerlichkeiten (Goldkettchen, Auto...) – Hass auf die Gebildeten und auf diejenigen, die sich durch eigene Arbeit einen gewissen Wohlstand geschaffen haben – Hass auf Juden und Homos.“ Leserbrief, Fokus Online, 12/02/2012
(8) „Man sollte die „Kiezsprache“ einfach als gegeben hinnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gebildete es ernsthaft ablehnen, dass man Ungebildete an der Sprache erkennt. So erspart man sich doch überflüssige Kontakte.“ Leserbrief, UniSPIEGEL, 29/03/2012
(9) „Ach, wenn sie doch nur wüssten, wie sie sich durch Sprache, Körperkunst und Kleidung zur untersten Kaste gehörend kennzeichnen. Eine Lebensführung auf Niveau Mindestlohn, HartzIV wird so vorprogrammiert.“ Leserbrief, Bild 18/02/2012
(10) „Unterschichtendialekt […], der überwiegend von Migranten mit türkisch-arabischem Hintergrund gesprochen […] wird“ Email, 27/02/2012
Wie diese Belege aus unterschiedlichen Bereichen illustrieren, lassen sich die Dichotomien, die hier deutlich werden, über Subkorpora hinweg nachweisen. Explizite Aussagen hierzu sind besonders häufig in Emails, in denen sie in über einem Drittel (36,8%) der Fälle auftreten, in Kommentaren zu Boulevardzeitun-gen (24,8%) und zu rechtslastigen Medien (21,4%).
In den folgenden beiden Abschnitten betrachte ich die beiden hier relevanten Domänen für wie/sie-Dichotomien kurz einzeln.
4.3 SozialeSchicht
In der Domäne der sozialen Schicht werden Kiezdeutsch-Sprecher/innen als sozi-ale Gruppe konstruiert, die gesellschaftlich niedriger steht als die dominante wir-Gruppe und als solche von den Schreiber/inne/n, die sich selbst als Mitglieder jener Gruppe verstehen, unterschieden ist.
Die Statusabwertung der Kiezdeutsch-Sprecher/innen wird realisiert über Themen wie Unterschicht (z.B. „Prolls“, „Asos“, „niedrige Kaste“, „Ghetto“, „Gossensprache“), Armut (z.B. „arm“, „Hartz IV“), Bildungsmangel (z.B. „unge-bildet“, „bildungsfernes Milieu“, „Schulversagen“), Aggression und Kriminalität
14
(z.B. „aggressiv“, „Gewalt“, „Provokation“, „kriminell“, „Terrorismus“, „Gangs-ter“), Kulturlosigkeit (z.B. „unkultiviert“, „primitiv“, „kulturlos“, „kultureller Niedergang“). Die beiden Letzteren sind dabei häufig mit einem Widerstand ge-gen liberale Werte assoziiert, wie dies etwa in (7) oben deutlich wird (für ähnliche Befunde aus vergleichbaren Debatten in Frankreich, Schweden und Großbritanni-en vgl. Pooley 2008, Milani 2010, Kerswill 2013).
In einer Reihe von Fällen wird die soziale Ausgrenzung von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n dadurch verstärkt, dass Schreiber/innen starke emotionale und physische Reaktionen sozialer Aversion ausdrücken und Kiezdeutsch etwa als „ekelhaft“, „widerlich“ oder „gruselig“ beschreiben, davon sprechen, dass sie „kotzen“ müssten, sich ihnen „die Nackenhaare heben“ oder „die Fußnägel hoch-drehen“.
Die Konstruktion von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n als aggressiv wird häufig durch angebliche, von den Schreiber/inne/n konstruierte Sprachbeispiele gestützt, die von Pejorationen, Beleidigungen und Drohungen dominiert sind. Diese Bei-spiele stellen eine sprachliche Besitznahme dar, bei der Schreiber/innen mit der Stimme des „Anderen“ sprechen und durch den Kontrast zur eigenen sprachlichen und sozialen Identität die Abgrenzung zu der betreffenden Gruppe verstärken. Insbesondere in den Emails, aber auch in Kommentaren auf Medienseiten, ermög-licht eine solche Aneignung den Schreiber/inne/n sprachliche Tabubrüche und den Gebrauch gewalttätiger Drohungen, Beleidigungen und Beschimpfungen (z.B. „du alte Scheiße“, „Bitch“, „Ey Pussy“, „yalla - verpiss dich“ „lan sick dich“, „Isch mach dich Krankenhaus“). (11) und (12) geben Illustrationen aus einer Email und einem Leserkommentar:
(11) „Ey, bissu voll krass behindert? Kanaksprak is voll nich cool, weil kriegst du keine richtige Job, weisdu? Ey, weis-wie-isch-mein? Höchstens voll schwule Professorentitel für Sozialfickdings, wie Du! Aber scheißegal, zahlt ja Steuerkartoffel! Ey figgdisch und schö-ne Grüße [Name]“ Email, 29/02/2012
(12) „Weischt du, das Bitch Heike versteht konkret... :-)“ Leserbrief, Der Westen, 29/01/2012
Wie an diesen Beispielen noch einmal deutlich wird, konstituiert dieser Gebrauch vorgeblicher „Kiezdeutsch“-Beispiele einen speziellen Fall des „Crossing“ im Sinne Ramptons (1995): In diesem Fall verwenden Schreiber/innen die Stimme des konstruierten „Anderen“, um sich in einer Weise verhalten zu dürfen, die normalerweise tabuisiert wäre, und betonen so die Verortung des „Anderen“ au-ßerhalb der Grenzen ihrer eigenen sozialen Gruppe. „Crossing“ dient hier somit gerade nicht der Markierung von Zugehörigkeit zu einer gemeinsamen Gruppe, sondern der Ausgrenzung und soziokulturellen Stigmatisierung einer anderen Gruppe über die sprachliche Ebene (vgl. hierzu auch Siebold, Kapitel IV.2 in
15
diesem Band, zur Karikatur gruppenspezifischen Sprachverhaltens als Mittel zum Ausdruck negativer Einstellungen und Demarkationen).
In Einklang mit dieser sozialen Ausgrenzung von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n wird die regionale Assoziation traditioneller deutscher Dialekte oft mit einer Lokalisierung für Kiezdeutsch kontrastiert, die nicht eine bestimmte geographische Region identifiziert, sondern generell Gebiete mit niedrigem sozia-len Status. Im folgenden Beleg wird dies mit einer alloethnischen Charakterisie-rung von Kiezdeutsch als „Türkendeutsch“ verbunden:
(13) „Dialekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in bestimmten Regionen gesprochen werden. Das als „Kiezdeutsch“ verharmloste Türkendeutsch wird dagegen in herunterge-kommen Gegenden gesprochen, wo die Bildung und die Integrationsfähigkeit gering sind.“ Leserbrief, UniSPIEGEL, 29/03/2012
Die ethnisch neutrale Bezeichnung „Kiezdeutsch“ wird hier als „Verharmlosung“ abgelehnt und durch „Türkendeutsch“ ersetzt. Dies impliziert eine Eingrenzung auf eine Gruppe, die nicht als Teil der deutschen Sprechergemeinschaft charakte-risiert wird. Diese Eingrenzung ist ein wiederkehrendes Thema in den Daten und bildet die Basis für die zweite zentrale wie/sie-Dichotomie: eine Dichotomie, die auf ethnischen Grenzziehungen beruht und Sprecher/innen aus der „deutschen“ wir-Gruppe ausschließt.
4.4 ‚Ethnien‘
Neben generellen Konstruktionen der Sprecher/innen als „Ausländer“ oder „Mig-ranten“ beziehen sich (allo-)ethnische Konzeptualisierungen zumeist auf türki-sche, arabische und kurdische Familienhintergründe. Hierbei ist zu beachten, dass Ethnien grundsätzlich nicht a priori bestehende, feste Klassen sind, sondern ver-änderliche und sozial konstruierte Zuschreibungen: Wer z.B. als „türkisch“, wer als „kurdisch“, wer als „deutsch“ zählt, aber auch wer als „Migrant“ gilt, ist nicht so sehr an Fakten zu Geburtsort, Mehrsprachigkeit oder Zuwanderungsgeschichte der Familie gebunden, sondern an soziale Interpretationen und kann sich je nach Kontext und Perspektive ändern. Die Ethnisierung von Kiezdeutsch, die in den Daten zu beobachten ist, involviert somit zwei Prozesse: zum einen die Ein-schränkung der Sprechergemeinschaft auf eine bestimmte Gruppe, zum anderen die Zuschreibung nicht-deutscher Ethnizität(en) zu dieser Gruppe. Zusammenge-nommen liefert dies die Basis für eine Reinterpretation von Kiezdeutsch als Sprachgebrauch einer Sprechergruppe, die von der als „deutsch“ wahrgenomme-nen wir-Gruppe abgegrenzt wird.
Diese alloethnische Grenzziehung liefert die Basis für eine besonders starke Ablehnung von Kiezdeutsch als Dialekt und wiegt dabei, wie der folgende Beleg deutlich macht, stärker als Grenzen der sozialen Schicht:
16
(14) „Kiezdeutsch ist kein Dialekt,es ist noch nicht mal Proletendeutsch! Sowas nennt man höchstens Tarzandeutsch.“ Leserbrief, rp-online, 22/04/2012
Die xenophoben Untertöne, die in dieser Domäne vorherrschen, treten besonders deutlich in den Bezeichnungen hervor, für die Schreiber/innen anstelle von „Kiezdeutsch“ plädieren, oft noch in Verbindung mit Demarkationen der sozialen Schicht. Die folgenden Belege aus einer ganzen Bandbreite von Quellen im Kor-pus illustrieren dies:
(15) „Kietzdeutsch? Türkenproll-Dialekt wäre wohl richtiger“ Leserbrief, rp-online, 22/04/2012
(16) „Das ist kein Kiezdeutsch, das ist „Ghettostylemigrantendeutsch“, das ist das Letzte! Neuer Dialekt, lächerlich“ Leserbrief, Bild, 17/02/2012
(17) „Was die als „Kiezdeutsch“ bezeichnet, ist nichts anderes als kanakengequassel“ Deutschland-Echo, 29/01/2012
(18) „Kiezdeutsch Schon dieser Terminus ist ein Euphemismus für ehemals „Kanack“ und ohne wenn und aber kein Dialekt“ Leserbrief, UniSPIEGEL, 29/03/2012
(19) „Kiezdeutsch oder wie immer sie diese Kanackensprache nennen wollen, soll ein Dia-lekt sein? So reden wie der Name schon sagt Kanacken!“ Email, 28/02/2012
Das folgende Zitat aus einem Leserkommentar zum UniSPIEGEL stellt eine Kau-salverbindung zwischen Dialektbesitz und der Zugehörigkeit zu deutschen „Volksstämmen“ her, von der Kiezdeutsch-Sprecher/innen als „Türken“ ausge-nommen werden – um dann, etwas widersprüchlich, beschuldigt zu werden, sich nicht zu integrieren:
(20) „Die Schwaben und Bayern sind deutsche Volksstämme und haben deshalb ihren ei-genen Dialekt. Kiezdeutsch, besser wäre Türkendeutsch, steht für mangelnde Integrations-bereitschaft.“ Leserbrief, UniSPIEGEL, 29/03/2012
Die ethnische Grenzziehung, die hier wirksam wird, wird oft noch durch eine religiöse Assoziation von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n mit dem Islam verstärkt, der in diesem Kontext generell negativ und als weiteres Allo-Merkmal gegenüber der wir-Gruppe wahrgenommen wird. Dies passt etwa zu Befunden des aktuellen „Religionsmonitors“ der Bertelsmann-Stiftung, demzufolge „der Islam […] von vielen Deutschen als etwas Fremdes, Andersartiges und Bedrohliches empfun-den“ wird (Pollack / Müller 2013, 56). (21) illustriert, wie in den Korpusdaten die Ablehnung von Kiezdeutsch als Dialekt mit einer Abwertung von Muslimen ver-bunden wird:
(21) „Das ist schlicht und ergreifend kein Dialekt sondern einzig und allein der unfähig der Muslime geschuldet die deutsche Sprache zu erlernen.“ Leserbrief, pi-news, 26/05/2009
17
Eine weitere sprachideologische Stütze für die ethnische Dichotomie, die in der Debatte zu beobachten ist, ist die sprachliche Ausgrenzung mehrsprachiger Spre-cher/innen aus einer „deutschen“ wir-Gruppe, insbesondere bei Sprecher/inne/n, deren Herkunftssprache einen niedrigen sozialen Marktwert besitzt. Zum einen führt ein verbreiteter monolingualer Bias zur Wahrnehmung von kindlicher Mehrsprachigkeit als problematisch (vgl. etwa Gogolin 2994), und ein „Migrati-onshintergrund“ wird als grundlegende Hürde für den Erwerb von Deutschkom-petenzen angesehen: Mythen zur „doppelten Halbsprachigkeit“ sind in der öffent-lichen Debatte ebenso verbreitet wie im Bildungsbereich, und „Migrationshinter-grund“ ist dort eng mit „Sprachförderbedarf“ assoziiert (vgl. auch Scarvaglieri / Zech 2013 zu Daten aus korpusbasierten Kookkurrenzen hierzu). Dies kann so weit gehen, dass z.B. die Berliner Senatsverwaltung den reinen Anteil von Kin-dern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund als negativen Faktor für den Entwicklungsindex eines Wohngebiets zählt.
Zum anderen tragen verbreitete Benennungspraktiken dazu bei, bestimmten Zuwanderern und ihren Nachkommen genuines „Deutschsein“ abzusprechen. Während „Russlanddeutsche“ morphologisch-kompositionell als „Deutsche“ charakterisiert sind, werden beispielsweise Einwohner/innen türkischer Herkunft typischerweise als „Deutschtürken“ bezeichnet, d.h. weiterhin semantisch als „Türken“, nicht als „Deutsche“ klassifiziert, auch wenn sie bereits zu der zweiten oder dritten Generation gehören, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist (vgl. hierzu auch Wiese 2012, Kap.7.3). An diesem Kontrast wird, ähnlich wie in dem obigen Beispiel zur Akzeptanz von Kiezdeutsch vs. Texasdeutsch als deutschen Dialekt, das Wirksamwerden eines sprachideologischen Ius sanguinis deutlich: die Konstruktion sozialer Gruppen und ihres Sprachgebrauchs als „deutsch“ vs. „nicht-deutsch“ entsprechend einer wahrgenommenen Verwandt-schaftsbeziehung zur „deutschen“ wir-Gruppe.
Solche Benennungpraktiken sind so stark verbreitet, dass sie sich z.T. auch unreflektiert in wissenschaftlichen Publikationen finden, wenn z.B. mehrsprachi-ge Jugendliche, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, als „serbo-kroatischer Sprecher“, „türkischer Sprecher“ u.ä. bezeichnet werden (vgl. demge-genüber inklusive Bezeichnungen wie „Italo-Deutsche“ und „Turk-Deutsche“ für Bilinguale in Kotthoff, Kap. IV-4 in diesem Band).
Im politisch-gesellschaftlichen Bereich hat die Einführung der Kategorie „Migrationshintergrund“ eine Funktion, die ebenfalls ein entsprechendes Ius san-guinis reflektiert: Wie Scarvaglieri / Zech (2013) in einer funktional-semantischen Analyse des Gebrauchs dieses Begriffs beschreiben, wurde der Ausdruck wesentlich mit der Reform des Staatsbürgerschaftsrechts populär, nachdem mehr Einwohner/innen die deutsche Staatsangehörigkeit erhielten, die zuvor als „Ausländer/innen“ galten, etwa weil sie selbst oder die Eltern Zuwande-rer waren. Die Kategorie „Migrationshintergrund“ erlaubt es, diese Gruppe inner-halb der Klasse der „Deutschen“ abzugrenzen und weiterhin in eine gemeinsame
18
Klasse mit „Ausländer/inne/n“ zu fassen. Die durch das neue Staatsbürgerschafts-recht faktisch nun stärker durchlässige Gruppe der „Deutschen“ wird damit als wir-Gruppe der Deutschen ohne „Migrationshintergrund“ wieder als undurchläs-sig konstruiert.
Die scheinbare Unmöglichkeit, jemanden türkischer Herkunft als „Deut-schen“ zu bezeichnen und sprachlich zur wir-Gruppe zu zählen, führt teilweise zu erstaunlichen Wendungen bis hin zu faktischen Falschdarstellungen, nicht nur im informellen Bereich, sondern auch in editierten Medienberichten. Drei Beispiele vom Frühjahr 2013 aus dem Berliner Tagesspiegel, der sich an eine eher bil-dungsbürgerliche, liberale Leserschaft richtet, sollen das Phänomen hier kurz illustrieren.
So berichtet ein Artikel zur „Bildung nach Pisa“ – nicht zufällig im Zusam-menhang mit Sprachförderbedarf – über Grundschüler/innen: „Beim ersten Pisa-Bericht 2000 kam jeder fünfte Grundschüler aus einer nicht-deutschen Familie, jetzt ist es schon jeder dritte“ (Tagesspiegel vom 7.12.2013). Tatsächlich gelten die entsprechenden Zahlen für Schüler/innen mit Migrationshintergrund, deren Familien hier jedoch unmittelbar als „nicht-deutsch“ klassifiziert werden.
Ein Artikel über ein Bombenattentat beschreibt zwei Verdächtige, die in Wien und Berlin festgenommen worden waren, als „der afghanischstämmige Österreicher und der Deutschtürke“ (Tagesspiegel vom 17.4.2013) – eine unge-wöhnlich holprige Koordination anstelle des eigentlich näher liegenden Paralle-lismus mit „… und ein türkischstämmiger Deutscher“.
Als zum ersten Mal ein Kinofilm aus der Türkei seine Premiere in Deutsch-land feierte, wurde der türkische Regisseur Yilmaz Erdoğan, der für die Premiere nach Berlin gekommen war und dort von einer begeisterten Menschenmenge empfangen wurde, im Tagesspiegel mit der Äußerung zitiert „Ich liebe die Berli-ner und merke, dass die Berliner uns Türken lieben.“ Dieses Zitat wurde unmit-telbar gefolgt von der qualifizierenden Kommentierung „Zumindest seine Lands-leute mit Berliner Wohnsitz“ (Tagesspiegel vom 23.2.2013). Diese Qualifizierung wurde offensichtlich als notwendig erachtet, damit Leser/innen verstehen konn-ten, dass „Berliner“ in Erdoğans Aussage nicht ausschließlich auf einsprachig deutsche Berliner begrenzt war, sondern auch solche mit türkischen Sprachkennt-nissen einbezog (der Film wurde, wie der Tagesspiegel-Artikel weiter fortfuhr, im türkischen Original mit deutschen Untertiteln gezeigt). Letztere wurden hier pau-schal als „Landsleute“ Erdoğans und damit als Türken klassifiziert.
Diese Beispiele illustrieren noch einmal die verbreitete Abgrenzung, die die hier untersuchte Dichotomie stützt und gerade auch auf sprachlicher Ebene wirk-sam wird: eine Abgrenzung, die eine „deutsche“ wir-Gruppe auf der Basis ethni-scher Zuschreibungen und monolingualer Ideale definiert und diejenigen, die hierdurch als „Andere“ konstruiert werden, aus dieser Gruppe ausschließt. Diese Konstruktion sozialer Gruppen spielt, wie in der vorliegenden Fallstudie deutlich
19
wurde, eine zentrale Rolle in der Debatte um Kiezdeutsch und seine Spre-cher/innen und die Eigentümerschaft für deutsche Dialekte.
5 Fazit:Kiezdeutsch‐Sprecher/innenalsdie„Anderen“
Die vorliegende Untersuchung hat für das Fallbeispiel „Kiezdeutsch“ zwei zentra-le wir/sie-Dichotomien nachgewiesen, die hier in der sprachlichen Konstruktion sozialer Gruppen wirksam werden: Kiezdeutsch-Sprecher/innen werden im öf-fentlichen Diskurs in zwei Domänen als die „Anderen“ konstruiert und so aus der wir-Gruppe ausgeschlossen. Zum einen werden sie als Angehörige einer niedrige-ren sozialen Schicht gedeutet und hier als ungebildet und unkultiviert assoziiert. Diese Konstruktion stützt eine Abwertung des Sprachgebrauchs als schlechtes oder fehlerhaftes Deutsch und der Sprecher/innen als sozial niedriger stehend und weniger kompetent. Demgegenüber wird die wir-Gruppe als Teil einer höheren sozialen Schicht, gebildeter und mit entsprechend höher bewerteten Sprachkom-petenzen einschließlich des „Hochdeutschen“ konstruiert.
Diese erste Dichotomie schließt Kiezdeutsch-Sprecher/innen aus der Gruppe der „Hochdeutsch“-Sprecher/innen aus, berührt jedoch nicht den Bereich um-gangssprachlicher und dialektaler Varianten, die vom Standarddeutschen abwei-chen und damit typischerweise generell als weniger hochstehend und oft auch als fehlerhaft wahrgenommen werden (vgl. etwa Milroy / Milroy 1999 zu Stan-dardsprachideologien, Davies 2012 detailliert für Deutschland).
So sind traditionelle regionale Dialekte heute auch Soziolekte in dem Sinne, dass ausgeprägter Dialektgebrauch als ein Marker für niedrigere soziale Schichten interpretiert wird. Durch den Bezug zu einer möglichen Dialekt-Einordnung von Kiezdeutsch lieferte die Debatte daher interessante weiter gehende Daten zur Konstruktion von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n: Die Analyse konnte hier eine zweite, grundlegendere Dichotomie aufdecken, die wesentliche Verknüpfungen von sozialen Gruppen mit sprachlicher Eigentümerschaft und Legitimation zeigte. Diese Dichotomie ist eine der ethnischen Zugehörigkeit und basiert auf einem spezifischen Narrativ darüber, was es heißt deutsch zu sprechen und wem deut-sche Dialekte gehören. Ein zentraler Aspekt, der hier deutlich wurde, ist die sprachideologische Wirksamkeit eines Ius sanguinis, das als Sprecher/innen des Deutschen nur solche zulässt, die als verwandt mit der wir-Gruppe wahrgenom-men werden. Kiezdeutsch-Sprecher/innen werden hier als ethnisch „Andere“ konstruiert.
Während Unterschiede der sozialen Schicht, auf die die erste Dichotomie ab-hebt, eher als graduell und stärker durchlässig erscheinen, ist die „ethnische“ Unterscheidung in „deutsch“ vs. „nicht-deutsch“, auf der diese zweite Dichotomie
20
basiert, kategorial und undurchlässiger. Sie führt damit, anders als die erste Di-chotomie, nicht nur zu einer Abwertung, sondern zu einer Ausgrenzung von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n. Abbildung 1 stellt die Wirksamkeit der beiden Di-chotomien graphisch dar.
Abbildung 1: wir/sie-Dichotomien in der Konstruktion von Kiezdeutsch-Sprecher/inne/n als die „Anderen“ Wie die Abbildung noch einmal illustriert, basiert die Konstruktion von Kiez-deutsch-Sprecher/inne/n als die „Anderen“ auf der Zuschreibung von Charakteris-tika (niedrige soziale Schicht, nicht-deutsch), die bestimmte Wahrnehmungen und Einstellungen gegenüber der betreffenden Sprechergruppe reflektieren, nicht jedoch ihre tatsächliche Zusammensetzung, wie sie in Abschnitt 2 deutlich wurde. Sie bringt damit zum einen ausgrenzende Uminterpretationen mit sich, etwa die von mehrsprachigen Sprecher/inne/n als „nicht-deutsch“ und die von Spre-cher/inne/n, die nicht aus der Mittelschicht stammen, als sprachlich weniger kompetent. Zum anderen beinhaltet sie ein „Erasure“, d.h. eine Negierung bzw. perzeptuelle Löschung, von Sprecher/inne/n, die nicht in diese Wahrnehmung passen, etwa einsprachig deutsche Sprecher/innen oder solche, die der Mittel-schicht angehören.
Die untersuchte Debatte erhellt damit beispielhaft wesentliche Prozesse bei der sprachlichen Konstruktion sozialer Gruppen, die Art von Dichotomien, die hierbei wirksam werden, und die Zuschreibung und Funktion von Gruppenmerk-malen, auf die sie rekurrieren. Die Debatte um Kiezdeutsch als Dialekt ist, wie hier deutlich wurde, dabei besonders geeignet, zentrale sprachideologische Zu-sammenhänge von sozialer Zugehörigkeit und sprachlicher Eigentümerschaft und Legitimation aufzudecken.
wir- Gruppe
Kiezdeutsch- Sprecher/innen
Soziale Schicht:
Abwertung
Ethnische Zugehörigkeit: Ausgrenzung
„deutsch“ „nicht-deutsch“
„höhere Schicht“
„niedrigere Schicht“
21
6 Literatur
Auer, Peter (2003): ‚Türkenslang‘: Ein jugendsprachlicher Ethnolekt des Deut-schen und seine Transformationen. In: Annelies Häcki Buhofer (Hg.): Spracherwerb und Lebensalter. Tübingen, 255-264.
Auer, Peter (2011): Dialect vs. standard: a typology of scenarios in Europe. In: Bernd Kortmann / Johan van der Auwera (Hg.): The Languages and Linguis-tics of Europe. Berlin, 485-500.
Besch, Werner, et. al. (Hg.) (1982): Dialektologie. Ein Handbuch zur deutschen und allgemeinen Dialektforschung. Vol.1. Berlin, New York [HSK 1.1].
Blommaert, Jan / Rampton, Ben / Spotti, Massimiliano (Hg.) (2011): Language and Superdiversities. Diversities [Special Issue] 13;2.
Boas, Hans C. (2003): Tracing dialect death: the Texas German Dialect Project. In: Julie Larson & Mary Paster (Hg.): Proceedings of the 28th Annual Meet-ing of the Berkeley Linguistics Society, 387-398.
Boas, Hans C. (2009): The Life and Death of Texas German. Durham, NC. Chambers, J. K. / Trudgill, Peter (1998): Dialectology. 2.Auflage. Cambridge. Cheshire, Jenny, et al. (2011): Contact, the feature pool and the speech communi-
ty: The emergence of Multicultural London English. In: Journal of Socio-linguistics 15(2), 151-196.
Davies, Winifred V. (2012): Myths we live and speak by: ways of imagining and managing language and languages. In: Matthias Hüning / Ulrike Vogl / Olivi-er Moliner (Hg.): Standard Languages and Multilingualism in European His-tory. Amsterdam, 45-69.
Dirim, İnci / Auer, Peter (2004): Türkisch sprechen nicht nur die Türken. Über die Unschärfebeziehungen zwischen Sprache und Ethnie in Deutschland. Ber-lin.
Fraurud, Kari / Boyd, Sally (2011): The native–non-native speaker distinction and the diversity of linguistic profiles of young people in multilingual urban con-texts in Sweden. In: Roger Källström / Inger Lindberg (Hg.): Young Urban Swedish. Gothenburg, 67-87.
Freywald, Ulrike, et al. (2011): Kiezdeutsch as a multiethnolect. In: Friederike Kern / Margret Selting (Hg.): Ethnic Styles of Speaking in European Metro-politan Areas. Amsterdam, 45-73.
Keim, Inken (2010): Sprachkontakt: Ethnische Varietäten. In: Hans-Jürgen Krumm et al. (Hg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache [HKS 35;1]. Ber-lin, 447-457.
Kern, Friederike / Selting, Margret (2006a): Einheitenkonstruktion im Türken-deutschen: Grammatische und prosodische Aspekte. In: Zeitschrift für Sprachwissenschaft 25(2), 239-272.
Kern, Friederike / Selting, Margret (2006b): Konstruktionen mit Nachstellungen
22
im Türkendeutschen. In: Arnulf Deppermann / Reinhard Fiehler / Thomas Spranz-Fogasy (Hg.): Grammatik und Interaktion. Radolfzell, 319-347.
Kerswill, Paul (2013): The objectification of ‘Jafaican’: The discoursal embed-ding of Multicultural London English in the British media. Ms, University of York
Milani, Tommaso (2010): What’s in a name? Language ideology and social dif-ferentiation in a Swedish print-mediated debate. In: Journal of Sociolinguis-tics 14, 116-142.
Milroy, James / Milroy, Lesley (1999): Authority in Language: Investigating Standard English. London.
Pfaff, Carol W. (2009): Parallel assessment of oral and written text production of multilinguals. In: Bernd Ahrenholz (Hg.): Empirische Befunde zu DaZ- Er-werb und Förderung. Freiburg, 213-234.
Pollack, Detlef / Müller, Olaf (2013): Religionsmonitor. Gütersloh. Pooley, Tim (2008): Analyzing urban youth vernaculars in French cities. In: Da-
lila Ayoun (Hg.): Studies in French Applied Linguistics. Amsterdam, 317-344.
Quist, Pia (2008): Sociolinguistic approaches to multiethnolect: Language variety and stylistic practice. In: International Journal of Bilingualism 12, 43-61.
Rampton, Ben (1995): Crossing: Language and Ethnicity Among Adolescents. London.
Rampton, Ben (2013): From ‘Youth Language’ to contemporary urban vernacu-lars. In: Arnulf Deppermann (Hg.): Das Deutsch der Migranten [IDS Jahr-buch 2012]. Berlin, 59-80.
Rampton, Ben (2014): Contemporary urban vernaculars. Ersch. 2014 in: Jaco-mine Nortier / Bente A. Svendson (Hg.): Language, Youth, and Identity in the 21st Century. Oxford. Kap.2.
Rothman, Jason / Treffers-Daller, Jeanine (2014): A prolegomenon to the con-struct of the Native Speaker: Heritage Speaker. Bilinguals are natives too! In: Applied Linguistics 35(1), 93-98.
Scarvaglieri, Claudio / Zech, Claudia (2013): „ganz normale Jugendliche, aller-dings meist mit Migrationshintergrund“. Eine funktional-semantische Analy-se von „Migrationshintergrund“. In: Zeitschrift für angewandte Linguistik 1, 201-227.
Selting, Margret (2011): Prosody and uni-construction in an ethnic style: the case of Turkish German and ist use and function in conversation. In: Friederike Kern / Margret Selting (Hg.): Ethnic Styles of Speaking in European Metro-politan Areas. Amsterdam, 131-159.
Trudgill, Peter (1992): Introducing Language and Society. London. Vertovec, Steven (2007): Super-diversity and its implications. In: Ethnic and
Racial Studies 30, 1024-1054. Wiese, Heike (2010): Kiezdeutsch: ein neuer Dialekt. In: Aus Politik und Zeitge-
23
schichte 8, 33-38 [Themenband: „Sprache“]. Bundeszentrale für politische Bildung.
Wiese, Heike (2012): Kiezdeutsch. Ein neuer Dialekt entsteht. München. Wiese, Heike (2013): Das Potential multiethnischer Sprechergemeinschaften. In:
Arnulf Deppermann (Hg.): Das Deutsch der Migranten [IDS Jahrbuch 2012]. Berlin, 41-58.
Wiese, Heike (2015): 'This migrants’ babble is not a German dialect!' – The inter-action of standard language ideology and ‘us’/‘them’-dichotomies in the pub-lic discourse on a multiethnolect. Ersch. in: Language in Society 2015;4.
Wiese, Heike (ersch.): Neue Dialekte im urbanen Europa. Ersch. In: Busse, Beatrix, & Warnke, Ingo (2014), Sprache im urbanen Raum / Language in Urban Space. Berlin, New York: de Gruyter [Handbuchreihe Sprachwissen, Band 20]. Kap.II.3.
Wiese, Heike, & Duda, Sibylle (2012): A new German particle ‘gib(t)s’ – The dynamics of a successful cooperation. In: Katharina Spalek / Juliane Domke (Hg.): Sprachliche Variationen, Varietäten und Kontexte. Festschrift für Rainer Dietrich. Tübingen, 39-59.
Yus, Francisco (2011): Cyberpragmatics. Internet-mediated Communication in Context. Amsterdam: Benjamins.

































![Schlesische Ritterburgen des späten Mittelalters und frühen Neuzeit im Lichte der archäologischen Quellen, [w:] F. Biermann, T. Kersting, A. Klamt (red.), Soziale Gruppen und Gesellschaftsstrukturen](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632068d518429976e406313b/schlesische-ritterburgen-des-spaeten-mittelalters-und-fruehen-neuzeit-im-lichte.jpg)