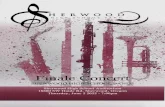Till Rippmann Lizarbeit Konstruktion des Boesen Finale Version
Transcript of Till Rippmann Lizarbeit Konstruktion des Boesen Finale Version
Die Konstruktion des Bösen Eine Diskursanalytische Auseinandersetzung mit der medialen
Feindbildkonstruktion in der Schweiz Eingereicht von:
Till Rippmann
Mattackerstrasse 3
8052 Zürich
Matrikel-Nr: 02-736-056
Tel: 076 488 24 23
Student im 20. Semester
Hauptfach: Politikwissenschaft
1. Nebenfach: Volkskunde
2. Nebenfach: Europäische Volksliteratur
Diese Lizenziats Arbeit wurde betreut durch:
Prof. Thomas Hengartner
Universität Zürich
Institut für Populäre Kulturen
Affolternstrasse 56
CH-8050 Zürich
Zürich, den 10.5.2013
1
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung S.3
2. Theoretischer Rahmen S.7
2.1. Diskurs S.7
2.2. Dispositiv S.8
2.3. Das Dispositiv im Verhältnis zum Diskurs S.9
2.4. Diskursanalyse S.10
2.5. Diskursanalyse S.14
3. Vorgehen S.14
4. Definitionen des Bösen S.17
4.1. Keine Verteidigung ohne Feinde S.18
4.2. Das Böse, Recht und Gewalt S.19
4.3. Feind oder Rivale S.20
4.4. Das Territorium des Bösen: Von der Kategorie zur Wirklichkeit S.23
4.5. Der Feind und das Fremde S.29
4.6. Die Abwertung des Feindes S.31
4.7. Feindbilder, Schwäche und die Komödie S.32
5. Die geistige Landesverteidigung S.33
5.1. Das geistige Schlachtfeld S.36
6. Dispositivanalyse an den relevanten Punkten S.39
6.1. „Geistige Landesverteidigung“: Von der Selbstfindung zur Abgrenzung S.41
6.2. Kriegsende , der „Sonderfall Kleinstaat“ und das neue Dispositiv S.45
7. Diskurse um das Schweizer Selbstbild S.46
7.1. Prag 1948: Der Vorhang fällt (Dispositiv) S.50
7.2. Der Positionsbezug nach Innen (Diskurs) S.51
7.3. Stalin als rhetorische Figur S.60
7.4. Ungarn 1956 (Dispositiv) S.61
7.5. Ungarn 1956 (Diskurs) S.63
2
8. Die Überfremdungsinitiative 1968-1970 S.64
8.1. Die Überfremdungsinitiative 1968-1970 (Dispositiv) S.65
8.2. Die Überfremdungsinitiative 1968-1970 (Diskurs) S.67
8.3. Die Sempacher Rede (Diskurs) S.71
9. Kim Jong Il: Vom Luzifer zum Pinocchio S.76
9.1. Die Verteidigung unter Anklage S.76
9.2. Der Zerfall der Sowjetunion S.78
9.3. Neuordnung des „Ostens“ S.80
9.4. Der gescheiterte Putsch von Moskau S.81
10. Die Dekonstruktion des Bösen: Looking at Kim Jong Il S.84
10.1. Die Schweiz und Nordkorea um 1994 (Dispositiv) S.85
10.2. Die Machtübernahme Kim Jong Ils S.88
10.2.1. Die Vermächtnisherrschaft S.88
10.3. Die Achse des Bösen S.90
10.4. Die Dekonstruktion eines Mythos S.93
11. Die Schreckliche Macht des Diskurses S.99
12. Quellenverzeichnis S.100
12.1. Primärquellen S.100
12.2. Sekundärliteratur S.103
12.3. Bildlegende S.104
13.Lebenslauf S.105
3
1. Einleitung
Basis dieser Arbeit ist die Idee der Frage nach dem Bösen, ganz für sich. Es ist nun mal
auffällig, dass das Böse, wie es uns in Märchen beispielsweise präsentiert wird recht
eindimensional dasteht. So ist oftmals „Böses zu tun“ Motivationsgrund genug für die Feinde
unserer populären Helden wie Hänsel und Gretel, Aschenputtel oder Frodo. Dicht gefolgt von
Rache, Gier und genereller Bitterkeit. Meist steht der Held einem Feind gegenüber, der im
Gegensatz zum Helden, nicht die Normen unserer Gesellschaft vertritt, nicht lauter und
tugendhaft ist und es auch nicht zu sein versucht, sondern aus einem meist recht irrational und
grob gehaltenen, gierigen Machtanspruch heraus, die Lebenswelt unserer Helden bedroht. Der
Feind im Märchen ist normalerweise übermächtig, dem Helden überlegen und macht diesem
sein Leben schwer oder vermeintlich ganz unmöglich. Wir sitzen dann als Kinder gebannt am
Herdfeuer und lauschen den Geschichten unserer Helden, wie sie eben dieses Böse am Ende
dann doch besiegen, also unsere Moral, unsere Normen, die uns mit diesen Geschichten
gelehrt werden, gegen dieses große Böse verteidigen. Nicht selten sind es diese Tugenden, die
gar den unmöglich scheinenden Sieg bringen.
Aus der relativierenden Überlegung, dass jede Kultur und jedes Land über ihre eigenen
Herdfeuer und Geschichten verfügt, darf angenommen werden, dass nicht alle Geschichten
von dem oder denselben Bösen berichten. Die narrative Konstruktion solcher Geschichten
dürfte heutzutage in vielen Kulturen ähnlich sein.
Jedenfalls ergibt sich aus dieser Perspektive die Annahme, dass auch jeweils dieselbe
Geschichte zwei Seiten hat: Also ist es vorstellbar, dass die alte, vom Leben und der
Dorfbevölkerung gepeinigte und in den Wald exilierte Lebkuchenbäckerin, sich lediglich
gegen einen dreisten Raub zu verteidigen versuchte, schließlich aber von den beiden
kriminellen Jugendlichen übermannt und auf unmenschlichste Art und Weise getötet wurde.
Das mag in dieser zugespitzten Form lustig klingen, birgt doch letztlich eine einfache
Vermutung: Das was böse ist, ist perspektivenabhängig. Es ist eine Wertung, eine
Bezeichnung, eine Kategorie. Die Anwendung dieser Kategorie ist wiederum
situationsabhängig. Wir benutzen die rhetorischen Figuren des Bösen dann, wenn sie
gebraucht werden, um etwas zu bezeichnen, als Warnung beispielsweise: „Achtung den Hund
nicht streicheln, er ist böse.“
Im Gegensatz zu einem Baum, der zwar etliche verschiedene Namen trägt und andere Rollen
in unterschiedlichen Kulturen spielt, aber eben ein Baum bleibt: Eine greif- und berührbare
4
Pflanze die mehr oder weniger weltweit aufgrund derselben Bedingungen wächst und gedeiht.
Er ist nicht erst dann da, wenn wir seinen Namen ausgesprochen haben, das Böse hingegen
schon.
Gemäß Knut Hickethier ist die Quelle des Bösen gerade in der Narration zu verorten, sie ist
das kulturelle Vermittlungsorgan für die „Ordnung erhaltende Differenz zwischen dem
Erlaubten und dem Nichterlaubten“.1 So ist es nach Hickethier genau die Geschichte am
Herdfeuer, die uns die „Vorstellungen, Ordnungssysteme“ und (für diese Untersuchung
besonders relevant) „Grenzziehungen vermittelt, mit denen wir die Welt wahrnehmen“2
So ist nicht jeder politische Aktivist, jede alte Kräuterhexe oder jeder Wolf böse. Nicht einmal
das Töten anderer Menschen kann als universell böse bezeichnet werden; zwar ist Mord in
den meisten Gesellschaften ein Kapitalverbrechen, wird doch (und ja gerade wegen der
Schwere des Verbrechens) auch in einer Reihe von (auch westlicher) Gesellschaften noch mit
dem Tod (Also einer legitimierten Tötung) bestraft. In dieselbe Kerbe schlägt natürlich auch
die Unterscheidung von gerechten und ungerechten Kriegen, an diesem Beispiel sogar
mehrdimensional: Einerseits kämpft eine moderne demokratische Gesellschaft nur in einem
Krieg der (wenigstens weitgehend) gerechtfertigt ist (respektive als gerechtfertigt akzeptiert
wird) und andererseits würde in heutigen Verhältnissen ein „ungerechter“ Krieg wiederum
von anderen Nationen auf diplomatischem oder physischem Weg bekämpft werden. Wie z.B.
der Bürgerkrieg in Libyen oder in Syrien.
Also ist selbst das Töten eines anderen Menschen weit davon entfernt als „das Böse
schlechthin“ gelten zu können. Daher gibt es das reine, materielle, wirkliche Böse vermutlich
nicht. Es existiert aber durchaus in unseren Diskursen und unseren Vorstellungen.
Das Böse ist erst in seinem Ausdruck, seinem Träger, seiner physischen Manifestation
greifbar: Dem Feind. Erst wenn wir einen Feind haben, der das Böse im wahrsten Sinne
verkörpert, erst dann ist es angreifbar. Dementsprechend stellt diese Untersuchung die Frage
nach der Konstruktion des Bösen und davon abgeleitet, der Konstruktion und Dekonstruktion
entsprechender Feindbilder.
Im ersten Teil der Arbeit werden die theoretischen Grundlagen als auch die Definitionen des
Bösen, dessen Genese als auch jene der Feindbilder dargelegt. Im Zweiten Teil wird die
1 Hickethier, Knut in: Werner Faulstich (Hrsg) 2008, S.228
2 Hickethier, Knut in: Werner Faulstich (Hrsg) 2008, S.229
5
Konstruktion von Feindbildern während der geistigen Landesverteidigung der Schweiz der
Nachkriegszeit untersucht. Da der Diskursstrang der geistigen Landesverteidigung über
Jahrzehnte hinweg in der einen oder anderen Art den Begriff des Bösen für die Schweizer
Gesellschaft und dessen Ausprägungen mitbestimmen soll, ist er für diese Untersuchung
unabdingbar.
Die ausgesuchten historischen Momente, an welchen die Diskurs- und Dispositivanalysen im
zweiten Teil durchgeführt werden, ziehen ihre Relevanz aus der Stärke und Sichtbarkeit der
Wechselwirkungen zwischen internationalen Geschehnissen, deren medialen Verarbeitungen
in der Schweiz und der entsprechenden Beiträge zur Konstruktion eines „Bösen“ und der
daraus folgenden Feindbilder. Die geistige Landesverteidigung wird über vier solche
historische, ideologiegeschichtliche Punkte hinweg, bis hin zu ihrer vermeintlichen Auflösung
in den frühen Neunzigerjahren untersucht werden. Diese Momente der Schweizer Geschichte
werden in chronologischer Reihenfolge sowohl einer Dispositiv- als auch Diskursanalyse mit
Bezug auf den Untersuchungsgegenstand unterzogen.
Besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Wirkung internationaler politischer Diskurse als
Dispositive für den Schweizer Diskurs: So wird etwa neben den sowjetischen
Putschversuchen in der Tschechei und Ungarn, die Überfremdungsinitiative von James
Schwarzenbach betrachtet werden. Anschließend wird der Zerfall der Sowjetunion in seiner
Wirkung auf die bis dahin untersuchten Diskursstränge hin untersucht.
Die Konstruktion eines vermeintlich Bösen in den Schweizer Medien, wird auf Basis des
Diskursstrangs „geistige Landesverteidigung“ veranschaulicht. Der Zerfall dieses
Diskursstranges und dessen Auswirkungen werden am Beispiel Kim Jong Il im zweiten
Hauptteil dargelegt. Im Zuge dieses Prozesses wird der entsprechende Diskurs im Kontext
des Dispositivs veranschaulicht und so die Definition und der Verlauf einer Konstruktion des
Bösen anhand rhetorischer Figuren über knapp Siebzig Jahre hinweg analysiert.
Nach der Herleitung einer Konstruktion des Bösen im Rahmen der jeweiligen, zuweilen sehr
stark international beeinflussten, Selbstdeutungs- Diskurse innerhalb der Schweizer
Gesellschaft, wird die Dekonstruktion eines Feindbildes betrachtet. Gegenstand der
Dekonstruktionsanalyse ist der frühere nordkoreanische Diktator: Kim Jong Il.
6
2. Theoretischer Rahmen
Die theoretische Grundlage zu dieser Arbeit bilden Michel Foucaults Arbeiten zur
Diskursanalyse und im Weiteren der Dispositivanalyse. Insbesondere seiner, im Rahmen der
Antrittsvorlesung anlässlich seiner Berufung ans Collège de France am 2. Dezember 1970,
geäußerten Überlegungen. 3
Es wird mit den von Foucault zur Verfügung gestellten analytischen Werkzeugen die
Konstruktion von Feindbildern und in deren Konsequenz die Konstruktion „des Bösen“ in den
Schweizer Medien untersucht. Der Untersuchungszeitraum wird durch den elementaren
Diskursstrang: „Geistige Landesverteidigung“ im Wesentlichen festgelegt und erstreckt sich
insofern von 1945 bis in das frühe 21. Jahrhundert. Um Übersichtlichkeit bemüht, werden im
Folgenden die wichtigsten beiden Analyseelemente „Dispositiv“ und „Diskurs“ erläutert und
jeweils an den ausgesuchten Punkten einzeln analysiert. Diese Arbeit wurde unter dem
Leitsatz: „Jeder Diskurs verläuft nach der Logik seiner Bedingungen“ verfasst, diese
Bedingungen sind jeweils durch das sog. Dispositiv beschrieben. Ausgehend von den
jeweiligen Dispositiven wird der Diskurs in seinen Bedingungskontext gesetzt, wobei die
Logik seines Verlaufs, die Beziehung zwischen Dispositiv und Diskurs ein Haupt-
Forschungsinteresse darstellt.
2.1. Diskurs
Um eine grundsätzliche Vorstellung des Diskursbegriffes zu geben, wird hier Foucaults
Definition übernommen: „Das über etwas sprechen“, umfasst laut Foucault den Begriff des
Diskurses in seiner Fülle. Michel Foucault bezieht sich hauptsächlich auf die Worte als die
Zeichen des Diskurses,4 meiner Auffassung nach können aber auch andere Formen dem
Diskursinhalt gleichermaßen Ausdruck verleihen, wie Bilder, Filme, Gewaltanwendung oder
gar Gerüche. Auch ergonomisches Wachstum oder Gruppenverhalten können als Bestandteile
eines Diskurses betrachtet werden. Die Definition muss also erweitert werden um die
eigentliche Tragweite des Foucaultschen Diskursbegriffes zu berühren. „Sprechen“ wird
demzufolge mit an sich jeder Form der Kommunikation gleichgesetzt werden. Diese
Erweiterung der Definition ist für diese Untersuchung nicht als definitorische, sondern
vielmehr als Verständniserweiterung aufzunehmen. Es ist eine Besonderheit des Bösen und
3 Foucault, 1970 , S.7 – S.49
4 Foucault, 1970 , S.10
7
des Feindes sich eben, wie wir noch verstehen werden, „nur“ in der begrifflichen Welt
abzuspielen. Aber es muss auch diese begriffliche Welt in ihrer Auswirkung und Macht
begriffen sein.
Da die mediale Wirkung auch von den genannten „nicht verbalen“ Diskurselementen,
wiederum mit verbalen Mitteln geführt wird, also im Endeffekt in eine sprachliche Form
gebracht wird und somit wieder auf Foucaults Ursprungsdefinition zurückführt, wird sich
diese Untersuchung ausschließlich mit Worten auseinandersetzen.
Anders formuliert: Da sich diese Untersuchung mit einer Analyse der Schweizer Medien
beschäftigen wird, wird sich der Diskursbegriff hier auf die mediale Kommunikation
beschränken. Es werden Bilder und Texte aus den (Deutsch-) Schweizer und in der Schweiz
konsumierten Medien untersucht, insofern stehen mediale Diskurse im Fokus der
Untersuchung. Im Weiteren wird so auf den Begriff „Diskurs“ Bezug genommen. Dass
dementsprechend ein jeweiliger Diskurs eine Vielzahl von Ebenen und Wirkungsräumen
haben kann, die sich so dem Blick dieser Untersuchung entziehen, ist bedauerlich, aber
gemessen an dem relativ großen Untersuchungsfeld kaum zu vermeiden.
Diskurse in und um das nationale Selbstverständnis sind konstant vorhanden und nehmen eine
dominante Rolle in der medialen Kommunikation während der Zeit des kalten Krieges ein.
Sie sind vorhanden solange die Schweiz als Nation existiert, verändern sich aber in ihrer
Erscheinung, Ausprägung und dementsprechend Auswirkung. Der einheitliche, geordnete
Diskurs existiert im Felde der Massenmedien gerade wegen ihrer „Massenhaftigkeit“
wahrscheinlich nicht,5es sei denn sie wären gleichgeschaltet. Die Diskurse werden gemäss
Foucault geregelt und kontrolliert von Abgrenzungsprozessen respektive
Ausschliessungsmechanismen die das „sagbare“ von dem „unsagbaren“ trennen. Diskurse
entstehen derweil im Rahmen eines spezifischen Dispositivs und wirken wiederum auf dieses
respektive das nächste Dispositiv zurück.
2.2. Dispositiv
Michel Ruoff definiert/interpretiert das Dispositiv nach Foucault als heterogene Gesamtheit,
bestehend aus Diskursen, Institutionen, architektonischen Einrichtungen, reglementierenden
Entscheidungen, Gesetzen, administrativen Massnahmen, materiellen Umständen,
wissenschaftlichen Aussagen, philosophischen, moralischen und philanthropischen
5 Behauptung nach: Foucault 1970, S.42
8
Lehrsätzen, kurz: Gesagtes ebenso wie ungesagtes sind seiner Meinung nach die Elemente des
Dispositivs. Das Dispositiv selbst ist das Netz das man zwischen diesen Elementen herstellen
kann.6
Nach dieser Definition, ist ein Dispositiv eine Gesamtheit von Institutionen, Diskursen und
(diskursiven als auch Nicht-diskursiven) Praktiken. Seine strategische Seite deutet auf seine
Verwendung im Zusammenhang von Macht und Wissen, respektive Macht/Wissen Strukturen
hin. Diese strategische Seite des Dispositivs wird für diese Untersuchung von Bedeutung sein.
Das Dispositiv verbindet Machtstrategien und Wissenstypen. Die Verbindungen und
Funktionen des Netzes „Dispositiv“ müssen nicht stabil oder in einer bestimmten Art
festgelegt sein. Die Funktionen innerhalb der Gesamtheit „Dispositiv“ können wechseln.
Beispielsweise kann das Element „Diskurs“ als „Programm einer „Institution“ oder als
Rechtfertigungsgrund einer Praktik erscheinen. Schließlich verbindet Foucault mit dem
Dispositiv noch eine weitere Auffassung, die sich als dessen integraler und übergeordneter
Zweck in einer historischen Anordnung verstehen lässt. Das Dispositiv ist nicht einfach
gegeben, sondern es entwickelt sich erst unter Vorgabe seiner Funktion. Michael Ruoff führt
folgendes Beispiel an:
Foucault illustriert diesen Gedanken anhand des Beispiels des Merkantilismus, der zu
einer verstärkten Disziplinierungsforderung gegenüber der Bevölkerung führt, die sich
nach ökonomischen Kriterien völlig unzuverlässig erwiesen hat. Dieser Impuls generiert
schliesslich unterschiedliche Dispositive für die Konstruktion/das Geschehen von Macht,
wobei die Entstehung an die Vorgabe eines Ziels gebunden ist und in diesem Punkt mit
dem strategischen Macht Typ übereinstimmt.7
2.3. Das Dispositiv im Verhältnis zum Diskurs
Zumal diese Arbeit im Kern eine Diskursanalyse anstrebt, wird hier kurz die Bedeutung des
Dispositivs für den Diskurs erläutert. Das Dispositiv stellt ein Netz aus der Summe an
Umständen her, diese Umstände erstrecken sich von administrativen Praktiken über Gesetze
jeder Art, Sprachverteilungen bis hin (wie in diesem Fall) zu geopolitischen Geschehnissen
und Gegebenheiten.
Das Dispositiv bildet also die Bedingungen nach deren „Logik“ der Diskurs verläuft. Es
besteht aus den Verbindungen seiner Elemente, dieser „Logik“ und ist insofern die
6 Ruoff, 2007, S. 392
7 Zitat aus: Ruoff, 2007, S. 392
9
augenblickliche Situation, die sich dem Diskurs stellt. Das Dispositiv ist niemals statisch,
gerade weil es aus einer richtiggehenden Masse an variablen Faktoren konstruiert ist.
2.4. Dispositiv -Analyse
Dispositive bilden so den (mehrdimensionalen) Rahmen, in welchem der Diskurs als Element
desselben stattfindet. Für diese Untersuchung ist es vornehmlich relevant, wie „Macht-
Wissen“ Positionen generiert werden. Nicht unbedingt individuelle, akteursbezogene Macht,
sondern „Diskursmacht“, die Macht den Diskurs zu regeln und gewisse Machtpositionen
erfolgreich zu beanspruchen. „Diskursmacht“ bestimmt, wer inwiefern ermächtigt ist den
Diskurs in eine Richtung zu lenken, also insofern die Ausschliessungsmechanismen
kurzweilig nahezu „befehligt“ oder zumindest in einem strategischen Sinne Nutzen kann.
Das Dispositiv ist weitgehend ausschlaggebend für die Möglichkeit des Machterhalts, resp.
der „Ermächtigung“ für einzelne Aussagen und damit verbundenen Positionen innerhalb des
Diskurses. Gemäß Jäger:
„Diese Voraussetzungen, der Macht-Dispositive – und das macht ihre Bedeutung aus –
konstruieren durch ihre kulturell integrative Funktion soziokulturelle Gegenstände,
‚Themen’ und Problematiken. Sie definieren Subjektpositionen und Kompetenzen, sie
konstruieren Wahrnehmungsweisen und Handlungsoptionen innerhalb des von ihnen
begrenzten Feldes.“8
Dispositive zeichnen sich mitunter dadurch aus, dass sie durch eine Verkopplung von nicht-
diskursiven und diskursiven Elementen „Machtbündel“ ermöglichen, die wiederum innerhalb
eines bestimmten, begrenzten Feldes Subjektivitäten und deren (Macht-)Fähigkeiten
bestimmen.9
In dieser Untersuchung werden die internationalen politischen Bedingungen dementsprechend
nicht als nichtdiskursiv, sondern als Teil des Dispositivs verstanden. Weil sie in der Schweiz
Diskursmacht begünstigen, respektive entziehen. Zur Darstellung dieses Prozesses werden die
historischen Punkte der Schweizer Geschichte so ausgewählt, dass diese Wechselwirkung
offensichtlich wird.
Das Dispositiv bildet den „Rahmen“ um den Diskurs. Dieser Rahmen wirkt auf den Diskurs
mitunter durch die Abgrenzungslinien, die Unterscheidungen zwischen „Sagbarem“ und
8 Zitiert aus: Jäger/Jäger, 2000
9 Gem. Jäger/Jäger,2000
10
„Unsagbarem“, „Wahrem und Falschem“ oder eben umfassend „Gutem und Bösem“
herstellen.
Der Diskurs kann also nur in dem spezifischen Dispositiv seine spezifische Form und Macht
erhalten, in einem beliebigen anderen Dispositiv, würde er eine entsprechend andere Gestalt
annehmen und dementsprechend andere Wirkungen zu Tage fördern. Der Diskurs wirkt auf
das (nächste) Dispositiv indem er dessen Grenzen zu verschieben vermag. Je nachdem wie
der Diskurs verläuft vermag er neue „Sagbarkeiten“ und „Unsagbarkeiten“ zu produzieren
respektive die Abgrenzungslinien die diese umgeben zu verschieben. Um ein Beispiel aus der
Popkultur zu nennen: Darth Vader war Jahrzehnte lang der „Böse“ der Star Wars Trilogie, bis
die „neuen“ drei Filme erschienen, welche seine Vorgeschichte erzählen und Darth Vader so
zum tragischen Helden der Filmreihe erhoben.
Das Dispositiv zu Beginn der „Episode 4“ ist also nach Erscheinen der neuen Filme ein ganz
anderes als 1979, als „Episode 4“ in der Form von „Star Wars 1“ erschien. Somit ist auch der
Diskurs, der dann beim (im und unter den) Betrachter(n) stattfindet, um Anakin Skywalker
(Darth Vader) ein ganz anderer. Dieses vielleicht etwas gewagte Beispiel illustriert die Macht
des Dispositivs deshalb sehr schön da sich die „alten“ drei Filme ja inhaltlich kaum verändert
haben aber komplett neu kontextualisiert sind.
Diese Untersuchung beschäftigt sich mit einem relativ weiten historischen Horizont von
knapp Sechzig Jahren. Dieser Zeitraum ist bewusst so weit gewählt, da es beim
Untersuchungsgegenstand um einen Diskurs (oder eine inhaltlich/thematisch
zusammengehörige Summe an Diskursen) handelt, der sich über diese Zeit hinweg entwickelt
hat und gerade diese Entwicklung der Konstruktion, steht im Fokus der Analyse. Um eine
Repräsentation herstellen zu können wird daher der Untersuchungsgegenstand an einigen
relevanten Punkten betrachtet werden, welche sich wiederum an diskursbezogenen medialen
Ereignissen orientieren. Anders formuliert; werden Veränderungen im Dispositiv untersucht,
die wiederum den Diskurs in eine der Untersuchung ausgesetzte Richtung lenken.
Das Dispositiv selbst unterliegt mitunter dem Einfluss, der durch (vorläufige) Diskurse
gewirkt wurde. So fand beispielsweise der Diskurs um die Drogenszene in Zürich während
der Neunzigerjahre innerhalb des Dispositivs einer offenen Drogenszene statt. Die
Auswirkung des Diskurses veränderte das nächste Dispositiv insofern, dass Methadon-
Abgabestellen entstanden und so der Diskurs um die Drogenszene im neuen Jahrhundert aus
einem Dispositiv ohne offene Drogenszene am Platzspitz stattfindet.
11
Im untersuchten Fall der Genese und Transformation eines medialen Feindbildes in der
Schweiz wird ein an den relevanten Punkten ein spezifisches Dispositiv, welches für die
entsprechenden Diskurse rund um das Schweizer Selbst- und Feindbild besteht, untersucht.
Als relevant qualifizieren sich jene historischen Punkte, in und an welchen diese
Abgrenzungsmechanismen als auch die Konstruktionsprozesse des Feindes ersichtlich
werden, also sich und ihre Auswirkungen zeigen. Die ausgesuchten historischen Momente,
an welchen die Diskurs- und Dispositivanalysen durchgeführt werden, qualifizieren sich
durch die Stärke und Sichtbarkeit der Wechselwirkungen zwischen internationalen
Geschehnissen, deren medialen Verarbeitungen in der Schweiz und der entsprechenden
Konstruktion eines „Bösen“ und daraus folgender entsprechender Feindbilder. Die Beziehung
zu internationalen Geschehnissen, die ihren Weg in den Schweizer Diskurs vornehmlich über
die Medien finden, ist als Kriterium von Bedeutung, da diese Informationsflussstruktur eine
Konstante der Untersuchung sein wird um die Logik einer Konstruktion des Bösen im
Hinblick auf die angestrebte Dekonstruktion aufzuzeigen.
Folglich werden historische „Orte“ (der Begriff soll Zeitpunkte und Ebenen einschließen)
ausgewählt, die eben dieses „Böse“ oder entsprechend „den Feind“ zeigen. Theoretisch wären
auch andere Punkte geeignet diese Konstruktionsweise des Bösen zu demonstrieren, da das
Endziel der betriebenen Analyse sich jedoch in der Untersuchung der Dekonstruktion des
Feindbildes Kim Jong Il findet, ist es vonnöten die Basis dieses spezifischen Feindbildes zu
analysieren. Kim Jong Il ist einer der letzten „stalinistischen“ Herrscher, der die Welt
(teilweise und sporadisch) mit Atomraketen bedrohte. Ähnlich wie sein Vater vor und sein
Sohn nach ihm.
Bei der Auswahl der Zeitpunkte werden daher Diskurse ausgesucht die den heutigen Diskurs
bezüglich Kim Jong Il respektive den Diskurs um das Feindbild vor oder über Kim Jong Il
betreffen. Kim Jong Il ist in der Schweiz nur über die Medien präsent, also muss der Diskurs
dort wo er stattfindet, in den Medien, untersucht werden. Kim Jong Il befindet sich in seiner
Funktion als erklärt „kommunistischer“ Diktator, in einem spezifischen Kontext: Dem (post-)
sowjetischen Kommunismus, also werden die Berichte und Diskurse um den Kommunismus
in der Schweiz untersucht werden müssen. Es werden aus denselben Gründen die dem
spezifischen Feindbild entsprechenden, gesellschaftlichen Abgrenzungslinien identifiziert
werden.
12
Da Kim Jong Il keine direkte Bedrohung respektive keinen direkten Bezug zur Schweiz hat,
ist der Diskurs in der Schweiz einem globalen insofern unterworfen, als dass dieser mit
dispositivem Charakter auf den Schweizer Diskurs wirkt. In dieser Beziehung ist er mit dem
Diskursstrang der geistigen Landesverteidigung vergleichbar.
Es werden in einem ersten Schritt die Bedingungen und die Mechanik einer, wenn man so
will „politischen“ und durch den globalen Diskurs bedingte Feindbildkonstruktion, wie sie im
Falle Kim Jong Ils erfolgt, untersucht, dort wo sie zu finden sind.
Die ersten beiden untersuchten Punkte zeigen diese Wechselwirkung in sehr direkter Variante
auf: Die Aufstände in Tschechien und Ungarn. Tschechien bietet sich unter anderem an, da
die Rhetorik des Bösen an diesem Punkt Eingang in den Diskurs fand. Weiter wird durch die
mediale Verarbeitung des Tschechien- als auch den Ungarnaufstands das Bild der
„Unterworfenen“ gezeichnet, mit welchem sich die Schweizer auch Jahrzehnte später im
Kontext des Putsches gegen Gorbatschow solidarisieren sollen, nachdem sie sich
Jahrzehntelang selbst in dieser Rolle wähnten.
Diese Solidarisierung ist eine relevante Reaktion, die als Indiz der ideologischen
Zugehörigkeit in jeder der drei untersuchten Putschsituationen dient. Besonders interessant
wird sich dieses Indiz als historisch jüngste Situation von den dreien ausnehmen: Dem
Putschversuch gegen Gorbatschow. An diesem Punkt wird gezeigt werden können, wie die
Solidarisierung zum Träger der Abspaltung vom Feindbild und dessen Ausprägungen wird.
Die Untersuchung der Überfremdungsinitiative qualifiziert sich durch die Rückbezugnahme
auf den Diskursstrang, welcher um die Geschehnisse in Tschechien und Ungarn entstanden
war. Insofern ist die Schwarzenbach-Initiative die Kehrseite derselben Medaille. Es werden
dieselben, auf der geistigen Landesverteidigung basierenden, Macht/wissen Strukturen
aktiviert, nur ist das den Diskurs um das Böse rahmende Dispositiv neu „inländisch“. Dieser
Transformation wird allerdings Rechnung getragen werden.
Das Dispositiv definiert die „Sagbarkeit“ insofern die Bahnen, in denen der Diskurs um die
Definition des Selbst und entsprechend des Feindes verläuft. Das Dispositiv um das
„Schweizerische Selbst“ liefert Grenzen der Zugehörigkeit an ein „geistiges Selbst“ der
Schweizer Bevölkerung resp. Gesellschaft. Auch aus diesem Grund wird die geistige
Landesverteidigung in ihrer Transformation und Zugehörigkeit (im Sinne der Beanspruchung
durch Akteure oder Bewegungen) bei jedem der untersuchten Punkte relevant sein. Die
13
„Nichtzugehörigkeit“ ist, anbei bemerkt, von notwendigem definitorischem Charakter für das
„Böse“.
Das Dispositiv umrahmt Situationen oder vielmehr ist es selbst die gewachsene, durch den
Diskursverlauf, Geschichte und aktuelle Geschehnisse konstruierte Situation, aus welcher
heraus Machtkonstruktionen stattfinden können, respektive generiert werden.
Das jeweilige Dispositiv wird also bei jedem der untersuchten historischen Momente in erster
Instanz analysiert, um seine begünstigende Wirkung für Machtkonstruktionen eines gewissen
Diskurses verstehen zu können. Die Vorgehensweise wird sich ferner an dem folgenden, von
Margarete und Siegfried Jäger aufgestellten, Postulat orientieren:
“Wenn die Analyse die Elemente des Dispositivs berücksichtigen soll, dann heißt dies,
dass Beschreibung und Bewertung der Sichtbarkeiten (oder Institutionen) und Praktiken
in die Analyse einfließen müssen. Schließlich soll gerade das Netz, die Logik der
Wirkung auf den Diskursverlauf erfasst werden, es sollen die jeweiligen Beziehungen
und Funktionen der Elemente zueinander in einem untersuchten historischen Moment
ermittelt werden.
Diese Vorgehensweise soll Auskunft auf die Frage generieren, wie dieses Dispositiv
reproduziert, verändert oder eben nicht mehr reproduziert wird, und dementsprechend mit
welchen Eigenheiten es ausgestattet ist.“10
2.5. Diskursanalyse
Es müssen die wichtigsten Diskurse des Untersuchungszusammenhangs analysiert werden.
Sie geben Aufschluss darüber, ob und wie diese Verflechtungen von Diskurssträngen und -
ebenen Teil des Diskurses um das „Schweizerische Selbstverständnis“ und der Konstruktion
von Feindbildern sind.
In einem weiteren Schritt werden die durch diese Analyse ermittelten, wichtigsten Praktiken
und Sichtbarkeiten des Dispositivs rekonstruiert. Diese Rekonstruktion erschliesst sich aus der
Analyse der relevanten Diskurse. Eine Erfassung der gesamten vielfältigen Praktiken und
Sichtbarkeiten ist nicht nur undurchführbar, sondern wäre auch falsch.
3. Vorgehen
Es wurde eine heuristische Vorgehensweise gewählt, anhand medialer Stoffe aus
diskursmächtigen Kanälen der jeweiligen Zeitpunkte, wird ein thematisches, aufgrund der
10
Zitiert aus: Jäger / Jäger, 2000
14
verwendeten rhetorischen Figuren und diskursiven Positionen ausgewähltes Sample
entnommen. Es wurde dabei auf Stoffe fokussiert, welche sich vornehmlich mit dem
Kommunismus und der Beschreibung kommunistischer Staaten, Führer oder Völker
beschäftigten und einen sichtbaren Effekt auf den Schweizer Diskurs beschrieben oder einem
solchen entsprechen. Begrifflich wurde nach rhetorischen Formen gesucht, die das „Böse“
oder den Feind bezeichnen oder behandeln, verarbeiten, deklarieren, sowie nach Orten und
Momenten der ausnehmenden diskursiven Reaktion auf die postulierten Dispositive;
vornehmlich in Form von Abgrenzung und Verdammung.
Diese Auswahl wurde mit Blick auf die Genese eines antizipierten Feindbildes Kim Jong Il
getroffen. Es wurde bereits im Vorfeld aufgrund der Lektüre der Schweizer Geschichte, der
Hinterfragung einiger Institutionen (wie beispielsweise dem Réduit oder der P27) eine
gewisse Charakteristika des (politischen) Bösen vermutet, die dann in die Auswahl
eingeflossen ist. Kim Jong Il ist eine politische Figur, die gerne in einem Atemzug mit den
„Feinden“ der westlichen Gesellschaft genannt und bezeichnet wird. Die Schweiz versteht
sich, wie hergeleitet werden wird, als Teil der westlichen Gesellschaft.
Natürlich hatte diese Auswahl in ihren ersten Gehversuchen einen gewissen post ex facto
Charakter: Es wurden politische Medienberichte ausgewählt, weil sich das Feindbild Kim
Jong Il mitunter durch seine politisch-ideologische Abgrenzung zur heutigen und wohl auch
damaligen Schweiz hervortut und sich der Diskurs um Kim in einer medialen Sphäre abspielt
die eben als „global-politisch“ bezeichnet werden kann. Es wurde ferner nach Institutionen
und Zeitzeugnissen gesucht, die eben eine Basis vermuten lassen oder Verständnisbeiträge
liefern, für das was die Schweizer Gesellschaft auch heute noch als Feind betrachtet. Auch
befindet sich die Schweiz nicht in einer isolierten Seifenblase, sondern ist eben Teil einer
Welt, die wiederum (wie dargelegt werden wird) Teil der Schweiz ist. Von der Mode über die
Popkultur bis hin zur politischen, wirtschaftlichen und im Endeffekt normativen
Positionierung ist die Schweiz beeinflusst durch eine stetig (zumindest diskursiv) enger
zusammenrückende Welt.
Diejenigen Medienberichte, die sich auf Geschehnisse im “Ausland“ beziehen, wurden
aufgrund ihres für die Untersuchung des Diskurses um das Selbst- und Feindbild der Schweiz
interessanten „Dispositiven Charakters“ ausgewählt. Im konkreten Fall handelt es sich um
jene Medienberichte, die globalpolitisches Geschehen um den ideologischen West-Ost
Antagonismus multiplizieren, in die Schweizer Gesellschaft einarbeiten oder umreißen.
15
Wie erwähnt, wird an jedem untersuchten historischen Punkt erst das relevante Dispositiv
analysiert und in einem Folgeschritt der jeweilig relevante Diskurs. Diese Einschränkung ist
notwendig, da das umfassende Dispositiv aus einer schier unendlichen Anzahl an Facetten
konstruiert ist. Insofern wird eine Schwierigkeit darin bestehen, das Dispositiv von dem
spezifischen Diskurs abzugrenzen, zumal die internationalen politischen Geschehnisse
beispielsweise als Teil des Dispositivs begriffen werden, allerdings gleich dem Diskurs
medial kommuniziert werden. Sie spielen sich also zumindest in der Wirkung auf den
untersuchten Raum in der diskursiven Ebene ab, sind gleichzeitig dem untersuchten Diskurs
aber in keiner Weise unterworfen und haben in diesem Sinne „rein“ dispositiven Charakter.
Spezialfälle, wenn man so will, bilden Momente in welchen die Schweiz als Staat Teil des
globalpolitischen Diskurses wird.
So ist die Überwachung des Friedensprozesses in Nordkorea theoretisch eine solche Situation.
Allerdings würden sich auch in einem solchen Fall (entsprechend der vorliegenden
Interpretation) Dispositiv und Diskurs erst überschneiden, wenn beispielsweise diese
Friedensmission aufgrund globalpolitischer Geschehnisse Gegenstand des Diskurses in der
Schweiz würde. Mit anderen Worten, wenn man im Nationalrat den Abzug der
Friedensmission aufgrund nordkoreanischer Truppenmobilisierung fordern würde. In einem
solchen Szenario würden Bestandteile des untersuchten Diskurses, Teil des für die
Untersuchung relevanten Dispositivs. Würde der Schweizerische Diskurs etwa zu einem
effektiven Abzug der Friedenstruppen führen, was wiederum eine Eskalation begünstigen
würde, was wiederum dazu führen würde, dass sich das Dispositiv von „angespannte
globalpolitische Situation“ zu „eskalierte politische Situation“ veränderte. Das ist natürlich
rein hypothetisch gesprochen und nur herangezogen zur Illustration. Es befinden sich
übrigens immer noch Schweizer Truppen an der Nord-/Südkoreanischen Grenze und eskaliert
ist die Situation trotz Sechzig Jahren Säbelrasseln immer noch nicht.
Ein drohender Krieg zwischen Kuba und Amerika etwa, ist ein Diskursgegenstand in der
Schweiz, aber gleichzeitig Teil des Dispositivs, da der schweizerische Diskurs im Sinne der
theoretischen Struktur der Untersuchung post ex facto darauf reagiert. Zudem ist die
Kubakrise an und für sich ein Diskurs der sich zwischen den beteiligten Akteuren und
Institutionen in einem spezifischen Dispositiv abspielt, aber für die mediale Verarbeitung in
der Schweiz sind diese Diskurse Teil des Dispositivs.
16
Die zentralen Aspekte der diskursanalytischen Betrachtungsweise werden durch folgende
Fragen aufgegriffen:
Akteure: Wer agiert mit welchem Anspruch, wie werden Akteure aggregiert. Wie verändern
sich diese Interessen?
Wen ermächtigt der Diskurs?
Wen schließt der Diskurs aus?
Wer besitzt, weshalb Diskursmacht?
Aus der punktuellen Beantwortung dieser Fragen wird die Konstruktion von „Selbst“, dem
„Bösen“ und dementsprechend „des Feindes“ in der Schweizer Gesellschaft nachgezeichnet
werden.
4. Definitionen des Bösen
Die Konstruktion des Bösen verlangt nach einem Begriff des Bösen, einer grundsätzlichen
Entstehungsstruktur und einer Definition.
Zu eben dieser Definition und theoretischen Genese des Bösen insbesondere des kollektiv
getragenen Feindbildes werden mitunter die Arbeiten von Simone Wagener herangezogen.
Sie beschreibt die Geburt der Feindschaft als von einer Art „Schwarzmagischem Charakter“:
„Es ist eine Art schwarzer Magie, wenn ein Begriff, der einen Traditionsverein
bezeichnet, dazu verwendet wird, eine Personengruppe zu stigmatisieren, die mit der
Entstehung dieser Feindschaft nicht das Geringste zu tun hat. Da dieses Feindbild nicht
nur dazu dient, den – scheinbaren – Feind zu bezeichnen, sondern vor allem, seine
Verfolgung zu legitimieren, muss es eine Eigenschaft aufweisen, die das Gewissen des
Täters entlastet: Die Identifizierung des Fremden mit dem Bösen.
(..) Er (Der Feind) ist von mir ausgegrenzt, ausserhalb meiner Normen und jenen meiner
Gesellschaft. Die Tatsache, dass ich das böse in ihm bekämpfe, beweist, dass ich keinen
Teil daran habe.“ 11
Was Wagener hier als schwarze Magie bezeichnet, ist mitunter Gegenstand dieser Untersuchung.
Um etwas vorzugreifen: Es bedarf keiner Hexen und schwarzer Katzen, um „Böses“ zu
konstruieren, obwohl sie, wie die heilige Inquisition bewiesen hat, dabei hilfreich sein können. Die
Genese des Bösen ist ein diskursiver Prozess, der als solcher, vor einem bestimmten Dispositiv,
bestimmte Diskurse und innerhalb dieser Diskurse verschiedene „Machtpositionen“ zu Tage
11
Zitiert aus: Wagener, 1999, Seite 35
17
fördert, die „das Böse“ für eine Gesellschaft bestimmen. Aufgrund „des Bösen“, lassen sich erst die
Feinde bestimmen.
In vorliegender Arbeit wird die Konstruktion des Bösen in den Medien untersucht. Die Medien, die
mit andauernd wachsender Reichweite dazu dienen „Orientierungen über Kultur, Gesellschaft - die
Welt insgesamt zu vermitteln“12
, sind dazu besonders geeignet. Da das Böse sich in der Welt der
Begrifflichkeit findet und nicht in der materiellen, wie dargelegt wird, durchaus eine
„Materialisierung“ zu einem Feindbild durchaus stattfindet.
Die Untersuchung findet also in einem Bereich der begrifflichen Konstruktion statt und nicht im
Bereich der materiellen. Also würde auch ein real existierender Ressourcenkampf beispielsweise
nicht auf seine ideologische Ausrichtung hin betrachtet, auch wenn dieser Kampf einen zumindest
zeitweiligen „Feind“ oder wohl eher „Rivalen“ mit sich bringen dürfte.
4.1. Keine Verteidigung ohne Feinde
Die geistige Landesverteidigung bietet sich für eine solche Untersuchung an, zumal sie eine
Kategorie ist, auf deren Existenz und Berechtigung die Schweizer Gesellschaft weitgehend einigte,
w.h. sie war ein politisches, intellektuelles und gesellschaftliches Programm, das sich eben
weitgehend im Geiste abspielte und dann auf die Lebenswelt auswirkte.
Das Grundprinzip der geistigen Landesverteidigung war es, sich (als Schweizer und in dessen
Konsequenz als Schweizer Gesellschaft) ideologisch zu definieren oder, je nach Auslegung, diese
Ideologie, die Schweizer Eigenheit zu erhalten. Die antizipierte Notwendigkeit dazu entsprang
einem neuartigen Weltpolitischen Dispositiv, welches durch seine bipolare Konstruktion eine
ideologische Positionierung nach außen und dementsprechend auch nach innen forderte. Die
geistige Landesverteidigung war sowohl institutionell getragen als auch von diversen
gesellschaftlichen Gruppen multipliziert.
Der Diskursstrang veränderte sich im Verlauf der letzten 70 Jahre stark. So wird die geistige
Landesverteidigung zu Beginn sehr breit getragen, mit der „Verengung“13
derselben, entsteht eine
zunehmend schärfere Charakterisierung des Bösen und dementsprechend des Feindbildes. Diese
„Verengung“ der geistigen Landesverteidigung folgte aus der Vereinnahmung durch konservative,
bürgerliche Kreise, die sich gegen jegliche Form progressiver Haltungen zu wehren begannen.
12
Zitat aus: Hickethier, 2008, in: Faulstich (Hrsg.),S.228
13 Gem. Mäusli 1995, S.35
18
Diese Protagonisten und Träger der (späten) geistigen Landesverteidigung griffen für ihre
Weltbildkonstruktion im Wesentlichen auf Werte zurück, die sie als althergebracht und urtümlich
ausflaggten: In konstanter Rückbezogenheit auf die Ursprünglichkeit der Schweiz, eine
Idealisierung des Bauernstandes, volkstümlicher Kunst und Musik und die entsprechenden Normen.
Die Feindbildkonstruktion, wie sie in der späten geistigen Landesverteidigung auftrat, weist also
gewisse fundamentalistische Grundzüge auf. Dementsprechend wird hier der Beschreib
fundamentalistischer Strukturen und ihrem Verhältnis zum Bösen von Carola Meier-Seethaler
herangezogen:
„Bis heute besteht das Wesen und die Tragik des Fundamentalismus jeglicher Provenienz
im Versuch, was moralisch Böse zu substantialisieren oder auf eine bestimmte
Personengruppe zu projizieren. Nur so kann von einer roten Gefahr oder einer Achse des
Bösen die Rede sein. Es werden bestimmte Religionen, Kulturen oder
Gesellschaftssysteme im Kontrast zu der eigenen, althergebrachten, negativ stigmatisiert.
Dabei scheint die trügerische Überzeugung, das schlechthin Gute zu vertreten, ein
Feindbild dringend zu benötigen, um den Kampf des Guten gegen das Böse
aufrechtzuerhalten.“ 14
Diese Definition ist auf den Diskurs um die Selbstfindung der Schweiz des späten kalten
Krieges durchaus anwendbar. Eine Rhetorik des Guten gegen das Böse fand schon innerhalb
der ersten drei Jahre der Nachkriegszeit Eingang in den Diskurs um das Schweizer Selbstbild.
Um sich in ein derart dichotomes Weltbild, wie es sich durch die globalpolitischen
Geschehnisse herauszukristallisieren begann, einzugliedern ist die Festlegung auf ein Böses
offenbar unabdingbar, zumal das Böse ein notwendiger Baustein für die Konstruktion
spezifischer Selbst- als auch Feindbilder darstellt. Ohne einen Feind, so scheint es, weiss ich
nicht wer oder was ich selbst zu sein habe. Ob diese Konstruktionsweise eine nur dem
Fundamentalismus zuzuordnende ist, sei dahingestellt, es ist für die Untersuchung auch nicht
nötig den fundamentalistischen Charakter der späten geistigen Landesverteidigung zu
beweisen. Doch ist die Wechselwirkung zwischen einem eigenem, bekannten „Guten“ und
dem fremden „Bösen“ durchaus wichtig, zumal sich daraus die Wechselwirkung zwischen
Selbst- und Feindbild abzeichnet.
Der von Meier-Seethaler postulierte Zusammenhang zwischen einer fundamentalistischen
Haltung (die im Kontext der geistigen Landesverteidigung einer gemäss Theo Mäusli
„engeren“ Auffassung derselben durchaus entspricht), die sich durch Enge und
Rückbezogenheit kennzeichnet und derweil ebenfalls ein engeres, stärkeres Feindbild
14
Zitiert aus: Meier-Seethaler, 2008, In: Faulstich (Hrsg.), S.48
19
konstruiert, wird im Kontext der späten geistigen Landesverteidigung zu beobachten sein und
veranschaulicht den Prozess der Feindbildkonstruktion dankbar.
Dieser Prozess der Feindkonstruktion versteckt sich bereits hinter dem Begriff der
„Verteidigung“ an sich. „Verteidigung“ impliziert die Abwehr gegen einen Feind, die geistige
Landesverteidigung ist also mit ihrem Entstehen gleich die verlangende Basis für die
Konstruktion eines neuen Bösen. Mit anderen Worten die geistige Landesverteidigung kann
nicht ohne Feindbild existieren. Keine Verteidigung kann das.
Es ist das Wesen jeder Verteidigung, dass sie nachdem der urtümliche Feind, gegen den sie
in ihrer Ursprungsform gerichtet ist, besiegt oder verschwunden ist, als „Verteidigung“
entweder obsolet (wie mittelalterliche Stadtmauern) oder mit einem neuen „Bösen/Feind“
betraut wird, gegen das es sich zu verteidigen gilt. Dieses „Böse“ wird sich in einer weiteren
Entwicklung in konkreten Feindbildern äussern und ist so die Grundlage derselben.
4.2. Das Böse, Recht und Gewalt
Im Folgenden wird die Konstruktion von Feinbildern auf Basis des Bösen hergeleitet. Es wird
das Böse definiert und sein Verhältnis zu Feindbildern und den daraus folgenden
Konsequenzen dargelegt. Wagener nähert sich dem Thema des Bösen über den Versuch einer
Erklärung kollektiver Gewaltanwendung:
„Wenn wir nach den Ursachen von kollektiver Gewaltanwendung fragen, ob Kriege oder
Gruppenterror, stossen wir regelmässig auf das Phänomen Feindbild. Eine Nation, eine
Gruppe verständigt sich darauf, in einer anderen Nation, einer anderen Gruppe von
Menschen den Feind zu sehen. Ein solches Feindbild - der Begriff entstand übrigens erst
in den achtziger Jahren, obwohl das Phänomen so alt ist wie die Menschheit - ist ein
bisher kaum untersuchtes kollektives Phantasma ,,ein wahnhaftes Gruppen-Vorurteil, das
in seiner Substanz keinen anderen Zweck hat, als aggressive (physisch oder psychische)
Handlungen zu rechtfertigen.“15
Nach Wagener handelt es sich also bei einem Feindbild vornehmlich um eine Kategorie die
eine daraus folgende Handlung rechtfertigt. Eine Legtitimationsstruktur, die den Mörder von
dem tapferen Soldaten oder dem texanischen Staatsanwalt zu unterscheiden vermag.
Besonders relevant für diese Untersuchung ist der Umstand, dass Feindbilder sich gemäss
Wagener nur in der Sprache ausdrücken, also wie einleitend betont keine Kategorie, Wesen
15
Zitat aus: Wagener, 1999, Seite 20
20
oder Gegenstände von Natur aus sind. Es ist nicht jeder Wolf ein böser Wolf sondern nur
derjenige der das Dorf bedroht. Ganz ähnlich ist die Bezeichnung des Feindes auf den
Menschen anzuwenden: Nur derjenige Mensch der dem Bösen entspricht, es verkörpert, ist
ein Feind. „Feind“ zu sein ist also ein Titel, eine Bezeichnung und demzufolge eine
Begriffliche Kategorie. 16
4.3. Feind oder Rivale
Sehr wichtig bei dieser Betrachtung ist die Trennung von Feind, Rivalen/Kontrahent und
Kampf zumal die Situation des Kampfes allein den Feind noch nicht definiert. Nehmen wir
nach Wagener an, zwei Bewaffnete treffen zufällig aufeinander und wollen sich nicht aus dem
Weg gehen, sondern beginnen zu kämpfen.
““In einem solchen Szenario wird ein Feindbild nur insofern wirksam, als derjenige, der
einem ans Leben will, in diesem Moment der Todfeind ist.““17
Er ist der momentane Todfeind, weil er eben den anderen töten möchte, aus welchen Gründen
auch immer. Doch sind es eben diese Gründe die den „bösen Feind“ vom an sich „neutralen
Rivalen“ unterscheiden. In einem Fall von schierer Rivalität erübrigt sich eine ideologische
oder überhaupt abstrakte Konstruktion, da dieser Feind „nur“ eine augenblickliche physische
Lebensbedrohung ist, gleich einer natürlichen Lebensbedrohung, die sich ausschliesslich
konkret, in der materiellen Realität abspielt. Beide Bewaffneten kämpfen also um ihr Leben,
gleich wie sie gegen eine Lawine ankämpfen würden, nicht um die Lawine zu besiegen,
sondern um ihr eigenes Leben zu retten.
Diese Situation ist allerdings noch kein Kampf gegen „das Böse“. Es wird nicht um Ideologie
sondern vielleicht um Gegenstände oder Wegrechte gekämpft. Der Feind als abstrakte
Konstruktion „Feindbild“ ist aber eben das: Ein Bild, eine Vorstellung, eine Konstruktion.
Das Feindbild ist so weitaus komplexer als die schiere Bedrohung für Leib und Leben. Es
wird auf anderen Ebenen und im Wesentlichen aus anderen Gründen bekämpft und aus diesen
„anderen“ Gründen bezieht die Vernichtung des Feindes auch seine Legitimität. Nicht weil er
meiner Physis oder Ansprüchen an den Hals will, sondern weil das wofür er steht mit dem
wofür ich stehe unvereinbar ist und deshalb ausgelöscht werden soll und zuweilen auch darf.
16
Gem. Wagener, 1999, S.20
17 Zitat aus: Wagener, 1999, S.20
21
Es handelt sich also bei dieser Beispielsituation um eine „situative Feindschaft aus
„Notwendigkeit“. 18
Wagener unterscheidet das Feindbild von dem beschriebenen Zustand durch seine
Eigenschaft:
„“(..) der stufenweisen Vorbereitung zum Handeln (dienend). Zum einen soll es als ein
Albträume hervorrufendes Phantom die Ruhe der Bürger stören. Zum anderen ist es eine
Wegfanfare, ein Angriffssignal, eine Lizenz zum Töten.““
““Der Kampf, die Auseinandersetzung an und für sich bildet also nicht die Grundlage für
ein Feindbild. Zu Feindbildern werden Menschen gemacht, die eine Position vertreten,
welche als Böse identifiziert wurde, anders formuliert ist mein Feind jener der das
Gegenteil meiner Auffassungen des Guten vertritt.““19
Aus diesem Beziehungsgeflecht heraus, wird die „feindgenerierende“ Rolle des Schweizer
Selbstverständnisses via geistige Landesverteidigung untersucht. Gerade die Feindbild
generierende Funktion der geistigen Landesverteidigung ist wiederkennbar in Wageners
Beschreibung des Fremden in seiner Beziehung zum Feind:
„Ein Feindbild setzt Distanz und Anonymität der Begegnung voraus, es ist eine
Begleiterscheinung kollektiver, nicht privater Feindschaft. Diese Untersuchung handelt
von einem sprachlichen Phänomen, um einen durch Übereinkunft entstandenen Begriff
mit relativ harten Rändern, ähnlich dem Stereotyp, aber vielschichtiger, mit tiefen
etymologischen Wurzeln und Jahrtausendringen variierender Bedeutung, zuweilen
aufladbar mit tödlicher Aggression. Jederzeit können diffuse Ressentiments und
gestaltlose Ängste ein "ruhendes" kaum mehr gebrauchtes Feindbild aktivieren.“20
Ein Prozess, den die Überfremdungsinitiative illustrieren wird. So Wagener weiter:
„„Die Verflechtung eines Feindbildes mit der Wirklichkeit ist unterschiedlich dicht; einen
Kern historischer Erfahrung enthält es immer. In das Barbarenbild der Griechen floss die
Begegnung mit den Persern ein. Selbst auf dem Grund der Antichrist-Projektion findet
sich die Erinnerung an die iranischen Herrscher des Altertums.““21
Der Erinnerung an die persischen Herrscher ist, am Rande bemerkt, auch in der
gegenwärtigen weltpolitischen Lage eine gewisse Aktualität nur schwer abzusprechen.
Entscheidend für diese Untersuchung ist nicht unbedingt die die Kulturen historisch
übergreifende Erinnerung, so mag unsere Kultur zu großen Teilen auf jener der alten
Griechen basieren, doch wird im Zuge dieser Untersuchung, die Erinnerung, die
18
Wagener, 1999, S.21
19 Zitat aus: Wagener, 1999, S.35
20 Zitat aus: Wagener, 1999, S.21
21 Zitat aus: Wagener 1999, S.21
22
Reaktivierung über weitaus kürzere Zeiträume festgestellt und analysiert werden. Kurzum;
dieselbe Kultur vermag sich mindestens so gut an sich selbst zu erinnern wie an vergangene
Kulturen.
Diese Prozesse des Erinnerns werden besonders nach dem Ende des zweiten Weltkrieges und
später im Kontext des Zusammenbruchs der Sowjetunion ersichtlich.
Wie im Verlauf der Untersuchung aufgezeigt wird, sind diese konkreten Ausprägungen ohne
weiteres von der abstrakten Größe „Feindbild“ trennbar. Der Putsch gegen Gorbatschow
illustriert diesen Prozess. Begründeter Weise wird sich an jenem Punkt die Trennung
zwischen „den Russen“ und dem „Feindbild“ „Sowjets“ vollziehen. Ganz besonders
augenscheinlich wird dieser Vorgang am Beispiel der Roten Armee, die bis zu jenem
Zeitpunkt konkreteste Form „kommunistischer Bedrohung“, die durch Berichte von
desertierenden Soldaten, ganz ähnlich dem russischen Volk, zwar als Feindbild bestehen
bleibt, aber von ihren „menschlichen Ausprägungen“ getrennt wird. Also sobald der Soldat
desertiert, sich so unter Inkaufnahme einiger persönlicher Risiken von der Roten Armee
abgrenzt, ist er kein Feind mehr, sondern fast ein Verbündeter im Kampf gegen das Feindbild
„Rote Armee“, da er mindestens in gleichem Ausmaß Bedrohung von diesem Feindbild
erfährt, wie es die Schweizer Bevölkerung tut.
“Abgelöst von seinem konkreten historischen Bezug, wird das Feindbild laut Wagener
zur Form ohne Inhalt.“22
Diese Analyse wird demonstrieren wie das Feindbild als (je nach Dispositiv aktivierbare)
Form bestehen bleibt, aber wieder mit neuem Inhalt aus dem Fundus des erinnerbaren Bösen
gefüllt werden kann. Wagener versteht das als Model das verfügbar bleibt um
„“..die Personengruppen, welche hineinpassen der kollektiven Aggression auszuliefern.
Diese Aggression erfährt ihre Legitimation durch das Feindbild.““ 23
Auf dieser Basis funktioniert beispielsweise der Krieg gegen den „Terror“: „Terror“ ist das
„Böse“, wer glaubhaft zum Assistenten des Terrors oder gar zu einem Terroristen stilisiert
wird, ist ein Feind und daher legitimer Weise bekämpfbar. Diese „Reaktivierungsprozesse“
produzieren jeweils eine Vielzahl an Diskursen, die eben diese Kategorisierung betreffen.
Wo beginnt das „Böse“? Wo trifft es nicht zu? Wann werden wir selbst „böse“? Es ist
nämlich nicht nur der „Terror“ sondern auch der „Rassist“ oder der „Folterer“ in dem
22
Zitat aus: Wagener, 1999, S. 21
23 Zitat aus: Wagener, 1999 S. 21
23
Feindbild der westlichen Gesellschaft enthalten. Man bezieht sich beispielsweise gerne auf
Folter um gewisse „fremde“ Regierungen in die Kritik zu ziehen. Ferner sind unter Folter
erwirkte Geständnisse vor Schweizer Gerichten als Beweismittel nicht verwertbar.
Dementsprechend entstehen auch Diskurse die den Unterschied zwischen einem potenziellen
Terroristen und einem unbescholtenen Muslim betreffen. Oder andere die den Unterschied
zwischen einem „guten“ Polizisten und einem rücksichtslosen Folterer thematisieren. Es gilt
in diesem Beispiel den Terroristen als Feindbild zu charakterisieren und derweil nicht selbst
zum Rassisten (der jeden Muslim undifferenziert als Feind versteht), einem anderen Feindbild
zu werden respektive rassistische Handlungsmuster zu übernehmen, da die legitime
Feindschaft auf den eigenen als „gut“ verstandenen Werten basiert, die jenen des Rassisten
widersprechen.
Es versteht sich von selbst, dass diese beiden, sich in gewisser Weise gegenüberstehenden
Aus- oder Abgrenzungslinien von unterschiedlichen Gruppierungen resp. Diskursteilnehmern
unterschiedlich betont und genutzt werden.
4.4. Das Territorium des Bösen: Von der Kategorie zur Wirklichkeit
Wagener verweist die Feindbilder also in die Welt der Begrifflichkeit:
„„Feindbilder sind Erfindungen der Sprache, Bezeichnungen, die unabhängig von ihrer
Wirklichkeit, Verweise im literarischen Kontext entwickelt, abgewandelt, definiert und
interpretiert werden. In unserer Kultur der Schriftlichkeit, die sich in virtuellen Territorien
reproduziert . Da das Feindbild nur in diesem virtuellen Territorium existiert und nicht
naturgegeben ist, übernehmen folglich auch die Begriffe das Kommando über
Wahrnehmung: Wir begreifen nur, wofür wir Wörter haben. Folglich können Werte sich
vor die Wirklichkeit schieben, bis nichts mehr von ihr zu erkennen ist.““24
Dies ist die Voraussetzung für das, was Wagener als Wort-Magie bezeichnet, die in der
propagandistischen Verwendung eines Feindbildes steckt „Es verzerrt das Gesicht des
Gegners und entzieht ihm so seine Menschlichkeit“.25
Auch Knut Hickethier qualifiziert das Böse als reine „Kategorie der Zuordnung“.26
Er
unterscheidet weiter das Böse vom Schlechten. Dem Schlechten hafte eine Passivität an, die
24
Zitat aus: Wagener Sybil, 1999, Seite 21
25 Wagener, 1999, Seite 22
26 Hickethier in: Faulstich (Hrsg.), 2008, S.228
24
es vom wirklich Bösen unterscheidet. Das Böse ist aktiv, dringt in unser Leben ein und
bedroht es.27
Unter Zuhilfenahme Wageners lässt sich so ein Zusammenhang herstellen zwischen dem
Bösen als Kategorie des aktiven Schlechten, das in seiner Ausprägung, dem Feindbild real
wird.
“Feindschaft ist etwas Reales. Der Begriff "Feindbild" kommt in älteren Etymologischen
Wörterbüchern nicht vor, wohl aber der "Feind". Grimms "deutsches Wörterbuch
"entnimmt sein Beispiel der Tierwelt: "Katze ist der Mäusefeind." Gemeint ist der
"natürliche Feind " der im Gleichgewicht der Natur dafür sorgt, dass eine bestimmte Art
nicht überhandnimmt. Die Jäger-Beute-Konstellation hat jedoch einen ganz anderen
Status als das, was wir unter Feindschaft verstehen, denn sie ist einerseits asymmetrisch
und andererseits naturgegeben. Ein Lebewesen greift an, während das andere,
unterlegene, zu entkommen versucht. Als Jäger tritt der Mensch auf, wenn er andere
Arten verfolgt.“ 28
Dieses tierische Charakteristikum als rhetorische Figur im Diskurs um das Gute, findet sich
anders beleuchtet auch in Diskursen um die Revier- und Treibjagd. Dort wird umgedreht, statt
tierisch verzerrt, das tierische vermenschlicht. Gegner der Jagd betonen den Jäger als Täter
und stellen das Tier als dessen (in diesem Sinn vermenschlichtes) Opfer dar, während die
Jäger selbst ihren Sport als Hege (sich und ihre Rolle also auf einen natürlichen Prozess
beziehen) bezeichnen, das erlegte Tier im Idealfall zur Nahrung nutzen und sich so auf
Jahrtausende alte, legitimationsstiftende Tradition rückbeziehen.
Wer also weiterhin gerne Tiere jagen möchte betont deren „Tierisches“ und zieht daraus die
(traditionelle) Legitimation (zum Selbsterhalt beispielsweise) zu töten. Die Argumentation der
„Hege“ führt den Jäger als natürlichen Feind zu Felde, während jene die dies gerne verhindert
sähen, dem Tier menschliche Attribute verleihen und so die Legitimation zu töten in Frage
stellen. Relevant sind hier die Beziehungen Täter-Opfer im Kontrast zu Jäger-Beute. Ein
Jäger ist ein hungriges Tier, Beute ist naturgegeben. Ein Opfer ist eine Person, welcher Leid
(also aktiv Schlechtes), angetan wurde. Ein Täter ist jemand der absichtlich schlechtes tat und
deshalb böse ist.
In der untersuchten Feindbild Konstruktion läuft dieser beispielhaft angeführte Prozess in die
andere Richtung, der (menschliche) Feind ist die entmenschlichte Manifestation des „Bösen“
insofern er aktiv „das Schlechte“ betreibt. Der Feind wird tendenziell entmenschlicht.
27
Hickethier in: Faulstich (Hrsg.), 2008, S.228
28 Zitat aus: Wagener, 1999, S. 22
25
„„Denn, basierend auf dem Grundsatz der Gleichheit aller Menschen setzen wir erst wenn sich
die Aggression gegen schwächere der eigenen Art richtet, die asymmetrische Beziehung "Täter-
Opfer" dafür ein.““29
Das Tier kann also erst durch seine Vermenschlichung zum Opfer werden, der Mensch erst durch
seine Entmenschlichung zum Feind. „Das aktiv Schlechte“ ist dieses Opfer als Täter zu jagen, was
im angeführten Beispiel den Jäger, als aktiven Betreiber dieses „Schlechten“ in eine Täter- und
deshalb Feindposition rückt.
Diese Kategorie des tierischen als diskursive Figur um das „schlechtere“ existiert schon seit
den Anfängen unserer Kultur:
“…schon mit der Unterscheidung, die nicht nur in der Antike, sondern auch im
ausgehenden Mittelalter das Denken prägte, zwischen zivilisierten Menschen und halb
wilden Barbaren, die "Sklaven von Natur" seien und besser wie Tiere gejagt werden
dürften.“30
Aristoteles kategorisierte bereits in seiner Politeia, ein Werk das heute zu den Grundsteinen
unserer politischen Kultur gezählt wird, gewisse Menschen als Sklaven von Natur aus und
legitimierte so seine Gesellschaftsordnung, in welcher Sklaven kaum mehr als sprechender
Besitz waren.
Wagener zieht nun, die dem in der westlichen Kultur als Norm verbreiteten dem Konzept der
Gleichheit entsprungene Institutionen wie die Menschenrechte heran um den Feind einer Definition
„als vergleichbar stark“ zu unterwerfen:
“Wenn es sich um eine als symmetrisch antizipierte Konstellation von gleichstarken bzw.
gleichermassen bewaffneten handelt, sprechen wir von Feindschaft. Gegner, Kontrahent,
Rivale, Widersacher – die Synonyme setzen Vergleichbarkeit voraus.“
Es handelt sich also bei Wageners Feind um eine Rivalität unter Gegnern einer ähnlichen
„Gewichtsklasse“, wenn man so will. Der Rivale ist in dieser Untersuchung allerdings, wie
eingangs dargelegt, nicht zwingend die Verkörperung eines Bösen und so nicht zwingend die
Manifestation eines Feindbildes und daher nicht unbedingt ein Feind. Genauer ist der Feind
in seiner Funktion als Bedrohung, als aktive Kraft „des Schlechten“ auch ohne weiteres als
mächtiger, gar übermächtig vorstellbar. Gerade aus dieser Asymmetrie, in der der Schwächere
unter Verachtung aller Risiken das „Gute“ gegen „die böse“ Bedrohung erfolgreich verteidigt,
ziehen die meisten Geschichten ihren Reiz und vor allem das identifikationsstiftende
29
Zitat aus: Wagener, 1999, Seite 22
30Zitat aus Wagener, 1999, Seite 22
26
Heldentum. Zudem ist die „Übermacht“ eine Vorraussetzung für die Opferkonstruktion,
welche wiederum Adressat des „aktiv schlechten“ ist.
Weniger vorstellbar ist ein schwächerer, an und für sich sowieso unterlegener Feind.
Natürlich verstehen Neonazis den einen Immigranten den sie gerade zu fünft durch die
Gassen jagen als Manifestation des von ihnen antizipierten Bösen und dementsprechend als
Feind. Auch wenn sie zahlenmäßig überlegen sind, fürchten sie sich vor dem Komplex des
„Bösen“ für welchen der Immigrant steht: Arbeitslosigkeit beispielsweise, einen drohenden
Schatten dem sie ohnmächtig (weil oftmals schlecht ausgebildet) gegenüberstehen.
Der Feind bleibt also nur solange Feind, wie er ein „Böses“ verkörpert und so eine aktive
Bedrohung des Schlechten darstellt. Ein Immigrant tut dies in den Augen der Neonazis schon
alleine durch sein Dasein. Der Feind unterscheidet sich also in der vorliegenden Untersuchung
von einem Kontrahenten oder einem Rivalen durch die abstrakte begriffliche Konstruktion,
die hinter oder über ihm steht. So sind wie erwähnt Selbstverteidigung oder Nahrungs- und
Territoriums Konflikte als instinktive Handlungen zu begreifen, die aus Selbstschutz oder
Notwendigkeit heraus geschehen und meistens dann vorüber sind wenn (unter der Annahme
eines neutralen Raums) die antizipierten Kosten der weiteren Konfrontation, den
vermeintlichen Gewinn zu übersteigen beginnen.31
Gemessen an der Härte der Strafen, die in den meisten Staaten auf Fahnenflucht stehen, darf
man davon ausgehen, dass die Mehrheit der Soldaten das Kämpfen an einem gewissen Punkt
einstellen würde, wenn man sie ließe.
Soldaten kämpfen aber in erster Instanz gegen Feindbilder, nicht gegen Rivalen. Also im
Wesentlichen gegen ein abstraktes „Böses“, das sich in den gegnerischen Soldaten
manifestiert. So sind sie bereit, obwohl sie wahrscheinlich im Normalfall lieber vermeiden
möchten jemanden zu töten, es doch zu tun und mit ihren Waffenbrüdern in einem Konvoi
genau dahin zu reisen, wo die Chance am grössten ist, dass sie selbst getötet werden. Sie töten
also nicht den Menschen Alexej Ibramowitsch (Name frei erfunden) sondern den
sowjetischen Soldaten vorne links, der im Namen des Kommunismus die Demokratie bedroht.
Das hier untersuchte Böse findet sich also in der symbolisch vermittelten Welt, in der wir uns
mithilfe der Sprache eingerichtet haben, statt. Diese Welt bezeichnet Wagener als virtuelles
31
Gemäß: Wagener, 1999, S.23
27
Territorium. Diese Welt, der durch „Werte hervorgerufenen Vorstellung“32
schiebt sich
gemäß Wagener in unserer Wahrnehmung neben und über die reale Welt.33
“..(..)ein Begriff wie "Feindbild" trägt der Tatsache Rechnung, dass wir auch die Realität
der Feindschaft durch den Filter unseres Bewusstseins wahrnehmen.“34
Die Quelle dieses virtuellen Territoriums verortet Wagener ähnlich wie Hickethier in sozialer
Konditionierung (Wageners „Lebensschule“ und die Erprobung der gelernten Strategien und
Hickethiers Orientierungskriterien).35
Dies unterstreicht die Diskursabhängigkeit insofern das
„Böse“ nur als Diskursfigur existiert:
Jeder soziale Verband vertritt eine mehr weniger geschlossene ideologische
"Lebensschule". Falls sich die dort gelernten Strategien in der erweiterten Umgebung
bewähren, wird der junge Mensch dabei bleiben. Würden diese Strategien ihn jedoch mit
der Realität, im Sinne einer Realität einer sozialen Um- und Aussenwelt in Konflikt
bringen, wird er sie entweder korrigieren, oder in eine Aussenseiterposition geraten. In
der Tat erfolgt die Korrektur einer solchen „falschen“ Vorstellung durch die Realität nicht
zwangsläufig. So fest gefügt kann die innere Plattform, das virtuelle Territorium sein,
dass es jeder Anpassung an die Tatsachen widersteht.
Durch internen Konsens bei systematischer Abschottung gegen die Aussenwelt werden
die wildesten Realitätsverzerrungen möglich. 36
Es muss hier logischerweise von der durch den Begriff „Verzerrung“ implizierten
Deutungshoheit abgesehen werden, zumal jede kulturelle Konditionierungsstruktur, (um
Wageners Begriff der „ideologischen Lebensschule“ mit dessen intragesellschaftlichen
Erprobungsprozessen zusammenzufassen) zu der nächsten per Definition in einem gewissen
Maß verzerrt ist. Wagener attestiert dieses Potenzial zur Verzerrung insbesondere
geschlossenen Sozialsystemen. Je geschlossener das System ist, auf das sich eine Gruppe in
ihrem Selbstverständnis einigt, desto höher pflegt nach Wagener das Potenzial an interner
Realitätskonstruktion zu sein, der gegenüber die von allfälligen Außenwelten getragene
Realitätsvorstellungen als Korrektiv nicht immer willkommen sind.37
Jede radikal-politische Gruppe, jede exklusive Sekte hat, je „realitätsferner“ ihre
ideologische Plattform ist, je leichter würden Tatsachen sie zum Einsturz bringen können,
desto nötiger, sich gegen die Aussenwelt aggressiv und möglichst konsequent
32
Zitat aus: Wagener, 1999, Seite 24
33 Wagener, 1999, Seite 24
34 Zitat aus: Wagener, 1999, Seite 24
35 Hickethier, 2008 in: Faulstich (Hrsg.) , S. 228
36 Zitat aus: Wagener 1999 Seite 26
37 Gem. Wagener 1999 Seite 26
28
abzuschirmen. Es handelt sich um ein sich selbst verstärkendes System von Abschottung,
Erfahrung eigener Ausgrenzung und vertiefter Abschottung. Wenn sich die Binnenwerte
auf die man sich geeinigt hat destabilisieren und so die Integrität der Gruppe in Gefahr
gerät, hilft es, einen gemeinsamen Feind an die Wand zu malen, der den Binnenwerten
neue Verbindlichkeiten attestiert.38
Um dieser Untersuchung dienlich zu sein, muss dieser Aspekt allerdings anders beleuchtet
werden: Es ist hernach nicht zwingend die Differenz zwischen Realität und ideologischer
Kategorisierung, welche die Abschottung der Konditionierung stiftenden Gruppe von der
„Außenwelt“ verstärkt, vielmehr entsteht diese intensivierte Notwendigkeit aufgrund
antizipierter asymmetrischer Konstellation. Eben der Furcht vor einem ideologischen Täter,
der die eigene bedroht. Wageners „Realitätsbegriff“ scheint einem Mehrheitsglauben zu
unterliegen. In etwa nach der Logik: Je mehr Menschen jenen Vogel als blau bezeichnen
umso realer ist dieses Blau. Umso schwieriger wird es für eine kleine eingeschworene Gruppe
weiterhin die Überzeugung aufrecht zu erhalten, dass derselbe Vogel gelb sei. Diese
Schwierigkeiten bestehen natürlich intern wie extern. Dies jedoch nicht weil der Vogel
effektiv gelb oder blau ist, sondern deshalb weil der Diskurs um den Vogel von etlichen
Multiplikatoren blau gesprochen wird. Je zahlreicher und „diskursmächtiger“ diese
Multiplikatoren, diese Träger der Idee „der Vogel ist blau“ sind umso „blauer“ ist der Vogel
in der gesamtgesellschaftlichen Wahrnehmung. Würde plötzlich mit genügend
„Diskursmacht“ (aufbauend auf einem breiten Konsens beispielsweise) verkündet der Vogel
sei rot, so würde er rot sein. Es versteht sich, dass der Vogel nicht seine Farbe ändern würde,
denn die effektive Farbe des Vogels ist wohl Realität, der Begriff für die Farbe allerdings ist
Definitions- und somit Diskursabhängig. Ferner ist die Farbe eines Vogels als
Diskursgegenstand nicht besonders interessant, zumal die Bezeichnungen von Farben sich
einer gewissen allgemeinen Akzeptanz erfreuen. Anders verhält es sich mit Ideologien. Wenn
sich also eine kleine Gruppe, Gemeinschaft oder eben Kleinstaat einer ideologischen
Umgebung ausgesetzt sieht, die eine andere Auffassung der Wahrheit vertritt als sie selbst,
erlebt sie (oder er) dasselbe wie das Individuum:
Jeder soziale Verband vertritt eine mehr weniger geschlossene ideologische
"Lebensschule". Falls sich die dort gelernten Strategien in der erweiterten Umgebung
bewähren, wird der junge Mensch dabei bleiben. Würden diese Strategien ihn jedoch mit
der Realität, im Sinne einer Realität einer sozialen Um- und Aussenwelt in Konflikt
bringen, wird er sie entweder korrigieren, oder in eine Aussenseiterposition oder gar
Feindposition geraten.39
38
Zitat aus: Wagener, 1999, Seite 26
39 Zitat aus: Wagener, 1999, Seite 26
29
Hier bietet sich ein Erklärungsansatz für das starke Bestreben der Schweizer Politik an, nicht
international isoliert zu werden, was mitunter ein starker außenpolitischer Motivator für die
Schweizer Regierungsinstitutionen zu sein scheint, heute wie damals.
4.5. Der Feind und das Fremde
Der Feind ist per se fremd, die Unterschiedlichkeit zur eigenen Kulturprägung definiert ihn
weitgehend. Nicht jeder Fremde ist aber ein Feind, jede Begegnung mit einem Fremden mag
kritisch sein, gerade weil sich hinter ihr bereits das Potenzial der Feindschaft verbirgt, man denke
an den Ausspruch: „Freund oder Feind“, den die mittelalterliche Torwache den nicht identifizierten
Neuankömmlingen entgegenzuschleudern pflegte. Der Fremde ist uns allein durch seine Gegenwart,
sein Dasein als „fremd“ bewusst, dass unsere Sprache, unsere Sitten, unsere äussere Erscheinung,
nicht universelle Geltung haben – was wir sind wird automatisch implizit relativiert. 40
Der Fremde ausserhalb unserer Grenzen rückt nur dann in unser Blickfeld, wenn wir in sein
Leben reisen oder Krieg mit dem „anderen“ beginnen. Der Fremde unter uns bringt daher stets
ein gewisses Konfliktpotenzial mit sich. Der Umgang mit den Fremden ist traditionell durch das
Gastrecht geregelt. "Fremder" und "Gast "sind im griechischen dasselbe Wort (xenos). Was den
Gast, zunächst schützt, ist die Tatsache, dass er entblösst erscheint: Er kennt sich nicht aus.
Jeder Einheimische kann sich ihm allein aus diesem Grund überlegen fühlen. Dieses
Überlegenheitsgefühl verhindert solange es besteht Konflikte, erst wenn Geltungsansprüche
formuliert werden und so etabliertes in Zweifel gezogen wird oder etabliertes im Zweifel
gesehen wird, beginnen die Konflikte.41
Diese Entwicklung ist im Diskurs um die Überfremdungsinitiative zu beobachten. Die
Italiener wurden geduldet, als Arbeiter, Teilnehmer der nationalen Wirtschaft bis zu jenem
Punkt an welchem sie ihre Kultur innerhalb der Schweizer Kultur zu leben und ihre
Unterlegenheit abzustreifen begannen. So wurde das „den Schweizer Frauen Komplimente
machen“, die hitzigere Herangehensweise an so ziemlich jede soziale Interaktion als auch das
lauthalse „herausbrüllen“ der eigenen Kultur den Italienern zum Vorwurf gemacht.42
Wagener definiert das Fremde über seine potenzielle Nicht-Zugehörigkeit im eigenen
virtuellen Territorium. Gemäss der hergeleiteten Begrifflichkeit des Guten sowohl als auch
des Bösen ist uns im „virtuellen Territorium“ ein Freund wer Teil hat an unserem
Wertesystem. „Er ist unser Mitbewohner auf dem Boden des Christentums, der
40
Zitat : Wagener, 1999 Seite 33
41 Zitat: Wagener, 1999 Seite 33
42 SRF, „mySchool“ vom 07.06.2012, «Zeitreise: Die Schwarzenbach-Initiative»
30
Menschenrechte, des Sozialismus“43
, der Landi. Der Vorgang der Zuordnung ist allerdings,
wenn nicht durch äußere Merkmale vereinfacht, analytisch komplex.44
Der Feind, der sich nicht äußerlich zu erkennen gibt, kann konsequenterweise erst aufgrund
des Vergleichs mit dem eigenen virtuellen Territorium identifiziert werden. Ein Diskurs ist
hier unabdingbar. Es ergeben sich aus diesem Umstand umgekehrt eine Reihe an
Missverständnissen, wenn ein potenzieller Feind eben nicht nach seinem „virtuellen
Territorium“45
gefragt sondern aufgrund seiner Äußerlichkeit kategorisiert wird. So wird das
Symbol der Feindschaft bewusst benannt: Uniformen, Knasttätowierungen oder Trikots,
während die eigene Kennzeichnung ebenfalls erfolgt aber aus der eigenen Perspektive mit
dem „Guten“ im Kontrast zum „Bösen“ beladen ist. So erfolgt die materielle Kennzeichnung
eines „virtuellen Territoriums“ als Zugehörigkeit und Abgrenzung gleichermassen. Doch
existiert auch ein „Innerhalb“ verfeindeter Gruppierungen insofern sich die „verfeindete“
Gruppe bereit erklärt, die Form in welcher die andere Gruppe ihre Zugehörigkeit demonstriert
als Symbol des Feindlichen zu kategorisieren und sich in gleicher Form kategorisierbar zu
gestalten.
So entscheiden beide der verfeindeten Armeen die Uniform zu tragen, sie zu verstehen und sie
so in ihrer Funktion zu akzeptieren. Gleichfalls ist die unabsichtliche Kennzeichnung
möglich. So ist ein schwarzer Schweizer eher der Anfeindung durch Fremdenfeinde
ausgesetzt, ganz egal seit wie vielen Generationen er sein Schweizersein nachweisen könnte
und obwohl er seine Hautfarbe kaum selbst gewählt hat.
Erfolgt die materielle Kennzeichnung jedoch nicht, bleibt uns nichts als die Sprache, um
Freund von Feind zu unterscheiden. Es existieren rhetorische Figuren, die eine Zuordnung
extrem einfach machen. „Kein Fußbreit den Faschisten“ ist beispielsweise ein Satz, der sich
recht klar einem politisch linken Spektrum zuordnen lässt. Doch kann eine solche
Abgrenzung beziehungsweise Kategorisierung weitaus komplexer ausfallen, wenn der
vermeintliche Feind sich weder materiell noch diskursiv einer Kategorisierung zuordnet. Mit
anderen Worten erst dann wenn er oder sie meine Abgrenzungslinien durchkreuzt, meine
Ausschliessungsmechanismen „aktiviert“ kann ich wissen, ob es sich um einen Feind handelt.
Diese Schwierigkeiten sind im politischen Prozess der Schweiz heute noch zu beobachten:
43
Wagener, 1999, Seite 27
44 Fussend auf: Wagener, 1999, Seite 27
45 Vergl. Wagener Sybil, 1999, Seite 26 ff.
31
Oskar Freysinger ist solange als demokratisch gewählter Volksvertreter legitim, wie ihm
keine Nationalsozialistische Gesinnung nachgewiesen werden kann. Entsteht jedoch der
Verdacht (wie es aufgrund einer deutschen Reichsflagge in seinem Hobbyraum der Fall war),
beginnt sich der Diskurs um seine Person einer gesellschaftlichen Abgrenzungslinie zu
nähern.46
Konkret verlangte man von ihm, die Fahne, ein Symbol des „Bösen“, abzuhängen.
Diese Zusammenhänge werden im Kontext der Verarbeitung des „Kommunistischen“ in der
Schweiz ersichtlich werden.
4.6. Die Abwertung des Feindes
Die Abwertung eines Feindbildes ist insofern Teil der Konditionierung zum Angriff, als dass
sie moralisch entlastet. Einen brutalen Diktator, der sein Volk hungern lässt als Feind zu
betrachten ist einiges einfacher, als einen Herrscher dessen Volk besser lebt als wir selbst.
Diese Mechanismen sind über den gesamten „Kommunismus-Diskurs“ zu beobachten.
Wichtig ist hier zwischen einem, beispielsweise statistischen Hochrechnen der Kulturen, zu
unterscheiden zu dem was hier untersucht wird: Einer rein diskursiven, insofern
metaphysischen, abstrakten Auseinandersetzung. Es ist für diese Untersuchung irrelevant wie
sich die sozialökonomischen Verhältnisse „in der Wirklichkeit“ äußern. Die Untersuchung
fokussiert einzig auf die mediale Verarbeitung in den Schweizer Medien, es wäre also
möglich, dass es den Untertanen von Stalin hervorragend ging, sie in Luxus schwelgten und
allesamt glücklich waren. Der mediale Diskurs mag sich je nachdem auf mehr oder weniger
solide Indizien und Beweise stützen, relevant ist hier aber nicht die inhaltliche Begründung
des Diskurses, sondern die Logik seines Verlaufs.
Das „Böse“ ist in seiner Begründung metaphysischer, abstrakter Natur, es überwindet nur
deshalb Verbindlichkeiten aller Art, unter anderen das Verbot zu töten.
Dazu Wagener:
„Soweit die Welt ein (Momentanes) Gewissen hat, werden gerechte Kriege nicht explizit gegen
andere Menschen geführt sondern gegen das „Böse“, das sich mit dem Umweg über das
Feindbild in ihnen verkörpert. Das Bild ist jedoch nur eine Formel, genau wie das Gute, in
dessen Namen die Vernichtung von Menschen betrieben wird.“47
Dementsprechend beschreibt sie die Funktion des Feindbilds:
46
Tages Anzeiger Online am 28.03.2013: „Freysinger soll die Fahne abhängen“,
47 Zitat: Wagener,1999 Seite 30
32
„Das Feindbild entbindet von Totschlagshemmungen, indem es dem Gegner das
menschliche Gesicht nimmt. Instinktiv schützt sich der Totschläger vor dem erkennen des
Mitmenschen in seinem Opfer. Das Bild ist eine abstrakte Kategorie; es muss schon der
Teufel persönlich sein, um für die Maske zu taugen. Doch der Teufel erscheint, wie alles
böse, in der menschlichen Fantasie als Zwitter aus Mensch und Tier. So lange das
Christentum die Mythen des Bösen liefert, wird der Gegner vorzugsweise mit
Teufelsattributen ausgestattet, doch letztlich entstammen Pferdefuss, Schweif und Hörner
einer anderen, nicht-menschlichen Kategorie: der Tierwelt.“48
Das Böse als Kategorie setzt sich allerdings schon aus einem Anteil an Abwertung zusammen. So
ist die Verdammung dieser und jener Norm bereits als Abwertung zu verstehen, da die Norm,
Politik, Moral etc. des Bösen (dessen Manifestation das Feindbild ja erst ist) als schlechter
gegenüber der eigenen zu stehen hat, um überhaupt als böse verstanden zu werden. Das Feindbild
als Ausprägung des Bösen wird dementsprechend über die Charakteristika des bestimmten,
definierten Bösen verlaufen: „Der Kommunismus unterdrückt die Menschen, ergo ist Stalin ein
Unterdrücker“. Das Feindbild erfährt diese Abwertung, weil sie in den meisten Fällen notwendig
ist, um überhaupt ein Feindbild zu kreieren. Der Soldat der das Böse verkörpert, muss ein schlechter
nahezu tierischer Mensch sein, denn ein guter (menschlicher) Mensch ist man ja, insbesondere
gegenüber dem Bösen selbst.
4.7. Feindbilder, Schwäche und die Komödie
Feindsatiren verzerren das Bild des Feindes ins Tierische. Auf der bildlichen Ebene findet
dies Ausdruck, via verliehener Attribute wie ein Vampirgebiss, rotglühende Augen, spitze
Ohren, Krallenhände, heruntergezogene Mundwinkel und dergleichen. Die Vergleiche mit
Tieren werden traditionell gerne herbeigezogen.49
.
Diese Herabwürdigung zum Tier hat verschiedene teilweise bereits dargelegte Funktionen wie
die „Entmenschlichung“, welche das Töten oder Bekämpfen legitimiert. So ist das Tier weiter
dem Menschen unterlegen und dieser darf gerechtfertigt über das Leben desselben verfügen.
Diese Verzerrung ins Tierische als „schlechter“ oder „weniger wert“ war besonders
augenscheinlich als sich die geistige Landesverteidigung ab Ende der Sechzigerjahre
neuerdings gegen kulturell Fremde und nicht mehr gegen politische Feinde richtete. Als
Beispiel sei der die Ausländerinitiative prägende Satz: „Für Hunde und Italiener verboten! “
herangezogen. Doch liefert das Tierische auch andere Dimensionen der Abwertung, wie den
Mangel an Vernunft, Intelligenz oder eben der lächerlichen Unterlegenheit.
48
Zitat aus: Wagener, 1999 Seite 31 unten und 32 oben
49 Wagener, 1999 Seite 32 unten und Seite 33 oben
33
Erst wenn das Tier wiederum vermenschlicht wird (wir erinnern uns an das Beispiel des Jagd-
Diskurses) wird diese Struktur der Legitimität neu diskutiert. Auch ist das Tier dumm und
nicht fähig, so wie der Mensch, zu verstehen. Eine hilfreiche, zuweilen hinreichende
Charakterisierung für jemanden der Dinge denkt, die so falsch sind, dass sie ihn zum Feind
machen.
Der Bezug zielt jedoch nicht nur auf Raubtiere oder Schreckgestalten. Affen beispielsweise
stehen eher im Ruf lustig und dämlich zu sein. Die „Herabsetzung“ sowohl ins Tierische als
auch generell, muss mehrdimensional verstanden werden, da sie nicht nur der Überstilisierung
als schlechter und deshalb böse dient, sondern den „Feind“ in verschiedenen Aspekten
herabsetzt. So kann er mit diesem als auch mit anderen Stilmitteln der Lächerlichkeit
preisgegeben werden. Es versteht sich derweil, dass sich der Humor einer Gesellschaft auch in
seinen konkreten Ausformulierungen verändert. Die „Verzerrung ins Tierische“ ist zwar
zuhauf zu beobachten, doch soll die Herabsetzung des Feindbildes in dieser Untersuchung
sich nicht auf diese Form beschränken. Es geht generell um eine Verzerrung der Züge von
einem hochstilisieren zum Fürsten der Dunkelheit bis hin zum Lächerlich machen. Der Feind
wird an sich nur über die Dissonanz mit unserem „Virtuellen Territorium“ definiert, dieses
wiederum ist durch die Abgrenzungslinien und Sagbarkeiten unserer Prägung bestimmt. So
ist für den echten Feind kein Platz darin. An welcher Stelle er herausfällt, ob er sich wegen
seiner Pädophilie oder wegen seiner wahnsinnigen Weltherrschaftsplänen an unserem
Selbstbild stößt, bestimmt im Endeffekt der Diskurs. Der Feind muss nicht unbedingt
ausschließlich bedrohlich sein, er kann auch beispielsweise die Gestalt eines lügenden Irren
mit einer Atombombe annehmen. Der ist auch noch recht gefährlich aber gelichzeitig nicht
nur gefährlich.
Hier öffnet sich das Tor für die schleichende Dekonstruktion eines Feindbildes; wenn es in
seinem Charakter, respektive wenn der Diskurs um das Feindbild facettenreicher wird, als
„nur“ die Manifestation des Bösen.
5. Die Geistige Landesverteidigung
Die geistige Landesverteidigung ist für die Untersuchung von Feindbildern in der Schweizer
Nachkriegskultur unabdingbar. Während der gesamten Nachkriegszeit dominierte sie auf sozial-
politischer Ebene durch diverse Ausprägungen den Diskurs um das Schweizer Selbst und die
jeweils aktuellen Feindbilder. Ferner ist sie dank ihrer offenen Bezeichnung, institutionellen
34
Planung, medial allgegenwärtigen Form und mannigfaltiger Umsetzung, ein wohldokumentierter
Forschungsgegenstand.
Theo Mäusli positioniert das Aufkommen des Begriffs der geistigen Landesverteidigung in die
Mitte der dreißiger Jahre. Er definiert sie als eben jene Orientierung, die der Schweiz zur
Krisenbewältigung diente. Obwohl die geistige Landesverteidigung als Programm zu jenem
Zeitpunkt nicht konkret existierte, identifiziert Mäusli die „geistige Landesverteidigung“ bereits als
Mittel des Umgangs mit den Wetterleuchten der drohenden internationalen Konflikte.50
Der Kampf
um eine solide „Gesamtidentität“ der Schweiz geht allerdings in deren Gründungszeit, Mitte des 19.
Jahrhunderts zurück. So wurde die „Helvetik“ als Konzept, das der Relevanz der Kantone
entgegenstand, nicht ganz so ohne Weiteres von der Schweizer Bevölkerung akzeptiert sondern in
seinen ersten Gehversuchen tendenziell abgelehnt.51
Mäusli konstatiert der Schweiz zu diesem Zeitpunkt „eine erfolgreiche Ideologie“52
, welche in einer
Zeit ideologischer Orientierungsnot, schon für wichtige Entscheidungen bewusst zu Hilfe gezogen
und in zahlreichem Schrifttum nahezu Gesetzes Kraft anmutend multipliziert wurde, (siehe dazu
insbesondere die Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung über die Organisation und
die Aufgaben der schweizerischen Kulturwahrung und Kulturwerbung vom 9.12.193853
) und
schnell verinnerlicht wurde: Geistige Landesverteidigung wurde zur Mentalität. Ihr Erfolg lag
anfangs, also bis kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem darin begründet, dass es sich um ein
sehr offenes Konstrukt handelte, dessen Inhalt sich auf die Einsicht in die Notwendigkeit der Pflege
des von außen bedrohten Schweizerischen, beschränkte, ohne dass derweil dieses „schweizerische“
abschließend und allgemeingültig definiert worden wäre.
Geistige Landesverteidigung war, gemäß Mäusli, an jenem Zeitpunkt somit variabel: Je nach
sozialer Herkunft und Bildungsstand, je nach persönlichen Interessen und Sympathien konnte diese
Bedrohung im Faschismus, in Hitler-Deutschland, im Bolschewismus oder schlechthin in allem,
was nicht als vermeintlich schweizerische Eigenart erschien, erkannt werden.54
50
Mäusli ,1995, Seite 33
51 Audrey 1986, in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, Seite 601
52 Mäusli 1995 Seite 33
53 Bundesblatt Jg. 90, Bd.2, nr.50, 14.12. 1938
54 Stirnimann, 1988 S.182 ff.
35
Von solcher geistiger Landesverteidigung konnte der städtische Weltenbürger geleitet sein,
der seine schweizerische Bewegungsfreiheit durch das Aufrüsten des nationalsozialistischen
Deutschland bedroht sah, ebenso wie mit der Naziideologie sympathisierende Frontisten sich
danach orientieren konnten, um das „Schweizerische“ jeglichem Wandel entgegensetzen. Die
geistige Landesverteidigung bot zu jenem Zeitpunkt also eine gewisse „ideologische Heimat
für Jedermann“.55
Es handelt sich bei der geistigen Landesverteidigung um einen abgeschlossenen, institutionell
und medial getragenen Diskursstrang, welcher mindestens bis und mit dem Zusammenbruch
der Sowjetunion existierte. Erst die Veränderung respektive das Wegfallen der
Existenzgrundlage der geistigen Landesverteidigung (des geistigen Feindes) soll die
Dekonstruktion der durch sie entstandenen Feindbilder ermöglichen. Doch dazu später.
Die Schweiz hat den ersten als auch den zweiten Weltkrieg, zumindest ökonomisch betrachtet
relativ schadlos überstanden. Die Ideologischen Aspekte der Weltkriege hingegen, stellten die
Schweizer Gesellschaft vor ein Problem, was ihre inhaltliche, ideologische und politische
Orientierung betraf. Die Schweizer Neutralität mag als politisches Utensil umsetzbar sein,
insofern sie einen Nichteintritt in die Kriege ermöglichte beispielsweise. Die durch den
Wiener Kongress (1814/15) aufoktroyierte Neutralität machte damals die politische Schweiz,
wie sie weitgehend noch heute besteht, erst möglich.56
Die außenpolitische Neutralität ist gewissermaßen in die Grundstrukturen der Schweiz in
einem internationalen Kontext gewoben. Sie mag situative Fragen aufwerfen, wie jene nach
der Legitimation von Waffenhandel beispielsweise, ist aber ein relativ klar definierter,
national als auch international ratifizierter Verhaltenskodex was die internationalen
Beziehungen der Schweiz betrifft.
Ideologische Neutralität zu wahren, ist hingegen eine Aufgabe, die (so wage ich zu
behaupten) Menschen ganz allgemein gesprochen nicht besonders leicht fällt, selbst wenn sie
es versuchen. In einer globalen Kriegssituation, die nebst territorial konkurrierenden
Weltmächten, konkurrierende Ideologien zum Inhalt hat, steht eine gewahrte außenpolitische
Neutralität also ganz automatisch in einem Kontrast zu innenpolitischen Ideologiediskursen.
55
Mäusli Theo, 1995 Seite 33
56 Historisches Lexikon der Schweiz Online
36
Die geopolitische Situation wie sie sich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs präsentierte,
war in ihrer abstrakten Dimension noch nie dagewesen.
5.1. Das geistige Schlachtfeld
Zwar waren die Jahrhunderte zuvor ebenfalls von kriegerischen Auseinandersetzungen
zwischen Großmächten geprägt, neu war allerdings der daran gekoppelte, die Gesellschaften
durchdringende ideologische Konflikt. Die Schweiz war, wie andere europäische Staaten
auch, während des 19 Jahrhunderts von einer Reihe an Widersprüchen und daraus
entstandenen Konflikten gebeutelt. Bestimmt ein Hauptproblem fand sich in dem
Widerspruch zwischen den Liberal- Radikalen und den katholisch-Konservativen. Später in
einer Zeit die Tobias Kästli als „Zeit des Kulturkampfs“57
bezeichnet, dann der ideologische
Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten, gefolgt von dem Widerspruch zwischen
Bürgertum und Arbeiterschaft, der große Teile der zivilisierten Welt bis heute zu prägen
vermag. 58
Als „vereinend“ bezeichnet Kaestli Faktoren wie die national organisierte Armee oder die
„helvetische“ Geschichtsschreibung.59
Ferner existierte als „Erbe des Helvetismus des 18
Jahrhunderts“60
ein ausgeprägter Patriotismus im Sinne eines „Nationalgeistes“61
. Dieser
wurde mitunter durch die öffentlichen Debatten über Bundespolitische Fragen bestärkt, da
diese das politisch-nationale „gemeinsame“ rein durch ihre Existenz in Erinnerung riefen. Zu
dieser Bundespolitik gehörte auch schon damals eine aktive Kulturpolitik. Es bietet sich an in
dieser den eigentlichen konzeptionellen Beginn der geistigen Landesverteidigung zu
verstehen, die ihren ersten konkreten Ausdruck mit den Bundesbeschlüssen zur Wahrung der
vaterländischen Altertümer und zur Förderung der Kunst von 1886 und 1887 fand.62
Ein weiterer bedeutungsschwangerer Schritt war natürlich das Erstellen einer einheitlichen
Gesetzgebung für den Schweizer Staat. Das von Eugen Huber verfasste und 1907 durch die
Bundesversammlung ratifizierte Zivilgesetzbuch, wurde gemäß Kaestli, in Bezugnahme auf
57
Kaestli, 2005, S. 37
58 Kaestli, 2005, S. 37
59 Kaestli, 2005, S. 37
60 Audrey 1986, in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, S. 601
61 Audrey 1986, in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer, S. 601
62 Kaestli, 2005, S. 37
37
den Rechtshistoriker Hans Fehr gelobt für seine Eigenschaft ein volkstümliches Recht zu sein,
dass in dieser Eigenschaft „Staat und Volk“63
zur Einheit zu verbinden vermag. Obwohl der
Begriff der geistigen Landesverteidigung an dieser Stelle noch nicht zum Programm erhoben
worden war, wird bereits hier ersichtlich wie die Schweiz schon mit ihrer Gründung um ein
Selbstbild wird zu ringen hatte. Der „Aufbruch“ der Kantone in die „Schweizer Nation“
konnte nur von einer Handvoll verbindender, identitätsstiftender Konstrukte aufgefangen
werden; Die „Helvetische Geschichte“ mit dem entsprechenden Heldenmythos und die
bundesübergreifenden Institutionen waren dabei zentral. Das Schweizer Selbstverständnis war
dementsprechend schon zu Beginn ein diskutiertes, institutionell benanntes und getragenes,
kulturelles Programm. Dieses Bewusstsein um die Notwendigkeit eines Selbstbildes äußert
sich beispielsweise in der Eröffnung des Landesmuseums 1898 und 1900 der
Nationalbibliothek in Bern.64
Dieses ein „Schweizer Selbstbild“ generierende Maßnahmenprogramm stand den genannten
ideologisch geprägten, innerstaatlichen Konflikten gegenüber. Die daraus entstandenen
Diskurse entluden sich während und in den Weltkriegen, in Korrespondenz zu deren Verlauf
zu einer neuen Situation. Also bereits vor den Kriegen stand die Schweiz einer
Selbstfindungsfrage gegenüber, diese wurde verstärkt durch die globalen Umwälzungen, die
ebenfalls von ideologischen Konflikten geprägt waren. Ob Nationalsozialismus,
Bolschewismus oder Monarchie, die „Art“ und der Charakter der neugeordneten Welt,
würden erst mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges etabliert sein. Dass die Welt derweil
neugeordnet würde, stand aber außer Frage.65
Auf globaler Ebene Vollzog sich, basierend auf den Thesen Karl Marx und Friedrich Engels,
eine Trennung zwischen dem Besitzbürger (Bourgeois) und dem arbeitenden Bürger
(Citoyen) aus der im Weiteren die globale proletarische Bewegung entstehen sollte. Die rein
bürgerliche Gründungsstruktur, die zwar von Konflikten zwischen Liberalen und
Konservativen geprägt, fand sich, insgesamt aber doch als bürgerlich im Sinne der
französischen Revolution zu bezeichnen bleibt, als Ganzes also einer neuen Antithese
gegenüber gestellt,66
die sich zudem als international organsiert verstand.
63
Fehr Zitiert in: Kaestli Tobias, 2005, S. 38
64 Kaestli Tobias, 2005, S. 37
65 Kaestli Tobias, 2005 S. 34
66 Kaestli Tobias, 2005, S.36
38
So führten diese globalen Umwälzungen durch die Weltkriege, zu neuen globalen
Dispositiven für den Schweizer Diskurs um das Schweizer Selbst. Die Schweiz, noch nicht
fertig mit der „Selbstfindung“ hatte sich neu auch gegen aussen zu definieren, was wiederum
innerstaatliche Diskurse mit sich brachte unter einer Orientierung und dem Einfluss globaler
Geschehen.
Die den beiden Weltriegen entsprungene, besondere Komposition aus einigermassen
ausgewogenen geopolitischen Machtblöcken, welche in diesem Sinne „herkömmlich“ um
territoriale und wirtschaftliche Dominanz konkurrieren, gekoppelt mit einer polit-
philosophischen Unvereinbarkeit, die die essentiellen Grundstrukturen der
Selbstwahrnehmung und existentielle Möglichkeitsspektren als Mitglied einer Gesellschaft
betrifft, war für die westliche Kultur bisher beispiellos und erst durch die (Transport,
Produktions- und Informations-) Technik überhaupt erst ermöglicht.
So stellten sich schon vor aber intensiviert mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs den
Einwohnern der Schweiz Ideologisch-gesellschaftliche Fragen.67
Die Schweiz verstand sich
alsbald als neutraler Kleinstaat zwischen dem sprichwörtlichen Hammer und Amboss der
ideologisch gefärbten Weltpolitik. Es ist daher naheliegend, der geistigen Landesverteidigung
einen gewissermaßen „akuten“ Charakter zu unterstellen.
Im Folgenden werden die Diskurse in und um die geistige Landesverteidigung in der Schweiz
untersucht. Hierbei stehen vornehmlich die Quellen des Selbstverständnisses, die Nachfrage
nach demselben als auch die Beanspruchung dieses Selbstverständnisses durch
unterschiedliche Strömungen der Schweizer Gesellschaft im Vordergrund.
Ferner soll in diesem Teil der Untersuchung hergeleitet werden, wie es in der Schweiz zu
einer Stilisierung und Übernahme des ideologischen Konflikts zwischen den beiden
Weltmächten U.S.A und U.D.S.S.R als „Kampf zwischen Gut und Böse“ kam und wie die
beiden Positionen, weshalb besetzt wurden.
6. Dispositivanalyse an den relevanten Punkten
Es wurde bisher hergeleitet wo sich die Wurzeln der geistigen Landesverteidigung finden,
respektive wie sich diese zu was für einem gesellschaftsumfassenden Programm mauserte.
Relevant für die Analyse des Diskurses als auch des Dispositivs sind folgende Aspekte:
67
Dürrenmatt, 1979, S.192
39
Die geistige Landesverteidigung war bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs nach aussen
gerichtet, was zur Folge hatte, dass sich fast jede/r Schweizerin mehr oder minder mit einer
(eben unangefochtenen individuellen) Selbstwahrnehmung als Schweizer identifizieren
konnte. Wie aus Meilis Ausführungen zur Landi68
klar hervorgeht, galt es zumindest 1939
noch eine Schweiz zu entwerfen, die sich selbst als tolerante Beispieldemokratie versteht und
sich in dieser Rolle auch gefällt. Auch wurde eine humanistische Tradition, im Rahmen der
Neutralität, gross geschrieben. Der schweizerische Begriff der Freiheit war so nicht alleine
aus politischem Wachstum (alle Gründungsväter der politischen Schweiz waren Mitglieder
des Freisinns) heraus, ein liberaler. Zur Illustration dieser Grundwerte seien Zwei Zeilen aus
dem Landespsalm69
herbeigezogen:
„Betet, freie Schweizer, betet!“ (1. Strophe)
Und
Aus der zweiten Strophe: „Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!“
Diese beiden Zeilen gehören zu den wenigen, die implizit ein Bild des Schweizers von sich
selbst abgeben, da der Rest des Psalms weitgehend eine Lobpreisung auf den christlichen Gott
zu sein scheint. Gott wiederum wird in den Kontext zu Land und Natur gesetzt, was dem
Selbstverständnis hier einen rural-ländlichen Charakter verleiht.
Basierend auf diesen Grundwerten hat Armin Meili mit der Landi 1939 eine ideologische
Blaupause der Schweiz erstellt. Das kreierte Selbstbild sollte primär die Schweiz nach aussen
zu definieren wissen, dass dieses Bild auch nach aussen abzugrenzen vermögen würde, war
Meili wohl kaum bewusst.
Peter Gilg und Peter Hablützel teilen die Nachkriegszeit in der Schweiz in vier Phasen auf70
:
1. Die Periode von 1945 bis in die frühen 50er Jahre (Rückkehr zur liberalen
Wirtschaftspolitik)
2. Die Periode bis in die erste Hälfte der 60er Jahre (starker wirtschaftlicher
Aufschwung)
68
Bieler Tagblatt (08.05.1999) : „Die Expo.01 als Antwort auf die Landi“
69 Vgl. Schweizer Landeshymne (Schweizerpsalm)
70 Gilg Peter/Hablützel Peter 1986, in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer S. 834
40
3. Neue Krisen (Wirtschaftlicher Aufschwung gerät ins Stocken)
4. Seit 1974; beginnt mit der Wirtschaftlichen Rezension, Wachstum wird unterbrochen
und der Fortbestand des Wachstums wird als ungewiss betrachtet.
Die Untersuchung wird an spezifischen Punkten der Schweizer Geschichte auf jeweilig
relevante Diskurse fokussieren, diese angeführte Unterteilung Auflistung bringt daher
bestenfalls einen Eindruck der zu erwartenden Diskursumstände.
Als relevant qualifizieren sich diese für die Untersuchung ausgewählten Zeitpunkte wie
eingangs erläutert, da in ihnen die Abgrenzungsmechanismen ersichtlich werden und sich
und deren regulierende Auswirkungen auf den Diskurs zum Schweizerischen Selbstbild
zeigen. Ferner korrespondieren sie grob mit den von Peter Gilg und Peter Hablützel
etablierten Zeitetappen.
Konkret sind die ersten beiden Punkte Tschechien und Ungarn interessant, da das Dispositiv
„Weltpolitik“ respektive „Weltpolitische Situation“ den Diskurs um das Böse in der Schweiz
hier einrahmt und bestimmt. Die Wechselwirkung zwischen dem spezifischen Dispositiv und
dem spezifischen Diskurs sind im Fokus der Untersuchung, dementsprechend werden auch
jene historischen Punkte untersucht, welche diese Wechselwirkung und deren Logik
veranschaulichen. Die ersten beiden untersuchten Punkte zeigen diese Wechselwirkung in
sehr direkter Variante auf. Die Untersuchung des Putschversuches gegen Gorbatschow und
des Zerfalls der Sowjetunion ist relevant, da er das Böse respektive das Feindbild von seinen
materiellen oder wenn man so will „realen“ Ausprägungen zu trennen vermag. Der Putsch in
der Sowjetunion gegen die russische Bevölkerung, isoliert das Feindbild „Kommunismus“
gegenüber „den Russen“.
Die Untersuchung der Überfremdungsinitiative qualifiziert sich durch die Rückbezugnahme
auf das Dispositiv und die rhetorischen Figuren, welche den Diskurs um Tschechien und
Ungarn einrahmten respektive begleiteten. Insofern ist die Schwarzenbach-Initiative die
Kehrseite derselben Medaille. Derselbe Diskurstrang unter einem veränderten Dispositiv.
Es werden dieselben Macht/Wissen Strukturen aktiviert, wie zuvor, nur ist das den Diskurs
um das Böse rahmende Dispositiv neu „inländisch“. Dieser Transformation wird allerdings
Rechnung getragen werden.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion ist sehr wichtig für diese Analyse, da sich durch diesen
politischen Wandel das bis dato global konstruierte Dispositiv für den Schweizer Diskurs
41
vollkommen verändert. Ganz abgesehen von der totalen Transformation der politischen
Machtverhältnisse auf dem Planeten und dem Ende des Ost-West Konflikts, ist der
Zusammenbruch der Sowjetunion zur Beobachtung der Dekonstruktion der Feindbilder von
entscheidender Bedeutung. Dieser Punkt wird die Trennung von Feindbildern, deren
Ausprägungen (z.B. Menschen) und vor allem Wirkungen (Bedrohung zerfällt durch
Dekonstruktion) aufzeigen.
6.1. „Geistige Landesverteidigung“: Von der Selbstfindung zur Abgrenzung
Die Integrationskraft der Bauern- und Landidealisierung für die Schweizer Gesellschaft darf
allerdings, gemäss Theo Mäusli, nicht überschätzt werden.71
Vielmehr lag seiner Meinung
nach im realen Stadt-Land-Konflikt die grösste Zerreissprobe für die Schweiz, aus der sie
vielleicht nur dank dem Bewusstsein einer Bedrohung von außen einigermaßen geschlossen
herausgegangen ist,72
meint Mäusli.
So wurde gemäss Mäusli die Bedeutung von „Landi“ und Anbauschlacht retrospektiv vor
allem in ihrer den Stadt-Land-Gegensatz überbrückenden Wirkung gesehen. Besonders
kritische Punkte im Verhältnis zwischen Stadt und Land waren die Lebensmittelpreise und
der Militärdienst "das Fleisch war zu teuer für den Arbeiter- aber nicht genug teuer für den
Bauern."73
Die geistige Landesverteidigung, als Weiterführung, Intensivierung einer Selbstsuche durch
Abgrenzung scheint also hier erste nachvollziehbare Wirkungen angesichts entstandener
Notwendigkeiten zu zeigen. Auffälligerweise wurden auch die Sowjetischen Bauern in einem
ideologischen Kontext dazu aufgefordert die Stadtbevölkerung in gewissem Sinne
„Mitzutragen“ respektive wurde die Selbstvorstellung als kommunistisches Volk als
Begründung für etwaige Enteignungen angeführt.74
Doch stand die Grundfrage der geistigen Landesverteidigung nach der Begründung der
„gemeinsamen“ Verantwortung in Konsequenz eines Einheitsgefühls deutlich stärker im
Raum als es für die sowjetischen Bauern der Fall war. Während die Sowjetischen Bauern
71
Maurer Peter,1985 S.160
72 Mäusli Theo, 1995 S. 30
73 Mäusli Theo 1995 S. 31
74 Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongesses über den Grund und Boden, 26. Oktober (8. November) 1917
42
selbst die Kollektivierung des Bodens vorantrieben,75
standen sich die Schweizer Land- und
Stadtbevölkerung deutlich kritischer gegenüber, da sie einerseits mit jeweils anderen, fast
komplementären Aspekten des soweit etablierten Selbstverständnisses haderten.
Viele Städter sahen beispielsweise ihre berufliche Karriere durch die militärische
Abwesenheit gefährdet, während Bauerndiensterleichterungen zur Bestellung der Felder
gewährt wurden.76
Hier wird ersichtlich wie die identitätsstiftende Funktion der national
organisierten Armee in Frage gestellt wird. Die beiden Gruppen waren so ganz
unterschiedlichen Erlebniswelten in der Schweiz ausgesetzt und bezogen ihr Selbstbild
konsequenterweise aus anderen, teils widersprüchlichen Quellen.
Der Stadt begegneten ländlich verwurzelte Menschen mit Misstrauen, weil sie davon getrennt
waren, weil sie dort so etwas wie ein Infektionsherd mit Fremdem befürchteten. Das Fremde
ist, wie bereits hergeleitet, eine mögliche Grundstruktur für die Genese eines Feindbildes. So
identifiziert Mäusli eine Situation in der:
““Argwohn gegenüber Unbekannten zu einer geistigen Flucht ins ländlich-einfache führt,
kann sie auch zu einer vermeintlichen Flucht nach vorne in Fremdenhass, Rassismus und
Antisemitismus verleiten.““ 77
Auf dem Land selbst wurde so eine zunehmend generelle Ablehnung gegen alles „Fremde“
stark. Das Fremde liefert, wie hergeleitet bereits das Potenzial für das „Feindliche“ muss aber
nicht zwingend in diesem resultieren, solange das Fremde als Gast der Gast, eben Gast
bleibt.78
Da die Kategorie „Gast“ allerdings in dieser Situation kaum von Wirkung gewesen
sein dürfte, entspricht die Transformation vom Fremden ins feindliche der Logik der
Situation.
So entstand ein aber der Konflikt zwischen Stadt und Land auf Basis des antizipierten
Fremden. Die Stadt war (und ist bisweilen heute noch) aus Sicht der Bauern ein Hort des
Fremden und auch als Sozialverband anders, abgrenzend, eine klare Alternative und
dementsprechend eine Relation ihres eigenen „virtuellen Territoriums“. Es waren zudem
andere Probleme, die die Menschen in Stadt und Land unterschiedlich betrafen. Die Bauern
fühlten sich durch das Fremde aus den Städten bedroht und in ihrer Lebensqualität
75
Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongesses über den Grund und Boden, 26. Oktober (8. November) 1917
76 Mäusli 1995, Seite 31
77 Zitat aus: Mäusli, 1995, Seite 31
78 Vgl. Wagener, 1999, Seite 33
43
eingeschränkt. So wurde das „andere, Fremde und Neue“ zum Feindbild der Bauern.
Besonders aussagekräftig wird dieser Prozess durch das von Mäulsi angeführte Schicksal des
jüdischen Viehhändlers Arthur Bloch illustriert.
Mäusli illustriert diesen Vorgang folgendermassen:
„“Verschuldete Bauern ganzer Talschaften sollen ihre desolate Lage bisweilen auf die
traditionellerweise jüdischen Viehhändler zurückgeführt haben. Vor diesen Hintergrund
jedenfalls stellt ein Beobachter jener Zeit das Verbrechen an Arthur Bloch in der Nähe
von Payerne, der ermordet wurde, "weil er Jude war"79
.““80
Interessant für den Nachvollzug der Wirkung einer „geistigen Verteidigung“ dass der jüdische
Viehhändler trotz der eigentlich traditionell hergebrachten Beschäftigung und Funktion
plötzlich als fremd, als Feind wahrgenommen wird, gar soweit dass er ermordet wurde. Auch
hier wird die Wirkung des Feindbildes im Gegensatz zum Konkurrenten evident und die
verständnisbestimmende Macht der Diskurse auf schreckliche Weise demonstriert, da der
besagte Viehhändler Jahre zuvor kein fremder und besonders kein Feind war, es aufgrund des
Diskurses aber wurde, in einem Ausmass, das ihn als neue Verkörperung des Bösen, gar das
Leben kostete.
So zogen auch die seit dem frühen 20. Jahrhundert aufgekommenen Heimatwehren ihre
Daseinsberechtigung aus der Verteidigung der ländlichen Werte in der Schweiz. Sie standen
so durch ihren markanten Antisemitismus der an und für sich eher städtischen
Frontistenbewegung nahe.81
Gemäss ihren deutschen und italienischen Vorbildern brachten
die Frontisten alle Probleme auf die einfache Formel der verschworenen dunklen Mächte des
internationalen Judentums, des Bolschewismus und des Freimaurertums.82
Anders formuliert: Die anderen, das Ausland und die verschworenen Intellektuellen, das
Fremde. Doch dürften im Lichte des Hergeleiteten die Bauern aus anderen spezifischen
Gründen, als die Frontisten zu Antisemiten geworden sein. Insofern sich unterschiedliches
„Böses“ auch in denselben Feindbildern zu manifestieren vermag.
Auffälliger Weise hat sich diese Ablehnung des Fremden in den ländlichen Gebieten bis heute
gehalten. Im Kontext des Abstimmungsverhalten in Demokratien bezüglich der Nutzung der
79
Rings, 1990, S. 113
80 Zitat aus: Mäusli 1995 S. 31
81 Vgl. Mäusli 1995 Seite 31
82 Vgl. Mäusli 1995 Seite 31
44
Bürgerrechte stellen Bruno Frey et. al. fest, dass obwohl ländliche Gebiete von der
Immigration-Problematik deutlich weniger betroffen sind als städtische Gebiete,
dementsprechend kaum von den mit den Immigranten in Verbindung gebrachten, steigenden
Verbrechensstatistiken betroffen sind, aber in überproportionalem Mass gegen jeglichen
Ausbau der Bürgerrechte von Minderheiten stimmen. Im Speziellen stimmen sie gegen jeden
Ausbau der Bürgerrechte von Immigranten und religiösen Minderheiten.83
Zusammenfassend kann bereits hier zwischen Stadt und Land eine gesellschaftsinterne
„Bruchstelle“ der geistigen Landesverteidigung identifiziert werden. Obwohl die
Verteidigung im Gros noch der Bedrohung durch die faschistischen deutschen Nachbarn gilt,
findet auf dem Land bereits eine „Anfeindung des Fremden“ statt und in deren Konsequenz,
eine Abgrenzung nach Innen. Die wenigen im ausgehenden 19. Jahrhundert etablierten
„Rückbezugsinstanzen“ des Schweizer Selbstbildes (wie das Militär oder der „Helvetische
Mythos“) wurden so einer neuen Diskussion ausgesetzt. Der Diskurs um die Verteidigung von
was gegen wen, erwacht zum Leben.
Die Geistige Landesverteidigung der Schweizer war in ihrem Effekt also nicht so feindbildfrei
wie Armin Meili sie sich in der Planung der Landi 1939 vorgestellt hatte. Vielmehr wurden
alsbald von diversen Gruppen eine ganze Reihe an Menschen, Politiken und Dingen gefunden
vor denen man sich „geistig“ zu verteidigen suchte und die folglich dem Diskurstrang
ausgesetzt wurden.
Während die Schweiz als Ganzes sich bestimmt ideologisch von der Nationalsozialistischen
Macht Deutschlands abgrenzte, war dennoch eine latente Deutschfreundlichkeit, vor allem in
der Deutschschweiz zu beobachten, welche natürlich im fortschreitenden Kriegsverlauf
zunehmend kleineren Gruppen an Extremisten überlassen wurde. Mäusli betont in Bezug auf
Georg Kries Aufsatz zum Stellenwert des Rassendenkens in der Schweiz der frühen
Dreißigerjahre, dass dieses „Denken in Rassenkategorien“ sich zwar in weiten Teilen mit dem
Nationalsozialistischen Denken deckte, doch eben nicht Resultat einer Übernahme eines
ausländischen Ideologieangebots war. 84
So verknüpfte der führende Bauern-Politiker Ernst Laur die traditionalistische und
nationalistische Mentalität mit einem anscheinend ganz besonderen, ländlich-bäuerlichen
83
Frey/Goette, 1988, S.1343-1348
84 Ruffieux 1974 S. 363
45
Inhalt. Dies ist allerdings keine typisch schweizerische Erscheinung, wenn auch diese
Strategie in der Schweiz vor und während des Zweiten Weltkriegs ziemlich erfolgreich war.85
6.2. Kriegsende , der „Sonderfall Kleinstaat“ und das neue Dispositiv
Mit 1945 begann das, was Peter Dürrenmatt die “offene Situation“86
nennt. Sie schien
zunächst, etwa wie in den ersten zehn Jahren der Nachkriegszeit, seiner Auffassung nach
„keine Probleme zu stellen“.87
„Die Schweiz hält durch“ lautete die Parole. Das schien
Dürrenmatts Interpretation zufolge zu genügen, und er sieht die Haltung in den damaligen
außenpolitischen Verhältnissen bestätigt.88
Aus heutiger Perspektive ist diese Einschätzung als Trugschluss zu kategorisieren. Wie
hergeleitet werden wird, war die Schweiz nicht in ihrem Selbst definiert, nur war diese
Selbstdefinition noch nicht abgeschlossen und sich selbst genug, sondern lediglich noch (um
Mäuslis Begriff zu bemühen) „offen“. Insofern die Abgrenzungs- und entsprechenden
Konfliktlinien eher „schwammig“ und noch nicht stark umrissen waren.
Durch das Ende des Zweiten Weltkrieges und die weitgehende Auslöschung der
nationalsozialistischen Strukturen in der ganzen westlichen Welt, löste sich die Struktur des
Dispositivs um den Diskursstrang der geistigen Landesverteidigung teilweise auf und wurde
neu gebildet. Wir beobachten also einen Moment der „ideologischen Freiheit, der sich aus der
notwendigen „Neudefinition“ und der daraus folgenden Neuorientierung der geistigen
Landesverteidigung ergibt, gleichzeitig aber den Diskurs in Richtung der „Enge“ auslösen
soll.
7. Diskurse um das Schweizer Selbstbild
Nach dem sich das Dispositiv der Zwischenkriegszeit und des Kriegszustandes, insofern
verändert hatte, als dass der Krieg vorbei und der Feind besiegt war, entstanden nun neue,
ich wage zu behaupten „offenere“ Diskurse. Das Feindbild „Nationalsozialisten“ war besiegt,
die entsprechende Ideologie als „Wahnsinn“ definitiv aus dem politischen und
gesellschaftlichen Spektrum ausgeschlossen. Am 1. Mai 1945, als die Kriegslage klar auf eine
85
Mäusli 1995 Seite 29
86 Dürrenmatt, 1979, Seite 191
87 Dürrenmatt, 1979, Seite 191
88 Dürrenmatt, 1979, Seite 191
46
vollständige Eliminierung des dritten Reichs hindeutete, befahl der Bundesrat die Auflösung
der NSDAP-Landesgruppe Schweiz und ihrer angegliederten Organisationen. Die Polizei
wurde innerhalb einer Woche darauf angesetzt eine groß angelegte Fahndungsaktion
durchzuführen um etwaige belastende Materialien bei Diplomaten als auch Sympathisanten
des dritten Reiches sicherzustellen. Da zwischen bundesrätlicher Proklamation und
Durchführung eine gute Woche verstrich, hielten sich die Funde und entsprechenden
Verhaftungen in Grenzen.
Relevant ist hier die Transformation des Dispositivs; während die politische als auch die
Gesellschaftliche Schweiz während des Krieges sich mit dem nationalsozialistischen
Gedankengut und den entsprechenden Expansionsbestrebungen, außenpolitisch als auch
innenpolitisch zu arrangieren wusste, wurde mit der Kriegsniederlage die geistige
Landesverteidigung zu einem vorläufigen und totalen Sieg im Innern geführt; der geistige
Feind wurde richtiggehend aus der Schweiz radiert. Dieser Umstand generierte wohl die
Illusion eines erfolgreich verteidigten „geistigen Selbst“. Diese Wahrnehmung kontrastierte
natürlich sehr stark mit dem Schweizerischen aussenpolitischen Verhalten während des
Krieges. So hatte die Schweiz noch 1943 die Einreisebedingungen für Flüchtlinge jeglicher
Couleur verschärft, obwohl der Bundesrat bereits 1942 über die Judenverfolgung informiert
war.89
Auch das abbilden eines Judensterns im Reisepass, geschah mitunter auf Drängen der
Schweizer Grenzbehörden hin.
Nun war die geistige Landesverteidigung ihres Gegenstücks beraubt und man hatte sich neu
zu „idealisieren“. Wir erinnern uns an die im Zuge der Definition angeführten
Konzeptionellen Problematik einer Verteidigung, deren Feind nicht mehr existiert.
Dieser neue Diskurs bezog sich mitunter auf die Rolle der Schweiz während des Zweiten
Weltkriegs: In den drei Jahrzehnten der Nachkriegszeit entstanden laut Dürrenmatt von der
Folgegeneration her kritische Fragen bezüglich des Standhaltens in der Kriegszeit:
“Hatte das Standhalten allein genügt? Ist das, was die Hochkonjunktur brachte, als Segen
zu bewerten, oder deuten bestimmte Fehlentwicklungen nicht auch ein Schweizer
Versagen an? Geht man den Zweifeln nach, wie sie in zahlreichen Publikationen ihren
Niederschlag fanden, so ergibt sich, dass die Zweifel vornehmlich denjenigen
bestehenden Institutionen galten, von denen die ältere Generation überzeugt waren, dass
sie zu den Grundlagen und damit zur Eigenart des selbständigen nationalen Existenz der
Schweiz zählten. Zweifelnde Fragen galten etwa der Kleinheit des Landes. Ob diese
89
Jost, am Mittwoch 30. Januar 2013, politblog24heures.ch
47
Begrenztheit nicht bedinge, dass auch der beste aufbauende Wille Schiffbruch erleiden
müsse, ob sie genüge, mit der breiten Problematik, die über die Landesgrenzen hinaus
reicht, fertig zu werden. Die Zweifel galten mitunter der Frage, ob der föderalistische
Aufbau des Landes und die eher mühsam und umständlich arbeitende direkte Demokratie
dem Tempo des Zeitalters noch angemessen, ja überhaupt noch zeitgemäß sei.“90
Diese Fragen waren natürlich mitbedingt durch die allseits spürbare Abhängigkeit von
Vorgängen im Ausland. Eine Abhängigkeit, die das Selbstverständnis der Schweizer auf
andauernde Proben stellte und stetig neue, situative Positionsbezüge forderte. Mit dem Beginn
der Rückschläge auf dem wirtschaftlichen Gebiet bekam gerade dieser Aspekt der
Abhängigkeit besonders Aktualität.91
Im Hinblick auf solche Fragen hieß „Besinnung“ sich in Bezug auf das schweizerische
„Selbst“ zu erhellen, die Eigenart der schweizerischen politischen Existenzform abzuklären,
diese näher zu umschreiben und auf ihre Fähigkeit, sich in dieser Zeit zu bewähren, zu
untersuchen. Was natürlich unter den zuweilen als fragwürdig begriffenen, herkömmlichen
Referenzinstanzen des Schweizer Selbstbildes, neue komplexere Diskurse zutage förderte.
Die außen- und innenpolitischen Probleme des Schweizer Staates waren also in Wirklichkeit
mit dem Kriegsende 1945 alles andere als erledigt. Die außenpolitische Problematik äußerte
sich unter anderem in den Neuordnungsplänen Siegermächte, in welchen die Neutralität der
Schweiz nicht in Stein gemeißelt war.
Die Schweiz stand sogar im Ruf, aufgrund dieser im Inneren identitätsstiftenden Neutralität
indirekt den Nazis wesentliche Dienste geleistet zu haben. Hier stand also bereits mit
Kriegsende auch auf internationaler, außenpolitischer Ebene, eine implizite Loyalitätsfrage im
Raum, die direkt die außenpolitischen Verhältnisse betraf und aus diesem Sektor entsprang,
indirekt aber Konsequenzen für den Diskurs um die Selbstfindung der Schweizer als
Schweizer haben sollte. Es war zudem völlig klar, dass der europäische Kontinent mit dem
Verschwinden Frankreichs und Deutschland als potente Grossmächte, dem Druck der
siegreich vorrückenden Russen und Amerikaner mehr oder minder ohnmächtig gegenüber
stand. Insbesondere ein Kleinstaat wie die Schweiz, würde sich in diesem globalen Kontext
keine Illusionen über die dominanten geopolitischen Machtverhältnisse machen.
Entsprechend ist die von der bereits 1914, also zum Ende des ersten Weltkrieges gegründete
„Neue Helvetische Gesellschaft“ (NHG) veranstaltete am 15./16. April 1944 eine öffentliche
90
Zitat aus: Dürrenmatt 1979, Seite 191
91 Dürrenmatt 1979, Seite 191
48
Tagung zu "Neutralität in unserer zukünftigen Politik" zu kontextualisieren: Hier analysierte
der Basler Privatdozent Adolf Gasser, ein Heer-und-Haus-Referent, die Internationale Lage
nach einem Sieg der Alliierten:
„"In diesem Fall wird die Welt und damit ein künftiger Völkerbund von einer Hegemonie
der vier führenden Weltmächte beherrscht werden. In die Machtsphäre dieser Staaten
werden die Kleinstaaten gezogen werden. Sie werden geradezu zur Reibungsfläche
werden. Ferner wird die Zerrissenheit Europas diese Entwicklung fördern. Ein vollständig
in kleinen und Mitgliedstaaten aufgelöstes Europa neigt dazu wegen seiner Schwäche der
Kampfplatz für die zu erwartenden Auseinandersetzungen der Hegemonie anvisierenden
Grossmächte zu werden. "“92
Man verstand sich also schon direkt nach dem Zweiten Weltkrieg als „Sonderfall Kleinstaat“
und implizierte spezifische politische Schwierigkeiten in diese Kategorisierung. Die
Bedeutung des „globalen Dispositivs“ wurde also bereits mit Kriegsende thematisiert.
Das „Lebensrecht des Kleinstaates“ wurde zu einem Grundthema des untersuchten Diskurses.
Im Oktober 1944 einigten sich Churchill und Stalin über die Einflusssphären in Balkan, und
im Februar 1945 regelte die Konferenz von Jalta die Abgrenzung des amerikanischen vom
russischen Einflussbereich. Diesen globalen Transformationen wurde in erster Instanz mit
Abschottung begegnet. Der Zürcher Staatsrechtler Werner Kägi äusserte in seinen "Bericht
der Nachkriegspolitik" zu Händen der NHG (Neue Helvetische Gesellschaft)1945 Skepsis
gegenüber der geplanten "Vereinten Nationen":
"Es bestehe wirklich keine Eile, einem "Bunde" beizutreten, der nichts anderes ist als ein
Machtsystem in der Hand der "drei". Das Projekt von Dumbarton Oaks ist für die
Kleinstaaten wenig einladend. Auch in Jalta hat man sich bestimmt nicht mit ihren
Sorgen befasst. "93
Als exemplarisch für die Differenzen zwischen der „außenpolitischen Schweiz“ zur
„Innenpolitischen Schweiz“ mag die Beziehung zu der im Anschluss an den Zweiten
Weltkrieg gegründeten UNO herangezogen werden. Peter Dürrenmatt beschreibt die
Beziehung der Schweiz zu den Vereinten Nationen etappenweise. So zeigte sich seiner
Ausführung nach die Schweiz schnell bereit, sich auf Feldern zu betätigen, die über das Ziel
der Sicherheitspolitik hinausreichten, trat aber bis in die 90er Jahre dem Bund nicht bei.94
92
Zitat nach: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987 Seite 56
93 Zitat aus: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987 Seite 56
94 Dürrenmatt, 1979 Seite 228 ff.
49
Durch den Krieg entstand in den betroffenen Regionen unter Anderem großes Kinderelend,
die UNO gründete dem begegnend ein Umfang- und segensreiches Kinderhilfswerk. Auch
um den Hunger zu bezwingen traf die UNO weitreichende Maßnahmen. Auch gegenüber dem
Flüchtlingselend wurde die Uno aktiv, andere UNO-Suborganisationen galten der Förderung
des Bildungswesens und dem Kampf gegen das Analphabetentum (UNESCO), bei deren
Bemühungen sich die Schweiz ebenfalls aktiv beteiligte. Es sind damit nur einige der vielen
UNO-Aktionen erwähnt, zu denen die Schweiz zur Teilhabe eingeladen wurde. Die Schweiz
half (entsprechend ihres humanistischen Selbstverständnisses) mit, diese Werke zu
finanzieren und in einigen Fällen wurden Schweizer gar in verantwortliche Posten berufen.
Hier wird die „Humanitäre Tradition“ der Schweiz herauskristallisiert, auf welche im Laufe
der folgenden Jahrzehnte vornehmlich aus Linken politischen Kreisen Referenz gezogen
werden soll. An dieser Stelle bleibt allerdings fraglich, ob es sich um eine moral-
philosophische Tradition oder um einen „schlichten“ außenpolitischen Positionsbezug
handelte.
Zusammenfassend sah sich die Schweiz als erfolgreich „verteidigt“, respektive als erfolgreich
„durchgehalten“ an, eine Wahrnehmung die in Bezug auf ihre Selbstverständnis-Quellen unter
dem Schatten des Zweifels stehen sollte und so den Anstoß zu neuen Diskursen liefern würde.
Das „Durchhalten“ war in vielerlei Beziehung eine Grundelement der Schweizer Armee- und
„Kriegskultur“: Auf militärischer Ebene wurden Pläne geschmiedet, die nicht etwa eine
Expansion der Schweiz oder eine effektive Verteidigung der Schweizer Grenzen zum Inhalt
hatten, sondern eine Invasion als bereits gegeben annahmen. So wurde durch strategische
Konzepte wie dem Réduit, welches im Wesentlichen daraus bestand sich in einer gigantischen
Bunkeranlage einzuigeln bis allfällige Aggressoren durch Guerillataktiken zur Aufgabe
zermürbt würden, die Durchhalteparole auf Regierungsebene verstärkt. Man sah sich also
schon zu Zeiten des zweiten Weltkriegs, gemessen an der geopolitischen Situation, als
potenzielles Opfer, das sich im Ernstfall gegen einen übermächtigen Täter zu verteidigen
haben werde.
Im Inneren, also auf gesellschaftlicher Ebene, galt die geistige Landesverteidigung dem
Widerstand gegen andere Ideologien, die ähnlich eines potentiellen Invasors, ausgehalten
werden sollten, bis sie verschwinden. Die globalpolitischen Geschehnisse verlangten nach
einem erneuten Positionsbezug, im Inneren wie auch im Äußeren. Insofern einer neuen
ideologischen Strategie, man konnte nicht mehr einfach Schweiz sein und abwarten. Weil
dieses „einfach Schweiz sein“ zum Einen neuen definitorischen Diskursen ausgesetzt war und
50
zum anderen durch die Rhetorik der Siegermächte ideologische außenpolitische
Positionsbezüge verlangt wurden, die gerade im Kontext der Reflexion der Rolle der Schweiz
im Zweiten Weltkrieg eine Stringenz zur innenpolitischen Ideologie aufweisen mussten.
Diese Positionsbezüge sollten durch äußere Katalysatoren beschleunigt werden, wie sich im
Folgenden zeigen wird.
7.1. Prag 1948: Der Vorhang fällt (Dispositiv)
Die Kombination realistischer außenpolitischer Befürchtungen und innenpolitischer
Reibungen, von denen die meisten westlichen Gesellschaften zu jenem Zeitpunkt betroffen
waren, insbesondere die Nichtkriegsparteien, stellte einen fruchtbaren Boden dar, für die
Bemühungen der USA, ihre Kriegsvereinbarungen mit der Sowjetunion zu ihren Gunsten zu
revidieren und als Kampf für die Freiheit der Welt propagandistisch zu verankern. Die neue
Policy des Präsidenten Truman steuerte, gemäß Frischknecht, Hafner, Haldimann und Niggli,
seit März 1945 einen klaren Kurs auf eine Revision der Jalta und anderer
Weltaufteilungsabkommen an.95
Der nach dem Krieg nicht wieder gewählte britische Premier Churchill wird von den
genannten Autoren als „Propagandisten der neuen Truman Politik auf dem europäischen
Kontinent“ kategorisiert. Churchill intonierte schliesslich den kommenden kalten Krieg in
seiner berühmten Rede in Fulton (Missouri) am 5. März 194696
:
„"von Stettin an der Ostsee bis Triest an der Adria hat sich ein "eiserner Vorhang" über
den Kontinent herab gesenkt." Es war wohl seinerzeit nur wenigen bekannt, dass der
Nazi-Propagandaminister Goebbels diesen Begriff in einer Rede am 23. Februar 1945 als
erster geprägt hatte, als er die Jalta-Abkommen, die Churchill mitunterzeichnete,
öffentlich verurteilte: "das Zugeständnis, die Russen Ost und Südeuropa besetzen zu
lassen, führt dazu, dass sich ein eiserner Vorhang über diese Gebiete herab senkt. Hinter
diesem Vorhang wird dann eine Massenabschlachtung von Völkern beginnen,
wahrscheinlich unter dem Beifall der Judenpresse in New York."“ 97
Für die schweizerische Öffentlichkeit bestand spätestens mit Verkündung der Truman-
Doktrin am 12. März 1947 ein zumindest implizites Ultimatum nach einer „Für uns oder
gegen uns“ Rhetorik. Truman bekundete damals, dass sich jedes Land und jedes Volk
zwischen zwei verschiedenen Wegen zu Leben („Way of Life“) zu entscheiden habe, diese
95
Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 56
96 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 56
97 Zitiert aus: John Lukacs 1955, „decline and rise of Europe“ in: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987,
Seite 56
51
Proklamation fiel mitten in die Moskauer Konferenz zur Regelung der deutschen Frage und
brachte diese so faktisch zum Scheitern. So begann der keimende Ost-West-Antagonismus
rasant seine ersten Blüten zu treiben.
Während die Amerikaner also in Griechenland einmarschierten, um die bankrotten Briten im
Kampf gegen die kommunistische Aufstandsbewegung abzulösen, griffen die Sowjets in
Ungarn durch und liessen die Führer der bürgerlichen Parteien verhaften. Im Mai 1947, also 3
Monate nach Verlautbarung der Truman-Doktrin, wurde der Marschall-Plan als
"Gegenoffensive" zu den russischen Massnahmen in Osteuropa gestartet, worauf die
Sowjetunion im Sommer mit einer ganzen Reihe von Wirtschaftsabkommen mit den von
ihnen besetzten Ländern antwortete. Das globale Dispositiv zeichnete sich also zusehends
schärfer aus.98
Im November 1947 rief Stalin, gewissermaßen als Vollendung der Antwort auf den
Transatlantischen Zusammenschluss ein neues internationales Kollektiv einzelner
kommunistischer Parteien ins Leben, die „Kominform“, die in der Gründungserklärung
faktisch die Truman-Doktrin für den Ostblock kopierte.
7.2. Der Positionsbezug nach Innen (Diskurs)
Am 28. Februar 1948 titelt der Spiegel: „Der Vorhang fiel-tragische Chöre in Prag.“99
Seinen
Anfang fand der „Februar-Putsch“, mit den zwölf antikommunistischen Ministern des seit 19
Monaten bestehenden Sechs-Parteien-Kabinetts des Kommunisten Gottwald, die aus Protest
zurückgetreten waren. Laut dem Spiegel waren die Minister zurückgetreten weil sie „die
Alarmglocken hörten“100
, als Gottwalds kommunistischer Innenminister Vaclav Nosek die
Schlüsselstellungen der tschechischen Polizei mit seinen Leuten besetzen ließ.
Dementsprechend begann die vom kommunistischen Innenminister abhängige Polizei mit
Hausdurchsuchungen und Verhaftungen am laufenden Band, die "reaktionäre Staatsstreichpläne"
der Oppositionsparteien zutage förderten. Neben Geheimpolizisten, die erstmalig ein rotes Band im
98
Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, S.57
99 Zitiert aus: Der Spiegel 9/1948
100 Zitiert aus: http: Der Spiegel 9/1948
52
Knopfloch als Erkennungszeichen trugen, tauchten auch neugebildete Arbeitermilizen mit roten
Armbinden auf, "um den souveränen Willen des Volkes zu sichern."101
Der Umstand, dass die kommunistischen Gewerkschaften eine relevante Rolle bei der
Machtübernahme einnahmen, hat in der Schweiz das Misstrauen gegenüber inländischen
kommunistisch beeinflussten Gruppierungen geschürt. Die Tschechischen kommunistischen
Gruppen verhinderten in Prag beispielsweise das Erscheinen rechtsgerichteter
Oppositionszeitungen, ferner drohten sie relativ unverblümt mit einem Generalstreik. Kurzum; die
tschechoslowakischen Gewerkschaften konnten offenbar ohne Weiteres zu Putschaktionen gegen
die Demokratischen Strukturen „aktiviert“ werden und waren so eine ideologische Bedrohung für
die liberalen Grundverständnis der Schweizer Interessant für diese Untersuchung ist natürlich der
vom New Yorker Herald Tribune gezogene und vom deutschen Spiegel übernommene Vergleich
zwischen den Bolschewisten und den Nationalsozialisten:
„"Die gleiche Rolle, wie sie Hindenburg gegenüber Hitler spielte, mußte Benesch jetzt
gegenüber Gottwald spielen", kommentierte die "New York Herald Tribune". Sie fügte hinzu:
"Trotz des unerhörten Drucks war der Augenblick gekommen, wo Kompromisse und
Zugeständnisse nicht mehr recht und ehrenhaft waren."“102
Wie im Zusammenhang mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs erklärt, befand sich der
„Nationalsozialismus“ als Konstrukt und Symbol bereits weit außerhalb der gesellschaftlichen
Abgrenzungslinien. Als Bedrohung und als Wahnsinn, war der Nationalsozialismus auf
politischer, sozialer und ideologischer Ebene „verdammt“. Der Vergleich zwischen
kommunistischen und nationalsozialistischen Elementen, kommt also einer Kategorisierung
als „böse“ und einer entsprechenden Reaktivierung gleich.
Staatspräsident Dr. Eduard Benesch erkannte die Demission der zwölf Minister und die neue
Regierung Gottwalds an und legalisierte sie so. Dieser hatte alle entscheidenden Posten mit
Parteigenossen oder prokommunistischen Sozialdemokraten besetzt. In den
Oppositionsparteien fand er vier Minister, die ihm halfen, den Anschein der nationalen Front
aufrechtzuerhalten. Sie wurden postwendend aus ihren Parteien ausgeschlossen.
Die kommunistische Machtergreifung in der Tschechoslowakei im Februar 1948 machte es
den Schweizern, wohl aufgrund ihrer staatsaushöhlenden Heftigkeit, unmöglich einen
wirklich neutralen ideologischen Standpunkt zwischen den beiden antagonistischen,
101
Zitiert aus: Der Spiegel 9/1948
102 Zitiert in: Der Spiegel 9/1948
53
systematischen Positionen zu halten. Zu vieles wurde mit diesem Putsch in Zweifel gezogen,
das auch für die Schweiz verbreitet zur Basis der Selbstwahrnehmung gehörte. Wie bereits
dargelegt war diese Basis zu diesem Zeitpunkt bereits angeschlagen. Die Schweiz trat also im
Rahmen dieser weltpolitischen Situation innerlich in den kalten Krieg ein indem sie
gegenüber den globalen Geschehnissen Position bezog.
Der gewaltsame Regierungsputsch in Prag weckte eine Empörungswelle an den
schweizerischen Hochschulen: Es folgten sich Kundgebungen in Freiburg, Zürich, Bern
Lausanne und Genf. Die Kundgebung an der Berner Universität war durch die freisinnige
Hochschulgruppe organisiert worden, Hauptredner der 23 -jährige Politikstudent Peter Sager,
späterer Leiter des schweizerischen Ostinstitutes, der das Leitmotiv des künftigen
Antikommunismus recht prägnant formulierte und so bereits die Kategorisierung des
Kommunismus als „Böse“ vornahm:
"Heute ist nicht mehr die Auseinandersetzung zwischen zwei Systemen, sondern es ist ein
Kampf des Bösen gegen das Gute."103
Peter Sager fungierte hier als Stimme des Liberalismus und vermochte in dieser Rolle einen
Grossteil der Studenten zu mobilisieren. Ferner ist der Begriff des „Bösen“, hier bereits in den
Diskurs eingeführt, es handelte sich ab diesem Punkt nicht mehr um alternative politische Systeme
oder Weltauffassungen sondern, wie Sager es formuliert, um einen Kampf des Guten gegen das
Böse.
Dieser klaren Verdammung der Geschehnisse in der Tschechoslowakei entsprechend, lehnten eine
Woche später alle Schweizer Hochschulen geschlossen die Einladung ab, an der
Sechshundertjahrfeier der Universität Prag teilzunehmen.104
Gleichsam verurteilten alle Parteien bis hin zur SPS und die gerade tagende Kantons-
Gemeindeparlamente den Umsturz in Prag aufs schärfste und gemäß der internationalen politischen
Lage, oft in apokalyptischer Form. Beispielsweise schrieb die NZZ in ihrem Leitartikel am 7.3.
1948:
„Wie man auf Leben und Tod den „Dämonen des Hitlertums“ widerstanden habe, werde
man die teuflische Methodik, der erweiterten Strategie, mit der freiheitlichen Staaten
103
Zitiert in: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987 , Seite 57, zitiert aus: NZZ 3.3. 48 nr.460
104 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 57
54
von innen heraus erobert und für die Einordnung in das Hegemoniesystem eine
Grossmacht gewonnen werden ,"zu durchkreuzen wissen.“105
Auch hier wird ersichtlich, dass in der medialen, als auch in der politischen Verarbeitung der
Geschehnisse eine Grenzziehungs-Rhetorik des „Guten gegen das Böse“ bereits ihren
Eingang in den Diskurs der geistigen Landesverteidigung gefunden hatte. Durch die
Gleichsetzung der Sowjetunion mit dem Dritten Reich wurde eine bereits erfolgte und vor
allem stark etablierte Ausschließung reaktiviert, die Kommunisten mussten nicht mehr
differenziert betrachtet werden, es war nicht nötig sich erneut einem Positionsbezug und den
entsprechenden Reflexionen auszusetzen, da diese an sich ja durch die Kriegszeit bereits
stattgefunden hatten, man hatte „schon mal widerstanden“ also würde man es wieder tun, egal
wer der neue Feind sein würde. So wurde der Prager „Februar-Putsch“, zum Scheidepunkt für
die Schweizer Gesellschaft und die ideologische Ausrichtung der geistigen
Landesverteidigung.
Das Verhalten der Partei der Arbeit (PdA) in Reaktion auf den Umsturz durch die von der
Sowjetunion angeleiteten kommunistische Partei, brachte die Verhandlung im direkten
Anschluss auf ein sehr konkretes innenpolitisches Niveau und beschleunigte den bürgerlichen
Anspruch auf die „Geistige Landesverteidigung“.
Die Schweizerische Partei der Arbeit (PdA) beging eine öffentliche Siegesfeier am 27.
Februar 1948, an welcher sie den Tschechischen Kommunistenführer Gottwald per
Telegramm zu seinem Triumph beglückwünschte und die Vorgänge als erfolgreiche
Revolution bezeichnete. Jedermann (also jedem Schweizer) war nach den Geschehnissen in
Prag klar, dass die Politik der PdA, welche sie ja selbst durch diese Beglückwünschung mit
der internationalen kommunistischen Norm gleichgesetzt hatte, nur über wesentliche
Verschiebungen der politischen Kräfteverhältnisse und Strukturen zu ihrem politischen Ziel
kommen könnte.106
Diese befürwortende Haltung stieß in der Schweizer Politik und Bevölkerung auf breite
Verurteilung. Alsbald wurde die PdA als "Partei des Auslandes" und potentielle fünfte
Kolonne geschmäht und verlor so innerhalb weniger Wochen ihren politischen Einfluss, der
105
Zitiert aus NZZ 7.3.1948 Nr. 463
106 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 57
55
in den eidgenössischen Wahlen 1947 mit 50'000 Wählerstimmen respektive 5 % ihren
bisherigen Höchstwert erreicht hatte.107
So schreibt die NZZ vom 11. 3. 1948 bezeichnend:
„Prag gestaltete sich so zu der eigentlichen innenpolitischen "Rechnung" – nicht die
aussenpolitische Bedrohung, sondern die Existenz einer kommunistischen Partei in der
Schweiz wurde so zum Prüfstein nationaler Gesinnung gemacht.“108
Es ist kein Zufall, wenn die Demokratische Partei (die seit den dreißiger Jahren mit der SPS lose
verhängt) in ihrer Verurteilung der Ereignisse in der Tschechoslowakei als probates Abwehrmittel
gegen allfällige Umsturzgefahren in der Schweiz die Vollendung des "sozialen
Verständigungswerks zwischen allen Kreisen des Volkes"109
verlauten liess.110
Die Abgrenzung
scheint hier nach beiden Seiten zu funktionieren, der Moment der Differenzierung, der
Unterscheidung liefert auch Anlass, wie im Fall der demokratischen Partei „Inklusionen“
herzustellen oder zu betonen.
Auch die die Erklärung der sozialdemokratischen Partei fiel Tenorkonform aus, die SP forderte bin
der Staatsschutzdebatte im Nationalrat die..„
"Handhabung dieser Bestimmungen (…) gegen alle Feinde der Demokratie und des
wahren sozialen Fortschritts ", eine leere Hoffnung, wie sich in den folgenden Jahren
erwies.“111
Auch hier ist die Abgrenzung ersichtlich; es wird gefordert gegen die Feinde der Demokratie
vorzugehen und der „wahre soziale Weg“ vom Kommunismus abgegrenzt. Die
Nuancierungen wurden laut Frischknecht, Hafner, Haldimann und Niggli in der bürgerlichen
Presse scharf registriert und dort an den Pranger gestellt, wo eine explizite Verurteilung der
PdAs durch die SPS, wie es in Zürich der Fall war, fehlte.112
Auffallend ist, wie die PdA zum „Feind“ und gleichzeitig die kommunistische Gesinnung
zum „Bösen“ ernannt wird. Genauer den vorangegangenen Überlegungen entsprechend
107
Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 57
108 NZZ, 11. 3. 1948
109 NZZ, 3.3.1948, Nummer 453
110 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
111 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
112 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
56
formuliert; wird die Kommunistische Gesinnung in diesem Kontext zum Bösen, die
Sowjetunion zum Feindbild und die PdA zum Feind der Schweizer Gesellschaft.
Das Dispositiv, das um den Schweizer Diskurs zur „Selbstdefinition“ einrahmte hatte durch
die Geschehnisse in Prag schlagartig eine neue Form angenommen. Die Sowjetunion tat sich
als Unterdrücker eines demokratischen, kleineren Staates hervor. Mit dieser Handlung
attackierte der Kommunismus, einige der wenigen „Grundbausteine“ des soweit noch
vorhandenen „Schweizer Selbst“, wie die Demokratie, die Freiheit (im Sinne einer liberalen
Tradition der Schweiz) und das Lebensrecht als Kleinstaat.
Die kommunistische Haltung wurde postwendend über diese Ausschliessungsmechanismen
zum „Bösen“ stilisiert und mit ihr fand diese „Abrechnung nach Innen“ statt. Welche
strategischen Überlegungen die PdA dazu bewegten, sich derart klar auf die Seite des
sowjetischen Putschisten in Tschechien zu stellen, kann hier nicht beantwortet werden,
vielleicht hatte man schlicht die politische Zustimmung dahingehend überschätzt, als dass
eine klare Solidarisierung mit dem internationalen Kommunismus zu einer Blockbildung
innerhalb der Schweizer Gesellschaft führen würde und man sich so dem Zulauf aller
anderen durch die bürgerliche Beanspruchung der Schweiz ausgeschlossen erfreuen würde.
Das Gegenteil war der Fall.
Der nationale Freisinn fand sich bald ermächtigt, auch die staatlichen Organe zu einer
Verurteilung und Aktivwerdung gegen die kommunistischen Elemente im eigenen Land zu
bewegen. Der Nebelspalter stellt den „Ausschluss“ in Form eines überkochenden Glases
Marmelade dar, das nicht in den Schrank zu den anderen passt:
57
113
An der Berner Kundgebung wurde schon "unnachsichtigere Überwachung aller
kommunistischen Elemente in der Schweiz" gefordert und die vereinigten bürgerlichen
Parteien verlangten am 8. März 1948 vom Zürcher Regierungsrat, "allen ihm zu Gebote
stehenden Mitteln ersetzenden Umtrieben rechtzeitig und kompromisslos entgegenzutreten",
ein Refrain, der von den meisten, vor allem freisinnigen Parteierklärung durchs ganze Land
hindurch aufgegriffen wurde.114
In jenen Monaten wurde die Staatsschutzgesetzgebung, neuerdings einer Überprüfung durch
die eidgenössischen Kammern unterzogen. Diese Debatte stand nun unweigerlich unter dem
Schatten der Geschehnisse in Prag, die den Diskurs als neues Dispositiv einrahmten. Es war
nun nicht mehr möglich eine neutrale Position zu halten, da sich die Sowjetunion klar zu
113
„Helvetas Hausfrauensorgen“, Nebelspalter 1948 Vgl. Bildverzeichnis Abbildung A
114 Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58 ff.
58
erkennen gegeben hatte. Vornehmlich diese neuen Umstände motivierten die Räte sich für
eine Verstärkung des „Staatsschutzes“ einzusetzen.
Am 4. März 1948 warnte die Kommission unter Leitung des katholisch-konservativen
Oberwallisers Escher, dementsprechend
"“keine Lockerung der Stadtschutzbestimmungen eintreten zu lassen, sondern
gegebenenfalls dieselben zu verschärfen und in die ordentliche Gesetzgebung über
zuführen".““115
Die Abwehr staatsgefährdender Umtriebe beschäftigte auch die darauf folgende Sitzung der
Landesverteidigungskommission vom 24. März 1948, an welcher der EMD (Eidg. Militär
Departement) -Vorsteher Bundesrat Karl Kobelt formulierte: „
"Unter den zu treffenden Massnahmen müsste vor allem die Vorbereitung gegen
kommunistische Agitation und allfällige Umsturzversuch im eigenen Land gepflegt
werden. In erster Linie ist die geistige Landesverteidigung zu fördern durch eine
entsprechende Aufklärung der Bevölkerung mittels Presse, Konferenzen und
gegebenenfalls durch eine Wiederbelebung der Tätigkeit der Sektion "Heer und
Haus“.“116
An dieser Stelle wird klar welche Tragweite der geistigen Landesverteidigung im Schweizer
Diskurs haben sollte. Sie ist ein von höchster politischer Instanz empfohlenes bis hin zu einem
befohlenen Konzept, das der Bevölkerung durch die Medien, Anlässe und daraus folgend
durch die Wiederbelebung der Sektion „Heer und Haus“ nähergebracht werden soll. Die
Sektion „Heer und Haus“ war ursprünglich im Nov. 1939 aufgrund eines Armeebefehls des
Schweizer Volkshelden und Gallionsfigur des „Durchhaltens“ General Henri Guisan aus der
Gruppe Armee der Pro Helvetia gegründet. Ursprünglich war die Sektion beauftragt, die
Soldaten zu belehren und zu unterhalten und so den Wehrwillen der Truppe auch während
längerer Einsätze aufrechtzuerhalten. Die Sektion war schon 1941 reorganisiert worden, als
Guisan der Generaladjutantur den Befehl erteilte, eine Kampagne zur "Aufklärung der
Zivilbevölkerung" vorzubereiten.
Nach der Demobilmachung 1945 entstanden aus der Sektion Haus und Heer zwei zivile
Aufklärungsdienste: Aus der welschen Abteilung des "Aufklärungsdienstes Zivil" gingen die
eher sozialpolitischen und wirtschaftlichen Zielen verpflichteten „Rencontres Suisses (RS)“
hervor, aus der Deutschschweizer Abteilung entsprang Ende 1947 mit entscheidenden
Impulsen durch die Neue Helvetische Gesellschaft, der Schweizerische Aufklärungsdienst
115
Zitiert in: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 57
116 Zitat aus: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
59
(SAD), der sich im Sinne der Geistigen Landesverteidigung dem Kampf gegen den
(kommunistischen) Totalitarismus widmete. 117
Bundesrat von Steigers interne Äußerungen lassen erkennen, dass private
"Staatsschutzbemühungen" behördlich abgedeckt, wenn nicht gefördert werden sollten.118
Die
Reaktivierung der Sektion Heer und Haus zeigt den Rückbezug auf Strategien des Zweiten
Weltkriegs deutlich auf. Dieser Rückbezug vermittelt die Sichtweise auf die neue Situation
aus Perspektive der Landesregierung.
Die geistige Landesverteidigung wurde also behördlich benannt und bewusst gefördert.
Weiter wurde sie aufbauend auf den Geschehnissen in Prag zu einer sehr konkret installierten,
abstrakten Basis des Staatsschutzes. Die geistige Landesverteidigung war nun politisches,
mediales und militärisches Programm.
An der Eröffnung der Nationalratssession vom 11. März 1948 wurde die PdA nicht nur als
die "Partei des Auslandes" exorziert, sondern wurde zusätzlich durch alle Parteien einer
Verschärfung des Staatsschutzes gehuldigt. Der zuständige Bundesrat Eduard von Steiger gab
in seiner Intervention den Ball an das "Volk" weiter:
"“Zum Schweizer Volk möchte ich sagen, dass es mit den Staatsschutzbestimmungen nicht
getan ist, sondern dass Wachsamkeit überall erforderlich ist."“ 119
Die globalpolitischen Geschehnisse wirkten also offensichtlich und mit durchdringender,
mobilisierender Kraft, als Dispositiv auf die Diskurse der Schweizer Gesellschaft ein. Nicht
nur vermochten diese Geschehnisse einen Popularitätsabsturz der PdA, wie er in
demokratischen Gesellschaften vorkommt, zu provozieren, sondern diese als
„gesinnungsfeindlich“ aus der demokratischen Gesellschaft der Schweiz auszuschliessen.
Politische Zensur und mediale Manipulation fanden sich plötzlich auf der Agenda des
demokratischen Kleinstaats Schweiz.
Als 1950 der Koreakrieg ausbrach, galt die Vorstellung eines neuen allgemeinen Krieges auf
einmal nicht mehr als unmöglich. Bezeichnend für die Beurteilung der inneren Lage war, dass
der Bundesrat die seit Kriegsende stillgelegte Sektion "Heer und Haus" im Armeestab wieder
117
Historisches Lexikon der Schweiz Online 29.11.2007: „Heer und Haus“
118 Zitat aus: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
119 Zitiert aus: Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
60
aktivierte. Also zusätzlich zum bereits aus dieser Sektion neu gebildeten SAD
(Schweizerischer Aufklärungsdienst).
Die politische geistige Abwehr der kommunistischen Subversion, als Nachfolgerin der
nationalsozialistischen, wurde vorbereitet. Die Weltgeschichte wiederholte sich scheinbar
unter neuen Vorzeichen.
Ab dem Jahr 1951 gab der Bundesrat Weisungen bezüglich "der Entlassung unzuverlässiger
Elemente aus dem Bundesdienst" heraus und am 5. Januar 1951 traten neue
Staatsschutzbestimmungen, die in das schweizerische Strafrecht integriert wurden, in Kraft.120
1953 begann das friedenssichernde Schweizer Engagement an der Grenze zwischen Nord-
und Südkorea: Eine Beobachterfunktion zur Sicherung des Waffenstillstandes. Die NNSC
(Neutral Nations Supervisory Commission in Korea) wurde so die älteste
Friedensförderungsmission der Schweizer Armee. Am 7. Juli 1953 hatte der Bundesrat
beschlossen das Militärdepartement zu ermächtigen, die Entsendung einer Kommission für
die Neutral Nations Supervisory Commission in Korea vorzubereiten. Im Laufe der folgenden
Monate reisten etappenweise insgesamt 146 Schweizer nach Korea, um den Waffenstillstand
zwischen Nord- und Südkorea zu überwachen, der vor allem eine Wiederaufrüstung
verhindern sollte. Diese Truppe ist auch heute noch aktiv. 121
Die Schweiz war zu jenem Zweck von Seiten der westlichen Mächte ausgewählt worden, die
östlichen Mächte stellten ebenfalls zwei Beobachtermissionen auf Nordkoreanischer Seite der
Grenze. Die Schweiz war also an diesem Punkt außenpolitisch bereits aktiv in die
Verhinderung einer kommunistischen Weltrevolution eingebunden.
7.3. Stalin als rhetorische Figur
Stalin sollte sich während dieser Zeit zum totalitären Diktator schlechthin stilisieren lassen.
Eine Wahrnehmung die sich durch die Karikatur seiner politischen Programmlehre
Nebelspalter illustrieren lässt:
120
Frischknecht/Hafner/Haldimann/Niggli, 1987, Seite 58
121 Homepage der Schweizer Eidgenossenschaft (08.02.2013): NNSC (Korea)
61
Auf dem Bild ist zu sehen wie der Teufel selbst dem Sowjetischen Dikator erklärt, wie er sich
zu verhalten habe. Gradliniger könnte eine Assoziation zum Bösen in einer christlich
geprägten Gesellschaft kaum verlaufen. Dieser kleine Einschub ist relevant da „Stalin“
respektive „Stalinistsich“ sich selbst (vergleichbar mit dem Teufel) zur rhetorsichen Figur des
Bösen qualifizieren soll. „Stalinistsich“ wird in den kommenden Jahrzehnten gleichgesetzt
werden mit einer Regierungsform die auf „Unterdrückung, Zensur, Massenmord,
Willkürherrschaft und Propaganda“ basiert. Es waren Ereignisse wie jene in Prag oder in
Tschechien, die in der Schweiz zu dieser Assoziation führten.122
7.4. Ungarn 1956 (Dispositiv)
Das Jahr 1956 war auf die globalpolitische Situation bezogen, nicht unbedingt ein
entspanntes. Britische und französische Truppen besetzten den von den Ägyptern
verstaatlichten Suezkanal. Die USA, mitten in der Präsidentenwahl stehend, protestierten
gegen das eigenmächtige militärische Vorgehen ihrer europäischen Verbündeten. Der
122
Abbildung B: Nebelspalter Nr. 14 , 1948;
62
Kremlherrscher Chruschtschow doppelte nach und drohte mit Raketenangriffen auf London
und Paris.123
Am 23. Oktober 1956 wird die Welt erneut Zeuge des kommunistischen
Durchsetzungswillens, diesmal in Ungarn. Allerdings ist die Struktur des Vorfalls dieses Mal
eine andere: Im Unterschied zu Tschechien wird der „Angriff“ nicht von Innen sondern von
aussen geführt. Der Kommunistische Ministerpräsident des Landes Imre Nargy wehrte sich,
wie aus heutiger, historischer Perspektive ausser Zweifel steht aktiv gegen die russische
Invasion.
Die militärische Niederwerfung des ungarischen Volksaufstandes gegen die sowjetische
Vormachtstellung brachte in der Schweiz den vorläufigen Höhepunkt der
antikommunistischen Gefühlswelle. Massendemonstrationen, an denen sich auch die Jugend
beteiligte, bekundeten die Solidarität mit den Unterdrückten. Begeisterung für die ungarische
Erhebung hatte freilich nicht nur einen antikommunistischen Aspekt. Wie 17 Jahre zuvor
beim Angriff der Sowjetunion auf Finnland identifizierte man sich in der Schweiz weithin mit
dem um seine Selbstständigkeit ringenden Kleinstaat.124
Anders als im Fall der Tschechoslowakei vor knapp 8 Jahren, findet dieser „Putsch“ nicht
durch, sondern gegen die kommunistische Landesregierung statt. Es handelt sich also im
Wesentlichen um eine sowjetische Invasion gegen eine, durch die Kommunistische Regierung
geführte Verteidigung.
Der Kapitalismus trat während der ersten Phase der Nachkriegszeit in seine wahrhaft globale
Entwicklungsphase ein. Zwar waren durch die kommunistische Machtübernahme in China
und Osteuropa große Teile vom Weltmarkt ausgeschlossen, allerdings erlaubte dieser
Umstand der kapitalistischen Systematik einen durchdringenderen Erfolg in der „westlichen“
Welt respektive den von Kapitalismus geprägten Ländern. In der Schweiz wurde das
(Neo)liberale Gedankengut willkommen geheißen und auch multipliziert, da es seit der
Gründung der politischen Schweiz zu den Grundpfeilern des Schweizer Selbstverständnisses
zählte.
123
Cattani, NZZ Folio, August1991
124 Gilg /Habützel 1986, in: Die Geschichte der Schweiz und der Schweizer S. 889/890
63
7.5. Ungarn 1956 (Diskurs)
Diese Vermengung von „Selbst“ als Kleinstaat und „Selbst“ als liberale Demokratie ist
exemplarisch für diesen Diskurs. So mag sich auch die Wahrnehmung von Imre Nagy in den
Medien einordnen lassen. „Das liberale“ stand gegen „das faschistische“ der Kleinstaat den
„Globalen Blöcken“ gegenüber. So war Imre Nagy ein Kommunist (also ein Feind) der einen
Kleinstaat (also einen Freund) gegen den kommunistischen grossen Bruder (also einen
grösserer Feind) verteidigte. Der Schweizer Diskurs reagierte, indem er die Bevölkerung als
Menschen einerseits von ihrer kommunistischen Regierung trennte und als Opfer verhandelte.
Ein ähnlicher Prozess wird im Kontext des Militärputsches gegen Gorbatschow zu beobachten
sein. Der Spiegel fasste die Situation für die deutschsprachige Bevölkerung zusammen:
„“..(..)in Waffen, Parteidoktrinen und barbarischen Normen erstarrten Oberfläche der
politischen Ordnung, die der titanische Tyrann Stalin in Osteuropa errichtete, ein
glühendes Lavameer der Verzweiflung, des Hasses und des Sehnens nach einem besseren
Leben angesammelt haben muß. Anders ist nicht zu erklären, was in den letzten Wochen
in Ungarn geschah. Die ungarische Revolution war bis gegen Mitte voriger Woche ein
Naturereignis - nicht weniger und nicht mehr.““ 125
Der Spiegel macht mit einer selbstverständlichen Logik klar, dass ein Widerstand gegen das
sowjetische System nichts anderes als menschlich ist, gar das Menschsein in seiner Natur
definiert. Ganz im Gegensatz zu der klar unmenschlichen, weil barbarischen Sowjetunion
unter ihrem „titanischen Herrscher“ Stalin. Wir erkennen hier Wageners „Entmenschlichung“
des Feindes wieder. Auch wird die Asymmetrie einer Täter-Opfer- Situation betont; Stalin ist
nicht nur ein böser (kaum noch) Mensch sondern eine überirdische Gottheit, so die Referenz.
Der gegenteilige Effekt wird beobachtbar sein, wenn Kim Jong Il erkrankt und so als eben
nicht über- sondern „untermächtig“ verstanden werden wird. Die Sowjetunion ist nun fernab
jeglicher Moral, fernab jeder Norm zu verorten, der „titanische Tyrann Stalin“, sein Einfluss,
seine Moral, seine Norm, sind das Böse, seine Person das Feindbild. Dementsprechend
reagiert die Schweizer Öffentlichkeit mit stärkster Unterstützung für die Bevölkerung.
Am 20. November fand in der Folge eine umfassende öffentliche Solidaritätsbekundung statt;
um punkt 11 Uhr 30, stand das Leben in der ganzen Schweiz für drei Minuten still. In den
Städten halten die Strassenbahnen an, die privaten Fahrzeuge zirkulieren nicht mehr, in den
Betrieben wurde die Arbeit eingestellt, die Menschen verharrten in ergriffenem Schweigen.
Die drei Schweigeminuten des 20. Novembers demonstrieren die durchgreifende
125
Der Spiegel 45/1956
64
Solidarisierung mit den Aufständischen/Unterdrückten in Ungarn. Jede Gesellschaftsschicht
schienen von tiefen empfinden betroffen.
Entsprechendes gilt für das Verhältnis zu Israel. Der ägyptische Staatschef Nasser erschien,
in seiner Nichtduldung des neuen Kleinstaates, als neuer Hitler. Waren auch antisemitische
Empfindungen manchem Schweizer seinerzeit nicht fremd gewesen, so gewährte man dem
fernen Judenstaat nun umso mehr volle Solidarität. Eine dem Diskursverlauf entsprechende,
verständliche Distanzierung, da „dem Faschismus die Stirn bieten“ gerade diskursbestimmend
ist. Es versteht sich bei dieser Interpretation, dass die „Faschistischen Elemente“ von den
eigentlichen Inhalten getrennt sind, also dass der Kampf gegen den Faschismus im Kampf
gegen den Kommunismus mitunter aufgrund dessen faschistischer Ideologie geführt wird.
Das faschistische Element ist also ein wichtiger Bestandteil des Bösen.
Dass der israelisch-arabische Konflikt in erster Linie in das allgemeine Verhältnis zwischen
Industrie-und Entwicklungsländern einzuordnen sei, begann man erst in den siebziger Jahren
zu erkennen. Und diese Erkenntnis trug eher dazu bei, das Verständnis für die
Entwicklungsländer zu erschweren als die Sympathien für Israel zu beeinträchtigen.126
Die Geschehnisse in Ungarn führten zu einer Verschärfung der Rhetorik, dieser diskursiven
Verschärfung folgend trieb die Furcht vor dem Feind neue Blüten.
So galt in der Schweiz beispielsweise seit Mitte der 50er Jahre, neu eine Bestimmung zum
Bau von Luftschutzkellern in jedem Wohngebäude, die in der Zwischenzeit zwar wieder
aufgehoben worden ist, allerdings bis und über das Ende des kalten Krieges hinaus, gelten
sollte. Das Schreckgespenst „Invasion“, schwebte also umso bedrohlicher über den Schweizer
Köpfen und fand darum an diversen Stellen Eingang in die Gesetzgebung. Die geistige
Landesverteidigung wird ab diesem Punkt also noch verstärkter institutionell getragen.
8. Die Überfremdungsinitiative 1968-1970
Im Folgenden wird die Überfremdungsinitiative im Lichte der geistigen Landesverteidigung
untersucht. Besonders bemerkenswert ist diese Angelegenheit weil das bisher aus einem
globalen Diskurs konstruierte Dispositiv eine Adaption erfährt. Die zunehmend abstrakter
werdende Bedrohung von Seiten der Sowjetunion schwindet aus dem alltäglichen
Bewusstsein und macht einem neuen, gegenwärtigeren Feind Platz: den Einwanderern.
126
Gilg /Habützel, 1986, in: Die Geschichte der Schweiz und der Schweizer S. 890
65
8.1. Die Überfremdungsinitiative 1968-1970 (Dispositiv)
Die Schweiz war in der Zwischenzeit noch vier weitere Male aufgefordert worden Teil der
UNO-Aktionen zu werden. Die Frage des Beitritts der Schweiz wurde erst Ende der sechziger
und Anfang der siebziger Jahre wieder ernstlich erwogen und zwar in zwei Berichten, die der
Bundesrat über die Beziehung der Schweizer zu den Vereinten Nationen der
Bundesversammlung vorlegte (1969 und 1971). Es war der Zeitpunkt, an welchem sich
Entspannung durch die globale Politik zwischen den vereinigten Staaten und der Sowjetunion
abzuzeichnen begann, da mittlerweile auch die Volksrepublik China und die Bundesrepublik
Deutschland und sogar die Deutsche Demokratische Republik die Mitgliedschaft der UNO
erlangten. Der kalte Krieg wurde in einem gewissen Sinne in seiner „Kälte“ institutionalisiert,
indem statt vollständig getrennten antagonistischen Blöcken nun doch eine umspannende
Institution bestand. Bei dieser Institution waren auch fast alle Staaten Mitglied, außer der
Schweiz. Der heute so gefürchtete Iran war übrigens Gründungsmitglied der UNO.
Die Zahl jener Staaten der Welt, die den vereinten Nationen nicht angehörten, war zu diesem
Zeitpunkt schon minim und es handelte sich bei den Nichtmitgliedern vornehmlich um
Staaten von geringer Bedeutung. Angesichts dieser Lage empfahl der Bundesrat in beiden
Berichten die Schweiz müsse möglichst bald unter Wahrung ihrer Neutralität den Vereinten
Nationen beitreten. Wir beobachten in diesem Bestreben, sofern denn Dürrenmatts
Interpretation der, den Bundesrat motivierenden, Beweggründe stimmt eine gewisse
Isolationsfurcht auf Seiten der Landesregierung. Die auch die Bemerkungen in den jeweiligen
Berichten, die ein weiteres Abseitsstehen als Gefahr verstanden, die Schweiz könne sich
durch ihr Verhalten international isolieren.127
Der Bundesrat setzte eine Studienkommission
ein, die 1975 in einem ausführlichen Bericht in ihrer mit Mehrheit zu ähnlichen Einsichten
kam. Beide Berichte enthielten keinen spezifischen Termin, auf welchen der Eintritt geplant
war. Damit wurde der Zwiespalt sichtbar, in den die schweizerische Politik geraten war: Die
nüchterne Vernunft und unsentimentale Überlegungen der politischen Nützlichkeit mussten
der Bundesrat Recht geben, wenn er die Meinung vertrat, der Zeitpunkt zum Beitritt sei
gekommen. 128
Auf allen Gebieten zeigte sich in jenem Moment, in wie hohem Umfang der Schweiz, in das
was sich in der Welt abspielte bereits integriert war. So auch am 17. Oktober 1973 als die
127
Dürrenmatt 1975, S.229
128 Dürrenmatt 1975, S.229
66
Organisation der Erdölexportierenden Staaten (OPEC) beschloss, in Reaktion auf den als
Yom-Kippur-Krieg bezeichneten Konflikt eine Reduktion des Ölangebots um 5 Prozent
gegenüber dem Niveau vom September 1973 umzusetzen. Dies war möglich, da die
arabischen Länder schon damals einen großen Teil des Ölmarkts unter ihrer Kontrolle
hatten.129
Auf der anderen Seite aber verstand die Schweizer Öffentlichkeit das Verhalten der
UNO als einseitig in der Stellungnahme zu weltpolitischen Konflikten.130
In der zentralen Frage der Vorgänge im Nahen Osten und der Beziehungen Israel zu seinen
arabischen Nachbarn bekannte sich die Mehrheit der UNO demonstrativ und eindeutig zu den
Auffassungen der Araber. Also diametral der in der Schweizer Gesellschaft verbreiteten
Auffassung entgegengesetzt, die sich ja aus ideologiegeschichtlichen Gründen eher einem
Staate Israel verpflichtet fühlten.
Solche Entwicklungen förderten das Misstrauen in großen Teilen der schweizerischen
Stimmberechtigten gegenüber der der politischen Mission der UNO. Für den Beitritt wäre das
„Ja“ von Volk und Ständen nötig gewesen. An dieses Ja glaubte auf Regierungsebene
niemand. Jedermann fürchtete die Folgen eines Neins für das internationale Ansehen der
Schweiz. So blieb es bei der beobachteten Verbindung. Es gibt auf dem Gebiet der Schweizer
Befreiungsmythologie kaum eine andere Haltung, die gleich populär ist wie jene Stelle im
ersten Bundesbrief, wo erklärt wird dass sie "keine fremden Richter" über sich dulden.
Dieses Spannungsverhältnis zwischen außenpolitischer Strategie und dementsprechender
Expertenempfehlung durch den Bundesrat und des innenpolitischen Ratifikationspotenzial
derselben, zeigt die bestimmende (oder überstimmende) Kraft dieser Schweizerischen
„Vorstellung des Selbst“ auf: Obwohl es strategisch Sinn machen würde und der Bundesrat
mehr oder minder geschlossen hinter der Idee steht, ist es zu diesem Zeitpunkt nahezu
unmöglich einen UNO Beitritt an der Urne zu erreichen
Seit den 50er Jahren war die Welt noch einige Male an den Rand eines Atomkriegs gerutscht,
am nahesten wahrscheinlich während der Kubakrise. Seither wurde es von den beiden
antagonistischen Blöcken auf das Dinglichste vermieden in eine direkte, vergleichbare
Konfrontation verwickelt zu werden. Der Stellvertreter Krieg wurde zur globalen Normalität.
Die Gefahr eines allumfassenden zerstörerischen dritten Weltkriegs ist so schrittweise aus
dem Spektrum der Alltagssorgen der Schweizer Bevölkerung gewichen. Der ideologische
129
Zeitenwende.de (1.7.2002): “Die Ölkrise 1973“
130 Fußend auf: Dürrenmatt, 1975, S.230
67
Konflikt wurde in eine stärker abstrakte Ebene verschoben, es ging neuerdings um Kategorien
wie: Technischer Fortschritt, Umstürze in Schwellen- und Drittweltländern und natürlich
Aufrüstung.
Der globale ideologische Wettbewerb und somit einer der Grundpfeiler der relevanten
Dispositive, gewann eine völlig neue und eben entferntere, abstraktere Gestalt indem er eben
durch neue Kategorien bewertet wurde. Das Schlachtfeld war so in eine abstraktere Sphäre
gerückt.
Um die Mitte der Sechzigerjahre befand sich die Schweizerische Vorstellungswelt noch in
einer Art labilem Gleichgewicht. Die Landesausstellung von 1964, die "Expo" von Lausanne,
versuchte den Zwiespalt zwischen Bindung an die Vergangenheit und Ausblick auf die
Zukunft mit Charme, aber ohne eigentliche Analyse der Probleme zu überbrücken.
Gleichzeitig stellte der Basler Staatsrechtslehrer Max Imboden eine schleichende Krise, die
"helvetische Malaise", fest. Er erfasste damit den Beginn einer Periode allgemeine
Ungewissheit infolge der Entkräftung von Wertvorstellungen, die bis anhin das
gesellschaftliche Dasein geprägt hatten. In dieser allmählich um sich greifenden
Orientierungskrise wurden nun auch in der Schweiz Bewegungen wirksam, die sich durch die
vom Wachstum veränderten Industrieländer verbreiteten und das Leben nach neuen Inhalten
auszurichten strebten.131
8.2. Die Überfremdungsinitiative 1968-1970 (Diskurs)
Im Jahre 1968 kam es in der Schweiz wie in anderen Gesellschaften auch, zu einer
Auflehnung gegen die gesellschaftlichen Ordnungen, die von einem großen Teil der jungen
Generation getragen wurde. Wenn sich das Gros der heranwachsenden der Fünfzigerjahre,
skeptisch gegenüber großen Zielsetzungen und auf die Wahrnehmung der beruflichen
Chancen konzentriert hatte, brach in der Jugend der späten Sechzigerjahre der Überdruss an
einer Gesellschaft durch, deren bestimmende Werte mehr und mehr Leistung und Konsum
geworden waren.
Die von der Elterngeneration und Schule vertretenen Traditionen und Vorstellungen, Sitten
und Ordnungen, wirkten unglaubwürdig und wurden als Fessel empfunden, von denen man
sich zu emanzipieren strebte. Man rief nach Freiräumen und sprengte in „schockierender
131
Gilg/Hablützel (1986) in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer Seite 893
68
Unbekümmertheit“ die überkommenen äusseren Formen: in Kleidung und Haartracht, im
zwischenmenschlichen Verkehr, im Umgang mit dem anderen Geschlecht.132
Diese Bewegung und die entsprechenden Diskurse waren von ausländischen Universitäten
ausgegangen und wurden auch in der Schweiz hauptsächlich von Studenten aufgenommen
und betrieben. Das gab der Bewegung einen Intellektuellen, darüber hinaus aber auch ein
missionarisch-revolutionären Charakter man griff auf die marxistische Analyse des
Kapitalismus zurück, ergänzte sie jedoch durch die von Sigmund Freud beeinflusste neuere
Sozialpsychologie.133
Was sich laut Dürrenmatt im schriftstellerischen Werk der Sechzigerjahre abzeichnete, war
die Darstellung persönlicher Identitätskrisen, oft in Zusammenhang gebracht mit dem
politischen Zustand des Landes. Es zeigte sich aber, dass mehr als ein literarisches Problem
hinter der Krise des schweizerischen Selbstverständnisses verborgen war. Für zahlreiche
Schweizer, die sich über die Lage der Schweiz Gedanken machen, stimmte das aus den
ideologischen Rückbezügen übernommene Bild mit der Realität nicht mehr überein.
Aus verschiedenen Ursachen entstand eine Lage, die mit dem französischen Wort "Malaise"
umschrieben wurde. Der Basler Rechtsprofessor Max Imboden verwendete den Ausdruck als
Titel eines kleinen Werkes. Darin fällte er ein hartes Urteil über die Schweiz, indem er
schrieb:
" Im 19. Jahrhundert waren wir eine revolutionäre Nation, heute sind wir eine der
konservativsten der Welt. Wir selbst verspüren diesen Wandel wenig, aber jeder
ausländische Betrachter verspürt ihn umso mehr."134
Diese, so rundum prägnant aufgestellten Behauptung wurde in jenem Moment von vielen
Schweizern, vor allem in den Kreisen der jungen Generation, zugestimmt.135
Es äußerte sich hier auch die Beanspruchung der geistigen Landesverteidigung durch
konservative bürgerliche Kreise. Theo Mäsuli benennt wie bereits erwähnt zwei verschiedene
Konzeptionen der geistigen Landesverteidigung, welche sich aus den unterschiedlichen
Wahrnehmungen und dem Ringen um den Begriff ergeben haben.
132
Gilg/Hablützel in: Geschichte der Schweiz und der Schweizer Seite 893
133 Gilg/Hablützel in: Die Geschichte der Schweiz und der Schweizer Seite 893
134 Zitiert in: Dürrenmatt, 1979, Seite 198
135 Zitiert aus: Dürrenmatt, 1979, Seite 198
69
Er anerkennt gewissermaßen die Aneignung des Begriffs durch die konservativen Kreise. Die
geistige Landesverteidigung bezieht ihre Kernwerte aus einer bäuerlichen, urtümlichen
„Schweiz als Dorf“. Spätestens seit dem Positionsbezug der PdA bezüglich des tschechischen
„Februar-Putsches“, der allgemeinen Verurteilung der PdA und v.a. der Expliziten
Beobachtung durch den SAD (Schweizerischer Aufklärungsdienst) aller möglichen
Kommunistischen Elemente, ist ersichtlich dass die Verteidigung seit den späten
Vierzigerjahren einem Feind von Links gilt.
„Alternative“, also nicht bürgerliche Kreise aus den unterschiedlichsten Gesellschaftsteilen,
verstanden sich aus diesen Gründen nicht unbedingt weniger als Schweizer, respektive
nahmen trotzdem die geistige Landesverteidigung als „ihre Verteidigung“ wahr, standen aber
ihren bürgerlichen Trägern gegenüber und dementsprechend den mittlerweile etablierten
Standpunkten der geistigen Landesverteidigung kritisch im Sinne einer Ausgeschlossenheit
aus der eigenen Selbstwahrnehmung als Schweizer gegenüber.
Mäusli nennt diese beiden Auslegungsweisen „Pole“ und unterscheidet die beiden möglichen
Auffassungen von geistiger Landesverteidigung in die Kategorien in einerseits "eng"
gegenüber andererseits "offen". Eng wäre eine Geistige Landesverteidigung, in der
Mentalitäten wie Nationalismus, Rassismus Traditionalismus eine überragende Rolle
einnehmen, eine gemäss Meier-Seethaler fundamentalistisch anmutende Konzeption136
, die
Mäusli als" Blut und Boden"-Ideologie bezeichnet.137
Offen zeigte sich zum Vergleich das Konzept etwa eines jungen Max Frisch, der im Radio
1937 sein Buch "Wort aus der Stille", in Schweizer Dialekt, so vorstellte:
„"Die Geschichte handelt im Wallis, aber es kommen keine Alpen vor, kein Jodeln und
nicht einmal ein Verein. Und trotzdem hoffe ich dann dort auf einen stillen Leser, der
vielleicht findet, dass es etwas von einem Schweizer geschriebenes, dass sein Land und
seine Berge gern hat, wie kaum etwas anderes, auch wenn er Schriftdeutsch schreibt."“138
Schweizer sein musste für Frisch nichts mit Folklore zu tun haben, dafür mit stiller, spürbarer
Liebe zum eigenen Land. Und auch ein schriftdeutscher (nicht hochdeutscher) Text vermag
sich von der aktuellen deutschen Kultur zu distanzieren. Mäusli hält es für wenig
erkenntnisreich, die damals leitende und bis heute nachwirkenden Mentalität pauschal als
136
Meier Seethaler, 2008, in: Faulstich (Hrsg.) S.48
137 Vgl. Mäusli 1995, S.30
138 Zitiert aus: Zeitzeichen, 50 Jahre Radio in der deutschen Schweiz, zitiert in: Mäusli 1995, S.34 (Fussnote 69)
70
"rassistisch" oder "Blut und Boden" zu richten, vielmehr ist aufzuzeigen wie dieses durch die
geistige Landesverteidigung bestimmte Denkmuster je nach Interesse oder je nach tiefer
verankerter Mentalität zu ganz unterschiedlichen Urteils- und Verhaltensweisen gegenüber
denselben Sachverhalten für konnte.
Für diesen Zusammenhang ist wichtig, dass die Identitätskrise der Romanfigur Stiller nicht
nur jene des Menschen an und für sich, sondern auch jene Stillers als Schweizer und jene des
Schweizer Bürgers war. Es zeigte sich, dass die in der Gestalt Stillers dargestellte Krise
zugleich Max Frisch eigene war. Auch er opponierte gegen die offizielle Schweiz. Es wurde
bedeutsam, dass nun eine ganze Generation von Schriftstellern zu Worte kam, die aus den
verschiedensten Richtungen ihre Fragezeichen zum schweizerischen Selbstverständnis
setzten.
„Selbstverständnis“ das Wort an sich war für die Literaten schon verdächtig.
Selbstverständnis wies nach ihrem Empfinden bereits auf eine neue, beginnende
Selbstgerechtigkeit hin. Im überwiegenden Urteil dieser Schriftsteller bot die offizielle
Schweiz im besten Falle Fragezeichen. In vielen Fällen nur noch negative Aspekte.
Das plötzliche Aufbrechen dieser Selbstverständnis- Krise war letzten Endes die Reaktion auf
die "geschlossene" Lage der Kriegszeit. Diese hat, aufgrund ihrer nahezu
fundamentalistischen Rückbezogenheit auf traditionelle Werte, ein Bild der Schweiz
hinterlassen, dass sich in die neue, in die "offene" Lage nicht einfügen wollte. Gegen den
Ausdruck "Landesverteidigung" war schon Ende der fünfziger Jahre opponiert worden. Er
klang in den Ohren der neu in die Politik eintretenden jungen, liberalen Schweizer zu sehr
nach bloßer Abwehr, nach Furcht vor dem Wettbewerb und nach der Ablehnung, sich im
internationalen Zusammenhang durchsetzen zu wollen. Die Terroraktionen am Ende der
sechziger Jahre relativierten allerdings diese Offenheitsbestrebungen der jungen
Generation.139
Das Unglück rührte daher, zunächst zumindest, dass in dem schweizerischen politischen
Empfinden der Unterschied zwischen dem idealen und dem wirklichen Land nicht
überwunden war. Es gab feste Vorstellungen über das Wesen der Schweiz, die mit der
Wirklichkeit nicht übereinstimmen. Es sind Vorstellungen, die in der Vorkriegszeit während
des Krieges entstanden sind. Das Bild der Schweiz, welches die Landesausstellung von 1939
139
Dürrenmatt, 1979, Seite 198
71
veranschaulicht hatte und das zu einem der Leitbilder der geistigen Landesverteidigung
geworden war.140
Natürlich ist der Begriff der Realität/Wirklichkeit immer ein besonders schwieriger wenn die
Diskussion von metphysischen Gegenständen handelt. Ideologie und so auch die geistige
Landesverteidigung ist ein metaphysischer Gegenstand. Der Kontrast zwischen
Selbstwahrnehmung und „Schweizer Wirklichkeit“ ist also schon rein durch die Konstruktion
Dürrenmatts der Fragestellung gegeben.
Laut Dürrenmatt war dieser Situation eine Entwicklung vorangegangen, die zunächst bloß
literarisch in Erscheinung trat, die aber die Krise des Schweizer Selbstverständnisses bereits
andeutete. Dürrenmatt meint den krassen Gegensatz, der sich plötzlich zwischen der
politischen Auffassung der offiziellen Schweiz, eben des (mittlerweile vielzitierten)
Establishments (oder um moderne rhetorischen Formen der SVP heranzuziehen: Der „classe
politique“) und einem großen Teil der schweizerischen Schriftsteller zeigte. Das war etwas
Neues. Die kritische Haltung der Literatur gegenüber den Inhalten der geistigen
Landesverteidigung, destabilisierten diese in ihrer Funktion der Schweiz ein „einheitliches“
insofern von allen Schweizern getragenes Selbstbild zu verleihen. Nebenher begannen sich
die Ausrichtungen der „Verteidigungswahrnehmung“ von Volk und Regierung zu trennen.
Während das Volk den West-Ost Konflikt nicht als zentrale oder gegenwärtige Problematik
wahrnahm, da dieser Konflikt in zunehmende „Abstraktheit“ rückte, verstärkten derweil die
staatlichen Institutionen ihre Abwehr gegen den „Kommunistischen“ Feind weiter. So wurden
geheime Organisationen wie die P27 (Projekt 27) und die P26 (Projekt 26) gegründet,
Geheimorganisationen die vollkommen der Kontrolle und auch dem Bewusstsein der
Schweizer Bevölkerung entzogen blieben.141
8.3. Die Sempacher Rede (Diskurs)
In diesen Diskurs der andauernd neu verhandelten Identität der Schweizer als Schweizer, als
auch des zunehmend abstrakter werdenden West-Ost Antagonismus, fällt James
Schwarzenbachs Überfremdungs-Initiative. James Schwarzenbach, geboren 1911 in
Rüeschlikon, entstammte einer Textilindustriellenfamilie aus dem Kanton Zürich. Er war
Verleger und betätigte sich auch als Autor. Die in seinem eigenen damaligen Thomas-Verlag
140
Dürrenmatt, 1979, Seite 198
141 SRF Reporter vom 16.12.2009, 22:31 Uhr: „In geheimer Mission - Mitglieder von P-26 brechen ihr
Schweigen“
72
erschienen Publikationen gelten teilweise als faschistisch, völkisch und antisemitisch, als
Beispiel sei seine wohl berühmteste Publikation „Dolch und Degen“ genannt. In seiner
Jugend war Schwarzenbach Mitglied der Nationalen Front, später wurde er Parteichef der
Nationalen Aktion. Von den Wahlen 1967 bis 1979 gehörte er dem Nationalrat an und war
1971 bis 1974 Fraktionspräsident.142
Im Jahr 1971 gründete er die Republikanische Partei der Schweiz. James Schwarzenbach
stand also Theo Mäuslis Definition folgend, politisch im Zentrum der „engen“ Auffassung
von geistiger Landesverteidigung. Die Schweiz hatte an dieser Grenze zwischen „enger“ und
„offener“ Auslegung von geistiger Landesverteidigung eine Spaltung erfahren. Die
konservativen, von Nationalismus geprägten und bürgerlichen Kreise hatten aufbauend auf
der Landidealisierung der Expo 39 ihr Bild der traditionellen als die „richtige“ Schweiz
verfestigen können.
Diese Verfestigung steht im Kontext zur Abwehr gegenüber dem Kommunismus insofern, als
dass die bürgerlichen Kreise durch ihren politischen Inhalt sich als Speerspitze des
Antikommunismus etablieren konnten. In Zuge dieses Prozesses wurde die geistige
Landesverteidigung durch die bürgerlichen Kreise weitgehend erfolgreich beansprucht. Aus
denselben Kreisen wurden auch staatliche Maßnahmen zur Abwehr des Kommunismus
gefördert. Diese Kreise waren im Kontext des Diskurses gesprochen „ermächtigt zu
verteidigen“. Durch die Mobilisierung der Studentenschaften auf der anderen Seite, die sich in
einem international kontextualisierten „linken“ Ansinnen begriffen, wurde diese Spaltung der
Schweizer Gesellschaft umso augenscheinlicher.
James Schwarzenbach konnte also auf einen Hintergrund zurückblicken, der ihn in eine
„diskursmächtige“ Position setzte: er entsprang einem bürgerlichen Geschlecht und war selbst
dem „Fronten“-Kontext zuzuordnen, was ihn zur „Nutzung“ der engsten Form des Begriffs
der geistigen Landesverteidigung ermächtigte, gleichzeitig aber breit abstütze. Dieser
Hintergrund war eben der bürgerliche, dessen Auffassung der Schweizer Identität von den
staatlichen Institutionen reproduziert wurde. So nutze Schwarzenbach diesen Hintergrund um
sich als „Verteidiger“ der Schweiz zu etablieren. Da der Kommunismus, respektive die
Sowjetunion als konkreter Feind, wie eingehend dargelegt, erheblich an Bedrohungsmacht
eingebüßt hatte, war Raum für einen näheren, sichtbareren Feind der Geistigen
Landesverteidigung geschaffen.
142
Webseite des Schweizer Parlaments: „Bundesversammlung - Fraktionspräsidenten seit 1917“
73
Dieser Feind bedrohte durch „Überfremdung“, die von den bürgerlichen Kreisen erst als Kern
der Geistigen Landesverteidigung definierten und dann für sich beanspruchte „Blaupause der
Schweiz“ insofern es sich um eine „kulturelle Überfremdung“ handelte.
Die gesellschaftliche Relevanz der Überfremdungsinitiative wird besonders durch die bis zu
jenem Zeitpunkt nie dagewesene Wahlbeteiligung von 74% illustriert. Es sei an dieser Stelle
angemerkt, dass sich diese Wahlbeteiligung noch ausschließlich aus der männlichen
Bevölkerung zusammensetzte, zumal das Frauenwahlrecht erst ein Jahr später eingeführt
werden sollte. Die Wahlbeteiligung zeigt die Relevanz der Inititaive für den Diksurs um das
„Schweizer Selbst“. Im Anschluss an die (sehr knapp verlorene) Abstimmung vom 7. Juni
1970 hielt James Schwarzenbach auf dem Schlachtfeld von Sempach eine 1. August-Rede:
Liebe Mitbürger, liebe Mitbürgerinnen! Nach dem denkwürdigen 7. Juni war es unser
Wunsch, einmal mit der grossen Familie, die unserm Volksbegehren gegen die Überfrem-
dung zugestimmt hat, zusammen zu kommen und ihr unsern Dank abzustatten. Gibt es
dafür einen schöneren Tag als den Geburtstag unseres Vaterlandes und einen würdigeren
Ort als Sempach, wo doch jedes Kind weiss, was hier vor bald sechshundert Jahren
geschehen ist?143
Bereits in der Eröffnungssequenz aktiviert Schwarzenbach Elemente der Schweizerischen
„Ur-einheit“ indem er die wählenden Befürworter seiner Initiative als Familie bezeichnet, die
auch schon die Grundeinheit des „Dörfli“ an der blaupausengebenden Expo 39 bildete. Ferner
wurden sowohl der Ort als auch der Zeitpunkt der Rede dem Schweizerischen
Entstehungsmythos entsprechend gewählt. Mit der Betonung auf „jedes Kind weiss“ verstärkt
er die Selbstverständlichkeit seines Anspruchs. Dieser Anspruch auf die Schweiz findet
Ausdruck im Folgenden Abschnitt, in welchem er sich bei den Unterstützern der Initiative mit
folgenden Worten bedankt:
Ein besonderer Dank gebührt den annehmenden Ständen, zunächst der Innerschweiz, den
Kantonen Uri, Schwyz, Unterwalden und Luzern. Ein weiterer herzlicher Dank gebührt
Freiburg und Solothurn. Und überdies hat es uns besonders gefreut, dass auch der Kanton
Bern, in dessen Hauptstadt unser Parlament seinen Sitz hat, angenommen hat. Sehr
herzlich danken wir auch den Bürgern und Arbeitnehmern der Industriekantone, denn wir
wissen, welch ungeheurem, geradezu totalitären Druck sie von Seiten der Industrie
ausgesetzt waren. Wärmster Dank auch unseren Tessiner Freunden. Volle
fünfzehntausend haben Ja gestimmt. Das ganze Bleniotal war für uns. Ebenso herzlicher
Dank gebührt der welschen Schweiz. Es hat sich kein Graben gebildet, wie die
gegnerische Propaganda immer prophezeit hat. Das Gegenteil ist der Fall: Zwischen Stadt
und Land, zwischen Welsch und Deutsch, zwischen den Konfessionen, zwischen Bauern,
Gewerbetreibenden und Arbeitern hat sich ein Band der Solidarität neu geknüpft,
zwischen all denen, die in der Liebe zur Heimat verbunden sind. Wir können sagen, der
143
Zitat aus: Schwarzenbach, 1970
74
alte, unverwüstliche Kern der Eidgenossenschaft hat dieser heimtückischen Nein-Parole
getrotzt.144
Durch die Betonung der Stände unterstreicht Schwarzenbach wiederum eine Schweizerische
Eigenheit, hier im politischen System selbst, ferner zieht er aus den Standesannahmen die
Berechtigung ganze Städte und Gebiete für seine ideologisch/politische Position zu
beanspruchen. Dieses „Übergreifen“ über die Regionen und Städte hinweg wird ebenfalls mit
starkem Bezug auf die Schweizerische Selbstwahrnehmung als föderalistischer,
mehrsprachiger Staat getätigt.
So wechselt Schwarzenbach die Kategorien von ganzen Ständen zu Städten bis zur Auflistung
einzelner Tausendschaften, die für seine Initiative gestimmt haben. In diesem Kontext ist die
spezielle Heraushebung der Tessiner augenfällig. Schwarzenbach schlägt so viele Brücken
wie es anhand der vorhandenen Daten überhaupt möglich scheint.
Über Sprach-, Einkommens- und religiöse Grenzen hinweg vereint er die Schweiz rhetorisch
unter dem „Dach“ der Überfremdungsinitiative. Ebenfalls als zentral ist die konsequente,
wenn auch teilweise der Logik entbehrende Verteidigungsrhetorik zu beobachten.
Schwarzenbach spricht von einem der „Nein-Parole trotzen“ als wäre diese Parole aktiv und
seiner Initiative vorrangig, als sei die Initiative gegen einen Feind verteidigt worden.
Der 7. Juni ist ein Markstein in unserer Geschichte, wenn nicht ein Wendepunkt! Es hat
sich politisch dort ereignet, was am 9. Juli 1386 hier militärisch geschehen ist: Antreten
geschlossen gegen eine gefährliche Übermacht – und dann der Ruf: «Eidgenossen, ich
will Euch eine Gasse machen!» Unsere Nationale Aktion mit ihren vielen Verbündeten
und Sympathisanten haben diese Bresche geschlagen. Aber eine Bresche wird sinnlos,
wenn nicht nachgestossen wird. Und der Einbruch in diese Phalanx der anonymen
Wirtschaftsdiktatur, die unsere Freiheit bedroht, der muss jetzt ausgeweitet werden.145
An dieser Stelle verortet Schwarzenbach seine eigene Initiative erneut in die Schweizer
Geschichte hinein, als Kampf gegen die Fremdbestimmung zum einen, doch noch viel
wichtiger für den Spross einer Textilindustriellenfamilie ist es, sich von dieser Klasse der
Besserverdiener abzugrenzen, einer vom Volk zu werden/sein. Auch die Begriffe „totalitär“
und „Diktatur“ können hier als reaktiviert aus der mittlerweile Jahrzehnte andauernden
Geistigen Landesverteidigung verstanden werden. So war es seit Kriegsende politisches
Hauptthema sich eben gegen solche Diktaturen und das „Totalitäre“ in und an diesen
(mindestens geistig) zu verteidigen.
144
Zitat aus: Schwarzenbach, 1970
145 Zitat aus: Schwarzenbach, 1970
75
Wir sind eine Eid-Genossenschaft. Und auf diesen beiden Grundpfeilern beruhen unsere
Freiheiten. Erstens auf dem Eid – unser Staat, jeder Einzelne von uns steht unter dem
Machtschutz des Herrgottes. Und der Christenglaube ist unser Fundament. Und aus dem
Glauben werden abgeleitet: Freiheit, Recht, Moral und soziale Verpflichtungen.146
In weiterer Instanz wird nun der vereinende Christenglaube zitiert, der natürlich ein weiteres
vereinendes Element in der Schweiz ist, zumal die Konfessionen regional unterschiedlich sein
mögen, die Basisreligion Christentum ist allerdings in der ganzen Schweiz vorherrschend. Im
Folgenden lässt es sich der Redner nicht nehmen denjenigen Eid zu zitieren, der von jedem
Bundesrat, Ständerat und Nationalrat bei Amtsantritt abgelegt wird:
«Ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze des Bundes
treu und wahr zu halten; die Einheit, Kraft und Ehre der schweizerischen Nation zu
wahren; die Unabhängigkeit des Vaterlandes, die Freiheit und die Rechte des Volkes und
seiner Bürger zu schützen und zu schirmen und überhaupt alle mir übertragenen Pflichten
gewissenhaft zu erfüllen, so wahr mir Gott helfe.» Wenn unsere Parlamentarier wirklich
diesem Eid nachleben würden, wenn sie Volksvertreter und nicht Interessenvertreter
wären, dann würde es mit uns besser bestellt sein. Dieser Eid sei unser Programm!147
Diese Selbst- Positionierung verbindet das urtümlich Schweizerische mit einem relativ
unverhohlenen Herrschaftsanspruch, zumal er den Eid der Regierungsbeauftragten zum
Programm seiner Partei ernennt. Dieser Gleichsetzung entsprechend ist jedes Parteimitglied
der Nationalen Aktion per Definition der geeignetste Volksvertreter für die Schweiz.
Wir schämen uns nicht, zu sagen, dass wir unsere Heimat über alles lieben. Wir wollen
für die kommende Generation, für unsere Kinder, unsere Heimat sichern. In den
beschränkten Raum, den wir haben, können wir nicht unbeschränkt Ausländer
hineinnehmen und deshalb haben wir den Kampf gegen die Überfremdung geführt und
werden ihn weiterführen. Man hat uns vorgeworfen, unsere Initiative habe dem Ansehen
der Schweiz im Ausland geschadet. Wer schadet wohl mehr unserm Ansehen: Unsere
Banken, die ausländische Fluchtgelder und hinterzogene Steuergelder horten und mit
ihren so genannten «Gangster-Konti» bis über den Atlantik zu einem Skandal werden,
oder unsere Nationale Aktion?148
Der Einbezug der Perspektive aus dem „Ausland“ wird von Schwarzenbach genutzt um jenen,
die die Überfremdungsinitiative als rufschädigend bezeichnen, mangelnden Nationalstolz
vorzuwerfen. Wiederum betont Schwarzenbach seine Distanz zur „Geld-Elite“ und den
Banken, die er durch Verwendung des Begriffs «Gangster-Konti» klar in Richtung der
Illegalität abgrenzt.
146
Zitat aus: Schwarzenbach, 1970
147 Zitat aus: Schwarzenbach, 1970
148 Zitat aus: Schwarzenbach, 1970
76
Im Folgenden wird Schwarzenbach zwischen nationalen und sozialen Elementen seiner Rede
hin und herschwenken und somit jegliche politische Couleur außer den spezifisch
abgegrenzten einschließen.
Diese Rede zeigt die Kernmechanismen der Überfremdungsinitiative, wie sie an den
etablierten Positionen der geistigen Landesverteidigung anschließen. Basierend auf dem
Abstimmungsresultat, das eine breite Zustimmung in der Bevölkerung zeigt, hat James
Schwarzenbach die Möglichkeit sich selbst in eine Position zu setzen, die das Schweizer
Selbstverständnis, die Schweizer Kultur im Kontrast zu den eingewanderten Menschen und
Kulturen beansprucht. Ferner nutzte Schwarzenbach dieses abstrakt-geworden-sein des
ursprünglichen Gegenstands der geistigen Landesverteidigung, um einen nationalen
Überfremdungs-Diskurs zu befeuern. In diesem untersuchten Beispiel wurde dargelegt wie
Schwarzenbach den „globalen“ Diskurs auf eine nationale Ebene brachte, das Schweizer
Selbst in einem gewissen Rahmen zu beanspruchen vermochte und so die italienischen
Einwanderer ausgrenzte.
9. Kim Jong Il: Vom Luzifer zum Pinocchio
Im Folgenden soll unter Zuhilfenahme der bisher etablierten Mechanik der Konstruktion eines
Feindbildes, die mediale Wahrnehmung eines der letzten „stalinistischen“ Herrscher des
Planeten untersucht werden. Im vermeintlichen Gegen- oder vielleicht besser Zusatz zu dem
bisherigen Vorgehen, wird hier nicht lediglich die Konstruktion des Feindbildes Kim Jong Il
analysiert, sondern sie soll auf die Dekonstruktion desselben ausgeweitet werden. Die bisher
Hergeleiteten Konstruktionsmechanismen eines Feindbildes, wie sie im Kontext der geistigen
Landesverteidigung und der Bedrohung „Kommunismus auftraten“, liefern die notwendigen
Kategorien und Werkzeuge das Böse hinter dem vermeintlichen Feindbild Kim Jong Il in
seiner diskursiven Konstruktion zu verstehen und davon abgeleitet dessen Dekonstruktion.
Allerdings fällt dieser Diskurs um das Feindbild Kim Jong Il in ein vollständig verändertes
Dispositiv.
9.1. Die Verteidigung unter Anklage
Das den zu untersuchenden Diskurs umrahmende Dispositiv muss wiederum auf Zwei Ebenen
verstanden werden. Der Nationalen und der globalen. Die globale Dimension wird den
Diskurs im Rahmen der ideologischen sowie faktischen Neuordnung der Welt betreffen,
während das nationale Dispositiv ebenfalls gewissen Transformationen unterzogen wird,
natürlich in Wechselwirkung zum globalen aber besonders in der Reflexion des Vergangenen
77
in Reaktion auf die neue Situation. Kim Jong Il kommt 1994 an die Macht, eines
kommunistischen (stalinistischen) Staates. An diesem Zeitpunkt ist die Sowjetunion
Geschichte und die geistige Landesverteidigung ohne einen (existenzbedingenden) Feind.
Um diesen Moment richtig zu kontextualisieren sind eben die beiden „dispositiven“
Diskursverläufe respektive deren relevante Neuordnungen zu betrachten.
Der Zerfall der Sowjetunion und die sich daraus ergebende vollständige Neuordnung der
weltpolitischen Determinanten, ist wohl die relevanteste Veränderung auf globalpolitischer Ebene.
Die Welt ist nicht mehr bipolar sondern multipolar unter den wachsamen Schwingen der, bis an die
Zähne bewaffneten, USA. So sind auch die Atomstaaten in ihrer Zahl gewachsen resp. zumindest in
ihrer strategisch relevanten Anzahl. Ins Weiße Haus zog 1993 der für einen amerikanischen
Präsidenten relativ friedliebende, diplomatisch bemühte Demokrat Bill Clinton ein, der auch die
nächsten 8 Jahre dort verweilen sollte. Clintons Regierungszeit soll durch seine diplomatischen
Aktivitäten eher den globalen Pluralismus beleuchten als einen neuen Feindbild- Diskurs ins Leben
zu rufen. Von einer „globalisierten Welt“ wird erstmals geprochen. Somit versiegt auch eine
wichtige Quelle für einen “globalgespeisten“ Feindbild-Diskurs.
Dieses veränderte „globale Dispositiv“ hat auch seinen Einfluss auf den Diskurs um die Schweizer
Selbst- und Feindbilder. Es ist erneut ein ideologischer Feind besiegt worden, und an sich kein
neuer in Sicht, außer jenen im eigenen Land. Die ideologische Ausrichtung der Schweiz, wurde
durch einen erneuten Wirtschaftsaufschwung in einer an und für sich traditionellen liberaleren
Haltung verfestigt. Der Wegfall eines „ideologischen“ Feindes durch das „selbstverschuldete
Scheitern“ desselben, stellte die Maßnahmen und Denkweisen der geistigen Landesverteidigung
automatisch in Frage.
Eine geistige Landesverteidigung hatte per Definition erst einmal ausgedient. Will heißen, dass sie
sich zumindest in einem ähnlichen „Schwebezustand„ befand wie im Anschluss an den Zweiten
Weltkrieg, zumal der oder das gegen welches verteidigt wurde so nicht mehr existierte. So wurde
die Verteidigung gleichzeitig einer Hinterfragung auf mehreren Ebenen ausgesetzt.
Die Affäre Kopp führte zur Aufdeckung der Fichenaffäre eines der bestimmenden Themen der
ausgehenden Achtzigerjahre.149
Subversive staatliche Institutionen wie die P 26 werden teilweise
enttarnt und aufgelöst. Ende der Neunzigerjahre wird eine Sonderkommission beauftragt die Rolle
149
SRF DRS (24. November 1989): „PUK zur Affäre Kopp deckt Fichenskandal auf“
78
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg zu untersuchen.150
Alles in allem eine Situation die an die drei
Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Prager Putsch erinnert, als sich Feind-und
Selbstverständnis in einer gewissen Offenheit befanden und sich noch neu zu positionieren hatten.
Was von der Sowjetunion medial und gewissen Beziehungen politisch übrig bleibt, sind also
einzelne, ihrer Feindbildfunktion entrückte (weil nicht mehr zwingend durch das “Böse“
vereinnahmte), Staaten, welche ihre neue Position im Rahmen des neuen multipolaren
Weltkonstrukts in der Schweizer Wahrnehmung einnehmen.
In diesen Kontext, des weitgehenden Wegfallens eines global determinierten Feindbildes und der
Hinterfragung des über Jahrzehnte hinweg durch den Diskursstrang der geistigen
Landesverteidigung etablierten Werte und Ideen, fällt die Machtübernahme Kim Jong Ils.
9.2. Der Zerfall der Sowjetunion
Am 3. Dezember 1989 lässt das Schweizer Radio DRS verlauten: Auf Kriegsschiffen vor der Insel
Malta halten Bush und Gorbatschow ihr erstes gemeinsames Gipfeltreffen ab. Zwar haben die
Gespräche lediglich inoffiziellen Charakter, sie läuten jedoch eine neue Ära der Beziehungen
zwischen den USA und der Sowjetunion ein. So sichert Bush Gorbatschow und dessen Politik von
Glasnost und Perestroika die Unterstützung der USA zu. Die Abrüstung soll zügig vorangetrieben
werden. Eine Zusammenarbeit der beiden Supermächte scheint möglich zu werden.151
Vorausgegangen sind der zweitägigen Begegnung die umwälzenden Ereignisse des Herbsts 1989 in
Osteuropa, welche mit dem Fall der Berliner Mauer am 9. November ihren Höhepunkt erreicht
haben. Das Ende des Kalten Krieges ist gegenwärtig.
Sowohl der neue Frieden zwischen West und Ost als auch der direkt anschliessende Zerfall der
mächtigen Sowjetunion sind von zentraler Bedeutung für den Feindbild- Diskurs in der Schweiz.
Das Konzept des großen bedrohlichen Invasors zerfällt mit der Sowjetunion. Durch diesen Zerfall
werden einzelne Staaten wie die Tschechei oder Ungarn aus der Perspektive der Schweiz „befreit“
während andere wie beispielsweise, China Kuba oder Nord Korea stärker, weil erneut isoliert
werden. Im Folgenden wird der Zusammenbruch der Sowjetunion gemäss der NZZ chronologisch
betrachtet.152
150
Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK)
151 SRF DRS (3.12.1989): 3. Dezember 1989: Treffen Bush und Gorbatschow vor Malta
152 Neue Zürcher Zeitung 18.8.2011: „Der Zusammenbruch der Sowjetunion“
79
1988: Kremlchef Michail Gorbatschow hebt die sogenannte Breschnew- Doktrin auf, die der
Sowjetunion die Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Ostblock-Staaten erlaubt.
1989/90: Kommunistische Regime in den osteuropäischen Staaten stürzen durch zumeist friedliche
Demonstrationen - in der Tschechoslowakei, in Ungarn, der DDR, Bulgarien, Polen und Rumänien.
11. März 1990: Litauen erklärt als erste Sowjetrepublik seine Unabhängigkeit.
15. März 1990: Wahl Gorbatschows zum ersten Sowjetpräsidenten
29. Mai 1990: Der Radikalreformer und Gorbatschow-Kritiker Boris Jelzin wird zum Präsidenten
der Russischen Föderation gewählt.
12. Juni 1990: Mit überwältigender Mehrheit stimmt der russische Volksdeputiertenkongress für die
Souveränität Russlands innerhalb der Sowjetunion. Fortan haben russische Gesetze Vorrang vor
sowjetischen. Andere Sowjetrepubliken folgen diesem Beispiel.
15. Oktober 1990: Wegen seiner Rolle im Friedensprozess zwischen West und Ost erhält
Gorbatschow den Friedensnobelpreis.
11. Januar 1991: Sowjetische Truppen besetzen strategische Punkte in Litauen, am 13. sterben beim
«Blutsonntag» von Vilnius 14 Menschen.
1. Juli 1991: Auflösung des Verteidigungsbündnisses Warschauer Pakt
19.-21. August 1991: Putsch kommunistischer Hardliner gegen Gorbatschow scheitert am
Widerstand von Jelzin und der Bevölkerung.
5. September 1991: Der Kongress der sowjetischen Volksdeputierten beschliesst das Ende der alten
Sowjetunion und die Umwandlung in eine demokratisch-bürgerliche Gesellschaft.
8. Dezember 1991: Russland, Weissrussland und die Ukraine gründen die Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS) und beschliessen die Auflösung der Sowjetunion.
21. Dezember 1991: Acht Sowjetrepubliken treten der Gemeinschaft bei. Gorbatschow wird für
abgesetzt erklärt.
25. Dezember 1991: Gorbatschow tritt zurück und übergibt die Kontrolle über die sowjetischen
Atomwaffen an Jelzin. Um 19 Uhr 38 Moskauer Zeit wird die sowjetische Fahne über dem Kreml
eingeholt und die russische Flagge gehisst.
80
31. Dezember 1991: Die Sowjetunion hört formell auf zu existieren.
Dieser chronologische Abriss soll ein Spektrum für die mediale Reaktion in der Schweiz herstellen.
Der Zerfall der UdSSR ist für die Schweiz vor allem von ideologischer Bedeutung. Diese
ideologische Bedeutung fand sich in der gescheiterten „Alternative“, dem besiegten Feindbild und
der eigenen wohletablierten Ideologie.
9.3. Neuordnung des „Ostens“
Durch den Zerfall des „Ostblocks“ wurden einige neue Positionierungen notwendig. Da man als
Staat nicht schlichtweg eine Position gegenüber allem jenseits der Grenze „Stettin bis Triest“
beibehalten konnte. Dieser große Transformationsprozess forderte Umwandlungen der
außenpolitischen Haltungen der Schweiz und dementsprechend auch innenpolitische, kurzum durfte
die Haltung gegenüber den Bestandteilen des ehemaligen Ostens totalrevidiert werden.
Dementsprechend lautet die erste Zeile des Vorworts zum Bericht 90 des Bundesrats an die
Bundesversammlung zur sicherheitspolitischen Lage der Schweiz:
„Die Jüngsten Umwälzungen in Europa machen es notwendig, die sicherheitspolitische
Lage neu zu beurteilen und den Verantwortungsbereich der Sicherheitspolitik und ihrer
Mittel neu festzulegen.“153
Später heisst es im selben Dokument:
„Der Ost-West-Konflikt hatte den Globus zweigeteilt. Mit der allmählichen Überwindung
dieses grundlegenden Systemkonflikts unseres Jahrhunderts treten in der multipolar gewordenen
Welt alte Spannungsfelder neu hervor. Dies gilt für das vielgliedrige Osteuropa, den Balkan und
den asiatischen Teil der Sowjetunion.“154
Daraus schliesst der Bundesrat:
„„Namentlich können die osteuropäischen Staaten nicht mehr als militärisches Vorfeld
der Sowjetunion gelten.““155
Insbesondere werden die Fernöstlichen Überbleibsel des Sowjetischen Grossreiches als
problematisch betrachtet so heißt es auf Seite 864 desselben Berichts:
„Nach wie vor bestehen ungelöste Probleme in Ost- und Südostasien, insbesondere auch
in Korea. Nach Rückschlägen im Öffnungsprozess hat sich China auf sich selbst
153
Zitat aus: Bericht 90 des Bundesrats an die Bundesversammlung zur Sicherheitspolitischen Lage der Schweiz
Seite 848
154 Bericht 90 des Bundesrats an die Bundesversammlung zur Sicherheitspolitischen Lage der Schweiz Seite 857
155 Zitat aus: Bericht 90 des Bundesrats an die Bundesversammlung zur Sicherheitspolitischen Lage der Schweiz
Seite 863
81
zurückgezogen, es bleibt aber nicht nur im südostasiatischen Raum, sondern auch global
ein machtpolitisch bedeutender Faktor.“156
Besonders augenscheinlich wird dieser Prozess an der Rolle des Sowjetischen Vorsitzenden
Michael Gorbatschow, der durch Glasnost als auch die Perestroika zum einen ein Stück
demokratische politische Kultur in die Sowjetunion bringt und zum anderen sich aktiv an die
westlichen Staaten annähert.
Gorbatschow erhält vom Westen Ansehen und positive Presse in diesem Kontext, freilich
gipfelt diese Anerkennung Gorbatschows in der Verleihung des Friedensnobelpreises am 15.
Oktober 1990.157
Spätestens durch diese Verleihung gewinnt Gorbatschow den Status eines
ausnehmend „vernünftigen“ Staatspräsidenten der vom Westen akzeptiert ja gar honoriert
wird. Ab diesem Punkt verändert sich die unbestimmte „Drohung“, das Monster im Dunkeln
zu einem Menschen respektive einem Volk, mit dem man, gleich wie mit allen anderen,
Gespräche führen kann. Gorbatschow ist nicht mehr Barbare sondern ein integrierter,
vernunftbegabter Staatsmann und insofern als Verkörperung des Bösen weniger geeignet, das
Feindbild bröckelt.
Die politischen Massnahmen, die Gorbatschow diese Ehrung einbrachten sprachen für sich
selbst und dieselbe Sprache: Von mehr Demokratie, weniger Einflussnahme auf
Satellitenstaaten und mehr Transparenz ist die Rede. Gorbatschow wird aus westlicher
perspektive gesprochen gewissermassen „einer von uns“.
9.4. Der gescheiterte Putsch von Moskau
Der Zerfall der UdSSR wurde im Westen mit Genugtuung aufgenommen. Nicht nur
verschwindet mit der Sowjetunion die einzige wahrnehmbare militärische Bedrohung sondern
auch der ideologische Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus, der Demokratie über
den Despotismus, Freiheit gegenüber dem Überwachungsstaat wird kommuniziert. Auch
trennt sich das Feindbild Kommunismus von der russischen Bevölkerung. Ferner ist letztere
auch „nur aus Menschen“ zusammengesetzt.
Am 21. August 1991 wird diese Wahrnehmung besonders deutlich anhand des versuchten
Militärputsches durch konservative sowjetische Kräfte in der Armeeführung. Dieses
156
Vgl. Bericht 90 des Bundesrats an die Bundesversammlung zur Sicherheitspolitischen Lage der Schweiz Seite
864
157 Focus.de, 1990: „Friedensnobelpreis: Michael Gorbatschow“
82
Putschmoment ist aus vielerlei Hinsicht ein Kristallisationspunkt der neuen Wahrnehmung
der „Russen“ durch die Schweizer. Erstmals ist Russland von der sowjetischen Politik
getrennt zu betrachten, es ist die russische Bevölkerung und der mittlerweile allseits beliebte
Gorbatschow, die nun Opfer eines Putsches im eigenen Land zu werden drohen. Das
Feindbild ist also in dem Moment von seinen ursprünglichen Trägern getrennt zu betrachten,
indem die russische Bevölkerung ihre Menschlichkeit in der Schweizer Wahrnehmung
zurückerhält.
Im Dezember 1990 warnte der KGB-Chef Krjutschkow im Fernsehen vor dem Kollaps der
Sowjetunion und drohte mit dem Einsatz der KGB-eigenen Truppen. Am 19. August 1991,
einen Tag bevor Gorbatschow und eine Gruppe der Staatenführer der Sowjetrepubliken einen
neuen Unionsvertrag unterzeichnen wollten, versuchte Krjutschkow zusammen mit einer
Gruppe hoher Funktionäre die Macht in Moskau zu ergreifen und putschten gegen
Gorbatschow. Doch sie scheiterten am Widerstand der Bevölkerung und der Opposition unter
der Führung Jelzins.
Der Putsch scheitert, Krjutschkow flüchtet. Somit ist der Weg zu einem demokratischen Russland,
einem Ende der Schreckensherrschaft des Kommunismus frei. Die Berichterstattung im Schweizer
Fernsehen präsentiert sich entsprechend: Man betont die Wichtigkeit des Widerstands durch die
russische Bevölkerung, Mann der Stunde neben Michail Gorbatschow ist Boris Jelzin der den
Putschisten „die Stirn geboten habe“158
.
So wird der neue nichtkommunistische Präsident Russlands bereits als Held gefeiert. Die drei Toten
die dem Putschversuch zum Opfer fielen werden von der Bevölkerung betrauert, laut Schweizer
Fernsehen sind sie der Grund, dass „die Freude über den verhinderten Putsch nicht überschwänglich
sei“.
Wolfgang Leonhard kommentiert auf SRF1 den gescheiterten Militärputsch in Moskau159
:
„Hohes Demokratisches Bewusstsein der Bevölkerung“ (nicht nur Moskau sondern sehr vielen
anderen Städten) habe zum Wandel und vor allem dem Widerstand gegen die konservativen Kräfte
geführt. In diesem Kontext kritisiert er die offenbar vorherrschende Meinung, dass „Demokratie nur
etwas für Intellektuelle sei“ als falsch. Offenbar findet er seinen Verdacht, dass „auch
„nichtintellektuelle„ Völker demokratiefähig sind, bestätigt. Auch diese Äusserung kann in die
158
Zitat aus: SRF WISSEN vom 21.08.1991, 00:00 Uhr: „Putsch gegen Gorbatschow ist gescheitert“
159 SRF Rundschau News-Clip vom 19.08.2011, 10:29 Uhr: „Einschätzungen zum Ende des Putschs“
83
Vermenschlichungsprozesse der russischen Bevölkerung durch die Deutschschweizer Medien
eingerechnet werden. Oder sie veranschaulichen die immer noch nachhallenden, vom Feind als
Barbare geprägten Grundmuster. Anders ist die Überraschung über das gleich intellektuell sein wie
die demokratischen Völker des Politologen kaum nachvollziehbar160
Dann wird der Zerfall der Roten Armee relativ detailliert geschildert. Dies ist von Bedeutung zumal
die rote Armee jene Instanz ist, die im Endeffekt die realste, verstehbarste Bedrohung darstellte.
Der Kommunismus kann als Idee gefährlich sein und das Land bedrohen, eine Invasion wäre aber
in jedem Fall von der Roten Armee durchgeführt worden. Sie verkörperte also förmlich die reale
Gefahr, die physische Auswirkung des metaphysischen Feindes, und dementsprechend die Angst
vor dem kommunistischen Weltreich UdSSR. Der Zerfall der Bedrohung wird vom Schweizer
Fernsehen also in zwei Dimensionen dargestellt:
1. Dimension: Die Bevölkerung, geleitet von Demokratiebedürfnis, Freiheitswillen,
Menschlichkeit und Verstand, setzt sich gegen die Oppression durch.
2. Dimension: Die Exekutivkraft der Bedrohung: Die Rote Armee zerbricht zusehends.
Von zentraler Bedeutung ist wiederum Gorbatschows Rolle in diesem Prozess. Gorbatschow wurde
durch den Nobelpreis, der ihm aufgrund seiner friedensstiftenden Leistungen verliehen wurde in die
gewissermaßen in die vernunftgeleitete (westliche) Weltpolitik integriert. Im Rahmen des Putsches
wurde Gorbatschow von radikalen Elementen in der Sowjetunion festgehalten und der Putsch
richtete sich im Wesentlichen gegen ihn, der eben die Öffnung Russlands und demokratische
Wahlen erst möglich gemacht hatte.
Dieser Prozess ist von grosser Bedeutung für den Bedrohungsverlust der Sowjetunion. Seit diesem
Augenblick zerbricht die Sowjetunion bereits in verschiedene Aspekte: Es gibt auf der einen Seite
den Kommunismus und seine Manifestationen: Rote Armee, sein KGB und sein Totalitarismus, der
das Böse verkörpert und auf physischer und ideologischer Ebene vorderhand eine Bedrohung
bleibt.
Wie insbesondere im Kontext zur Überfremdungsinitiative sind diesen Grössen schrittweise, schon
seit den späten Sechzigerjahren, die konkreten Manifestationen genommen. Die Gefahr eines
weltenverschlingenden Atomkrieges wurde Schritt für Schritt durch den „Stellvertreterkrieg“
ersetzt, d.h. basierend auf dem „Gleichgewicht des Schreckens“ wurde seit den Sechzigerjahren,
160
Vgl. SRF WISSEN vom 21.08.1991, 00:00 Uhr: „Putsch gegen Gorbatschow ist gescheitert“
84
spätestens nach dem Schweinebucht-Zwischenfall, von beiden Weltmächten peinlich genau darauf
geachtet keine direkte Konfrontation zwischen den U.S.A und der Sowjetunion zu provozieren.
Somit war die Gefahr eines „Atomaren Weltkriegs“ schon einige Jahrzehnte aus der Palette der
„wahrscheinlichen Bedrohungen“ für die Welt und die Schweiz ausgeschieden.
Die „Stellvertreterkriege“ fanden zudem hauptsächlich in instabilen, putschgefährdeten Schwellen-
und Drittweltländern statt, wozu sich die Schweiz beim besten Willen nicht zählen würde.
Das Schweizer Fernsehen zeigt nun Bilder vom neuen russischen Präsidenten Boris Jelzin, der auf
einem Panzer der roten Armee stehend, unter dem Jubel der russischen Bevölkerung, sich für
Gorbatschow und gegen die „alte“, „totalitäre“ Sowjetunion ausspricht. Durch die Solidarisierung
des „vernünftigen“, „demokratischen“ Gorbatschow und dem demokratisch gewählten, also
legitimen Boris Jelzin, mit dem jubelnden russischen Volk, entsteht medial ein Russland, das sich
erfolgreich gegen das „Böse“ also den repressiven Kommunismus wehrt und stante pede davon
abgegrenzt wird.
So wird nicht nur Russland neu wahrgenommen, sondern die Bedrohung wird vor allem von seinen
konkreten Trägern getrennt. Der Kommunismus mag als Idee weiter bestehen, doch gibt es keine
Rote Armee mehr, die ihn verbreitet, keine Sowjetunion mehr, die seine bedrohliche Heimat an
Europas Grenzen ist. Was bleibt sind die Residuen, die Rudimente dieser dereinst die halbe Welt
umfassenden Bedrohung. Diese Reste müssen nun neu eingeordnet werden in ein Schweizer
Verständnis des selbst und der Welt als Ganzes.
10. Die Dekonstruktion des Bösen: Looking at Kim Jong Il
Vor dem Hintergrund der geführten Analyse konstruierter Feindbilder und dementsprechender
Analyse der Konstruktion von Feindbildern wird im Folgenden die Analyse einer Dekonstruktion
eines Feindbildes angestrebt. Kim Jong Il eignet sich für dieses Vorhaben besonders, zumal er im
relativ direkten Anschluss an den Zerfall der Sowjetunion die Macht im nordkoreanischen Staat
übernimmt, der nach wie vor kommunistisch, nach stalinistischem Vorbild geführt bleibt. Er
übernimmt die Herrschaft von seinem Vater.
So führt (oder wiederbelebt) er einen mindestens 50 Jahre alten Diskurs weiter, dies jedoch in
einem vollständig veränderten Dispositiv. Es wird daher von Bedeutung sein, wie sich dieselben
Figuren und Reaktivierungen des alten Dispositivs, welches durch den Zusammenbruch der
Sowjetunion markante Veränderungen erfuhr, im Diskurs um Kim Jong Il verhalten. Nordkorea
gehört nun nicht mehr zu einem Block der, der westlichen Welt und allem wofür sie steht feindlich
85
und bedrohlich gegenübersteht, sondern ist ein kleines Schwellen- bis Drittweltland das mit den
Symbolen des alten Feindes übersäht ist.
Hinzu kommt, dass dieser Kommunistische Kleinstaat doch vom neuen amerikanischen Präsidenten
mit zwei weiteren zu den größten Feinden Amerikas (und so der westlichen Welt) gezählt wurde.
Wiederum wirkt der globalpolitische Diskurs als Dispositiv auf den Schweizerischen.
Ferner wird die Abschottung gegenüber dem Westen von Nordkoreanischer Seite her (umso)
intensiv (er) betrieben. Der neue Herrscher ist, im diametralen Gegensatz zu Gorbatschow gegen
Ende dessen Amtszeit, nicht in die globale Politik integriert. Selbst rudimentärste Informationen
über die persönlichen Daten des neuen „großen“ Führers sind schwer zu erhalten, was ein grosses
Feld für Spekulation und selektive Informationsverwertung eröffnete.
Schon die Machtübernahme Kim Jong Ils als Vermächtnisherrschaft stösst sich in nahezu jeder
Hinsicht am westlichen Politikverständnis. Hinzu kommen die konstante Bedrohung anliegender
Staaten durch das Nordkoreanische Atomprogramm und dessen weit über alle Verhältnisse
aufgerüstete Armee.
Dementsprechend wird im ersten Schritt das Dispositiv für die diskursive Wahrnehmung
Nordkoreas in der Schweiz und der westlichen Welt betrachtet. Danach wird die Konstruktion um
Kim Jong Il als Feindbild analysiert und abschließend, dessen Dekonstruktion zum lächerlichen
Sonderling.
10.1. Die Schweiz und Nord Korea um 1994 (Dispositiv)
Nordkorea ist für die Schweiz kein unbeschriebenes Blatt. Bereits während der Spaltung des
Landes, also dem Koreakrieg von 1951 bis 1953, hat die Schweiz im Kontext ihrer eigenen
diplomatischen Positionierung eine Haltung gegenüber dem kommunistischen Kleinstaat generiert.
Am 7. Juli 1953 hatte der Bundesrat beschlossen das Militärdepartement zu ermächtigen, die
Entsendung einer Kommission für die Neutral Nations Supervisory Commission in Korea (NNSC)
vorzubereiten. Im Laufe der folgenden Monate reisten etappenweise, insgesamt 146 Schweizer nach
Korea, um den Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea zu überwachen, der vor allem eine
Wiederaufrüstung verhindern sollte. Die Schweizer Delegation war gemeinsam mit einer
Schwedischen von Seiten der westlichen Mächte als Beobachter aufgestellt worden. Ihr gegenüber
standen auf Wunsch der Nordkoreaner Kontrollkommissionen aus der UdSSR .
Das zwischen den Kriegsparteien ausgehandelte Waffenstillstandsabkommen wies der NNSC
ursprünglich Kontroll-, Beobachtungs-, Inspektions- und Untersuchungsfunktion zu. Diese weit
86
reichenden Funktionen wurden jedoch bereits zu Beginn der Mission darauf reduziert, mit
Inspektionsteams an zehn im Waffenstillstandsabkommen festgelegten Umschlagplätzen (ports of
entry) in Nord- und Südkorea den Austausch von Militärpersonal und Kriegsmaterial zu
überwachen. Diese Inspektionen wurden 1956 wieder eingestellt, worauf die Personalbestände in
allen vier NNSC-Delegationen massiv reduziert wurden.161
Mit dem seit 1991 bestehenden nordkoreanischen Boykott der Waffenstillstandskommission hat
Nordkorea schrittweise begonnen, allmählich auch den Kontakt zur NNSC abzubrechen. Durch die
Auflösung der Tschechoslowakei im Jahr 1993 wurde deren Delegation aus der NNSC ausgewiesen
und nicht ersetzt. Am 28. April 1994 hat die KPA (nord-koreanische Volksarmee) in einem
Memorandum erklärt, dass sie die NNSC als inexistent betrachtet und verlangte auch den Abzug
der Polen. Die polnische Delegation blieb jedoch auch nach Verlassen ihres Hauptquartiers formell
Mitglied in der NNSC, aber ohne permanente Präsenz auf der koreanischen Halbinsel. Zwei bis drei
Mal jährlich reist die polnische Delegation nach Korea, um an den NNSC-Sitzungen
teilzunehmen.162
Die verbleibende Schweizer Delegation befindet sich also obwohl Nordkorea die „diplomatischen“
Beziehungen zu ihr abgebrochen hat (indem Nordkorea sie „inexistent“ deklariert hat) an der
sprichwörtlichen Grenze der westlichen Welt. Die Mission ist in ihrer Herkunft als auch
Konstruktion ein Überbleibsel des kalten Krieges, so wie Nordkorea ein solches ist.
Seither gilt Nordkorea in der Schweiz als Agressor. Dies aus einer Reihe an Gründen: Allen
anderen voran ist Nordkorea ein mittlerweile als exotisch zu bezeichnendes Überbleibsel
stalinistisch geprägter politischer Kultur. „Stalinistisch“ hat seine Eigenschaft als bezeihcnung des
Bösen nach wie vor nicht eingebüsst. Diese Wahrnehmung wird bedient von der massiven
Propaganda, welcher die Bevölkerung ausgesetzt wird bis hin zu einem periodischen Androhen von
Atomschlägen gegen umliegende Staaten. Der Herrscher Nordkoreas wird als Despot
wahrgenommen, der in Saus und Braus lebt während sein Volk verhungert. Die spezifische Rolle
der Schweiz in dieser friedenssichernden Mission, steht ebenfalls unter den Vorzeichen des kalten
Kriegs, zumal die Schweizer Delegation mit Schweden gemeinsam die westlichen Mächte vertritt,
gegenüber die von nordkoreanischer Seite gewünschten Beobachter aus sowjetisch beeinflussten
Staaten. Man versteht sich in der Schweiz also eher als jemand der Nordkorea auf die Finger schaut,
als als jemand der Südkorea unter Kontrolle halten muss.
161
Homepage der Schweizer Eidgenossenschaft (08.02.2013): NNSC (Korea)
162 Homepage der Schweizer Eidgenossenschaft (08.02.2013): NNSC (Korea)
87
Die Schweiz nahm im Rahmen des Zusammenbruchs der Sowjetunion, neue Positionen gegenüber
den einzelnen, jetzt „freien“ Staaten ein. Diese Positionen kamen aber nicht von ungefähr, zumal
der grosse Feind im Osten zwar besiegt war, ergab sich zwingend eine Vielzahl „neuer“
internationaler Beziehungsgeflechte. Somit war die direkte Bedrohung invasiver Natur noch weiter
in eine abstrakte, surreale Sphäre gerückt, da eine Bedrohung durch eine organisierte
kommunistische Armee schlichtweg und rein technisch nicht mehr realistisch war. Selbst das
Konzept des „Stellvertreterkrieges“ hatte ausgedient, da ja die beiden antagonistischen Blöcke als
solche nicht mehr existierten und deshalb auch keine Stellvertreter mehr brauchten. Der globale
ideologische Konflikt war mit dem Ende der Sowjetunion ebenfalls beendet und gewonnen.
Was bleibt, sind aktivierbare Erinnerungen und die Rudimente eines zerfallenen Bösen. Besonders
diese aktivierbaren Erinnerungen werden das Bild Nordkoreas in der Schweiz geprägt haben,
obwohl die Trennung von Volk und Feindbild oder gar Staat und Feindbild hier teilweise (durch die
Betonung der Differenz zwischen in Saus und Braus lebendem Herrscher und hungerndem,
versklavtem Volk) vollzogen wurde. Besonders intensiviert ist der Diskurs um den
Nordkoreanischen Herrscher durch die digitale Informationsrevolution. Während der Herrschaft
Kims hat sich die Nutzung des Internets weltweit extrem ausgebreitet und verstärkt. Mit jedem Jahr
wurde die Informationsmasse grösser und leichter zugänglich.
So sind Deutungsansprüche schwieriger zu bestimmen und auch weniger relevant, zumal die Presse
eine gewisse Internationalisierung bei gleichzeitiger Demokratisierung erfuhr. Die Wendung
„Demokratisierung der Presse“ bezieht sich hier auf den Umstand, dass Information durch die
technische Entwicklung weitaus billiger verbreitbar ist. Blogs werden relevant, die kaum
Produktionskosten (von der Arbeit mal angesehen) schlucken. So ist es (aus Perspektive der
Untersuchung) „neuerdings“ jedermann möglich, sein Scherflein zu jedem Thema beizutragen und
dieses global zugänglich zu machen.
Ferner wird die Referenzziehung unter den Medien verschiedener Länder intensiviert. Man bedient
sich weitaus öfter und einfacher Berichten, die beispielsweise aus Amerika stammen, was den
Effekt des globalen Dispositivs auf den Diskurs in der Schweiz insofern intensiviert, als dass der
globale Diskurs, der für die Schweiz Teil des Dispositivs ist, viel direkter in den Schweizer Diskurs
einfliessen kann und das auch tut.
Auch der Humor, der für die Dekonstruktion eines Feindbildes mitunter wichtig ist, wurde in
diesem Sinne „internationalisiert“. Die Welt hat sich in dieser Zeit natürlich in etlichen Aspekten
massiv verändert, doch ist sie in Fragen der Diskurse deutlich näher zusammengerückt. So ist auch
88
die Teilhabe an einem Schweizerischen Diskurs nicht durch die Landesgrenzen bestimmt. Nach
einem ähnlichen Prinzip wie die amerikanische Präsidentschaftswahl sich zu einem globalen
Medienereignis gemausert hat. Die englische Sprache hat sich durch die Verbreitung des Internets
noch mehr als „Landessprache“ der Welt durchgesetzt. So wird heute nicht mehr unbedingt auf die
deutsche Version einer Serie gewartet, sondern bereits die originale Version im Internet konsumiert,
so wird auch der Humor transportiert und globalisiert.
Es wird daher im Folgenden zwar auf die Deutsch-Schweizer Medienlandschaft fokussiert, doch
werden zuweilen auch relevante global diskursmächtige Medien der westlichen Welt zur Erklärung
herangezogen, respektive werden das sample auch in Bezug auf den Schweizer Diskurs erweitern.
Dieses Vorgehen wird besonders im Fall der Dekonstruktion vonnöten sein.
10.2. Machtübernahme Kim Jong Ils
Mehr noch als Nazi-Deutschland, die Russen, die eingewanderten Italiener, ist Kim Jong Il, seine
Kultur, als der Fremde, der potenzielle Feind physisch als auch ideologisch weit von derjenigen der
Schweiz entfernt. So nimmt durch die geografische Entfernung ein ähnlicher Effekt, wie jener der
Stellvertreterkriege Form an: Nordkorea ist zu weit entfernt um einen direkten Militärschlag gegen
die Schweiz anvisieren zu können. Nicht einmal die Atomraketen würden über eine solche
Reichweite verfügen. Jeder krieg der gegen Nordkorea gefochten würde, ist aus Schweizer
perspektive ein Stellvertreterkrieg, davon ausgehend dass die Schweizer Gesellschaft den Staat als
Feind betrachtete. Obwohl das Dasein als Kleinstaat relevant zu sein scheint für das Schweizer
Selbstbild und auch auf Nordkorea zutrifft, erfährt Nordkorea medial keine politische Freundschaft,
die Assoziation fehlt wie jeder andere Direktvergleich nahezu gänzlich, wohl mitunter weil die
Identität der Schweiz als Kleinstaat an die Neutralität und die Demokratie gekoppelt ist, Werte die
dem Bild Nordkoreas widersprechen.
In den Schweizer Medien wird Nordkorea als Drittweltland beschrieben. Gerne wird der Vergleich
zum (in diesem Kontext ideologischen vorbildlichen) südlichen Nachbarn herangezogen, der sich
zu einer kapitalistischen Industrienation entwickelt hat.163
Dieser Vergleich wirkt auf verschiedenen
Ebenen: Einerseits kommt entspricht der Darstellung als „böse“ das Bild vom „Volk, welches vor
den Augen seiner „bösen“ Herrscher verhungert“, andererseits wirkt der Vergleich zwischen Nord
und Südkorea wie ein Vergleich zwischen Kapitalismus und Kommunismus unter gleichen
Vorzeichen (obwohl diese Implikation einem gewissen Zynismus natürlich nicht entbehrt).
163
DER SPIEGEL 24/1994: „Atombombe im Armenhaus“
89
Noch im Juni 1994, also einen Monat vor dem Tod Kim Il Sungs und der Machtübernahme durch
Kim Jong Il, bringt der mittlerweile 80-jährige Kim Il Sung sein Land an den Rand eines atomaren
Konflikts. Er ist voll der Drohgebärden und weigert sich auf die Forderungen der internationalen
Gemeinschaft einzugehen. Der Spiegel beschreibt dies als ein Verhalten zu welchem „gescheiterte
Diktatoren tendieren“. Der Vergleich erinnert wohl am ehesten an Adolf Hitler, der angesichts der
drohenden Niederlage gegen die Russen, Kinder mit Gewehren auf die Strassen schickt um „bis auf
den letzten Mann“ ihre Heimat zu verteidigen und sich selbst als auch seine Familie in der
Zwischenzeit umbrachte. Dann stirbt Kim Il Sung relativ plötzlich.
Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang die Berichterstattung über die Beerdigung
des Alleinherrschers, sie wird in den Nachrichten des Schweizer Fernsehens mit den Worten:
„Was Sie hier zu sehen bekommen, wird sie aller Voraussicht nach befremden“164
eingeleitet.
2 Millionen Nordkoreaner nehmen teil an den Beerdigungsfeierlichkeiten. Die
Fernsehsprecherin bezeichnet die Abläufe als „mit unbeschreiblichem Pathos betriebene
politische Machtdemonstration.“165
Es werden Bilder von den weinenden Massen gezeigt, ein
Vierzig Kilometer langer Zug zutiefst trauernder, förmlich am Boden zerstörter Nordkoreaner
aller Altersgruppen. „Szenen der ohnmächtigen Trauer und Verzweiflung“ beschreibt der
Kommentator. Während dem Bericht wird von der Off-Stimme betont, dass es sich bei dem
gezeigten um nordkoreanische Propaganda handelt. Der Zweck sei die Hingabe zu zeigen mit
welcher das nordkoreanische Volk seinen Führer liebe, was auch noch den Rest der Woche so
weiter gehen würde. Der Sprecher streicht weiter heraus wie das Volk in bitterer Armut lebe
und Hunger leide und diese Tränen das Resultat von Gehirnwäsche und angedrohter
Repression seien.
Gegen Mitte des Berichts betritt Sohn und Nachfolger Kim Jong Il die Bühne. Er wird
gezeigt, wie er an das Grab seines Vaters herantritt und in einigem Abstand davon seine
Ehrerbietung demonstriert. Er ist flankiert von Zwei nordkoreanischen Funktionären in
dunklen Anzügen, er selbst trägt ein traditionelles Hemd und die entsprechenden Hosen,
beides aus schwarzer Seide.
Aus dem Auftritt Kims begleitet von zwei Leuten, die der Kommentator als „die mächtigsten
Personen Nordkoreas“ bezeichnet, der Marshall und der Premierminister, schliesst der
Kommentator, dass Kim zweifelsohne seine Machtübernahme sichern konnte. Aus diesem
164
Zitat aus: SRF WISSEN vom 19.07.1994, 00:00 Uhr: „Trauer um Kim Il Sung“
165 Zitat aus: SRF WISSEN vom 19.07.1994, 00:00 Uhr: „Trauer um Kim Il Sung“
90
Bild ergibt sich für den Kommentator ebenfalls dass Kim Jong Il…“seine vermeintlichen
Konkurrenten, spezifisch seine Stiefmutter und seinen Halbbruder..(..)166
schon kaltgestellt
habe“. Die Formulierung „kalt stellen“ verleiht der Furcht und dem Misstrauen Ausdruck, mit
welcher Kim Jong Il von Seiten der Schweizer Presse begegnet wird, da Kim Jong Il seine
Verwandten nicht umgebracht, wie die Bemerkung impliziert, sondern sie lediglich
ausmanövriert hat.
Es werden alles in allem die antidemokratischen Züge des Nordkoreanischen Staatwesens
betont und Kim wird bereits hier als „Klon“ seines Vaters betrachtet, der womöglich mit
unlauteren Mitteln an die Macht gelangt ist.
10.2.1. Die „Vermächtnisherrschaft“
Während man Kim Jong-Ils Machtübernahme schnell als gegeben und selbstverständlich
ansah, war mit diesem Prozess ein gewisses Maß an Ungewissheit verbunden, denn bis zu
jenem Zeitpunkt war eine Vater-Sohn-Machtnachfolge in keinem kommunistischen Land
geglückt. Auf der persönlichen Ebene bedeutete Kim Il-Sungs Tod eine politische Bedrohung
für Kim Jong-Il. Auf der nationalen Ebene hätte Kim Il-Sungs Tod das Regime in eine Krise
stürzen können. Kim Jong-Il meisterte die Situation mittelsder „Vermächtnisherrschaft“.
Indem Kim Jong-Il hierdurch die fast schon göttlich verklärte Erscheinungsform von Kim Il-
Sungs Herrschaft bewahrte und diese mit der traditionellen ostasiatischen Tugend des
Gehorsams gegenüber den Eltern verband, war es Kim Jong-Il möglich, seine Macht zu
festigen, während er gleichzeitig das Regime in seiner Form bewahrte.167
Dieses innenpolitische Dispositiv, welchem sich Kim Jong Il ausgesetzt sieht, mag die
massive Propaganda und Mystifizierung um seine Person erklären, dies ist aber für diese
Untersuchung von nicht allzu grosser Bedeutung, da ja die Wahrnehmung durch die
Schweizer in der Schweiz relevant ist. Bedeutsam wird sie allerdings als Bestandteil der
Wahrnehmung durch die Schweizer Medien, zumal eine bewusste Missinformation respektive
mediale Mystifizierung durch die Nordkoreanischen Organe an und für sich bereits
Diskursgegenstand für die Schweizer Berichterstattung ist.168
166
Zitat aus: SRF WISSEN vom 19.07.1994, 00:00 Uhr: „Trauer um Kim Il Sung“
167 KBS World: Die „Drei-Revolution-Mannschaft-Bewegung“
168 Spiegel Online (13.10.2010): „Nordkorea: Kim-Jong-Un-Anhänger sollen Anschlag auf dessen Halbbruder
geplant haben“
91
Auch die Vermächtnisherrschaft ist Gegenstand von Kritik, da sie den antidemokratischen
und anachronistischen Charakter des Nordkoreanischen Regimes unterstreicht. Besonders die
Schweiz legt Wert auf Demokratie, ein Element des Schweizer Selbstbildes, das sich die
Letzten Jahrzehnte hindurch wacker gehalten hat. Basierend auf einem demokratischen
Politikverständnis stellt sich natürlich die Frage nach den Fähigkeiten des neuen Herrschers,
zumal das Vorhandensein von Fähigkeiten in demokratischen Gesellschaften alleine durch die
Wahl selbst implizit beantwortet.
Kim Jong Il bewegt sich also auf einem Grat zwischen dem Bösen Herrscher der Dunkelheit
und einem simplen Wahnsinnigen.
10.3. Die Achse des Bösen
Während der ersten 14 Herrschaftsjahre wurde Kim Jong Il als „Feind“ stilisiert. Es
existierten auch zu dieser Zeit Karikaturen und erste Anzeichen einer Dekonstruktion, das
steht außer Frage, den Gnadenstoß wird die Schreckgestalt Kim jedoch erst um das Jahr 2008
erhalten.
Die Basis für diesen feindbildkonstruierenden diskursiven Prozess bildete der Rückbezug auf
„traditionelle“ sowjetische Strukturen, vor allem der referentielle Bezug auf Stalin wurde
gerne und oft bemüht Die Frankfurter Allgemeine Zeitung liefert am Tag nach George W.
Bushs Rede, die Nordkorea diskursiv zurück in den kalten Krieg katapultieren sollte, eine
Analyse derselben.169
Der republikanische Präsident George W. Bush konzentrierte sich in seiner Rede an die
Nation im Januar 2002 auf drei Schwerpunkte: die Fortsetzung des Antiterrorkrieges, die
innere Sicherheit und die Überwindung der Wirtschaftskrise. Bushs Rede war auch ein
Auftakt für das Wahljahr, in welchem er aus seiner „Kriegsherren“ Rolle politisches Kapital
zu schlagen hoffte. Relevant ist hier allerdings nicht die politische Strategie der
Republikanischen Partei Amerikas, sondern vielmehr wie eines der mächtigsten politischen
Diskurs-Foren der westlichen Welt; die Rede an die Nation des amerikanischen Präsidenten,
dem Feindbild- Diskurs um Nordkorea neues Leben einhaucht.
Bushs Ausblick auf den weiteren Verlauf der Antiterror-Kampagne verzichtete auf
diplomatische Umschweife: Irak, Iran und Nordkorea benannte er als „Achse des Bösen“, von
169
Frankfurter Allgemeine (30.1. 2002): Vereinigte Staaten: Bush droht der Achse des Bösen“
92
der Terrorismus und die Bedrohung durch Massenvernichtungswaffen ausgingen. Doch
konkrete Aktionen gegen die drei Länder kündigte der Präsident nicht an – laut der FAZ
handelte es sich nur um verschärfte Drohgebärden. Was wir ein gutes Jahrzehnt später nur
teilweise bestätigen können.
Die Achse des Bösen, ist eine rhetorische Figur, die ihre erste Verwendung im
Zusammenhang des Zweiten Weltkriegs in Form der „Achsenmächte“ erhielt, damals betitelte
die militärische Führung der Alliierten Japan, Deutschland und Italien als „die
Achsenmächte“. Damals mögen reale politische Faktoren bei der Namensgebung eine Rolle
gespielt haben, in Bushs Rede handelt es sich bei ihrer Verwendung um eine Reaktivierung
alter rhetorischer Figuren.
Grundsätzlich wäre das Prädikat „des Bösen“ nicht mal nötig gewesen um die Zuordnung
zum Bösen augenscheinlich zu machen- man wollte wohl keine Zweifel im Raum stehen
lassen.
Ebenfalls zentral ist die Assoziation mit dem neuen Feindbild der westlichen Welt
insbesondere Amerikas: Dem Terrorismus. Es ist für diese Untersuchung zwar grundsätzlich
nicht relevant aber es ist auch klar, dass im Gegensatz zu den Achsenmächten im Zweiten
Weltkrieg, die neue „Achse des Bösen“ keine gemeinsame, offizielle Kriegspartei ist. Iran
und Nordkorea mögen sich durch ihre geteilte Verteufelung durch Amerika diplomatisch
näherkommen- oder nicht- Bushs Aussage zielt nicht auf die Erklärung internationaler
Beziehungen, sondern positioniert. Erst die Bösen als solche und danach sich selbst als der
Befreier, Bekämpfer des Bösen, als potentieller Bezwinger der Feinde. Falls er widergewählt
würde, versteht sich. Diese Bezeichnung als Achse des Bösen, wird Bush während seiner
gesamten zweiten Amtszeit (bis und mit 2008) aufrechterhalten. Er erhebt sie zur Kategorie
170 der es für Nordkorea zu entfliehen (indem es sich als „gut“ bewährt) gilt. Genau das ist es
auch, eine Kategorie des Feindlichen, solange sich Nordkorea in dieser Kategorie befindet, ist
auch das Bekämpfen bis zum Tod legitimiert. Als Staat möchte man natürlich lieber nicht der
Feind von Amerika sein.
Entsprechend dem Spiegel unterliegen die Diskurse zwischen den beiden Koreas einer
ähnlichen Situation, wie die Diskurse in der Schweiz.
170
Die Presse.com (6.8.2008): „Bush: Nordkorea weiterhin Teil der "Achse des Bösen"“
93
Bushs Rede wirkt auch auf die Verhandlungen zwischen Nord- und Südkorea als Dispositiv.
Die Rede dezimiert die Erfolgschance von Friedensverhandlungen, da Nordkorea von einem
der mächtigsten Menschen der westlichen Welt aus derselben ausgeschlossen, ja gar zum
Feind erhoben wurde. Die Verhandlungen zur Annäherung der beiden Teilstaaten liegen so
unter dem Schatten dieser Kategorisierung: Kim Jong Il ist bereits Feind des Westens, jede
Annäherung an Südkorea ist aus seiner Perspektive, jetzt nicht mehr glaubwürdig. Die
Verdammung durch die Uno erfolgt abschliessend und zementiert das Bild Nordkoreas als
„Feind der Welt“.171
10.4. Dekonstruktion eines Mythos
Die „Dekonstruktion“ im Rahmen von Humor und Lächerlichkeit, findet Hand in Hand mit
dieser „ultimativen Schwäche“ der Sowjetunion ihren Anfang. Nicht dass der Westen seit
dem Mauerfall über Kim Jong Il (resp. Kim Il Sung) lachen würde, doch ist der Wegfall der
mitunter überlegenen Bedrohung, der „bösen“ Sowjetunion eine notwendige Bedingung für
die Dekonstruktion des Feindbilds Kim Jong Il.
Die offiziellen Nordkoreanischen Kanäle multiplizieren den Mythos um ihren „geliebten
Führer“ der als allmächtige Vaterfigur dargestellt wird, dessen überragende Fähigkeiten alles
Menschliche überbieten. Der fein ausgeklügelte Personenkult um die Führerfigur reicht von
einem göttlichen Golftalent bis hin zu einem Pop Hit mit dem Titel: "No Motherland Without
You", der Kims Führung anpreist. So zumindest dringt die Propaganda zum Westen durch. In
diesem Aspekt wird der Diskurs durch den Umstand befeuert, dass es sich bei vielen der
vermeintlichen Behauptungen der nordkoreanischen Propagandakanäle eben um Lügen
handle. So wird also durch diese Kommunikation seitens Nordkoreas eine Abgrenzungslinie
in der Schweizer (und wohl auch dem Rest der westlichen) Gesellschaft gekreuzt, da diese
Gesellschaften, diese Informationen als gelogen empfinden. Im Weiteren wird zu beobachten
sein, dass eben diese „Fehlinformationen“ mitunter Stoff für die Dekonstruktion Kims vom
Feind zum amüsanten Trottel liefert. Ferner wird durch die Abwesenheit des „grossen
Bruders“ Sowjetunion als auch die relative Entfernung, ist die Schweiz keineswegs direkt
bedroht durch den Nordkoreanischen Führer.
Das willl heissen, dass die materielle Lebenswelt in keiner antizipierbaren Weise beeinflusst
wird durch Nordkorea oder eben dessen Präsidenten. Die Auseinandersetzung mit der Figur
171
Spiegel Online (23.10.2009): „Nordkorea: Uno prangert Kim Jong Ils Grausamkeiten an“
94
verläuft rein medial und mitunter deshalb; abstrakt. Bei der Beschaffung von schlichten Daten
über den „geliebten Führer“ wird dieser Personenkult bereits ersichtlich, der seitens der
nordkoreanischen Medien um den Machthaber generiert wird. So ist bereits sein
Geburtsdatum Gegenstand von Mythen. Laut koreanischer Medien wurde Kim Jong Il unter
einem doppelten Regenbogen auf der Spitze eines heiligen Berges zur Welt gebracht.
Tatsache nach westlichem Verständnis ist, dass er unter dem Namen Yuri Irsenovich Kim in
einem kommunistischen Arbeitslager das Licht der Welt erblickte. Gleich wie sein Sohn (Kim
Jong Un) nach ihm, sollte auch Kim Jong Il mit dem Tod und unter dem weiten Schatten
seines Vaters an die Macht gelangen, was einer automatischen Reaktivierung alter Figuren
des Feindlichen gleichkommt. In diesem Kontext wird die Dimension „Glaubwürdigkeit“
relevant und insofern Foucaults Abgrenzungskategorie von „Wahrem“ zu „Falschem“
So wurde der Mensch hinter der Maske des Diktators in den Fokus der Medienberichte
genommen. Wir beobachten eine Bewegung der Thematik Kim Jong Il weg von den
politischen Berichten hin zu einer eher als „gesellschaftlich“ zu beschreibenden
Themengruppe. Seine Liebe zum südkoreanischen und amerikanischen Kino, respektive Kino
überhaupt wurde thematisiert. Seine Freizeit, der Pferdesport den er betreibt. Bald geriet sein
Kleidungsstil in den Fokus der Online-Öffentlichkeit. Auffällig ist der „Spiegel“ dessen
Wirtschaftsteil sich mit Kim zu beschäftigen beginnt.172
Als einer der letzten
kommunistischen Herrscher, befindet sich Kim Jong Il aus kapitalistisch geprägter
Perspektive der Weltwirtschaft bereits implizit jenseits aller Vernunft. So erhalten Kims Ideen
das Prädikat „absurd“.
Wir erinnern uns: Der Kommunismus ist als globale Alternative gescheitert. Würde aus
Wirtschaftsperspektive ein Feindbild aufrechterhalten würde das eine Alternative implizieren,
eine Eigenschaft die man dem Kommunismus und insbesondere Kim Jong Il nicht zugesteht.
Das Kapital ein geeigneter Feind zu sein, wird ihm so abgesprochen.
Kim wird erst als Verbrecher diskutiert später werden seine Ideen und Fortschrittspläne
zerpflückt.173
Der Spiegel fragt woher denn Kim Jong Il sein Geld habe und bietet als
Erklärung Versicherungsbetrug an. Er stützt sich dabei auf Aussagen der Washington Post,
also auf ein amerikanisches Medium.
172
Wagner, Wieland (18.05.2010):“Absurde Expo-Pavillons: Strom sparen wie Kim Jong Il“ in: Spiegel Online
173 Wagner, Wieland (18.05.2010):“Absurde Expo-Pavillons: Strom sparen wie Kim Jong Il“ in: Spiegel Online
95
Dabei entstand nicht jeder Gesprächsstoff der zur Dekonstruktion beitragen sollte durch die
westlichen Medien.174
Die thematische Quelle scheint auch von den Nordkoreanischen
Medien mitbestimmt. So stammt beispielweise der Inhalt Kim Jong Il sei eine Modeikone aus
dem Nordkoreanischen Propagandaapparat. Im Westen wurde sie dann der Lächerlichkeit
preisgegeben.
In ihrer ersten Ausgabe im Jahr 2003 beginnt die Weltwoche zu dekonstruieren. Sanft und relativ
vorsichtig wird der Mann Kim Jong Il gegenüber der weltpolitischen Lage respektive der
diplomatischen Situation diskutiert. Der Autor zeichnet einerseits eine Situation die dem leicht
sonderbaren Herrscher über den Kopf gewachsen sei, andererseits treten bereits einige Eigenheiten
auf, die später Bestandteil des „Lächerlichen“ sein werden.
So z.B. die Gewohnheit des „geliebten Führers“ sich alle möglichen Fabriken und
Produktionsstätten anzuschauen und „wertvolle“ Inputs abzugeben. Diese Gewohnheit wird sich
Jahre später in einem der erfolgreichsten „Kim Jong Il Dekonstruktion“-Blogs175
„Kim Jong Il
Looking at things“, der auch eine der Inspirationsquellen für diese Untersuchung ist, wiederfinden.
Die Weltwoche zitiert im weiteren Gerüchte, die den Staatschef als versoffenen, Orgien feiernden
Fremdgeher qualifizieren. Er sei einer der stärksten Einzelkunden einer amerikanischen
Whiskeymarke und habe seine Frau erst ins Exil gezwungen und danach alleine in Moskau sterben
lassen.
„Er liebt schnelle Autos, soll in jeder Provinz Nordkoreas eine luxuriöse Residenz
unterhalten, eine private Videothek mit 22`000 Filmen besitzen, ein James-Bond-Fan sein,
sich überhaupt mehr um Filme kümmern als um die Staatsgeschäfte. In seinem Büro sollen
stets auf zwanzig Bildschirmen Fernsehprogramme laufen, drei davon südkoreanische.“176
In diesem Artikel wird Kim über eine ganze Reihe an Ausgrenzungslinien geschoben, die ihn
nicht mehr als rein böse, sondern vornehmlich als inkompetent und in der Konsequenz als
mehr oder minder geistig umnachtet dastehen lassen. Wiederum wird zusammenfassend
Referenz auf die „Weltpresse“ gezogen, die Kim Jong Il als „Spinner, Playboy und Irren
verhöhnt.“177
Interessanterweise wird in demselben Artikel relativiert: Der Autor bezieht sich
174
Welt.de (7.9.2010): „Kim Jong-il: Die schlimmsten Nachrichten“
175 Kim Jong Il Looking at Things (tumblr.com)
176 Neidhart, Christoph (13.5.2013): „Vater ist schuld“. Weltwoche Online.
177 Neidhart, Christoph (13.5.2013): „Vater ist schuld“. Weltwoche Online
96
auf einen Südkoreanischen Filmemacher und den Südkoreanischen Präsidenten, die Kim als
intelligente, humorvolle Person darstellen, dies wird der offenbar immer noch
diskursbestimmenden Aussage George W. Bushs gegenübergestellt der Kim als „launischen
Tyrann, Pirat, Rüpel und Schurke“ darstelle. Die Frage bleibt aber abgesehen von den Zitaten
unbeantwortet. Es muss allerdings erwähnt sein, dass George W. Bush zu jenem Zeitpunkt
zwar enorm „diskursmächtig“ ist, wie jeder amerikanische Präsident, sich im Schweizerischen
Diskurs selbst aber auch starker Kritik ausgesetzt sieht.
Ein Jahr später, 2004 Titelt die Welt: „Kim Jong Il - der Pygmäe von der Achse des Bösen“
und zitiert so erneut den amerikanischen Präsidenten.178
Hier wird wiederum betont wie
wenig man eigentlich über den Staatsführer wisse, Spekulationen über seine Vorlieben
bezüglich Filme und Nahrung werden als solche zu erkennen gegeben, auch habe er sich
bisher noch keinen Fragen von westlichen Medien gestellt. Der Mythos bleibt bestehen, doch
wirkt er Misstrauenserregend und lädt weiter zur Spekulationen ein. So wird in diesem Artikel
die Biografie Kims besprochen. Ein Drogenhändler mit künstlerischer Ader soll er sein. Hier
wird, anders als über andere Präsidenten sehr persönlich der Mensch Kim Jong Il in den
Fokus der Berichterstattung genommen. Er wird so als Mensch dargestellt, als schlechter
Mensch vielleicht, aber als Mensch. Insofern wird er von der Feindbildkonstruktion
abgetrennt, diese Tendenz zeigt sich beim Berichten über „geheime kapitalistische
Machenschaften“, so soll er nebst den Drogen auch mit Waffen und Edelmetallen handeln.
Die Abtrennung von Volk und Herrscher findet parallel statt:
„Vor dem Hintergrund, dass angeblich über 200`000 seiner Untergebenen unter
grausamsten Bedingungen in Lagern gefangen gehalten werden und geschätzte zehn
Prozent der Bevölkerung Nordkoreas Ende der neunziger Jahre schlicht verhungerten,
zeigt sich hier die wahre Arroganz der Macht: Kim Jong Il ist der einzige Dicke in
Nordkorea.“179
Wie schon beim Moskauer Putsch zu beobachten war, wird Kim gleich wie die Rote Armee
oder der KGB von der Nordkoreanischen Bevölkerung getrennt betrachtet. Er ist die Geissel
seines Volkes, nicht dessen Vertreter. Wir befinden uns an diesem Punkt immer noch
innnerhalb eines Feidnbildes. Kim Jong Ils Person wird betont auf illegale Machenschaften
hin präsentiert. Gelichsam stellen wir hier bereits den Beginn der Dekonstruktion fest.
178
Küchen Marina, (13.9.04): „Kim Jong Il; der Pygmäe der Achse des Bösen-Mythen umranken den
Machthaber von Pjong Jang“ Welt.de
179 Zitiert aus: Küchen Marina, (13.9.04): „Kim Jong Il; der Pygmäe der Achse des Bösen-Mythen umranken den
Machthaber von Pjong Jang“ Welt.de
97
Letztere äussert sich durch die Verwendung von Attributen wie „absurd“. Der Artikel fasst
zusammen und positioniert Kim und Nordkorea folgendermaßen in das politische
Weltgeschehen:
„Alles in allem hat Kim Jong Il großen politischen Überlebenswillen bewiesen. Sein Land
ist isoliert und pleite, aber durch seinen absurden Stolz, die omnipräsente Furcht vor
einen Kollaps des Landes und die rücksichtslose Unterdrückung der Bevölkerung und
nicht zuletzt die stringente Nicht-Informationspolitik kann er sich jedoch an der Macht
halten.“180
Die Bezeichnung „Pygmäe“ spricht derweil für sich. Ein kleingewachsener Eingeborener aus
einem fernen, fremden Land. Auffällig ist, dass Bush Kim einerseits als Pygmäen bezeichnet
aber andererseits in einem Atemzug mit den gefährlichsten Feinden der USA nennt. Dieser
Widerspruch macht nur im Kontext einer Dekonstruktion Sinn, da ein Feindbild, wie eingangs
hergeleitet generell eher aufgebaut, entmenschlicht und zur anonymen, kompromisslosen
Bedrohung stilisiert wird. Kim hingegen wird eher vermenschlicht und als tendenziell
machtfrei dargestellt.
So werden Kims Drohungen mit Atomraketen als diplomatische Tricks bezeichnet, sie
werden nicht als konkrete Bedrohung verstanden. Dies unterscheidet ihn von den „Bösen
Herrschern“ des kalten Krieges.
Die Prozesse der Trennung von diesem anonymisierten Bild, die starke Relativierung der
Bedrohung, welche von Kim ausgeht gekoppelt mit einer Vermenschlichung und der
Distanzierung vom eigentlichen Feindbild „Kommunismus“ bildet eine Vorstufe zur
Dekonstruktion des Feindbildes Kim Jong Il.
Das Prädikat „absurd“ kann als Vorstufe des Wahnsinns verstanden werden. Der vom Spiegel
im Kontext der Weltausstellung auf Kims Ideen zur Stromgenerierung gemünzte Begriff soll
auch später noch Verwendung finden.
Im Jahr 2008 erlitt Kim Jong Il einen Hirnschlag oder ein vergleichbares Trauma, die Berichte
variieren stark. In diesem Kontext wurde die Geheimniskrämerei des Nordkoranischen
Propgandaapparats wieder augenscheinlich. Auffällig ist der Spiegel, der sich bei seiner
Berichterstattung auf einen französischen Arzt beruft, die Referenzziehung zeigt wie wenig
man aller Information aus Nordkorea noch vertraut. Der Französische Arzt soll einer von
vielen sein, der wichtige Mitglieder der Nordkoreansichn Führungsriege behandeln soll. Der
180
Küchen Marina, (13.9.04): „Kim Jong Il; der Pygmäe der Achse des Bösen-Mythen umranken den
Machthaber von Pjong Jang“ Welt.de
98
Spiegel bezieht sich auf die französische Zeitung „le figaro“ ein weiteres Indiz für die
angeführte „Internationalisierung“ des Diskurses.181
Diese Zweifel, die implizite Annahme der Lüge geht gar soweit, dass 20 Minuten die schiere
Existenz des Diktators zeitweise bezweifelt. An diesem Punkt kann davon ausgegangen
werden dass alle Kommunikation seitens Nordkoreas per se als „falsch oder unwahr“
kategorisiert wird und erst die interpretierte Information durch die westlichen Medien
Gültigkeit haben kann.182
Indiz liefert u.a. die thematische Zuordnung in die Sparte „Kreuz
und Quer“. Dieser Bruch mit den Abgrenzungslinien der Schweizer Gesellschaft dürfte ein
entscheidender Schritt weg von der Wahrnehmung Kims als Gefahr oder Feind hin zu einer
Wahrnehmung als Hampelmann gewesen sein. Kim ist als Person schon ein alter halbtoter der
in keinster Weise gefährlich werden kann. Die ideologische Qulle für das Böse in Kim Jong
Il, George W. Bush wurde, im Kontext der eben nicht vorhandenen
Massenvernichtungswaffen im Irak in diesem Jahr, selbst unglaubwürdig. Zusätzlich endet im
Jahr 2008 die Regierungszeit von George W. Bushs, der Kim Jong Il in den Status eines
internationalen Feindes erhob, die Quelle der Kategorisierung als „böse“, wird den Diskurs zu
seiner Person also aus einer Reihe an Gründen nicht weiter bestimmen können.
So ist mit seiner Krankheit eine chronologische Grenze zu ziehen, nach welcher, der später
zurückgekehrte Präsident stetig und definitiv in die Region des wahnsinnigen, mit
Atomwaffen bestückten Harlekins abrutscht. Ebenfalls Entscheidend ist die Abwesenheit
eines Feindbildgenerierenden Bösen, das in Kim Jong Il einen Träger finden kann. Durch die
Hinterfragung und „überflüssig“-werdung der geistigen Landesverteidigung sind diese
Abgrenzungsmechanismen zur Selbstdefinition nicht mehr aktiv. So ist der „Feind“ einer
obsoleten Verteidigung ebenfalls obsolet geworden und daher keine Bedrohung.
Das Resultat dieses neuen Dispositivs um einen höchstwahrscheinlich schrecklichen Diktator,
ist ein Diskurs der diesen schrittweise in die Lächerlichkeit zieht. Dieser Prozess geschieht
über den Verlust der ideologischen Bedrohung, der physischen Bedrohung, dem Potenzial in
irgendeiner Form als Täter des Bösen zu fungieren und über den schieren Umstand, dass ein
solcher Feind nicht mehr gebraucht wird, um der Schweiz ein „Selbst“ zu verleihen.
181
Spiegel Online (11.12.2008): “Französischer Arzt bestätigt Gerüchte über Kim Jong Ils Schlaganfall“
182 20 Minuten Online (11.11.2008): „Existiert Kim Jong Il nur noch auf Bildern?“
99
11. Die Schreckliche Macht des Diskurses
Die Untersuchung der medialen Konstruktion des Bösen hat einen Einblick in die
Funktionsweisen der immer noch enger werdenden Beziehungen zwischen internationalen
Diskursen und nationalen Diskursen geschaffen. Die Schweiz ist seit dem Ende des Zweiten
Weltkriegs Teil einer sich diskursiv verdichtenden Welt. Der Begriff der Neutralität, mag
bezogen auf kriegerische Handlungen nach wie vor seine Gültigkeit haben, ideologisch
gesehen existiert sie nicht und kann es je länger umso weniger. Das Selbstverständnis der
Schweiz scheint eines internationalen Kontextes zu bedürfen, man gehört zu der einen oder
anderen globalen Idee. Weiterführend könnte mittels der hergestellten analytischen Basis auch
die politische Entwicklung in der Schweiz, der Aufschwung des Rechtspopulismus
beispielsweise, untersucht werden. Die Konstruktion eines „Bösen“ ist ein sehr breit genutztes
Medium der Politik, gäbe es sie nicht, gäbe es wohl unter anderem keine Krieg.
Die Analyse ergibt auch, dass der Begriff des „Bösen“ eben nichts weiter ist als ein Begriff.
Eine Jahrtausende alte, mit rhetorischen Figuren assoziierte „ideologische Quelle“ der durch
Reaktivierung jeweils neues Leben eingehaucht wird. Natürlich verändern sich die „Zeichen
des Bösen“ die eine solche Kategorisierung stattfinden lassen mit der Kultur und der
Geschichte. Das Böse ist also in keiner Weise real sondern existiert nur abstrakt und wird
vom Diskurs gemäß dem entsprechenden Dispositiv bestimmt. Eine begriffliche Kategorie,
die nicht als Ausprägung in der Realität vorkommt. Die „realen“ Ausprägungen werden erst
mit der Kategorisierung definiert. Das Böse ist der Boden aus dem ideologische Feindbilder
erwachsen und und von einer enormen, die Gesellschaftsschichten und Kulturen
durchdringenden Mobilisierungskraft. Diese Erkenntnis ist aus der Konstruktionsstruktur des
Bösen und dessen Auswirkungen zu ziehen und enthüllt eine durchaus schreckliche Macht
des Diskurses.
100
12. Quellenverzeichnis
12.1. Primärquellen
20 Minuten Online (11.11.2008): „Existiert Kim Jong Il nur noch auf Bildern?“
http://www.20min.ch/news/kreuz_und_quer/story/10330590
Bericht 90 des Bundesrats an die Bundesversammlung zur Sicherheitspolitischen Lage der
Schweiz.
Bieler Tagblatt (08.05.1999) : „Die Expo.01 als Antwort auf die Landi ’39“.
Dekret des 2. Allrußländischen Sowjetkongesses über den Grund und Boden (26. Oktober /8.
November 1917): / http://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0006_bod_de.pdf
Der Spiegel 9/1948: „Der Vorhang fiel, Tragische Chöre in Prag“.
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44415769.html
Der Spiegel 45/1956: „Ungarn Aufstand: Um ein besseres Leben“
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43064554.html
DER SPIEGEL 24/1994: „Atombombe im Armenhaus“
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13686055.html
Die Presse.com (6.8.2008): „Bush: Nordkorea weiterhin Teil der "Achse des Bösen"“
http://diepresse.com/home/politik/aussenpolitik/404195/Bush_Nordkorea-weiterhin-Teil-der-
Achse-des-Boesen
Focus.de , (1990): „Friedensnobelpreis: Michael Gorbatschow“
http://www.focus.de/politik/ausland/tid-20029/friedensnobelpreis-1990-michail-
gorbatschow_aid_559932.html
Frankfurter Allgemeine (30.1. 2002): Vereinigte Staaten: Bush droht der Achse des Bösen“
http://www.faz.net/aktuell/politik/vereinigte-staaten-bush-droht-der-achse-des-boesen-
150464.html
Historisches Lexikon der Schweiz Online 29.11.2007:http://www.hls-dhs-
dss.ch/textes/d/D8695.php
Homepage der Schweizer Eidgenossenschaft (08.02.2013): NNSC (Korea):
http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/themen/einsaetze/peace/korea.html
101
Jost, Hans-Ulrich: „Der Bundesrat wusste bereits 1942 über den Holocaust Bescheid“.
http://politblog.24heures.ch/blog/index.php/16061/der-bundesrat-wusste-ber-den-holocaust-
bescheid/?lang=de
KBS World: Die „Drei-Revolution-Mannschaft-Bewegung“:
http://world.kbs.co.kr/german/event/nkorea_nuclear/general_04d.htm
Kim Jong Il Looking at Things (tumblr.com)http://kimjongillookingatthings.tumblr.com/
Küchen, Marina (13.9.04): „Kim Jong Il; der Pygmäe der Achse des Bösen-Mythen umranken
den Machthaber von Pjong Jang“ Welt.de : http://www.welt.de/print-welt/article340045/Kim-
Jong-Il-der-Pygmaee-von-der-Achse-des-Boesen.html
Neidhart, Christoph (13.5.2013): „Vater ist schuld“. Weltwoche Online:
http://www.weltwoche.ch/ausgaben/2003-01/artikel-2003-01-vater-ist-schuld.html
Neue Zürcher Zeitung (3.3. 1948). Nr.460
Neue Zürcher Zeitung (7.3.1948). Nr. 463
Neue Zürcher Zeitung 18.8.2011: „Der Zusammenbruch der Sowjetunion“
http://www.nzz.ch/aktuell/international/der-zusammenbruch-der-sowjetunion-1.11963279
NZZ Folio, Cattani Alfred Erwünschte Flüchtlinge (August 1991): Ungarn, Tibeter und
Tschechoslowaken in der Schweiz: www.nzzfolio.ch/www/d80bd71b-b264-4db4-afd0-
277884b93470/showarticle/0c4ef933-b5b2-4e50-8ce7-6226617e49d6.aspx
Schwarzenbach, James(1970): „Im Rücken das Volk“. Christiana-Verlag AG, Stein am Rhein
Schweizer Landeshymne (Schweizerpsalm): http://www.admin.ch/org/polit/00055/
Spiegel Online (23.10.2009): „Nordkorea: Uno prangert Kim Jong Ils Grausamkeiten an“
http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-uno-prangert-kim-jong-ils-grausamkeiten-
an-a-656884.html
Spiegel Online (13.10.2010): „Nordkorea: Kim-Jong-Un-Anhänger sollen Anschlag auf
dessen Halbbruder geplant haben“ http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-kim-jong-
un-anhaenger-sollen-anschlag-auf-dessen-halbbruder-geplant-haben-a-722819.html
102
Spiegel Online (11.12.2008): “Französischer Arzt bestätigt Gerüchte über Kim Jong Ils
Schlaganfall“: http://www.spiegel.de/politik/ausland/nordkorea-franzoesischer-arzt-bestaetigt-
geruechte-ueber-kim-jong-ils-schlaganfall-a-595900.html
SRF DRS (3.12.1989): 3. Dezember 1989: Treffen Bush und Gorbatschow vor Malta
http://drs.srf.ch/www/de/drs/155002.3-dezember-1989-treffen-bush-und-gorbatschow-vor-
malta.html
SRF mySchool vom 07.06.2012, 09:45 Uhr: „Zeitreise: Die Schwarzenbach-Initiative“ -
Folge 9: http://www.srf.ch/player/video?id=ee71155c-299c-4bf8-bb31-53e605ccba46
SRF DRS (24. November 1989): „PUK zur Affäre Kopp deckt Fichenskandal auf“
http://drs.srf.ch/www/de/drs/152867.24-november-1989-puk-zur-affaere-kopp-deckt-
fichenskandal-auf.html
SRF DRS News-Clip vom 19.08.2011, 10:29 Uhr: „Einschätzungen zum Ende des Putschs
(Rundschau, 21.08.1991)“ http://www.srf.ch/player/tv/news-clip/video/einschaetzungen-zum-
ende-des-putschs-rundschau-21-08-1991?id=1a843d0a-4a1d-4430-9475-423a6fdf4c97
SRF Reporter vom 16.12.2009, 22:31 Uhr:In geheimer Mission - Mitglieder von P-26
brechen ihr Schweigen http://www.srf.ch/player/tv/reporter/video/in-geheimer-mission-
mitglieder-von-p-26-brechen-ihr-schweigen?id=136127bb-65ef-4278-8618-93fb2800d5a3
SRF WISSEN vom 19.07.1994, 00:00 Uhr: „Trauer um Kim Il Sung“
http://www.srf.ch/player/tv/srf-wissen/video/trauer-um-kim-il-sung?id=fae7010f-8598-4b45-
b67a-7de4958c11f6)
SRF WISSEN vom 21.08.1991, 00:00 Uhr: „Putsch gegen Gorbatschow ist gescheitert“
http://www.srf.ch/player/tv/srf-wissen/video/putsch-gegen-gorbatschow-ist-
gescheitert?id=f70eaa65-d79a-491d-af71-ef95d6744924
Schweizer Parlament Homepage: „Bundesversammlung - Fraktionspräsidenten seit 1917“
http://www.parlament.ch/d/organe-
mitglieder/bundesversammlung/fraktionen/praesidentenseit1917/Seiten/default.aspx
Tages Anzeiger Online am 28.03.2013: „Freysinger soll die Fahne abhängen“.
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Freysinger-soll-die-Fahne-
abhaengen/story/26281963
103
Unabhängige Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg (UEK)
http://www.uek.ch/de/
Wagner, Wieland (18.05.2010):“Absurde Expo-Pavillons: Strom sparen wie Kim Jong Il“ in:
Spiegel Online: http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/absurde-expo-pavillons-strom-
sparen-wie-kim-jong-il-a-695084.html
Welt.de (7.9.2010): „Kim Jong-il: Die schlimmsten Nachrichten“
http://www.welt.de/satire/article9460741/Kim-Jong-il-Die-schlimmsten-Nachrichten.html
Zeitenwende.de (1.7.2002): “Die Ölkrise 1973“: http://zeitenwende.ch/finanzgeschichte/die-
oelkrise-1973/
12.2. Sekundärliteratur
Audrey George (1986): „Das Werden des modernen Staates“ in: Comité pour une nouvelle
Histoire de la Suisse(Hrsg.) (1986): Geschichte der Schweiz und der Schweizer. Schabe
Verlag. Basel
Dürrenmatt, Peter (1979): Herausforderung der Schweiz. Vom Zweiten Weltkrieg bis zur
Gegenwart.
Foucault, Michel (1970): „Die Ordnung des Diskurses“. Fischer Verlag. Frankfurt a. Main
Frey, Bruno S./ Goette Lorenz (1988): „Does popular Vote destroy Civil Rights?“, American
Journal of Political Science 42(2) S.1343-1348).
Frischknecht Jürg, Hafner Peter, Haldimann Ueli, Niggli Peter (1987): „Die unheimlichen
Patrioten-Politische Reaktion in der Schweiz“-ein Aktuelles Handbuch. Limmat Verlag,
Zürich
Gilg Peter/Hablützel Peter (1986): „Beschleunigter Wandel und neue Krisen“ in: Comité
pour une nouvelle Histoire de la Suisse (Hrsg.) (1986): Geschichte der Schweiz und der
Schweizer. Schabe Verlag. Basel
Hickethier, Knut (2008): Das narrative Böse-Sinn und Funktionen medialer Konstruktionen
des Bösen in: Faulstich, Werner (Hrsg) (2008): Werner Faulstisch (Hrsg) „das Böse Heute“
München. Wilhelm Fink Verlag.
104
Historisches Lexikon der Schweiz Online: http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D16572.php
Jäger Margarete/ Jäger Siegfried (2007): Von der Diskurs- zur Dispositivanalyse:
Überlegungen zur Weiterführung eines Stadtteilprojekts. Vortrag, gehalten auf dem
Workshop des DISS (in Verbindung mit der FES) in Freudenberg (http://www.diss-
duisburg.de/Internetbibliothek/Artikel/Diskurs-_Diapositivanalyse.htm)
Kaestli, Tobias (2005): „Selbstbezogenheit und Offenheit-Zur politischen Geschichte eines
neutralen Kleinstaats. Verlag Neue Zürcher Zeitung: Zürich
Meier-Seethaler, Carola (2008): Das Böse als Produkt gescheiterter menschlicher Sinnsuche,
in: Faulstich, Werner (Hrsg) (2008): Werner Faulstisch (Hrsg) „das Böse Heute“ München.
Wilhelm Fink Verlag
Maurer Peter (1985): Anbauschlacht. Landwirtschaftspolitik, Plan Wahlen, Anbauwerk 1937-
1945. Zürich
Mäusli, Theo (1995): Jazz und Geistige Landesverteidigung. Chronos Verlag. Zürich
Ruffieux, Roland (1974): „La suisse entre-deux-guerres. Lausanne
Ruoff, Michael (2007): Foucault-Lexikon: Entwicklung, Kernbegriffe, Zusammenhänge.
München
Rings, Werner (1990): Schweiz im Krieg 1933-1945-Ein Bericht mit 400 Bilddokumenten.
Erweiterte Neuauflage.zürich
Stirnimann Charles (1988): Das rote Basel 1935-1938. Basel
Wagener Sybil (1999): Feindbilder, wie kollektiver Hass entsteht. Quadriga Verlag. Berlin
12.3. Bildlegende
Abbildung A: Nebelspalter Nr. 14 vom 1. 4. 1948 ;74. Jahrgang
Abbildung B: Nebelspalter Nr. 14 vom 1. 4. 1948; 74. Jahrgang
105
13. Lebenslauf
Name: Rippmann
Vorname: Till
Adresse: Mattackerstr.3
Wohnort: 8052 Zürich
Tel: 076`488`24`23
E –mail: [email protected]
Geburtsdatum: 8.7.1982
Nationalität: CH / EU
Zivilstand: Ledig
Schulische Laufbahn
Primarschule: 1-6 Klasse im Primarschulhaus Itschnach in Küsnacht bei Zürich
Sekundarschule: 1-3 Klasse an der Sekundarschule Küsnacht dann Wechsel ins
Gymnasium: 1998-2002 Kantonsschule in Küsnacht, neusprachliches Profil
Universität Zürich: Seit Sommersemester 2003 immatrikuliert
Studiengang
Hauptfach: Politikwissenschaften
1.Nebenfach: Volkskunde
2.Nebenfach: Europäische Volksliteratur
Aktuelle Beschäftigungen:
Chefredakteur VICE Media Schweiz (www.vice.com/alps)
Veranstalter Plaza Zürich