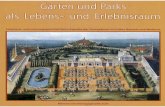072 305-332 418f Oevermann Hysterie sozialer sinn
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of 072 305-332 418f Oevermann Hysterie sozialer sinn
sozialersinn, Heft 2/2007, 8. Jg.: 305–332 – Lucius & Lucius (Stuttgart) – ISSN 1439-9326 – www.sozialer-sinn.de
Professionalisierung in der Wissenschaft (2)
Ulrich Oevermann
Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyseals Paradigma für Freuds Übergang von derNeurologie zur Psychoanalyse
Zugleich ein professionalisierungsgeschichtlicher Befund
I ProblemstellungFreuds Begründung der Psychoanalyse als theoretisch fundierter Erfahrungswissen-schaft und als professionalisierter therapeutischer Praxis stellt in mehrfacher Hinsichteinen wissenschaftsgeschichtlich bis heute revolutionierend wirkenden Vorgang derInstitutionalisierung eines eigenen wissenschaftlichen Paradigmas dar, die nach wievor die wissenschaftliche Forschung in höchst gegensätzliche Reaktionsmuster auf-spaltet von der idolatrischen Begeisterung mancher Anhänger für eine ghettohaft sicheinigelnde Geheimwissenschaft auf der einen Seite bis zur affektgeladenen Ablehnungund Ausgrenzung aus der wissenschaftlichen Normalität auf der anderen Seite. Einediese Ambivalenz der Reaktionen aufhebende, nüchterne und mit unvoreingenomme-nem Blick durchgeführte souveräne Einordnung und Integration in den Kanon derErfahrungswissenschaften und der interdisziplinären Forschung ist nach wie vor nurselten überzeugend anzutreffen. Es ist, als ob die vielen Tabus, die Freud inhaltlich,methodisch und theoriekonstruktiv durchbrochen hat, nach wie vor nach Wiederher-stellung drängen.
1. Nach der Einrichtung der Forschungsgegenstände- der epistemischen Ausstattung der Gattung Mensch qua Logik, Wahrnehmung, Spra-
che und Vernunft;- der natürlichen, d. h. physikalischen, chemischen, biologischen und geographisch-
kosmologischen Welt, in der der Mensch lebt;- der Sozialität, Gemeinschaftlich- und Gesellschaftlichkeit, in der dieses Leben sich
vollzieht;- der Kultur, die dieses Leben hervorbringt und in der es sich eigenlogisch in histori-
scher, ästhetischer und sprachlicher Hinsicht verkörpert,kristallisierte sich Freuds neue Wissenschaft um den eigentümlichen, auf die anderenGegenstandsbereiche nicht reduzierbaren Gegenstand, der sich aus dem Umstand er-gibt, dass der Leib als mein eigener Körper zugleich mein Außen und mein Innen ist
306 sozialersinn 8 (2007): 305–332
und damit ein eigenständiges Erfahrungsproblem konstituiert,1 dessen paradoxale Lo-gik darin besteht, dass es sich als dieses erst unter der Bedingung der sprachlich kon-stituierten Kulturhaftigkeit menschlicher Praxis stellt und zugleich die Anerkennungder animalischen, dieser Kultur wesenslogisch entgegengesetzten Basis abfordert.Kulturwesen kann der Mensch nur sein, wenn er diese animalische Basis als Grundlageseiner in Selbstreflexion kulturierten Praxis anerkennt und in sein Selbstbild integriert,dabei aber zugleich die dieser Selbsterkenntnis qua leiblicher Existenz gezogenen un-aufhebbaren Grenzen akzeptiert. In der Terminologie des berühmten Freudschen Sat-zes, dass Ich werden solle, wo Es war, ist diese Leiblichkeit zugleich Bedingung derBegrenzung von Selbsterkenntnis und Quelle der Dynamik des guten Lebens, vonUtopie im wahrsten Sinne dieses Wortes. Einer eigenen Triebtheorie bedarf die Erfah-rungswissenschaft vom Menschen im Freudschen Verständnis nicht deshalb, weil eineAntriebsbasis nur dem Menschen eigen wäre und nicht etwa Bestandteil eines mitallem animalischen Leben geteilten dynamischen Fundaments, sondern weil angesichtsdieser fraglosen Gemeinsamkeit mit allem organischen Leben dieses nur für den zurErkenntnis und zur Autonomie der Krisenbewältigung „verurteilten“ Menschen zueinem jenseits der biologischen Erkenntnis liegenden unhintergehbaren Erfahrungs-problem wird, das in der gegenwärtig in den Neurowissenschaften im Schwange be-findlichen Rede von der Erst-Person-Perspektive in einer Theorie des Geistes nur unzu-reichend aufgenommen ist.
2. Indem menschliche Praxis durch die sprachliche Konstitution von Geist undBedeutung zur rationalen Erkenntnis unmittelbar erfahrbarer Welt befähigt wird unddamit zur bewussten Repräsentation von Welt einschließlich der des eigenen Leibes,d. h. in dem Hiatus von unmittelbar erfahrenem Hier und Jetzt der ins Aufmerksam-keitsbewusstsein tretenden Wirklichkeit und der als Begriffsallgemeines konstituiertenRealität der eine mögliche Welt entwerfenden Prädikate operiert, durch die jene Wirk-lichkeit in Vermittlung allererst bestimmbar wird, bildet sich zwingend, gewisserma-ßen als von der Selbstreflexion uneinholbarer Rest, die zum Bewusstsein gegensätzli-che Sphäre des Unbewussten, die sich eben gerade nicht in der auch von den Neuro-wissenschaften heutzutage bereitwilligst anerkannten Sphäre der nicht zu Bewusstseingelangenden, gleichwohl höchst komplexen und eigengesetzlich prozedierenden neu-ronalen Steuerungsprozesse erschöpft, sondern weit über diese hinausgehend aus Le-bensgeschichte und Triebschicksale sinnlogisch chiffrierenden Erfahrungsgehaltensemantisiert sich zusammensetzt. Von daher ist schon die kategoriale Auftrennung indie Bezüge einer (1) epistemisch-explikativen, einer (2) objektiven, äußeren, physikali-schen, einer (3) sozialen, normativ regulierten, und einer (4) subjektiven Welt (Haber-mas 1981: 99, 114ff.) insofern irreführend, als darin das Subjekt als eine Einheit vonBewusstsein und Unbewusstem unterstellt wird, wo es sich doch gerade um einenunhintergehbaren, wenngleich dynamisch beständig antreibenden Konflikt und Hiatusvon einer dieser Rationalität verpflichteten Sphäre des erkennenden Bewusstseins ei-nerseits und einer diese Rationalität in ihrer Begrenztheit als Welt der Routine in Fragestellenden und nur scheinbar ausschließlich irrationalen Sphäre der letztlich vom Leib
1 Damit ist das Problem konstituiert, wie die beiden darauf bezogenen Beobachtungsreihen einander zuge-
ordnet werden. Ohne diese Zuordnung kann es ein integriertes Körperbild und -empfinden als Basis einesIdentitätsentwurfs nicht geben.
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 307
konstituierten Mittigkeit des Lebens als Ausgangspunkt für authentische Lebendigkeitandererseits handelt. Diese überschreitet als Instanz der Krisenbewältigung die Sphäreder Routine und fällt nicht nur abweichend oder im Scheitern hinter sie in die Irratio-nalität zurück, sondern bildet das positionale Zentrum der Lebendigkeit. Freuds Para-digma stellt aus der Perspektive des bewusstseinsfähigen erkennenden Subjekts das„innere Ding an sich“ der Welt des Unbewussten dem „äußeren Ding an sich“ der bisdahin einzig den Erfahrungswissenschaften methodisch zugänglichen erfahrbaren Weltder „äußeren“ Realität gegenüber. Er erschließt damit die konstitutionstheoretischeBestimmung eines ganz neuen Bereichs der erfahrbaren Welt für die erfahrungswissen-schaftliche Forschung, der zuvor allenfalls im Bereich von Literatur, Kunst und Musiksowie von religiöser Erfahrung thematisch war. Daraus erwächst dann systematischerst die Möglichkeit, über die Oberfläche des rational Intendierten bzw. des subjektivgemeinten Sinns in den Handlungstheorien hinauszugelangen und die wesentlichenStrukturierungsschichten menschlicher Lebenspraxis zu thematisieren. Erst auf derFolie einer solchen konstitutionstheoretischen Einrichtung des Gegenstandsbereichshumanwissenschaftlicher Forschung wird nämlich offenbar, wie dünn und wie oberflä-chenhaft die Strukturierungsschichten des rational intendierten und geplanten Handelnstatsächlich sind. Und erst dann wird der bis dahin faktisch nur residual bzw. als irratio-nal gekennzeichnete Bereich nicht-intendierter Folgen des Handelns bzw. latenterFunktionen sozialer Phänomene vom Rand der handlungstheoretischen Betrachtung indas Zentrum einer sozialwissenschaftlichen Strukturanalyse von Praxis gerückt.
3. In dieser Perspektivität kann Freud dann mit Recht für sein neues Paradigma inAnspruch nehmen, dass es nach den beiden paradigmatischen Revolutionen der Um-kehrung vom geozentrischen in das heliozentrische Weltbild durch die kopernikanischeWende und der Verdiesseitigung der Erklärung der Entstehung der Arten einschließlichder menschlichen Gattung durch die Darwinsche Evolutionstheorie eine dritte Umwäl-zung des Weltbildes erzeugt: nämlich die Fundierung der Erklärung der Konstitutionund Genese des Subjekts von Lebenspraxis in der leibhaften animalischen Antriebsba-sis und der in der Sexualität radizierten Sozialität. Freud bezeichnet diese Provokationfür die vorausgehenden Weltbilder, die im Wesentlichen in der Rückbindung der Sozi-alität und der innerartlichen Verständigung an die beiden auch in der Biologie derGattungen zentralen und basalen Funktionen der materiellen und sexuellen Reproduk-tion besteht, als die narzisstische Beleidigung der religiösen Überhöhung der Beson-derheit des Menschen in dessen Selbstbild.
4. Soziologisch-anthropologisch lässt sich daran die grundlegende These von derleibgebundenen Positionalität des Lebens anschließen, die für den Pragmatismus kon-stitutiv ist, und die unter der Bedingung von sprachlich erzeugter Kulturalität2 als der
2 In diesem Zusammenhang kann man im übrigen nicht oft genug betonen, dass nicht „Gesellschaft“ der
Gegenbegriff zu „Natur“ ist, sondern „Kultur“. Gesellschaftlich ist natürlich auch das Leben in der bloßenNatur, sofern es um die beiden Grundfunktionen der materiellen und sexuellen Reproduktion organisiertsein muss, die nur unter der Bedingung innerartlicher Kommunikation erfüllt werden können. Die Frage istalso nicht, ob und ab wann in der Gattungsgeschichte kommuniziert wird, sondern ab wann sprachlichkommuniziert wird, wodurch eine grundlegende kategoriale Trennung zwischen der Sphäre des unmittelbarin Relation zu einer leiblichen Positionalität oder der Mitte des je individuellen Lebens sich konstituieren-den Gegeben-Seins einer Wirklichkeit im Hier und Jetzt und der Sphäre der begriffsallgemeinen, durchsprachlich erzeugte Bedeutung ermöglichten hypothetisch konstruierten Realität von Möglichkeiten sich
308 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Anfangskeim von sich bildender Subjektivität zu gelten hat. Dieser Bildungsprozessvollzieht sich, wie im Meadschen Theorem von der „I-me relationship“ systematischexpliziert und an Freuds Entwicklungstheorien anschließbar, in der nachträglichenPrädikation der Emergenz der Unmittelbarkeit, die von der Spontaneitätsinstanz des dieleibliche Positionalität wesentlich einschließenden „I“ ausgeht. Diese Emergenzschlägt durch jene Prädizierung in der Vergegenwärtigung des inzwischen vergangenenUnmittelbaren dialektisch in die Determination eines prädizierten „me“ um.3
5. Methodisch wirft der Begriff des dynamisch Unbewussten im Sinne der Psy-choanalyse erhebliche Folgeprobleme auf. Denn definitionsgemäß lässt es sich durchdie in den Sozialwissenschaften und der Psychologie dominanten Datenerhebungsme-thoden der Befragung und in den Kategorien des subjektiv gemeinten, nachvollziehba-ren Sinns nicht erfassen. Was dynamisch unbewusst ist, lässt sich nicht abfragen, son-dern nur an der objektiven Bedeutungsstruktur oder latenten Sinnstruktur der Aus-drucksgestalten menschlicher Praxis rekonstruktiv ablesen, getreu dem Grundsatz dassman subjektiv nur meinen, aber objektiv nur sagen oder ausdrücken kann, aber nichtjeweils umgekehrt. Wie aber lassen sich dann diese der neurowissenschaftlichen Be-trachtung des Unbewussten begrifflich unzugänglichen Sinnstrukturen des dynamischUnbewussten sichtbar machen, wenn sie als solche verborgen und latent sind, ohnedass einer Immunisierung entsprechender Analysen nach Art verschwörungstheoreti-scher Verdächtigungen Tür und Tor geöffnet werden? Letztlich nur durch die strikteund sture Erfüllung des für die objektive Hermeneutik zentralen Prinzips, die Behaup-tungen über das Unbewusste aus der Objektivität der Details der empirisch fassbarenAusdrucksgestalten lückenlos zu erschließen. Freud ist angesichts dieser unabweisba-
einstellt, d. h. kulturell ein Hiatus aufgerissen wird, durch den die krisenhafte Unmittelbarkeit von Welt imHier und Jetzt von Praxis, die der Mensch in Begriffen physikalischer Temporalität und Räumlichkeitgrundsätzlich mit dem animalischen Leben teilt, überhaupt erst im dialektischen Bedingungsverhältnis zurkulturbedeutsamen Sphäre der Vermittlung zu jener ästhetisch bedeutsamen Unmittelbarkeit sinnlicherErfahrung (bei Adorno bekanntlich die Sphäre des Nicht-Identischen) wird, deren Nicht-Abspaltung vonmenschlicher Praxis dann die paradoxale Form authentischen und wahren Lebens zum Grundproblem vonpersonaler Autonomie werden lässt, das auch bei Freud das zentrale Movens theoretischen Denkens wird,indem eben die die Utopie der Versöhnung erzwingende Entzweiung des Menschen nicht eine beklagens-werte Entgleisung der Ontogenese bildet, der man durch eine magische Hintertür ins heile Leben à la Wil-helm Reich entgehen könnte, sondern – wie bei Hegel – zur Konstitutionsbedingung der Kulturierungmenschlicher Praxis wird. Entsprechend ist bei Freud, was von Soziologen leicht übersehen wird, Verdrän-gung nicht nur pathogener Abwehrmechanismus, sondern auch, bezogen auf den Ödipuskomplex, notwen-dige Konstitution von normaler handlungsfähiger Praxis.
3 In der deutschen sozialwissenschaftlichen Theorietradition ist philosophisch-anthropologisch Plessnerdiesem Theorem in der Figur der exzentrischen Positionalität des Ich am nächsten gekommen. Unglückli-cherweise aber trägt diese Figur die tatsächliche pragmatistische Dialektik des Meadschen Grundgedan-kens insofern nicht ganz, als in jenen Vergegenwärtigungsvorgang immer zwei Positionalitäten einge-schlossen sind, zum einen die nachträglich prädizierte der ursprünglichen Emergenz durch ein „I“ und zumanderen die in der unmittelbaren Aktualität des Vergegenwärtigungsvorganges präsente Positionalität einesdas erste „I“ als „me“ bestimmenden „I“, das als Instanz der Unmittelbarkeit und Spontaneität immer prä-sent ist, solange der Leib lebt, und somit die eigentümliche Paradoxie dieser Spontaneitätsinstanz als äu-ßerst flüchtiger, diskontinuierlicher und krisenhafter Unmittelbarkeit und zugleich äußerster Kontinuitätvon Lebendigkeit von der Einnistung bis zum Tod repräsentiert. Bei Plessner ist analytisch unentschieden,welchem dieser beiden Positionalitäten die Eigenschaft der Exzentrizität zukommen soll, ja, die Notwen-digkeit ihrer Unterscheidung wird nicht deutlich.
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 309
ren Anforderung faktisch und zwingend zum Vorläufer einer Methodologie der objek-tiven Hermeneutik geworden, wie noch zu zeigen sein wird.
6. Als dieses Paradigma ist die Psychoanalyse sowohl als Theorie wie als Be-handlungspraxis vor allem hinsichtlich dieses Begriffs vom Unbewussten umkämpft.Akademische Psychologie, analytische Philosophie, methodologisch individualistischeSozialwissenschaften, handlungstheoretischer Idealismus, verhaltenswissenschaftlicherObjektivismus und historischer Positivismus verdächtigen gleichermaßen bis heute diePsychoanalyse des Obskurantismus und der methodologischen Unwissenschaftlichkeit.Freud steht im Mittelpunkt dieser Verdächtigungen. Immer wieder von Neuem wird erin die Nähe von Scharlatanerie und Dogmatismus gerückt. Diesen Verdächtigungengibt eine innerpsychoanalytische Tendenz zur geistigen Ghettoisierung, zur geheim-wissenschaftlichen Abgrenzung und zur übergriffigen Allzuständigkeit und Nicht-Anschlussfähigkeit leider allzu oft Nahrung.
So erscheint die Freudsche Wissenschaft sowohl in der Perspektive ihrer Gegnerund Feinde wie ihrer Anhänger und Gefolgschaft immer wieder als eine kapriziöse,singuläre, arbiträre, schwer verdauliche und verstiegene Konstruktion, als etwas, an dasman entweder bedingungslos glaubt oder das man aus vorgegebenen Gründen man-gelnder empirischer Fundierung fast ebenso religiös ablehnt. Beiden Perspektiven fehltaber vor allem gleichermaßen, wenn auch unter je gegenteiligen Bewertungsvorzei-chen, die hinreichende Würdigung der methodischen, begrifflichen und habituellenKontinuität von Freud als strengem Naturwissenschaftler und -forscher einerseits undFreud als methodisch strengem, mit den Mitteln der präzisen hermeneutischen Sinnre-konstruktion arbeitendem Psychoanalytiker und Geisteswissenschaftler andererseits.Vielmehr wird in beiden Perspektiven diese Kontinuität verdeckt durch das Bild ent-weder eines Bruches zwischen diesen beiden wissenschaftlichen ExistenzweisenFreuds oder der schlichten Tilgung je einer Hälfte davon. Vor allem aber verdeckenbeide Perspektiven gleichermaßen die herausragenden Leistungen Freuds als ebensopräzise wie einfallsreich arbeitenden Naturforschers, dessen wissenschaftliches Arbei-ten durch einen Forschungshabitus geprägt ist, der jene leichtfertigen Verdächtigungenseiner wissenschaftlichen Dignität als vollständig haltlos, wenn nicht gar bösartig er-scheinen lässt. Ich möchte dieses Bild hier zurechtzurücken und zu ersetzen versuchendurch ein gegenteiliges, das zum einen die wissenschaftlich-methodologische Präzisionund Schärfe von Freuds Forschungspraxis und zum anderen die Kontinuität und Kohä-renz zwischen den beiden nur scheinbar unvereinbaren Wissenschaftsparadigmen undErkenntnisweisen in Freuds Biographie und Professionalisierung aufweist, und dieinnere Konsequenz in einem nur vordergründigen Bruch in der wissenschaftlichenBiographie Freuds nachzeichnen. Dabei wird sich dann zeigen, dass diese innere Kon-tinuität und Kohärenz ganz wesentlich dem extrem professionalisierten Habitus Freudssowohl als Wissenschaftler wie als Arzt zu verdanken ist und die daraus hervorgehen-den Leistungen mit der Begründung der Psychoanalyse eine neue Dimension der Pro-fessionalisierungsgeschichte eröffnet haben. Die Rekonstruktion des in Freuds wissen-schaftlicher Biographie verkörperten Übergangs von der physiologischen Forschung indie die Sinnstrukturiertheit des Unbewussten erschließende Psychoanalyse vermöchte,würde man ihn in allen seinen Facetten detailliert darstellen können, einen Beitrag zurErforschung sowohl eines entscheidenden Schritts in der Amplifikation des Zugriffsvon Erfahrungswissenschaften auf die erfahrbare Welt, die seit der zweiten Hälfte des
310 sozialersinn 8 (2007): 305–332
17. Jahrhunderts sich stürmisch vollzog, als auch einer Dimension des vor allem imletzten Drittel des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluss der Erfahrungswissenschaftensich vollziehenden Prozesses der Professionalisierung als einer widersprüchlichenEinheit von ingenieurialer Anwendung standardisierten Wissens und in seinem Namenverantworteter fallbezogener Intervention in der Praxis stellvertretender Krisenbewälti-gung zu leisten. Hier kann auf dem beschränkten Raum davon nur ein exemplarischerAusschnitt beleuchtet werden.
II Der Übergang von der naturwissenschaftlichen Forschung überdie ärztliche Professionalisierung zur psychoanalytischen Praxis
Betrachten wir zunächst die überlieferten Daten zum Übergang von der naturwissen-schaftlichen Forschung nach Beginn des Medizin-Studiums bis hin zur Stufe der erstengroßen metapsychologischen Befestigung der neuen psychoanalytischen ärztlichenPraxis in der Traumtheorie von 1900 (1899), zusammengefasst im folgenden Schema:
Biographische Daten zu Freuds Übergang von der naturwissenschaftlichen Forschung in diepsychoanalytische Praxis und Theoriebildung
1856 – geboren
1873–1881 – Studium der Medizin in Wien, mit allen medizinischen Abschlussexamen und demDoktorat beendet
1876 – Untersuchungen zum männlichen Geschlechtsorgan von Aalen im meeresbiologischenLabor von Prof. Carl Claus in Triest
1876–1882 – Als Famulus und dann als Assistent im physiologischen Labor von Ernst Brückemit neuroanatomischen und –physiologischen Untersuchungen zur Nervenzelle und -faser be-schäftigt.
1880 – Einjähriger Militärdienst als Arzt
1881 – Beginn der langjährigen Freundschaft mit dem ärztlichen Kollegen und finanziellenFörderer Josef Breuer
1882 – Auf Anraten Brückes und veranlasst durch die Bekanntschaft mit seiner späteren FrauMartha Bernays (April, im Juni heimliche Verlobung) verlässt Freud um der Sicherung seinesfinanziellen Lebensunterhaltes willen die Forschungstätigkeit bei Brücke und entscheidet sichdafür, als Arzt zu praktizieren. – Erfährt zum ersten Mal von Breuers hypnotischer Behandlungder Hysterie-Patientin „Anna O.“
1882–1885 – Eintritt ins Wiener Allgemeine Krankenhaus und ärztliche Tätigkeit in verschiede-nen Abteilungen bei verschiedenen medizinischen Koryphäen der damaligen Zeit: Chirurgie beiTheodor Billroth; Innere Medizin bei Hermann Nothnagel; als Sekundararzt in der Psychiatriebei Theodor Meynert; dann in der Dermatologie, der Abteilung für Nervenleiden und derOphthalmologischen Abteilung. Forschungsarbeiten (insbesondere an der medulla oblongata)vor allem im gehirnanatomischen Labor von Theodor Meynert, der ihn gerne gehalten hätte. –In dieser Zeit weitere wichtige Arbeiten zum Zentralnervensystem und zur Nervenzelle und -fasersowie zur Wirkung des Kokain u. a. als Anästhetikum.
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 311
1885 – Privatdozent für Neuropathologie; Erhalt eines Stipendiums für eine Studienreise zuCharcot nach Paris.
1885 (Herbst)–1886 (Frühjahr) – Aufenthalt in Paris, Forschungsarbeiten bei Charcot an derSalpétrière. Lernt die Hysterie kennen und die Anwendung der Hypnose, übersetzt CharcotsVorlesungen über Hysterie.
1886, April – Eröffnung einer nervenärztlichen Praxis in Wien, Behandlung von vornehmlichneurasthenischen und hysterischen Patienten, mehrheitlich Frauen aus der begüterten Wienerbürgerlichen und osteuropäischen Adels- Gesellschaft, Therapien mit Hilfe der Erbschen Elekt-risiermethode und zunehmend der Hypnose, kombiniert mit der von Breuer übernommenenkathartischen Methode. Die Hypnose wird zunehmend durch das „Drücken“ und die Auswer-tung freier Assoziationen ersetzt. Zusätzlich Übernahme einer mehrjährigen Leitung der neueingerichteten Nervenabteilung am öffentlichen Kinderkrankeninstitut von Max Kassowitz.
1886, September – Hochzeit mit Martha Bernays.
1886, 15. Oktober – Vortrag vor der Wiener Ärztlichen Gesellschaft über einen „Fall vonmännlicher Hysterie“, in dem Freud zugleich die wesentlichen Gedankengänge Charcots zurHysterie vorstellt.
1887 – Geburt des ersten Kindes Mathilde (der Vorname nach Breuers Ehefrau); Beginn desBriefwechsels mit Wilhelm Fließ (bis 1902)
1888 – Erscheinen von Freuds Übersetzung des Buchs von Hippolyte Bernheim über die Hypno-se
1889 – Reise nach Nancy, um sich dort bei Bernheim und Liébault in der hypnotischen Methodeweiterzubilden, erstmalige Anwendung der kathartischen Methode von Breuer im Falle von„Emmy von N.“ – Geburt des Sohns Jean-Martin (die Vornamen nach Charcot).
1890 – Veröffentlichung der wohl wichtigsten neurologischen Schrift: „Zur Auffassung derAphasien“, als Plädoyer für eine funktionelle Theorie an Stelle einer Lokalisationstheorie. –Umzug in die Bergasse 19. – Geburt des Sohnes Oliver.
1892 – Publikation von „Ein Fall hypnotischer Heilung“, allmähliche Aufgabe der Hypnoseanlässlich des Falles „Elisabeth von R.“ – Geburt des Sohnes Ernst (nach Ernst Brücke)
1893 – Nekrolog auf Charcot; Formulierung der Hypothese von der „traumatischen Verfüh-rung“ in der Ätiologie der Hysterie; gemeinsam mit Breuer „Vorläufige Mitteilung“ über ihreBetrachtung der Hysterie. – Geburt der Tochter Sophie.
1894 – Offener Bruch mit Breuer anlässlich der Publikation über die „Abwehr-Neuropsychosen“ wegen der darin enthaltenen Hypothese über die Verursachung der Hysteriedurch Traumen in der psycho-sexuellen Entwicklung.
1895 – Erscheinen der „Studien über Hysterie“ (mit einer Fallanalyse von Breuer); Übersen-dung des „Entwurfs einer Psychologie“ auf streng naturwissenschaftlicher Basis an Fließ.Erstmalige Verwendung des Begriffs der „Übertragung“. Im Aufsatz „Zur Psychotherapie derHysterie“ wird die freie Assoziation als die wichtigste Technik der Psychotherapie gewürdigt. –Geburt der Tochter Anna, des sechsten und letzten Kindes.
1896 – Erstmalige Verwendung des Terminus „Psychoanalyse“. Freuds Vorlesung über diesexuellen Ursachen der Hysterie erregt großes Aufsehen in der Wiener ärztlichen Kollegenschaftund führt zu zunehmender Isolation Freuds. – Tod des Vaters Jakob.
312 sozialersinn 8 (2007): 305–332
1897 – Beginn der Selbstanalyse Freuds. Entdeckung des Ödipus-Komplexes
1898 – Erste Analysen von Fehlleistungen und des Witzes.
1899 – Fertigstellung der „Traumdeutung“
Die Zeit der wissenschaftlichen Tätigkeit als Naturwissenschaftler und Mediziner mit Beginn desStudiums bis zur Begründung der psychoanalytischen Praxis lässt sich in fünf großen Periodenzusammenfassen:
1873–1882 Medizinstudium sowie experimentelle Forschung bei Claus und Brücke
1882–1885 allgemeine praktische medizinische Ausbildung am Wiener Allgemeinen Kranken-haus sowie neuroanatomische Forschungen bei Meynert
1885–86 Privatdozent für Neuropathologie, das „Konversionserlebnis“ in Paris bei Charcot undsystematische Beschäftigung mit der Hysterie und der hypnotischen Technik
1886–1895 Eröffnung einer nervenärztlichen Praxis in Wien, Behandlung von Hysterien, Lei-tung der Nervenabteilung im Kinderkrankeninstitut Kassowitz, Familiengründung (6 Kinder)
1894–1899 Theoretische Fundierung der psychoanalytischen Praxis in der Neurosenlehre undder Metapsychologie der Traumdeutung.
Freud, 1856 geboren, eröffnet seine nervenärztliche Praxis für die damalige Zeit ver-gleichsweise spät, mit 30 Jahren. Er verbringt zuvor viel Zeit mit der physiologischenund neurobiologischen Forschung in führenden Laboratorien der damaligen Zeit. Dabeientwickelt er sich zu einem führenden neurowissenschaftlichen Forscher in der Welt.Wir müssen uns vor Augen halten, dass Freud schon in Brückes Institut seit etwa 1878auf dem Sprung zu den entscheidenden neuronentheoretischen Entdeckungen war, diespäter von Waldeyer-Hartz (1836-1921) (1891) und Raymond y Cajal (1852-1934)(1936; 1990) zugeschrieben wurden, und dass er auf der Grundlage von Golgis Silbe-rimprägnationsmethode (1878) die von Golgi (1843-1926) selbst zwei Jahre später(1883/84) ebenfalls entdeckte und seitdem mit diesem Namen verbundene Goldchlo-rid-Färbemethode als entscheidendes Laborverfahren zur Präparation von Nervenzellenfür die Untersuchung unter dem Mikroskop als erster entwickelt hatte. Die heutigen imstürmischen Aufwind befindlichen Neurowissenschaften scheinen vergessen zu haben,dass Freud aufgrund dieser großen Leistungen vor seiner Begründung der Psychoana-lyse zu den weltweit führenden Neurologen gehörte.4 Er war ein begeisterter, leiden-schaftlicher Naturforscher, dessen Leistungen aus der Kombination genauen, geduldi-gen Beobachtens am Mikroskop und kühner, analytisch scharfsinniger, gestalterschlie-ßender Spekulation erwuchsen. Seine Schrift über die Aphasien war auf diese Weisedas Ergebnis einer spekulativen, durch präzise Diagnosen angeregten funktionstheore-tischen, lokalisationstheoretische Ansätze überwindenden Modellierung, die neue undweite Perspektiven in die Zukunft der Neurowissenschaften eröffnete. Auch in der Zeitals Krankenhausarzt forschte Freud neurowissenschaftlich weiter, jetzt neuroanato-misch an aus Obduktionen stammenden Gehirnen von Föten, an denen er wichtigeEntdeckungen machte. Dass er noch 1897, also 13 Jahre nach Gründung seiner psy-chotherapeutischen Praxis, „Die infantile Cerebrallähmung“ als Teil II, Abt. II des 9.
4 Vgl. auch die von Ingrid Kästner und Christina Schröder vorzüglich eingeleitete Sammlung der entspre-
chenden Schriften (Freud 1990).
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 313
Bandes des von Hermann Nothnagel herausgegebenen Handbuches „Spezielle Patho-logie und Therapie“ als überall gepriesene grundlegende Schrift verfassen konnte, diebis in die 40er Jahre des 20. Jahrhunderts als Standardwerk galt, mag als eindrucks-voller Beleg für die lang andauernde Intensität des naturwissenschaftlichen Forschensbei Freud gelten. Dazu sind des weiteren die bedeutende Entdeckung der anästheti-schen Funktion des Kokains besonders für die augenärztliche Praxis, womit Freudeinen Reichtum hätte erwerben können, sowie die verschiedenen klinischen und theo-retischen Schriften über die zerebralen Lähmungen im Kindes- und Jugendalter zuzählen. Zusammengenommen alles wissenschaftliche Hochleistungen, die allein ausge-reicht hätten, Freud eine bleibende Stelle in der Geschichte der Wissenschaften zusichern. Während die Naturwissenschaftler und erst recht die akademischen Psycholo-gen, die es so gerne sein möchten, den präzisen und einfallsreichen naturwissenschaft-lichen Forscher hinter der vermeintlich unseriösen Psychoanalyse verschwinden lassen,tun es – unter umgekehrten Vorzeichen – die der Psychoanalyse idolatrisch wohlge-sonnenen Kulturwissenschaftler ebenso hinter der letztlich auf den Neukantianismuszurückgehenden Überbetonung des Gegensatzes von Natur- und Geisteswissenschaf-ten.
Das Ausmaß der naturwissenschaftlichen Forschungsleistungen sowie zugleichdie enorme Geschwindigkeit der Schritte zur Gründung der Psychoanalyse vergegen-wärtigt aber erst das Schriftenverzeichnis derselben Jahre (Freud 1999: 799-804; Mey-er-Palmedo/Fichtner 1999), wenn man darin die aus der naturwissenschaftlichen For-schungspraxis hervorgegangenen Veröffentlichungen den Darstellungen der psycho-analytischen Forschung gegenüberstellt und sich dabei vor Augen führt, wie lange diebeiden Bereiche sich überlappen. Bis 1892 veröffentlicht Freud neben zahlreichenRezensionen und Übersetzungen 45 neurowissenschaftlich und medizinisch wichtigeForschungsbeiträge, drei weitere Bücher auf diesem Gebiet bis 1897. Und ab 1886beginnt er mit den Publikationen zur Psychoanalyse und psychoanalytischen Praxis: 37Publikationen bis zur Traumdeutung von 1900. 1886 bis 1897 ist die lange Zeit dersich aus beiden Forschungssträngen überlappenden Publikationen.
Dass Freud diese außerordentlich erfolgreiche neurobiologische und neuromedizi-nische Forscherkarriere nicht fortsetzt, muss Gründe haben, die außerhalb des Bereichsder wissenschaftlichen Motivierung liegen. Freud hatte als Jude nur geringe Aussichtenauf ein einkömmliches Universitäts-Ordinariat, und sein ihm wichtiger Lehrer ErnstBrücke hat ihn rechtzeitig und nachhaltig vor dieser Hoffnungslosigkeit gewarnt.Nachdem er sich heftig in Martha Bernays verliebt hat und eine Familie gründen undernähren können will, wird der in die naturwissenschaftliche Forschung vertiefte Freudum 1882 für diese Argumente empfänglich. Nolens volens muss er sich aus der ge-liebten naturwissenschaftlichen Forschung in eine ärztliche Praxis verabschieden.Während er im Wiener Allgemeinen Krankenhaus nun alle medizinischen Abteilungendurchläuft, um sich die dafür notwendigen praktischen Kenntnisse anzueignen, bleibtsein Interesse für die neurowissenschaftlichen aufregenden Erkenntnisse erhalten
In dieser Konstellation lag es natürlich nahe, dass Freud auch als praktizierenderArzt möglichst nahe an seinem Spezialgebiet tätig sein wollte. Das war umstandslosmöglich in seiner Funktion als Leiter der Nervenabteilung im Kassowitz’schen Institutfür Kinderkrankheiten. Jedoch in seiner eigenen nervenärztlichen Praxis war bei demdamaligen Wissensstand letztlich nicht viel auszurichten. Freud musste im Vergleich
314 sozialersinn 8 (2007): 305–332
zu seinem Forschungsstandard mit den Behandlungspraktiken höchst unzufrieden sein,die ihm zur Verfügung standen: die diffuse, unspezifische Elektrisiermethode, die mehrdazu angetan war, bei Laien einen gewissen Eindruck von Wissenschaftlichkeit zuerwecken als kausal wirklich etwas zu bewirken. Die verschriebenen Kuren verschie-dener Art, die damals im Schwange waren, waren funktionell und kausal ebenso un-spezifisch, enthielten aber zumindest doch intuitiv einen sozial stützenden verborgenenSinn, der in der ärztlichen Zuwendung zum Patienten im allgemeinen – vorausgesetztein intuitives Verständnis des Arztes für die konkrete soziale und psychische Situationdes Patienten – wirksam wurde und in dem wahrscheinlich die von Ärzten erzieltepraktisch-therapeutische Wirkung viel mehr begründet war als in dem bis zu Beginndes letzten Drittels des 19. Jahrhunderts noch äußerst dürftigen medizinisch-naturwissenschaftlichen Wissensstand.
Freud bildete sich zum Mediziner in einer Zeit enormer, auf strenger, sowohl kli-nischer als auch experimenteller Forschung beruhender Wissensentwicklung. Habituellgehörte die Zukunft demjenigen, der streng empirisch neugierig die tatsächlichen Be-funde auf ihre Bedingungsverhältnisse hin nach allen Seiten erkundete und Schritt fürSchritt erschloss, dabei eine einmal ins Auge gefasste Hypothese bzw. Modellvorstel-lung so lange stur festhielt, bis sie zwingend widerlegt war oder so vielen strengenFalsifikationsversuchen standgehalten hatte, dass es sich lohnte, sie in einen großenspekulativen Entwurf einer Theoriearchitektonik einzuordnen. Für Freud war Darwindarin das große Vorbild. Es zeigte ihm aber auch, wie wichtig es war, scheinbar un-wichtigen kleinen Andeutungen über unerwartete Zusammenhänge zuzuhören und zufolgen bzw. sie im Gedächtnis zu behalten.
Breuer, der väterliche Freund, selbst ein einfallsreicher und außerordentlich gebil-deter Arzt aus Leidenschaft, hatte ihn mit der Erzählung über die aufregende Behand-lung der „Anna O.“, einer Freundin von Freuds Frau Martha Bernays, auf die entschei-dende Spur der Hysterie-Erkrankung, einer scheinbaren Modeerscheinung in der höhe-ren Wiener Gesellschaft, und auf die Hypnose als einer Möglichkeit ihrer Behandlunggebracht. In dieser Behandlung hatte sich Breuer von der Patientin selbst zur katharti-schen Methode führen lassen müssen. Die Hypnose wurde darin nicht mehr nur zurSetzung einer das Symptom negierenden Gegensuggestion benutzt, sondern vor allemdazu, die im Gedächtnis gespeicherten Situationen und Anlässe der Entstehung derSymptome der Hysterie (Lähmungen und Anästhesien bzw. Überempfindlichkeiten) zuerinnern und zur Sprache zu bringen. Breuer machte die Erfahrung, dass sich dabei dieSymptome steigerten, um dann deutlich in den Hintergrund zu treten, als ob sie durchAbreaktion aufgegeben worden wären. Es muss diese Spur gewesen sein, die Freud,nachdem er die Privatdozentur 1885 erworben hatte, mit dazu veranlasst hatte, einReisestipendium für einen Aufenthalt bei Charcot in Paris mit Erfolg zu beantragen.Charcot war damals der bekannteste unter den wenigen Vertretern einer wissenschaft-lichen Theorie der Hysterie, die bis dahin ärztlich nicht wirklich ernst genommen undals Weiberkram abgetan worden war. Aber zunächst, bis zum Dezember 1885, hatteFreud gar nicht vor, sich allein auf die Thematik der Hysterie zu werfen. Viel mehrwollte er ursprünglich die neuroanatomischen Forschungen am infantilen Gehirn fort-setzen, für die er sich am Institut von Charcot mit Recht reichhaltiges Datenmaterialversprach. Jedoch müssen ihn dann sehr bald die von ihm als äußerst aufregend erfah-renen Vorstellungen hysterischer Patienten in den Vorlesungen von Charcot, der
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 315
zugleich ein sehr effektvoller Hypnotiseur war und nach Belieben, so schien es, hyste-rische Patienten in hysterische Zustände versetzen konnte, von seinem ursprünglichenVorhaben abgebracht haben.
Die außerordentliche Wirkung, die Charcot in dieser Phase, also unmittelbar vorder Begründung einer eigenen nervenärztlichen Praxis auf Freud entfaltete, kommt inden zahlreichen Briefen an Martha Bernays am plastischsten zur Geltung.„Ich bin wirklich jetzt sehr behaglich, und ich glaube, ich verwandle mich sehr. Ich will Dir daseinzeln aufzählen, was auf mich einwirkt. Charcot, der einer der größten Ärzte, ein genial nüch-terner Mensch ist, reißt meine Ansichten und Absichten einfach um. Nach manchen Vorlesungengehe ich fort wie aus Notre-Dame, mit neuen Empfindungen vom Vollkommenen. Aber er greiftmich an; wenn ich von ihm weggehe, habe ich gar keine Lust mehr, meine eigenen dummenSachen zu machen; ich bin jetzt drei Tage faul gewesen, ohne mir darum Vorwürfe zu machen.Mein Gehirn ist gesättigt wie nach einem Theaterabend. Ob die Saat einmal Früchte bringenwird, weiß ich nicht; aber daß kein anderer Mensch je ähnlich auf mich gewirkt hat, weiß ichgewiß.“ (Freud 1988: 122)
Diese Begeisterung erwächst auf dem Boden eines tief verankerten Forschungshabitus:„Aber das Versuchen will ich nicht unterlassen und Du weißt, was man oft versucht und immerwill, das gelingt dann einmal. Mehr als einen solchen glücklichen Wurf brauchen wir nicht, uman unsere Hauseinrichtung denken zu dürfen. Setz Dir, Weibchen, aber nicht zu fest in den Kopf,daß es diesmal gelingen muß. Du weißt, das Temperament des Forschers braucht zwei Grundei-genschaften: Sanguinisch beim Versuch, kritisch bei der Arbeit.“ (a. a. O.: 82, anlässlich seinerExperimente mit Kokain)
Außer der persönlich-charismatischen Ausstrahlung Charcots als neugierig forschen-den Arztes waren vor allem die folgenden Leistungen dieses Gelehrten für Freudhöchst bedeutsam. Er hatte die bis dahin medizinisch nicht ernst genommene, aberzugleich im Bereich von Aberglauben und Magie vorurteilsvoll belassene, ausschließ-lich den Frauen zugeschriebene Hysterie nosologisch und symptomatologisch geordnetund als eine systematisch diagnostizierbare, typologisch abgrenzbare Krankheit mitidealtypischen und abweichenden Erscheinungsformen beschrieben, als solche beiMännern ebenso nachgewiesen wie bei Frauen, als funktionelle neurotische Störungohne neuroanatomischen Befund bestimmt und sie in einen systematischen Zusam-menhang mit der Hypnose gebracht. Er konnte die hysterischen Symptome in seinenVorlesungen bei hysterischen Patienten durch Hypnose, die ihm leicht gelang, fastnach Belieben reproduzieren, so dass er die These vertrat, die Hypnose gelänge bei derHysterie deshalb so problemlos, weil sie durch hypnoide Zustände gekennzeichnet sei.Durch Charcot geriet die Hypnose in eine eigentümliche Doppelstellung zur Hysterie.Sie stellte sowohl gleichsam eine Analogie zu dieser Krankheit dar als dass sie auchsich, aus diesem Grunde, als Behandlungstechnik zumindest dadurch eignete, dass mandort, wo man die hysterischen Zustände bei hysterischen Patienten durch Hypnoseherstellen konnte, sie auch durch Gegen-Suggestion wieder beseitigen können musste.Es war zunächst vor allem diese Überlegung, die sich Freud zu eigen machte. Gleich-wohl hielt Charcot an der These der hereditären Konstitution dieser Krankheit fest.
Bei Freud mussten diese Überlegungen, abgesehen von seiner durchgehendenNeugierde und Faszination auf und durch alles Neue auf dem Gebiet der neuropatholo-gischen Erscheinungen aus den folgenden Gründen auf fruchtbaren Boden fallen:
316 sozialersinn 8 (2007): 305–332
1. Er war durch seine Freundschaft mit Breuer, der die Hypnose als Arzt schonsystematisch in seiner Praxis verwendet hatte, auf diese Behandlungsmethode vorbe-reitet. Auch auf den inneren Zusammenhang dieser Praktik mit der Hysterie. Seit 1882beschäftigten ihn die Geschichte der Behandlung der „Anna O.“ und die dabei vonBreuer gefundene kathartische Methode in der Hypnose.
2. Freud war ein ausgesprochen befähigter, erfahrener und geübter neuropatholo-gischer Diagnostiker. Er brachte also alle Voraussetzungen dafür mit, das Charcot’sche Vorgehen, bei dem es ja vor allem darauf ankam, differentialdiagnostisch genaudie Symptome der Hysterie auf die neuroanatomischen Ausgangsbedingungen zu be-ziehen, die hier gewissermaßen vorgetäuscht wurden, sofort zu verstehen und zudurchschauen. Von Freud wird berichtet, dass er in seiner Zeit der neurologischenTätigkeit in der Lage war, bei bestimmten Lähmungserscheinungen, die von Läsionender medulla oblongata (hinterster, zum Hirnstamm gehörender Teil des Gehirns) ab-hingen, die affizierte Stelle auf diesem Organ außerordentlich genau zu lokalisieren.Wir müssen uns ja vorstellen, dass damals nichts von den wunderbaren Bild gebendenVerfahren, die seit einiger Zeit den enormen Aufschwung der neurowissenschaftlichenForschung ermöglichen, zur Verfügung stand, und dass der Neurologe stattdessen amlebenden Organismus alles aus den Erscheinungen der Körperoberfläche erschließenmusste und allenfalls dieses Erschlossene am späteren Obduktionsbefund noch einmalüberprüfen konnte. Der neurologische Forscher der damaligen Zeit musste also miteiner methodologisch schwierigen Zirkularität fertig werden: Er musste einerseits einneuroanatomisches und neurophysiologisches Modell voraussetzen, um die Symptomean der Leiboberfläche interpretieren zu können, er musste aber gleichzeitig diese Mo-delle aus diesen Oberflächenphänomenen erschließen.
Dieses Problem ließ sich nur bewältigen, wenn man zugleich die Oberflächen-Symptome im Detail sehr genau beobachtete und fähig war, ihren inneren Zusammen-hang mit dem Gesamteindruck vom Patienten als prägnante Gestalt vorab zu erkennen.Genau darin bestand das Genie von Freud. Er war nicht der Forschertyp, der im Zwei-felsfalle am Gegenstand experimentell manipulierte, um auf irgendetwas zu kommen,sondern er gehörte zum Typ des Forschers, der geduldig und genau hinschaute und dasSichtbare auf Gestalten und tieferliegende Zusammenhänge treffsicher erschließenkonnte. Er lebte also im Forschungsprozess wie im ärztlichen Diagnostizieren vonetwas, was man mit Adorno als den „physiognomischen Blick“ bezeichnen könnte, undwas ihn wie selbstverständlich auch beim ästhetischen Genuss von Bildwerken führte.Dieses sehende Dechiffrieren und Erschließen von tiefenstrukturellen Konfigurationen,das man dem abduktiven Schließen in der Erkenntnistheorie von Charles Sanders Peir-ce zuordnen darf und das wir in der objektiven Hermeneutik, bezogen auf sinnstruktu-relle Zusammenhänge mit dem Begriff der Strukturgeneralisierung zu treffen versu-chen, hat Freud dann aber, wie wir sehen werden, nicht nur bezüglich der körperlichenErscheinungen geübt, sondern auch – wie selbstverständlich – auf die sinntragendenErscheinungen des Sprechhandelns und auf die kulturellen Objektivationen, also aufAusdrucksgestalten übertragen, wie von der Position des Arztes im Arbeitsbündnis mitdem Patienten fallverstehend gefordert. Ja, man kann sagen, dass Freud wie selbstver-ständlich unter dem Gesichtspunkt der Erscheinungen als Ausdrucksgestalten die so-matischen, psychischen und sozio-kulturellen Aspekte der Psychopathologien zusam-mengezogen hat. Wie sehr er für diese letztlich im Modus der ästhetischen Erfahrung
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 317
prozedierende Erkenntnis empfänglich war, zeigt die folgende Passage aus dem Nach-ruf auf Charcot von 1893 sehr schön:„Er war kein Grübler, kein Denker, sondern eine künstlerisch begabte Natur, wie er es selbstnannte, ein visuel, ein Seher. Von seiner Arbeitsweise erzählte er uns selbst folgendes: Er pflegtesich die Dinge, die er nicht kannte, immer von neuem anzusehen, Tag für Tag den Eindruck zuverstärken, bis ihm dann plötzlich das Verständnis derselben aufging. Vor seinem geistigen Augeordnete sich dann das Chaos, welches durch die Wiederkehr immer derselben Symptome vorge-täuscht wurde; es ergaben sich die neuen Krankheitsbilder, gekennzeichnet durch die konstanteVerknüpfung gewisser Symptomgruppen; die vollständigen und extremen Fälle, die ‚Typen‘,ließen sich mit Hilfe einer gewissen Art von Schematisierung hervorheben, und von den Typenaus blickte das Auge auf die lange Reihe der abgeschwächten Fälle, der formes frustes, die vondem oder jenem charakteristischen Merkmal des Typus her ins Unbestimmte ausliefen. Er nanntediese Art der Geistesarbeit, in der er keinen Gleichen hatte, ‚Nosographie treiben‘ und war stolzauf sie. Man konnte ihn sagen hören, die größte Befriedigung, die ein Mensch erleben könne, sei,etwas Neues zu sehen, d. h. es als neu zu erkennen, und in immer wiederholten Bemerkungenkam er auf die Schwierigkeit und Verdienstlichkeit dieses ‚Sehens‘ zurück. Woher es denn kom-me, daß die Menschen in der Medizin immer nur sehen, was sie zu sehen bereits gelernt haben,wie wunderbar es sei, daß man plötzlich neue Dinge – neue Krankheitszustände – sehen könne,die doch wahrscheinlich so alt seien wie das Menschengeschlecht, und wie er sich selbst sagenmüsse, er sehe jetzt manches, was er durch 30 Jahre auf seinen Krankenzimmern übersehenhabe. Welchen Reichtum an Formen die Neuropathologie durch ihn gewann, welche Verschär-fung und Sicherheit der Diagnose durch seine Beobachtungen ermöglicht wurde, braucht mandem Arzte nur anzudeuten. Der Schüler aber, der mit ihm einen stundenlangen Gang durch dieKrankenzimmer der Salpetriere, dieses Museums von klinischen Fakten, gemacht hatte, derenNamen und Besonderheit größtenteils von ihm selbst herrührten, wurde an Cuvier erinnert,dessen Statue vor dem Jardin des Plantes den großen Kenner und Beschreiber der Tierwelt,umgeben von der Fülle tierischer Gestalten, zeigt, oder er mußte an den Mythus von Adam den-ken, der jenen von C h a r c o t gepriesenen intellektuellen Genuß im höchsten Ausmaß erlebthaben mochte, als ihm Gott die Lebewesen des Paradieses zur Sonderung- und Benennung vor-führte“ (Freud 1977: 22-23)
3. Schließlich stand Freud unter dem unmittelbaren existentiellen Druck, neuro-pathologische, im Grunde also psychopathologische Patienten durch erfolgverspre-chende Behandlungen für seine neue Praxis gewinnen zu müssen. Ihm war sofort klar,dass die bis dahin üblichen Kuren mehr auf magische Suggestion als auf wissenschaft-lich begründete Verfahren hinausliefen. Da war im Vergleich dazu das, was er in Parisbei Charcot und im Anschluss daran aus der in Frankreich in voller Blüte stehendenDiskussion über Hypnose erfahren konnte, ein großer Rationalisierungsschritt.
4. Die folgende Stelle aus den Braut-Briefen aus einer Zeit lange vor dem PariserAufenthalt kann belegen, dass Freud schon sehr früh einen diagnostischen Blick fürden sozio-kulturellen Hintergrund der Hysterie hatte:„Als er mir erzählte, daß sie ihn gebeten, ihre Schwester zu heiraten, und daß sie sich momentanerleichtert gefühlt, nachdem man ihr einen Aufschub der Hochzeit zugestanden, war mir klar,daß sie ihn nicht möge, und ich erzählte es Breuer. Breuer sagte, daß das größte Unglück könneentstehen, wenn ein Mädchen so zur Ehe schreite, und solche Verhältnisse pflegen damit zuenden, daß sich einer in der Verwandtschaft finde, der erklärt: Ich lasse Dich nicht heiraten. Derfand sich nicht, die ganze Verwandtschaft drängte die Arme. Sie wurde auf eine kleine Reisegeschickt und kam nicht anders zurück. Nun bat ich ihn, zu glauben, daß sie ihn nicht liebe undzu verreisen, wenn er wiederkomme, werde er kühler denken, werde sie geklärt auftreten, und
318 sozialersinn 8 (2007): 305–332
dann könne es zur definitiven Entscheidung kommen. Er vertrug aber den Gedanken nicht, daßein Mädchen ihn ablehnen könnte, er opferte alles so rücksichtslos dem einen Zweck, nicht vordie Welt mit einem Mißerfolg treten zu müssen. Die Verwandten bedrängten sie so unklug, daßsie, die nicht den Mut zu einer entscheidenden Ablehnung fand, auf den Aufschub verzichtete.Fünf Tage nachdem er mir versprochen hatte, zu verreisen, war die Hochzeit. Sie soll gesagthaben: Jetzt heißt es schnell heiraten oder gar nicht. Warum sie sich geweigert, ist nicht schwerzu erraten.“ (Freud 1988: 54)
III Die Publikationen unmittelbar nach dem Pariser Aufenthaltund nach Gründung der Praxis
Eine genauere Betrachtung der Veröffentlichungen zu den Anfängen der ambulantenPraxis, möglichst nahe zum Zeitpunkt unmittelbar nach dem Pariser Aufenthalt, kannam ehesten Aufschluss darüber geben, wie Freud unter den stark veränderten Lebens-und Arbeitsbedingungen als verheirateter niedergelassener Arzt vermittelt über dieBehandlung der Hysterie den Weg in die Psychoanalyse betritt und eröffnet. Freudselbst hat später geklagt, er habe für diesen Lebensabschnitt, also von 1886 bis etwa1892 so gar nichts Rechtes geforscht und publiziert. Das spiegelt nur seinen Anspruchals Forscher und sein Selbstbild, er sei eigentlich kein richtiger Arzt gewesen. In Wirk-lichkeit war sein Geist außerordentlich rege und es findet eine stürmische theoretischeund methodische Entwicklung statt, eben jene, die vielfach und allzu oberflächlichspäter als Bruch gesehen wird, aber viel mehr als konsequente Kontinuität zu geltenhat. Der Bruch liegt viel mehr auf der Ebene der sozialen und ökonomischen Lebens-führung, zu der er angesichts der antisemitischen Diskriminierungen im akademischenBetrieb gezwungen war. Es empfiehlt sich diese genauere Betrachtung der frühenSchriften zur Psychopathologie aus dieser Zeit auch deshalb, weil sie weniger bekanntsind und ihre bibliographische Lokalisierung lange Zeit recht verworren war. Ich ver-suche, chronologisch so genau wie möglich vorzugehen.
Unmittelbar nach seiner Rückkehr nach Wien ist Freud bemüht, seine neuen Er-kenntnisse über Hysterie und Hypnose unter den ärztlichen Kollegen bekannt zu ma-chen. Dabei stößt er auf allergrößte Widerstände. Nachdem er einen ausführlichenReisebericht an das Professorenkollegium abgefasst hat (Freud 1999: 34-44), das ihmdas Reisestipendium genehmigt hatte, stellt er am 15. Oktober 1886 die CharcotschenNachweise der männlichen Hysterie vor. Dieser Text ist nicht überliefert,5 dürfte aberim Wesentlichen dem Reisebericht entsprechen. Meynert macht sich zum Sprachrohrder Kritik und fordert Freud auf, den Wiener Kollegen doch einen Fall männlicherHysterie aus Wien zu demonstrieren. Mit großen Schwierigkeiten gelingt es Freud,einen solchen Patienten für eine überzeugende Präsentation am 26. November zu ge-winnen. Der – erst später publizierte – Text (Freud 1886) belegt einmal mehr die au-ßerordentlich genaue diagnostische Erfassung und Beweisführung. Danach publiziertFreud Übersetzungen von Charcot und Rezensionen von Werken über Hypnose, Neur-asthenie und Hysterie. Er arbeitet sich also in sein neues Gebiet der Psychopathologieein.
5 Vgl. dazu die Notiz in der editorischen Vorbemerkung zur nachfolgenden Schrift (a. a. O.: 54).
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 319
1888 verfasst er eine außerordentlich aufschlussreiche Schrift zur Hysterie, die bisheute nur wenig rezipiert worden ist, und die lange Zeit gar nicht als eine FreudscheSchrift bekannt war (erst 1953 von Paul Vogel wieder entdeckt und dann in der Psychenachgedruckt – Freud 1888). Ich meine den Artikel „Hysterie“ (gemeinsam mit derkurzen Notiz über „Hysteroepilepsie“) im Handwörterbuch der gesamten Medizin,1888 von A. Villaret.6 Darin findet sich eine sehr genaue symptomatologische Be-schreibung der systematischen Differenz zwischen organischen und hysterischen Läh-mungen bzw. Anästhesien. Diese Argumentation wiederholt sich in dem auf Franzö-sisch erschienenen Artikel „Quelques considérations…“ (Freud 1893), der darüberhinaus im letzten Abschnitt noch eine psychologische, aufregend neue Deutung dieserDifferenz enthält, die im Handbuchartikel fehlt. Deshalb konzentriere ich mich, wasdie ersten Deutungen der Hysterie anbetrifft, auf diesen auf Französisch erschienenenArtikel.
Obwohl für die systematische Entwicklung der Psychoanalyse von zentraler Be-deutung, ist seine Rezeption bis heute schwach. Erst 1997 ist er in einer deutschenÜbersetzung von Marie Luise Knott und Mechthilde Kütemeyer im Jahrbuch der Psy-choanalyse erschienen (Freud 1997). Die Gesammelten Werke enthalten bis heute diefranzösische Fassung wie sie 1893 in den „Archives de Neurologie“, Bd. 26 publiziertist. Man kann aber Freuds Bericht über seine Studienreise nach Paris, der am 22. April1886 abgeschlossen wurde, entnehmen, dass das Manuskript zu diesem Zeitpunkt, alsosieben Jahre vor der Publikation in den „Archives“, schon abgeschlossen war.7 WarumJones (Jones 1960: 276-278) die Abfassung dieses Aufsatzes in den Mai 1888 verlegt,hinter die Verwendung der entsprechenden Argumentation in einer Vorlesung von1887, ist mir unerfindlich und nicht gut belegt. Bei Gay (1989) wird die ganze Angele-genheit nicht erwähnt. Demnach ist dieser Aufsatz die erste zusammenhängende Deu-tung der Hysterie durch Freud nach der Charcot-Konversion. Und diese enthält denentscheidenden Übergang zur Psychoanalyse, wie wir gleich sehen werden.
Dass sie erst sieben Jahre später erscheint, kurz vor Charcots Tod, kann ich mirnur so zurechtlegen, dass Freud oder andere vor allem mit dem letzten Kapitel, derentscheidenden Wendung zu einer psychologischen Erklärung der Hysterie, doch nocherhebliche Schwierigkeiten hatten, weil sie doch sehr revolutionär war und vor allemauch mit Charcots Standpunkt der hereditären Konstitution der Hysterie radikal brach.Für diese Annahme spricht, dass diese psychologische Deutung im Handbuchartikelvon 1888 über Hysterie, also einem späteren Text nicht mehr enthalten war und auch inden Studien über Hysterie in dieser Klarheit nicht mehr anzutreffen ist.
Daneben sind zwei weitere sehr früh veröffentlichte Texte aufschlussreich, in de-nen zum einen die Strukturlogik des Arzt-Patient Verhältnisses, modern ausgedrückt:des Arbeitsbündnisses, auf dessen Basis als professionalisierter Praxis Freud seineEinsichten zur Begründung der Psychoanalyse gewinnt, reflektiert wird, und zum ande-ren die faktisch zentrale hermeneutische Komponente in der Praxis der hypnotischen
6 Wieder abgedruckt in Freud 1999: 72-90.7 „...aus dem eine zur Aufnahme in die ‚Archives de neurologie‘ bestimmte Arbeit hervorging, welche als
‚Vergleichung der hysterischen mit der organischen Symptomatologie‘ bezeichnet ist“ (Freud 1999: 41;„Bericht über meine mit Universitäts-Jubiläums-Reisestipendium unternommene Studienreise nach Parisund Berlin Oktober 1885–Ende März 1886“).
320 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Suggestion evident wird. Für beide Texte steht im Vordergrund, wie Freud, von derSache selbst gedrängt, sowohl als scharfer, in der naturwissenschaftlichen Forschunggeschulter Beobachter als auch als in der ärztlichen Praxis professionalisierter Thera-peut wie selbstverständlich die zentralen Komponenten einer hermeneutisch-sinntheoretischen Begründung der Psychoanalyse neben ihrer naturwissenschaftlichenFundierung entwickelt. Ich werde diese Schriften, die neben den beiden anderen ge-nannten: der Falldarstellung einer männlichen Hysterie und den Handbuchartikeln überHysterie, zu den ersten zur an der Behandlung der Hysterien sich entfaltenden Psycho-analyse gehören, im folgenden in dieser Reihenfolge durchgehen.
IV Die frühe Evidenz für eine systematische sinntheoretische undhermeneutisch-methodologische Komponente im Entwurf derPsychoanalyse…
1 …in der Deutung der Kausalität der HysterieIn der Rekonstruktion der frühen Argumentation im Detail sei zunächst der wahr-scheinlich schon 1886 entstandene, aber erst 1893 publizierte, auf Französisch ver-fasste Vergleich von organischen und hysterischen Lähmungen betrachtet. Man kanndiese Schrift in zwei Argumentationsblöcke teilen, von der der letzte, psychologischeviel kürzer ist als der erste, in dem differentialdiagnostisch außerordentlich sorgfältigdie organischen Lähmungen von den hysterischen Lähmungen unterschieden werdenund hier und da auch die Anästhesien einbezogen werden. Ich bin kein Neurologe undwerde laienhaft die wichtigsten Unterscheidungskriterien referieren.
Freud unterscheidet unter den organischen Lähmungen die peripher-spinalen unddie zerebralen und stellt sie diametral gegenüber. Klinisch ist die peripher-spinaleLähmung eine Lähmung im Detail, die zerebrale eine „en masse“ oder vielleicht bes-ser: flächenhafte. Man könnte es anschaulicher etwa so ausdrücken: Während die peri-phere Lähmung randscharf umschrieben ist, aber nur kleine Flächen der Körperober-fläche einnimmt, ist die zerebrale großflächig, aber randunscharf. Die Erklärung dafürist eine einfache neuroanatomische. Freud geht vom einfachen Modell der motorischenNervenbahnen aus. Sie sind zweigeteilt. Zum einen führen direkte Nervenfasern vonden Zellen der Vorderhörner im Rückenmark bis zur Peripherie der Extremitäten. Zumanderen von der Hirnrinde ins Rückenmark. Weil letztere Bahnen nicht mehr direkt,gewissermaßen eins-zu-eins, von der Hirnrinde zur Peripherie hin leiten, sondern ge-bündelt und funktionell verteilt sind, bezeichnet Freud die zerebralen Lähmungen alsRepräsentationslähmungen und die peripheren als Projektionslähmungen. Letzteremüssen also scharf umschrieben und detailliert abgrenzbar sein, erstere sind viel diffu-ser im Erscheinungsbild.
In Relation dazu setzt nun Freud das Erscheinungsbild der hysterischen Lähmungmit der Frage, ob diese tatsächlich erfolgreich die organische simuliert. Grob gesagt –das ist jetzt nicht Freuds Argument – teilen die hysterischen Lähmungen mit den zereb-ralen, dass sie in der Regel großflächig sind, und mit den peripheren, dass sie ver-gleichsweise scharf umschrieben sind; dass sie also je ein zentrales Merkmal der bei-
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 321
den gegensätzlichen, sich ausschließenden organischen Formen widerspruchsvoll mit-einander verbinden. Freud akzentuiert vor allem das Folgende. Die hysterischen Läh-mungen gleichen phänomenal eher den zerebralen, sie haben von den peripheren so gutwie gar nichts, weil diese natürlich nur die Muskeln betreffen, die kleinräumlich voneiner Läsion eines bestimmten peripher-spinalen Nervs affiziert sind. Im Unterschiedzu den zerebralen, gerade auch den corticalen Lähmungen sind aber nun die hysteri-schen Lähmungen in der großen Fläche viel absoluter, während bei den organischenimmer noch etwas sich innervieren lässt. Vor allem aber sind sie viel randschärfer,während die organischen, weil ja im Großhirn die zu den verschiedenen Extremitätenführenden motorischen Nerven jeweils lateral relativ eng beieinander liegen, also ge-meinsam geschädigt sind, die Störung sich großflächig diffus ausbreitet. So sind in derRegel bei organischen Lähmungen, wenn auf einer Seite etwa das Bein gelähmt ist, derArm und andere Körperregionen ebenfalls affiziert. Des weiteren und charakteristisch:Bei den organischen zerebralen Lähmungen ist die Peripherie einer Extremität, alsoz. B. die Hand oder der Fuß viel stärker affiziert als deren Rumpf, weil mehr Nerven-endigungen in die feinzusteuernde Peripherie führen. Bei der hysterischen Lähmung isteher umgekehrt das Zentrum des Glied-Rumpfes besonders stark affiziert. Es kommennoch viele stützende Einzelheiten hinzu (z. B. bei Aphasien), die sehr interessant sind,die ich mir hier aber ersparen muss.
Das alles läuft auf einen zentralen, entscheidenden Schluss hinaus. Die hysteri-schen Lähmungen erscheinen so, als ob der von ihnen befallene Organismus den Ner-venatlas nicht kennt, aber sie dennoch als organisch bedingt gelten lassen will. Diehysterische Lähmung ist also neuroanatomisch nicht zu erklären und man wird nieeinen entsprechenden Befund vor sich haben.„Nun, woher kommt es, daß die hysterischen Lähmungen zwar weitgehend die kortikalen Läh-mungen simulieren, jedoch in jenen Unterscheidungsmerkmalen von diesen abweichen, welcheich versucht habe aufzuzählen, und welchen allgemeinen Charakter besitzt die besondere Reprä-sentation, auf die wir die Unterscheidungsmerkmale zurückführen müssen? Die Antwort aufdiese Frage enthielte einen guten und wichtigen Teil einer Theorie der Neurose.“ (Freud 1997:18)
Mit dieser Argumentation ist die Festung gewissermaßen sturmreif geschossen, dennnun drängt ja ein offenes Problem nach einer Deutung und Erklärung. Wenn nämlicheine Lähmung vorliegt, aber neuroanatomisch ohne Befund und nicht erklärbar ist, wasbedeutet sie dann und wie kann man sie erklären? Indem Freud hier nun eine ganz neuepsychologische Deutung vorschlägt, entfernt er sich radikal von Charcot und betrittNeuland. Ich will diese Deutung zunächst in wenige kurze eigene Worte fassen, umZeit und Raum zu sparen. Der Hysteriker entwickelt seine Symptome so, dass der Ein-druck einer anatomischen Verursachung entstehen soll, dieser Versuch aber von medi-zinischer bzw. neuroanatomischer Unkenntnis geprägt ist. Dadurch entstehen Fehler,aber sie sind motiviert. Zum ersten Mal haben wir hier voll entwickelt das hermeneu-tisch-rekonstruktionslogische Grundschema der Psychoanalyse vor uns: Fehler, z. B.Krankheitssymptome, sind nicht einfach die Folge eines Versagens, einer zu reparie-renden Funktionsstörung in einem „Maschin-Kaputt“-Modell der Erklärung, sondernsinnlogisch motivierte Gebilde. Sie haben einen lebens- bzw. traumatisierungsge-schichtlich motivierten Sinn und sind insofern nicht einfach Fehler, sondern Fehl-Leistungen. Es operiert also dabei ein vom medizinischen Fachwissen abweichendes
322 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Konzept des Körpers und zwar ein umgangssprachliches. Der Arm, der gelähmt ist,wird dann z. B. semantisch als ein Körperteil aufgefasst und vorgestellt, wie er etwadem Ärmel entspricht, der den Arm bekleidet, abzeichnet und in eine Jacke oder Hemdvom Schneider eingesetzt ist. Das Konzept bzw. der Begriff oder die Prädizierung derKörperteile ist also umgangssprachlich vorgegeben, konventionalisiert und nach se-mantischen Regeln strukturiert. Diese operieren in der Psyche des Hysterikers, wenn erein Organ in der Lähmung dissoziiert.„Ich werde nun versuchen zu zeigen, daß es sehr wohl eine funktionelle Veränderung ohne einebegleitende organische Schädigung geben kann, zumindest ohne eine größere greifbare Schädi-gung, selbst mittels genauester Analyse. Anders ausgedrückt: ich werde ein passendes Beispielfür die Veränderung einer Grundfunktion geben; dazu möchte ich lediglich um die Erlaubnisbitten, auf das Gebiet der Psychologie überwechseln zu dürfen, was schließlich unvermeidlichist, wenn man sich mit der Hysterie beschäftigt. Ich sage, übereinstimmend mit Janet, daß beiden hysterischen Lähmungen wie bei den Anästhesien usw. eine landläufige, banale Vorstellungvon den Organen, vom Körper überhaupt, im Spiele ist. Diese Vorstellung beruht nicht auf einertieferen Kenntnis der Nervenanatomie, sondern auf unseren taktilen und vor allem visuellenWahrnehmungen. Wenn diese Vorstellung nun die Besonderheiten der hysterischen Lähmungbestimmt, dann muß letztere sich von ihrer Natur her als ahnungslos erweisen, ja: als unabhän-gig von jeglicher Kenntnis der Anatomie des Nervensystems. Die Läsion bei der hysterischenLähmung wäre folglich eine Veränderung der Vorstellung, der Idee, z. B. des Arms. Aber wel-cher Art ist diese Veränderung, damit sie die Lähmung hervorruft?“ (a. a. O.: 23) 8– „Psycholo-gisch betrachtet, besteht die Lähmung eines Armes in der Tatsache, daß die Vorstellung vomArm nicht in Beziehung treten kann mit den anderen Ideen, die das Ich konstituieren, und derKörper des Individuums ist gewiß ein wichtiger Teil desselben. Die Läsion bestünde folglich inder Außer-Kraft-Setzung der assoziativen Zugänglichkeit der Vorstellung des Arms. Der Armbenimmt sich, als ob er für das Spiel der Assoziationen nicht existiere. Während die Vorstellungals solche gewiß auch verloren geht, wenn die materiellen Bedingungen, die sich an die Vor-stellung des Arms knüpfen, eine grundlegende Veränderung erfahren, geht es mir darum aufzu-zeigen, daß die Vorstellung unzugänglich sein kann, ohne zerstört zu sein und ohne daß ihrmaterielles Substrat (das Nervengewebe der entsprechenden Region in der Hirnrinde) geschä-digt wäre“ (a. a. O.: 24). – „Es handelt sich hier nicht um einen bloßen Vergleich, es ist nahezudie Sache selbst, wenn wir uns auf das Gebiet der Psychologie der Vorstellungen begeben. Wenndie Vorstellung des Arms an eine Assoziation von großem Affektbetrag gebunden ist, wird dieseunzugänglich werden für das freie Spiel anderer Assoziationen. Der Arm wird dann in demMaße gelähmt sein, in dem dieser Affektbetrag fortbesteht oder sich durch geeignete psychischeMittel verringert. Dies ist die Lösung des Problems, das wir aufgeworfen haben, denn in allenFällen hysterischer Lähmung stößt man darauf, daß das gelähmte Organ oder die außer Kraftgesetzte Funktion an eine unbewußte Assoziation gebunden ist, die mit einem hohen Affektbetragbefrachtet ist, und man kann zeigen, daß der Arm frei wird, sobald dieser Affektbetrag gelöschtist. Die Vorstellung vom Arm also existiert zwar im materiellen Substrat, sie ist aber nicht zu-gänglich für bewußte Assoziationen und Impulse, weil die Gesamtheit seiner assoziativen Bin-dung, wenn man so will, abgesättigt ist durch eine unbewußte Assoziation mit der Erinnerung andas Ereignis, das Trauma, das die Lähmung hervorgerufen hat.“ (ebd.)
Ich möchte nun die Freudsche Deutung noch etwas zuspitzen. Ganz offensichtlich hatder Hysteriker zwar die neuroanatomischen Sachverhalte verfehlt, aber er hat dennocheine organische Bedingtheit seiner Lähmung herstellen bzw. konstruieren wollen, nur
8 Es wird sich gleich zeigen, dass das Opake an Freuds Deutung vor allem in den letzten beiden Sätzen des
Zitats enthalten ist.
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 323
eben in der laienhaften, die organischen Verhältnisse verfehlenden Begriffssprache desAlltags. Der Hysteriker hat also sich und andere getäuscht, aber diese Täuschung kannnicht bewusst oder strategisch sein, sondern sie vollzieht sich im Unbewussten underhält dadurch die Funktion, gewissermaßen im moralischen Sinn, also objektiv be-dingt, weil organisch berechtigt, an der Krankheit festhalten zu können (sekundärerKrankheitsgewinn), ohne deren psychische Verursachungen sich zu Bewusstsein brin-gen zu müssen. Denn wenn die Krankheit organisch bedingt ist, dann ist man dafürauch nicht verantwortlich und dann kann man auch nicht viel ändern. Zudem istgleichzeitig gesichert, dass der Organmediziner auch nichts machen kann, denn einorganischer Befund liegt ja nicht vor. Wir müssen also mindestens drei Ebene anneh-men, auf der unbewusste Prozesse operieren:
1. Auf der letzten Ebene der Symptomproduktion operiert der Hysteriker unbe-wusst mit den semantischen Regeln, dem Sprachspiel der Umgangssprache. Ohne es zuwissen, folgt er in der klassifikatorischen Kartierung des Körpers ihren Distinktionen.Dem entspricht das soziale Unbewusste im Sinne des „tacit knowledge“ der sprachli-chen Kompetenz.
2. Auf der vorletzten Ebene wird mit dieser Körperkartierung eine unbewussteTäuschung vorgenommen, die sowohl eine Selbsttäuschung als auch eine Fremdtäu-schung z. B. des Arztes bewirkt. Ihre Funktion ist, dass der verursachende psychische,traumatisierende Konflikt des Bewusstseins mit einer unzulässigen, sozial und kulturellgeächteten Vorstellung oder Erfahrung als anatomische Verursachung maskiert wird,mit der die Psyche des Kranken scheinbar nichts zu tun hat. Diese Selbsttäuschungmuss ihrerseits, gerade weil sie unbewusst ist, also nicht zu Bewusstsein kommen soll,wiederum unbewusst motiviert sein.
3. Das führt zur eigentlich verursachenden ersten Ebene, der Krankheitsursache inGestalt eines psychischen Konflikts zwischen zwei unverträglichen Erwartungen oderAnsinnen unter der Bedingung, dass dieser Konflikt weder offen benannt werden darfnoch rational durchgearbeitet und gelöst werden kann. Vielmehr muss die geächtete,vom Bewusstsein nicht zuzulassende Vorstellung, das unzulässige Sinnelement besei-tigt bzw. dissoziiert werden als ob es nicht vorhanden wäre. Das hat zur Folge hat, dassder daran hängende Affektbetrag aufgrund nicht erfolgender angemessener Abfuhreingeklemmt bleibt und irgendwo hin seinen Weg bahnen muss, d. h. sich entweder aneine andere weniger skandalöse Vorstellung oder – wie im Falle der Hysterie – durchKonversion ins Soma an ein Organ energetisch heftet und gleichzeitig außer Assoziati-on mit dem Bewusstsein gestellt wird. Im Falle der hysterischen Konversion führt dieseDissoziation zur Lähmung oder Empfindungsstörung bei einer durch die um-gangsprachliche Abgrenzung umschriebenen Körperregion.
Diese Unterscheidung einer Kaskade von drei Ebenen unbewusster Operationenwird bei Freud nicht genügend deutlich.
1. Freud übergeht diese Unterscheidungen, er argumentiert ausschließlich auf derzuletzt behandelten ersten Ebene und zieht dort die beteiligten Elemente zusammen. Ergewinnt die an die Stelle der neuroanatomischen Determination tretende sinnlogischeDetermination der Lähmung dadurch, daß er die im Hysteriker operierende Vorstellungvom dissoziierten Organ nicht unabhängig im Sprachsystem verankert und als vorge-geben unterstellt, sondern direkt durch die der Dissoziation zugrundeliegende Körper-empfindung bestimmt. Zum einen führt er die „Banalität“, d. h. das vom medizinisch
324 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Fachgemäßen Abweichende der „Vorstellung von den Organen“ „auf unsere taktilenund vor allem visuellen Wahrnehmungen“ zurück, aber eben nicht deutlich genug aufdie semantischen Regeln der Umgangssprache als einem zentralen Parameter für dieErzeugung von objektivem Sinn. Zum anderen vermengt er von vornherein die Bana-lität dieser Vorstellungen damit, daß sie „nicht in Beziehung treten kann mit den ande-ren Ideen, die das Ich konstituieren“, also mit der Dissoziation selbst, der komplemen-tär die „Absättigung“ aller Assoziationen dieser Organvorstellung mit jenen zur trau-matisierenden Konstellation entspricht. Er übersieht dabei, dass die umgangssprach-lich, qua „tacit knowledge“ bedingte Körperkartierung als solche nicht der Dissoziationanheimfällt, sondern durchaus prinzipiell bewusstseinsfähig bleibt und jedenfalls inbewußten Vorgängen strukturierend zur Verfügung steht. Die später als dynamischeVerdrängung dargestellte Dissoziation betrifft vielmehr ausschließlich den traumatisie-renden Vorfall, mit dem dieser so kartierte Körperteil in Verbindung steht. Damit aberdie Konversion des mit der zur Dissoziation verurteilten Vorstellung gekoppelten Af-fektbetrages ins Soma in der je spezifischen Weise von statten gehen kann, muß diedazu erwählte Stelle im Soma durch die umgangsprachlich festgelegte objektive Be-deutung der Körperregion zuvor bestimmt sein. Dieser von der Umgangssprache ge-führten Körpereinteilung bedient sich eine zur Dissoziation verurteilte Assoziation miteinem traumatischen lebensgeschichtlichen Vorgang, einer subjektiven Krisenerfah-rung, die den primären, Krankheit verursachenden Konflikt ausmacht.
Aber auch in diesen Konflikt gehen nicht nur subjektive Einstellungen und Be-wertungen ein, sondern auch objektiv geltende, d. h. im Sinne sozial gültiger Regelnerzeugte Bedeutungen, die den Gegenstand dieser Einstellungen ausmachen. JedeTraumatisierung geht von einer Krisenkonstellation aus, für die gilt, daß sie zwar im-mer eine Eigenschaft der Relation von Konstellationen einer Umwelt zu einem kon-kreten Erfahrungssubjekt darstellt, aber eine Relation, deren eines Glied diese Kons-tellation in ihrer letztlich sprachlich vermittelten objektiven Bedeutung ist und derenanderes Glied erst in der subjektiven Perspektivität auf diese Bedeutung sich konstitu-iert. Freud führt der Sache nach den Begriff der Konversion im gleichen Atemzuge ein,in dem er deren Voraussetzung, nämlich die illusionistische organische Kausalerklä-rung durch umgangssprachlich vorausgehende Konstruktionen, erst zu erklären hätte.Anders gesprochen: Er definiert die illusionistische Kausalerklärung selbst durch denVorgang der Konversion und damit zirkulär, weil er die der Konversion vorausgehendeumgangssprachliche, sinnlogisch Determination der Körperzone des hysterischenSymptoms nicht analytisch unabhängig von ihr bestimmt.
2. Faktisch aber kann er seine Deutung nur entwickeln und aufrechterhalten, wenner sich auf die vorausgehende objektive Deutungskraft der Sprache als Sprache beruftund zwar unabhängig von der jeweiligen subjektiven Interpretation des konkreten Ak-teurs.
Führt man sich die enorme Reichweite dieser frühen Deutung der Symptome derHysterie vor Augen und dazu den Umstand, daß dieser frühe Text erst seit 1997, alsokaum 10 Jahre in einer deutschen Übersetzung vorliegt, worin seine Verborgenheit undVergessenheit sich objektiviert, dann zeigt sich darin, wie wenig das mit der Psycho-analyse entstehende neue Wissenschaftsparadigma bis heute ausgeschöpft ist. Paralleldazu scheint auch die medizinisch-praktische Relevanz dieses Paradigmas ganz imGegensatz zur landläufigen Abwertung der Psychoanalyse in einem engen naturwis-
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 325
senschaftlichen und psychologischen Reduktionismus eher umgekehrt noch im Ver-borgenen zu schlummern. Jedenfalls deuten darauf dramatisch die folgenden, aus derinternistisch-ärztlichen Praxis stammenden Bemerkungen der späten Übersetzerin jenerfrühen französischen Schrift Freuds hin:„Mein eigenes Ergebnis aus 20jähriger konsiliarischer Tätigkeit in verschiedenen Krankenhäu-sern ist, daß – bei Anwendung der von Freud genannten Unterscheidungsmerkmale – Konversi-onen (auch Schwindel, Schmerzen und Gangstörungen im Sinne somatisierter Angst) bei mehrals der Hälfte der Patienten auszumachen sind. So fand sich bei den 1200 von mir neurologischuntersuchten Patienten mit Rücken-, Schulter-, Nacken- und anderen Schmerzen der letzten 10Jahre im St. Agatha- Krankenhaus, Köln- Niehl, nur in 24 Fällen (2%) eine klare radikuläre oderandere neurologische Störung – nur eine Patientin bedurfte der Bandscheiben-Operation –, bei220 Patienten (18%) eine unspezifische ‚organische‘ Situation, alle übrigen Schmerzsyndrome(80%) erfüllten (mit ihrer extremen Intensität, ihrer unanatomischen Ausstrahlung sowie ihrerResistenz gegen Analgetika, selbst gegen Morphine) unverwechselbar die Kriterien der Psycho-genie… Angesichts des Aussparens gerade dieser basalen Werkzeuge zur Diagnose von Konver-sionen – und Angstneurosen – entsteht der Eindruck, als ob die umwerfenden Erkenntnisse überdie Hysterie, die Freud der Medizin geliefert hat, unter der Hand – auch von den Anhängern derPsychoanalyse – wieder rückgängig gemacht, abgewehrt, verleugnet werden müssen, damit ihreubiquitäre Relevanz für den klinischen Alltag nicht deutlich werde; es wäre eine zu große Ver-wandlungsarbeit der Medizin damit verbunden“. (Kütemeyer 1997)
2 …bei der Differenz von objektivem und subjektivem SinnFreud kann also seine geniale Deutung der Täuschungsfunktion in der Ausbildung desSymptoms der hysterischen Lähmung, einer Täuschung, die ja sowohl als erfolgreicheSelbsttäuschung wie als erfolgreiche Fremdtäuschung auf den Plan tritt und damitkategorial von einer dem Bewusstsein zuzurechnenden strategischen Täuschung, mitder sie vor Freud sozial abwertend und diskriminierend, gegen den Kranken gewendet,verwechselt wurde, zu unterscheiden ist, nur deshalb entwickeln, weil er sich, ohne esals solches hinreichend explizit zu bestimmen, faktisch auf das „tacit knowledge“ derumgangssprachlichen Regeln auf seiten des traumatisierten Subjekts berufen kann.Denn die dynamisch-subjektive Seite des mit dem traumatischen Konflikt konfrontier-ten Subjekts, das diesen rational nicht ertragen kann, bildet ja nicht wiederum subjektivdie Vorstellungen aus, deren es sich bei dem erfolgreichen Täuschungsmanöver be-dient. Das wäre ja schon deshalb nicht erfolgreich, weil dann das eine organische Ver-ursachung vortäuschende implizite Argument von vornherein die dafür notwendige,gewissermaßen im öffentlichen Diskurs beglaubigte Gültigkeit nicht in Anspruch neh-men könnte und als bloß subjektive, mehr oder weniger willkürliche Bildung sofortentlarvt werden könnte.
Faktischer objektiver Hermeneut wird Freud nun gleich zu Beginn seiner Karriereals niedergelassener Neuropathologe, weil er auf der Grundlage einer außerordentlichpräzisen neurologischen Diagnostik die Lücke in einer anatomischen Erklärung einesKrankheitsgeschehens scharf bestimmen kann und daran die unabweisbare Notwen-digkeit für das, was er eine psychologische Erklärung nennt, festmacht. Von Anfang anmuss er dabei, obwohl er sie hier so noch nicht nennt, unbewusste Prozesse – vonvornherein eine Kombination von sinnlogischen und neuronalen, die energetischeVerteilung von Affektbeträgen regulierenden Komponenten – und Strukturen auf der
326 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Seite der sinnlogischen Parameter wie selbstverständlich unterstellen. Und diese unbe-wussten sinnlogischen Operationsweisen auf den eben genannten drei Ebenen setzenihrerseits voraus, dass man in Differenz zum subjektiven Meinen und Fühlen als ent-scheidend und nicht auf anderes reduzierbar die letztlich durch Sprache konstituiertenobjektiven Bedeutungs- und Sinnstrukturen in das theoretische Modell einsetzen muss.Die implizit in Anspruch genommenen sinntheoretisch zu fassenden Elemente erschöp-fen sich bei Freud der Sache nach von vornherein nicht, wie später in den Verhaltens-und Handlungstheorien üblich, im subjektiv gemeinten – oder auch nur gefühlten –Sinn der kontextrelativen, situationsabhängigen Konnotation. Viel mehr setzen dieseimmer schon einen sozial generierten objektiven Sinn voraus, dem sich das Subjekt wieeiner objektiven Realität im Sinne von sozialen Tatsachen sui generis analog zu Durk-heims Konzeption nicht entziehen kann. Im Krankheit verursachenden Trauma amal-gamiert sich die objektive Sinnhaftigkeit des krisenhaften Erfahrungsgegenstandes mitdessen subjektiver Valenz, die sich ihrerseits sowohl aus der leibgebundenen Lust-Unlust-Reaktionsskala als auch den Anforderungen lebensgeschichtlicher Selbstkohä-renz zusammensetzt. Erstaunlich ist eben, wie ein ursprünglich genialer Naturwissen-schaftler in der konsequenten Verfolgung einer wissenschaftlichen Methodologie indem Moment, in dem er aus kontingenten Gründen Psychopathologien praktisch be-handeln muss, sofort auf ein außerordentlich weitreichendes Modell der Amalgamie-rung von somatischen und sinnlogischen Determinanten des lebenspraktischen Ge-schehens gebracht wird.
3 …in der Deutung des Arbeitsbündnisses zwischenArzt und Patient
Die nächste eigenständige Schrift auf der Seite der psychopathologischen Praxis ist dieebenfalls lange Zeit zeitlich falsch eingeordnete „Psychische Behandlung (Seelenbe-handlung)“ von 1890, die, weil sie der dritten Auflage des populären Handbuches „DieGesundheit: Ihre Erhaltung, ihre Störungen, ihre Wiederherstellung“ entnommen wur-de, in den GW fälschlicherweise auf 1905, also 15 Jahre zu spät, datiert wurde (Freud1991: 287-315).
In dieser Schrift setzt sich Freud, die Bedingungen seiner frühen Fallbehandlun-gen reflektierend, letztlich mit seinem aktuellen Problem in seiner niedergelassenenPraxis auseinander. Wie soll er die zu ihm kommenden Patienten behandeln, wenn maneigentlich über kein spezifisches Wissen verfügt. Was tut der Arzt als Arzt, wenn ereinem Patienten helfen muss, aber eigentlich – im wissenschaftlich-methodisch be-gründbaren Sinne – nicht weiß wie. Freud behandelt damit eigentlich ein systemati-sches Problem der ärztlichen Praxis über Jahrhunderte hinweg, jedenfalls seitdem esvon den Universitäten ausgebildete und qualifizierte Ärzte als Professionen gab, alsoseit dem ausgehenden 12. Jahrhundert in Europa – und in der Antike und der arabi-schen Kultur schon viel früher. Das änderte sich grundlegend ja erst an den For-schungsuniversitäten des 19. Jahrhunderts und vor allem an dessen Ende, also zuFreuds Anfangszeiten.
Freud zeigt nun, dass der Arzt ohne dieses spezifische Wissen nicht nur einfachtäuscht, sondern selbst dann, wenn er magisch handelt, etwas tut, was tatsächlich dem
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 327
Patienten helfen kann: Das Placebo-Effekt-Problem. Indem er nämlich den Patientenan sich bindet, ihm Vertrauen einflößt, ihm Zuwendung gewährt, ihn ernst nimmt undanerkennt, ihm Hoffnung macht und vor allem seine Probleme mit ihm geduldig durch-spricht, weckt er – so Freud – Affekte und Emotionen im Patienten, die sich im Sinneeiner Mobilisierung von Selbstheilungspotentialen therapeutisch günstig auswirkenkönnen. Der Arzt hat also, indem er, soziologisch ausgedrückt, mit dem Patienten nichtnur eine geschäftliche Dienstleistungsbeziehung aufnimmt, also eine spezifische rollen-förmige Sozialbeziehung, sondern vor allem eine diffuse Sozialbeziehung zwischenganzen Menschen, also eine Beziehung, die man mit Talcott Parsons bestimmen kanndurch das Kriterium, dass in ihr derjenige die Beweislast trägt, der thematisch etwasausschließen will, immer etwas zu bieten, solange er diese Beziehungslogik ernsthaftaufrechterhält als – eben – Arbeitsbündnis mit dem Patienten.9
Es ist nun interessant zu sehen, wie außerordentlich sensibel Freud, obwohl er sichdoch gar nicht primär für einen Arzt sondern für einen Forscher hielt, in dieser Schriftdie Strukturlogik des Arbeitsbündnisses, ohne diesen Begriff schon zu gebrauchen,entwickelt. Zunächst ist es ihm wichtig zu zeigen, dass die Medizin endlich auch lernenmuss, die seelischen Erscheinungen nicht nur als organisch bedingte ernst zu nehmen,sondern auch in der Position, in der sie umgekehrt eigenlogisch auf das organische
9 Soziologisch-professionalisierungstheoretisch lässt sich dieses Arbeitsbündnis als eine widersprüchliche
Einheit von Elementen einer spezifischen und diffusen Sozialbeziehung deuten. Das gilt für beide Seitendes Bündnisses, also sowohl für den Patienten wie für den Therapeuten. Die Asymmetrie dieses Verhält-nisses lässt sich dann so deuten, dass für den Patienten der Pol der Diffusheit eigens gefordert werdenmuss, weil er über das evidente Moment des Spezifischen des Arbeitsbündnisses als rollenförmigesDienstleistungsverhältnis hinaus jeweils von Neuem in seiner Befremdlichkeit zu Bewusstsein gebrachtwerden muss. Das drückt sich in der Grundregel des psychoanalytischen Settings sinnfällig aus: Ihr gemäßsoll der Patient alles offen kommunizieren, was ihm durch den Kopf geht, sei es subjektiv auch noch soirrelevant oder noch so peinlich. Die Grundregel besagt also soziologisch gesehen: Sei diffus, d. h. be-weislastig ist, wenn etwas ausgelassen wird. Für den Arzt, der gewissermaßen ein professionalisierter Spe-zialist für die Thematisierung des Diffusen ist, u. a. in der Voraussetzung einer Lehranalyse zum Ausdruckkommend, gilt auf der Folie dieser paradoxen Spezialisierung umgekehrt. dass er immer wieder von Neu-em daran zu erinnern ist, dass diese diffuse Beziehungspraxis der bedingungslosen Thematisierung derÜbertragungsinhalte des Patienten nicht praktisch ausagiert werden darf und der soziale Rahmen einesspezifischen Dienstleistungsverhältnisses aufrechterhalten werden muss. Die für den Therapeuten geltendeAbstinenzregel meint analog: Sei bzw. bleib spezifisch, d. h. verhalte Dich nicht praktisch folgenreich wiedas in der Diffusität thematische Übertragungsobjekt. Entsprechend lassen sich Übertragung und Gegen-übertragung im psychoanalytischen Setting soziologisch deuten einerseits als symmetrische Erfahrungs-bzw. Empfindungsmodi einer diffusen Sozialbeziehung auf beiden Seiten und andererseits als asymmetri-sche Prozesse dahingehend, dass die Übertragung eine Re-Inszenierung von neurotisierenden Beziehungs-konstellationen vornehmlich aus der frühen Kindheit des Patienten erlaubt, auf die der Therapeut innerlichbedingungslos ebenso diffus reagiert, indem er in seinem Unbewussten motivierte Abwehr- oder Primärre-aktionen gleichermaßen neutralisiert, d. h. sowohl die Reinszenierung authentisch nachempfinden als auchdem Impuls einer Primärreaktion widerstehen kann:
Arzt Patient
diffuse Beziehung Gegenübertragung(innere Reaktion)
Grundregel(Übertragung)
spezifische Beziehung Abstinenzregelexpertenhafte Dienstleis-tung
Einhaltung von Ver-pflichtungen, z. B. Be-zahlung
328 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Leben einwirken. Unter dem Gesichtspunkt dieser Einwirkung deutet er dann das ärzt-liche Handeln als Praxis. Damit ist er systematisch an der Stelle angekommen, an derz. B. der Hysteriker, dessen sprachlich induzierte Selbsttäuschung in der Symptombil-dung Freud erkannt hat, im Gespräch mit dem Arzt grundsätzlich dazu gebracht wer-den kann, dass entweder die symptomatischen Folgen dieses Illusionismus durch Be-sprechen gemildert oder beseitigt werden können oder gar eine Einsicht in das unbe-wusste Geschehen der Krankheit hergestellt werden kann.
Nachdem Freud so die magischen Anteile am ärztlichen Handeln durchaus hatgelten lassen, ohne deshalb romantisch auf die Magie zu regredieren, behandelt er dieHypnose als einen Spezialfall des bedingungslosen Vertrauens, dass der Patient zuseinen eigenen Gunsten dem Arzt entgegenbringt. Und in der Tat: Soziologisch gese-hen führt ja die Hypnose den Patienten in einen Zustand, in dem er grenzenlos, also alsganzer Mensch, dem Arzt ausgeliefert ist. Er weiß ja vorher schon, dass er bedin-gungslos den Suggestionen Folge leisten wird. Gleichzeitig gelingt die Hypnose nur,wenn der Arzt als Hypnotiseur über jene suggestive Kraft verfügt, die eben für dasGelingen einer magischen Handlung bzw. die Herbeiführung eines Placebo-Effektesnotwendig ist. Insofern ist also die Hypnose ein radikaler Spezialfall der Strukturlogikdes Arbeitsbündnisses zwischen Arzt und Patient. Und als solche deutet sie Freudletztlich auch systematisch. Er kommt damit im Grunde genommen der Sache nachschon auf die Wechselbeziehung des Prozesses von Übertragung und Gegenübertra-gung zu sprechen.
Nun lässt sich ja leicht zeigen, inwiefern die Hypnose zugleich aber auch in einerzentralen Hinsicht von diesem Arbeitsbündnis abweicht. Sie schaltet nämlich den Pati-enten in seiner mit seinen gesunden Anteilen gleichzeitig verbleibenden Autonomie, inseinem Wachbewusstsein aus und macht ihn zu einem Sklaven bedingungsloser Ge-folgschaft. Insofern sind die durch Suggestion in der Hypnose erzielbaren Wirkungenauf bloße Symptomveränderungen von zudem kurzer Dauerhaftigkeit von vornhereinbeschränkt. Eine wirkliche Transformation des Krankheitsgeschehens durch Einsichtist darin letztlich nicht möglich. Das gibt Freud am Ende dieser Schrift auch in allerDeutlichkeit zu erkennen, ohne deshalb der Hypnose undankbar zu sein als einer Tech-nik, die eine erste Türöffnung in die Hysterie-Behandlung ermöglichte. Auch die vonBreuer übernommene kathartische Methode, durch die die Hypnose nicht nur dazubenutzt wird, eine der hysterischen Autosuggestion konträre Suggestion der Symptom-beseitigung zu setzen, sondern den Patienten dazu zu bringen, sich ungehemmt an diekonkreten Umstände der Entstehung eines Symptoms zu erinnern und im Sprechendarüber den eingeklemmten Affekt eben kathartisch abzureagieren, führe, so Freud hierschon, letztlich nicht wirklich weiter. Er weiß also hier schon, 1890, dass man im Ge-spräch mit dem Patienten die unbewussten Vorgänge und Verstrickungen ins Bewusst-sein heben muss.
Es ist hier doch schon ein erstaunlich weitgehender Vorgriff auf das großartigeModell von Psychotherapie am Ende der „Studien über Hysterie“ zu verzeichnen, indem Freud das Argument der drei systematischen, großenteils sinnlogisch zu verste-henden Anordnungen des pathologischen Materials entwickelt, denen es in der psy-chotherapeutischen Praxis geduldig zu folgen gilt.
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 329
4 …in der Technik der hypnotischen SuggestionIch möchte nun an der ersten kurzen Fallanalyse aus den Hysteriebehandlungen, dem1892 publizierten „Fall einer hypnotischen Heilung“ (Freud 1892), also einer Behand-lung vor der Reihe derjenigen, die in den „Studien über Hysterie“ dargestellt werden,eine weitere Hinsicht aufzeigen, in der Freud schon von Anfang an in seiner Entwick-lung zum Psychoanalytiker faktisch zu einer Sichtweise gebracht wird, die systema-tisch wesentliche Aspekte der Methodologie der objektiven Hermeneutik enthält.
In diesem Fall wurde Freud mehrmals und bei verschiedenen Geburten zu einerWöchnerin gerufen, die ihr Kind unbedingt stillen wollte, daran aber hysterisch behin-dert war, indem sie zum Beispiel das Essen nicht bei sich behalten konnte, dadurchständig erschöpft war, etc.
Freud gelingt es, diese Frau trotz ihres Widerstandes in einen hypnotischen Zu-stand zu bringen und ihr darin die folgenden Suggestionen zu setzen:„Haben Sie keine Angst, Sie werden eine ausgezeichnete Amme sein, bei der das Kind prächtiggedeihen wird. Ihr Magen ist ganz ruhig, Ihr Appetit ausgezeichnet, Sie sehnen sich nach einerMahlzeit u. dgl.“ (a. a. O.: 6)
„Die Kranke werde fünf Minuten nach meinem Fortgehen die Ihrigen etwas unwillig anfahren:wo denn das Essen bleibe, ob man denn die Absicht hatte, sie auszuhungern, woher sie denn dasKind nähren solle, wenn sie nichts bekäme u. dgl.“ (a. a. O.: 7)
Was können wir an diesem Beispiel ablesen? Selbst wenn wir die Hypnose nicht nurals eine Technik interpretieren, die nur einen physiologischen Zustand der Ausschal-tung des Wachbewusstseins herstellt, und wir haben ja gesehen, dass sie ein radikalerFall der Arzt-Patient-Beziehung ist, z. B. ist der Hypnotisierte disponiert, den Anwei-sungen des Hypnotiseurs und nur seinen zu folgen, selbst dann also stellt sie als Be-handlungstechnik letztlich doch nur ein Mittel zum Zweck dar. Worauf es nämlichtherapeutisch ankommt, ist das, was unter dieser Bedingung interaktiv geschieht. Wärees vollständig gleichgültig, was der Hypnotiseur mit dem Hypnotisierten interaktivmacht, wie z. B. im Zirkus oder auf dem Jahrmarkt, wo es nur darum geht, dem Publi-kum die Sensation vorzuführen, dass tatsächlich der Hypnotisierte nach dem Wieder-aufwachen genau das tut, was ihm suggeriert worden ist, obwohl er sich nicht mehrdaran erinnern kann, dass es ihm in der Hypnose befohlen wurde, dann ginge es nur umeine Vorführung von etwas dem gesunden Menschenverstand kaum Glaubhaften. Da-mit aus der Verwendung der Hypnose eine Behandlung wird, müssen – für den Fall derBenutzung von Suggestionen – mindestens zwei Bedingungen erfüllt sein.
1. Die Gegensuggestion muss eine sinnlogische Negation des Symptoms sein.2. Um das sein zu können, muss zuvor das Symptom selbst sinnlogisch gedeutet
sein oder in einen sinnlogischen Bedingungszusammenhang gestellt worden sein.Bei beiden Verfahren, sowohl der Konstruktion der Gegen-Suggestion als auch
der ihr vorausliegenden Sinn-Interpretation der Symptomkonfiguration handelt es sichum hermeneutische Verfahren der Sinnrekonstruktion. Ihr Gegenstand ist aber geradenicht der subjektiv gemeinte Sinn des Patienten oder das Bild das er selbst von seinenSymptomen oder seiner Krankheit hat, sondern die objektive Bedeutungsstruktur derSymptome selbst, das also, was ihre unbewusste Bedeutung ausmacht. Freud operiertalso von Anbeginn in seiner ärztlichen Praxis mit einem Verfahren der hermeneuti-schen Rekonstruktion des objektiven Sinns sowohl von somatischen Phänomenen als
330 sozialersinn 8 (2007): 305–332
auch des Handelns des Patienten, vor allem innerhalb des Arbeitsbündnisses selbst. Ja,man kann sagen: Ohne diese – methodologische – Voraussetzung wäre der Weg in diePsychoanalyse nicht eröffnet worden.
V SchlussbetrachtungAuf der Grundlage dieser gleich zu Beginn der psychoanalytischen Praxis aufgrundgenauer Beobachtung aus der Sache selbst entspringenden hermeneutisch-sinntheoretischen Komponente entwickeln sich alle jene revolutionierenden Leistungeneines neuen Wissenschaftsparadigmas, die in der Einleitung summarisch kurz ange-deutet wurden. Sie in ihrer Systematik und inneren Theoriearchitektonik zu entfalten,ist hier nicht möglich. Aber die weitreichenden Konsequenzen nicht nur für die ärztli-che Praxis und deren Professionalisierung, sondern auch und gerade für die Gesamtheitder kultur-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen von der sinnstrukturier-ten Welt sind, so hoffe ich, doch wenigstens aufgeschienen: das Verhältnis von Unbe-wusstem zum Bewusstsein und der enorme Anteil des ersteren an der Erklärung vonPhänomen menschlicher Praxis; das methodologische Problem der Erschließung vonUnbewusstem auf der Basis der Rekonstruktion objektiver und latenter Sinnstrukturen;die Verzahnung von somatischen, psychischen und sozialen Prozessen in Vollzügenmenschlicher Praxis und ihren kulturellen Objektivationen; die Differenz zwischeneinem „Maschin-kaputt“ Modell der Erklärung von Psychopathologien und einemModell von deren sinnlogischer Motiviertheit und Determination; das in der Rekon-struierbarkeit von latenten Sinnstrukturen verborgene Potential für Prozesse der Selbst-heilung, insofern die latenten Sinnstrukturen von Ausdrucksgestalten der Psychopa-thologie diese – und damit ihre lebensgeschichtliche sinnlogische Motiviertheit – im-mer gültig zum Ausdruck bringen; das spezifische Erkenntnisproblem, dass die Positi-onalität des Leibes als unseres Innen und Außen zugleich dem Menschen als Kulturwe-sen stellt; das Moment der Universalität der sexuellen und materiellen Reproduktion,das daraus resultiert, in seinem Verhältnis zur Historizität der kulturellen Positivierun-gen dieser Reproduktionen – um nur einige dieser Konsequenzen wenigstens schlag-wortartig zu benennen. Für alle diese Gesichtspunkte ist die durch Freud vollzogenesystematische Verknüpfung von naturwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichenBetrachtungsweisen unter der Bedingung genauester Detailbeobachtungen und – ana-lysen konstitutiv.
Angesichts dessen Freud ein „szientistisches Selbstmissverständnis“ (Habermas1973: 300-332) entgegenzuhalten, kommt einer eigentümlichen Verkennung dieserVerknüpfungsleistung und der aus ihr resultierenden Besonderheit des psychoanalyti-schen Wissenschaftsparadigmas gleich. Nicht nur wird darin, wie auch in der Feststel-lung einer Grenze des „Universalitätsanspruchs der Hermeneutik“ (Habermas 1970)gegenüber dem Problem der Erklärung von Psychopathologien, die Reichweite desEindringens sinnstruktureller Determinationen in die Somatik des menschlichen Leibesund der Erklärungskraft sinntheoretischer Argumente für die leibliche Existenz desMenschen unterschätzt, sondern es wird darin auch verkannt, dass Freud die ursprüng-liche naturwissenschaftliche Basis der in der Organmedizin ursprünglich entwickeltenprofessionalisierten therapeutischen Praxis als sicheren Boden seines ärztlichen Han-delns beibehalten musste, um auf ihm die psychoanalytische Theorie entfalten zu kön-
Ulrich Oevermann: Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse Freuds 331
nen.10 Wie selbstverständlich nämlich begegnet uns in Freuds Leistung die Wahrheitder Feststellung, dass die Einheit von Theorie und Praxis sich erst in der professionali-sierten Praxis der stellvertretenden Krisenbewältigung im Namen einer Erfahrungswis-senschaft herstellt, für deren Autonomie als Forschungsoperation die kategoriale Tren-nung von Wissenschaft und Praxis konstitutiv ist. Freuds angebliches szientistischesSelbstmissverständnis ist in Wirklichkeit Ausdruck jenes forschungslogischen Re-spekts vor der Autonomie von Erfahrungswissenschaft, die durch eine voreilige pro-grammatische Forderung der Einheit von Theorie und Praxis schon in der erkenntnis-theoretischen Begründung von Forschung sich zur technokratischen Bevormundungvon Forschung pervertieren würde. Eine wirklich folgenreiche Einheit von Theorie undPraxis, die sich erst in der Praxis des professionalisierten Arbeitsbündnisses ergebenkann, wäre dann schon im Vorfeld reduziert und „pädagogisierend“ in Regie genom-men. Damit hängt zusammen, dass in der psychoanalytischen Praxis nicht, wie einst inder kollektiven Phantasie von Teilen der 68er-Generation, die gesellschaftliche Be-dingtheit individueller Leiden Gegenstand der Thematisierung und Bearbeitung ist,sondern der Anteil von „Entfremdung“, für den der Patient selbst verantwortlich ist.Diese scheinbare Ausblendung des Themas der Fremdbestimmung ist in WirklichkeitAusdruck der radikalen Anerkennung der Autonomie des Subjekts.
LiteraturCajal, S.R. (1935): Die Neuronenlehre. In: Bumke, Oswald & Otfrid Foerster (eds.): Handbuch
der Neurologie. Bd. I. Berlin 1935: 887-982— (1990): New Ideas on the Structure of the Nervous System in Man and Vertebrates. Cam-
bridge/Mass.Freud, S. (1886): Beobachtung einer hochgradigen Hemianästhesie bei einem hysterischen Man-
ne. In: Wien. med. Wschr., Bd. 36: Sp. 1633-1638, 1647-1676; (auch in Freud 1999: 57-64)— (1888): Hysterie. In: Psyche, Bd. 7, Nr. 9 (1953): 486-500— (1893): Quelques considérations pour une étude comparative des paralysies motrices organi-
ques et hystériques. In : Archives de Neurologie, Bd. 26 : 29-43 (wieder abgedruckt in Freud1977: 37-55)
— (1892): Ein Fall von hypnotischer Heilung, nebst Bemerkungen über die Entstehung hysteri-scher Symptome durch den ‚Gegenwillen‘. In: Freud 1977: 3-17
— (1977): Gesammelte Werke. Chronologisch geordnet. Erster Band. Werke aus den Jahren1892–1899. Frankfurt/M.
— (1988): Brautbriefe, Frankfurt/M.— (1990): Hirnforscher. Neurologe. Psychotherapeut – Ausgewählte Schriften. (Hrsg. u. eingel.
v. Ingrid Kästner & Christina Schröder) Leipzig— (1991): Gesammelte Werke. Chronologich geordnet. Fünfter Band. Werke aus den Jahren
1904–1905. Frankfurt/M.— (1997): Einige Betrachtungen zu einer vergleichenden Studie über organische und hysterische
motorische Lähmungen. In: Jahrbuch der Psychoanalyse, Bd. 39: 9-26— (1999): Gesammelte Werke. Nachtragsband. Texte aus den Jahren 1885-1938. Frankfurt/M.
10 Dadurch konnte das ärztliche Behandlungsmodell konsequent auf die Psychopathologien übertragen
werden, mit der Folge, dass diese nunmehr nicht mehr nur im „Maschin-Kaputt“ Modell einer bis heuteweiter wirkenden naturwissenschaftlichen Psychiatrie kombiniert mit der Unterbringung der Patienten ineiner totalen Institution, in der ein Arbeitsbündnis sich nur bedingt aufrechterhalten lässt, erklärt, sondernzusätzlich als sinnlogisch in einer Traumatisierungsgeschichte motiviert gedeutet werden.
332 sozialersinn 8 (2007): 305–332
Gay, P. (1989): Freud. Eine Biographie für unsere Zeit. Frankfurt/M.Golgi, C. (1878): Di una nuova reazione apparentemente nera delle cellule nervose cerebrali
ottenuta col bicloruro di mercurio (1878). In: ders.: Opera omnia. Vol I. Milano 1903: 143-148
— (1883/84): Recherches sur l’histologie des centres nerveux. In: Arch. Ital. Biol., 3: 285-317;4: 92-123
Habermas, J. (1970): Der Universalitätsanspruch der Hermeneutik (1970). In: Ders.: Zur Logikder Sozialwissenschaften. Frankfurt/M. 1982: 331-366
— (1973): Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M.— (1981): Theorie des kommunikativen Handelns, Band 1. Frankfurt/M.Jones, E. (1960): Das Leben und Werk von Sigmund Freud, Bd. 1. Bern, StuttgartKütemeyer, M. (1997): „Die Verbindung dieser Hand mit der Idee des Königs...“ in: Jahrbuch
der Psychoanalyse, Bd. 39: 40Meyer-Palmedo, I. & G. Fichtner (1999): Freud-Bibliographie mit Werkkonkordanz. Frank-
furt/M.von Waldeyer-Hartz, H.W.G. (1891): Über einige neuere Forschungen im Gebiete der Anatomie
des Centralnervensystems. In: Deutsche medizinische Wochenschrift 17
418 sozialersinn 8 (2007): 413–423
The objectivity of seeing as a problem in the sociology of knowledgeThe article discusses the “social genesis of the view” and the sociological-genetic in-terpretation of works of art as problems of the ‘objectivity’ of seeing. For this purposethe author reconstructs the relations of art history and sociology of knowledge in itsformative years. Raab outlines and examines the parallels and divergences in the theo-retical concepts of Karl Mannheim, Erwin Panofsky, and Pierre Bourdieu in regard totheir methodical approaches in describing and analyzing the processes of the constitu-tion of sense in the acts of visual perception. In order to confront the increasing com-plexity and the paradoxes of media communication as well as the changing ways ofvisual presentation and perception, Raab argues for a sociology of visual knowledge,which follows the theory of Berger and Luckmann in its main features, and is phe-nomenologically and hermeneutically oriented in addition.
Keywords: visual sociology, sociology of knowledge, hermenutics of visual data, KarlMannheim, Erwin Panofsky, Pierre Bourdieu
Anschrift des Verfassers: PD Dr. Jürgen Raab, Universität Luzern, Institut für So-ziologie, Kasernenplatz 3, CH-6000 Luzern; Tel.: (+41 228) 70 22;[email protected]; http://www.unilu.ch/deu/dr._juergen_raab_78856.aspx
Ulrich Oevermann
Implizite objektive Hermeneutik in der Hysterieanalyse als Paradigmafür Freuds Übergang von der Neurologie zur Psychoanalyse –Zugleich ein professionalisierungsgeschichtlicher BefundDer durch die Freud’sche Psychoanalyse bewirkte Paradigmenwechsel im Kanon derErfahrungswissenschaften wird systematisch bestimmt im Hinblick auf die Selbster-kenntnis des Subjekts in seiner leiblichen Positionalität, das daraus resultierende not-wendige Bedingungsverhältnis von Bewusstsein und Unbewusstem und das darauswiederum sich ergebende Problem der methodologischen Erschließbarkeit des Unbe-wussten im empirischen Datenmaterial. In diesem Licht erscheinen die auf den Ratio-nalitätsbegriff sich konzentrierenden Handlungstheorien als vergleichsweise ober-flächlich und unfähig, die maßgeblichen, durch unbewußte Dispositionen generiertenStrukturen sozialer Prozesse zu erfassen. Freuds Leistung als Begründer der Psycho-analyse wird als durch den Habitus von Forschung und ärztlicher Praxis gewährleisteteKontinuität des Übergangs von herausragender neurologischer Forschung zu psycho-analytischer Forschung und Praxis rekonstruiert. Bei dem Bruch in diesem Überganghandelt es sich keineswegs um einen Bruch mit den Naturwissenschaften; er reduziertsich vielmehr auf die lebensgeschichtliche Kontingenz, dass Freud als Jude chancenloswar, einen Lehrstuhl für Neurophysiologie zu besetzen. Es wird an drei Schlüsselar-gumenten in den frühesten Schriften zur Psychoanalyse gezeigt, dass der mit der Be-handlung und Erforschung der Hysterie sich vollziehende Übergang zur Psychoanalysewesentlich auf Konstruktionen beruht, die als Vorgriffe auf die Methodologie der ob-
Abstracts 419
jektiven Hermeneutik gelten können. In dieser Betrachtung werden die Psychoanalysezu einer sozialwissenschaftlichen Leitdisziplin und die objektive Hermeneutik zu einermethodologischen Basis der Psychoanalyse.
Schlagworte: Freud, objektive Hermeneutik, Psychoanalyse, Hysterie, objektiver Sinnvon Symptomen, Professionalisierung.
Implicit objective hermeneutics in the analysis of hysteria as a paradigmfor Freud’s transition from neurology to psychoanalysis –At the same time findings in the history of professionalisationThe paradigm-change in the empirical sciences caused by Freud’s psychoanalyticaltheory is systematically worked out with respect to the problem of self-knowledge ofthe subject in its body positionality, to the resulting necessary conditional hiatus be-tween consciousness and the unconscious and to the thereby generated methodologicalproblem of the logical inference of the unconscious from empirical data. In this per-spective, the traditional action theories focusing on rationality appear as comparativelysuperficial, and not sufficiently able to analyse the main structures of social processes,which are generated by unconscious dispositions. Freud’s achievement is historicallyreconstructed as the result of his discrimination as a Jew, repudiating him a call to achair of neurophysiology and thereby forcing him to run a medical practice for neuro-pathological diseases. But behind this forced biographical rupture his habitus as a re-searcher in the natural sciences continually operated in the medical profession, too.With respect to three different key arguments and constructions the article shows thatFreud’s engagement in the problem of explaining and working therapeutically withcases of hysterical pathology – the basis for the future development of the psychoana-lytic framework – systematically is guided by theoretical concepts of meaning whichpreconceive the key concepts of “objective hermeneutics”. In this perspective psycho-analysis is uncovered a leading discipline for the social sciences and objective herme-neutics is to be regarded a methodological base for psychoanalysis.
Keywords: Freud, objective hermeneutics, psychoanalysis, hysteria, objective meaningof pathological symptoms, professionalisation.
Anschrift des Verfassers:Prof. Dr. Ulrich Oevermann, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Robert-Mayer-Str. 5, 60054 Frankfurt/M.; [email protected]









































![Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bc0ca93f371de19011b9c/wer-nutzt-social-tv-die-nutzer-als-treiber-sozialer-interaktion-mit-fernsehinhalten.jpg)