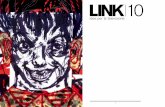Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using...
-
Upload
uni-weimar -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using...
Wer nutzt Social TV? – Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten
Christopher Buschow, Beate Schneider, Alena Bauer, Lisa Carstensen und Kira Drabner1 Erschienen in: MedienWirtschaft, 10. Jg., Nr. 04/2013, S. 48-57
Autoren Christopher Buschow, M.A. Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK), Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover E-Mail: [email protected] Prof. Dr. Beate Schneider Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK), Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover E-Mail: [email protected] Alena Bauer, M.A. MTU Maintenance Hannover GmbH E-Mail: [email protected]
Lisa Carstensen, M.A. aserto GmbH & Co. KG E-Mail: [email protected]
Kira Drabner, B.A. Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung (IJK), Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover E-Mail: [email protected]
1 Die in diesem Beitrag präsentierte Studie entstand unter Mitarbeit eines Forschungsseminars am IJK, an dem außerdem Lena Hautzer, Martin Heuer, Sonja Kränz, Peter Liberski, Nadine Mußmann, Daniel Possler, Vanessa Precht, Ina von Salzen, Torben Schindler, Johannes Schlag, Anika Schoft, Anja Stotz, Simon Ueberheide und Julian Werner beteiligt waren. Ihnen und den beiden anonymen GutachterInnen der MedienWirtschaft ist an dieser Stelle herzlich zu danken.
1
Wer nutzt Social TV? – Die Nutzer als Treiber sozia-ler Interaktion mit Fernsehinhalten
Management Summary (5-10 Zeilen):
Social TV ist kein Phänomen, das von kapitalstarken Organisationen in Innovationsprozessen
strategisch entwickelt wurde. Es entstand vielmehr in der Alltagspraxis von Nutzern, die neue
Möglichkeitsräume in digitalen Medien erschlossen haben. Der Beitrag stellt Ergebnisse einer
Befragung dieser Lead User vor und gibt Auskunft über ihre Nutzungsgewohnheiten, ihre
technologische Ausstattung, genutzte Plattformen und Genrepräferenzen. Vergleichend wer-
den Ergebnisse einer Untersuchung von Nichtnutzern herangezogen. Auf Basis der empiri-
schen Erkenntnisse können Handlungsoptionen für die Marktteilnehmer, insbesondere für
Fernsehunternehmen, abgeleitet werden.
Kernthesen:
1. Unter den betrachteten Lead Usern werden vor allem Second-Screen-Devices einge-
setzt, Smart TV spielt hingegen für sozialen Austausch nur eine sehr untergeordnete
Rolle.
2. Es sind nicht die Plattformen der etablierten Fernsehunternehmen, die primär für Soci-
al TV eingesetzt werden, sondern die Social Networking Sites Facebook und Twitter.
3. Nicht alle Genres funktionieren auf allen Plattformen: Während Twitter als Genre-
Allrounder gilt, ist Facebook stärker für fiktive Erzählformate geeignet.
4. Nichtnutzer besitzen zwar die technologische Ausstattung für Social TV, sie schauen
aber selten bis nie Fernsehen oder empfinden begleitende Kommunikation als unnütz,
uninteressant, mithin sogar als störend.
Schlüsselbegriffe (5): Social TV, Zukunft des Fernsehens, Fernsehnutzung, Nutzeranalyse,
Quantitative Befragung
1. Die Nutzer als Innovationstreiber
Social TV, die Verknüpfung von linearem Fernsehen und Social Media, hat in letzter Zeit
auch in Deutschland zunehmend an Prominenz gewonnen. Immer mehr Nutzerinnen und Nut-
zer tauschen sich vor, während oder nach dem Fernsehen mit anderen über das Gesehene aus.
So wurden zum TV-Duell zwischen Angela Merkel und Peer Steinbrück in 90 Minuten allein
2
bei Twitter rund 132.000 Statusmeldungen abgesendet (vgl. Ipsos 2013). Der Super Bowl im
Frühjahr 2013 generierte parallel zur Ausstrahlung weltweit 30,6 Millionen Kommentare –
ein neuer Social-TV-Rekord (vgl. Bluefin Labs 2013). Diese Zahlen belegen die Relevanz des
Phänomens, verdeutlichen aber auch, dass Social TV in Deutschland im Vergleich zu anderen
Ländern – etwa dem angloamerikanischen Raum – weiterhin unterentwickelt ist und erst eine
kleine Gruppe von ‚frühen Nutzern‘ den Austausch während des Fernsehens wagt.
Das kann auch damit zusammenhängen, dass deutsche Sender und Unternehmen den Trend
zur Parallelnutzung recht spät für sich entdeckt haben. Social TV ist kein Phänomen, das von
kapitalstarken Organisationen in Innovationsprozessen strategisch entwickelt wurde. Es ent-
stand vielmehr in der Alltagspraxis von Nutzern, die neue Möglichkeitsräume in digitalen
Medien erschlossen haben – entsprechend gelten sie als die Treiber der Entwicklung (vgl.
Buschow/Schneider/Carstensen/Heuer/Schoft 2013; Strippel 2013). Von besonderem Interes-
se ist es daher, die heute bereits aktiven Nutzerinnen und Nutzer in Deutschland, die wir hier
als „Lead User“ (von Hippel 1986) verstehen, näher zu betrachten. Sollte Social TV so rapide
wachsen, wie es am Markt derzeit erwartet wird (vgl. exemplarisch A.T. Kearney 2013;
Kerkau 2013; kritisch: TNS Infratest 2013; Hündgen/Argirakos 2013), könnten Erkenntnisse
über diese frühen Nutzer eine Prognosekraft für zukünftige Nutzererwartungen und -wünsche
entfalten (vgl. von Hippel 1986). Für Marktteilnehmer ist das Wissen darüber von großer Be-
deutung, um Angebote entsprechend der Nutzungsweisen abzustimmen und zu entwickeln. So
resümieren etwa König, Benninghoff und Prosch (2013) aus der Perspektive von ProSieben-
Sat.1:
„Während das klassische TV-Nutzungsverhalten in jahrzehntelanger Marktforschung bis auf das kleinste Detail analysiert wurde, steht die Branche in der Ära des interaktiven Fernsehens mit ihren Erkenntnissen noch ganz am Anfang.“ (König/Benninghoff/Prosch 2013: 209-210)
Der Beitrag schließt an diese Beobachtung an und berichtet Ergebnisse einer Onlinebefragung
von 409 deutschen Social-TV-Nutzerinnen und -Nutzern, die Ende 2012 bis Anfang 2013
durchgeführt wurde. Diese jungen, internet- und technologieaffinen, überdurchschnittlich ge-
bildeten Lead User werden im Hinblick auf folgende forschungsleitende Fragen untersucht:
(a) Wie gestaltet sich ihre Nutzung?
(b) Welche technischen Geräte besitzen sie und setzen sie ein?
(c) Auf welchen Plattformen tauschen sie sich über das Gesehene aus?
(d) Welche Inhalte finden bei ihnen für Social TV besonderen Anklang?
3
Zum Vergleich wurde eine Stichprobe von 405 Nichtnutzern im gleichen (Rekrutie-
rungs-)Umfeld befragt.
Im Folgenden geben wir einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu den hier in-
teressierenden Dimensionen (Kapitel 2). Anschließend stellen wir unser methodisches Vorge-
hen und die Operationalisierungen vor (Kapitel 3). In Kapitel 4 werden die Ergebnisse der
Untersuchung berichtet. Der Beitrag schließt mit einem Fazit und potenziellen Handlungsop-
tionen für die Marktteilnehmer (Kapitel 5).
2. Aktuelle Erkenntnisse zur Social-TV-Nutzung in Deutschland
„Fernsehbegleitendes Sprechen“ (Klemm 2000: 149) ist zunächst kein neues Phänomen:
Schon seit Erfindung des Rundfunks haben sich Gruppen während der Ausstrahlung von Sen-
dungen unterhalten und gemeinsam über das Gehörte oder Gesehene gelacht, getrauert, ge-
spottet usw. (vgl. Hepp 1998; Klemm 2000; Morley 1986). Tatsächlich fand 2011 in Deutsch-
land etwa ein Drittel der gesamten privaten Fernsehnutzung zusammen mit anderen statt (vgl.
Kessler/Kupferschmitt 2012). Neu ist heute, dass diese soziale Interaktion (zusätzlich) via
digitale Medien stattfindet – vor allem durch das Schreiben und Lesen von Kommentaren zu
Fernsehinhalten. Die fernsehbegleitende Kommunikation wird so zum „Social Soundtrack“
einer Sendung, wie Joel Lunenfeld, Vice President Global Brand Strategy bei Twitter, an-
merkt (vgl. Roy 2013). Hier setzen die Social-TV-Angebote der verschiedenen Marktteilneh-
mer an, indem sie das soziale Erlebnis Fernsehen über die Grenzen von Familie, Freundes-
kreisen und geographischen Regionen hinaus erweitern (vgl. Buschow et al. 2013; Schnei-
der/Buschow, 2013).
Social TV ist in den vergangenen Monaten zu einem wichtigen Thema in Wissenschaft und
(kommerzieller) Marktforschung geworden. Die vorliegenden Befragungsstudien1 sind über-
wiegend bevölkerungsrepräsentativ und verdeutlichen, dass gerade in der Zielgruppe der jun-
gen, internet- und technologieaffinen, höher gebildeten Lead User, an die sich unsere Studie
wendet, Social TV besonders relevant ist (vgl. anywab 2012; Best/Breunig 2011; BITKOM
2012; IP Deutschland/TNS Emnid 2011). Sie werden deswegen auch von den Marktteilneh-
mern bevorzugt angesprochen. Hinzu kommt die Befürchtung, dass die lineare Fernsehnut-
zung in dieser Zielgruppe in Zukunft stark rückläufig sein könnte (empirische Studien belegen
das jedoch aktuell nicht; vgl. Zubayr/Gerhard 2013). Die vorliegenden Social-TV-Studien
1 Wir möchten uns bei anywab Feedback Strategy und der Fittkau & Maaß Consulting GmbH für den Zugang zu aktuellen Forschungsergebnissen bedanken.
4
legen nahe, dass die Frage der technischen Ausstattung im Prinzip als entschieden gelten
muss. Demnach setzen die Befragten vor allem Laptops, Smartphones und stationäre PCs für
Social TV ein (vgl. anywab 2012; IP Deutschland/TNS Emnid 2011). Über internetfähige
Smart TVs (One-Screen- oder First-Screen-Technologien) gehen 50 Prozent ihrer Besitzer nie
in das Internet (vgl. Fittkau & Maaß Consulting 2012) – möglicherweise auch aufgrund der
oft mangelnden Usability dieser Geräte (vgl. Buschow et al. 2013). Offen ist allerdings noch,
auf welchen Plattformen (Social Networking Sites wie Facebook, Twitter, Google+; Anbie-
terplattformen wie ProSieben Connect, RTL Inside; Internetforen wie IOFF), mittels welcher
Applikationen (Checkin-Services wie Zapitano, wywy, Couchfunk, Miso) oder (In-
stant-)Messaging-Dienste (Whatsapp, SMS, E-Mail) Social TV genutzt wird. Unseres Wis-
sens wurden öffentliche, teilöffentliche und ausschließlich geschlossene Angebote noch in
keiner Studie vergleichend hinsichtlich der Nutzung untersucht. Lediglich die hohe Relevanz
von Facebook für den (teil-)öffentlichen Austausch in Deutschland scheint belegt (vgl.
exempl. anywab 2012). Weitgehende Übereinstimmung besteht auch im Hinblick auf die
Genrenutzung. Sowohl vorliegende Studien (vgl. exempl.
Ducheneaut/Moore/Oehlberg/Thornton/Nickell 2008; Geerts 2009; Geerts/Cesar/Bulterman
2008) als auch aktuelle Social-Media-Reichweitenmessungen wie der „Goldmedia Social-TV-
Monitor“ oder „MediaCom Social TV Buzz“ und Befragungen (vgl. IP Deutschland/TNS
Emnid 2011; BVDW/OVK 2013) zeigen, dass vor allem Live-Events, Soaps und ähnliche
Serienformate, Reality-TV, Quizshows, Sport und Nachrichtensendungen für Social TV ge-
nutzt werden. Insgesamt sind es Sendungen mit hoher Aktualität und hoher Emotionalität, die
von den Zuschauern online begleitet werden (vgl. Buschow et al. 2013).
3. Methodisches Vorgehen
Um ein möglichst differenziertes Bild der heutigen Social-TV-Nutzerinnen und -Nutzer zu
erhalten, wurde im Zeitraum vom 06. Dezember 2012 bis 09. Januar 2013 eine quantitative,
standardisierte Onlinebefragung durchgeführt. Aus oben bereits angeführten Gründen lag der
Fokus der Untersuchung auf der für Medienunternehmen besonders attraktiven Zielgruppe der
frühen Nutzer („Early Adopters“), die jung (14 bis 29 Jahre), internet- und technologieaffin
sowie überdurchschnittlich gebildet sind. Die Teilnehmenden wurden im Netz rekrutiert: In
einem Schneeballverfahren konnte die Umfrage über Onlinemedien wie Foren und Blogs so-
wie die Social Networking Sites Facebook und Twitter verbreitet werden. Außerdem wurde
mit dem Hersteller eine Social-TV-App kooperiert, der seine Nutzer zur Teilnahme einlud.
Das Schneeballverfahren, wie es hier angewandt wurde, kann keine Repräsentativität für alle
5
Social-TV-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland gewährleisten. Insbesondere spezifische,
kleinere und schwerer zu erreichende Populationen wie Lead User werden aber so kosten- und
ressourceneffizient erreicht (vgl. Häder 2010).
3.1 Operationalisierung
Der Fragebogen bildete die oben beschriebenen Dimensionen ab, außerdem wurden Nut-
zungsmotive erhoben, die hier aufgrund der Umfangsbeschränkung nicht dargestellt werden
können. Tabelle 1 fasst die Operationalisierung der interessierenden Dimensionen mit den
entsprechenden Quellen zusammen.
Tabelle 1: Operationalisierung der Dimensionen
Operationalisierung Skala Quelle
Dimension: Social-TV-Nutzung
Nutzer oder Nichtnutzer (Filter)
Item: „Kommt es vor, dass Du Dich – zumindest gelegentlich – während des Fernsehens über die Sendung online aus-tauschst oder liest, was andere online darüber schreiben?“ Antwortoptionen: „Ja“, „Nein“
-
Tätigkeiten während der Social-TV-Nutzung
(nur Nutzer)
acht Items, jeweils Likert-Skala: von 1 („stimme über-haupt nicht zu“) bis 5 („stim-me voll und ganz zu“) & „weiß nicht"
in Anlehnung an Ergebnisse aus Buschow et al. (2013)
Gründe für Nichtnutzung (nur Nichtnutzer)
acht Items, Mehrfachselektion möglich
in Anlehnung an Ergebnisse aus Buschow et al. (2013)
Dimension: Mediennutzungsgewohnheiten
Technikaffinität
fünf Items, jeweils Likert-Skala: von 1 („trifft überhaupt nicht zu“) bis 5 („trifft voll und ganz zu“)
Karrer/Glaser/Clemens/Bruder (2009)
Tätigkeiten während der Internetnutzung
acht Items, Skala: „nie“, „sel-ten“, „gelegentlich“, „häufig“, „sehr häufig“
in Anlehnung an Li/Bernoff (2008)
Mediennutzung TV & In-ternet
in Stunden und Minuten pro Tag
ARD/ZDF Studie „Massen-kommunikation“ (2010)
Dimension: Technologische Ausstattung
Gerätebesitz und -nutzung sechs Geräte: „besitze ich in Anlehnung an anywab
6
(nur Nutzer) nicht“, „nie“, „selten“, „gele-gentlich“, „häufig“, „sehr häu-fig“
(2012)
Dimension: Plattformen
Plattformkenntnis und -nutzung (nur Nutzer)
acht Plattformen, Skala: „ken-ne ich nicht“, „nie“, „selten“, „gelegentlich“, „häufig“, „sehr häufig“
in Anlehnung an Ergebnisse aus Buschow et al. (2013)
Dimension: Genres
Genutzte Genres zehn Genres (& Freitext Sons-tiges), Skala: „nie“, „selten“, „gelegentlich“, „häufig“, „sehr häufig“
in Anlehnung an Ergebnisse aus Buschow et al. (2013)
Quelle: eigene Darstellung
3.2 Stichprobenbeschreibung
An der Befragung nahmen 814 Personen teil, die zu jeweils 50 Prozent Social-TV-Nutzer
(n=409) und -Nichtnutzer (n=405) waren. Die Teilnehmerinnen (insgesamt 40% der Befrag-
ten) sind dabei etwas aktiver: 54 Prozent der Frauen in der Stichprobe nutzen Social TV, wäh-
rend es bei den Männern nur 48 Prozent sind. Abgesehen von der Geschlechterverteilung sind
die Gruppen sehr homogen. Sowohl Nutzer als auch Nichtnutzer sind jung (durchschnittlich
26 Jahre), meist Studierende und entsprechend hochgebildet. Die Befragten wohnen im Ver-
gleich zur Gesamtbevölkerung in überdurchschnittlich großen Haushalten: Bei den Nutzern
sind es im Schnitt 2,8 (SD=5,09) und bei den Nichtnutzern 2,7 (SD=2,57) Personen. Vermutet
wird, dass die Zielgruppe recht häufig in Wohngemeinschaften oder noch bei den Eltern lebt.
4. Ergebnisse
Das Kapitel fasst die zentralen Ergebnisse der Studie zusammen. In Kapitel 4.1 werden so-
wohl die Nutzer als auch die Nichtnutzer im Hinblick auf ihre Mediennutzungsgewohnheiten
betrachtet und – wo möglich – miteinander verglichen. Kapitel 4.2 stellt dar, welche techni-
sche Ausstattung bei Social TV zur Anwendung kommt. In Kapitel 4.3 betrachten wir, welche
Plattformen Einsatz finden. Kapitel 4.4 stellt schließlich die genutzten Genres vor und setzt
sie in Beziehung zu den Plattformen.
4.1 Mediennutzungsgewohnheiten
7
Sowohl die tägliche Nutzungsdauer des Fernsehens als auch von Onlinemedien unterscheidet
sich zwischen den von uns befragten Social TV-Nutzern und -Nichtnutzern hochsignifikant.2
Nutzer sehen nach eigenen Angaben am Tag 135 Minuten (SD=108,7) fern, was mit den Zah-
len von AGF/GFK übereinstimmt, die eine tägliche Sehdauer der 14- bis 29-jährigen Deut-
schen mit 134 Minuten angeben (vgl. Frees/van Eimeren 2013). Nichtnutzer schauen hinge-
gen nur 86 Minuten (SD=93,6) und damit im Vergleich zur Gesamtbevölkerung deutlich sel-
tener. Wird die Nutzungsdauer des Internets verglichen, zeigt sich, dass Nutzer mit 371 Minu-
ten pro Tag (SD=214,1) über eine Stunde länger online sind als Nichtnutzer (MW=308,
SD=189,4). Beide Gruppenwerte übertreffen allerdings bei weitem die Ergebnisse der
ARD/ZDF-Onlinestudie 2013, die für die Deutschen von 14 bis 29 Jahren 237 Minuten Ver-
weildauer pro Tag ausweist (vgl. van Eimeren/Frees 2013). Die vorliegende Stichprobe
zeichnet sich also durch eine hohe Internetaffinität aus, wie auch ein Blick auf die online aus-
geübten Tätigkeiten belegt. Beide Gruppen verzeichnen hier jeweils hohe Werte, allerdings
sind die Social-TV-Nutzer nochmals bedeutend aktiver: So schöpfen sie etwa die Potenziale
von Social Networking Sites auch abseits der Unterhaltung über das Fernsehen viel häufiger
aus.
Vor dem Hintergrund der geringen soziodemographischen Unterschiede zwischen Nutzern
und Nichtnutzern interessieren auch die Gründe, die innerhalb der Nichtnutzer-Gruppe zur
Ablehnung von Social TV führen (vgl. Abbildung 1).
Abbildung 1: Gründe für die Nichtnutzung von Social TV
2 Verfahren: Einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA); Fernsehnutzung F(1, 808) = 47.3, p = 0.000; Internetnut-‐zung F(1, 804) = 19.2, p = 0.000
8
N=405 (nur Social-TV-Nichtnutzer); Frage: „Was sind die Gründe dafür, dass Du Dich während des Fernsehens nicht mit anderen online austauschst oder liest, was andere über die laufende Sendung online schreiben?“ Mehr-fachantworten möglich; Quelle: eigene Erhebung.
Deutlich wird, dass nicht die Geräteausstattung der Hinderungsgrund ist: Nur drei Prozent der
Nichtnutzer fehlt die Hardware, mit der sie Social TV sinnvoll betreiben könnten. Weitaus
bedeutender ist die generelle Abwendung dieser Teilgruppe vom linearen Fernsehen, wie
schon die quantitativen Nutzungszahlen, die für die Nichtnutzer unter dem Bevölkerungs-
schnitt liegen, dokumentiert haben. Hier gibt nun ein Viertel der Befragten an, „selten oder
nie Fernsehen“ zu schauen. Auch die Frage nach dem persönlichen Nutzen spielt eine Rolle –
dies hatten in einer von den Autoren durchgeführten Studie befragte Experten schon 2012
vermutet: „Viele Social-TV-Anwendungen ließen einen offensichtlichen Mehrwert nicht er-
kennen. Ein wirklicher Zusatznutzen, der potenzielle Nutzer zum Mitmachen motivieren
könnte, fehle aktuell oftmals noch“ (Buschow et al. 2013: 28). Die ausschließliche Konzentra-
tion auf die Sendung (17%) und das Desinteresse an Kommentaren anderer (16%) zeigen,
dass viele Nichtnutzer Social-TV-Angebote eher als störend empfinden.
4.2 Technologische Ausstattung: Welche Geräte werden eingesetzt?
Vor dem Hintergrund der berichteten Ergebnisse ist es kaum verwunderlich, dass sich beide
Gruppen – sowohl Nutzer als auch Nichtnutzer – mit ihren technischen Geräten gut ausken-
nen und technikaffin sind. Die Social-TV-Nutzer probieren aber signifikant häufiger neue
Apps oder Programme aus und werden öfter von Freunden und Bekannten um Rat gefragt,
wenn es um den Kauf von Hardware geht.
9
Unter den Nutzern sind Notebooks/Laptops (84%), Smartphones (71%) und stationäre PCs
(60%) am weitesten verbreitet. Ein internetfähiges Fernsehgerät besitzen rund 34 Prozent, bei
Tablet PC (23%) und iPod Touch (14%) sind es deutlich weniger. Wird der Besitz mit der
Nutzung der abgefragten Geräte verglichen, zeigt sich, dass Tablet PCs wie Apple iPad oder
Samsung Galaxy Tab bei der Nutzung am häufigsten zum Einsatz kommen, obwohl nur we-
nige Befragte ein solches Gerät besitzen. Ist ein Tablet vorhanden, wird es demnach häufig
für Social-TV-Aktivitäten genutzt. Internetfähige Fernseher, also One- oder First-Screen-
Devices, rangieren bei der Nutzung gar auf dem letzten Platz, noch hinter dem iPod Touch
(vgl. Abbildung 2).
Abbildung 2: Besitz und Nutzung von Geräten für Social TV
N=409 (Social-TV-Lead User); Frage: „Welche der folgenden Geräte benutzt Du wie häufig für Social TV?“; Skala von 1 (nie) bis 5 (sehr häufig); 0 = „besitze ich nicht“; Quelle: eigene Erhebung.
4.3 Plattformen: Wo wird Social TV genutzt?
Neben der technischen Ausstattung interessiert bei der Betrachtung der Nutzer deren Kenntnis
und Nutzung verschiedener Plattformen, über die Social TV ablaufen kann. Insgesamt ist die
Bekanntheit der abgefragten Plattformen sehr groß, was im Lead User-Umfeld kaum verwun-
dert. Am geläufigsten ist demnach Twitter (98%), knapp gefolgt von Facebook, E-Mail und
Instant Messenger (z. B. Skype). Einzige Ausnahme: Second-Screen-Apps wie Zapitano,
Wywy oder Couchfunk, die nur 57 Prozent der Befragten ein Begriff sind (vgl. Abbildung 3).
10
Abbildung 3: Kenntnis und Nutzung von Social-TV-Plattformen
N=409 (Social-TV-Lead User); Frage: „Bitte gib für jede Plattform an, wie häufig Du sie für Social TV nutzt“; Skala von 1 (nie) bis 5 (sehr häufig); 0 = „kenne ich nicht“; Quelle: eigene Erhebung.
Diese Ergebnisse zur Bekanntheit der einzelnen Plattformen spiegeln sich auch in der Nut-
zungshäufigkeit wider. Social Networking Sites erzielen die höchsten Werte, wobei Facebook
deutlich vor Twitter rangiert. Auch Internetforen wie IOFF und Instant Messaging Dienste
spielen eine wichtige Rolle. Second-Screen-Apps werden seltener genutzt. Auch die Commu-
nities der Sender (z. B. ProSiebenConnect) haben noch nicht die Verbreitung gefunden, die
man sich bei den Fernsehunternehmen wünschen würde. Weit abgeschlagen ist Google+: Die
Social Networking Site des Suchmaschinenanbieters hat sich in Deutschland bislang nur in
einem kleinen Zirkel von technikaffinen Experten durchsetzen können – die offenbar nur sehr
selten parallel zum Fernsehen schreiben.
4.4 Genres: Welche Inhalte finden besonderen Anklang?
Social TV-Nutzer tauschen sich prinzipiell zu allen Arten von Fernsehsendungen, die abge-
fragt wurden, aus. Es lassen sich aber Unterschiede zwischen den Genres ausmachen: Am
häufigsten sind die Nutzer bei Serien sowie bei Unterhaltungs- und Castingshows aktiv. Ge-
rade Castingshows besitzen ein hohes Aktivierungsniveau: Sie werden von den Nutzern zwar
relativ selten geschaut und rangieren auf den letzten Plätzen bei der Sehhäufigkeit von Fern-
sehsendungen. Werden sie aber eingeschaltet, findet während der Rezeption der zweithöchste
Austausch statt. Eher selten ist der soziale Austausch dagegen bei der Rezeption von Nach-
richten, Quizshows und Werbung (vgl. Tabelle 2).
11
Tabelle 2: Beliebtheit einzelner Genres für die Social-TV-Nutzung
Rang Genre Häufigkeit der Social-TV-Nutzung
1 Serien (Bsp.: Tatort, Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Friends, How I met your mother)
2,8
2 Castingshows (Bsp.: Voice of Germany, Das Supertalent, Germanys Next Topmodel)
2,7
3 Unterhaltungsshows (Bsp.: Wetten dass…?, Schlag den Raab)
2,7
4 Sport (Bsp.: Fußball-Übertragung, Olympische Spiele, Sportschau)
2,5
5 Politische Talkshows (Bsp.: Günther Jauch, Maybritt Illner, hart aber fair)
2,4
6 Reality-TV (Bsp.: Bauer sucht Frau, Das perfekte Dinner, Berlin Tag und Nacht, Mitten im Leben)
2,3
7 Filme (Bsp.: Skyfall, Titanic, Mit geradem Rücken) 2,3
8 Nachrichten/Information (Bsp.: Tagesschau, heute, Wetter) 2,1
9 Quizshows (Bsp.: Wer wird Millionär, Rette die Million, Das Quiz mit Jörg Pilawa)
1,8
10 Werbespots 1,4 N=409 (Social-TV-Lead User); Frage: „Wie häufig nutzt Du Social-TV-Angebote zu den hier aufgelisteten TV-Sendungen?“; Skala: 1=„nie“, 2=„selten“, 3=„gelegentlich“, 4=„häufig“, 5=„sehr häufig“; Quelle: eigene Dar-stellung.
Das jeweilige Sendungsformat hat auch einen Einfluss auf die genutzte Plattform – bei-
spielsweise aufgrund von strukturell-technischen oder inhaltlichen Faktoren, da etwa eine
bestimmte Fan-Community nur bei Facebook angetroffen werden kann, oder weil ein Aus-
tausch möglichst schnell in wenigen Zeichen erfolgen soll. Abbildung 4 zeigt die Ergebnisse
einer Korrelationsanalyse von Plattformnutzung und Genrepräferenz. Die Eignung einer Platt-
form für ein bestimmtes Genre ist durch einen Haken, der eine signifikante Korrelation zwi-
schen Plattform- und Genrenutzung (p<0.05) anzeigt, hervorgehoben.
12
Abbildung 4: Zusammenhang zwischen Genre und Plattformen
N=155 bis 389 (Social-TV-Lead User); Alle dargestellten Haken zeigen signifikante Korrelationen (p<0.05) an. Quelle: eigene Darstellung.
Zusammenfassend lassen sich drei Typen von Plattformen differenzieren: Zum einen gibt es
den offensichtlich für fast alle Genres populären Dienst Twitter, welcher für den Großteil der
abgefragten Formate – Castingshows, Politische Talkshows, Quizshows, Unterhaltungsshows,
Sport und Reality TV – eingesetzt wird und deswegen als der generalistische Genre-
Allrounder beschrieben werden kann. Es handelt sich bei den besonders stark mit dem Aus-
tausch über Twitter verbundenen Formaten vor allem um non-fiktionale Live-Sendungen mit
einem Erlebnischarakter, über die bevorzugt kurze, prägnante – bei Twitter maximal 140 Zei-
chen lange – Statusmeldungen abgegeben werden.
Als zweiten Typ von Social-TV-Plattformen lassen sich Facebook, Messenger und E-Mails
als die Fokussierten beschreiben. Jede dieser Plattformen weist zwar auch eine Nutzung für
mehrere, allerdings deutlich weniger unterschiedliche Genrearten als bei Twitter auf. Auffäl-
lig ist, dass diese drei Plattformen einen positiven Zusammenhang mit den fiktionalen, meist
anspruchsvolleren Genres Film und Serien verzeichnen, was bei Twitter nicht der Fall ist.
Messenger und E-Mails wiederum korrelieren auch mit Werbespots, wobei denkbar wäre,
dass in diesen Fällen die Werbung als „Auszeit“ gesehen wird, um Social-TV-
Kommunikation über das unterbrochene Programm zu betreiben. Für die Fokussierten schei-
nen die fiktiven Genres die Lücke zu sein, um gegen den Genre-Allrounder Twitter zu beste-
hen. Dies mag auch darin begründet sein, dass bei ihnen viel eher private Teilöffentlichkeiten
bis hin zu einzelnen Personen adressiert werden können, während Twitter-Kommunikation im
13
Grunde vor der gesamten Internetöffentlichkeit geschieht. Möglich ist, dass der hohe Grad an
Emotionalität, den Filme und Serien erzeugen können, zu einer privateren Form der Kommu-
nikation anregt.
Den dritten Typ der Social-TV-Plattformen stellen Internetforen als Spezialisten dar. Für sie
lässt sich eine verstärkte Nutzung nur für das Genre Nachrichten finden. Der Austausch über
Foren erscheint plausibel, da die Kommunikation über Nachrichtenformate potenziell größe-
ren Austauschbedarf produziert, als bei Diensten wie Facebook oder Twitter möglich bzw.
üblich ist. Zudem stellen Sendungen wie Tagesschau oder ZDFheute spezielle Plattformen für
den Austausch über aktuelle Nachrichtenthemen bereit.
5. Fazit und Ausblick
Die vorliegende Studie zeigt erstmals, wie deutsche Social-TV-Lead User sich heute während
des Fernsehens austauschen, welche Geräte und Plattformen sie dafür einsetzen und welche
Genres bevorzugt begleitet werden. Bisherige Untersuchungen haben vor allem auf die gene-
relle Social-TV-Nutzung innerhalb der Gesamtbevölkerung oder in der Population der Inter-
netnutzer abgestellt. Unsere Ergebnisse zu den ‚frühen Nutzern‘ informieren dagegen über
Trends und Entwicklungen, die in Zukunft auch in einem größeren Marktsegmenten relevant
werden können. Vor diesem Hintergrund diskutieren wir die Bedeutung der Ergebnisse für die
Marktteilnehmer und zeigen Anschlussstellen für weitere Forschung auf.
5.1 Handlungsoptionen für Marktteilnehmer
Social TV in Deutschland ist ein von Nutzerseite angetriebenes Phänomen. Das haben auch
die in diesem Beitrag aufgezeigten Ergebnisse zu Lead Usern einmal mehr verdeutlicht. So
sind es nicht die Plattformen der etablierten Fernsehunternehmen, die unter Lead Usern für
Social TV primär Einsatz finden. Weiterhin ist der Vorsprung der generalistischen Social
Networking Sites ungebrochen – ein Relikt aus Zeiten, als Fernsehsender den Nutzern noch
keine eigenständigen Angebote machten. Mit dieser Nutzerbasis versuchen Twitter und Face-
book zunehmend, die Kommunikation über TV-Inhalte zu einem eigenen Geschäftsmodell zu
entwickeln (vgl. exempl. Albergotti 2013). Fernsehsender helfen ihnen dabei, indem sie die
sozialen Netzwerke in ihre jeweiligen Apps und Websites integrieren. Sie verfolgen weiterhin
eine Kooperationsstrategie, obwohl eigentlich ein Konkurrenzverhältnis zu den sozialen
Netzwerken besteht. Die Fernsehunternehmen sollten daher Vor- und Nachteile dieser Strate-
gie kontinuierlich überprüfen. So lange externe Plattformen Teil dieser Strategie sind, ist zu-
14
dem zu beachten, dass Plattformen aus Sicht der Nutzer unterschiedliche Funktionen haben.
Nicht alle Genres funktionieren auf allen Plattformen: Während Twitter als Genre-Allrounder
gilt, ist Facebook stärker für fiktive Erzählformate geeignet.
Auch unter den hier betrachteten Lead Usern werden vor allem Second-Screen-Devices einge-
setzt. Smart TV spielt für den sozialen Austausch hingegen nur eine sehr untergeordnete Rol-
le. Hardwarehersteller am TV-Markt sollten diese Erkenntnisse als mögliches Signal dafür
deuten, die Entwicklung bedienfreundlicherer Geräte voranzutreiben oder auszutesten, in-
wieweit zusammen mit dem Fernseher Zweitgeräte vertrieben werden können. Es gilt, die
Hürden für die Nutzung gering zu halten. Eine hohe Usability und User Experience bedeutet
aber nicht automatisch, dass in der jungen Zielgruppe Nutzerinnen und Nutzer hinzugewon-
nen werden. Dagegen spricht, dass zwischen Nichtnutzung und Nutzung eher eine persönliche
als eine technische Hemmschwelle besteht.
Neue Zielgruppen können von Unternehmen am ehesten über eigenständige Plattformen an-
gesprochen werden, die exklusive Anreize setzen. Zwar entwickeln alle großen Privatsender
in Deutschland mittlerweile solche Plattformen. Speziell für den Austausch geschaffene Apps
erreichen aber selbst bei internet- und technikaffinen Lead Usern (noch) keine große Be-
kanntheit. Gerade Fernsehunternehmen sollten hier in Zukunft ihre Anstrengungen intensivie-
ren. Sie müssen einerseits im Wettbewerb um die Nutzer gegenüber den Internetunternehmen
aufholen und andererseits vermeiden, die Werbungtreibenden zu verprellen, indem etwa zu
hohe Social-TV-Aktivitäten während der Werbepausen angestoßen werden. Ein schwieriger
trade-off, den es zu managen gilt.
5.2 Hinweise für Anschlussforschung
Auch für die Wissenschaft gilt es weiterzuarbeiten: Wenn Social TV, wie von Praktikern und
Forschenden vorgeschlagen, einer der wichtigsten Trends in der Fernsehindustrie ist, sind
weitere Studien erforderlich, um das Phänomen im Hinblick auf die Marktteilnehmer und ihre
Angebote sowie auf die Nutzer und ihre Kommunikationsinhalte besser zu verstehen. Diese
Studie hat ein exploratives, nicht-repräsentatives Vorgehen gewählt, um ein möglichst diffe-
renziertes Bild der heutigen Social-TV-Lead User in Deutschland geben zu können. Aller-
dings müssen die in dieser Studie vorgestellten Daten aus stichprobentheoretischen Erwägun-
gen mit Vorsicht interpretiert werden. Zukünftige Untersuchungen können an der vorgenom-
menen Operationalisierung anschließen, sollten aber vorzugsweise mit repräsentativen Stich-
proben arbeiten. Des Weiteren könnten auch transnationale Befragungsstudien – z. B. im
15
Vergleich zum weiterentwickelten, angloamerikanischen Raum – fruchtbare Erkenntnisse
generieren. Ausgehend von den Forschungsergebnissen zum Zusammenhang von spezifischen
Genres und Plattformen erscheint es darüber hinaus sinnvoll, die Kommunikationsinhalte von
Social-TV-Aktivitäten stärker in den Blick zu nehmen.
Literaturverzeichnis
A.T. Kearney (Hrsg.) (2013): Social TV treibt Online-Werbeumsätze in die Höhe.
http://www.atkearney.de/communications-media-technology/ideas-insights/social-tv,
16.09.13.
Albergotti, R. (2013): Facebook Adds TV Partners Overseas. In: The Wallstreet Journal
[Online]. http://blogs.wsj.com/digits/2013/10/06/facebook-ads-tv-partners-overseas,
11.11.13.
anywab (Hrsg.) (2012): Second Screen One. Internetnutzer in Deutschland von 14 bis 49 Jah-
ren zur Internetnutzung vor dem Fernseher. Darmstadt.
Best, S./Breunig, C. (2011): Parallele und exklusive Mediennutzung. Ergebnisse auf Basis der
ARD/ZDF-Langzeitstudie Massenkommunikation. In: Media Perspektiven, 41. Jg.
(2011), S. 16-35.
BITKOM (Hrsg.) (2012): Pressemitteilung: Mit dem zweiten Bildschirm sieht man besser.
http://www.bitkom.org/de/presse/74532_73959.aspx, 16.09.13.
Bluefin Labs (Hrsg.) (2013): Super Bowl up 150% in Social TV, Sets New All-Time Record.
https://bluefinlabs.com/blog/2013/02/04/super-bowl-up-150-in-social-tv-sets-new-all-
time-record/, 16.09.13.
Buschow, C./Schneider, B./Carstensen, L./Heuer, M./Schoft, A. (2013): Social TV in
Deutschland – Rettet soziale Interaktion das lineare Fernsehen? In: MedienWirtschaft,
10. Jg. (2013), S. 24-32.
BVDW/OVK (Hrsg.) (2013): Mediascope 2012 – Fokus Multiscreen.
http://www.bvdw.org/medien/fokusreport-multiscreen?media=4980, 16.09.13.
Ducheneaut, N./Moore, R. J./Oehlberg, L./Thornton, J. D./Nickell, E. (2008): Social TV: De-
signing for distributed, sociable television viewing. In: International Journal of Human-
Computer Interaction, 24. Jg. (2008), S. 136-154. Doi: 10.1080/10447310701821426.
Fittkau & Maaß Consulting (Hrsg.) (2012): W3B Report. Smart TV – Das Fernsehen der Zu-
kunft? Hamburg.
16
Frees, B./van Eimeren, B. (2013): Multioptionales Fernsehen in digitalen Medienumgebun-
gen. In: Media Perspektiven, 43. Jg. (2013), S. 373-385.
Geerts, D. (2009): Sociability heuristics for interactive TV. Supporting the social uses of tele-
vision. Leuven.
Geerts, D./Cesar, P./Bulterman, D. (2008): The implications of program genres for the design
of social television systems. In: UXTV '08 (Hrsg.): Proceedings of the 1st international
conference on designing interactive user experiences for TV and video, New York 2008,
S. 71-80. Doi: 10.1145/1453805.1453822.
Häder, M. (2010). Empirische Sozialforschung: Eine Einführung (2. Aufl.). Wiesbaden 2010.
Hepp, A. (1998): Fernsehaneignung und Alltagsgespräche: Fernsehnutzung aus der Perspekti-
ve der Cultural Studies. Wiesbaden 1998.
Hippel, E. von (1986): Lead Users: A Source of Novel Product Concepts. In: Management
Science, 32. Jg. (1986), S. 791-805.
Hündgen, M./Argirakos, D. (2013): Lasst uns diskutieren! In: Gräßer, L./Riffi, A. (Hrsg.):
Einfach fernsehen? Zur Zukunft des Bewegtbildes. Düsseldorf, München 2013, S. 53-64.
IP Deutschland/TNS Emnid (Hrsg.) (2011): DigitalBarometer. Parallelnutzung: Interaktivität
beim Fernsehen. Dezember 2011. http://www.tns-
emnid.com/presse/pdf/presseinformationen/Digitalbarometer_Herbst_2011.pdf, 16.09.13.
Ipsos (Hrsg.) (2013): Kanzlerduell bei Twitter: Raab klarer Gewinner als Moderator.
http://www.ipsos.de/publikationen-und-presse/pressemitteilungen/2013/kanzlerduell-bei-
twitter-raab-klarer-gewinner-als-moderator, 16.09.13.
Karrer, K./Glaser, C./Clemens, C./Bruder, C. (2009): Technikaffinität erfassen – der Fragebo-
gen TA-EG. In: Lichtenstein, A./Stößel, C./Clemens, C. (Hrsg.): Der Mensch im Mittel-
punkt technischer Systeme. Düsseldorf 2009, S. 196-201.
Kerkau, F. (2013): Social TV-Blase schon geplatzt? Gastbeitrag von Florian Kerkau für
kress.de. http://www.goldmedia.com/blog/2013/10/social-tv-blase-schon-geplatzt-
gastbeitrag-von-florian-kerkau-fur-kress-de, 10.11.2013.
Kessler, B./Kupferschmitt, T. (2012): Fernsehen in Gemeinschaft. In: Media Perspektiven, 42.
Jg. (2012), S. 623-634.
Klemm, M. (2000): Zuschauerkommunikation. Formen und Funktionen der alltäglichen
kommunikativen Fernsehaneignung. Frankfurt am Main 2000.
17
König, K./Benninghoff, A./Prosch, M. (2013): Social TV als Chance für neue Geschäfts-
modelle mit ePace am Beispiel von ProSiebenSat.1. In: Heinemann, G./Haug,
K./Gehrckens, M. (Hrsg.): Digitalisierung des Handels mit ePace, Wiesbaden 2013, S.
201-212.
Li, C./Bernoff, J. (2008): Groundswell: Winning in a World Transformed by Social Technol-
ogies. Boston.
Morley, D. (1986): Family television. Cultural power and domestic leisure. London 1986.
Roy, D. (2013): Television's future has a social soundtrack. In: Harvard Business Review,
Blog Network. http://blogs.hbr.org/cs/2013/03/televisions_future_has_a_socia.html,
16.09.13.
Schneider, B./Buschow, C. (2013): Fernsehen trifft Social Media. Was Social TV für Produk-
tionsunternehmen bedeutet. In: Medienproduktion – Online Zeitschrift für Wissenschaft
und Praxis, o. J. (2013), S. 7-9. http://www2.tu-
ilmenau.de/zsmp/fernsehen_trifft_social_media_schneider_buschow, 10.11.13.
Strippel, C. (2013): Das soziale Fernsehen. Formen, Chancen und Herausforderungen. In:
ALM (Hrsg.): Programmbericht 2012. Fernsehen in Deutschland. Programmforschung
und Programmdiskurs, Berlin 2013, S. 193-197.
TNS Infratest (Hrsg.) (2013): TNS Convergence Monitor 2013. München/Bielefeld.
van Eimeren, B./Frees, B. (2013): Rasanter Anstieg des Internetkonsums – Onliner fast drei
Stunden täglich im Netz. In: Media Perspektiven, 43. Jg. (2013), S. 358-372.
Zubayr, C./Gerhard, H. (2013): Tendenzen im Zuschauerverhalten. In: Media Perspektiven,
43. Jg. (2013), S. 130-142.
![Page 1: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/13.jpg)
![Page 14: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/14.jpg)
![Page 15: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/15.jpg)
![Page 16: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/16.jpg)
![Page 17: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/17.jpg)
![Page 18: Wer nutzt Social TV? Die Nutzer als Treiber sozialer Interaktion mit Fernsehinhalten [Who is using social TV? Users as promoters of social interaction with television content]](https://reader037.fdokumen.com/reader037/viewer/2023012813/631bc0ca93f371de19011b9c/html5/thumbnails/18.jpg)





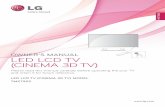
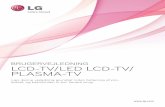

![Social TV in Deutschland – Rettet soziale Interaktion das lineare Fernsehen? [Social TV in Germany - Is linear television saved by social interaction?]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631bc14fa906b217b9069e5b/social-tv-in-deutschland-rettet-soziale-interaktion-das-lineare-fernsehen-social.jpg)