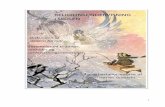Wahrheit, Begründbarkeit und Fallibilität: Ein Beitrag zur Diskussion epistemischer...
Transcript of Wahrheit, Begründbarkeit und Fallibilität: Ein Beitrag zur Diskussion epistemischer...
Boris Rähme Wahrheit, Begründbarkeit und Fallibilität
Ein Beitrag zur Diskussion epistemischer Wahrheitskonzeptionen
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
EPISTEMISCHE STUDIEN Schriften zur Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie
Herausgegeben von / Edited by
Michael Esfeld • Stephan Hartmann • Albert Newen
Band 18 / Volume 18
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
Boris Rähme
Wahrheit, Begründbarkeit
und Fallibilität
Ein Beitrag zur Diskussion epistemischer Wahrheitskonzeptionen
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
Bibliographic information published by Die Deutsche Bibliothek Die Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliographie;
detailed bibliographic data is available in the Internet at http://dnb.ddb.de
D 188
North and South America by
Transaction Books Rutgers University
Piscataway, NJ 08854-8042 [email protected]
United Kingdom, Ire, Iceland, Turkey, Malta, Portugal by Gazelle Books Services Limited
White Cross Mills Hightown
LANCASTER, LA1 4XS [email protected]
Livraison pour la France et la Belgique: Librairie Philosophique J.Vrin
6, place de la Sorbonne ; F-75005 PARIS Tel. +33 (0)1 43 54 03 47 ; Fax +33 (0)1 43 54 48 18
www.vrin.fr
2010 ontos verlag P.O. Box 15 41, D-63133 Heusenstamm
www.ontosverlag.com
ISBN 978-3-86838-088-0
2010
No part of this book may be reproduced, stored in retrieval systems or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilming, recording or otherwise
without written permission from the Publisher, with the exception of any material supplied specifically for the purpose of being entered and executed on a computer system, for exclusive use of the purchaser of the work
Printed on acid-free paper
ISO-Norm 970-6 FSC-certified (Forest Stewardship Council)
This hardcover binding meets the International Library standard
Printed in Germany by Strauss GmbH
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
Für Valentina, Ute und Gerd
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
Inhalt
Vorwort ........................................................................................................7 Einleitung .....................................................................................................9 I. ‚Wahrheit‘ und ‚Begründung‘ als normative Begriffe ............................ 17
I.1 Behauptungshandlungen und Gültigkeitsansprüche .......................... 23 I.2 Einige Normen für Behauptungshandlungen ..................................... 36 I.3 Deflationistische Abwiegelung? ........................................................ 46
I.3.1 Deflationistische Thesen ............................................................. 48 I.3.2 Ein Argument gegen den wahrheitstheoretischen Deflationismus ............................................................................ 66
I.4 Fallibilismus ohne Wahrheit? ............................................................ 73 I.5 Gründe haben, geben, zuschreiben und bewerten .............................. 82
II. Fallibilität und Fallibilismus .................................................................. 95 II.1 Das Problem der Formulierung des Fallibilismus ........................... 100
II.1.1 Fallibilismus und möglicher Irrtum .......................................... 107 II.1.2 Fallibilismus und logische Folgebeziehung .............................. 117 II.1.3 Fallibilismus und epistemische Gewissheit .............................. 124 II.1.4 Fallibilismus und epistemisch wahrheitsgarantierende Begründung ............................................................................... 134
II.2 Ist die ‚Selbstanwendung‘ des Fallibilismus widersprüchlich? Zu Apels Kritik des uneingeschränkten Fallibilismus ........................... 140
III. Elemente epistemischer Wahrheitskonzeptionen am Beispiel der Konsenstheorie von Peirce ....................................................................... 147
III.1 Zur Standarddeutung der Peirceschen Konsenstheorie ................. 148 III.2 Peirces epistemische Wahrheitsäquivalenz ................................... 156 III.3 Idealisierungen und kontrafaktische Annahmen ........................... 168 III.4 Faktische Erkennbarkeit ................................................................ 184
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
IV. Epistemische Wahrheitsäquivalenzen als Begriffsdefinitionen? ....... 199
IV.1 Wahrheit, Verifikation und Erkennbarkeit ................................... 200 IV.2 Wahrheit und Kohärenz ................................................................ 202 IV.3 Wahrheit und Begründbarkeit unter idealen epistemischen Bedingungen ......................................................................................... 212 IV.4 Wahrheit und Konsens .................................................................. 221
IV.4.1 Konsens der Forschergemeinschaft – Peirce .......................... 222 IV.4.2 Konsens und ideale Sprechsituation – Habermas ................... 225 IV.4.3 Konsens und ideale Argumentationsgemeinschaft – Apel ..... 233
V. Epistemische Regulative und Transzendenzthesen ............................. 247
V.1 Regulative ...................................................................................... 253 V.2 Transzendenzthesen ....................................................................... 263 V.3 Fitchs Argument und das ‚Paradox of Knowability‘ ...................... 276 V.4 Was zeigt Fitchs Argument? .......................................................... 288 V.5 Begründete Behauptbarkeit, Behauptbarkeit und Verstehbarkeit .. 295 V.6 Lassen sich epistemische Transzendenzthesen begründen? ........... 308
VI. Ist Wahrheit eine regulative Idee? Zwei Einwände gegen die transzendentalpragmatische Konsenstheorie ........................................... 319
VI.1 Zum Begriff der regulativen Idee in der „Kritik der reinen Vernunft“ .............................................................................................. 322 VI.2 Apels Rekurs auf regulative Ideen und Wellmers Kritik .............. 327 VI.3 Wahrheit ist keine regulative Idee ................................................ 337 VI.4 Apels Postulat der Selbstanwendbarkeit der Konsenstheorie und das Problem des konditionalen Fehlschlusses ................................ 344
VII. Resümee ........................................................................................... 357 VII. Literatur ............................................................................................ 367
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:06
Vorwort
Ursprünglich hatte ich mit dieser Arbeit das theoretische Ziel, die hinter epistemischen Wahrheitskonzeptionen stehenden Grundgedanken zu ver-teidigen und zu entfalten. Vor allem wollte ich die These, dass manche wahren Aussagen prinzipiell nicht als wahr erkannt werden können, als falsch oder sogar als sinnlos erweisen. Im Laufe des Nachdenkens über diese Dinge aber haben die Einwände gegen das Projekt epistemischer Wahrheitstheorien die Überhand gewonnen. Die meisten dieser Einwände laufen auf den folgenden, für sich betrachtet recht unspektakulären, Punkt hinaus: Man kann mit guten Gründen die These vertreten, dass es Aussa-gen gibt, für die zwar niemand auf konsistente Weise einen Wahrheitsan-spruch erheben kann, die aber trotzdem wahr sein mögen, und – dies ist ein wichtiger Zusatz – dabei die Frage nach konkreten Beispielen für sol-che Aussagen auf ganz und gar legitime Weise unbeantwortet lassen. So ist mir dieser Text, der doch eigentlich eine Verteidigung und Entfaltung der Grundgedanken epistemischer Wahrheitskonzeptionen werden sollte, in weiten Teilen unter der Hand zu einer Kritik geraten.
Mein besonderer Dank gilt Holm Tetens und Gregor Betz, den beiden Gutachtern dieser Arbeit. Auch bei Jens Peter Brune, Sven Rosenkranz, Albrecht Wellmer und Micha H. Werner bedanke ich mich für kontroverse Diskussionen und konstruktive Kritik. Last but not least, danke ich Micha-el Esfeld, Stephan Hartmann und Albert Newen dafür, dass sie diesen Text in die Reihe „Epistemische Studien“ aufgenommen haben. Trento, im Juli 2010
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
Einleitung
Im Zentrum dieser Arbeit steht eine Auseinandersetzung mit epistemischen Wahrheitskonzeptionen. Proponenten solcher Ansätze der Wahrheitstheo-rie – etwa C. S. Peirce, M. Dummett, C. Wright, K.-O. Apel, J. Habermas und H. Putnam1 – erheben den Anspruch, die Frage nach der Bedeutung von ‚Wahrheit‘ im Rekurs auf epistemische, also das Erkennen, Begründen und rationale Überzeugtsein betreffende Konzepte wie ‚Verifizierbarkeit‘, ‚Kohärenz‘, ‚Begründbarkeit‘ oder auch ‚argumentative Konsenswürdig-keit‘ beantworten zu können. Ferner behaupten sie, dass die Annahme, es könne schlechthin unerkennbare und unbegründbare Wahrheiten geben, al-so wahre Aussagen, die nicht allein de facto, sondern prinzipiell nicht als wahr erkannt oder doch zumindest mit Gründen behauptet werden können, falsch oder sogar sinnlos ist.
Im Hintergrund der damit vorläufig charakterisierten Kernthesen epi-stemischer Wahrheitskonzeptionen steht ein spezifisches Verständnis der Frage nach einer angemessenen philosophischen Erläuterung des Wahr-heitsbegriffs. Dieses Verständnis lässt sich ausgehend von der Tatsache er-läutern, dass wir den Wahrheitsbegriff als normatives Konzept in der Be-wertung von Überzeugungen und Behauptungen verwenden. Ob wir eine Aussage zu Recht behaupten oder sie uns zu Recht als Gehalt einer Mei-nung zueigen machen, das hängt unter anderem davon ab, ob diese Aussa-ge wahr ist. Epistemischen Wahrheitskonzeptionen liegt nun – zwar nicht immer explizit, aber doch der Sache nach – die folgende Überlegung zu-grunde: Wenn es zutrifft, dass der Wahrheitsbegriff in die Bestimmung der normativen Korrektheitsbedingungen von Behauptungen und Überzeugun-gen eingeht, dann muss er mit einer Erläuterung versehen werden, die es erlaubt, den Umstand, dass wir die Einschätzung des Berechtigungsstatus einer gegebenen Behauptung oder Überzeugung B unter anderem von un-serer Einschätzung des Wahrheitswerts des propositionalen Gehalts von B abhängig machen, als einen rationalen Zug unserer diskursiven und epi-stemischen Praxis auszuzeichnen. Akteure können sich in ihren Handlun-
1 Sowohl Putnam als auch Habermas haben sich von ihren ehemaligen epistemisch-
wahrheitstheoretischen Ansätzen distanziert. Darauf komme ich zurück.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
10 Einleitung gen um die Erfüllung einer Norm N aber nur dann rationalerweise bemü-hen – und sie können die Handlungen anderer für die Erfüllung oder Nichterfüllung von N nur dann rationalerweise würdigen oder kritisieren –, wenn es ihnen möglich ist, festzustellen beziehungsweise zu erkennen, ob N erfüllt ist oder nicht. Wäre Wahrheit unerkennbar, dann wäre ein we-sentlicher Aspekt unserer diskursiven und epistemischen Praxis nicht mehr als rational explizierbar und verstehbar: das Bewerten von Überzeugungen und Behauptungen entlang der Frage, ob ihre jeweiligen propositionalen Gehalte wahr oder falsch sind. Insofern liefert der Hinweis darauf, dass wir den Wahrheitsbegriff normativ verwenden, prima facie einen Grund für die von Proponenten epistemischer Ansätze vertretene These, dass Wahrheit als erkennbar gedacht werden muss.
Im Rekurs auf das diskurspragmatische Konzept des Gültigkeitsan-spruchs wird in Kapitel I zunächst die für epistemische Wahrheitskonzep-tionen grundlegende Annahme der normativen Relevanz des Wahrheitsbe-griffs für die epistemische und diskursive Praxis expliziert. Sodann diskutiere ich die von Proponenten des wahrheitstheoretischen Deflationis-mus und – aus anderen Gründen – von Richard Rorty aufgestellte Behaup-tung, dass dem Wahrheitsbegriff keine normative Relevanz zukommt. Der Deflationismus kann sich dabei auf eine einleuchtende These stützen: Die in der Diskussion epistemischer Wahrheitstheorien übliche Rede von der Erkennbarkeit oder Nichterkennbarkeit der Wahrheit darf nicht verdecken, dass zum Beispiel die Frage ‚Ist es wahr, dass Caesar eine Erkältung hatte, während er den Rubikon überquerte?‘ und die Frage ‚Hatte Caesar eine Erkältung, während er den Rubikon überquerte?‘ nicht zwei verschiedene Fragen sind, sondern ein und dieselbe. Sie unterscheiden sich allenfalls hinsichtlich ihrer konversationellen Implikaturen2: Ein Sprecher, der die erste Frage in einem gegebenen Gesprächskontext stellt, legt damit norma-lerweise nahe, dass die Aussage, dass Caesar eine Erkältung hatte, wäh-rend er den Rubikon überquerte, zuvor bereits in das Gespräch eingebracht worden ist. Mit der Äußerung der zweiten Frage ist dagegen keine solche Implikatur verbunden. Dieser konversationelle Unterschied ändert aber nichts daran, dass für diese beiden Fragen und jedes nach ihrem Muster
2 Zum Konzept der conversational implicature, auf das der Deflationismus in die-
sem Zusammenhang zurückgreifen kann, vgl. Grice 1989, S. 22-57.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
Einleitung 11 formulierbare Fragenpaar gilt: Die erste ist genau dann beantwortet, wenn die zweite beantwortet ist. In diesem Sinn handelt es sich, darauf weisen Deflationisten zu Recht hin, bei den beiden ihrem Wortlaut nach verschie-denen Fragen um ein und dieselbe Frage. Nach der Erkennbarkeit oder Un-erkennbarkeit der Wahrheit von Aussagen zu fragen, ist dasselbe wie nach der Erkennbarkeit oder Unerkennbarkeit dessen zu fragen, worüber wir mit diesen Aussagen sprechen. So betrachtet, scheint die Diskussion über die These der Erkennbarkeit der Wahrheit gleichsam durch den Wahrheitsbe-griff gekürzt werden zu können. Deflationisten behaupten nun, dass das-selbe auch für prima facie normative Verwendungen des Wahrheitsbegriffs in der Bewertung des Berechtigungsstatus von Überzeugungen und Be-hauptungshandlungen gilt. Diese Behauptung ist aber, wie sich in der Dis-kussion des Deflationismus zeigen wird, ungerechtfertigt.
Rorty bietet eine andere Begründung für die These an, dass man Wahrheit nicht als eine für den Berechtigungsstatus von Behauptungen und Überzeugungen normativ relevante Eigenschaft von Aussagen ansehen sollte. In einigen seiner späten Texte behauptet er, dass wahre Aussagen nicht als wahr erkannt werden können, und schließt dann von dieser Be-hauptung aus konsequenterweise auf die normative Irrelevanz des Wahr-heitswerts einer gegebenen Aussage p für den Berechtigungsstatus einer jeden Behauptung von p.3 Was zähle, sei hier allein die Antwort auf die Frage, ob p begründet ist oder nicht, und der Begründungsstatus einer ge-gebenen Aussage p lasse sich – im Gegensatz zu dem Wahrheitswert von p – sehr einfach daran ablesen, ob p die Zustimmung aller oder doch der meisten derer findet, an die eine Behauptung von p jeweils de facto adres-siert ist. Diese allein auf faktische Konsensfähigkeit in einem Redekontext bezogene, also strikt kontextrelative Erläuterung der Bedingungen, unter denen Behauptungen berechtigt sind, lässt aber keinen Raum für eine Er-klärung der Tatsache, dass wir eine Behauptung B selbst dann noch als möglicherweise unberechtigt und korrekturbedürftig behandeln, wenn wir selbst und auch alle anderen, an die B de facto adressiert ist, B auf der Ba-sis geteilter Gründe als berechtigt anerkennen. Mit anderen Worten: Sie ist unvereinbar mit einem fallibilistischen Verständnis von Behauptungshand-lungen und Überzeugungen. Um gegenüber Behauptungen von Aussagen
3 Vgl. etwa Rorty 1998a.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
12 Einleitung selbst dann noch einen Fallibilitätsvorbehalt aufrecht erhalten zu können, wenn sie in dem jeweiligen Kontext, in dem sie aufgestellt werden, allge-meine Zustimmung finden, ist die Bezugnahme auf einen kontexttranszen-dierenden Gültigkeitssinn von Aussagen notwendig, und Wahrheit liefert genau diesen normativen Bezugspunkt.
Die Wahrheit oder Falschheit einer gegebenen Aussage p ist in den weitaus meisten Fällen unabhängig davon, ob p de facto von irgendjeman-dem (mit Gründen) für wahr oder für falsch gehalten wird. Proponenten epistemischer Wahrheitskonzeptionen und solche nicht-epistemischer An-sätze – etwa Proponenten von Korrespondenztheorien der Wahrheit – stim-men darin überein, dass diese These ein Element unseres vortheoretischen Verständnisses des Wahrheitsbegriffs zum Ausdruck bringt, dem eine ak-zeptable philosophische Erläuterung von ‚Wahrheit‘ Rechnung tragen muss. Um dieser Adäquatheitsbedingung gerecht zu werden, bringen epi-stemische Wahrheitstheorien bestimmte Idealisierungen ins Spiel. Sie er-läutern den Sinn der Rede von Wahrheit in Begriffen idealer Verifizierbar-keit, Kohärenz, Begründbarkeit oder Konsenswürdigkeit. Die Frage nun, wie die Idealisierungen genau zu verstehen sind, auf die in epistemischen Erläuterungen des Wahrheitsbegriffs jeweils zurückgegriffen wird, mar-kiert eines der zentralen Deutungsprobleme in Bezug auf Konsens-, Kohä-renz- und Verifizierbarkeitstheorien. Einerseits soll mit solchen Theorien ein interner Zusammenhang zwischen Wahrheit und Begründbarkeit auf-gedeckt werden, der es dann erlaubt, ‚Wahrheit‘ sinnvollerweise als einen für unsere tatsächliche und nicht-ideale epistemische Praxis normativ rele-vanten Gültigkeitsbegriff anzusehen, andererseits verwenden diese Theo-rien dabei aber Konzepte idealer Begründbarkeit, Konsenswürdigkeit oder Kohärenz, bei denen fraglich ist, ob sie mit unserer realen Begründungs-praxis überhaupt noch in Verbindung gebracht werden können. Donald Davidson vertritt in diesem Zusammenhang die These, dass epistemische Wahrheitskonzeptionen mit einem Dilemma konfrontiert sind:
„[I]f the conditions under which someone is ideally justified in asserting some-thing were spelled out, it would be apparent either that those conditions allow the possibility of error or that they are so ideal as to make no use of the intended connection with human abilities.“4
4 Davidson 1990, S. 307. Vgl. auch Alston 1996, S. 228, und Williams 1996, S. 236.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
Einleitung 13 Davidson bezieht sich hier auf die von Hilary Putnam in den 1980er Jahren bevorzugte Erläuterung von ‚Wahrheit‘ im Rekurs auf einen Begriff be-gründeter Behauptbarkeit unter idealen epistemischen Bedingungen5, die Pointe seiner Kritik lässt sich aber im Blick auf epistemische Wahrheits-konzeptionen insgesamt generalisieren: Entweder ist der von einer episte-mischen Wahrheitstheorie verwendete Begriff idealer Begründung verein-bar mit der These, dass auch noch eine ideal begründete Aussage falsch sein könnte, und eignet sich daher nicht zur Explikation von ‚Wahrheit‘; oder er schließt die Möglichkeit, dass auch noch eine ideal begründete Aussage falsch sein könnte, aus, muss dann aber mit derart starken Ideali-sierungen verbunden sein, dass er jeglichen Zusammenhang mit unserer tatsächlichen Begründungspraxis einbüßt. Im letzteren Fall wird aber zu-gleich fraglich, ob wir ein solches Konzept idealer Begründung überhaupt hinreichend verstehen, um ihm wahrheitstheoretische Explikationsleistun-gen zumuten zu können.6 Die Stichhaltigkeit von Davidsons Einwand steht allerdings unter der Voraussetzung, dass allein ein Konzept infallibler Be-gründung hinreichend anspruchsvoll wäre, um in einer epistemischen Er-läuterung des Wahrheitsbegriffs theoretische Explikationsarbeit zu leisten. In Kapitel II schlage ich eine Deutung des Prädikats ‚fallibel‘ zum einen und des erkenntnistheoretischen Fallibilismus zum anderen vor, die es er-laubt, die für epistemische Wahrheitskonzeptionen zentrale These, dass ei-ne Aussage, die unter idealen epistemischen Bedingungen begründbar wä-re, nicht falsch sein kann, begrifflich von der These zu entkoppeln, dass Begründungen unter idealen epistemischen Bedingungen infallibel wären.
Nach den die Diskussion epistemischer Wahrheitstheorien selbst vor-bereitenden Kapiteln I und II werden in Kapitel III sodann am Beispiel von Peirces Konsenstheorie zentrale Elemente und Thesen rekonstruiert, die sich, verschieden variiert, in den epistemischen Wahrheitskonzeptionen von Putnam, Habermas, Apel und – mit Einschränkungen – Wright sowie Dummett wiederfinden lassen: der Rekurs auf epistemische Idealisierun-gen, die Verwendung von kontrafaktischen Konditionalen sowie die Diffe-renzierung zwischen faktischem Erkanntsein und prinzipieller Erkennbar-
5 Vgl. etwa Putnam 1981, S. 49 und S. 55. 6 Vgl. in diesem Zusammenhang Williams 1996, S. 236: „[T]he main problem with
epistemic accounts of truth is to understand them.“
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
14 Einleitung keit. Peirce behauptet ferner, dass alle wahren Aussagen im Prinzip auch als wahr erkannt werden können. Dem entsprechen bei den anderen ge-nannten Proponenten epistemischer Wahrheitskonzeptionen Behauptungen von Aussagen der folgenden Art: Alle wahren Propositionen können im Prinzip Gehalt von Wissen sein; jede wahre Aussage ist prinzipiell be-gründbar; wenn eine Aussage wahr ist, dann ist es möglich, sie rein argu-mentativ als konsenswürdig zu erweisen. Ich nenne Thesen dieser Art, in denen jeweils die Möglichkeit eines bestimmten epistemischen Status als notwendige Bedingung für die Wahrheit von Aussagen ins Spiel gebracht wird, epistemische Regulative.7 Darüber hinaus wird der Wahrheitsbegriff in nahezu allen epistemischen Ansätzen mit Hilfe von Äquivalenzaussagen erläutert, die sich zwar von Theorie zu Theorie inhaltlich voneinander un-terscheiden, aber eine gemeinsame Struktur aufweisen8:
Die Aussage p ist wahr genau dann, wenn gilt: Wenn bestimmte epistemisch relevante Bedingungen gegeben wären und wir unter diesen Bedingungen prüfen würden, ob es der Fall ist, dass p, dann würden wir zu dem Ergebnis gelangen, dass p.
Äquivalenzaussagen dieser Art, in denen die Rede von ‚bestimmten‘ epi-stemisch relevanten Bedingungen durch spezifische Formulierungen kon-kretisiert wird, bezeichne ich als epistemische Wahrheitsäquivalenzen.
Epistemische Wahrheitskonzeptionen werden oftmals unter der Frage-stellung diskutiert, ob sie Definitionen oder doch zumindest zirkelfreie be-griffliche Erläuterungen von ‚Wahrheit‘ zu liefern imstande sind. Auch scheinen manche ihrer Proponenten jedenfalls implizit genau diesen An-spruch mit den von ihnen angebotenen Wahrheitsäquivalenzen zu verbin-den. Wenn sich Proponenten und Opponenten epistemischer Wahrheits-konzeptionen aber erst einmal darin einig sind, der philosophische Anspruch dieser Ansätze bestehe darin, den Wahrheitsbegriff im Rekurs
7 In der englischsprachigen Diskussion ist in diesem Zusammenhang der von Cris-
pin Wright eingeführte Ausdruck ‚epistemic constraint‘ gebräuchlich. Vgl. etwa Wright 1992, S. 41 und passim.
8 Wrights Überlegungen zur Frage, ob das Prädikat ‚superassertible‘ als ein Wahr-heitsprädikat verstanden werden kann, und die von Dummett vertretene These, dass eine Aussage genau dann wahr ist, wenn es möglich ist, sie als wahr zu er-kennen, stellen hier Ausnahmen dar (vgl. dazu die Abschnitte III.4 und IV.1).
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07
Einleitung 15 auf epistemische Konzepte zu definieren, dann ist der argumentative Streit schon zu Gunsten der Kritiker entschieden. Letztere können dann nämlich schlicht darauf hinweisen, dass jeder Versuch einer solchen Definition von ‚Wahrheit‘ nur zu zirkulären Definitionsangeboten führen kann, weil die jeweils ins Spiel gebrachten epistemischen Konzepte selbst wiederum nur im Rekurs auf den Wahrheitsbegriff erläutert werden können. In Kapitel IV wird dargestellt, inwiefern epistemische Erläuterungen des Wahrheits-begriffs zirkulär sind – im Blick auf eine Reihe von Thesen, in denen der Wahrheitsbegriff mit jeweils mehr oder weniger stark idealisierten episte-mischen Konzepten von Kohärenz, Begründbarkeit, Verifizierbarkeit, be-gründeter Behauptbarkeit (‚warranted assertibility‘) und argumentativer Konsenswürdigkeit in Zusammenhang gebracht wird. Dies gibt mir zu-gleich die Gelegenheit, einige epistemische Wahrheitsäquivalenzen einzu-führen, die sich ihrer Sache nach in Texten von Bradley, Joachim und Blanshard sowie Putnam, Habermas und Apel finden und ihre Struktur mit Peirces konsenstheoretischer Wahrheitsäquivalenz teilen.
In Kapitel V rekonstruiere ich zunächst eine Reihe von unterschied-lich anspruchsvollen epistemischen Regulativen, um diese sodann ausge-hend von einem Argument Frederic B. Fitchs zu diskutieren. Fitchs Argu-ment wird von vielen Kritikern epistemischer Wahrheitskonzeptionen als konklusiver Einwand gegen die These der prinzipiellen Erkennbarkeit je-der wahren Aussage als wahr bewertet. In der Diskussion wird sich zeigen, dass jedenfalls pauschale epistemische Regulative, also vollkommen gene-relle Thesen, mit denen die Erkennbarkeit oder auch die Begründbarkeit schlechthin aller wahren Proposition behauptet wird, nicht haltbar sind. Nach einer Kritik der von Karl-Otto Apel vertretenen These, Wahrheit sei eine regulative Idee, mit der in Kapitel VI die Diskussion der Frage nach dem angemessenen Verständnis der mit epistemischen Wahrheitstheorien ins Spiel gebrachten Idealisierungen wieder aufgenommen wird, argumen-tiere ich abschließend dafür, dass epistemische Regulative nicht als gene-relle wahrheitstheoretische Thesen formuliert, sondern als Explikationen von Rationalitätspräsuppositionen der Behauptungs- und Begründungspra-xis aufgefasst werden sollten.
Bereitgestellt von | Freie Universität BerlinAngemeldet | 130.133.8.114
Heruntergeladen am | 15.06.13 09:07