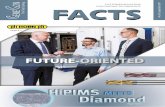Tumor type and stage-oriented surgical concept for thyroid carcinoma
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Tumor type and stage-oriented surgical concept for thyroid carcinoma
Onkologe 2010 · 16:666–677DOI 10.1007/s00761-010-1868-9© Springer-Verlag 2010
H. Dralle · K. Lorenz · A. Machens · M. Brauckhoff · P. Nguyen ThanhKlinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Universitätsklinikum Halle, Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale
Tumortyp- und tumorstadien-orientiertes chirurgisches Konzept bei Karzinomen der Schilddrüse
Leitthema
Die chirurgische Therapie der Schild-drüsenkarzinome hat in den letzten Jahren durch den zunehmenden Nach-weis von Frühkarzinomen, die An-erkennung der Bedeutung der lokore-gionären Lymphknotendissektion im Rahmen eines kurativen Therapiean-satzes und die Entwicklung eines ver-feinerten Nachsorgekonzepts (Thy-reoglobulinbestimmung und Radio-jodtherapie unter exogener TSH-Sti-mulation bei differenzierten Karzino-men) weltweit erhöhte Aufmerksam-keit gefunden. Die chirurgische Thera-pie insbesondere der Frühkarzinome ist jedoch noch immer durch einen be-trächtlichen Anteil postoperativer Kar-zinomzufallsbefunde mit der Notwen-digkeit der Komplettierungsoperation bei primär wegen benigner Schild-drüsenerkrankung operierten Patien-ten gekennzeichnet. Durch verbesser-te prä- und intraoperative Diagnos-tik, aber auch bessere Differenzierung der Low-Risk-Tumoren von High-Risk-Tumoren kann die Rate der mit erhöh-tem Komplikationsrisiko einhergehen-den Komplettierungsoperationen oh-ne Radikalitätsverlust gesenkt wer-den. Bei High-Risk-Tumoren mit lym-phogener Ausbreitung (papilläres und medulläres Karzinom) führt die Kom-partmentresektion zu einem deutlich verbesserten rezidivfreien Überleben. Auch bei lokal fortgeschrittenen Karzi-nomen können chirurgische Behand-lungsverfahren im Sinne des Konzepts einer Therapie des regionalen Schritt-machers wesentlich zur Senkung loka-ler Tumorkomplikationen beitragen.
Die Verbesserung und breitere Anwen-dung moderner bildgebender Verfahren, insbesondere des Ultraschalls, hat nicht nur zu einer vermehrten Inzidenz frü-her Schilddrüsenkarzinome geführt [9], sondern auch die Nachweisschwelle lo-koregionärer Karzinomrezidive deutlich gesenkt. Zur Vermeidung sowohl einer Untertherapie als auch einer Überthera-pie ist daher aus chirurgisch-onkologi-scher Sicht die Frage von Bedeutung, bei welchen Karzinomen zur Rezidivvermei-dung eine radikale Primärtumorchirurgie (Thyreoidektomie und Lymphknotendis-sektion) erforderlich ist und bei welchen Karzinomtypen und -stadien eine einge-schränkte Resektion ohne Lymphknoten-dissektion ausreichend ist. Bei lokal fort-geschrittenen und metastasierten Schild-drüsenkarzinomen ist heute ein „multidi-sciplinary approach“ „standard of care“. Dem Konzept der Chirurgie des Schritt-machers kommt hierbei ein zentraler Stel-lenwert zu.
Chirurgische Primärtherapie
Aufgrund der tumorbiologischen Beson-derheiten der 5 Haupttypen der Schild-drüsenkarzinome (papillär, PTC; folliku-lär, FTC; wenig differenziert, PDTC; un-differenziert, UTC; medullär, MTC; [11]) und der hiermit in Verbindung stehenden unterschiedlichen adjuvanten (Radiojod-therapie) bzw. additiven (Radiojodthera-pie, externe Strahlentherapie, Chemothe-rapie) Therapieverfahren steht der primä-re Karzinomtyp im Mittelpunkt der chi-rurgischen Therapiestratifizierung. Ab-hängig vom primären Karzinomtyp be-
stimmt das Ergebnis der lokalen und ggf. distanten Tumorausbreitung das konkre-te Resektionsausmaß. Inoperabilität oder Irresektabilität stellen seltene Ausnah-men bei Patienten mit Schilddrüsenkar-zinomen dar, sodass zur Beseitigung lo-kaler Tumorkomplikationen oder im Fal-le differenzierter Karzinome zur Ermögli-chung der Radiojodtherapie auch oder ge-rade bei Vorliegen von Fernmetastasen in der Regel eine adäquate Primärtumorchi-rurgie indiziert ist.
Klassifikation der lokoregionalen Lymphknoten beim Schilddrüsenkarzinom
Aufgrund der in der Regel potenziell ku-rativen Intention der Lymphknotendis-sektion v. a. bei papillären und medullären Karzinomen wäre zur besseren Vergleich-barkeit von Studienergebnissen, aber auch zur Vereinheitlichung der Terminologie der Lymphknotendissektion eine inter-national einheitliche Klassifizierung des lokoregionären Lymphknotensystems der Schilddrüse wünschenswert. Derzeit existieren international 4 publizierte Klas-sifikationen, die als Gemeinsamkeit die grundsätzliche anatomische Differenzie-rung des beidseits zentralen von den late-ralen Kompartments aufweisen, sich aber hinsichtlich der anatomischen Details der Kompartmentgrenzen unterscheiden. Da-rüber hinaus ist nur durch die Kompart-mentklassifikation [15, 16] das mediasti-nale Kompartment als anatomischer Be-standteil des lokoregionären Lymphkno-tensystems definiert:
666 | Der Onkologe 7 · 2010
1. Die US-amerikanische Klassifikation unterscheidet insgesamt 6 zervikale Regionen zentral (Level 1 und 6) und lateral (Level 2 bis 5) [7, 56, 57]. Das infrabrachiozephale obere Mediasti-num wird nicht berücksichtigt.
2. Die japanische Klassifikation unter-scheidet 4 zentrale von 3 lateralen Lymphknotengruppen. Auch bei die-ser Klassifikation fehlt eine Definition des mediastinalen Lymphknotensys-tems [54].
3. Die UICC-Klassifikation unterschei-det 3 zentrale [1, 2, 8] von 6 latera-len Lymphknotengruppen [2, 5, 6, 7]. Auch hier wird das mediastina-le Kompartment nicht berücksichtigt [69].
4. Die Kompartmentklassifikation [15, 16] unterscheidet 4 Lymphknoten-kompartments zentral (K1a rechts, K1b links), lateral (K2 rechts, K3 links) und infrabrachiozephal im obe-ren Mediastinum (K4a rechts, K4b links) (. Abb. 1). Der Vorteil dieser Klassifikation ist die klare Zuordnung der Kompartments zu chirurgisch-re-levanten Strukturen im Hals und obe-ren Mediastinum (A. carotis com-munis als anatomische Grenze zwi-schen zentralem und lateralem Kom-partment; V. brachiocephalica sinist-ra als anatomische Grenze zwischen zentralem und mediastinalem Kom-partment) sowie der Einbezug des in-frabrachiozephalen oberen Mediasti-nums in das lokoregionäre Lymphsys-tem.
Technik der Lymphknotendissektion
Insbesondere in der Primärchirurgie der Schilddrüsenkarzinome hat sich in den vergangenen 2 Jahrzehnten das Konzept der sog. kompartmentorientierten Mik-rodissektion durchgesetzt [7, 8, 13, 14, 15]. Die Sentineltechnik hat aufgrund unter-schiedlicher und insgesamt nicht befrie-digender Ergebnisse [23] keine allgemei-ne Verbreitung und Akzeptanz gefunden. Die regionale Lymphknotenentfernung (Entfernung einzelner Lymphknoten-gruppen, nicht eines gesamten Kompart-ments) oder das sog. „berry picking“ wird als Verfahren der Primärtherapie nicht
mehr empfohlen [8, 23], hat jedoch wei-terhin einen Stellenwert im Rahmen der fokussierten Rezidivtherapie nach initia-ler Kompartmentresektion [8, 23].
Die mittlere Anzahl pro Kompartment entnommener Lymphknoten beträgt je 5 für die beiden zervikalen und die bei-den mediastinalen Kompartments sowie je 20 für die lateralen Kompartments [16, 47]. Die Anzahl tumorbefallener Lymph-knoten im zentralen Kompartment hat eine prädiktive Bedeutung für den Befall der übrigen lokoregionalen Lympknoten-kompartments [45, 48]. Das pathohisto-
logische Staging des zentralen Kompart-ments mit Bestimmung der entfernten und tumorbefallenen Lymphknoten er-hält damit einen besonderen Stellenwert für die Evaluation des individuellen Risi-koprofils insbesondere der papillären und medullären Karzinome.
Papilläre Karzinome (PTC)
Nachdem lange Zeit kontrovers disku-tiert wurde, ab welcher Primärtumorgrö-ße bzw. welchem Primärtumorstadium beim PTC eine radikale Primärtherapie
mit totaler Thyreoidektomie, Lymphkno-tendissektion und ablativer Radiojodthe-rapie erforderlich ist, haben mehrere Stu-dien der vergangenen Jahre v. a. folgende bislang offene Fragen klären können:
ThyreoidektomieEs wurde anhand des umfangreichen SEER-Krankenguts der USA nachgewie-sen, dass bei PTC über 1 cm Durchmesser die Rezidiv- und Überlebensrate nach to-taler Thyreoidektomie signifikant besser ist als nach nichttotaler Thyreoidektomie [1]. Dieses Ergebnis konnte auch durch
1a 1b32
4b4a
1a 1b 32
4a 4b
K1: zervikales zentralesKompartment, K1 a rechts,K1b links
4a
1a 1b 32
4b
K2: zervikolaterales Kompartment rechts
4a
1a 1b 32
4b
K3: zervikolaterales Kompartment links
K4: mediastinalesKompartment, K4a rechts,K4b links
1a 1b 32
4a 4b
K1: vom Hyoid bis zur V. bracheocephalica sinistra zwischen der A. carotis communis rechts, K1a, bzw. links, K1b, und der Trachea
zervikozentrale Kompartmentresektion rechts (K1a) bzw. links (K1b); 10 Lymphknoten, 5 auf jeder Seite der Trachea
selektive LKD K1a, K1b
subclavia dextra
K2: lateral der A. carotis communis rechts vom N. hypoglossus bzw. zur V.
zervikolaterale Kompartmentresektion rechts; 20 Lymphknoten
selektive LKD K2
K3: lateral der A. carotis communis links vom N. hypoglossus bis zur V. subclavia sinistra
zervikolaterale Kompartmentresektion links; 20 Lymphknoten
selektive LKD K3
K4: caudal der V. brachiocephalica sinistra unter Einschluß des Thymus bis zum Pericard (ventral) und zur Trachealbifurkation (dorsal), K4a rechts, K4b links der Trachea
mediastinale Kompartmentresektion rechts (K4a) bzw. links (K4b); 10 Lymphknoten, 5 auf jeder Seite der Trachea
selektive LKD K4a, K4b
Kompartment- De�nition
Terminologie der Kompartmentresektion, durchschnittliche Anzahl resezierter Lymphknoten
Terminologie der selektiven LKD
Abb. 1 9 Kompartment-klassifikation der lokoregio-nären Lymphknoten beim Schilddrüsenkarzinom und Terminologie der Lymph-knotendissektion. LKD Lymphknotendissektion. (Aus Dralle 2009 [22])
668 | Der Onkologe 7 · 2010
Leitthema
die Daten aus Österreich bestätigt werden [52]. Unter Berücksichtigung der Lage des Primärtumors in Hinsicht auf die Organ-kaspel und des Differenzierungsgrads er-gibt sich daraus folgendes Konzept für die Resektion des primärtumortragenden Organs beim PTC:F Bei allen PTC über 1 cm im Durch-
messer besteht grundsätzlich die Indi-kation zur totalen Thyreoidektomie. Dies bedeutet, dass bei primär wegen benigner Struma nicht erfolgter to-taler Thyreoidektomie bei PTC über 1 cm eine Komplettierungsoperation empfohlen wird.
F Bei nicht organkapselinfiltrierenden solitären PTC unter 1 cm Durchmes-ser ohne Metastasen ist eine totale Thyreoidektomie mit nachfolgender Radiojodtherapie nach R0-Resektion nicht erforderlich. Diese Empfehlung schließt auch die Frage einer Kom-plettierungsoperation nach primär nichttotaler Thyreoidektomie ein und betrifft etwa 27% der Patienten mit Karzinomzufallsbefund eines PTC <1 cm nach nichttotaler Thyreoidek-tomie, denen damit eine Komplettie-rungsoperation erspart werden kann [19].
Noch nicht hinreichend geklärt ist der Vorteil eines radikalen chirurgischen Vorgehens bei papillären Karzinomen kleiner als 1 cm Durchmesser, jedoch mit folgenden Besonderheiten: Multifokali-tät, Organkapselinvasion und schlech-tem Differenzierungsgrad [19]. Da ein er-höhtes Rezidivrisiko nach nichtradikaler Primärtherapie bislang nicht sicher aus-geschlossen werden konnte, wird daher für die genannten Primärtumoren auch bei einer Größe unter 1 cm Durchmesser eine radikale Primärtherapie wie bei PTC über 1 cm empfohlen.
Die Grundsätze dieser Behandlungs-empfehlungen sind bereits 1996 in der ersten Fassung der Leitlinien der Therapie maligner Schilddrüsentumoren der Deut-schen Gesellschaft für Chirurgie [24, 27] formuliert worden. International umstrit-ten war bislang vor allem der „cut-off “ von 1 cm hinsichtlich der Indikation zur totalen Thyreoidektomie. Nachdem schon die British Thyroid Association 2002 [4] und jetzt auch in ihrer 2. Auflage 2007
Zusammenfassung · Abstract
Onkologe 2010 · 16:666–677 DOI 10.1007/s00761-010-1868-9© Springer-Verlag 2010
H. Dralle · K. Lorenz · A. Machens · M. Brauckhoff · P. Nguyen Thanh
Tumortyp- und tumorstadienorientiertes chirurgisches Konzept bei Karzinomen der Schilddrüse
ZusammenfassungDie chirurgische Therapie der Schilddrüsen-karzinome hat in den letzten Jahren auf-grund verfeinerter Techniken und Nachsor-gekonzepte weltweit erhöhte Aufmerksam-keit gefunden. Wegen der tumorbiologischen Besonderheiten der 5 Haupttypen der Schild-drüsenkarzinome und der hiermit in Verbin-dung stehenden unterschiedlichen adjuvan-ten (Radiojodtherapie) bzw. additiven (Radio-jodtherapie, externe Strahlentherapie, Che-motherapie) Therapieverfahren steht der pri-märe Karzinomtyp im Mittelpunkt der chir-urgischen Therapiestratifizierung. Abhängig von der Ausdehnung des Primärtumors (ex-trathyreoidal vs. intrathyreoidal) und vom lo-koregionären Lymphknotenbefall kann ein erhebliches lokoregionäres Rezidivrisiko be-stehen. Aufgrund der zwar reduzierten, aber
trotz Rezidiv auch im Langzeitverlauf nicht ungünstigen Prognose ist bei Fehlen einer progredienten Fernmetastasierung insbeson-dere bei differenzierten und medullären Kar-zinomen grundsätzlich die Indikation zur Re-zidivresektion gegeben. Die Diagnostik von Primärtumoren und Rezidiven konnte insbe-sondere durch Sonographie und PET/CT we-sentlich verbessert werden und hat dadurch nicht nur zu einer früheren Diagnosestellung, sondern auch zu einem differenzierten Ver-ständnis der Tumorbiologie beigetragen.
SchlüsselwörterSchilddrüsenkarzinom · Chirurgische Thera-pie · Primärtumor · Rezidiv · Lymphknoten-befall
Tumor type and stage-oriented surgical concept for thyroid carcinoma
AbstractIn recent years surgical therapy of thyroid carcinoma has received increased attention worldwide due to refined techniques and postoperative concepts. Due to the biological characteristics of the five main types of thy-roid carcinoma and the corresponding differ-ent adjuvant (radioiodine therapy) and addi-tive (radioiodine therapy, external radiation therapy and chemotherapy) therapeutic pro-cedures, the type of primary carcinoma is the focus of surgical therapy stratification. There can be a substantial locoregional risk of re-currence depending on the spread of the pri-mary tumor (extrathyroidal versus intrathy-roidal) and the locoregional lymph node in-
festation. Due to the reduced but despite re-currence not unfavorable prognosis even in the long-term, the indications for resection of recurrences are given by a lack of progressive distant metastization especially for differenti-ated and medullary carcinomas. The diagnos-tics of primary tumors and recurrences have been substantially improved especially by so-nography and PET-CT and have led not only to an earlier diagnosis but also to a differenti-ated understanding of tumor biology.
KeywordsThyroid carcinoma · Surgical therapy · Primary tumor · Recurrence · Lymph node metastasis
669Der Onkologe 7 · 2010 |
[5] der „Guidelines for the management of thyroid cancer in adults“ den „cut-off “ von 1 cm beim PTC zur Grundlage ihrer Therapieempfehlungen gemacht hatte, hat jetzt auch die American Thyroid Associa-tion in ihrer jüngsten Revision der The-rapieempfehlungen zum differenzierten Schilddrüsenkarzinom v. a. aufgrund der Bilimoria-Publikation [1] die 1-cm-Gren-ze beim PTC hinsichtlich der Indikation zur Thyreoidektomie akzeptiert [8]. Ins-gesamt ergibt sich damit eine sehr große internationale Übereinstimmung für die Indikation zur radikalen Thyreoidekto-mie beim PTC über 1 cm.
LymphknotendissektionIm Gegensatz zu früheren Untersuchun-gen [6] haben viele große Studien in den letzten Jahren schlüssig nachgewiesen, dass Lymphknotenmetastasen beim PTC aggressivere Tumoren signalisieren und mit einem höheren Fernmetastasenrisi-ko einhergehen als nodal-negative PTC [29, 32, 35, 42, 59, 64, 66, 68]. Die thera-peutische Lymphknotendissektion ist da-her international Bestandteil aktuell gülti-ger Behandlungsempfehlungen [5, 8, 24].
Weiterhin umstritten ist jedoch die Durchführung einer sog. prophylakti-schen Lymphknotendissektion, d. h. die Entfernung prä- bzw. intraoperativ nicht tumorverdächtiger Lymphknoten [8, 68]. Während bei PTC kleiner 1 cm die Durch-führung einer prophylaktischen Lymph-knotendissektion v. a. im zentralen Kom-partment (K1 bzw. Level 6) keinen Vorteil hinsichtlich Rezidiv und Überleben erge-ben hat [28, 29, 36, 67] und daher von den meisten Zentren angesichts der auch bei erfahrenen Chirurgen relevanten potenz-tiellen chirurgischen Morbidität (Recur-rensparese und insbesondere Hypoparat-hyreoidismus) nicht empfohlen wird, ist das Risiko einer metachronen Lymph-knotenmetastasierung bei PTC >1 cm aufgrund des häufigeren Lymphknoten-befalls [40] deutlich erhöht. Auch klini-sche Studien unter Berücksichtigung des Langzeitverlaufs [30, 31, 65] sprechen da-für, bei PTC über 1 cm routinemäßig, d. h. prophylaktisch zumindest im zen-tralen Kompartment eine Lymphkno-tendissektion durchzuführen. Bei ausge-dehntem zentralem Lymphknotenbefall (>5 Lymphknotenmetastasen) [47] ist da-
rüber hinaus eine laterale Lymphknoten-dissektion von Vorteil, da bei diesen PTC eine hohe Wahrscheinlichkeit für laterale Lymphknotenmetastasen (>50%) besteht.
Risikofaktoren für eine mediastinale Lymphknotenmetastasierung beim PTC sind v. a. geringer Differenzierungsgrad (OR 14,6), Fernmetastasen (OR 6,1) und bilateral-zervikolaterale Lymphknoten-metastasen [48]. Aufgrund des wesent-lich erweiterten Resektionsausmaßes und erhöhten komplikativen Risikos ist jedoch die Indikation zur transsternalen Media-stinaldissektion nur bei prä- bzw. intra-operativem Nachweis mediastinaler Me-tastasen gegeben.
Follikuläre Karzinome (FTC)
ThyreoidektomieDie aktuell gültige WHO-Klassifikation der Schilddrüsenkarzinome [63] definiert als follikuläre Karzinome der Schilddrü-se alle malignen epithelialen Tumoren, die eine follikuläre Zelldifferenzierung und keine für PTC typischen Zellkerncharak-teristika aufweisen. Im Einzelfall kann je-doch die Unterscheidung insbesondere zwischen minimal-invasivem FTC, folli-kulärem Adenom und follikuärer Varian-te eines PTC selbst für Experten schwie-rig sein [10, 60, 62] und konsekutiv unter-schiedliche Therapieoperationen eröff-nen, wenn es um die Frage der Komplet-tierungsoperation (Restthyreoidektomie mit dem Ziel einer postoperativen Radio-jodablation) bei primär nichttotaler Thy-reoidektomie geht.
Zahlreiche multivariate Analysen der Risikofaktoren stimmen in ihren Ergeb-nissen darin überein, dass bei breit-inva-siven FTC aufgrund des Fernmetastasen-risikos in jedem Fall eine totale Thyreoid-ektomie mit postoperativer Radiojodab-lation erfolgen sollte [19]. Problematisch dagegen ist, den „cut-off “ hinsichtlich des radikalen Primärtherapiekonzepts beim minimal-invasiven FTC festzulegen. Vo-raussetzung hierfür ist eine entsprechen-de Expertise von Seiten des Pathologen hinsichtlich der Definition des Primär-tumors (minimal-invasives FTC vs. fol-likuläres Adenom vs. follikuläre Variante eines PTC) und darüber hinaus die De-finition der Tumorkapsel- und Angioin-vasion. Auch wenn in den vorliegenden
multivariaten Analysen selbst eine Angio-invasion nicht übereinstimmend als Risi-kofaktor für Fernmetastasen beim mini-mal-invasiven FTC nachgewiesen wurde [19], ist die Empfehlung der Fachgesell-schaften [5, 8], sicherheitshalber bei die-sen Tumoren eine totale Thyreoidekto-mie mit postoperativer Radiojodablation durchzuführen. Aufgrund des höheren Rezidivrisikos oxyphiler Tumoren wird auch bei diesem Zelltyp des FTC unab-hängig von der Primärtumorgröße und dem Vorliegen einer Angioinvasion gene-rell die Durchführung einer totalen Thy-reoidektomie empfohlen [5, 8]. Beim mi-nimal-invasiven nichtoxyphilen Karzi-nom ohne Angioinvasion wird dagegen unabhängig von der Primärtumorgröße eine primäre Lobektomie bzw. nicht-tota-le Schilddrüsenresektion ohne anschlie-ßende Radiojodtherapie als ausreichende Primärtherapie angesehen.
LymphknotendissektionLymphknotenmetastasen treten beim FTC im Gegensatz zum PTC seltener auf und in der Regel nur dann, wenn gleich-zeitig Fernmetastasen vorliegen. Die pri-märe oder sekundäre Indikation zur pro-phylaktischen Lymphknotendissektion wird daher gegenwärtig von den meisten Fachgesellschaften nicht gesehen [5, 8].
Wenig differenzierte (PDTC) und undifferenzierte Karziome (UTC)
ThyreoidektomieBei resektablen Tumoren ist die Indika-tion zur totalen Thyreoidektomie in aller Regel gegeben, v. a., wenn aufgrund der präoperativen Diagnostik (Klinik, Bild-gebung, FNP) nicht klar zwischen PDTC und UTC oder PDTC und DTC (diffe-renziertem Karzinom) differenziert wer-den kann. Auch bei organüberschreiten-den PDTC sollte eine Thyreoidektomie angestrebt werden, da viele dieser Tumo-ren prognostisch deutlich günstiger sind als UTC [38, 53] und darüber hinaus nicht selten eine zumindest partiell erhaltene Radiojodaufnahme besitzen. Bei UTC sollte eine chirurgische Palliativresektion (R2) nur im begründeten Ausnahme-fall erfolgen, z. B. dann, wenn noch keine Fernmetastasen vorliegen.
670 | Der Onkologe 7 · 2010
Leitthema
LymphknotendissektionZur Verbesserung der lokalen Tumor-kontrolle ist die Durchfühung einer be-fallsorientierten Lymphknotendissektion zu empfehlen, auch wenn die Gesampt-prognose im Wesentlichen durch die bei diesen Malignomen hohe Fernmetastasie-rungsrate bestimmt wird.
Medulläre Karzinome
Große multizentrische Studien haben ge-zeigt, dass der wichtigste Prognosefak-tor beim medullären Karzinom das Tu-morstadium (Organkapselinfiltration, Lymphknoten- und v. a. Fernmetastasen) ist, nicht jedoch Alter, Geschlecht, oder Pathogenese (sporadisch, hereditär) [50]. Aus chirurgischer Sicht ergeben sich aber hinsichtlich der hereditären MTC Beson-derheiten, die das Konzept der prophy-laktischen Thyreoidektomie betreffen, so-dass hierauf besonders eingegangen wird.
ThyreoidektomieHauptargumente für die primäre Thy-reoidektomie bei allen Stadien und For-men (sporadisch, hereditär) des MTC sind die im Gegensatz zu den Follikelzell-karzinomen (PTC, FTC) nicht gegebene Möglichkeit der Radiojodtherapie und
die v. a. beim hereditären, aber auch beim sporadischen MTC häufige Multifokalität (65% vs. 10%; [44]). Als einzige Ausnahme von der primären Thyreoidektomie gilt die Situation des postoperativen Zufalls-befunds eines sporadischen, RET-Muta-tion-negativen MTC, wenn die postopera-tiven basalen und stimulierten Calciton-inwerte im Normbereich sind, da Lang-zeituntersuchungen gezeigt haben, dass diese Patienten unter entsprechender Cal-citoninnachsorge kein erhöhtes Rezidivri-siko aufweisen [49, 55].
Bei Genträgern einer zum hereditä-ren MTC disponierenden RET-Muta-tion ist der beste Zeitpunkt für eine pro-phylaktische Thyreoidektomie, wenn un-abhängig vom Alter ein basal noch nicht erhöhtes Calcitonin vorliegt (. Abb. 2, [20]). Es konnte nachgewiesen werden, dass bei dieser Konstellation noch kei-ne Lymphknotenmetastasen vorhanden sind [46]. Die alleinige Altersempfehlung als Grundlage der Festlegung des opti-malen Zeitpunktes der prophylaktischen Thyreoidektomie ist dagegen nicht aus-reichend, da die Manifestationsbreite der neoplastischen C-Zell-Transformation bei den einzelnen RET-Mutationen er-heblich ist [17, 41, 46] und bei alleiniger Altersbasierung ein beträchtliches Risiko
für eine zu spät durchgeführte Operation besteht. Hauptstellenwert der mutations- und altersgruppenbasierten Risikoklas-sen der neuen ATA- (American-Thyro-id-Association-)Klassfikation [33] ist da-her ihre Bedeutung innerhalb der gene-tischen Beratung von Familien mit here-ditärem MTC und bei der Nachkontrolle nach operativer Therapie, nicht jedoch bei der Festlegung des optimalen Zeitpunkts der prophylaktischen Thyreoidektomie.
LymphknotendissektionBasierend auf der Erkenntnis, dass ca. 60% der nodal-negativen, aber nur ca. 10% der nodal-positiven MTC [43] bio-chemisch geheilt werden können, hat sich das Konzept der kompartmentorientier-ten Lymphknotendissektion [15] weltweit durchgesetzt [51, 61]. Inadäquate Lymph-knotendissektion ist einer der Hauptgrün-de für eine unzureichende lokale Tumor-kontrolle [34]. Da beim MTC die Lymph-knotenmetastasierung bei im Mittel 5 mm Primärtumorgröße einsetzt und Fernme-tastasen bei Primärtumoren ab 10 mm in zunehmender Frequenz beobachtet wer-den [43], beschränkt sich das therapeuti-sche Fenster beim MTC auf den nicht sehr großen Bereich der 5–10 mm großen Tu-moren. Das primärtumorgrößenabhän-
Gentest (RET-Analyse)
Kalzitoninbestimmung(basal, stimuliert)
kein GenträgerKalzitonin i. N.
positiverMutations-nachweis
keine weitereNachkontrolle
erforderlich
basales Kalzitonin
erhöht
basales Kalzitonin normal
TT, K1 bis K3 Kontroll eentsprechen dRisikogruppe
(ATA A-D)
TT be iansteigendem
stimulierten Kalzitonin
Abb. 2 9 Konzept der pro-phylaktischen Thyreoid-ektomie bei Genträgern einer hereditären C-Zell-Er-krankung mit RET-Protoon-kogen-Mutation. TT tota-le Thyreoidektomie, K1, K2, K3 s. . Abb. 1. (Kloos et al. 2009 [33])
672 | Der Onkologe 7 · 2010
Leitthema
gige Metastasierungsrisiko ist in Verbin-dung mit den hierbei beobachteten Cal-citoninspiegeln Grundlage des heutigen Konzepts der Lymphknotendissektion beim MTC (. Tab. 1).
Chirurgische Rezidivtherapie
Abhängig von der Ausdehnung des Pri-märtumors (extrathyreoidal vs. intrathy-reoidal) und vom lokoregionären Lymph-knotenbefall kann ein erhebliches loko-regionäres Rezidivrisiko bestehen. Auf-grund der zwar reduzierten, aber trotz Rezidiv auch im Langzeitverlauf nicht ungünstigen Prognose ist bei Fehlen einer progredienten Fernmetastasierung insbe-sondere bei differenzierten und medul-lären Karzinomen grundsätzlich die In-dikation zur Rezidivresektion gegeben. Hinzukommt, dass Rezidive im Zervikal- und Mediastinalbereich bei Lokalisation in der Nähe vitaler Strukturen (N. recur-rens, N. vagus, N. phrenicus, Larynx, Tra-chea, Ösophagus, Bronchialsystem) grö-ßenunabhängig ein beträchtliches tumor-bedingtes Komplikationsrisiko aufweisen, sodass auch zur Vermeidung tumorbe-dingter Komplikationen Rezidiveingriffe einen hohen Stellenwert besitzen.
Enorme Fortschritte hinsichtlich der Lokalisation persistierender und rezidi-vierender Schilddrüsenkarzinome konn-ten durch die PET/CT-Technik erzielt werden [26, 58]. Vorteil dieser Bildge-bung im positiven Fall ist der gleichzei-tige Ausschluss bzw. Nachweis von Fer-metastasen und die Ermöglichung eines chirurgisch gezielten Vorgehens („focus-sed approach“; [23]). Als möglicher Nach-teil ist zu berücksichtigen, dass bei etwa einem Drittel der Fälle (eigene Ergebnis-se) nur ein Teil der lokoregionären Rezi-divlokalisationen dargestellt wird. Dies muss bei der chirurgischen Verfahrens-wahl bedacht werden. Die PET/CT eignet sich besonders für den Nachweis oxyphi-ler und radiojodnegativer differenzierter bzw. wenig differenzierter Schilddrüsen-karzinomrezidive.
Im interdisziplinären Therapiekonzept lokoregionärer Rezidive sind hinsichtlich des Stellenwerts der chirurgischen Thera-pie folgende Besonderheiten von Bedeu-tung:
1. Bei postprimärer Tumorpersistenz sollte vor jeder additiven Therapie durch entsprechende Bildgebung (So-nographie, CT/MRT, FDG PET/CT) die Resektabilität in einem speziell hiermit erfahrenen Zentrum geklärt und die Option einer Komplettie-rungsoperation geprüft werden [21]. Die Indikationen zur externen Strah-lentherapie beschränken sich heute auf die additive Therapiesituation bei Irresektabilität, sodass bei resektablen Tumorresten eine Bestrahlung nicht empfohlen werden kann. Diese Emp-fehlungen gelten ebenso für differen-zierte [8] wie für medulläre Karzino-me [33]. Bei undifferenzierten Kar-zinomen ist dagegen die externe Be-strahlung weiterhin fester Bestandteil
des multimodalen Therapiekonzepts [39].
2. Die Indikation zur Resektion resekt-abler lokoregionärer Rezidive be-steht immer dann, wenn der „Schritt-macher“ der Erkrankung im Zerviko-mediastinalbreich lokalisiert ist, kei-ne progrediente Fernmetastasierung vorliegt und das Rezidiv bzw. die Re-zidive vitale Organe (Larynx, Tra-chea, Ösophagus, Stammbronchien) oder Strukturen (N. vagus, N. recur-rens, N. phrenicus, Hauptgefäße) ge-fährden. Sowohl aus Sicht der chirur-gischen Technik als auch der multi-modalen Therapieentscheidung sind zwei Rezidivsituationen von beson-derer Bedeutung: die Infiltration der zervikoviszeralen Achse und die Zer-vikalkarzinose.
Tab. 1 Therapieempfehlungen zum Resektionsausmaß an der Schilddrüse und den lo-koregionären Lymphknoten bei Schilddrüsenkarzinomen
Karzi-nomtyp
Subtyp Schilddrüse Lokoregionäre Lymph-knoten
PTC <1 cm und unifokal, nicht or-ganüberschreitend, ohne Metas-tasen, keine Vorbestrahlung im Halsbereich, keine familiäre Dis-position zum nichtmedullären Schilddrüsenkarzinom, keine bilaterale Knotenstruma, keine Immunthyreopathie
Hemithyreoidektomie Keine prophylaktische LKD
>1 cm und alle Tumormanifesta-tionen und Schilddrüsenpatho-logien, die nicht o. g. Definition entsprechen
Totale Thyreoidektomie Zentrale LKD und ggf. laterale LKD (s. Text), befallsorientiert medi-astinale LKD
FTC Primärtumorgrößenunabhän-gig, solitär, nichtoxyphil, mini-mal-invasiv ohne Angioinvasion, keine bilaterale Knotenstruma oder Immunthyreopathie
Hemithyreoidektomie Keine prophylaktische LKD
Primärtumorgrößenunabhän-gig, multipel, oxyphil, minimal-invasiv mit Angioinvasion, oder breit-invasiv
Totale Thyreoidektomie Keine prophylaktische LKD
PDTC Totale Thyreoidektomie Zentrale LKD, befallsori-entiert laterale LKD
UTC Totale Thyreoidektomie bei Resektabilität (R0, R1)
Zentrale LKD, befallsori-entiert laterale LKD
MTC Sporadisch und hereditär (mit Ausnahme der Genträger im Rahmen des genetischen Scree-nings, s. . Abb. 2)
Totale Thyreoidektomie Zentrale, und bei basalem Calcitonin >500 pg/ml (Referenz-bereich <10 pg/ml) bilateral zervikolaterale LKD (K1–3)
PTC papilläres Karzinom, FTC follikuläres Karzinom, PDTC wenig differenziertes Karzinom, UTC undif-ferenziertes Karzinom, MTC, medulläres Karzinom, LKD Lymphknotendissektion, K1–3 s. . Abb. 1.
673Der Onkologe 7 · 2010 |
a) Eine Invasion des Aerodigestiv-trakts wird bei ca. 6% der Schild-drüsenkarzinome beobachtet [18, 37]. Abgesehen von Infiltratio-nen der perithyreoidalen Weich-gewebe und bisweilen der Gefäße sind dabei in zwei Drittel der Fäl-le der Luftweg (Larynx, Trachea), seltener der Speiseweg (Hypo-pharynx, Ösophagus) betroffen. Da im Gegensatz zu den primä-ren Malignomen der genannten Organe der initiale Tumorprozess immer extramural lokalisiert ist, schließen Überlegungen zur Frage der Resektionsindikation folgende
Kriterien ein: das Ausmaß der ex-tramuralen vs. transmuralen/int-ramuralen Tumorinvasion, Karzi-nomtyp und -stadium, den Allge-meinzustand des Patienten. Wenn nur eines der genannten Krite-rien gegen eine radikale Resektion am zervikalen Aerodigestivtrakt spricht, sollte stattdessen ein sog. „shaving“ vorgenommen werden oder es sollten alternative nichtre-sezierende Verfahren gewählt wer-den. Irresektabilität besteht i. Allg. dann, wenn die transmurale Tu-morinfiltration die Grenze der la-teralen Halsgefäßscheide bzw.
kaudal der V. brachiocephalica si-nistra überschritten hat. Die Frage der Resektabilität und rekonstruk-tiven Verfahrenswahl (. Abb. 3) hängt dabei nicht nur vom longi-tudinalen und transversalen Inva-sionsausmaß im Bereich des Ae-rodigestivtrakts ab, sondern auch von der ggf. durch Voroperatio-nen beeinträchtigten biologischen Beschaffenheit, insbesondere der Trachea ab. Im Gegensatz zu dif-ferenzierten und medullären Kar-zinomen [2, 3, 12, 25, 37] sind bei undifferenzierten Karzinomen aufgrund der Tumorbiologie zer-
Typ 1:Laryngokrikoid, unilateral, < 2 cm längs, < ¼Zirkumferenz: Wandresektion, SCM-Flap
Typ 2:Trachea, unilateral, < 2 cm längs, < ¼ Zirkumferenz:Wandresektion, SCM-Flap
Typ 3:Laryngokrikoid, unilateral, > 2 cm längs, > ¼Zirkumferenz: Tracheasegmentresektion (schräg),primäre Anastomose, SCM-Flap
Typ 4:Trachea,uni/bilateral, > 2 cm längs, > ¼ Zirkumferenz:horizontale Tracheasegmentresektion, primäreAnastomose, SCM-Flap
Typ 5:Laryngokrikoid, bilateral: Laryngektomie
Typ 6:Laryngokrikoid, bilateral plusHypopharynx/Ösophagus: zervikale Eviszeration, freieDünndarmtransplantation
Abb. 3 9 Klassifikation der zervikoviszeralen Invasions-typen bei Schilddrüsenkar-zinomen, der Resektions- und Rekonstruktionsver-fahren. (Mod. nach [18]; mit freundl. Genehmigung des Elsevier-Verlags)
674 | Der Onkologe 7 · 2010
Leitthema
vikoviszerale Tumorresektionen in der Regel nicht indiziert.
b) Die Zervikalkarzinose ist eine nicht häufige, jedoch therapeu-tisch enorm problematische Tu-morsituation, die in ihrer Ätiolo-gie bislang ungeklärt ist, da keine im Vergleich zur Peritoneal- oder Pleurakarzinose ähnliche anato-mische Basis der lokoregionären Tumorzelldissemination vorliegt. Meist handelt es sich um oxyphi-le oder wenig differenzierte Fol-likelzellkarzinome. Anstelle einer prophylaktischen externen Radia-tio stellt hierbei das Konzept der sequenziellen Chirurgie eine The-rapiemöglichkeit dar, durch ge-plant focussierte Wiederholungs-eingriffe die lokale Tumorkontrol-le zu behalten oder wiederzuerlan-gen. Die Notwendigkeit der hier-bei meist vorliegenden Einzelfall-entscheidung unterstreicht in be-sonderem Maße die Bedeutung
spezialisierter multidisziplinä-rer Teams mit der Möglichkeit, al-le modernen Therapieoptionen in die individuelle Therapieentschei-dung miteinbeziehen zu können.
3. Häufigste Ursache lokoregionäre Re-zidive bei differenzierten und medul-lären Karzinomen sind Lymphkno-tenmetastasen. Wie bei der Primär-manifestation gilt auch für die Re-zidivmanifestation das Prinzip Ein Lymphknoten – ein Kompartment, d. h. ein bildgebend oder makrosko-pisch befallener Lymphknoten ist fast immer nur der sichtbare Tumorherd eines mikroskopischen Befalls des be-troffenen Kompartments, selten auch weiterer Kompartments. Das Konzept der kompartmentorientierten Mik-rodissektion [15], wenn nicht bereits beim Primäreingriff durchgeführt, gilt somit auch für die Rezidivsitua-tion bei Lymphknotenmetastasen pa-pillärer und medullärer Karzinome.
Zur Festlegung des individuellen Re-sektionsausmaßes kommt der ana-tomischen (Sonographie, CT/MRT) und, wenn möglich, auch funktionel-len Bildgebung (PET/CT) ein beson-derer Stellenwert zu, da in der Regel aufgrund des komplikativen Risikos von einer Resektion bildgebend nicht befallener Kompartments abgesehen werden kann.
Fazit für die Praxis
Aufgrund der besonderen Tumorbiologie der Schilddrüsenkarzinome ist die chir-urgische Therapie die einzige Therapie-modalität mit potenziell kurativem An-satz. Die Diagnostik von Primärtumo-ren und Rezidiven konnte insbesonde-re durch Sonographie und PET/CT we-sentlich verbessert werden und hat da-durch nicht nur zu einer früheren Diag-nosestellung, sondern auch zu einem dif-ferenzierten Verständnis der Tumorbiolo-gie beigetragen. Es ist somit heute inter-
nationaler Konsens, auch in der chirur-gischen Therapie zwischen Niedrig- und Hochrisikokarzinomen zu unterscheiden. Bei papillären Karzinomen kann als all-gemein akzeptierter „cut-off“ zwischen einer sog. eingeschränkten und radika-len Standardtherapie die 1-cm-Grenze bei Primärtumoren angesehen werden. Bei follikulären Karzinomen ist dagegen nicht die Primärtumorgröße, sondern der Nachweis einer Angioinvasion für die Entscheidung zur radikalen Primärchi-rurgie entscheidend. Bei den frühzeitig lymphogen metastasierenden medullä-ren Karzinomen hat sich als „cut-off“ die 5-mm-Primärtumorgrenze erwiesen. Als weiterer international akzeptierter Stan-dard der Lymphknotenchirurgie gilt heu-te das Konzept der kompartmentorien-tierten Mikrodissektion. Das Ausmaß der Lymphknotenentfernung orientiert sich somit nicht am Nachweis der sichtbar be-fallenen Lymphknoten, sondern tumor-involvierter Kompartments. Da insbe-sondere die zentrale Lymphknotendis-sektion ein erhöhtes Komplikationsrisi-ko aufweist, wird bei Niedrigrisikotumo-ren, d. h. beim nodal-negativen papillä-ren Mikrokarzinom und bei den nicht pri-mär lymphogen metastasierenden folli-kulären Karzinomen eine generelle, d. h. prophylaktische Lymphknotendissektion nicht allgemein empfohlen.Das hohe lokoregionäre Rezidivrisiko bei gleichzeitig weiterhin vergleichsweise günstiger Prognose und eingeschränk-ter Effektivität nichtoperativer Therapie-verfahren differenzierter und medullärer Karzinome begründet den herausragen-den Stellenwert der Chirurgie auch im multimodalen Konzept der Rezidivthe-rapie. Nicht nur bei Lymphknotenrezidi-ven, sondern auch bei organüberschrei-tenden Karzinomen mit Invasion des Ae-rodigestivtrakts sind bei entsprechender operativer Erfahrung radikale Resektio-nen unter weitgehendem Funktionser-halt möglich. Der Einsatz einer externen Strahlentherapie wird heute mit Ausnah-me des undifferenzierten Karzinoms nur noch in der irresektablen Rezidivsitua-tion empfohlen, nicht jedoch als postchi-rurgisches adjuvantes Verfahren.
KorrespondenzadresseProf. Dr. H. DralleKlinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäß-chirurgie, Universitätsklinikum Halle Medizinische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-WittenbergErnst-Grube-Straße 40, 06120 Halle/[email protected]
Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.
Literatur
1. Bilimoria KY, Bentrem DJ, Ko CY et al (2007) Extent of surgery affects survival for papillary thyroid can-cer. Ann Surg 246:375–384
2. Brauckhoff M, Meinicke A, Bilkenroth U et al (2006) Long-term results and functional outcome after cervical evisceration in patients with thyroid can-cer. Surgery 140:953–955
3. Brauckhoff M, Dralle H (2009) Zervikoviszerale Re-sektionen beim organüberschreitenden Schilddrü-senkarzinom. Chirurg 80:88–98
4. British Thyroid Association (2002) Guidelines for the management of thyroid cancer in adults. Royal College of Physicians
5. British Thyroid Association (2007) Guidelines for the management of thyroid cancer in adults. Royal College of Physicians. Second edition
6. Cady B, Rossi R (1988) An expanded view of risk-group definition in differentiated thyroid carcino-ma. Surgery 104:947–953
7. Carty SE, Cooper DS, Doherty GM et al (2009) Con-sensus statement on the terminology and classifi-cation of central neck dissection for thyroid cancer. Thyroid 19:1153–1158
8. Cooper DS, Doherty GM, Haugen BR et al (2009) Revised American Thyroid Association manage-ment guidelines for patients with thyroid no-dules and differentiated thyroid cancer. Thyroid 19:1167–1214
9. Davies L, Welch HG (2006) Increasing incidence of thyroid cancer in the United States, 1973–2002. JAMA 295:2164–2167
10. Delbridge L, Barraclough B, Parky R et al (2002) Mi-nimally invasive follicular thyroid carcinoma: com-pletion thyroidectomy or not? ANZ J Surg 72:844–845
11. DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU, Eng C (eds) (2004) Pathology and generetics of tumors of endocrine organs: World health organization classification of tumors. IARC Press, Lyon
12. Dralle H, Scheumann GFW, Meyer HJ et al (1992) Cervical procedure at the aerodigestive tract in ad-vanced thyroid cancer. Chirurg 63:282–290
13. Dralle H, Scheumann GFW, Hundeshagen H et al (1992) Die transsternale zervikomediastinale Pri-märtumorresektion und Lymphadenektomie beim Schilddrüsenkarzinom. Langenbecks Arch Surg 377:34–44
14. Dralle H, Scheumann GFW, Kotzerke J, Brabant EG (1992) Surgical management of MEN 2. Rec Res Cancer Res 125:167–195
15. Dralle H, Damm I, Scheumann GFW et al (1994) Compartment-oriented microdissection of regio-nal lymph nodes in medullary thyroid carcinoma. Surg Today 24:112–121
16. Dralle H, Gimm O (1996) Lymphadenektomie beim Schilddrüsenkarzinom. Chirurg 67:788–806
17. Dralle H, Gimm O, Simon D et al (1998) Prophy-lactic thyroidectomy in 75 children and adole-scents with hereditary medullary thyroid carcino-ma: German and Austrian experience. World J Surg 22:744–751
18. Dralle H, Brauckhoff M, Machens A, Gimm O (2005) Surgical management of advanced thyroid cancer invading the aerodigestive tract. In: Clark OH, Duh QY, Kebebew E (eds) Textbook on endocrine sur-gery. 2nd edn. Elsevier Saunders, Philadelphia, p 318–333
19. Dralle H, Machens A (2008) Surgical approaches in thyroid cancer and lymph-node metastases. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 22:971–987
20. Dralle H, Machens A, Lorenz K (2008) Hereditäre Schilddrüsenkarzinome. Chirurg 79:1017–1028
21. Dralle H, Lorenz K, Machens A, Nguyen TP (2009) Postoperativer Zufallsbefund Schilddrüsenkar-zinom: chirurgisches Konzept. Dtsch Med Wo-chenschr 134:2517–2520
22. Dralle H, Lorenz K, Machens A (2009) Chirurgie der Schilddrüsenkarzinome. Chirurg 80:1069–1083
23. Dralle H, Machens A (2009) Lymph node dissection in thyroid cancer. In: Hubbard JGH, Inabnet WB, Lo CY (eds) Endocrine Surgery. Springer, London, pp 173–193
24. Garbe C, Albers P, Beckmann MW et al (2006) Kurz-gefaßte interdisziplinäre Leitlinien 2006. Deutsche Krebsgesellschaft e. V. Zuckschwerdt, München, S53–S61
25. Grillo HC, Suen HC, Mathisen DJ, Wain JC (1992) Resectional management of thyroid carcinoma in-vading the airway. Ann Thorac Surg 54:3–10
26. Grünwald F, Kalicke T, Feine U et al (1999) Fluori-ne-18 fluorodeoxyglucose positron emission to-mography in thyroid cancer: results of a multicen-tre study. Eur J Nucl Med Mol Imaging 26:1547–1552
27. Hartel W, Junginger TH (1996) Leitlinien der Thera-pie maligner Schiddrüsentumoren. Beilage zu den Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Chir-urgie. Heft 3
28. Ito Y, Tomoda C, Uruno T et al (2004) Papillary mi-crocarcinoma of the thyroid: how should it be trea-ted? World J Surg 28:1115–1121
29. Ito Y, Uruno T, Takamura Y et al (2005) Papillary mi-crocarcinomas of the thyroid with preoperative-ly detectable lymph node metastasis show signi-ficantly higher agressive characteristics on immu-no-histochemical examination.Oncology 68:87–96
30. Ito Y, Jikuzono T, Higashiyama T et al (2006) Clini-cal significance of lymph node metastasis of thyro-id papillary carcinoma located in one lobe. World J Surg 30:1821–1828
31. Ito Y, Tomoda C, Uruno T et al (2006) Clinical sig-nificance of metastasis to the central compart-ment from papillary microcarcinoma of the thyro-id. World J Surg 30:91–99
32. Ito Y, Miyauchi A (2007) Lateral and mediastina-le lymph node dissection in differentiated thyroid carcinoma: indications, benefits, and risks. World J Surg 31:905–915
33. Kloos RT, Eng C, Evans DB et al (2009) Medulla-ry thyroid cancer: Management guidelines of the American Thyroid Association. Thyroid 19:565–612
34. Kouvaraki MA, Lee JE, Shapiro SE et al (2004) Pre-ventable reoperations for persistent and recurrent papillary thyroid carcinoma. Surgery 136:1189–1191
676 | Der Onkologe 7 · 2010
Leitthema
35. Leboulleux S, Rubino C, Baudin E et al (2005) Prog-nostic factors for persistent or recurrent disease of papillary thyroid carcinoma with neck lymph node metastases and/or tumor extension beyond the thyroid capsule at initial diagnosis. J Clin Endocri-nol Metab 90:5723–5729
36. Lee YS, Kim SW, Kang HS et al (2007) Extent of rou-tine central lymph node dissection with small pa-pillary thyroid carcinoma. World J Surg 31:1954–1959
37. Machens A, Hinze R, Lautenschläger C et al (2001) Thyroid carcinoma invading the cervicovisceral axis: routes of invasion and clinical implications. Surgery 129:23–28
38. Machens A, Hinze R, Lautenschläger C et al (2001) Multivariate analysis of clinicopathologic parame-ters for the insular subtype of differentiated thyro-id carcinoma. Arch Surg 136:941–944
39. Machens A, Lautenschläger C, Thomusch O et al (2001) Extended surgery and early postoperative radiotherapy for undifferentiated thyroid carcino-ma. Thyroid 11:373–380
40. Machens A, Hinze R, Thomusch O et al (2002) Pat-tern of nodal metastasis for primary and reoperati-ve thyroid cancer. World J Surg 26:22–28
41. Machens A, Niccoli-Sire P, Hoegel J (2003) Ear-ly malignant progression of hereditary medullary thyroid carcinoma. N Engl J Med 349:1517–1525
42. Machens A, Holzhausen HJ, Lautenschläger C et al (2003) Enhancement of lymph node metastasis and distant metastasis of thyroid carcinoma. Can-cer 98:712–719
43. Machens A, Schneyer U, Holzhausen HJ et al (2005) Prospects of remission in medullary thyroid carci-noma according to basal calcitonin level. J Clin En-docrinol Metab 90:2029–2034
44. Machens A, Hauptmann S, Dralle H (2007) Increa-sed risk of lymph node metastasis in multifocal hereditary and sporadic medullary thyroid cancer. World J Surg 31:1960–1965
45. Machens A, Hauptmann S, Dralle H (2008) Predicti-on of lateral lymph node metastases in medullary thyroid cancer. Br J Surg 95:586–591
46. Machens A, Lorenz K, Dralle H (2009) Individuali-zation of lymph node dissection in RET carriers at risk for medullary thyroid cancer: value of prether-apeutic calcitonin level. Ann Surg 250:305–310
47. Machens A, Hauptmann S, Dralle H (2009) Lymph node dissection in the lateral neck for completion in central node-positive papillary thyorid cancer. Surgery 145:176–181
48. Machens A, Dralle H (2009) Prediction of media-stinal lymph node metastasis in papillary thyroid cancer. Ann Surg Oncol 16:171–176
49. Miyauchi A, Matsuzuka F, Hival K et al (2000) Unila-teral surgery supported by germline RET oncoge-ne mutation analysis in patients with sporadic me-dullary thyroid carcinoma. World J Surg 24:1367–1372
50. Modigliani E, Cohen R, Compos JM et al (1998) Prognostic factors for survival factors for survival and for biochemical cure in medullary thyroid car-cinoma: results in 899 patients. Clin Endocrinol (Oxf) 48:265–273
51. Moley JF, DeBenedetti MK (1999) Patterns of nodal metastases in palpable medullary thyroid carcino-ma: recommendations for extent of node dissecti-on. Ann Surg 229:880–888
52. Passler C, Scheuba C, Asari R et al (2005) Importan-ce of tumor size in papillary and follicular thyroid cancer. Br J Surg 92:184–189
53. Pulcrano M, Boukheris H, Talbot M et al (2007) Poorly differentiated follicular thyroid carcinoma: prognostic factors and relevance of histological classification. Thyroid 17:639–646
54. Qubain SW, Nakano S, Baba M et al (2002) Dis-tribution of lymph node micrometastasis in pN0 well-differentiated thyroid carcinoma. Surgery 131:249–256
55. Raffel A, Cupisti K, Krausch M et al (2004) Inciden-tally found medullary thyroid cancer: treatment ra-tionale for small tumors. World J Surg 28:397–401
56. Robbins KT, Medina JE, Wolfe GT et al (1991) Stan-dardizing neck dissection terminology. Arch Otola-ryngol Head Neck Surg 117:601–605
57. Robbins KT, Clayman G, Levine PA et al (2002) And the committee for Hand and Neck Surgery and Oncology, American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery. Neck dissection classifi-cation uptdate. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 128:751–758
58. Robbins RJ, Wan Q, Rewal RK et al (2006) Real-time prognosis for metastatic thyroid carcinoma based on 2-[18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose-positron emis-sion tomography scanning. J Clin Endocrinol Me-tab 91:498–505
59. Scheumann GFW, Gimm O, Wegener G et al (1994) Prognostic significance and surgical management of locoregional lymph node metastases in papilla-ry thyroid cancer. World J Surg 18:559–568
60. Schmid KW, Farid NR (2006) How to define follicu-lar thyroid carcinoma? Virchows Arch 448:385–393
61. Scollo C, Baudin E, Travagli JP et al (2003) Rationale for central and bilateral lymph node dissection in sporadic and hereditary medullary thyroid cancer. J Clin Endocrinol Metab 88:2070–2075
62. Shaha A (2001) Invited commentary. Minimal-ly invasive follicular thyroid carcinoma. Surgery 130:119–120
63. Sobrinho-Simoes M, Noguchi SU, Mazzaferri EL et al (2004) In: DeLellis RA, Lloyd RV, Heitz PU (eds) Tumours of endocrine organs. Pathology and ge-netics. World Health Organization classification of tumours. IARC Press, Lyon
64. Sugitani I, Kasai N, Fujimoto Y et al (2004) A novel classification system for patients with PTC: additi-on of the new variables of large (3 cm or greater) nodal metastases and reclassification during the follow-up period. Surgery 135:139–148
65. Sywak M, Cornfod L, Roach P et al (2006) Routine ipsilateral level 6 lymphadenectomy reduces post-operative thyroglobulin levels in papillary thyroid cancer. Surgery 140:1000–1007
66. Vasko V, Hu S, Wu G et al (200s5) High prevalence and possible de novo formation of BRAF mutation in metastasized papillary thyroid cancer in lymph node. J Clin Endocrinol Metab 90:5265–5269
67. Wada N, Duh QY, Sugino K et al (2003) Lymph no-de metastasis from 259 papillary thyroid microcar-cinomas. Ann Surg 237:399–407
68. White ML, Gauger PG, Doherty GM (2007) Central lymph node dissection in differentiated thyroid cancer. World J Surg 31:895–904
69. Wittekind CH, Greene FL, Henson DE et al (2003) TNM supplement. 3rd ed. Wiley-Liss, New York. 25–30
S3-Leitlinie Prostatakarzinom
Das Prostatakarzinom ist die häufigste bös-artige Neubildung beim Mann; jährlich erkranken allein in Deutschland 60 000 Männer. Leitlinien mit Empfehlungen und Feststellungen zu Früherkennung, Diagnose und Behandlung sind daher sowohl für
die behandelnden Ärzte als auch die Patienten von großer Bedeutung, um eine individuell zuge-schnittene, qualitativ hochwertige Therapie zu ermöglichen. Im Herbst 2009 wurde mit der „S3-Leitlinie
Prostatakarzinom“ von der Deutschen Gesell-schaft für Urologie eine interdisziplinäre evi-denzbasierte Leitlinie zum Prostatakarzinom vorgestellt. Das Leitthemenheft „S3-Leitlinie Prostatakarzinom“ der Fachzeitschrift „Der Urologe“ (Ausgabe 2/10), beschäftigt sich umfassend mit der neuen Leitlinie und ihrer Anwendung.
Es beinhaltet Beiträge zu folgenden Themen:F Methodik und Entwicklungsprozess der
S3-Leitlinie zum ProstatakarzinomF Probleme, Zielsetzung und Inhalt der
Früherkennung beim Prostatakarzinom F Bildgebende Verfahren bei Primärdiagno-
se und Staging des Prostatakarzinoms F Ein Paradigmenwechsel. Defensive
Strategien zur Behandlung des lokal be-grenzten Prostatakarzinoms in der neuen S3-Leitlinie
F Pelvinale Lymphadenektomie und radi-kale Prostatektomie. Empfehlungen der S3-Leitlinie
F Strahlentherapie des Prostatakarzinoms in der neuen S3-Leitlinie
F Die systemische Therapie des metastasier-ten Prostatakarzinoms
F Der RezidivtumorF Risiken und Prävention des Prostata-
karzinoms
Bestellen Sie diese Ausgabe zum Preis von EUR 43,- bei:Springer Customer Service CenterKundenservice ZeitschriftenHaberstraße 769126 HeidelbergTel.: +49 6221-345-4303Fax: +49 6221-345-4229E-Mail: [email protected]
Lesetipp
677Der Onkologe 7 · 2010 |