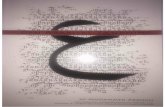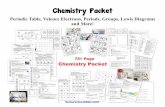Soziologie studieren. – Einblicke in den Alltag des Soziologiestudiums
-
Upload
xn--universitt-siegen-yqb -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Soziologie studieren. – Einblicke in den Alltag des Soziologiestudiums
2
Inhalt I. Gebrauchsanweisung für dieses Buch .................................................................................. 3
II. Warum Soziologie? .............................................................................................................. 6
1. Mein Weg zum Soziologiestudium ................................................................................... 6
1.1. Von der Bundeswehr über Hannibal Lecter zur Soziologie.......................................... 6
1.2. Soziologie als Neuentdeckung altbekannter Themen ................................................. 8
2. Warum hast du dich für das Soziologiestudium entschieden? ...................................... 10
2.1. Alltag, Gesellschaft und Identität ............................................................................... 10
2.2. Die Wahl der Uni ........................................................................................................ 12
III. Soziologie studieren. Wie gestaltet sich dein Soziologiestudium im Alltag? .................... 14
1. Welche Lehrformen kommen im Soziologiestudium vor? ............................................. 14
2. Welche Arbeitsweisen werden im Soziologiestudium ausgebildet und angewandt? ... 18
2.1. Lesen, diskutieren, recherchieren und Referate halten ............................................ 18
2.2. Methoden der empirischen Sozialforschung ............................................................. 20
3. Welche Prüfungsformen gibt es? ................................................................................... 22
4. Vom Bachelor zum Master? ........................................................................................... 25
IV. Soziologie jenseits von Credit Points, Stundenplan und Modulkatalog. Wie sieht dein
Studium neben dem obligatorischen Studienalltag aus? ................................................. 30
1. Welche Möglichkeiten bieten sich am Institut erste wissenschaftliche Arbeit
aufzunehmen? ................................................................................................................ 30
2. Wie kann man sich in studentischen Gremien engagieren? .......................................... 32
3. Lohnt sich ein Auslandsemester? ................................................................................... 36
3.1. Sich neu auf sein Studium einlassen .......................................................................... 36
3.2. „Ein Auslandssemester - immer eine gute Idee?“ ..................................................... 38
4. Wie gestaltet sich ein Hochschulwechsel in der Soziologie? ......................................... 41
5. Ist es sinnvoll, sich neben dem Studium in studentisch organisierten Eigeninitiativen zu
engagieren? .................................................................................................................... 43
V. Wozu Soziologie? ............................................................................................................... 46
1. „Und was macht man dann damit?“ .............................................................................. 46
2. Erst die Party, dann das Semester! ................................................................................ 48
VI LINKS ................................................................................................................................. 52
VII Einführungsliteratur .......................................................................................................... 52
3
I. Gebrauchsanweisung für dieses Buch
Liebe Soziologieinteressierte,
wenn es sich hier um eine Gebrauchsanweisung handelt, dann in dem Sinne, dass wir dich
darauf vorbereiten wollen, was du von diesem Heft erwarten darfst. Außerdem wollen wir dir
vorschlagen, wie du je nach Interessenlage dieses Heftes lesen kannst:
Nach dem Abi-Stress, nun der Stress um die Entscheidung zu einem Studium? Manche wis-
sen gleich nach dem Schulabschluss oder schon lange vorher wohin sie in der Arbeitswelt spä-
ter wollen und wie sie dies bewerkstelligt bekommen. Andere dagegen verabschieden sich erst
mal für kurz oder lang in die weite Welt. Für die meisten steht jedoch die Entscheidung für ein
Studienfach an. Dies muss jedoch nicht in Stress oder tagelangen, ziellosen Suchprozessen in
Internet oder Behörden ausarten. Vieles ist möglich. Das Richtige für sich zu finden, ist aber
manchmal gar nicht so einfach. Diese studentische Einführung in den Studienalltag der Sozio-
logie soll prägnant und umfassend Grundlagen und Möglichkeiten aufzeigen und bei der Wahl
für oder gegen ein Soziologiestudium behilflich sein.
2010 haben sich Studierende der Friedrich-Schiller-Universität Jena, unterstützt durch ei-
nen Erasmus-Studenten aus der Schweiz, zusammengefunden, um fernab von komplizierten
theoretischen Einführungen und unverständlichen Modulkatalogen, mittels eines an der All-
tagspraxis orientierten Studienratgebers, einen Einblick in den Alltag von Soziologiestudieren-
den zu geben. Ziel war es, eine Lücke im Bereich der Ratgeberliteratur für angehende Studie-
rende zu füllen. Dieses Heft unterscheidet sich maßgeblich von der bisherigen Literatur, da es
gleichzeitig eine Einführung in die Soziologie als Fach und ein Einblick in die Perspektive einiger
Soziologiestudenten bietet. Außerdem erklärt es die Studien- und Prüfungsordnungen und er-
gänzt so die Angaben, welche für gewöhnlich von den jeweiligen soziologischen Instituten im
Internet zu finden sind. Eine Liste empfehlenswerter Einführungsliteratur findest du ebenso
wie hilfreiche Links am Ende des Heftes.
Unsere Absicht ist es weder erstes fachliches Wissen zu vermitteln, noch die gar themati-
sche und institutionelle Breite der Soziologie darzustellen. Stattdessen wollen wir auf einer
bewusst praxisnahen Ebene über die verschiedenen Bereiche des Studiums der Soziologie
sprechen, wenngleich an den Rändern selbstverständlich auch Fragen nach der Soziologie im
Allgemeinen und der institutionalisierten Studienordnung aufgeworfen werden müssen.
Anhand eines systematischen Fragenkatalogs werden alle wesentlichen Bereiche des Sozio-
logiestudiums thematisch erfasst. In unterschiedlichster Form wird ein persönlicher und zu-
4
gleich möglichst umfassender Zugang zu Gestaltungsspielräumen während des Studiums auf-
gezeigt. Die Antworten sind inhaltlich aufeinander abgestimmt und so kurz gehalten, dass man
sich auf wenigen Seiten einen Überblick zu den entsprechenden Bereichen verschaffen kann.
Wenngleich eine gewisse Chronologie beabsichtigt ist, wird dennoch ein flexibles, zielorientier-
tes und kurzweiliges Lesen des Ratgebers ermöglicht. Man kann das Buch also von vorn nach
hinten durchlesen, aber sich auch einzelne Fragen herauspicken. Zur Übersichtlichkeit sind die
Schlüsselbegriffe oder –fragen fett markiert.
Wir haben uns weitestgehend auf unsere eigenen Erfahrungen gestützt und glauben, dass
sich die Eine oder der Andere darin wiederfindet, zumindest aber sollten unsere Darstellungen
anschlussfähig sein. Findest du dich darin nicht wieder, dann keine Bange: Die Wege in und um
das Studium der Soziologie sind so vielfältig wie die Soziologie selbst.
Das Buch ist chronologisch nach Stadien des Studiums gegliedert. Kapitel II steht vor dem
Beginn des Studiums und fragt danach, warum man Soziologie studiert. Einerseits zeigen wir
euch beispielhaft, wie einige von uns auf die Soziologie aufmerksam geworden sind, anderseits
warum und aus welchen Gründen wir uns für ein Soziologiestudium entschieden haben. Dieses
Kapitel ist für diejenigen wertvoll, die sich noch nicht sicher sind, ob ein Soziologiestudium das
Richtige für sie ist. Außerdem werden all jene angesprochen, die gar nicht wissen, was Soziolo-
gie eigentlich alles beinhaltet.
Kapitel III ist besonders für diejenigen interessant, die sich bereits für ein Soziologiestudium
entschieden haben, aber noch nicht genau wissen, wie dieses aufgebaut ist. Es zeigt euch die
Strukturen und Dimensionen des Studienalltags. Dieser umfasst u.a. Lehrformen, Arbeitswei-
sen und Prüfungsformen. Es soll euch darauf vorbereiten, wie soziologische Inhalte vermittelt
werden, wie soziologisches Forschen aussieht und welche Leistungen ihr erbringen müsst, um
das Studium erfolgreich absolvieren zu können.
Kapitel IV zeigt wo und wie ihr euch neben der Studienordnung und dem Modulkatalog zu-
sätzlich engagieren könnt. Dabei wird immer wieder der Bezug zu den eigenen Studienbedin-
gungen und Studieninhalten aufgezeigt. Dieses Kapitel ist also für diejenigen, die etwas mehr
als das dünne Brett bohren wollen und die Uni mitgestalten oder einfach mal über den Teller-
rand der eigenen Uni oder der Pflichtseminare hinaus schauen oder erste praktische Erfahrung
sammeln wollen. Dies umfasst die Mitarbeit am Institut, die studentische Selbstverwaltung,
das Praktikum, das Auslandsstudium oder den Hochschulwechsel.
Neben dem eher spezifischen oder unspezifischen Interesse an der Soziologie, zeigt dir Ka-
pitel V schließlich, was du später mit einem Soziologiestudium machen kannst. Dieses Kapitel
5
richtet sich an die Pragmatiker, die gerne konkrete Vorstellung darüber haben wollen, welche
Berufsperspektiven und Anwendungsfelder es für angehende Soziolog_innen gibt.
Im ersten Semester kann man natürlich noch nicht alles wissen. Diese kleine Einführung soll
euch jedoch die ersten Studientage erleichtern. Ohne Eigeninitiative ist aber kein Studium zu
meistern, deshalb kommt es besonders auf euch selbst an: setzt Prioritäten, findet Gleichge-
sinnte, nehmt euch Zeit, fragt Kommilitonen und schaut hinter die Kulissen. Ein Studium bietet
vielfältige Möglichkeiten. Denkt immer daran, dass es mehr gibt als das bloße Studieren.
Viel Spaß beim Lesen!
6
II. Warum Soziologie?
1. Mein Weg zum Soziologiestudium
1.1. Von der Bundeswehr über Hannibal Lecter zur Soziologie
Von Jan Kalies
Mein Weg zur Soziologie war nicht von Anfang an geplant. Viel mehr haben mich einige Zu-
fälle ins Soziologiestudium getrieben. Ursprünglich wollte ich gar nicht studieren. Nach der
Schule war mein Motto zunächst: „Nie wieder Schulbank drücken, nie wieder lernen und nie
wieder irgendwelche Prüfungen!“ Natürlich war diese Haltung alles andere als durchdacht,
denn auch in einer Ausbildung muss man die Berufsschule besuchen und Prüfungen absolvie-
ren. Aber soweit dachte ich damals nicht. Ich war einfach nur froh, endlich aus der Schule raus
zu sein. Diese Einstellung änderte sich dann schlagartig während meiner Zeit im Grundwehr-
dienst bei der Bundeswehr. Die vielen negativen Erfahrungen dieser neun Monate beim Bund
führten tatsächlich dazu, meine „Anti-Studium-Haltung“ aus der Schulzeit aufzugeben und
mich ganz neu zu orientieren.
Mein Tagesablauf während der Grundausbildung begann damit, mich nach dem Aufstehen
anbrüllen zu lassen und dem „Befehl“ Folge zu leisten: in den Waschraum zu gehen, mich zu
waschen, die Zähne zu putzen, mich gegebenenfalls zu rasieren und mich dann ordnungsge-
mäß anzukleiden. Dass es sich hierbei um Tätigkeiten handelte, die ich bisher sowieso jeden
Morgen „ausgeführt“ hatte, (weshalb es eigentlich keiner Anordnung bedurft hätte) brauche
ich hier nicht zu erwähnen. Es hätte mich kaum verwundert, wenn man mir noch befohlen hät-
te, meine Zähne in kreisenden Bewegungen immer schön vom Zahnfleisch weg zu putzen und
bei der Rasur darauf zu achten, nicht gegen den Strich zu rasieren. Der Logik nach wäre dies
absolut vorstellbar gewesen. Der weitere Tagesverlauf blieb dem Morgenritual strukturell ver-
bunden: brüllend wurde gesagt, was zu tun und zu unterlassen sei. Brüllend wurde uns beige-
bracht, wie man sich ordnungsgemäß tarnen muss und brüllend wurde uns gezeigt, wie man
durch den Schlamm kriecht und was sonst noch so zu einem „waschechten Soldaten“ gehört.
Da das autoritäre Geschrei die einzige Kommunikationsmethode darstellte, die die Bundes-
wehr kannte, bekam ich schon bald das Gefühl, dass es sich bei der Bundeswehr eigentlich um
ein Sammelsurium manischer Choleriker handelt. Mir wurde irgendwie klar, dass es tatsächlich
besser ist, nicht immer hin zuhören und dabei trotzdem höllisch darauf zu achten, das „Weg-
7
hören“ mit gespielter Aufmerksamkeit zu überdecken. Denn nichts ist schlimmer, als sich von
seinen Vorgesetzten bei privater Träumerei erwischen zu lassen, abgesehen vielleicht von akti-
ver Opposition, einer eigenen Meinung und lästigen Fragen nach dem Sinn.
Nach meiner Grundausbildung wurde der Tonfall etwas ruhiger; dafür die Aufgaben umso
langweiliger. Neben der Annahme von Patient_innen (Ich war im Sanitätsdienst.), musste ich
mit dem alphabetischen Sortieren unzähliger Akten vorlieb nehmen. Außerdem gehörte es zu
meiner Pflicht, bei den Übungen der anderen Kompanien daneben zu sitzen und Kopfschmerz-
tabletten zu verteilen. Einmal in der Woche wurden diese Aktivitäten durch das Aufräumen
und Säubern der Räumlichkeiten aufgelockert. Alles in allem waren es jedenfalls keine intellek-
tuell sonderlich anspruchsvollen Aufgaben, zumal mir auch weiterhin alle Aufgaben diktiert
wurden.
Dennoch, es waren diese neun Monate staatlich initiierter Infantilisierung und intellektuel-
ler Verwahrlosung, die mich zu der Einsicht brachten, dass es besser wäre, doch etwas mehr
Zeit in Bildung zu investieren und ein Studium aufzunehmen. Ich wollte nicht irgendwann als
willenloser, befehlsgehorsamer Zombie enden. Aus dem Grund habe ich auch nach meinem
Austritt aus der Bundeswehr den Großteil meines Entlassungsgeldes in Sach- und Fachbücher
aller Art investiert, wenngleich die meisten davon psychologische Themen zum Inhalt hatten.
Zu dem Entschluss ein Studium der Sozial- und Verhaltenswissenschaften zu beginnen,
führten zum einen Beobachtungen während meiner Bundeswehrzeit. Beispielsweise verwun-
derte mich, dass sich die Vorgesetzten mir gegenüber anders verhielten als gegenüber den Pa-
tient_innen und vor allem gegenüber den Ärzt_innen. Man hofierte den Vorgesetzten und ließ
die „Rangniederen“ die ganze Gewalt des eigenen autoritären Egos spüren. Was veranlasste
die betreffenden Personen sich derart zu verhalten?
Zum anderen verspürte ich damals eine gewisse Faszination für die Figur des Hannibal
Lecter aus „Schweigen der Lämmer“ und hatte ein wenig Freud gelesen, weshalb ich eigentlich
Psychologie studieren wollte. Das Fach war ja schließlich auch recht bekannt und beliebt und
die Psychologie schien mir als Wissenschaft äußerst wichtig zu sein. Von der Soziologie hatte
ich hingegen bis dahin noch nie etwas gehört.
Nur die komplizierten Anmeldeformalitäten und die Wartesemester, die ich für dieses Stu-
dium hätte in Kauf nehmen müssen, ließen mich noch einmal nach Alternativen Ausschau hal-
ten. Und da ich wirklich keine Lust auf eine längere Phase der Arbeitslosigkeit hatte, versuchte
ich es mit Soziologie. Meine Fragen wurden mir zu meiner Überraschung auch hier mehr als
zufriedenstellend beantwortet.
8
1.2. Soziologie als Neuentdeckung altbekannter Themen
Von Simon Bohn
Ich komme aus einer Kleinstadt in Brandenburg und das Wort „Soziologie“ kennen dort
wahrscheinlich die Wenigsten. Auch mir waren zu Schulzeiten soziologische Theorien und die
großen Soziologen weitestgehend unbekannt und so war die Soziologie für mich persönlich
eine große Neuentdeckung, allerdings von „altbekannten“ Themen. Denn dass man selbst
„auf dem Lande“ über soziologische Problemstellungen spricht und soziale Konflikte nicht ohne
Rückgriff auf soziologische Überlegungen diskutiert, ist zwar kaum jemandem bewusst, aber
wurde mir im Studium bald klar.
In unserer Kleinstadt gab es, wie in vielen ostdeutschen Provinzen, ein ganz beachtliches
„Nazi-Problem“ und ich war nun mit 17 Jahren gerade in einer Phase, in der mich das was an-
ging. Ich war tagtäglich damit konfrontiert und ich hatte die nötigen Ressourcen zur Verfügung,
um mich diesem Problem zu stellen. Natürlich war ich nicht allein. Zusammen mit einigen gu-
ten Freunden bildeten wir eine „Jugend-Antifa“, vernetzten uns mit anderen linken Gruppie-
rungen in der Stadt und auch mit den großen Antifas in Berlin. In dieser Konstellation machten
wir der Nazi-Szene über einige Jahre hinweg ziemlichen Druck. Wir veranstalteten Anti-Nazi-
Demos, Vorträge zu Themen wie Rassismus und Antisemitismus oder aber auch Partys am 8.
Mai (Tag der Befreiung). Über die Antifa kam man natürlich in Kontakt mit anderen Themenfel-
dern: wachsende soziale Ungleichheit, welche gängiger Weise mit Kapitalismus assoziiert
wurde, dem man dann wiederum die zauberhafte Utopie des kosmopolitischen Kommunismus
entgegen schleuderte; die deutsche Ausländer- bzw. Asylpolitik und der bis dahin (ca. 2004)
noch vergleichsweise klein gehaltene deutsche Nationalismus (da hat sich in den letzten Jah-
ren durch Kampagnen wie „Du bist Deutschland“ oder durch die Fußball-Weltmeisterschaft
2006 einiges verändert); die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen und was man ge-
meinhin unter Sexismus zusammen fasst. All diese „Ismen“ waren für uns in der Zeit der gym-
nasialen Oberstufe neben der Schule ein äußerst spannendes Feld, voll von persönlicher und
politischer Brisanz und von großem identitätsbildendem Potential. Denn dass man „in der Anti-
fa“ war, zu Demos und Gedenkveranstaltungen in ganz Deutschland fuhr, sich auf Wochenend-
Seminaren mit Marx und Freud und der Kritischen Theorie auseinander setzte, das hatte alles
schon sehr großen Einfluss auf die eigene Gedankenwelt und das Selbstbild. Man könnte also
sagen, dass ich schon während der Schulzeit durch meine politischen Aktivitäten einen Großteil
meiner Freizeit auf Themen, Theorien und Denker_innen verwandte, die dann später und zu
meiner Überraschung die Soziologie bzw. das Soziologiestudium ganz wesentlich bestimmten.
9
Fast alle meine Freunde gingen nach dem Abitur an die Universität und die meisten von ih-
nen wählten ein geisteswissenschaftliches Fach, denn hier sah jede und jeder für sich die Chan-
ce, den eigenen politischen und „revolutionären“ Neigungen auf ihre/seine Art nachzugehen.
Die „Psycholog_innen“ unter ihnen interessierten sich für das kollektive Unbewusste, unter-
drückte Triebregungen und psychosoziale Gruppenbildungsprozesse. Die angehenden Politik-
wissenschaftler_innen beschäftigten sich fortan mit autoritären Staaten und diktatorischen
politischen Systemen. Die Erziehungswissenschaftler_innen plagten sich mit der „Erziehung
nach Auschwitz“ (Theodor W. Adorno) oder dem Begriff von Bildung. Ich selbst bin in der Sozio-
logie gelandet und das mehr oder weniger durch einen glücklichen Zufall. Denn wie oben er-
wähnt, war ich mit der Soziologie ja keineswegs in dem Sinne vertraut, wie man es durch das
Studium (hoffentlich) wohl wird.
Im Soziologiestudium konnte ich in vielen Punkten an meine Vorüberlegungen aus „Antifa-
Zeiten“ anknüpfen. Die politische Kapitalismuskritik fand ihren Widerhall in der Kapitalismus-
analyse der Wirtschaftssoziologie, bei mikrosoziologischen Ansätzen zu Identitäts- und Grup-
penbildung konnte ich auf meine Kenntnisse zum Rassismus und Nationalismus zurück greifen,
in der Genderforschung auf Kenntnisse über die Frauenemanzipation und alltäglichen Sexis-
mus aufbauen und in der Bewegungsforschung (eine der unzähligen Bindestrich-Soziologien)
auf Erfahrungen in „meiner“ Jugendbewegung.
Im Grunde kann man aber wirklich viele Alltagserfahrungen in das Studium der Soziologie
einbringen und man muss nicht unbedingt politisch aktiv gewesen sein, um auf die zahlreichen
Verbindungen zwischen öffentlichen und medialen Diskursen und denen der Soziologie auf-
merksam zu werden.
Dass ich meinen Interessen aus der Schulzeit auch im Studium so unbefangen nachgehen
kann, ist ein glücklicher Zufall, nicht nur weil die Soziologie ein so breites Themenspektrum ab-
deckt und ich mich durch meinen politischen Hintergrund schnell in ihr zurecht finden und es
mir bequem machen konnte. Inzwischen weiß ich, dass die soziologischen Institute jeweils ganz
unterschiedliche Forschungsprofile aufweisen und ich daher sicherlich nicht an jeder Universi-
tät so leichtfüßig den Einstieg in die Soziologie gefunden hätte.
Außerdem glaube ich, dass es bei der Auswahl des Studiums und auch des Studienortes
wichtig ist zu wissen, warum man dieses Fach studieren möchte. Denn gerade weil das Soziolo-
giestudium i.d.R. nicht auf einen festgelegten Beruf oder ein eindeutiges Arbeitsfeld ausgerich-
tet ist, fällt es vielen Studierenden in der Anfangszeit wirklich schwer, sich in der Fülle von mög-
lichen Themen und Forschungsgebieten zurechtzufinden. Irgendein Thema muss regelrecht
unter den Nägeln brennen, dann erst bringt man die nötige Energie fürs Studium auf! Für mich
10
war der innige Wunsch, weiterhin an meinen politischen Idealen zu feilen und an gesellschaftli-
chen Problemstellungen zu arbeiten, eine wichtige Orientierung. Gerade das Ziel, Gesellschaft
nicht nur zu verstehen (was den wenigsten je gelingen wird), sondern verändernd auf sie ein-
zuwirken, war für mich in den Anfangsjahren des Studiums ganz zentral und ist es im Grunde
bis heute.
2. Warum hast du dich für das Soziologiestudium entschieden?
2.1. Alltag, Gesellschaft und Identität
Von Markus Flück
Wieso ist die gesellschaftlich anerkannte Beziehungsform eigentlich eine heterosexuelle,
monogame Beziehung? Wären polygame Beziehungen etwa nicht praktizierbar? Wie verbindet
Mode gesellschaftlichen Mainstream und persönliche Ausdrucksformen? Was ist eigentlich der
Unterschied zwischen der Arbeitslosenquote und der Erwerbslosenquote? In welchem Ver-
hältnis steht Arbeitslosigkeit zu der Erwerbsquote und der Erwerbstätigenquote? Inwiefern ist
Arbeitslosigkeit selbst verschuldet, inwiefern ist sie ein gesellschaftliches Phänomen? Wie
kommt es zu einem gesellschaftlichen Konsens, was den Atomausstieg anbelangt? Wieso sind
bei mir im Studium fast nur Kinder von Akademiker_innen, während Kinder von Arbei-
ter_innen kaum repräsentiert sind?
Es sind diese Fragen, die sich mir in der einen oder anderen Weise immer wieder stellen,
mit denen wir alle oft sanft (im Rahmen eines Familienfestes) und manchmal sehr unsanft (in
Form von selbst erlebter Arbeitslosigkeit) konfrontiert werden, - sei es in den Medien, im
Freundeskreis, Schule oder Beruf - welche mich letztlich zum Studium der Soziologie motiviert
haben. Ich wollte einen Blick hinter die Bühne (Goffman(1959): „Wir alle spielen Theater“) un-
seres Alltags (kollektive und individuelle Rhythmen der Erwerbsarbeit, Freizeit, Reprodukti-
onsarbeit, Schlafen etc.) werfen. Hinter die „Bühne Gesellschaft“, auf der wir uns Tag für Tag
bewegen, Rollen innehaben als Freund_in, Einzelhandelskaufmann/frau, Schüler_in etc.. Um-
geben von einer von Menschen gemachten Kulisse: Im Kaufhaus, beim Fußball, im Klinikum, an
der Uni, ja selbst da, wo ich denke, ganz allein zu sein, beispielsweise in meinem Zimmer, ist
Gesellschaft da und über Medien (Internet, Fernseher, Bücher etc.), Objekte oder Verhaltens-
weisen präsent. Wenn ich schlafen gehe auf dem Bett einer großen schwedischen Möbelkette,
steht dahinter eine gesellschaftliche Produktionskoordination, die sehr voraussetzungsreich
11
ist. Jedes Wort, das ich spreche, ist gesellschaftlich mit Sinn angereichert, der sich zwar verän-
dern kann, aber immer nur im Verlauf eines intersubjektiven Prozesses.
Zusammenhänge, die auf den ersten Blick keine zu sein scheinen, entdecken und nicht zu-
letzt handelnd eingreifen in dieses amorphe, kaum greifbare, aber dennoch manifeste Etwas
namens Gesellschaft, das ist es, was mich motiviert hat. Kritik ist dabei die Nahtstelle zwischen
Wissenschaft und dem Politischen. Da wo kritische Soziologie fragt: Wieso die gesellschaftli-
chen Verhältnisse sind, wie sie sind und zeigt, dass sie nicht so sein müssen, schlägt die Analy-
se um in Handlung.
Soziologie ist zudem enorm anschlussfähig an andere Wissenschaftsbereiche, bspw. an die
Sprachwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Kulturwissenschaften, aber auch an die Na-
turwissenschaften. Dies zeigt sich an den unzähligen Bindestrich-Soziologien und führt zu ei-
nem sehr weiten Forschungsspektrum, dass für alle Interessen etwas bereithält. Die Anwen-
dung der Methoden der quantitativen Sozialforschung ermöglicht es dabei einen Überblick
über das große Ganze zu erhalten, während qualitative Methoden einen tieferen Einblick in
Einzelphänomene ermöglichen.
Das Studium der Soziologie muss nicht, kann aber einen wesentlichen Beitrag zur Beant-
wortung der Frage nach der Identität leisten. Denn durch den Einblick in die Vielfalt an mögli-
chen Lebensgestaltungsformen und –zwängen können Handlungspotentiale geschöpft werden.
Diese gründen sich auf dem Bewusstsein, dass feste Identitäten, seien es nationale, familiäre,
geschlechtliche oder persönliche durch Ritualisierung (zum Beispiel im Rahmen von Feierta-
gen) hervorgebracht und weitergegeben werden, hochgradig symbolisch aufgeladen sind (zum
Beispiel Nationalflaggen, Hymnen, Kleidung) und letztlich immer eine spezifische, soziale Kon-
struktion darstellen. Daraus ergibt sich ein Verständnis der Welt, das nicht relativistisch, son-
dern relational vorgeht, also versucht Verbindungen aufzuzeigen und herzustellen.
Die dezidierte Anschlussfähigkeit soziologischer Fragestellungen an Alltagsphänomene
macht meiner Meinung nach den besonderen Reiz dieses Faches aus. Soziolog_innen sind im-
mer schon Teil eines sozialen Gefüges, von Macht- und Herrschaftsverhältnissen, eingewoben
in kulturelle Codes, die wir in unserem Alltagsleben unhinterfragt anwenden (z.B. Begrüssungs-
floskeln), die aber bei genauerer Betrachtung sehr aufschlussreich sind.
Das Spannungsfeld zwischen Individuum und Gesellschaft stellt dabei eine der zentralen
Analyseachsen der Soziologie dar. Individuelle Freiheit und gesellschaftliches „Gemachtsein“
gehen dabei immer Hand in Hand (bspw. in der Mode, aber auch bezüglich der Vertragsfrei-
heit). Die gesellschaftliche Arbeitsteilung und die Ausdifferenzierung haben hochgradig, kom-
plexe Gesellschaften hervorgebracht, die heute vor allem über Märkte und Bürokratien regiert
12
und reguliert werden. Einen Blick auf die Funktionsmechanismen und Handlungsrationalitäten
dieser gesellschaftlichen Institutionen zu werfen, ist ein Abenteuer namens Soziologie.
2.2. Die Wahl der Uni
Von Naby Berdjas
Die Wahl der Universität ist unter anderem dafür bedeutsam, welche inhaltlichen und me-
thodischen Schwerpunkte die Studierenden begleiten und prägen werden. Wer sich ‚blind’ für
eine Universität entscheidet, kann dies im Verlauf seines Studiums bereuen. Besonders für je-
ne, die schon vor dem Studium ein ganz bestimmtes Interesse (z.B. Geschlechterforschung,
Umweltsoziologie etc.) oder eine bevorzugte Herangehensweise (z.B. eher empirisch-
statistisch) aufweisen, kann die Entscheidung für eine Uni, an der all die Interessengebiete der
Studierenden nicht gelehrt werden, zu viel Frust während des Studiums führen.
Aber auch den angehenden Studierenden, die sowohl methodisch als auch thematisch völ-
lig offen sind, kann es nicht schaden, sich über die Schwerpunkte der verschiedenen Universi-
täten schlau zu machen. Vielleicht bilden sich Interessen bereits während der Suche heraus.
Oder aber man merkt schon währenddessen, dass deutschlandweit keine Uni auch nur im An-
satz den eigenen Interessen entspricht. Selbst wenn dieser „worst case“ eintritt, ist man zu-
mindest so weit zu wissen, was man nicht studieren will. Einen Überblick zu den Ausrichtungen
soziologischer Institute findet man auf: soziologiestudium.info.
Es ist mehr als unwahrscheinlich, dass eines der Institute zu hundert Prozent Lehrstoff an-
bietet, der dich fesselt. „Saure Äpfel“ gibt es überall und an jeder Uni schmecken sie gleich.
Aber wenn das ganze Studium nur daraus besteht, sich Modul für Modul durchzubeißen, dann
sollte man sich doch eine Denkpause nehmen und sich fragen, ob Studienfach oder Universi-
tätsstandort gewechselt werden sollten.
Viele Studierende können aber nicht einfach so Fach und Standort wechseln, sobald das
Studium einmal aufgenommen wurde. So kann es z.B. Probleme mit dem BAföG–Amt geben,
da nach einem Fachwechsel die Regelstudienzeit des neuen Faches eine Verlängerung der fi-
nanziellen Leistungen bedeuten würde. Oder es können Probleme mit der Anerkennung ein-
zelner Module an anderen Hochschulen auftreten. Um solchen Problemen schon vor Studien-
beginn entgegenzuwirken, erscheint eine intensive Auseinandersetzung mit den verschiede-
nen Uni-Schwerpunkten als sehr sinnvoll.
13
Das Fach Soziologie wird sowohl an technischen Universitäten, als auch an sogenannten
Volluniversitäten angeboten. Als Volluniversität gelten Hochschulen, an denen in der Regel alle
grundlegenden natur-, geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen sowie Wirt-
schaftswissenschaften, Jura und Medizin angeboten werden. Dies betrifft die Forschung eben-
so wie den Lehrbetrieb.
Ein Studium ist, wenn man nicht das Glück hat, wohlhabende Eltern oder Erziehungsberech-
tigte allgemein unterstützend „hinter“ sich zu wissen, meist mit einem erheblichen Kosten-
aufwand verbunden. Dabei spielt es nicht nur eine Rolle, ob man BAföG– Gelder oder ein Sti-
pendium erhält. Die Wahl des Studienstandortes ist, wenn finanzielle Faktoren berücksichtigt
werden müssen, in Punkto Lebenshaltungskosten und Mietpreis nicht unbedeutend. Nicht
überall in Deutschland sind die Mietpreise gleich hoch und der Alltag gleich kostenintensiv. Vor
allem aber schlägt sich die Entscheidung für bzw. gegen einen Studienstandort in Sachen Fi-
nanzen darin nieder, ob Studiengebühren zusätzlich zum Semesterbeitrag erhoben werden
oder nicht. Dies ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt.
Hochschul-Rankings sind mit äußerster Vorsicht zu betrachten. Zum einen sind die ange-
wendeten Methoden teils fragwürdig oder nicht nachvollziehbar. So finden u.a. nicht selten
auch Institute ohne komplette Datengrundlage Eingang in Rankings oder Datensätze werden
nicht veröffentlicht. Zum anderen fördern Rankings eine der Freiheit von Forschung und Lehre
entgegenstehende akademische Konkurrenzkultur, welche zwangsweise Verlierer und Gewin-
ner erzeugt, jedoch nicht zur Steigerung der Qualität der wissenschaftlichen Forschung und
Lehre beiträgt.
14
III. Soziologie studieren. Wie gestaltet sich dein Soziologiestu-
dium im Alltag?
1. Welche Lehrformen kommen im Soziologiestudium vor?
Von Christian Nehl und Michael Wutzler
Montag 8.16 Uhr: Ich hab's geschafft, die Vorlesung nicht zu verschlafen. Nur die anderen
scheinen munterer zu sein als ich. Zum Glück gibt es das akademische Viertel. Ein Höllenlärm
im Hörsaal, mehrere hundert Student_innen auf einem kleinen Raum machen einfach Krach,
auch wenn sie sich nur unterhalten. Die Dozentin fängt mit ihrer Vorlesung an, ist jedoch kaum
zu hören, auch das Mikro hat wenig gebracht. Schon kommt die erste Beschwerde: „Könnten
Sie bitte etwas lauter sprechen!“ - wir könnten auch leiser sein. Links hinter mir geht es um das
Finale von irgendeiner Casting-Show; vor mir spielt jemand an seinem Laptop ein Online-
Game; was schaut die da vorne rechts mich so komisch an oder schaut sie über mich drüber?
Ah, da kommt noch Stefan, er hat es also auch geschafft; er sieht mich und setzt sich zu mir,
nachdem er sich durch die Reihe gequetscht hat. Inzwischen wechselt die Power-Point-
Präsentation schon zur achten Folie. Ich hätte mich einfach weiter vorne hinsetzen sollen, da
sind jedes Mal noch Plätze frei. Naja, zum Glück finde ich die Folien im Netz und kann alles
nacharbeiten, aber warum bin ich dann überhaupt hier? Stefan liegt mit dem Kopf schon auf
dem Tisch! Vielleicht lohnt es sich ja doch. Wenn wir Glück haben, bekommen wir einen wich-
tigen Tipp für die Klausur oder Infos, die nicht auf den Folien stehen. Als einfache und schnelle
Einführung und Übersicht lohnen sich Vorlesungen durchaus; und der ein oder andere Litera-
turtipp regt zum Weiterlesen an. Mit dem oder der richtigen Dozierenden, wird die Thematik
oft durch spannende und anregende Anekdoten oder Beispiele aufgefrischt und greifbar ge-
macht. Interessant wird es vor allem, wenn Professor_innen Vorlesungen über aktuelle For-
schungsprojekte halten. Endet eine Vorlesung aber wirklich im Vorlesen, dann lohnt es sich zu
Hause die Inhalte selbst zu erarbeiten.
Die 90 Minuten sind um. Neben meiner lückenhaften Mitschrift und einigen Zeichnungen,
die jede_r Dreijährige besser hinbekommen hätte, finden sich durchaus noch offene Fragen
und eigene Gedanken auf meinem Block. Diese werde ich im Tutorium ansprechen, das von
Studierenden höherer Fachsemester geleitet wird und in den ersten Semestern die Möglich-
keit bietet, begleitend zur Vorlesung, den Stoff oder Literatur noch einmal zu besprechen oder
gar zu vertiefen. Dadurch, dass Studierende die Tutorien organisieren, entsteht eine viel offe-
15
nere Atmosphäre, in der sich der ein oder andere auch traut Fragen zu stellen, die er sonst
nicht stellen würde. Zudem können die Tutor_innen wertvolle Infos über das Institut, die Do-
zent_innen oder die Klausur geben. Auch andere Fragen kann man hier los werden; beispiels-
weise Fragen zum wissenschaftlichen Arbeiten oder anderen Dingen, mit denen man als Erst-
semester vorher nicht in Kontakt kam, wie Bibliothek, das städtische Nachtleben, Hochschul-
gruppen, Auslandsstudium oder studentische Gremien.
Zu den Veranstaltungen der Statistik und Methodik gibt es manchmal auch Übungen, in de-
nen man die in der Vorlesung gelernten statistischen Maße und Methoden der empirischen
Sozialforschung an verschiedenen Beispielen durchprobieren kann. Wenn man weiß, wie und
wo man das Gelernte anwenden kann, bleibt es oft schneller und besser hängen.
Entgegen dem Frontalunterricht einer Vorlesung, in der Fragen und Diskussion wegen der
hohen Anzahl an Studierenden und der Größe der Hörsäle meist unmöglich sind, sollen Semi-
nare ein Klima schaffen, in dem Inhalte und Texte in Kleingruppen vertieft vorgestellt und dis-
kutiert werden können. Seminare sind thematisch sehr eng begrenzt und bieten deshalb meist
einen detailreichen Einblick in spezielle Thematiken. Zur Vorbereitung der einzelnen Sitzungen
werden Texte bereitgestellt, die als Diskussionsgrundlage dienen. Die Sitzungsthematik wird in
der Regel von einem Studierenden oder kleinen Gruppen von Studierenden im Rahmen eines
Referats vorgestellt. Idealerweise schließt sich an diese ca. zwanzig bis dreißig minütige Einfüh-
rung eine ausgiebige Diskussion an. Alternativ gibt es zu den Thematiken sogenannte Exper-
tengruppen (einzelne Teilnehmer des Seminars bereiten sich intensiver vor als die anderen),
welche die Diskussion durch eigene Thesen einleiten. Für Seminare sollte man sich ausrei-
chend Zeit nehmen, um sie vorzubereiten und auch nachzubereiten, nur dann kann eine
fruchtbare Diskussion innerhalb des Seminars zustande kommen.
Zum Gelingen eines Seminars ist jedoch nicht nur die aktive Teilnahme der Studierenden
gefragt. Dozent_innen können mit Einwürfen den Seminarverlauf auffrischen, lenken und
strukturieren. Wenn der oder die Dozierende genau aufzeigt, wohin das Seminar führen soll,
wie es aufgebaut ist und zusammenhängt, dann fällt das Lernen meist leichter. Wichtig ist je-
doch, die Dozierenden nicht für unnahbar zu halten, denn auch mit ihnen kann man diskutie-
ren und auch sie lernen mit jedem Seminar hinzu.
Die Realität sieht jedoch oft anders aus. Die Thematiken sind auf den Blickwinkel und das
Wissen der Dozierenden begrenzt. Zudem kann durch einen schlechten Dozierenden die The-
matik schnell eintönig und langweilig werden. Jedoch viel schlimmer: Seminare mutieren durch
spannende oder vielversprechende Thematiken und beliebte Dozierende oft und sehr schnell
zu Vorlesungen, da sie von bis zu 120 Studierenden besucht werden. Eine solche Größe er-
16
schwert das interaktive Arbeiten enorm. Referate werden zu Vorlesungen, Studierende verste-
cken sich hinter der Masse der anderen, die Vorbereitung schleift und die Diskussionen kom-
men meist zu zaghaft. Die Möglichkeit in einer Diskussion Argumente auszutauschen geht ver-
loren. Deshalb: auch mal zu einem/einer unbekannten Dozent_in gehen und die Seminarbe-
schreibungen genau durchlesen, vielleicht versteckt sich hinter einem sperrigen Seminartitel ja
ein unverhofft packendes Semester.
Probleme in Seminaren ergeben sich aus vielerlei Gründen: Zum einen weist der Vorwis-
sensstand und das Niveau der Studierenden oft sehr große Unterschiede auf. Dies führt dazu,
dass sich einige Studierende zurückhalten. Zweitens müssen von Woche zu Woche schwierige
und lange Texte gelesen werden. Die Bearbeitung kann aus verschiedenen Gründen schwer
fallen, manchmal liegt es einfach am aufzubringenden Wochenpensum oder schlechter Zeit-
planung. Für den Dozierenden ist es dabei schwer festzustellen, ob die Literatur nicht gelesen
oder nicht verstanden wurde oder ob die Teilnehmer_innen einfach eher zurückhaltend sind.
Eine zu große Distanz zwischen Lehrenden und Studierenden ist oft Grund für Redehemmun-
gen mancher Seminarteilnehmer_innen. Dagegen gibt es selten einen Grund vor Dozent_innen
zu kuschen. Entgehen kann man dem, wenn man sich in Lern- und Lesegruppen einfindet, in
denen man vorab die Texte und Themen gemeinsam lesen und diskutieren kann.
Ein weiterer Veranstaltungstyp ist die Lehrforschung. In der Lehrforschung wird Theorie
und Methodik verbunden. Ziel ist die praktische Teilnahme an einem vollständigen Prozess
empirischer Sozialforschung sowie die Erarbeitung und Durchführung eigener empirischer Ar-
beit. Dies bietet die Chance, die eigene Teamfähigkeit auszutesten und auch mal aus der Uni
heraus zukommen, um zu untersuchen, was denn eigentlich in der Gesellschaft vor sich geht.
Am lehrreichsten kann die Lehrforschung werden, wenn man eigene Forschungsfragen und
Interessen einbringt. Die Veranstaltungen laufen meist über zwei Semester. Im ersten Semes-
ter geht es zunächst um die theoretische Vorklärung von Problemstellungen und das Erstellen,
Spezifizieren sowie Operationalisieren von Hypothesen. In Vorbereitung auf das zweite Semes-
ter muss schließlich ein Forschungs- bzw. Untersuchungsdesign ausgewählt werden. Dieses
bildet die Grundlage, auf der das Forschungsproblem und die Hypothesen analysiert bzw. ge-
löst werden sollen. Bei der Planung eines Forschungsdesigns müssen die Fragen geklärt wer-
den, an welchem Untersuchungsobjekt was, wann, wie und wie oft beobachtet werden soll. Im
zweiten Semester geht es dann hauptsächlich um das Erheben, Aufbereiten und Auswerten
von den selbst erhobenen empirischen Daten, die in einem Forschungsbericht vorgestellt wer-
den müssen.
17
Wer dann noch Zeit und Muße hat, kann die Kolloquien der einzelnen Lehrstühle besuchen.
In Kolloquien werden aktuelle Trends und Neuerscheinungen der jeweiligen Fachgebiete be-
sprochen. Geleitet werden sie meist von den Lehrstuhlinhabern. Teilnehmen kann eigentlich
jede_r, in der Regel sind dies aber die Mitarbeiter_innen des Lehrstuhls und Studierende höhe-
ren Fachsemesters, von denen man auf jeden Fall viel lernen kann. Oft werden auch Gastdo-
zent_innen für einen Vortrag eingeladen. Weiterhin bietet das Kolloquium die Gelegenheit die
eigene Abschlussarbeit vorzustellen und mit den Teilnehmern_innen zu besprechen.
Wem keiner dieser Veranstaltungstypen liegt, dem bleibt nur, abgesehen von der Anwe-
senheitspflicht, selbst ein (autonomes) Seminar zu organisieren oder das Selbststudium!
In welchem Rahmen man den Scheinerwerb bzw. ECTS zu leisten hat, steht in der Studien-
und Prüfungsordnung. Dort ist ebenfalls geregelt, welche Art von Veranstaltung und wie viele
welcher Art besucht werden müssen. Es kommt also hauptsächlich auf die Studien- und Prü-
fungsordnung und die eigene Motivation im Studium an. Das Angebot an Vorlesungen und
Seminaren, die unterschiedliche Schwerpunkte innerhalb der Soziologie abdecken, ist meist
sehr breit. Deshalb empfiehlt es sich, bereits im Grundstudium mehr Veranstaltungen, als von
der Prüfungsordnung verlangt wird, zu besuchen. Dies bietet die Chance seinen eigenen
Schwerpunkt (schnell) zu finden. Je früher der eigene Schwerpunkt gesetzt wird, desto effizien-
ter kann man sein Studium strukturieren. In der Regel wird man sich bereits in den Einfüh-
rungsveranstaltungen des ersten Semesters für einen bestimmten Themenbereich der Soziolo-
gie begeistern können, doch auch der Blick in andere (für einen selbst evtl. nicht ganz so inte-
ressante) Schwerpunkte, erweitert nicht nur allgemein den eigenen Horizont, sondern ermög-
licht es grundlegend, einen breiteren Einblick in die Soziologie zu bekommen.
Vor allem kommt es im Studium aber auf die eigene Motivation an: Siehst du das Studium
als reine „Ausbildungsstelle“ zum Erwerb eines akademischen Abschlusses, dann reicht es si-
cherlich, einfach die „minimalen“ Anforderungen der Studien- und Prüfungsordnung zu erfül-
len. Wenn du nicht nur den akademischen Abschluss im Blick hast, sondern mit dem Interesse
am Verständnis der Soziologie als Wissenschaft und einer hohen intrinsischen Motivation an
dein Studium heran gehst, dann sollte die Bereitschaft ein Seminar, eine Vorlesung oder einen
selbst organisierten Lesekreis neben der „normalen“ Anforderung zu besuchen, von selbst ent-
stehen.
18
2. Welche Arbeitsweisen werden im Soziologiestudium ausgebildet
und angewandt?
2.1. Lesen, diskutieren, recherchieren und Referate halten
Von Simon Bohn
Man muss wohl feststellen, dass das Soziologiestudium heute vielerorts durch Lehr- und
Lernmethoden bestimmt ist, die dem eigentlichen Charakter des Faches nicht gerade zuträglich
sind. Vormals zentrale und äußerst fruchtbare Arbeitsweisen der Soziologie werden hingegen
zum Teil systematisch zurückgedrängt. So ist das Bachelorstudium derzeit stark durch regelmä-
ßige Klausuren geprägt, welche meist ein verhältnismäßig stures Pauken erfordern, so wie man
es (leider) auch aus der Schule gewöhnt ist. Dass dieses alte „Trichter-Prinzip“, nach welchem
die (angeblichen) Fakten nur anständig gebüffelt werden müssen (wobei sie nach der Klausur
natürlich schleunigst wieder in Vergessenheit geraten), schon in der Schule für die wenigsten
„Lerntypen“ angemessen ist und auch im Studium nicht besser funktioniert, zeigen Erkenntnis-
se aus der Erziehungswissenschaft schon seit Jahrzehnten. Und inzwischen regt sich auch in
verschiedenen Kreisen aus Wirtschaft und Wissenschaft Kritik, denn viele wichtige Fähigkeiten,
wie die intensive eigenständige Auseinandersetzung mit einem Thema, ausgeprägte Lesekom-
petenzen und ein ausreichendes Maß an Kreativität, bleiben bei der Ausbildung von
Soziolog_innen in den letzten Jahren oft auf der Strecke. Daher ist die nachfolgende Beschrei-
bung von Arbeitsweisen während des Soziologiestudiums auch ein Stück weit von ideellen Vor-
stellungen geprägt, welche nicht mehr uneingeschränkt von allen soziologischen Instituten in
Deutschland verfolgt bzw. häufig erst für den Masterstudiengang wieder ernsthaft ins Auge
gefasst werden können.
Am Anfang der meisten sozial- und geisteswissenschaftlichen Tätigkeiten steht das Lesen
wissenschaftlicher und zum Teil auch sehr schwieriger Texte. Selten muss man ganze Bücher
lesen; stattdessen gilt es, den Umgang mit den zur Verfügung stehenden Quellen zu erlernen
und bei der Arbeit in der Bibliothek schnell die richtigen Kapitel und die spannendsten Texte
aus der schier unendlichen Fülle von Literatur auswählen zu können. Als angehende_r Soziolo-
giestudent_in muss man sich darauf einstellen, jede Woche mindestens sechs Stunden mit in-
tensiver Lesezeit zu verbringen, häufig sind es mehr. Dabei ist es gerade am Anfang des Studi-
ums zum Teil schwierig, die Texte und wesentliche Inhalte dieser überhaupt zu verstehen, wes-
halb man einzelne Passagen doppelt lesen muss und gewisse Techniken im Umgang mit Texten
unabdingbar sind.
19
Zu den einzelnen Seminarsitzungen sind meist Texte im Umfang von etwa 40 Seiten zu le-
sen. Spätestens bei der Erarbeitung eines Referats oder einer Hausarbeit wird das Lesen jedoch
zur Hauptbeschäftigung, in der es selten darum geht, einfach nur bestimmte Daten und Fakten
aus dem Text herauszufiltern. Stattdessen müssen Argumentationsmuster erkannt, spezifische
Stilmittel der Autoren verstanden und theoretische Verbindungen zu anderen Autoren und
Schulen nachgewiesen werden. Ausreichende wissenschaftliche Lesekompetenzen stellen sich
bei den meisten Studierenden erst nach einigen Semestern ein, aber es ist durchaus zu emp-
fehlen, sich einschlägige Lesetechniken und Methoden der Textarbeit schon frühzeitig anzueig-
nen (Literaturempfehlung: Martha Boeglin: Wissenschaftliche Arbeiten Schritt für Schritt.).
Zweitens werdet ihr in eurem Soziologiestudium zahlreiche Vorträge halten müssen. Die Er-
arbeitung eines Themas anhand komplexer wissenschaftlicher Texte, die anschauliche Präsen-
tation und eine rhetorisch sowie argumentativ ansprechende Vortragsweise sind dabei in der
Regel extrem wichtig. Die konkreten Inhalte rücken in der langfristigen Perspektive sogar fast
ein wenig in den Hintergrund; sie werden nicht nur von euren Kommilitonen sondern von euch
selbst vermutlich schnell wieder vergessen. Zentral sollte für euch sein, verschiedene Vortrags-
weisen (Thesen, Stundengestaltung etc.), Redestile (z.B. Erläutern oder Argumentieren) und
Präsentationsmedien (Beamer, Overhead-Projektor, Tafel, Flipchart, Moderationstafel) auszu-
probieren, stets mit großer Energie an der Verständlichkeit und der argumentativen Struktur
des Referats zu arbeiten und dadurch nach und nach euer kleines „Theaterstück“, denn als nicht
anderes solltet ihr jeden neuen Vortrag verstehen, zu perfektionieren. Rhetorik, Argumentati-
on und Stil, dies alles sind für die Wissenschaft im Allgemeinen und die Soziologie im Speziel-
len sehr wichtige Elemente. Sie sind für das, was als Wahr akzeptiert oder als wahrheitsfähig
präsentiert wird, meist wichtiger als man gemeinhin denkt. Eine Beschäftigung mit diesen Me-
thoden des argumentativen Überzeugens und der sachlichen Einwirkung auf wissenschaftliche
Diskurse ist daher während des Studiums unabdingbar. Die zahlreichen Referate während eures
Studiums sind dafür ein prima Übungsfeld.
Zuletzt möchte ich über das Schreiben von wissenschaftlichen Arbeiten sprechen. Übli-
cherweise unterscheidet man in der Soziologie zwischen der Form des Essays und der klassi-
schen Hausarbeit, ihr werden aber möglicherweise auch Rezensionen, Praktikumsberichte
oder etwa Auswertungsberichte über statistische Erhebungen schreiben müssen. All diese
verschiedenen wissenschaftlichen Formen verlangen unterschiedliche Arbeits- und Schreibwei-
sen und nur eine spezielle Einführung in die wissenschaftlichen Arbeitstechniken (also ein ext-
ra Seminar, welches auf jeden Fall im ersten oder zweiten Semester angeboten wird) sowie die
jeweils von den Instituten zur Verfügung gestellten Leitfäden können angemessen über die ver-
20
schiedenen Anforderungen informieren. Auch hier gibt es zum Teil sehr gute und ausführliche
Beschreibungen, wie man eine solche schriftliche Arbeit anfertigt und wodurch sie sich formell,
stilistisch und inhaltlich von anderen wissenschaftlichen Formen unterscheidet. (Literatur:
Bänsch, Axel: Wissenschaftliches Arbeiten, München u.a.: Oldenbourg; Eco, Umberto: Wie
man eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreibt. Doktor-, Diplom- und Magisterarbeit in
den Geistes- und Sozialwissenschaften, Heidelberg: Müller (UTB); Theisen, Manfred: Wissen-
schaftliches Arbeiten. Technik – Methodik – Form, München: Vahlen.)
(Tipp: manchmal gibt es von anderen Instituten sehr viel brauchbarere Leitfäden und Ar-
beitshinweise. Hier lohnt sich eine kurze Recherche im Internet, falls man mit den Materialan-
geboten der eigenen Lehrveranstaltung unzufrieden ist. Wichtig: Bevor ihr euch auf die Hin-
weise eines Leitfadens stützt, besprecht diesen nochmal mit eurer_m jeweiligen Dozent_in.
Was jedoch für (fast) alle schriftlichen Arbeiten gilt: Sie nehmen viel Zeit in Anspruch! Denn
für jedes wissenschaftliche Problem gibt es verschiedene Möglichkeiten, es zu präsentieren.
Jedes einzelne Kapitel kann diesen oder einen ganz anderen argumentativen Aufbau bekom-
men und schließlich ist jeder einzelne Satz das Ergebnis von vielen kleinen Zufällen und be-
wusst gewählten Wortkombinationen. Das Schreiben von Texten wird also zu einem großen
Spiel, bei dem ihr permanent experimentieren und sukzessive euren eigenen Stil entwickeln
könnt. Denn Schreiben ist in der Soziologie in den seltensten Fällen bloßes „Aufschreiben“ von
Informationen. Das Schreiben von Texten ist während des Studiums in der Regel eine ganz zent-
rale Beschäftigung; das Formulieren von komplexen Gedankengängen und interessanten gesell-
schaftlichen Phänomenen in wissenschaftlicher, aber zugleich auch ansprechender Form ist
eine wesentliche Aufgabe des/r Soziolog_in.
2.2. Methoden der empirischen Sozialforschung
Von Jan Kalies
Im Grunde ist jede_r schon vielfach mit den Ergebnissen der empirischen Sozialforschung in
Berührung gekommen, auch wenn dies bisher noch nicht so klar war. Immer wenn in Magazi-
nen, Büchern, Zeitschriften oder im Fernsehen bunte Graphiken abgebildet werden oder wenn
Statistiken über die neuesten Wahlergebnisse, Umfragen in der Fußgängerzone oder Gebur-
tenraten visualisiert werden, bedient man sich dabei an Methoden, die auch in der Soziologie
Gang und Gäbe sind. Die Soziologie ist eine empirische Wissenschaft, dass heißt, sie erhebt
systematisch Daten über soziale Sachverhalte durch Verfahren wie Beobachtungen, Befragun-
21
gen oder Interviews und wertet diese aus. Die Schlüsselqualifikationen für die Durchführung
solcher Studien werden im Studium erlernt und bilden ein wichtiges Fundament im Berufsfeld
der meisten Soziolog_innen.
Ziel der empirischen Soziologie ist es, sichere Aussagen über einen Forschungsgegenstand
zu formulieren und dabei so vorzugehen, dass das Zustandekommen der Forschungsergebnisse
für alle am Wissenschaftsprozess Beteiligten nachvollziehbar und prinzipiell wiederholbar ist.
Ein Forschungsprojekt beginnt im Allgemeinen mit theoretischen und begrifflichen Vorüberle-
gungen, einer thematischen Eingrenzung und einer präzise formulierten Forschungsfrage. Da-
nach entwirft man einen Arbeitsplan und entscheidet, mit welchen Erhebungs- und Auswer-
tungsverfahren man neue Informationen erfassen und bearbeiten will. Hierzu teilt man die
üblichen Erhebungsmethoden danach ein, ob durch sie entweder eine möglichst große Zahl
von soliden Daten in einem weit gestreuten Forschungsfeld erhoben (quantitative Datenerhe-
bung), oder ob nur wenige Personen ganz intensiv mit ihren genauen Aussagen, Gefühlen und
Wahrnehmungen in den Fokus der Untersuchung gerückt werden sollen (qualitative Datener-
hebung).
Man kann sich diese Unterscheidung ganz gut am Beispiel von Dokumentarfilmen verdeut-
lichen. Stellen wir uns eine Doku über Konsum in der DDR vor: Wenn einzelne Zeitzeugen darin
über ihre liebsten Produkte befragt werden, sie über ihren täglichen Einkauf und über Engpäs-
se im Warenangebot, kurz, über ihre Erfahrungen erzählen, handelt es sich um eine qualitative
Befragungsmethode. Werden hingegen Statistiken über das Konsumverhalten der DDR-Bürger
im Allgemeinen präsentiert, dann sind diesen quantitative Forschungsmethoden vorhergegan-
gen.
Die empirische Sozialforschung arbeitet, ganz gleich ob es sich um quantitative oder quali-
tative Forschung handelt, nach einem dem jeweiligen Forschungsgegenstand angepassten Re-
gelsystem und versucht, die erhobenen Daten zu ordnen, zu systematisieren und schließlich
Phänomenbereiche, die wiederholt auftreten und ein erkennbares Muster aufweisen, kontrol-
liert zu verallgemeinern.
Im Studium werdet ihr mit beiden methodischen Ausrichtungen mehr oder weniger ver-
traut gemacht. Auch hier empfiehlt es sich, vorher zu schauen, wie das soziologische Institut an
der entsprechenden Uni ausgerichtet und welche Forschungsmethoden in der wissenschaftli-
chen Praxis am meisten verwendet werden. Gerade wer sich für qualitative Forschungsmetho-
den und spezielle Methoden, wie etwa die Diskursanalyse interessiert, muss genauer hinse-
hen, ob diese im Lehrplan ausreichend Beachtung finden. Häufiger wird man hingegen eine
intensive Ausbildung im Bereich der quantitativen Datenerhebung und vor allem ihrer Auswer-
22
tung mittels Statistik erleben. Das heißt auch, dass ihr mit einem Studium der Soziologie kei-
neswegs um Mathematik herum kommt. Im Gegenteil! Auch wenn in der Regel keine außer-
gewöhnlichen Mathematikkenntnisse vorausgesetzt werden, ist eine Auseinandersetzung mit
den mathematischen Zusammenhängen, Formeln und Berechnungen, mit denen Statistikpro-
gramme (z.B. SPSS, STATA und andere) arbeiten, unabdingbar. Oft wird unterschätzt, wie zent-
ral die Statistikveranstaltungen in der soziologischen Grundausbildung sind, weshalb viele Stu-
dierende an diesen etwas trockenen Veranstaltungen scheitern oder aufgrund mangelnder
Motivation (bspw. für Formeln und Rechenaufgaben) ihr Studium frühzeitig aufgeben müssen.
3. Welche Prüfungsformen gibt es?
Von Katrin Schwarz
Dem Bachelor-Studium wird im Allgemeinen nachgesagt, es würde durch seine ständigen
Prüfungen sämtliche Zeitressourcen des Studierenden auffressen und durch den Lerndruck,
der hinter dem Studium steht, Nerven und Lebensfreude verschlingen. Ganz so dramatisch
sieht es aber doch nicht aus. Sicherlich gibt es Phasen, in denen viele Prüfungen anstehen, der
Zeitdruck größer ist und enorm viel von den Studierenden verlangt wird, aber es ist keinesfalls
unmöglich, diese Leistungen auch zu erbringen. Man sollte nur darauf achten, den Überblick zu
behalten. Mit einer vernünftigen Organisation und einem guten Zeitmanagement bekommt
man alle Prüfungen unter einen Hut.
Grundlegend für jeden Studierenden ist seine Prüfungsordnung. In dieser ist genau aufge-
schlüsselt, welche Leistungen im Laufe des Studiums zu erbringen sind:
„Das Bachelor-Studium an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften umfasst eine Gesamtleistung von 180 Leistungspunkten (LP) nach dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Soziologie ist als Kernfach im Umfang von 120 LP (ein-schließlich 10 LP Bachelor-Arbeit und 20 LP Schlüsselqualifikationen) mit einem Ergän-zungsfach (60 LP) oder als Ergänzungsfach (60 LP) zu wählen. Pro Studienjahr sind in der Regel 60 Leistungspunkte zu erwerben, die sich aus den Lehrangeboten des Kernfaches und des Ergänzungsfaches zusammensetzen. Die Bachelor-Arbeit schließt das Studium ab. Das Studium im Kernfach Soziologie (120 LP)besteht aus 8 Pflichtmodulen und 5 Wahlpflichtmodulen.(...) Das Studium im Ergänzungsfach Soziologie (60 LP) besteht aus 2 Pflichtmodulen und 5 Wahlpflichtmodulen.“
1
1 - n-
fach und Ergänzungsfach in Studiengängen mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Stand vom: 05.01.2009. Unter: http://www.uni-jena.de (download am 14.06.2011).
23
Ein Blick in die Prüfungsordnung lohnt sich, da einem dadurch am Ende des Studiums der
Schock erspart bleibt, welcher droht, wenn einem kurz vor der Angst auffällt, dass die Hälfte an
zu erbringenden Leistungen noch fehlt.
Um Leistungspunkte (ECTS) sammeln zu können, muss man verschiedene Prüfungsarten
meistern, mit denen man oft schon im ersten Semester konfrontiert ist. Zum einen gibt es
schriftliche Prüfungen: Klausuren, Essays oder Hausarbeiten. Klausuren finden meist am Ende
jedes Semesters statt und umfassen etwa 1 ½ Stunden. Der Schwierigkeitsgrad von Klausuren
variiert stark, je nach Art der Klausur, dem Thema und dem/der Dozent_in der Lehrveranstal-
tung. Meist bekommt man aber im Seminar oder in der Vorlesung bereits gute Ratschläge, wie
man sich vorbereiten sollte. Grob kann man zwei Arten von Klausurfragen unterscheiden. Ers-
tens: offene Fragen, auf die man je nach Frage kürzer oder länger antworten kann. Zweitens:
Multiple-Choice-Fragen, bei denen mehrere Antwortmöglichkeiten zu jeder Frage vorgegeben
werden, aus denen man auswählt.
Zu den schriftlichen Prüfungsarten zählt auch das Verfassen von Hausarbeiten oder Essays.
Diese können je nach Lehrveranstaltung seminarbegleitend oder in den „Semesterferien“ an-
gefertigt werden. Eure Dozent_innen werden euch am Anfang des Seminars genau erklären,
wie die Anforderungen für schriftliche Ausarbeitungen sind und wann ihr sie abzugeben habt.
Ziel von Essays und Hausarbeiten ist es, wissenschaftliches Arbeiten zu erlernen. In der Regel
findet man einen Leitfaden zum Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten auf der Homepage des
Instituts. Darin ist erklärt, was darunter zu verstehen ist und es werden gleichzeitig die Anfor-
derungen und Bewertungen transparent gemacht. Neben der konkreten Ausarbeitung —
Hausarbeiten umfassen ca. 15 Seiten, Essays sechs Seiten — geht es im Besonderen um die
Entwicklung einer Fragestellung, der Eingrenzung des Themas und den Umgang mit sowie der
Recherche nach Literatur.
Ich persönlich kann nur empfehlen zur Sprechstunde des/der Dozent_in zu gehen, wenn ihr
euch irgendwie unsicher seid. In der Sprechstunde kann man sich gute Tipps zum speziellen
Thema und zur Literatur holen. Außerdem beruhigt es die Nerven, wenn man weiß, dass die
eigene wissenschaftliche Arbeit den richtigen Ansatz hat. Wenn man mit dem oder der Do-
zent_in spricht, bekommt man meist schnell ein Gefühl dafür, was ihm für Hausarbeiten und
Essays wichtig ist.
Weiterhin müssen Studierende der Soziologie auch mündliche Prüfungsleistungen erbrin-
gen. Dazu zählen Referate und mündliche Prüfungen zu einem bestimmten Thema. Referats-
themen werden meist in der ersten Semesterwoche im Seminar vergeben und sind dann in
einer der folgenden Seminarsitzungen vorzustellen. Der zeitliche und inhaltliche Umfang der
24
Präsentation wird vom/ von der Dozent_in festgelegt. Mündliche Prüfungen sind oft sehr ner-
venaufreibend, aber wenn man sich vorher gut mit seinem/seiner Dozent_in abspricht, sind sie
in jedem Fall machbar. Ziel ist es ein ausreichendes Grundwissen aus der Veranstaltung nach-
zuweisen sowie Zusammenhänge zu erkennen und einzuordnen.
Schlüsselqualifikationen sind auch Teil des Bachelor-Studiums. Diese bestehen in Jena aus
einem Modul „fachspezifische Schlüsselqualifikationen“ und einem berufsfeldorientierten
Praktikumsmodul. Die Schlüsselqualifikationen umfassen meist die Vertiefung fachspezifischer
Fremdsprachenkenntnisse (in der Regel Englisch) und Grundlagen des wissenschaftlichen Ar-
beitens. Im Rahmen des berufsfeldorientierten Praktikumsmoduls soll ein Praktikum von min-
destens sechs Wochen Dauer absolviert werden. Das Praktikum muss einen soziologischen
Schwerpunkt haben, ansonsten obliegt es euch, wo ihr es machen wollt. Als Leistungsnachweis
im Praktikumsmodul dient ein Praktikumsbericht, der am Ende des Praktikums verfasst werden
soll. Hilfe bei der Suche nach einem Praktikumsplatz bekommt ihr bei der Praktikumsbörse des
Instituts oder des Fachschaftsrats, welche auch regelmäßig Informationsveranstaltungen zum
Thema Praktikum anbieten.
Mit dem Praktikum wird dir die Möglichkeit gegeben, dein erworbenes Wissen praktisch
anzuwenden und die konkrete Arbeitssituation von Soziolog_innen kennen zu lernen. Mit Hilfe
der bereits erlangten Qualifikationen sollen tätigkeitspezifische Probleme definiert, analysiert
und Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden. Ein Praktikum dient also dazu die Inhalte und
erlernten Kenntnisse des eigenen Studiums anwenden und kritisch überprüfen zu können.
Die Bachelorarbeit ist die letzte Studienleistung, die im Rahmen des Bachelor- Studiums
erbracht werden muss. Ziel der Bachelorarbeit ist es nachzuweisen, dass in einer vorgegebe-
nen Frist ein Problem nach den wissenschaftlichen Standards selbständig bearbeitet werden
kann. Der Umfang der Bachelor- Arbeit beträgt ca. 40 Seiten, die in zwölf Wochen geschrieben
werden sollten. Thema und alles andere sind mit eurem/eurer Betreuer_in zu besprechen.
Der Modulkatalog ist ein weiteres wichtiges Instrument, um den Überblick im ECTS-
Dschungel zu behalten. Im Gegensatz zur Prüfungsordnung ist im Modulkatalog sehr detailliert
aufgeschlüsselt, welche Art, welchen Umfang und welche Anforderung die Prüfungsleistungen
der einzelnen Modulen haben. Das letzte Wort hat aber dennoch der/die Lehrbeauftragte.
Sehr hilfreich finde ich den Musterstudienplan. Dieser zeigt anschaulich, wann man am
besten welche Leistung erbringt. Da viele Lehrveranstaltungen thematisch aufeinander auf-
bauen und auch nicht jedes Semester angeboten werden, ist der Musterstudienplan die ein-
fachste Möglichkeit, alles richtig zu machen. Er sollte von einer individuellen Gestaltung des
Studiums jedoch nicht abhalten.
25
Das Wichtigste zum Schluss: Die Noten der Fachmodule gehen in die Abschlussnote ein. Die
Note eines Moduls ergibt sich dabei aus den zu leistenden Teilprüfungen. Schlüsselqualifikati-
onen müssen nur bestanden werden, beeinflussen die Abschlussnote demnach nicht.
Scheut euch nicht davor nachzufragen. Sei es beim/ bei der Dozent_in, beim Prüfungsamt,
bei der Studienberatung oder bei euren Mitstudierenden. Nutzt auch Informationsveranstal-
tungen und die Studieneinführungstage (STET). Wenn ihr den Überblick behalten könnt, bleibt
euch auch genug Zeit für die schönen Seiten des Studierendenlebens.
4. Vom Bachelor zum Master?
Von Katharina Warda
Bachelorarbeit abgegeben, alle Prüfungen absolviert und das Abschlusszeugnis beim Prü-
fungsamt abgeholt. Den Bachelorabschluss der Soziologie also in der Tasche, aber was nun?
Ähnlich wie nach dem Abi stehst du jetzt wieder vor dieser Frage: Was mache ich als nächstes?
Was fange ich mit meinem Abschluss an?
Die Hauptfrage, die du für dich beantworten musst, ist ob du dein Studium fortsetzt oder
gleich ins Berufsleben einsteigst. Beide Optionen bringen eine Fülle an Vor- und Nachteilen mit
sich. Diese für sich abzuwägen, um zu einer Entscheidung zu gelangen, liegt voll und ganz bei
dir. An alle die, die in Betracht ziehen, ihr Studium fortzusetzen und ein Master-Programm zu
beginnen, richtet sich der folgende Text.
Zu Beginn stellen sich dir wahrscheinlich ähnliche Fragen wie vor deinem Bachelorstudium:
Was studieren? Wo studieren? Wie einschreiben und wie studieren?
Im Gegensatz zum Bachelorstudium wird, bekanntermaßen, zum Masterstudium nur eine
Auswahl an Studierenden zugelassen. Das klingt erst einmal verunsichernd, hat aber auch sei-
ne Vorteile. Viele Soziologie-Bachelorstudiengänge sind „überfüllt“: volle Hörsäle, anonyme
Seminare und im höchsten Maße standardisierte Prüfungsverfahren, wie die oft verwendete
Multiple-Choice-Klausur, sind Studienalltag. Das verringert die Lernqualität und schafft Unmut
auf Seiten der Dozierenden und vor allem auf Seiten der Studierenden. Hinzu kommt ein in-
haltlich sehr auf Basiswissen ausgerichtetes, aber vom Pensum straffes Studienprogramm, das
wenig Möglichkeiten und besonders kaum Zeit für individuelle Spezialisierungen lässt. Mit
„mehr Zeit“ können die meisten Masterstudiengänge auch nicht werben, aber anderes ändert
sich schon.
Nur ein geringer Teil der Bachelorabsolvent_innen entscheidet sich für einen Masterstudi-
engang. Da diese oft recht speziell sind, sucht man sich idealerweise bereits den aus, der den
26
eigenen Interessen am nächsten kommt. Insofern ist die Studienmotivation im Regelfall schon
zu Beginn des Studiums sehr hoch. Der damit häufig verbundene Universitäts- und Ortswech-
sel, also „Neustart“, trägt sein Übriges dazu bei. Durch die geringere Zahl an angebotenen
Plätzen und dem damit verbundenen „Aussiebe-Verfahren“ der Universitäten soll noch ver-
stärkt dafür gesorgt werden, dass sich hauptsächlich qualifizierte und hoch motivierte Studie-
rende einschreiben. Master-Studierende berichten häufig von der guten Lernatmosphäre, die
dadurch in ihren Studiengängen herrscht. Oft affiziert das auch die Lehrenden, die dann in
kleineren, persönlicheren Seminaren tätig sein können. Prüfungen verlaufen nun an vielen
Unis eher durch individualisierte Verfahren. Dabei sind Hausarbeiten, Essays und mündliche
Prüfungen die Hauptprüfungsmodalität.
Trotz all der Vorteile wird sich am Tempo und der rigiden Prüfungsordnung, die du bereits
aus deinem Bachelorstudium kennen müsstest, nicht viel ändern. Das bringt der Elitecharakter,
der dem Master anheftet, ebenso mit sich, wie ein eventuell ansteigendes Konkurrenzverhal-
ten zwischen den Kommiliton_innen bzw. die bereits erwähnten zum Teil sehr eingeschränk-
ten Zugangschancen. Hinzu kommt, dass Neuanfang auch Neueingewöhnung heißt. Anderer
Ort, andere Uni und neuer Studiengang bedeutet auch, sich wieder völlig neu zurechtfinden zu
müssen. Das kann seine Zeit beanspruchen und Stress mit sich führen. Davon solltest du dich
aber nicht verunsichern lassen. Das geht den meisten so und birgt auch Chancen in sich.
Wenn du dich entschieden hast ein Masterstudium zu beginnen, stehst du natürlich zu aller
erst vor dem Problem, einen Studiengang auszusuchen. Das Angebot ist groß und in sich sehr
verschieden. Entsprechend deiner Interessenlage, die du während des Bachelorstudiums aus-
gebildet hast, gilt es nun auszuwählen. So ist zu überlegen, ob man mit einem Master in Sozio-
logie weitermachen möchte. Der ist zwar oft relativ allgemein konstituiert, kann aber dadurch
breit gefächerte Interessen vereinen, ohne zu sehr festzulegen. Für die, die eine Fachrichtung
(z.B. Wirtschaftssoziologie) fokussieren wollen, eignen sich eher speziellere Masterstudien-
gänge, die genau das abdecken (z.B. MA Wirtschaftssoziologie, Universität Trier). Ebenso eig-
nen sich interdisziplinäre Studiengängen, die neben speziellen soziologischen Themen anver-
wandte Themen aus anderen Bereichen unter einem Spezialgebiet vereinen und es so multi-
perspektivisch beleuchten. So kannst du dein Interesse an z.B. Geschlechterforschung durch
einen Master in Gender Studies (z.B. HU Berlin) weiterverfolgen oder Interessengebiete, wie
Raum-, Stadt- und Architektursoziologie, durch einen Master in Urbanistik (z.B. Bauhaus-
Universität Weimar) zusammenführen und ergänzen.
Der Bachelorabschluss in Soziologie kann aber auch Basis für einen ganz anderen Masterab-
schluss sein. Es gibt eine große Zahl an Aufbaustudiengängen, die an sich sehr spezielle The-
27
men behandeln, denen als Zugangsvoraussetzung aber ein Abschluss in einem inhaltlich ähnli-
chen Fach bzw. lediglich irgendein Bachelorabschluss genügen. Je nach Interessen und Vorlie-
ben tun sich so sehr viele andere Möglichkeiten auf (z.B. M.A. Zentralasienstudien, HU Berlin).
Wie bereits gesagt, die Auswahl ist groß und kann nur bewältigt werden, wenn du dir selbst
einen fachlichen Schwerpunkt setzt. Neben inner-soziologischen Interessen, bzw. denen aus
deinem Nebenfach, ist es auch immer ratsam auf die Realisierung von Berufswünschen bzw.
Promotionsvorhaben zu achten und mit dem gewählten Master darauf hin zu arbeiten.
Ebenso wichtig wie das richtige Thema, ist es die richtige Universität zu finden. Ist dein
Masterprogramm sehr speziell, kann es sein, dass es nur von einer Uni angeboten wird. Einige
Studiengänge begegnen dir aber auch im Studienprogramm vieler verschiedener Unis. Sie un-
terscheiden sich auf den ersten Blick nur marginal, bzw. gar nicht. Genauso aber wie beim Ba-
chelor können Studiengänge mit gleichem Titel an den verschiedenen Unis stark differieren.
Das gilt für Struktur und Didaktik, aber vor allem für die gelehrten Inhalte. Auf deine fachlichen
Schwerpunkte ist auch hier zu achten. Je nach dem in welcher Tradition die Soziologie bzw. das
andere Fach an der Uni steht und welche Wissenschaftler_innen an ihr lehren, liegt der Fokus
verstärkt auf Theorie oder Empirie, wird auf manche Inhalte mehr Wert gelegt als auf andere
und werden gelehrte Inhalte auch unterschiedlich betrachtet und ausgelegt. Gerade wenn du
dich für einen Master in Soziologie entscheidest, wirst du, genauso wie beim Bachelor, starke
Unterschiede zwischen den einzelnen Unis feststellen. Wähle also am besten schon von An-
fang an eine Uni, deren Ausrichtung und Studienschwerpunkte dir zusagen. Das Durchstöbern
der aktuellen und vergangenen Vorlesungsverzeichnisse, ebenso wie Projekte der einzelnen
Lehrstühle und Publikationslisten der Dozierenden vor Ort, sind beim Finden der für dich rich-
tigen Uni mehr als hilfreich. Auch Kooperationen mit ausländischen Unis und (Forschungs-
)Assoziationen können dabei bedacht werden. Ein Studienwechsel nach einer Fehlentschei-
dung ist natürlich immer möglich, aber nicht alle Studierenden sind dazu in der Lage, z.B. we-
gen Einschränkungen durch das BAföG-Amt.
Ein weiterer Punkt, den du bedenken kannst, ist der Ruf der Uni. Sicher ist ein guter Ruf ein
gutes Zeichen für eine hervorragende Lehre, aber dabei ist darauf zu achten, auf welche Studi-
enfächer sich dieser Ruf bezieht. Wie viele Nobelpreisträger_innen eine Universität hervorge-
bracht hat, sagt nicht viel über die Qualität der an ihr gelehrten Soziologie aus, deren Ruf aber
für dich entscheidend sein sollte. Das herauszufinden ist manchmal nicht leicht. Von einigen
Unis, an denen man gut bis sehr gut Soziologie studieren kann, hat man eventuell schon mal
während des Studiums gehört. Um mehr heraus zu finden, kann man Freunde und Bekannte
fragen, die an anderen Unis Soziologie studieren. Auch die Studienberatung und Dozent_innen
28
kann man konsultieren. Letztere kennen häufig auch Studienschwerpunkte einzelner Unis. Ein
objektiveres Verfahren sind Ranking-Listen. Die sind meinungsbildend und verbreiten den Ruf
einer Uni. Auch wenn das Vergleichen der Unis durch die simple Gegenüberstellungen sehr
einfach und schnell geht, sollte man Rankings mit Vorsicht genießen und sich mehr Informati-
onen einholen, bevor man sich ein Urteil bildet.
Noch ein wichtiger Punkt, der hier mehrmals anklang, ist die Prominenz der Wissenschaft-
ler_innen an einer Uni. Einige Namen von gegenwärtig lehrenden Soziolog_innen habt ihr wäh-
rend eures Studiums sicher häufiger gehört als andere. Das kann mit der Ausrichtung eures
Bachelors zusammenhängen, sagt aber auch etwas über die Bedeutung dieser Wissenschaft-
ler_innen im gegenwärtigen Wissenschaftsdiskurs aus. Hoch renommierte Wissenschaft-
ler_innen an einer Uni tragen viel zum Ruf und zur Qualität der dortigen Lehre bei und setzten
vor allem inhaltliche Schwerpunkte. Sich die Mitarbeiter_innenlisten der einzelnen Universitä-
ten im Fach Soziologie anzusehen, bietet eine weitere gute Orientierungshilfe.
Auch wenn sich die Mehrheit derer, die einen für sich geeigneten Master-Platz suchen, in
Deutschland orientieren, sei an dieser Stelle daran erinnert, dass das keine Selbstverständlich-
keit sein muss. Der Bolognaprozess ist eine europaweite Initiative, zur Entwicklung eines ein-
heitlichen europäischen Hochschulraums. Bachelor- und Master-Programme werden immer
häufiger in den verschiedensten Ländern Europas angeboten, z.T. auch in einer viel längeren
Tradition als in Deutschland. Hinzu kommt eine hohe Anzahl an international ausgelegten
Master-Programmen, deren Anzahl jährlich steigt und die in den unterschiedlichsten Ländern
zu finden sind. Das Masterstudium im Ausland wird unter den gleichen Bedingungen wie das
im Inland durch BaföG gefördert. Darüber hinaus gibt es einen großen Pool an nationalen und
internationalen Stiftungen, die Stipendien dafür anbieten. Trotz all der Vorteile, die durch ext-
ra Skills, wie zusätzlichen Erwerb von Sprachkenntnissen und transkultureller Erfahrungen,
noch komplementiert werden, ist hier auch oft mehr Organisationstalent und -wille gefragt.
Die Auswahl an Möglichkeiten ist wesentlich höher und die fremde Kultur und evtl. Sprache
machen die Organisation nicht leichter. Dennoch handelt es sich hierbei um eine nicht zu ver-
nachlässigende Option, über die es sich lohnt einmal nachzudenken.
Erstmal entschieden für einen Studiengang fehlt „nur noch“ die Bewerbung. Die Modalitä-
ten dafür können sich von Uni zu Uni stark unterscheiden. Die Abschlussnote ist immer wichtig
bei Studiengängen, auf die sich mehr Studierende bewerben als Plätze zur Verfügung stehen,
muss aber nicht das letzte Wort sprechen. Manche Master-Programme haben eigene Aus-
wahlverfahren, die zumeist aus verschiedenen Tests und anzufertigenden Arbeiten bestehen.
Praxiserfahrungen, Fremdsprachenkenntnisse und andere Qualifikationen können ebenfalls
29
verlangt bzw. in das Entscheidungsverfahren mit einbezogen werden. Für den Großteil der So-
ziologie-verwandten Master-Programme genügt es allerdings, (ähnlich) wie beim Bachelor,
Antragsformulare auszufüllen, das Abschlusszeugnis anzuhängen und Daumen zu drücken,
dass man angenommen wird. In diesem Sinne viel Erfolg beim Bewerben!
30
IV. Soziologie jenseits von Credit Points, Stundenplan und Mo-
dulkatalog. Wie sieht dein Studium neben dem obligatori-
schen Studienalltag aus?
1. Welche Möglichkeiten bieten sich am Institut erste wissenschaft-
liche Arbeit aufzunehmen?
Von Michael Wutzler
Während meines ersten Semesters an der Uni habe ich mich oft gefragt, wer denn dieser
Typ ist, der zu Beginn der Vorlesung dem Professor immer die Technik vorbereitet (manchmal
sah es so aus, als würde er ihm den ganzen Tag hinterher dackeln). Oder wunderte mich, wie
es kommt, dass die Seminarlektüre und die Power-Point-Präsentationen so schnell im Netz
verfügbar sind. Und die, die mit einem riesigen Stapel an Büchern und Zeitschriften jedes Mal
den Kopierer besetzte, ging mir schon lange auf die Nerven. Nur für meinen Tutor, der mir
wichtige Tipps gab und bei dem ich alle offenen Fragen loswerden konnte, empfand ich Sym-
pathie. All diese Situationen beschreiben Tätigkeiten, die von studentischen Hilfswissenschaft-
ler_innen (Hiwis) ausgeführt werden. Aber die Mitarbeit am Institut ist nicht nur auf diese Tä-
tigkeiten begrenzt.
Hiwis sind studentische wissenschaftliche Hilfskräfte, die den Lehrstühlen zur Unterstüt-
zung ihrer Forschungsarbeit dienen. Aber auch in der universitären Verwaltung, in Bibliotheken
oder in angeschlossenen Sonderforschungsbereichen sind Hiwis angestellt. Sie arbeiten als
Tutor_in, korrigieren Übungsaufgaben oder Klausuren, warten PCs, redigieren Arbeiten, bear-
beiten Websites oder recherchieren, kopieren und arbeiten in Bibliotheken usw.
Die Liste der Hiwi-Tätigkeiten ist lang und die Möglichkeit der studentischen Beschäftigung
am Institut vielfältig und sehr gefragt. Hiwis müssen Prüfungen ablegen, wie jeder andere Stu-
dierende auch, aber die jeweiligen Tätigkeiten geben ihnen die Möglichkeit, Einblicke in kon-
krete wissenschaftliche Arbeit zu bekommen und gleichzeitig Fähigkeiten und Kenntnisse zu
erwerben, die einem auch in der Zukunft nützlich sind. Darüber hinaus sind Hiwis ein wichtiger
Teil der wissenschaftlichen Lehre und Forschung. Sie halten die Uni am Laufen. Ein Hiwi-Job ist
nicht nur ein gute und meist flexible Art und Weise das Studium zu finanzieren, mitunter sind
Hiwi-Tätigkeiten der erste Schritt in eine akademische Karriere.
Beispielsweise als Mentor_in zu den Studieneinführungstagen: Damit du dich vor Beginn
des Studiums nicht verloren fühlst, gibt es für alle neuen Studierenden die Möglichkeit zu den
31
Einführungstagen alles Wichtige über das Studium und das Studierendendasein zu erfahren.
Neben einem allgemeinen Teil gibt es fächerspezifische Veranstaltungen, die von Studieren-
den, den Mentor_innen, organisiert werden. Darunter fallen sowohl Veranstaltungen zur Ein-
führung und Erläuterung der Studiengänge, eine Bibliotheksführung, ein Stadtrundgang als
auch die Präsentation des Fachschaftsrats, das Zusammenbringen der Professor_innen für die
Vorstellung der Lehrstühle und schließlich Kleingruppenarbeit, in der die Erstsemester alle
noch offenen Fragen durch die studentischen Mentor_innen beantwortet bekommen.
Als Tutor_in veranstaltet man in Begleitung zu Vorlesungen oder Seminaren der ersten Se-
mester eigene Veranstaltungen, in denen die Studierenden alles Offengebliebene oder Nicht-
verstandene diskutieren können. Dabei wird man als Tutor_in nicht nur rhetorisch geübter,
sondern lernt auch, wie man Argumente zuspitzen und konkretisieren kann.
Einen besonderen, lehrreichen und spannenden Einblick in die Abläufe des Instituts sowie
der Forschungsarbeit bekommt man als Lehrstuhl-Hiwi oder Hiwi in einem Forschungsprojekt.
Hier ist man direkt in konkrete Forschungsarbeit und den alltäglichen Ablauf am Institut inte-
griert. Die Arbeit, die man übernimmt ist qualitativ sehr unterschiedlich. Sie reicht vom einfa-
chen Kopieren und der Literaturrecherche, über das Transkribieren von Interviews, bis hin zum
Entwerfen von Fragebögen oder der Auswertung von Daten. Manchmal hat man sogar das Pri-
vileg eines eigenen Arbeitsplatzes in der Uni.
Die studentischen Tätigkeiten gelten zwar als unverzichtbar und sind sehr begehrt, haben
jedoch auch ihre Kehrseite. Maßgeblich für das Arbeitsverhältnis eines Hiwis ist sein Arbeits-
vertrag. Doch oft sind die Arbeitsbedingungen alles andere als gerecht. Viele Hiwis haben Ver-
träge mit nur kurzen Laufzeiten (meist nur über ein Semester) oder müssen unbezahlte Über-
stunden leisten. In den meisten Bundesländern gibt es, trotz jahrelanger Bemühungen der
Gewerkschaften, für Hiwis keinen Tarifvertrag. Der Stundenlohn wird in jedem Bundesland
individuell geregelt. Der überwiegende Teil der studentisch Beschäftigten ist zudem nicht aus-
reichend über die eigenen Rechte informiert. Urlaub und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall
werden oft nur zögernd gewährt oder die Zeit muss nachgearbeitet werden.
Hiwis gelten als Beschäftigte und werden deshalb auch vom Personalrat vertreten. Bei
Problemen kann man sich also an den Personalrat oder an die studentischen Gremien wenden.
Hilfe, Informationen und Unterstützung bekommt man auch von den Gewerkschaften. Zumeist
sind Hiwis nicht organisiert, aber in der Regel lohnt es sich, Mitglied in einer Gewerkschaft zu
werden.
Maximal darf ein Hiwi die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit arbeiten, das sind 20 Stunden
in der Woche oder 80 im Monat. Die Dauer des einzelnen Hiwi-Vertrags wird von den entspre-
32
chenden Einrichtungen, Instituten oder Lehrstühlen festgelegt. Ein Hiwi-Dasein endet aber in
jedem Fall mit der Exmatrikulation.
Schaden kann eine Hiwi-Stelle nie. Wenn man eng mit einem Dozenten oder einer Dozentin
zusammenarbeitet, kann man ein Gefühl dafür entwickeln, was dieser von einem erwartet
oder wo seine Vorlieben liegen. Dies ist besonders für Prüfungen hilfreich. Zudem hat ein_e
Professor_in meist Zeit für seine Hiwis. Man muss also nicht stundenlang auf Termine in
Sprechstunden warten.
Infos über freie Stellen findet man auf der Instituts-Homepage oder am Schwarzen Brett im
Institut. Dort sind die Stellen meist ausgeschrieben. Hin und wieder kann man auch von
Kommiliton_innen, die bereits angestellt sind erfahren, ob es eine freie Stelle gibt. Von Vorteil
ist es, wenn der- oder diejenige der/die die Stelle anbietet dich bereits aus einer Veranstaltung
kennt.
2. Wie kann man sich in studentischen Gremien engagieren?
Von Elisabeth Nickler und Michael Wutzler
Am 17.6.2009 waren ca. 270 000 Studierende und Schüler_innen auf der Straße, um für ei-
ne bessere Bildung zu demonstrieren. Die Demo stand im Mittelpunkt der bundesweiten Bil-
dungsstreikwoche im Sommersemester 2009, in der es auch zu Blockaden, Flash Mobs, Beset-
zungen und weiteren solidarischen Aktionen kam. Gründe für den Unmut der Lernenden wa-
ren u.a. die steigende finanzielle Last der Studierenden durch Studiengebühren; die schlechten
Betreuungsverhältnisse; die fehlenden Freiheiten in der eigenen Studiengestaltung; die man-
gelhafte Umsetzung des Bologna-Prozesses und die geringen Gestaltungsmöglichkeiten inner-
halb der Hochschulen.
Studierende stellen die größte Gruppe der Angehörigen in den Hochschulen, dagegen ist ihr
Einfluss ziemlich gering. Aber man kann sich durchaus auf verschiedenen Ebenen studentisch
engagieren und die eigenen Studienbedingungen und die Hochschule mitgestalten. Dass Stu-
dierende an der demokratischen Gestaltung der Hochschulen mitwirken können, ist nicht
selbstverständlich. Viele Rechte mussten erst erkämpft werden. Das jeweilige Hochschulgesetz
eines Bundeslandes bestimmt dabei die Organisationsstruktur der Hochschulen.
Es gibt verschiedene Institutionen, die das Zusammenwirken aller Mitarbeiter_innen und
Studierenden regeln. Einerseits gibt es die studentischen Selbstverwaltungsgremien
(Fachschaftsrat und Studierendenrat bzw. Allgemeiner Studierendenausschuss), andererseits
die studentischen Vertreter_innen in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung der
33
Hochschule (Fakultätsrat und Senat), in denen man sich für die Belange der Studierenden ein-
setzen kann. Gewählt werden sie jährlich, leider ist die Wahlbeteiligung meist sehr gering.
Finanziert werden die Gremien der studentischen Selbstverwaltung durch die Semesterbei-
träge der Studierenden. Das Geld geht jedoch keinesfalls an die Mitglieder selbst, die Arbeit in
den Gremien ist ehrenamtlich. Die Gremien sind dafür verantwortlich, die Studierendengelder
in verschiedenste (eigene und externe) studentische Projekte zu investieren. Dabei kontrollie-
ren sie, ob dies auch im Sinne der Studierendenschaft geschieht. Finanziert und gefördert wer-
den beispielsweise Vortragsreihen, studentische Medien, die studentische Kultur in der jewei-
ligen Stadt und Betreuungs-, Service- und Beratungsangebote für Studierende.
Vermutlich wirst du das erste Mal auf Vertreter_innen studentischer Gremien während den
Studieneinführungstagen treffen. Die Mentor_innen, welche die Einführungstage organisieren,
sind häufig Mitglieder des Fachschaftsrats – kurz FSR. Einen FSR gibt es in der Regel für jede
Fachrichtung. Häufig schließen sich jedoch kleine Fachschaften oder inhaltlich nah beieinander
liegende Fachschaften zusammen. Je nach Satzung ist die Anzahl der gewählten Mitglieder be-
grenzt. Gleichzeitig ist der FSR jedoch für jede und jeden ein offenes Gremium, das sich insbe-
sondere auch über die aktive Mitarbeit von nicht gewählten Studierenden freut, denn nur
durch Offenheit und Zusammenarbeit lassen sich innovative Ideen entwickeln und zahlreiche
Projekte verwirklichen.
Kernaufgabe des FSR ist die Interessenvertretung der Studierendenschaft gegenüber dem
Institut. Mit anderen Worten: Du solltest nicht zögern, dich an deinen Fachschaftsrat zu wen-
den, wenn studentische Interessen, Belange, Wünsche, Anregungen und Kritik gegenüber dem
Institut Gehör finden sollen. Am einfachsten geht dies natürlich, wenn du dich einfach an der
Arbeit des FSR beteiligst.
Doch dies ist noch nicht alles. Der FSR sollte als Gremium verstanden werden, dass sich für
all das einsetzt, was den Student_innen der eigenen Fachschaft zu Gute kommen kann. Das
fängt bei guten Partys, Wandertagen, Spiele-Abenden, sportlichen Wettkämpfen und gemein-
samen Frühstücken an (auch mit den Dozent_innen). Häufig lassen sich hier auch neue Kontak-
te knüpfen, gerade in den ersten Wochen des Studiums. Je mehr interessierte und engagierte
Student_innen im FSR mitarbeiten, desto mehr Großprojekte lassen sich organisieren, wie bei-
spielsweise: thematische Vortragsreihen oder Filmreihen mit daran anschließenden Diskussio-
nen; die Organisation von Diskussionsrunden zur aktuellen Studiensituation, welche die Zu-
sammenarbeit und Gestaltung des eigenen Studiums gemeinsam mit Dozent_innen verbessern
sollen; Informationsveranstaltungen zu Themen wie einem Auslandsstudium und möglichen
Berufsperspektiven; oder das Etablieren einer Praktikumsbörse. Je mehr Student_innen sich
34
für ihren FSR engagieren, desto vielfältigere Ideen über mögliche Projekte gibt es. Außerdem
lässt sich die Arbeit besser verteilen und so aufwändige Veranstaltungen leichter organisieren.
Der FSR trifft sich in der Regel einmal pro Woche, um alle laufenden Projekte zu besprechen
und zu organisieren, sowie weitere Ideen zu sammeln. Diese wöchentlichen Sitzungen sind für
alle Student_innen offen, sodass sich jede_n Student_in aktiv im FSR beteiligen, seine Interes-
sen und Wünsche dort äußern oder den FSR bei konkreten Anliegen um Unterstützung bitten
kann. Erfolgreiche FSR-Arbeit lebt also von interessierten, intrinsisch motivierten, engagierten
oder mit einer gesunden Portion Idealismus ausgestatteten Student_innen, die sich an ihrer
eigenen Hochschule für hochschulpolitische Arbeit im Interesse der Studierenden beteiligen
wollen. Kurz gesagt: bei der Arbeit des FSR kann man viel Spaß haben und zugleich so einiges
bewegen. Es lohnt sich in jedem Fall.
Der Studierendenrat (StuRa) oder der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA) sind die
gewählten studentischen Vertretungen der gesamten Studierendenschaft einer Hochschule.
Der AStA wird in der Regel vom Studierendenparlament bestimmt. Der StuRa (vor allem in den
neuen Bundesländern) vereinigt AStA und Studierendenparlament. Ausnahmen bilden Bayern
und Baden-Württemberg. In diesen Bundesländern wurde in den 1970er Jahren die verfasste
Studierendenschaft abgeschafft. Im Gegenzug bildeten sich unabhängige Studierendenschaf-
ten (UStA). Auch in Hessen wurden 2006 massive Einschnitte in die Rechte der Studierenden-
schaft vorgenommen. Allgemein geht der Trend auch in anderen Bundesländern hin zu weni-
ger demokratischen Strukturen an den Hochschulen. Allein deshalb lohnt es sich Engagement
aufzubringen.
Die Gremien und Organe der verfassten Studierendenschaft vertreten die Interessen der
Studierenden gegenüber der Hochschule, der Hochschulleitung, der Stadt, dem Land und der
Öffentlichkeit. Die genauen Strukturen sind von Bundesland zu Bundesland und auch von
Hochschule zu Hochschule unterschiedlich geregelt. Die Sitzungen sind öffentlich und finden
meist wöchentlich statt. Neben der meinungsbildenden und vertretenden Funktion, werden
auch verschiedene Dienstleistungen von den Gremien der studentischen Selbstverwaltung an-
geboten, beispielsweise Rechts- und Sozialberatung, Beratung der Hiwis, Wohnungs- und Ar-
beitsvermittlung, verbilligte Kopier- sowie Druckmöglichkeiten und Verkauf von Büromateria-
lien. Zudem gehört die Verhandlung über das Semesterticket mit der Deutschen Bahn und den
lokalen Verkehrsgemeinschaften zu den Tätigkeiten dieser Gremien.
Den Gremien der Studierendenschaft sind meist Referate angegliedert, welche die Verwal-
tung und Durchführung verschiedenster Aufgaben übernehmen (z.B. Kultur, Hochschulpolitik,
Umwelt, Soziales, Gleichstellung, Inneres, Öffentlichkeitsarbeit, Technik). Das Umweltreferat
35
beispielsweise beschäftigt sich mit den Themen Arten-, Umweltschutz, Nachhaltigkeit und ge-
sunder Ernährung. Es versucht u.a. die Hochschulleitung dazu zu bewegen, sich zu nachhalti-
gem Handeln zu verpflichten; tritt dafür ein, dass es mehr FairTrade und Bio-Nahrungsmittel
sowie ein breiteres Angebot an veganen und vegetarischen Mahlzeiten in den Mensen gibt;
bietet meist eine Sammelstelle für alte Batterien, CDs und Energiesparlampen an; und leiht
Energiemessgeräte aus. Ziel ist es einerseits, mittels Sensibilisierung, zu umweltbewusstem
Handeln zu motivieren, andererseits über kleinere oder größere Projekte, die umweltpolitische
Situation an der jeweiligen Hochschule und Stadt zu verbessern. Die Referent_innen der Refe-
rate werden vom StuRa oder dem Studierendenparlament gewählt. In der Regel bestehen die
Referate jedoch aus vielen gleichberechtigten Mitgliedern.
Innerhalb der akademischen Selbstverwaltung werden studentische Vertreter_innen für
Fakultätsräte und Senat gewählt, sowie in verschiedene Ausschüsse entsandt. Die Aufgaben
dieser Gremien sind in jedem Bundesland spezifisch geregelt.
Der Fakultätsrat setzt sich aus den gewählten Vertreter_innen der Professor_innen, des
wissenschaftlichen Mittelbaus und der Studierenden zusammen. Diese wählen den Dekan,
welcher die Fakultät leitet. Der Fakultätsrat beschäftigt sich mit allen Fragen von Bedeutung
für die Fakultät, beispielsweise: der Organisation, Struktur und Erfolgskontrolle von Forschung,
Lehre und Verwaltung; er erarbeitet Vorschläge zur Einrichtung, Änderung und Aufhebung von
Studiengängen; beschließt Studien-, Prüfungs- und Promotionsordnungen; verteilt zugewiese-
ne Personal- und Sachmittel; und führt Promotions- und Habilitationsverfahren durch.
Der Senat ist das zentrale und oberste Organ der Universität. Er besitzt strategische, kon-
trollierende und Leitungsaufgaben der Hochschule. Die Senatoren werden von den unter-
schiedlichen Personengruppen der Hochschule gewählt. Verglichen mit den Vertreter_innen
der Professor_innen und des Mittelbaus steht die Anzahl der studentischen Vertreter_innen
jedoch in keinem Verhältnis. Aufgaben des Senats sind u.a. die Verteilung von Personal- und
Sachmitteln an die Fakultäten, die Erarbeitung eines Hochschulentwicklungsplans und die
Strukturierung der Hochschule (Grundordnung). Für die Erfüllung spezifischer Aufgaben gibt es
meist Ausschüsse mit Beteiligung von Studierenden wie bspw. den Forschungsausschuss, Stu-
dienausschuss oder Bibliotheksausschuss. Diese koordinieren und bereiten Beschlussfassungen
vor.
Trotz der geringen Stimmenanzahl in den Gremien der akademischen Selbstverwaltung ist
es durchaus möglich Ideen und Anträge einzubringen, ebenso wie andere Mitglieder dieser
Gremien auf Missstände aufmerksam zu machen oder diese für seine Anliegen zu gewinnen.
Zum selbstbestimmten Lernen ist es jedoch selbstverständlich noch ein weiter Weg, aber mit
36
Engagement in den Gremien der Hochschule und der studentischen Selbstverwaltung kann
man den Anfang machen.
3. Lohnt sich ein Auslandsemester?
3.1. Sich neu auf sein Studium einlassen
Von Simon Bohn
Mit Antritt des Studiums war mir bereits klar, dass ich auf jeden Fall auch einige Zeit im
Ausland studieren wollte. Wie und wo genau wusste ich natürlich noch nicht, aber irgendwie
gehörte ein studienbezogener Auslandsaufenthalt für mich einfach zum „Programm“. Wäh-
rend des relativ stark durch strukturierten Grundstudiums war an diesen nicht zu denken und
mit diesem „Zeitproblem“ werden sich sicherlich auch viele Bachlorstudenten/innen herum
schlagen müssen. Dennoch empfiehlt es sich, frühzeitig nach Möglichkeiten für ein Auslands-
studium zu recherchieren und gegebenenfalls auch bereits in einer frühen Phase des Studiums
den entscheidenden Schritt zu wagen. Denn profitieren wird Mensch davon allemal, vorausge-
setzt es ist einem einigermaßen klar, wofür man den Auslandsaufenthalt nutzen möchte. Vie-
len geht es primär darum, eigene Sprachkenntnisse aufzufrischen oder gar eine neue Sprache
zu lernen. In diesem Fall empfiehlt es sich, im Voraus einen der vielen Sprachkurse wahrzu-
nehmen, die in der Regel an eurer Universität angeboten werden. Auch ein Sprachtandem,
also regelmäßige private Treffen mit einer Muttersprachlerin oder einem Muttersprachler, bei
denen es primär darum geht in lockerer Atmosphäre und im direkten Dialog die andere Spra-
che zu erlernen, bietet sich zuweilen an.
Neben der Sprache interessieren sich die meisten Studierenden auch für die Gebräuche
und Sitten in dem entsprechenden Land, kurz: die fremdartige Kultur. Zu beachten ist dann
natürlich, dass man während des Auslandsaufenthalts auch tatsächlich unter „Einheimische“
kommt, denn allzu oft berichten Studierende nach ihrem Auslandssemester, dass sie fast nur
mit Deutschen Kontakt hatten. Natürlich ist es manchmal nicht schlecht, wenn man sich mit
Kommilliton_innen über den Aufenthalt, die Probleme und auch die schönen Dinge im neuen
Land austauschen kann. Aber am besten ist es wohl, wenn man dies bereits vor der „Tour“
macht, etwa indem man sich mit Studierenden unterhält, die bereits an der gewünschten Uni-
versität waren und dort ihre Erfahrungen gemacht haben. Für mich persönlich war es dann
später wichtig, den neuen Studienort auf eigene Faust zu erkunden und gerade durch die zeit-
37
weilige Situation, ganz auf mich allein gestellt zu sein, um ein Maximum aus dem Auslandsauf-
enthalt „heraus zu holen“.
Für mich standen inhaltliche Schwerpunkte und eine gewisse „theoretische“ Ausrichtung
der entsprechenden Universität bzw. der ansässigen Forschungsinstitute deutlich im Vorder-
grund. Dieses inhaltliche Interesse ging soweit, dass ich mich sogar gegen den Besuch einer
fremdsprachigen Universität entschied. Denn von Freunden und Bekannten hatte ich häufig
gehört, dass sie aufgrund der Fremdsprache auf der inhaltlich-fachlichen Seite während ihres
Auslandsstudiums kaum dazu gelernt und stattdessen eben vor allem ihre Sprachkompetenzen
erweitert hatten. Sowohl inhaltlich als auch sprachlich voran zu kommen, ist eine sehr schwie-
rige Aufgabe und funktioniert vermutlich nur, wenn man die Landessprache bereits sehr gut
beherrscht.
Ich selbst suchte also vor allem nach fachlich spannenden Unis und wurde an der Uni in Ba-
sel fündig. Ich hatte das Vorlesungsverzeichnis der Uni Basel intensiv studiert und ging mit vol-
ler Vorfreude und klaren Zielen nach Basel. Der schweizerdeutsche Dialekt war natürlich trotz-
dem gewöhnungsbedürftig und zum Teil auch problematisch (Gespräche unter Schwei-
zer_innen blieben mir bis zum Schluss unverständlich, zumindest wenn sich diese nicht um
eine „ausländerfreundliche“ Aussprache bemühten), machte mir jedoch an der Universität nur
selten Schwierigkeiten, da die große Mehrzahl der Dozent_innen und auch viele Student_innen
aus Deutschland kamen.
Den dreimonatigen Aufenthalt organisierte ich über das SOKRATES/ERASMUS-Programm
der EU, für welches seit 1987 der DAAD als Nationale Institution zuständig ist. Die Teilnahme
an diesem grenzüberschreitenden Aktionsprogramm für den Hochschulbereich ist verhältnis-
mäßig unkompliziert und wurde unter anderem vom Soziologischen Institut und einem Aus-
landsbüro meiner Heimatuniversität aus geregelt, sodass die ganze Sache auch von der Ver-
waltung her schaffbar ist. Besonders gut war dabei natürlich der finanzielle Zuschuss, den man
durch das Programm erhält und ohne den so ein Auslandsaufenthalt nur sehr schwer zu
stemmen wäre. Zusätzlich zu dieser Förderung durch das ERASMUS-Programm erhielt ich eine
Auslandsförderung durch meine Studienstiftung, sodass ich in den drei Monaten finanziell gut
abgesichert war und sogar mein Zimmer in Jena halten konnte. Meine diesbezüglichen Erfah-
rungen sind also gut und ich kann nur empfehlen, sich die Mühe zu machen und einen studi-
enbezogenen Auslandsaufenthalt früher oder später in Angriff zu nehmen.
Es ist toll, einmal eine andere Universität kennen zu lernen, zu schauen, wie es sich woan-
ders studieren lässt und sich noch einmal ganz neu auf sein Studium einzulassen. Ich selbst
habe in Basel wahnsinnig viel gelernt und spannende Wissenschaftler_innen für mich „ent-
38
deckt“. Rückblickend haben diese drei Monate mit Sicherheit den größten Einfluss auf mein
Studium ausgeübt und mich in einer Intensität befördert, wie man es von einem eigentlich
sehr kurzen Zeitraum kaum erwartet.
3.2. „Ein Auslandssemester - immer eine gute Idee?“
Von Katrin Schwarz
Ein Auslandssemester gehört definitiv zu den spannenden Seiten des Studiums. Zum einen
ist es eine interessante und meist unvergessliche Erfahrung, allein in ein fremdes Land zu zie-
hen, um dort zu leben und zu studieren. Oftmals hört man von ausufernden Partys, lässigem
Leben und einfach verdienten ECTS. Auch wenn diese Leistungspunkte oft nicht von der Hei-
matuniversität anerkannt werden.
Diese Erfahrungen habe ich so nicht gemacht. Nach einem sehr bürokratischen Start fand
ich mich an der University of Warwick in den idyllischen West-Midlands in England wieder. Die
Universität stellte sich als eine der führenden Eliteuniversitäten Großbritanniens heraus, was
die Erasmus-Vorurteile schnell beseitigte. Mein Studienpensum dort war sehr viel höher als an
meiner Heimatuniversität, da das Studium in Großbritannien sehr literaturbasiert gestaltet
wird. Wer in Jena schon bei 60 Seiten pro Seminar pro Woche kurz vor dem Zusammenbruch
steht, ist bei dem Satz „Just read the whole book.“ sicherlich genauso geschockt, wie ich es
war. Die ECTS waren somit nicht leicht verdient, sondern mussten mit sehr vielen Essays und
noch mehr theoretischen Debatten über noch theoretischere Texte erkämpft werden. Doch
auch wenn ich es zunächst unfair fand, dass es anderen Erasmus-Studierenden an ihren Briti-
schen Unis sehr viel leichter gemacht wurde, konnte ich mich im Laufe der Zeit sehr gut damit
anfreunden. Die Seminare waren sehr klein, was sich positiv auf die Diskussionskultur auswirk-
te. Ich habe selten so viel Neues gelesen und gelernt wie in Warwick. Beispielsweise konnte ich
mit Parita Mukta über Entwicklungspolitik diskutieren und bekam einen Einblick in dieses gro-
ße, von der Soziologie in Jena weitestgehend unberührte, Feld. Beeindruckend waren auch
Charles Turners theoretische Diskussionen der soziologischen Klassiker, welche in England mit
einer anderen Perspektive betrachtet werden, als es in Jena üblich ist. Doch am meisten be-
eindruckt hat mich das Seminar „Sociology of the Holocaust“ mit Steve Fuller. Mir ist erst dort
klar geworden, was es bedeutet, sich nicht ausreichend von einem Thema distanzieren zu kön-
nen, um Objektivität zu schaffen. Sprachlich hat man zunächst einige Probleme, da einem das
Vokabular und die Übung fehlen, um schnell und effektiv zu lesen, zu schreiben und zu disku-
39
tieren. Doch ich war überrascht, wie schnell man auch hier ein hohes wissenschaftliches Ni-
veau erreichen kann. Zeitlich habe ich durch meinen Aufenthalt in England übrigens auch
nichts eingebüßt, da mir alle Leistungen anerkannt wurden.
Der Einstieg in den Unialltag wurde den Erasmus-Studierenden sehr leicht gemacht. Es
wurden hilfreiche Einführungsveranstaltungen zu studienrelevanten Themen, wie Präsentati-
onstechniken, wissenschaftliches Schreiben, richtige Aussprache, etc. angeboten. Weiterhin
waren in jedem Seminar ausgiebige Vorstellungsrunden üblich. Außerdem basierten die Dis-
kussionen innerhalb des Seminars auf dem Prinzip „Jeder trägt etwas bei und wenn es der Rei-
he nach gehen muss.“ Diese Verfahrensweise war für mich sehr gewöhnungsbedürftig, hatte
aber den Vorteil, dass man dazu gezwungen wurde, aktiv teilzunehmen und mit den anderen
Seminarteilnehmer_innen zu interagieren. Man musste somit seine eigene Hemmschwelle
überwinden, was die sprachlichen Fähigkeiten sehr verbesserte. Für meine Fremdsprachen-
kenntnisse war dies sehr förderlich, da ich gelernt habe mich auf hohem Niveau in Englisch in
Diskussionen zu behaupten. So entstanden auch schnell Kontakte zu „Einheimischen“, welche
dann oft bei gemeinsamen Aktivitäten in den Societies, kurz socs, vertieft wurden.
Mit über 250 verschiedenen socs war es jedem Studierenden in Warwick möglich, seine
Freizeit sinnvoll zu nutzen und nach seinen Wünschen zu gestalten. Von Sport, über Reisen,
Whisky trinken, kochen, Filme schauen oder die Welt retten ist alles erdenklich Mögliche bei
den socs vertreten. Großer Vorteil dieser Vereinigungen ist, dass man den Kontakt zu anderen
Studis aufbauen kann, die eventuell nicht im ERASMUS-Dunstkreis verankert sind. Außerdem
gibt es mehrmals im Term socials, d.h. Treffen, welche nicht selten in Kneipentouren enden.
Kategorisch für jeden ERASMUS-Studierenden ist die ERASMUS-society, welche bei Fragen
zur Verfügung steht und die ERASMUSees untereinander vernetzt. Natürlich kümmert sich die-
se society darum, die ausländischen Studierenden in das Partyleben auf dem Campus und in
der Umgebung einzuführen, Shoppingtipps zu vergeben und last but not least eine gigantische
Klassenfahrt zu organisieren. Für meinen Erasmusjahrgang ging es mit dem Bus nach Edin-
burgh. Rückblickend muss ich sagen, dass dieser Wochenendtrip mit zu meinen schönsten und
lustigsten Erlebnissen gehörte.
Die gemeinsame Zeit mit anderen Erasmusstudent_innen war im Allgemeinen sehr unter-
haltsam, da man sich regelmäßig zu Hauspartys traf, Tea Time zusammen genoss und es feste
Termine gab, wie die 1₤- Party jeden Donnerstag. Die kollektive Erfahrung fremd in einem
Land zu sein, schweißt eine Gruppe sehr zusammen. Man sollte jedoch versuchen, sich nicht
gänzlich von den Einheimischen abzugrenzen. Empfehlenswert ist auch das Angebot ein Wo-
chenende bei einer Britischen Gastfamilie zu verbringen. Für die sprachlichen Fähigkeiten ist
40
der Kontakt mit Natives sehr wichtig, da man so am schnellsten und effektivsten sprachliche
Feinheiten erlernt. Bleibt man die ganze Zeit unter Erasmusees, ist die Gefahr groß, entweder
in seiner eigenen Sprache zu bleiben oder Fehler anderer zu übernehmen.
Neben den vielen verlockenden Freizeit- und Reiseangeboten ist es äußerst schwer sich auf
das Studienpensum zu konzentrieren, sodass es häufig zur Regel wurde von Sonntagabend bis
Donnerstagnachmittag zu einem extrem fleißigen Studierenden zu mutieren und die restliche
Zeit ausgiebig mit Freizeitaktivitäten zu füllen. Der Balanceakt gelingt nicht jedem, aber es
kann funktionieren.
Der ständige Vergleich mit der Heimatuniversität bleibt mental immer vorhanden, so dass
nach einem Auslandssemester einige Aspekte an Wert gewonnen und andere an Wertschät-
zung verloren haben. Unabhängig von objektiven Rankings ist so ein Vergleich der Universitä-
ten sehr gut möglich.
Ein Aufenthalt im Ausland verändert auch den Blick auf sein eigenes Heimatland, Familie
und Freunde. Seltsamerweise vermisst man plötzlich persönliche Kontakte und Kleinigkeiten,
die vorher sehr marginal wahrgenommen wurden. Man entwickelt zwar sehr ausgeprägte So-
zialkompetenzen und wird geübter im Umgang mit Fremden und internationalen Bekannten,
doch auch der Wert von langjährigen Freunden steigt plötzlich merklich.
Ich kann jedem ein Auslandssemester empfehlen, weil es neben viel Spaß und neuen inter-
nationalen Bekannten, auch dafür sorgt, dass man frische Motivation für das weitere Studium
schöpft. Besonders durch die Möglichkeit zum Vergleich des Instituts in der Heimat und dem
Institut in der Ferne, kann die eigene wissenschaftliche und fachliche Ausrichtung nach einem
Auslandssemester zunehmend differenzierter reflektiert werden.
Es sollte aber keineswegs vergessen werden, dass ein Semester im Ausland neben tollen
neuen Erfahrungen, auch negativere Empfindungen mit sich bringt. Es ist zu beschreiben als
ein emotionales Auf und Ab. Sicher kommt es immer auf das spezifische Land und die Hoch-
schule an, ich habe jedoch die Erfahrung gemacht, dass man sich zunächst durch Berge von
bürokratischen Anforderungen kämpfen muss, um dann in eine lange Phase des Nichtwissens
zu tauchen, da man erst sehr spät Bescheid bekommt, ob man angenommen ist, seine Kurse
genehmigt bekommt und ob man einen Platz in einem Wohnheim beziehen kann. Drei Wo-
chen vor Abreise wird man erst in Kenntnis gesetzt und geht in die Phase der hektischen Vor-
bereitungen über.
Angekommen an der neuen Universität stellt man fest, dass Planung nicht viel bringt, wenn
man die dortigen Gepflogenheiten nicht kennt. Zwischen Chaos, Panik und Heimweh lernt man
unzählige neue Menschen kennen, die einen dann durch die anschließende
41
„Honeymoonphase“ begleiten. Alles ist neu, alles ist chic und alles ist viel besser als zu Hause.
Nach dieser Phase folgt meist die nüchterne Routine. Studieren und Leben im Ausland ist halt
doch kein Urlaub. Es gibt auch hier Abgabefristen, uninteressante Bekannte und Abende, an
denen man besser zu Hause geblieben wäre. Die feinen Unterschiede im sozialen Umgang wir-
ken nun nicht mehr nur spannend, sondern z.T. auch nervig. Der Blick auf den Kontoauszug
holt einen auch schnell in die harte Realität zurück.
Kurz vor Ende des Aufenthalts kehrt man jedoch zurück zu Euphorie und Jubelstimmung.
„Back in Good Old Germany“ fällt es den meisten dann schwer, sich wieder einzufinden. Ganz
in Schütz'scher Tradition kann der Heimkehrer nicht einfach seine alten Handlungs- und Orien-
tierungsmuster aufgreifen, da die Zeit auch in der Heimat weitergelaufen ist.
Abschließend kann ich jedoch sagen, dass man vorab festlegen sollte, welche Erfahrungen
man im Ausland machen möchte: Wer hauptsächlich feiern und Spaß haben will, sollte sich
eine entsprechende Universität aussuchen. Die Erfahrungsberichte früherer Erasmus-
Studierender sind bei der Recherche sehr hilfreich. Die Zeit als Erasmusstudent_in bringt einen
persönlich und auch fachlich sehr viel weiter und ist jedem zu empfehlen, der den Mut hat aus
dem schnöden Trott, der sich Routine nennt, auszubrechen.
4. Wie gestaltet sich ein Hochschulwechsel in der Soziologie?
Von Katharina Block
Von dem Vorhaben einen Hochschulwechsel durchführen zu wollen, kann ich ein Liedchen
singen, da ich schon zweimal die Hochschule gewechselt habe. Das bringt natürlich so einige
Dinge mit sich, die man berücksichtigen muss und die man auch unbedingt bedenken sollte. So
eine Entscheidung muss wohl überlegt sein, schließlich verbringt man meistens mehrere Jahre
an einer Uni.
Als Soziologiestudentin konnte die erste Hochschule bzw. Uni, an der ich studiert habe, ab
einem bestimmten Punkt meine Interessen nicht mehr zufriedenstellend abdecken. Der
Schwerpunkt in Soziologie wurde an dieser Uni auf Empirische Sozialforschung gelegt. Ich woll-
te mein Wissen aber in den Theorien der Soziologie vertiefen, so war für mich irgendwann klar,
dass ich nach dem Bachelorabschluss eine Uni mit einem Masterprogramm finden musste,
dass mehr meinen Interessen entsprach. Damals dachte ich nicht, dass es tatsächlich sehr fei-
ne inhaltliche Unterschiede zwischen den Soziologieangeboten der verschiedenen Unis gibt.
Einige Unis legen beispielsweise den Schwerpunkt auf Demographieforschung und haben
dementsprechend ein großes Angebot an Familien-, Jugend- und/oder Alterssoziologie inklusi-
42
ve einem großen Anteil an Statistik im Studium. Andere Unis legen den Schwerpunkt vielleicht
auf eine kritische Soziologie, die sich vorwiegend theoretisch mit den gesellschaftlichen Gege-
benheiten, deren Voraussetzungen und möglichen Transformationen auseinandersetzt. Hier
werden häufig Positionen vertreten, die beispielsweise den Kapitalismus, bürgerliche Gesell-
schaftsstrukturen oder auch den Staat in seiner jetzigen Form kritisch hinterfragen. Dies macht
sich natürlich auch in den Lehrinhalten bemerkbar. Wiederum andere Soziologielehrstühle an
anderen Unis haben vielleicht den Schwerpunkt auf Funktionalismus, Systemtheorie und Rati-
onal-Choice-Theorien gelegt, was sich dementsprechend in den Lehrplänen widerspiegelt.
Zwar sollen in den Einführungsveranstaltungen der ersten Semester die Inhalte verschiedener
soziologischer Theorien in einem möglichst breiten Spektrum vermittelt werden, aber in den
höheren Semestern schält sich dann normalerweise eine Schwerpunktrichtung heraus. Man
sollte sich einfach im Klaren darüber sein, dass nicht jede Uni den gleichen Soziologielehrplan
hat.
Dass die persönlichen Interessen gut durch die Lehrangebote der Uni abgedeckt sein soll-
ten, ist allgemein ein wichtiger Punkt, denn so kann man einen Wechsel vielleicht von vornhe-
rein vermeiden. Ob sich das Lehrangebot der ausgewählten Uni mit den persönlichen Interes-
sen deckt, kann man ganz leicht durch einen Blick in das Vorlesungsverzeichnis herausfinden.
Dieses findet man in der Regel direkt auf der Internetpräsenz der Universitäten. Häufig kann
man sich sogar auch noch die Vorlesungsverzeichnisse der letzten Semester anschauen, so
dass man einen guten Überblick über das Lehrangebot und die Lehrenden bekommen kann.
Bei meinem ersten Hochschulwechsel hatte ich noch nicht genügend darauf geachtet, wie
sich das Lehrangebot der Uni in Soziologie zusammensetzt. Ich wusste zwar von einem Institut,
das mich interessiert hatte. Aber selbst über dieses hatte ich mich nicht wirklich gründlich in-
formiert. So bin ich ein wenig blauäugig an die von mir ausgewählte Uni gewechselt. Dieser
Schritt bedeutete ja auch gleichzeitig einen kompletten Umzug in eine neue Stadt. Man muss
sich ja nicht nur eine neue Uni suchen, sondern auch ein neues WG-Zimmer oder ähnliches
und sich eine neue Sozialstruktur aufbauen, denn wer will schon die ganze Zeit allein in einer
fremden Stadt 'rumsitzen. Mit letzterem hatte ich zwar bei meinem ersten Hochschulwechsel
Glück, denn ich hatte eine super WG gefunden, aber ich merkte ziemlich schnell, dass die Vor-
lesungen und Seminare doch nicht ganz dem entsprachen, was ich mir vorgestellt hatte. Die
Soziologie, die ich studieren wollte, wurde auch hier nicht angeboten. Hätte ich vor dem
Wechsel einfach einmal mehrere Universitäten miteinander verglichen — was Lehrangebote,
Institute und auch Lehrende betrifft — hätte ich bestimmt schon vor dem Hochschulwechsel
gewusst, dass der Soziologielehrstuhl, zu dem ich gewechselt hatte, doch nicht so gut zu mei-
43
nen Interessen passte. Tatsächlich lohnt es sich auch, sich über die aktuellen Lehrstuhlinha-
ber_innen bzw. Professor_innen, der Soziologielehrstühle und deren jeweiligen Forschungs-
schwerpunkte und Veröffentlichungen zu informieren, da man sich so einen differenzierten
Eindruck vom Wissensstoff, der an den jeweiligen Lehrstühlen vermittelt wird, machen kann.
Daneben sollte man sich ebenso über die nötigen formellen Anforderungen informieren, d.h.
besonders darauf zu achten, welche bereits bestandenen Module und erlangten ECTS von der
neuen Uni anerkannt werden.
Zum Glück habe ich schnell gemerkt, dass ich noch nicht den richtigen Soziologielehrstuhl
gefunden hatte und habe mich sofort nach einer Alternative umgesehen. Dieses Mal habe ich
mich vorher gründlich über die Soziologielehrstühle informiert. Am Ende fand ich eine Uni, an
der es einen Theorielehrstuhl in Soziologie gibt, der ziemlich genau die von mir erwünschten
Inhalte vermittelt. Zwar musste ich einen weiteren Umzug dafür in Kauf nehmen, aber lieber
diesen Umstand und dafür die nächsten Jahre das studieren, was ich will, als den Schritt nicht
wagen und am Ende das Gefühl haben, dass man eigentlich nicht das studiert hat, was man
immer wollte.
5. Ist es sinnvoll, sich neben dem Studium in studentisch organisier-
ten Eigeninitiativen zu engagieren?
Von Michael Wutzler
Du hast von interessanten Themen gelesen oder gehört, diese werden aber in keinem Se-
minar behandelt? Seminare fordern dich nicht mehr heraus oder sind uninteressant? Die the-
matische Breite der angebotenen Seminare ist zu dünn? Du kennst die Ausrichtung der hiesi-
gen Dozent_innen schon auswendig oder du findest sie zu einseitig? Für randständige, sehr
spezielle oder unbekannte Thematiken war im Seminar keine Zeit und kein Raum? Du hast dich
mit einer bestimmten Thematik auseinander gesetzt und möchtest dein Wissen teilen und im
Austausch mit anderen vertiefen? Oder suchst du einfach eine Abwechslung zu den herkömm-
lichen Veranstaltungen und möchtest etwas anders ausprobieren?
Dann höre auf zu warten und dich mit vorgesetzten Lerninhalten und -konzepten abzufin-
den: Nimm deine Bildung in die Hand und eigne dir dein Wissen selbst an. Am besten und
schnellsten lernt und versteht man soziologische Thematiken, wenn man den Lernprozess
selbst in die Hand nimmt. Und das unabhängig von deinem Vorwissen, der Thematik oder der
Anzahl der studentischen Mitstreiter_innen. In autonomen Veranstaltungen kann sich beson-
ders gut das entwickeln, was wissenschaftliches Arbeiten vor allem auszeichnet: der reziproke
44
Denkprozess und dessen ungezwungene Artikulation von eigenständigen Argumentationsli-
nien.
Mögliche Alternativen zum konventionellen Unibetrieb sind die Organisation von Vortrags-
reihen einerseits und von Lesezirkeln oder autonomen Seminaren andererseits. Alle drei bie-
ten die Möglichkeit und die Herausforderung sich selbstbestimmt Wissen anzueignen, margi-
nalisierte Themen zu behandeln, den eigenen Horizont zu erweitern und alternative Lernfor-
men auszuprobieren. Unterstützt werden solche weiterführenden Lernformen nicht nur durch
studentische Gremien, wie dem Fachschaftsrat oder dem Studierendenrat, sondern oft auch
durch das Institut oder die jeweiligen Lehrstühle. Mitarbeiter_innen oder Dozierende des Insti-
tuts haben oft gute Informationen über und Kontakte zu anderen Wissenschaftler_innen, die
bei der Organisation hilfreich sein können. Bei spezifischen Themen kann man auch mit ande-
ren studentischen Gruppen, dem Studentenwerk, verschiedenen Bereichen der Stadtverwal-
tung oder anderen städtischen Vereinen und Organisationen zusammenarbeiten. Die Organi-
sation und Durchführung muss keinesfalls auf die Uni und die Studierenden begrenzt sein.
Meist ist es gerade höchst interessant auch andere Blickwinkel mit einzubinden.
Vortragsreihen laufen in der Regel verteilt über ein Semester und können aus verschie-
densten Elementen zusammengesetzt sein. Meist sind die Veranstaltungen als Vorlesungen
organisiert, d.h. man lädt zu einem spezifischen Thema eine/einen Referent_in ein und im An-
schluss an den Vortrag kann mit ihm/ihr darüber diskutiert werden. Die Referent_innen müs-
sen aber nicht nur Wissenschaftler_innen sein, oft ist es spannend gewisse Interessengruppen,
Politiker_innen, Journalist_inen oder Vertreter_innen von Organisationen einzuladen. Die
thematische Einleitung und die Grundlage der Diskussion kann jedoch auch als Film, Schau-
spiel, Foto- oder Diashow etc. gestaltet sein. Man kann die Veranstaltung auch gleich als Podi-
umsdiskussion zweier Konfliktparteien oder gegenüberstehender Gruppen konzipieren. Der
Phantasie sind hier kaum Grenzen gesetzt. Besonders die Möglichkeit (bekannte) Wissen-
schaftler_innen einzuladen und kennenzulernen, sowie die Chance, Akteure des Alltags zu
Wort kommen zu lassen, sind für eine Vortragsreihe gewinnbringend.
Vortragsreihen ähneln in der Regel herkömmlichen Veranstaltungen. Dagegen bieten auto-
nome Seminare die Möglichkeit, herkömmliche Lernmethoden durch Alternativen zu ersetzen.
Dabei ist es wichtig vorab genau darüber zu reflektieren, was einem an der konventionellen
Vorgehensweise nicht gefällt bzw. wo sie Ungleichheiten schafft. Autonom werden diese Se-
minare deshalb genannt, weil sie möglichst unabhängig von Dozierenden, durch Studierende
für Studierende organisiert und veranstaltet werden. Komplett unabhängig kann man nur au-
ßerhalb der Universität lernen. Wenn man autonome Seminare in den regulären Lehrbetrieb
45
einbinden möchte, um beispielsweise Prüfungen ablegen und ECTS erwerben zu können, be-
nötigt man einen Dozierenden, der das Seminar und die Prüfungen rechtlich gegenüber dem
Prüfungsamt absichert und eine_n Professor_in der die Schirmherrschaft für das Seminar
übernimmt. Dies hindert die autonomen Studierenden jedoch nicht daran, das Seminar ohne
Dozierenden zu gestalten. Solche Seminare sind meist für jede_n offen. Ziel ist es vor allem
einen hierarchiefreien, herrschaftsfreien und basisdemokratischen Raum zum Lernen zu schaf-
fen, der es ermöglicht, die eigenen Fähigkeiten frei entfalten zu können. Dies soll sich auch im
Charakter des Seminars niederschlagen, potentiell Teilnehmende sollen sich darüber verstän-
digen, was, in welcher Weise in der Veranstaltung behandelt werden soll. Vor Beginn des Se-
minars werden deshalb Vortreffen benötigt, die dazu dienen, über den Charakter der Veran-
staltung zu entscheiden und somit darüber, wie ein Raum alternativen Lernens und Lehrens
gestaltet werden kann. Solch ein Entscheidungsprozess bedarf viel Zeit und Geduld, d.h. ein
hohes Eigeninteresse, kollektives Engagement und viel Idealismus sind eine wichtige Voraus-
setzung für das Gelingen. Durch einen hohen Grad an Eigenreflexion, sollen die Ziele und Vor-
gehensweisen regelmäßig diskutiert werden, besonders dann, wenn etwas nicht so läuft, wie
ihr es euch gedacht habt. Der Lesezirkel, also die gemeinsame Lektüre eines bestimmten Bu-
ches oder Autors, stellt eine der meist praktizierten Möglichkeiten dar.
Die Entstehung und der Verlauf selbst organisierter Veranstaltungen sind meist besonders
vielfältig und offen. Einige entstehen schleppend oder zerbrechen schnell wieder, andere sind
eher dynamisch und richten sich immer wieder auf andere Themen und Arbeitsweisen aus.
Projekte, die über mehrere Semester gehen, haben meist ständig wechselnde Teilnehmer. Am
Ende eines solchen (Selbstbildungs-)Prozesses stehen dann vielleicht nicht nur eine neue Er-
fahrung und neues Wissen, sondern auch neue liebgewonnenen Freunde.
Beide Alternativen lassen sich jedoch nicht ohne etwas Aufwand betreiben. Schließlich
muss auch die Infrastruktur, also die Räume und die Technik organisiert, die Referent_innen
eingeladen, deren Unterbringung geregelt, in die Veranstaltungen eingeführt, die Refe-
rent_innen vorgestellt und die Werbetrommel angeworfen werden. Am einfachsten und aus-
gewogensten lassen sich Vortragsreihen und autonome Seminare deshalb in einer Gruppe or-
ganisieren. Dann kann nicht nur die Arbeit auf viele Schultern verteilt werden, sondern durch
eine vorherige Diskussion, über den Inhalt und den Verlauf der Veranstaltung, sichergestellt
werden, dass diese nicht zu einseitig ausgerichtet ist.
Legt los, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert! Die Mühe lohnt sich!
46
V. Wozu Soziologie?
1. „Und was macht man dann damit?“
Von Katrin Schwarz
Für Soziolog_innen bieten sich nach ihrem Studium verschiedene und vielfältige Möglich-
keiten, beruflich tätig zu werden. Das ist zum einen ein Vorteil, da für jede_n etwas dabei ist.
Andererseits überfordern die vielen Möglichkeiten auch schnell und es fällt immer schwerer
jene Frage zu beantworten, die man so oft gestellt bekommt: Du studierst Soziologie? Und was
macht man dann damit?
Während meines Studiums der Soziologie hat sich für mich relativ schnell herausgestellt,
dass ich eher im Bereich der quantitativen Sozialforschung tätig werden möchte. Die angebo-
tenen Seminare zu Statistik und Methodenlehre haben mich sehr begeistert. Für mich ist es
einfacher auf Grund von Daten und Zahlen zu argumentieren, als auf rein theoretischer Basis.
Befragungen durchführen, Daten erheben und auswerten und daraus analytische Schlüsse zie-
hen, stellt die Grundlage meiner beruflichen Zukunft. Ich sehe die quantitative Empirie als et-
was Handfestes an, das mir klare Antworten gibt und auch sofort Entwicklungen erkennen
lässt.
In den Lehrveranstaltungen zur empirischen Sozialforschung werden einem die nötigen
Grundlagen, die man später für sein Berufsziel braucht, vermittelt. Hier erlernt man zum Bei-
spiel Methodenkenntnisse, insbesondere quantitative Forschungsmethoden, sowie Kenntnisse
im Umgang mit Auswertungs- und Analysesoftware (z.B. SPSS, SAP, STATA). Diese Grundlagen
sind zwar extrem wichtig, jedoch sollte man neben Pflichtveranstaltungen auch weiterführen-
de Seminare und Übungen zu Statistik oder Datenanalyse besuchen, um sich möglichst viele
Kenntnisse im Bereich der empirischen Sozialforschung anzueignen. Es ist auch empfehlens-
wert als Tutor_in oder studentische Hilfskraft zu arbeiten, um seine gewonnenen Kenntnisse
anzuwenden und zu vertiefen. Außerdem kann man so einen guten Kontakt zum/zur Do-
zent_in aufbauen, was sehr nützlich sein kann und einen eventuell später von Konkurrenten im
Kampf um eine Stelle abhebt. Verschiedene Praktika erhöhen ebenfalls die Chancen nach dei-
nem Studium gut ins Berufsleben zu starten. Was man auf jeden Fall in der empirischen Sozial-
forschung beachten muss, ist, dass Übung und somit Erfahrung den Meister macht. Es ist wich-
tig sich ausgiebig und regelmäßig damit zu beschäftigen, um erstens routinierter mit Fragestel-
lungen umgehen zu können und zweitens nicht alles Erlernte gleich wieder zu vergessen.
47
Für den Fall, dass man sich während des Studiums auf quantitative Sozialforschung speziali-
siert, bieten sich verschiedene berufliche Perspektiven an. Ich möchte hier nur ein paar Bei-
spiele geben: In Marktforschungsinstituten oder Marketingagenturen werden häufig
Soziolog_innen gesucht, die quantitative Methoden beherrschen. In diesen Unternehmen be-
treibt man Marktforschung oder beschäftigt sich mit Arbeits- oder Qualitätsmanagement.
Auch Personal- und Unternehmensberatung oder Marketing können in den Arbeitsbereich
fallen.
Zu diesen Instituten zählen zum Beispiel auch das Statistische Bundesamt oder die statisti-
schen Ämter der einzelnen Bundesländer. Das Forschungsdatenzentrum SOEP (sozio-
oekonomisches Panel) ist auch ein bekannter Vertreter der statistischen Institute in Deutsch-
land. Auch auf europäischer Ebene gibt es ein statisches Amt, das EuroStat, welches sich z.B.
mit Wirtschafts- und Finanzfragen beschäftigt oder auch mit Beschäftigungs- und Sozialpolitik.
Neben Statistik, Markt- und Meinungsforschung gibt es aber auch die Möglichkeit in Be-
triebe der freien Wirtschaft zu gehen, um dort für Firmen Daten zu erheben, die sie für die
Weiterentwicklung und Verbesserung ihrer Produkte benötigen. In der Privatwirtschaft ist es
wichtig zu wissen, wie der/die Kund_in denkt oder welches Produkt benötigt wird. Diese Fra-
gen können mit Hilfe der Methoden der empirischen Sozialwissenschaften beantwortet wer-
den. Auch in der Stadtentwicklung und -planung werden Soziolog_innen tätig, indem sie z.B.
Daten erheben zu Bevölkerungsdichte, Wohnraum, Wohnzufriedenheit und Bevölkerungsver-
teilung. Es ist wichtig für die Stadtplanung einschätzen zu können, wer, wo in der Stadt wohnt,
um z.B. soziale Brennpunkte zu verhindern oder die Infrastruktur der Stadt zu verbessern.
Ein weiterer Arbeitgeber für Soziolog_innen mit dem Schwerpunkt empirische Sozialfor-
schung sind Bildungseinrichtungen, wie die Universität oder Forschungsinstitute. An diesen
hat man zum einen die Möglichkeit zu promovieren und zum anderen kann man neben der
Forschung auch lehren. Wer eine akademische Karriere anstrebt profitiert definitiv davon,
wenn er als Hiwi oder Tutor_in bereits Erfahrungen mit der akademischen Arbeitswelt ge-
macht hat.
In sozialwissenschaftlichen Forschungsinstituten begleitet man eher Forschungsprojekte.
Diese können sich zum Beispiel mit demografischem Wandel, Konsumverhalten oder Migration
und Integration beschäftigen. Auch Universitäten bieten viele Möglichkeiten zur Forschung. Da
es so viele verschiedene Forschungsschwerpunkte gibt, ist es hier nicht möglich diese zusam-
menzufassen. Am besten schaut man sich die Stellenausschreibungen auf den jeweiligen Inter-
netseiten an, um auf dem neusten Stand zu bleiben.
48
Als empirische_r Sozialforscher_in ist es auch möglich, mit Parteien oder Gewerkschaften
zusammenzuarbeiten. Im Wahlkampf ist es für Politiker_innen besonders wichtig, einen Ein-
druck von der vorherrschenden Meinung zu haben, weshalb oft auf Meinungsumfragen zu-
rückgegriffen wird.
Bei den vielen beruflichen Perspektiven, die sich bieten, wenn man sich für quantitative
Methoden in der Soziologie entschieden hat, darf man aber nicht vergessen, dass sich die Ana-
lysesoftware ständig weiterentwickelt. Man muss also auch hier stets auf dem neusten Stand
sein.
2. Erst die Party, dann das Semester!
Von Katharina Block
Als ich mein Studium begonnen habe, war ich mir noch gar nicht im Klaren darüber, was ich
später eigentlich damit machen will. Über meine beruflichen Perspektiven, die sich mir mit
einem Soziologiestudium eröffnen werden, habe ich mir im Grunde ziemlich spät Gedanken
gemacht. Damals stand natürlich das Genießen des Studierendenlebens im Vordergrund, wes-
halb bei uns ein beliebtes Motto war: Erst die Party, dann das Semester!
Dabei ist es gerade bei einem Soziologiestudium sehr wichtig, dass man sich schon vor dem
Beginn des Studiums über die beruflichen Möglichkeiten im Klaren ist oder sich zumindest gut
informiert. Es wird zwar oft behauptet, mit Soziologie kann man praktisch in jeden Bereich,
aber ganz so einfach ist es dann doch nicht.
Das Fach Soziologie gehört zu den Geistes- und Sozialwissenschaften und ist somit ein so
genannter Bildungsstudiengang, d. h. es werden überwiegend theoretische Kenntnisse vermit-
telt. Praktische Fähigkeiten muss man sich selbst neben dem Studium durch Praktika oder ähn-
liches aneignen. Zwar gibt es an den meisten Unis ein obligatorisches Pflichtpraktikum, das
man als Teil des Studiums absolvieren muss, als ausreichende Aneignung praktischer Kenntnis-
se bei späteren Bewerbungen reicht dieses jedoch nicht aus. Zu jedem Soziologiestudium ge-
hören außerdem auch Seminare zu Statistik und zu Empirischen Methoden der Sozialfor-
schung. Aber auch hier muss man sich im Klaren darüber sein, dass in diesen Seminaren über-
wiegend theoretisches Wissen für eine zukünftige praktische Anwendung vermittelt wird. Die-
ses ist jedoch wichtig, wenn man z.B. später beruflich empirische Forschung betreiben will.
Vor Beginn des Studiums sollte man also schon mal eine Ahnung haben, in welchem Bereich
man später arbeiten möchte. Ein typischer beruflicher Werdegang mit Soziologie, für den ich
mich schließlich selbst entschieden habe, ist an der Uni zu bleiben und dort in der Forschung
49
und Lehre zu arbeiten, d.h. aber auch, dass man sozusagen immer weiter studiert, quasi eine
Art „ewige_r Student_in“ bleibt.
Nach dem Master-Abschluss muss man auf jeden Fall den Doktortitel erwerben, will man
eine akademische Laufbahn an der Uni einschlagen. Hierfür gibt es verschiedene Wege der
Umsetzung bzw. Finanzierung der Promotion.
Jede_r kann natürlich ein Dissertationsthema ausarbeiten und seinen Professor oder seine
Professorin fragen, ob er oder sie die Betreuung der Arbeit übernehmen würde. Dieser Weg
des Promovierens nennt sich dann Individualpromotion, da man nicht in ein Doktorand_innen-
Programm eingebunden ist oder eine Stelle als wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in hat, bei der
die Uni einem, neben der eigentlichen Arbeit, die Möglichkeit zur Promotion gibt. Eine Indivi-
dualpromotion muss in den häufigsten Fällen selbst finanziert werden. Es sei denn, man be-
kommt ein Stiftungsstipendium. Stipendien von Stiftungen sind jedoch rar und von daher auch
schwer zu bekommen. Über die Voraussetzungen, die man für eine Bewerbung erfüllen muss,
kann man sich aber ganz leicht im Internet informieren, meistens auf den Seiten der Stiftungen
selbst. Auch die Doktorand_innen-Programme der Unis und die Ausschreibungen für wissen-
schaftliche Mitarbeit sind sehr attraktiv, was aber dazu führt, dass es beispielsweise für sieben
ausgeschriebene Stipendien bzw. zwei wissenschaftliche Mitarbeiter_innenstellen 100 Bewer-
ber gibt, von denen alle exzellente Leistungen vorzuweisen haben. In dem Fall also, dass man
sich für ein Stipendium bewerben, aber auch, wenn man sich für eine Stelle als wissenschaftli-
cher Mitarbeiter_in bewerben will, sollte man eine relativ lange Liste an Zusatzaktivitäten und
damit Zusatzqualifikationen, die man neben dem Studium erworben hat, vorweisen können.
Hierfür bieten sich hervorragend Tätigkeiten, die man in der Uni als Student_in nebenbei ma-
chen kann, an. So gibt es z.B. die Möglichkeit als studentische Hilfskraft zu arbeiten oder Tuto-
rien zu übernehmen, was nicht nur die Kompetenzen erweitert, sondern auch noch ganz ne-
benbei den Kontakt zu dem/der Professor_in enger werden lässt. Die enge Anbindung an einen
Lehrstuhl ist für spätere Promotionsmöglichkeiten sehr wichtig, zumal man z.B. für eine
Stipendiumsbewerbung auch Empfehlungsschreiben von einem oder zwei innen braucht. Aber
nicht nur das, grundsätzlich gilt: Will man später an der Uni bleiben, sollte bzw. muss man ge-
kannt werden. Das sogenannte „Vitamin B“(-eziehung) ist existentieller Bestandteil für eine
Universitätskarriere. Ich selbst arbeite neben dem Studium auch als wissenschaftliche Hilfs-
kraft und merke immer wieder, wie wichtig der enge Kontakt zum Lehrstuhl ist.
Hervorragende Leistungen sollte man aber trotzdem noch erbringen, denn schließlich will
man ja auch sehr gute Wissenschaft betreiben. Sehr wichtig in einem geisteswissenschaftli-
chen Fach wie Soziologie ist außerdem viel zu schreiben. Je mehr man schreibt, desto besser
50
wird auch die Qualität der Schriften bzw. Essays oder Hausarbeiten. Zu einer Unikarriere ge-
hört auch das Veröffentlichen von Texten, welche schon einen gewissen qualitativen Anspruch
erfüllen müssen. Oft wird der Erfolg eines Hochschulmitarbeiters an der Zahl seiner Veröffent-
lichungen gemessen. Nichtsdestotrotz ist eine Karriere als Soziologe_in an der Uni natürlich
prestigeträchtig, dementsprechend aber eben auch ein aufwendiger Weg. Man muss dazu be-
reit sein, die meiste Zeit in seinem Leben Bücher zu wälzen und überwiegend theoretisch zu
arbeiten. Klar gibt es die Empirische Sozialforschung, in der man auch ins Feld „Gesellschaft“
geht und Umfragen, Interviews etc. macht, aber auch hier bedeutet der größte Teil der Arbeit
z.B. Fragebögen zu konzipieren oder Analysen am Computer zu machen. Für Menschen, die
einen großen praktischen Bezug brauchen, ist die Unikarriere von daher eher nicht geeignet.
Zum Glück gibt es aber ja auch noch andere Bereiche, in die man als Soziologe_in gehen
kann. Durchaus üblich ist es mit einem Soziologiestudium in NGOs tätig zu werden. Oder man
kann, wenn man sich für Entwicklungshilfe und ähnliche internationale Hilfsprojektarbeit inte-
ressiert, in vom Bund finanzierten Organisationen, wie dem Deutsche Entwicklungsdienst oder
die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, tätig werden.
Viele Soziolog_innen gehen aber auch in die Sozial- und Marktforschung oder andere For-
schungsinstitute. Beliebt sind auch Stellen im PR-Bereich (Journalismus und Öffentlichkeits-
arbeit), bei Parteien oder Gewerkschaften, im Personalwesen, in Personal- und Organisati-
onsentwicklung, in Qualitäts- oder Projektmanagement, in Weiterbildung und Beratung oder
bei Verwaltungen und Stiftungen. Man sieht also, es gibt noch einige andere Möglichkeiten.
Was man hier aber eben nicht vergessen darf, ist, dass Soziologie ein Bildungsstudium ist
und man nach seinem Abschluss noch keine Berufserfahrung vorweisen kann. Auch deswegen
ist es so wichtig, dass man sich möglichst früh für das spätere Berufsfeld entscheidet. Je frü-
her die Entscheidung, desto mehr Zeit, durch Praktika in dem entsprechenden Bereich, mög-
lichst viel praktische Erfahrungen zu sammeln. Gerade im Bereich der NGOs oder der Hilfspro-
jektarbeit sind praktische Erfahrungen, die man durch Praktika in solchen Organisationen er-
worben hat, unerlässlich. Hat man schon eine Tätigkeit im Blick, die man sich für die Zeit nach
dem Soziologiestudium vorstellt, sollte man auch schon die Seminare im Studium thematisch
passend aussuchen. Außerdem kann man sich weiterhin einmal darüber informieren, was für
Ansprüche in welchen Berufen üblicherweise gestellt werden, damit man eine Vorstellung da-
von bekommt, welche praktischen Erfahrungen man mitbringen sollte und Praktika oder ähnli-
ches dementsprechend planen kann. Diese Informationen bekommt man am besten heraus,
wenn man sich einmal Stellenausschreibungen für das berufliche Feld, das einen interessiert,
anschaut. Hier kann man mittels des Profils, welches die Bewerber haben sollten, einen schnel-
51
len und einfachen Überblick über praktische Erfahrungen oder sonstige Talente, die man mit-
bringen soll, gewinnen.
Das Studium der Soziologie öffnet zwar nicht sämtliche Türen, aber ebnet auch nicht nur
den Weg der Unikarriere. Will man das angeeignete Wissen über die Gesellschaft mit mehr
praktischem Bezug, als an der Uni üblich, anwenden, finden sich in jedem Fall genügend Mög-
lichkeiten, dies auch zu tun. Man sollte sich bloß früh darüber im Klaren sein, was man will,
damit man gezielt darauf hin arbeiten kann. Dafür muss es dann auch öfter mal heißen: Erst
das Semester, dann die Party!
52
VI LINKS
Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) solziologie.de
Soziologie studieren soziologiestudium.info
Berufsverbandes Deutscher Soziologinnen und Soziologen e. V. (BDS) bds-soz.de
Studentisches Soziologie-Magazin soziologiemagazin.de
Studentischer Soziologiekongress soziologiekongress.de
European Sociological Association (ESA) europeansociology.org
International Sociological Association (ISA) isa-sociology.org
Arbeitsgemeinschaft Sozialwissenschaftlicher Institute e.V. (ASI) asi-ev.org
VII Einführungsliteratur
Bahrdt, Hans Paul (2003): Schlüsselbegriffe der Soziologie: eine Einführung mit Lehrbeispie-
len. 9. Aufl.. München: Beck.
Beger, Wolfram (Hrsg.) (2007): Was werden mit Soziologie: Berufe für Soziologinnen und So-
ziologen. Stuttgart: Lucius & Lucius
Jäckle, Michael (2010): Soziologie: Eine Orientierung. Wiesbaden: VS .
Joas, Hans (Hrsg.) (2007): Lehrbuch der Soziologie. 3. Auflage. Frankfurt a.M.: Campus.
Kneer, Georg/ Schroer, Markus (Hrsg.) (2010): Handbuch Spezielle Soziologien. Wiesbaden: VS.
Korte, Hermann (2010): Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie. 8. Aufl.. Wiesbaden : VS.
Meulemann, Heiner (2006): Soziologie von Anfang an: eine Einführung in Themen, Ergebnisse
und Literatur.2. Aufl.. Wiesbaden: VS.
Nassehi, Armin (2008): Soziologie: zehn einführende Vorlesungen. Wiesbaden : VS.
- (2010): Mit dem Taxi durch die Gesellschaft : soziologische Stories. Hamburg: Murmann.
Schimank, Uwe/ Schöneck, Nadine M. (Hrsg.) (2008): Gesellschaft begreifen: Einladung zur So-
ziologie. Frankfurt am Main [u.a.]: Campus.
Späte, Katrin (Hrsg.) (2007): Beruf: Soziologie?! – Studieren für die Praxis. Konstanz: UTB
Wagner, Gerhard (2008): Paulette am Strand. Roman zur Einführung in die Soziologie.
Weilerswirst: Velbrück.