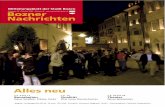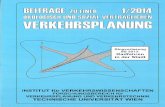SEP Borken_Projektbericht - Stadt Borken
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of SEP Borken_Projektbericht - Stadt Borken
Sportentwicklungsplanung der Stadt Borken - Projektbericht -
FUHRMANN, H. | RITTNER, V. | FÖRG, R.
UNTER MITARBEIT VON
ERDELT, F. | SCHATZ, R.
Köln, 2012
Inhalt | 1
Inhalt
1 Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel ................................................... 5 1.1 Problembezug ............................................................................................... 5 1.2 Die Notwendigkeit systematischer Daten ........................................................... 8 1.3 Auf dem Weg zu einer neuen kommunalen Politikfähigkeit der Sportakteure ......... 10
1.3.1 Von der Planung zur Steuerung ............................................................... 10 1.3.2 Intersektorales Politikverständnis als Steuerungsansatz .............................. 12 1.3.3 Heterogene Akteurs-Netzwerke als Schlüssel der kommunalen Sportplanung ... 13 1.3.4 Dialogisches Verfahren ........................................................................... 14
1.4 Prozess und Verfahren .................................................................................. 15
2 Erläuterungen zu den Untersuchungsergebnissen ................................................ 18
3 Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken ...................................................................................................................... 19
3.1 Ablauf/Vorgehen ......................................................................................... 19 3.1.1 Stichprobe ........................................................................................... 19 3.1.2 Rücklauf .............................................................................................. 20 3.1.3 Qualität der Stichprobe .......................................................................... 21
3.2 Sportengagement ........................................................................................ 26 3.2.1 Sportaktivität und Geschlecht ................................................................. 28 3.2.2 Sportaktivität und Alter ......................................................................... 29 3.2.3 Sportaktivität nach Stadtteilen ............................................................... 30 3.2.4 Sportaktivität und Bildungsabschluss ....................................................... 31 3.2.5 Gründe zum Sportreiben ......................................................................... 33 3.2.6 Gründe, nicht Sport zu treiben ................................................................ 36
3.3 Ausgeübte Sportarten ................................................................................... 38 3.3.1 Ausgeübte Sportarten nach Geschlecht ..................................................... 41 3.3.2 Ausgeübte Sportarten nach Alter ............................................................. 42 3.3.3 Ausgeübte Sportarten nach Stadtteil ........................................................ 45
3.4 Häufigkeit und Intensität der Sportausübung .................................................. 48 3.4.1 Häufigkeit und Intensität nach Geschlecht ............................................... 50 3.4.2 Häufigkeit und Intensität nach Alter ........................................................ 51 3.4.3 Häufigkeit und Intensität nach Stadtteil .................................................. 52
3.6 Organisationsform der Sportausübung ............................................................. 53 3.6.1 Organisationsformen differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart .......... 54 3.6.2 Organisationsform nach Geschlecht .......................................................... 55 3.6.3 Organisationsform nach Alter .................................................................. 55 3.6.4 Organisationsform nach Stadtteil ............................................................. 57
3.7 Zeitliche Verteilung der Sportaktivität auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen ................................................................................... 59
Inhalt | 2
3.7.1 Verteilung der gesamten Sportaktivität nach Geschlecht ............................. 60 3.7.2 Verteilung der gesamten Sportaktivität nach Alter ..................................... 60 3.7.3 Verteilung der gesamten Sportaktivität nach Stadtteil ................................ 61
3.8 Breiten-, Leistungs-/Wettkampf- oder Hochleistungssport ................................. 62 3.9 Orte der Sportausübung ................................................................................ 64
3.9.1 Sportanlagen differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart .................... 67 3.9.2 Nutzung von Grünanlagen, Parks und Wäldern ........................................... 69
3.9.2.1 Nutzungsverhalten .......................................................................... 69 3.9.2.2 Bewertung der Grünanlagen, Parks und Wälder .................................... 71
3.9.3 Nutzung städtischer Turn- und Sporthallen ............................................... 74 3.9.3.1 Nutzungsverhalten .......................................................................... 74 3.9.3.2 Bewertung städtischer Sport- und Turnhallen ...................................... 75
3.10 Wichtigkeit von Rahmenbedingungen der Sportausübung .................................. 82 3.10.1 Sportanbieter ....................................................................................... 82 3.10.2 Sportanlagen ........................................................................................ 84
3.11 Wünsche und Bedarfe ................................................................................... 86 3.11.1 Bewertung der Angebotssituation ............................................................ 86 3.11.2 Fehlende Angebote und Möglichkeiten im Stadtteil .................................... 88 3.11.3 Wünsche nach neuen bzw. weiteren Sportangeboten und -stätten ............... 90
3.12 Sport und Sportförderung in Borken ............................................................... 91 3.12.1 Zustimmung zu Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken .......... 91 3.12.2 Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Maßnahmen zur Förderung von Sport und Bewegung in Borken .................................................................................. 93
3.13 Sportveranstaltungen und ihr Stellenwert in Borken ......................................... 95 3.14 Sportliches Engagement der 3 bis 13-Jährigen ................................................. 96
3.14.1 Darstellung der Stichprobe ..................................................................... 96 3.14.2 Sportaktivität der 3 bis 13-Jährigen ......................................................... 97 3.14.3 Ausgeübte Sportarten der 3 bis 13-Jährigen .............................................. 99 3.14.4 Häufigkeit und Intensität der Sportausübung .......................................... 101 3.14.5 Organisationsform der Sportausübung der 3 bis 13-Jährigen ...................... 101 3.14.6 Orte der Sportausübung der 3 bis 13-Jährigen ......................................... 103
4 Sportanbieter in Borken .................................................................................. 105 4.1 Sportvereine in Borken ............................................................................... 106 4.2 Weitere Sportanbieter in Borken .................................................................. 108 4.3 Vereinsbefragung ....................................................................................... 110
4.3.1 Überblick zu den antwortenden Vereinen ................................................ 110 4.3.2 Zwecke und Zielstellungen der Vereine ................................................... 111 4.3.3 Problemstellungen der Vereine .............................................................. 113 4.3.4 Mögliche Maßnahmen der Vereine .......................................................... 115 4.3.5 Finanzielle Rahmenbedingungen ........................................................... 117 4.3.6 Sportanlagen ...................................................................................... 120
Inhalt | 3
4.3.7 Sportverwaltung und -politik ................................................................ 130 4.3.8 Netzwerkstrukturen und -bedarfe ........................................................... 134
4.3.8.1 Quantität und Intensität der Vernetzung der Sportvereine mit anderen Organisationen in Borken ............................................................... 134
4.3.8.2 Gewünschte Vernetzung der Sportvereine mit anderen Organisationen in Borken ........................................................................................ 135
4.3.9 Kommentare der Vereine zu Sportverwaltung und Sportpolitik .................... 136 4.4 Empfehlungen für die Vereine in Borken ....................................................... 138
5 KiTa und Schule ............................................................................................. 140 5.1 Ergebnisse der KiTa-Befragung .................................................................... 140
5.1.1 Räume für Sport und Bewegung ............................................................. 140 5.1.2 Bewegungsförderung ........................................................................... 141 5.1.3 Kooperationen mit Sportvereinen .......................................................... 152 5.1.4 Sonstige Anmerkungen der KiTas ........................................................... 156
5.2 Befragung der Schulsportbeauftragten .......................................................... 157 5.2.1 Sportstätten aus der Sicht der Schulen ................................................... 157 5.2.2 Probleme zur Erfüllung des Stundensolls im Sportunterricht ....................... 160 5.2.3 Kooperationen .................................................................................... 162
5.3 Offener Ganztag ........................................................................................ 166 5.4 Kinder- und Jugendgesundheit .................................................................... 169
6 Sportstätten .................................................................................................. 171 6.1 Allgemeine Entwicklungen und Bedarfe ......................................................... 171 6.2 Allgemeine Kennzeichen der Sportstättensituation ......................................... 172 6.3 Demographischer Wandel in Borken .............................................................. 173 6.4 Turn- und Sporthallen ................................................................................ 175
6.4.1 Überblick Turn- und Sporthallen ............................................................ 175 6.4.2 Zustand ............................................................................................. 177 6.4.3 Nutzung und Auslastung ...................................................................... 177
6.5 Sportanlagen / Fußballplätze ...................................................................... 182 6.5.1 Überblick Spielfelder ............................................................................ 182 6.5.2 Nutzungssituation ............................................................................... 183
6.6 Kunststoffrasendiskussion ........................................................................... 187 6.6.1 Tennenflächen: ................................................................................... 187 6.6.2 Kunststoffrasen ................................................................................... 187 6.6.3 Belastbarkeit von Sportrasen ................................................................ 188 6.6.4 Kosten-Analyse ................................................................................... 189
6.6.4.1 Herstellungskosten ........................................................................ 189 6.6.4.2 Pflegekosten pro Jahr .................................................................... 189 6.6.4.3 Investitionskosten pro Jahr und Nutzungsstunde (über 20 Jahre) ........ 189
6.6.5 Fazit ................................................................................................. 190
Inhalt | 4
6.7 Bewertung von Vereinsanträgen im Bereich Sportstätten ................................. 191
7 Sportgelegenheiten in Borken ......................................................................... 197 7.1 Nutzung und Bewertung von Grünanlagen, Parks und Wäldern .......................... 197 7.2 Nutzungsverhalten ..................................................................................... 197 7.3 Allgemeine Bewertung der Grünanlagen, Parks und Wälder ............................... 199 7.4 Nutzerbewertungen und Ergebnisse der Begehung .......................................... 200
7.4.1 Pröbsting ........................................................................................... 202 7.4.2 Ehemaliges Bundeswehrgelände (Fliegerberg) .......................................... 203 7.4.3 Sternbusch ......................................................................................... 205 7.4.4 Stadtpark ........................................................................................... 207 7.4.5 Galgenberg ......................................................................................... 208 7.4.6 Klosterbusch ...................................................................................... 210
7.5 Gesamteindruck der Sportgelegenheiten ........................................................ 211
8 Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken .................................. 212 8.1 Einführung ............................................................................................... 212 8.2 TeilnehmerInnen der Lenkungsgruppe Sportentwicklung Borken ....................... 213 8.3 Handlungsempfehlungen (verabschiedet in der Sitzung der Lenkungsgruppe
Sportentwicklung Borken am 30.08.12) ........................................................ 214
9 Ausblick ........................................................................................................ 224
10 Literatur ........................................................................................................ 225
Tabellenverzeichnis ............................................................................................. 227
Abbildungsverzeichnis ......................................................................................... 230
Anhang ............................................................................................................... 234 Übersicht Sportanlagen in Borken ........................................................................ 234
Städtische Sport- und Turnhallen ..................................................................... 234 Städtische Sportplätze .................................................................................... 270 Sonstige Sportanlagen .................................................................................... 278
Mögliche Kriterien einer Bedarfsanalyse ................................................................ 281
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 5
1 Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel
1.1 Problembezug
Das Verhältnis zwischen Stadt und Sport ist einem turbulenten Wandel begriffen. Für die kommunale Sportpolitik ergeben sich damit viele neue Herausforderungen. Lange Zeit eher verwöhnt durch ein elementares und klar strukturiertes Medium, wird sie mit einem mittlerweile äußerst dynamischen Komplex von Sport, Alltagskultur, Körperbewusstsein und Lebensstil konfrontiert, der das Medium grundlegend verändert. Die Städte der Gegenwart, die ohnehin schon durch den beschleunigten sozialen Wandel und die Informations- und Zeichenflüsse der Globalisierung um eine neue Identität in Zeit und Raum sowie verschobenen Standortparametern ringen müssen, sehen sich auch mit einem „Neuen Sport“ konfrontiert. Auch er ist wie vieles im Zeitalter der Globalisierung vielfältiger, dynamischer, unberechenbarer geworden; er lässt sich nicht mehr mit leichter Hand verwalten oder dirigieren. Tatsächlich sind die Städte Schauplatz einer tiefgreifenden Individualisierung des Sportver-ständnisses. Die Inlineskater und jugendlichen Skateboardfahrer, die ihren Sport auf Gehwegen, Plätzen, Straßen, Treppen, Parkdecks, Wirtschaftswegen und Parks ausüben, sind ein Beispiel dafür, dass viele Sportarten der Gegenwart, speziell die Trendsportarten, völlig neue Raumansprüche stellen und damit eine eigenwillige, neue städtische "Raumpolitik" betreiben. Auf die Prozesse eines beschleunigten sozialen Wandels geht weiterhin zurück, dass die Sportvereine mit ständig neuen Bedürfnissen ihrer Mitglieder konfrontiert werden. Trotz bemerkenswerter Leistungen vieler Vereine stagnieren die Mitgliederzahlen des gemeinnützigen Sports. In den Ballungsgebieten hingegen steigt die Zahl der Mitgliedschaften der kommerziellen Sportanbieter kontinuierlich. Verloren gegangen ist das Deutungs- und Organisationsmonopol der Vereine und Verbände. Die kommunale Sportpolitik kann nicht mehr von den klassischen Raumbindungen des organisierten Sports ausgehen, die die Sportaktivitäten auf die traditionellen Sportstätten, die Sportplätze und Hallen fixierten. Unverzeihlich wäre es, würde sie an einem klassischen Verständnis vom Sport festhalten, das die Sportausübung weitgehend auf die Kinder- und Jugendlichen sowie leistungswilligen jungen Erwachsenen festlegte. Brüchig geworden ist das traditionelle Einverständnis der kommunalen Sportpolitik, dass die Belange des Sports in einer Stadt ausschließlich oder doch weitgehend durch die Sportvereine und -verbände festgelegt und geregelt werden. Die Städte müssen in neuen Politikkategorien denken; Sportentwicklung hat es zunehmend mit der demographischen Entwicklung zu tun; sie muss mit der Stadtplanung und -entwicklung, der Sozial- und Gesundheitspolitik wie auch der Bildungspolitik abgestimmt werden. Die sympathische Idee, dass der Sport nur eine schöne Nebensache sei, ist obsolet geworden. Eine aktive kommunale Sportpolitik muss weiterhin davon ausgehen, dass das Medium Sport bzw. Bewegung und körperliche Aktivität zu einem zentralen Bestandteil allgemeiner gesellschaftspolitischer Zielsetzungen geworden ist. Die Kommunen sind vor diesem Hintergrund die Arena, an denen sich die Hoffnungen und Perspektiven entsprechender
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 6
Zielsetzungen zu bewähren haben. Sie repräsentieren den Raum, in denen neue Experimente mit dem Medium geschehen. Man muss sich nur eine Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sichtbarkeit körperlicher Aktivität ansehen, um spontan zu erkennen, dass sie ein Labor bunter körperlicher Inszenierungen geworden ist. City-Marathonläufe gehören mittlerweile zur Tagesordnung. Mit ihnen ist der Körper wieder in die Stadtzentren eingezogen. Auch der Alltag in Grünflächen, Parks und auf Straßen liefert eindrucksvolle Beispiele für neue Beziehungen zwischen Sport und Stadtlandschaft. In dem großen Experiment Stadt und Sport, das neue kategoriale Anstrengungen erforderlich macht, finden sich darüber hinaus viele Binnen-Experimente mit unterschiedlicher Logik - in den sozialen Brennpunkten bei Projekten der Jugendsozialarbeit, bei den Nordic-Walking-Szenen gesundheitsbewusster Frauen unterschiedlichen Alters wie bei den Skatern der stadtkulturellen Jugendszenen. Die vielleicht größte Zumutung für die kommunale Sportpolitik besteht in der Notwendigkeit der Entwicklung eines erweiterten Politik- und Handlungs-Verständnisses. Wie kann man die gemeinnützigen Sportorganisationen mit den Ganztagsschulen zusammenbringen? Wie können die Ressourcen des Sports für die Gesundheitspolitik erschlossen werden? Wie können die Potentiale des Mediums im Bereich der Integration von Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund genutzt werden, also in dem delikaten Verhältnis zwischen Sport, Körper, Ethnie und Kultur? Dass der Sport nicht von vornherein völkerverständigend ist, weiß man von den Aggressionen auf den Fußballplätzen gerade der unteren Ligen. Andererseits sind seine Vorzüge hinsichtlich des Schaffens von Gelegenheiten und Kontakten zur Verständigung und Integration kaum zu überschätzen. Neuere Untersuchungen geben allerdings zu erkennen, dass für die Sicherstellung derartiger Funktionen spezifische Konzepte und ergänzende Strukturen zu entwickeln sind. Die Spannungen, die sich für die kommunale Sportpolitik ergeben, zeigen sich daran, dass damit sehr heterogene Handlungsbereiche und Traditionen sowie Kulturen aufeinander stoßen. Auf der einen Seite sind es die autonomen Freiwilligen-Assoziationen, die darauf spezialisiert sind, Clubgüter zu produzieren. Sie werden konfrontiert mit externen gesellschaftspolitischen Zielsetzungen und Projektionen. Natürlich ist es reizvoll, mit den Sportvereinen jenen Bereich zu mobilisieren, der als erfolgreichste Freiwilligenorganisation in Deutschland nach wie vor die meisten Gemeinschaftsaktivitäten und ehrenamtlichen Betätigungen gewährleistet. Zwischen der Eigenwilligkeit und Autonomie der Freiwilligenorganisation und den externen Zielsetzungen ergeben sich allerdings vielfältige Spannungen. Hier ist die Stadtpolitik in besonderer Weise gefordert, neue Lösungen zu entwickeln. Sie können nur durch das Lernen der Organisationen bewältigt werden. Wie aber lernen Freiwilligenorganisationen mit sehr beschränkten Ressourcen? Wie können sie besser zusammenarbeiten? Für die kommunale Sportpolitik ergeben sich Fragen und Problemstellungen, für die es keine Standardlösungen gibt. Auch kann man nicht auf bewährte Rezente der Vergangenheit zurückgreifen. Wenn die kommunale Sportpolitik ernst machen will mit den vielfältigen Zielsetzungen und Zuschreibungen, so kann sie ganz offensichtlich nicht umhin, ihre Leitbilder und Prämissen zu ändern. Eine kommunale Sportpolitik, welche die Möglichkeiten ihres Mediums systematisch erschließen und sichern will, ist genötigt, diese Umstände zu bedenken. Noch mehr: sie
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 7
muss den Sport neu denken und sich von den Gewohnheiten und Vertrautheiten der Vergangenheit befreien. Nach wie vor wird sie die Kooperation mit den Sportvereinen als unentbehrlichen Trägern des gemeinnützigen Sports suchen müssen. Aber sie kommt nicht umhin, eigene Konzepte der kommunalen Sportentwicklung zu entwerfen. Damit wird sie selbst anspruchsvoll und komplex. Tatsächlich ist eine kreative kommunale Sportpolitik nur unter der Bedingung zu haben, dass sie die völlig veränderten Parameter der zeitgenössischen Sportentwicklung fest ins Auge nimmt und in neuen Kategorien des politischen Handelns und der Steuerung der Abläufe denkt. Dafür allerdings braucht man entsprechende Daten und ein geeignetes Handwerkzeug bzw. entsprechende Instrumente. Der Grad der Herausforderung wird nicht zuletzt dann erkennbar, dass eine Planung nach dem „Goldenen Plan“ und den davon abgeleiteten moderneren Richtwertmethoden nicht mehr möglich ist. Diese fast legendären Planungsinstrumente, welche die Sportstätteninfrastruktur des deutschen Breitensportsystems ermöglichten, verdankten ihre Eleganz und (ehemalige) Stimmigkeit der Dominanz des Wettkampfsports. Mit den klaren und eindeutigen Strukturen des Wettkampfsports und unter der Regie der gemeinnützigen Sportvereine und –verbände kamen Kennzahlen und faktisches Sportverhalten in den Kommunen fast zur Deckung – gewissermaßen der Traum von Planern. In der Gegenwart sind Richtwerte allerdings nur noch sehr begrenzt aussagekräftig. Sie sind keine hinreichende Grundlage für Entscheidungen. Jede Stadt ist anders. Und jeder Stadtbezirk ist anders. Und die Gruppen und Bedürfnisse sind heterogen. Entsprechend variieren auch die Anforderungen an die Infrastruktur, die Angebote und die Politik. Eine kommunale Sportpolitik aus einem Guss ist nicht mehr möglich. Die „selbstaktiven Felder im Sport“, d.h. die spontanen Bewegungen, sind ein weiteres Beispiel für die Zwänge zu einem Umdenken der kommunalen Sportpolitik. Durch Verwalten kann man diesen Entwicklungen nicht gerecht werden. Sie erfordern ein aktives Handeln der Sportakteure. Erforderlich ist ein neuer Stil der Planung im Umgang mit den Bedürfnissen der unterschiedlichen Gruppen. Die Szenen und Milieus der Jugendkultur stellen andere Ansprüche, als die Gesundheitswünsche der „jungen Alten“. Auf die heterogenen Sozialräume einer Stadt bezogen sind Flexibilität, Reflexivität und Sensibilität erforderlich. Hinzu kommen die Anforderungen an Partizipation. Sportnächte mit Jugendlichen sind ein Beispiel. Sie erfordern Flexibilität hinsichtlich der Strukturen und der Gestaltung offener Veranstaltungen, die einen Event-Charakter beinhalten müssen. Sie erfordern Sensibilität gegenüber den Gruppen und Kulturen, die man gewinnen will. Und sie bedingen Reflexivität hinsichtlich der Zielsetzung, des Einsatzes der Mittel und der Gewinnung von Nachhaltigkeit. Damit die Ereignisse nicht singuläres Element bleiben, müssen sie in den Sozialräumen verankert sein. Sie müssen also im Sinne von Giddens sowohl Ereignis als auch Struktur sein. Der Unterschied zum klassischen Stil kommunaler Sportpolitik ist auch hier evident. Das Medium Sport muss systematisch erschlossen werden. Dies ist allerdings nur dann erfolgversprechend, wenn die Maßnahmen die Möglichkeiten des Mediums auf die Organisation, Strukturen und Kultur der Lebenswelt und Sozialräume differenziert abstimmen. Reines Verwaltungshandeln stößt hier schnell an seine Grenzen. Kommunale
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 8
Sportpolitik wird zu einem umweltsensiblen Verfahren genötigt: Die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen, die man mit dem Sport verbindet, haben nur dann eine Realisierungschance, wenn dieser Wandel im Verhältnis zwischen Sport und Stadt zu einem zentralen Merkmal der kommunalen Sportpolitik wird. Möglichkeiten des Sports und augenblickliche Grenzen der kommunalen Sportpolitik werden dann deutlich, wenn man sie mit avancierten Ideen der Stadttheorie konfrontiert. Ganz offensichtlich kann sich das Medium Sport in den von Kevin Lynch herausgestellten drei Funktionen einer idealen Stadt behaupten. Der Sport kann einen exzellenten Beitrag zur Funktion der Repräsentation beisteuern. In besonderer Weise ist er geeignet, Bühnen der Inszenierung der Identität einer Stadt zu erzeugen; er fungiert zunehmend als Reparaturwerkstatt im Bereich der Kosten des beschleunigten sozialen Wandels; und er kann mit seinen Bindungen auch Heimat erzeugen (vgl. Lynch, 1989; auch Sieverts, 1994).
1.2 Die Notwendigkeit systematischer Daten
In den meisten Kommunen fehlen systematische Daten, die eine planvolle und umsichtige Sportpolitik überhaupt erst ermöglichen; so fehlen Daten zur Veränderung der Sportbedürfnisse in ihren städtischen Bezügen bzw. hinsichtlich der städtischen Sportversorgung; es fehlen aber auch Daten zur Wahrnehmung der Leistungen der Sportorganisationen. Drei Entwicklungen, die einen besonderen gesellschaftspolitischen Rang reklamieren können bzw. kommunale Brisanz aufweisen, machen deutlich, dass das Verharren der kommunalen Sportpolitik in überkommenen Denkmustern und ihre Theorielosigkeit gegenwärtig fatale Auswirkungen haben.
1. Angesichts der zunehmenden Inkongruenz zwischen veränderten Sportbedürfnissen und Sportstätten bzw. Sportinfrastruktur stellt sich mit den „kritisch gewordenen (traditionellen) Sportstätten“ die Frage, wie eine zukunftsorientierte Sportinfrastruktur aussehen muss; d.h., es stellen sich Fragen nach einer neuen Passung zwischen Sportinfrastruktur und veränderten Sportbedürfnissen. Sollen vorhandene Anlagen renoviert, umgenutzt oder ersetzt werden? Müssen völlig neue Sportstätten gebaut werden? Dies ist angesichts der erforderlichen Investitionen ein volkswirtschaftlich bedeutsames Problem. Allein die Renovierung der überkommenen Infrastruktur würde nach vorsichtigen Schätzungen einen Milliardenaufwand von ca. 34 Mrd. Euro1 erforderlich machen (vgl. Jägemann, 2005). Das Geld ist schlicht nicht vorhanden. Aber selbst wenn dies finanziell darstellbar wäre, bliebe doch das tieferliegende Problem des Sinns einer solchen Maßnahme ungeklärt. Nagelneue Sportanlagen des alten Typs würden an den veränderten Sportbedürfnissen der Gegenwart völlig vorbeigehen. Die Wiederauferstehung der wettkampfbezogenen Anlagen im alten Gewand wäre Ergebnis von Fehlinvestitionen gigantischen
1 Abweichend zu seinen ersten Berechnung hat Hans Jägemann im Juni 2005 den Sanierungsbedarf für Hallen- und Freibäder um rund 8 Mrd. Euro nach unten korrigiert, so dass der prognostizierte Gesamtbedarf von ca. 42 Mrd. auf 34 Mrd. Euro gesunken ist.
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 9
Ausmaßes. Die Fragen gehen aber noch weiter. Was folgert für die Städte daraus, dass völlig neue Sporträume entstanden sind (vgl. Eulering, 2001; 2002; Schemel & Strasdas, 1998)? Wie müssen zukunftsorientierte Sportstätten dann aussehen (vgl. Rittner & Roth, 2004)? Dass es mittlerweile ganz andere Bevölkerungsgruppen sind, die Sport treiben? Wie ist der Umstand zu handhaben, dass die Sportgelegenheiten mittlerweile die meisten Sportaktivitäten in den Kommunen binden? Und weiter: sind die Sportvereine tatsächlich die Treuhänder der allgemeinen Sportentwicklung, so wie sie es behaupten? Wer vertritt die Interessen der selbstorganisierten Sportler? Was ist mit den kommerziellen Einrichtungen, die beträchtliche Marktanteile gewonnen haben?
2. Tatsächlich zeigen sich insbesondere in den Kommunen die Kosten des
beschleunigten sozialen Wandels in Form von zunehmenden Desintegrationsproblemen. Hier entsteht mit der Polarisierung in den Stadtbezirken, speziell in den „sozialen Brennpunkten“ in der Tat eine Neue Soziale Frage. Was hat es in dieser Situation mit den vielfach behaupteten Integrationsfunktionen des Sports auf sich? Zwar gibt es viele Projekte und Initiativen (vgl. Rittner & Breuer, 2000), aber bislang ist kein befriedigendes Konzept entwickelt worden, welches die Integrationspotenziale des Sports in einen systematischen Zusammenhang mit den Sozialräumen einer Stadt stellt. Es stellen sich weiterhin Fragen nach den tatsächlichen (nicht nur behaupteten) Integrationsleistungen des Sports sowohl (a) im Bereich der sozialen Integration als auch (b) im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung. Wo gibt es eine systematische Zusammenarbeit mit Jugendämtern und anderen Trägern der Jugendhilfe? Wo gibt es theoretisch reflektierte Modelle, die den Zusammenhang zu den Sozialräumen aufzeigen? Wo findet sich die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten, mit Gesundheitsämtern? Die aktuelle Auswertung der Daten im Rahmen des Sportentwicklungsberichts des Deutschen Sports (als Nachfolgeuntersuchung der Finanz- und Strukturanalyse des Deutschen Sports – FISAS), die auch das Thema der kommunalen Kooperation aufgriff, zeigt, dass die Sportvereine immer noch zu einem großen Teil in einem weitgehend geschlossenen Handlungsraum verharren. Wenn überhaupt, dann kooperieren sie primär mit ihresgleichen, d.h. anderen Sportorganisationen, im Weiteren noch, unter Gesichtspunkten der Talentsichtung, mit den Schulen. Dann klafft eine große Lücke. Die Zusammenarbeit beispielsweise mit Jugendämtern, anderen Einrichtungen der Jugendhilfe sowie Krankenkassen und Gesundheitsämtern, also wichtigen Schaltstellen kommunaler Integration, erscheint am Rande (vgl. Rittner & Keiner, 2006).
3. Eine Herausforderung besonderer Art sowohl in inhaltlicher als auch
organisatorischer Hinsicht stellt weiterhin die Einführung der (offenen) Ganztagsschule dar. Immerhin wird zum ersten Mal in der Nachkriegsgeschichte des Sports ein System des staatlichen Nachmittags-Sports für Kinder und Jugendliche
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 10
außerhalb der Vereine etabliert. Fast über Nacht ist damit eine Situation entstanden, in der die Sportorganisationen zu interorganisatorischem Handeln aufgefordert sind. Dabei geht es um sehr viel mehr als nur um eine neue Konkurrenz zwischen Vereinen und Schulen, um Kinder und Jugendliche sowie um Sportstättenzeiten. Die Sportorganisationen müssen ihre Identität und ihre Zielsetzungen gegenüber einem anderen Typus von Organisation behaupten. Sie müssen sich in Verhandlungssystemen darstellen und neue Außenbezüge herstellen.
Kreativ wäre eine kommunale Sportpolitik zu nennen, die diese Aufgabenfelder als Zusammenhang begreifen würde. Sie wäre zukunftsorientiert, wenn sie Lösungsstrategien entwickeln würde, welche die Probleme als Frage- und Aufgabenstellungen kommunaler Integration konzipiert. Die Problematik aktueller kommunaler Sportpolitik erhellt daraus, dass sie gegenwärtig weit entfernt davon ist, in Theorie, Diagnose und Verfahrenssystemen den Gesamtzusammenhang offensiv anzugehen. Stattdessen findet sich eine Praxis, so z.B. die Ansätze in der Sportstättenentwicklungsproblematik, die Probleme durch Partikularlösungen anzugehen (Leitfaden für die Sportstättenentwicklungsplanung, Bundesinstitut für Sportwissenschaft, 2000).
1.3 Auf dem Weg zu einer neuen kommunalen Politikfähigkeit der Sportakteure
Mit dem Projekt in Borken konnten Erfahrungen, die bereits in anderen Projektzusammen-hängen gemacht worden waren, bestätigt und erweitert sowie ergänzt werden. Als Voraus-setzungen sind sie wichtig und bedeutsam genug für eine Neubegründung der kommunalen Sportpolitik, aber sie sind nicht hinreichend. Eine kreative kommunale Sportpolitik, die ihrem Gegenstand gewachsen sein will, muss auf dieser Grundlage weitere Schritte vollziehen. Vor diesem Hintergrund sollen die Grundlagen einer kreativen kommunalen Sportpolitik auch in ihrer Fortführung zusammengestellt werden.
1.3.1 Von der Planung zur Steuerung Die zentrale Einsicht besteht darin, dass die kommunale Sportpolitik neue Steuerungsansätze entwickeln muss. Angesichts der Veränderungen und der Dynamik des Sports und der Interdisziplinarität der Probleme sind intelligente Steuerungsansätze zu entwickeln, die dem schnellen Wechsel ihres Gegenstandes und den Metamorphosen seiner Nutzung nicht nur folgen, sondern die Entwicklung auch gestalten. Insbesondere sieben Gesichtspunkte sind zu gewährleisten:
Datenkompetenz
Interpretationskompetenz (hinsichtlich der Veränderungen und Potenziale des Mediums)
Kommunale Handlungsfähigkeit (Politikfähigkeit)
Interorganisatorisches und intersektorales Politikverständnis
Aufbau von Verfahrenssystemen und Denken in heterogenen Akteursprofilen (Netzwerke)
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 11
Sozialraumbezug
Partizipation Die Problematik der kommunalen Sportpolitik besteht demnach insbesondere darin, dass von den Akteuren nichts weniger verlangt wird, als dass sie den traditionellen Selbstbezug im Sport um weitere Systemreferenzen erweitern. Das veränderte Sportpanorama, die veränderte Organisationsumwelt und die neuen gesellschaftspolitischen Probleme müssen in zweifacher Weise abgebildet werden, (a) sie müssen als Zusammenhang gesehen werden, und sie müssen (b) in Bezug auf das Selbstverständnis des Sports und seine Organisationsmittel als Freiwilligenassoziationen als bearbeitbar und lösbar erscheinen. Dies sind angesichts der Organisationsgeschichte der Sportakteure besondere Zumutungen. Die Ebenendifferenz, die damit „auszuhalten“ und zu bewältigen ist, erfordert Konzepte und Instrumente, die bisher allenfalls in ersten Ansätzen vorliegen (vgl. Breuer, 2005). Tatsächlich werden die Akteure des Sports – Sportämter wie Verbände und Vereine – mit einer Situation konfrontiert, für die sie bislang nur unzureichend vorbereitet bzw. trainiert sind. Die verstärkten Bemühungen um neue Leitbilder, so wie sie gegenwärtig zu beobachten sind, korrespondieren damit; sie zeigen angesichts des Versagens selbstgenügsamer Selbstverständnisse der Vergangenheit zumindest die zunehmende Verbreitung der Erkenntnis, dass differenziertere Formen der Selbstbeschreibung und Orientierung wie Motivation erforderlich sind. Die Perspektiven einer innovativen kommunalen Sportpolitik stehen und fallen demnach damit, dass es in verschiedenen Verfahrensschritten gelingen muss, die Veränderungen der Umwelt als stärkstes Argument für das Organisationslernen herauszuarbeiten. Der erste Schritt muss in der angemessenen Interpretation des Mediums Sport bestehen. Hier sind es insbesondere drei Perspektiven und Argumente, die von Bedeutung sind: (1) der Strukturwandel des Sports ist herauszustellen, (2) zentrale Probleme der Gesellschaftspolitik und die Möglichkeiten des Sports sind zu benennen und zu begründen sowie (3) das „Argument der großen Zahl“ zu entwickeln, d.h. das Argument politikfähig zu machen, dass der Sport wie kaum ein anderes Medium massenwirksam ist. Der zweite Schritt besteht in der Vermittlung dieser Erkenntnisse in geeigneten Verfahrenssystemen. Dabei spielt es zunächst eine große Rolle, dass einschlägige Daten verfügbar sind. Zwei Zielrichtungen im Sinne des Organisationslernens sind dann primär zu entwickeln. Die Kommunikation muss nach innen wie nach außen wirken. Sie muss die Akteure des Sports selbst überzeugen und gewinnen; und sie muss andere Organisationen überzeugen, d.h. die Vertreter der interessanten Politikbereiche außerhalb des Sports. Dies ist nur möglich, wenn zwei weitere Anschlussprobleme gleichzeitig gelöst werden, zum einen die Darstellung der Veränderungen des Mediums und zum anderen die Abbildung der Perspektiven der anderen Politikbereiche. Damit sind besondere Herausforderungen einer „Neuen kommunalen Sportpolitik“ verbunden. Politikfähigkeit, die sie entwickeln müsste, setzt die Leistungen wissensbasierter Kommunikation und den Einsatz entsprechender Instrumenten der Steuerung voraus. Damit vollzieht sich auch an den Sportorganisationen eine wichtige Erkenntnis der Verbands- und Policy-Forschung. Politikfähigkeit ist eine Funktion in einem Interaktions-Verhältnis, in dem externe und interne Bedingungsfaktoren
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 12
systematisch miteinander variieren. Leistungsstärke in den Außenziehungen setzt intraorganisatorische Fähigkeiten und Konzepte voraus (vgl. Mayntz, 1992, S. 33).
1.3.2 Intersektorales Politikverständnis als Steuerungsansatz Nur dann, wenn es gelingt, die Sportentwicklungsplanung um die Dimension eines theoretisch begründeten, intersektoral operierenden und kompetenten Steuerungsansatzes zu erweitern, und in Netzwerken gelernt wird, kann gehofft werden, dass die kommunale Sportpolitik aus einer Position der Defensive herauskommt. Erforderlich ist offenbar ein Paradigmenwechsel, d.h. ein Ansatz, der Leistungen der Umweltsensibilität (gegenüber einer turbulenten Umwelt) mit Formen der reflexiven Steuerung (Selbstbeobachtung) sowie des Arbeitens mit heterogenen Akteursprofilen verbindet und sich dabei von Gesichtspunkten einer interorganisatorischen Beziehungslogik leiten lässt (vgl. Pankoke, 2002). In anderen Anwendungsbereichen – so z.B. in den neuen Steuerungsansätzen der Jugendhilfe oder in den Konzepten der Wohlfahrtsverbände – liegen bereits entsprechende Erfahrungen vor. Damit sind zugleich die systematischen Bedingungen der kommunalen Politikfähigkeit genannt, der es unter Gesichtspunkten der Gemeinwohlorientierung darum gehen muss, dass die integrativen Potenziale in den Kommunen intensiver und nachhaltiger genutzt und in einen engeren Bezug zur Stadtentwicklung und kommunalen Integration gebracht werden. Gesellschaftspolitische Bedeutung wird der Sport offenbar nur dann gewinnen, wenn er auf die sehr konkreten Anforderungen und Perspektiven jener Handlungs- und Problembereiche Antworten findet, auf die er seinen Gemeinwohlbezug bzw. eine entsprechende Rhetorik vielfältiger integrativer Leistungen in der Gegenwartsgesellschaft bezieht. Dies sind u.a. die Perspektiven folgender angrenzender Politikbereiche mit ihren „Krisenphänomenen“ bzw. Interventionsbedarfen:
Kinder- und Jugendpolitik/Jugendhilfe
Gesundheitspolitik/Gesundheitsförderung
Probleme sozialer Integration mit ihrem Sozialraumbezug
Probleme der Seniorenpolitik
Probleme der allgemeinen Stadtentwicklung und Stadtplanung bzw. des Zusammenhangs von Stadtentwicklung und Sportentwicklung (z.B. Disparitäten in den Stadtbezirken).
In den skizzierten Bereichen finden sich erhöhte und konkretisierte Anforderungen sowie der Bedarf an neuen Problemlösungen (Sport in der Ganztagsschule, Sport als Medium der Gesundheitsförderung in unterschiedlichen Settings wie Kindergarten und Schule, Sport im Sozialraum bzw. Quartiersmanagement) sowie ein geschärftes öffentliches Problembewusstsein. Glaubwürdigkeitslücken bzw. Darstellungsprobleme des Sports bestehen deshalb, weil die lebensweltlich gewachsenen Möglichkeiten des Mediums dort nur unzureichend gesehen bzw. anerkannt und entsprechend praktiziert werden.
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 13
In allen skizzierten Bereichen finden sich überdies neue Methodologien und Methoden und vor allem neue Steuerungsansätze und veränderte Formen des Wissensmanagements. Dies erzwingt nicht nur die Einsicht in die Notwendigkeit, die Ansprüche und Belange anderer Politikbereiche zu verstehen; es erfordert vor allen Dingen ein Denken und Handeln in anderen Systemreferenzen. Wie sehr dies zutrifft, wird daran erkennbar, dass Organisationen aus allen tragenden gesellschaftlichen Bereichen vertreten sind und zu berücksichtigen sind: (1) der Öffentliche Sektor, (2) der Privatwirtschaftliche Sektor und insbesondere der Dritte Sektor (Freiwilligenassoziationen, neben den Sportverbänden und –vereinen insbesondere Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Initiativen etc.). Dies wiederum erfordert neue Maßstäbe der Selbstidentifikation und die Einsicht, dass Strukturänderungen immer auch Selbständerungen in einer polykontextuellen Umwelt erfordern.
1.3.3 Heterogene Akteurs-Netzwerke als Schlüssel der kommunalen Sportplanung
Eine kreative kommunale Sportpolitik hängt weiterhin entscheidend davon ab, inwieweit es ihr gelingt, problemlösende intersektorale Netzwerke zu etablieren und zu steuern. Netzwerke als ein spezifischer Verhandlungstyp sind in Fällen der kommunalen Sportpolitik insbesondere aus drei weiteren Gründen angezeigt. (1) Sie ermöglichen Kommunikations-formen, die, jenseits von Markt und Hierarchie, einen aufmerksamen Umgang mit Ehrenamtlichkeit und dem Steuerungsmedium Solidarität gestatten, d.h., sie repräsentieren ein Verhandlungssystem, das die Verständigung in der Spannweite von Verwaltungshandeln und marktbezogenem und solidarischem Handeln ermöglicht. Insofern sind sie Motoren der Bewahrung bzw. Erzeugung sozialen Kapitals. (2) Sie ermöglichen das Kunststück, sehr unterschiedliche Politikbereiche zusammenzuführen, sofern sie professionell konzipiert und gesteuert werden; und sie erzeugen (3) öffentlichen Einfluss bzw. sind Produktionsmittel von „community power“. Zu den wichtigsten Problemen der kommunalen Sportpolitik zählt, dass eine überkommene Handlungslogik des Sportsystems, die sich im Sinne des Freiraum-Theorems von anderen Handlungslogiken freiwillig abkapselt, nicht mehr tragfähig ist. Unterscheidet man die drei Steuerungsprinzipien Solidarität (Handeln auf der Basis von Reziprozitätsnormen), Geld (als universales Tauschmittel) und Wissen (in der Wissens-gesellschaft zunehmend das Leitmedium), so kommt das System des Sports, das lange Zeit auf der Basis von Solidarität (Ehrenamtlichkeit), dann zunehmend Geld basierte, nicht umhin, das Steuerungsmedium Wissen zu adaptieren und durchzusetzen, um in den Politikarenen der kommunalen Politik und in den Austauschbeziehungen der Organisationen untereinander anschlussfähig zu sein. Dies ist ein elementares Erfordernis, um überhaupt als gestaltende politische Kraft wahrgenommen zu werden und damit die Basisvoraussetzung kommunaler Politikfähigkeit. Die, gemessen an den Vorarbeiten, Herkulesaufgabe besteht also allem Anschein nach darin, diese allgemeine Forderung unter den Bedingungen von Non-Profit-Organisationen sowie der Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure sowohl intraorganisational als auch interorganisational zu realisieren. Dies erfordert Behutsamkeit
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 14
und spezifische angepasste Beratungsleistungen angesichts der Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements im Sport, das in seinen Voraussetzungen nicht zu sehr durch überzogene Rationalitätsansprüche im Sinne einer Betriebswirtschafts-Logik strapaziert werden darf. Dass nachhaltige Problemlösungen intersektoral und multidisziplinär angesetzt werden müssen, kann angesichts des Strukturwandels des Sports aber auch angesichts neuer Politikstile und Verfahren (New Public Management, Wirksamkeitsdialoge, Zielvereinbarungen etc.) sinnvoll nicht mehr angezweifelt werden. In einer anderen Akteurskonstellation ist die Entwicklung bereits weiter fortgeschritten, im Fall der Wohlfahrtsverbände. Hier wird davon ausgegangen, dass „wohlfahrtssteigernde Effekte“ nur von neuen Kombinationsformen, Verknüpfungen und "Mixes" sektorspezifischer Handlungslogiken zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen und Institutionen zu erwarten sind“ (Evers & Olk, 1996, S. 27).
1.3.4 Dialogisches Verfahren Auf allen Stufen eines integrierten Forschungs- und Umsetzungsprojektes sind Gesichtspunkte des dialogischen Verfahrens von größter Bedeutung. Dies ist zum einen eine Reaktion auf die spezifische inhaltliche Problematik, zum anderen aber auch eine Maßnahme, welche die Umsetzung der Ergebnisse und die Nachhaltigkeit der Maßnahmen durch Partizipation sichern soll. Die Notwendigkeit eines Verfahrens, das den unterschiedlichen Perspektiven der beteiligten Akteure und Organisationen Rechnung trägt, und ihnen in einem spezifischen Verfahrenssystem Gewicht gibt, erklärt sich zunächst aus der Mehrdimensionalität der Problematik und der Heterogenität der Akteure sowie der Janusköpfigkeit des Mediums selbst, das, emotional hoch besetzt, in vielfältiger Beziehung zur Alltagskultur steht und dort in unterschiedlichen Sinnzusammenhängen verankert ist. Nimmt man den Idealfall eines intersektoralen Handlungskonzepts an, so treffen sehr unterschiedliche Kulturen und Organisationskonzepte aufeinander: Sportamt, Stadtsportbund bzw. Verbände und Vereine der Selbstverwaltung des Sports, die Vertreter der Schulen und Kindertagesstätten, die Stadtplanung, das Gesundheitsamt, das Jugendamt sowie weitere Träger der freien Jugendhilfe, interessierte Bürger, die Öffentlichkeit und gegebenenfalls auch Sponsoren. Weiterhin treffen Ehrenamtliche und Hauptamtliche aufeinander, die jeweils ihre eigenen Handlungskompetenzen und Verständnisse einbringen. Angesichts der Hybridizität der Akteure und des Geschehens kann prinzipiell nicht angenommen werden, dass es, unabhängig von den verschiedenen Perspektiven, einen exklusiven Königsweg zur Wahrheit bzw. zu „richtigen oder unabweisbaren“ Erkenntnissen gibt, geschweige denn durchgesetzt werden kann. Vor diesem Hintergrund kann es keine Einbahnstraße zwischen Wissenschaft und Praxis geben, d.h. ein Gefälle, in dem die „Praktiker“ die Forschungsergebnisse staunend zur Kenntnis nehmen und sie dann beflissen anwenden. Das dialogische Verfahren macht sie zu Partnern auch des Erkenntnisprozesses selbst.
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 15
Das Dialogische Verfahren sichert den interdisziplinären Erkenntnisprozess; es ist Motor des richtigen Vorgehens angesichts der Komplexität der Verhältnisse und es ist damit Erkenntnisorgan wie auch Koordinations- und Steuerungsmedium. Zugleich arbeitet es qua Partizipation auch als Konsens und Durchsetzungsmechanismus, der die beteiligten Akteure zu einer entsprechenden Praxis bzw. Maßnahmenpolitik treibt. Damit reduziert sich zugleich die Wahrscheinlichkeit, dass entsprechende Projekte und ihre Ergebnisse das typische Schubladenschicksal erleiden, dass Wissenschaft nur für Wissenschaft produziert. Das dialogische Verfahren funktioniert allerdings nur, wenn seine Logik respektiert wird und die Akteure jenseits der Routinen und der damit verbundenen Sicherheiten Rollendistanz zeigen und die Positionsvorteile unterschiedlicher Perspektiven anerkennen. Uminterpretationen von Wissenschaft und Praxis, die jeweilige Expertenkulturen darstellen, dürfen nicht missbraucht werden. Eine spezifische Kultur des Dialogs muss sicherstellen, dass die Unterschiedlichkeit der Perspektiven tatsächlich zur Geltung kommt. Die Wissenschaft benötigt ihre Distanz zum konkreten Geschehen; die Praxis benötigt den Respekt, dass in der Realität viele Problemlösungsversuche experimentell vorhanden sind, dass es entsprechendes Wissen und entsprechende Expertise bereits gibt, und dass diese in den Prozess der Herstellung von Handlungswissen und Konzepten aufzunehmen sind.
1.4 Prozess und Verfahren
Die nachfolgende Untersuchung hat zur Prämisse, dass eine kreative kommunale Sportpolitik nicht durch einen Verwaltungsakt zu schaffen ist. Das Konzept der intersektoralen Sportpolitik und –entwicklung, so wie es hier in wesentlichen Bestandteilen vorgestellt wird, war demnach von vornherein als ein mehrstufiger dialogischer Prozess konzipiert, in dem Zielsetzung, Datengewinnung, Interpretation, gesellschaftspolitischer Bezug, Organisationslernen, Umsetzung und Entwicklung geeigneter Strategien und Instrumente in aufeinanderfolgenden Verfahren aufeinander bezogen werden. Analytisch lassen sich dabei vor allem vier Phasen unterscheiden. Phase 1: Datengewinnung, Zielverständigung und Beginn des dialogischen Verfahrens Die Zielsetzung, Zielverständigung, Datengewinnung und der Start eines dialogischen Verfahrens gestalteten den Beginn des Projekts. Das vorliegende Projekt ging von der mittlerweile mehrfach bestätigten Praxis aus, dass eine neue Qualität der Sportpolitik nur über einen mehrstufigen Planungs- und Entscheidungs- sowie Umsetzungs-Prozess erreicht werden kann. Auch für den Planungsprozess in Borken war klar, dass nach der Zielsetzung mit der Gewinnung differenzierter Daten eine erste Grundlage allen Handelns zu schaffen war. Begleitet wurde dies von einem Konzept des dialogischen Verfahrens, das von vornherein die verschiedenen Sportakteure in die Prozesse des Erkenntnisgewinns und der Einordnung der Daten eingebunden hat. Mit diesem Schritt wurde nicht nur ein konstruktives Verhältnis zwischen Theorie und Praxis geschaffen; es wurden auch im Rahmen einer Netzwerkstruktur und des Beteiligungsverfahrens wichtige Elemente des Organisationslernens vermittelt. Insbesondere den Daten der repräsentativen
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 16
Bevölkerungsbefragung kommt dabei die Aufgabe zu, drei Begrenzungen traditioneller Sportplanung aufzulösen: (1) Die Daten zur Partizipation größerer Bevölkerungsgruppen und zur Bevorzugung der Freizeit- und Gesundheitssportarten demonstrieren, dass der Wettkampfsport seine Leitfunktion eingebüßt hat; (2) die Daten zur Zunahme der selbstorganisierten Sportaktivitäten dokumentieren die Auflösung bzw. Relativierung des Organisations- und Deutungsmonopols der Sportorganisationen; (3) die Daten zu den (veränderten) Orten der Sportausübung verdeutlichen, dass es keine prästabilierte Harmonie mehr zwischen Wettkampf-Infrastruktur und Sportbedürfnissen gibt. Phase 2: Integration und Einordnung der Daten sowie Intensivierung des Dialogischen Prozesses In einer zweiten Stufe wurden die Daten zusammengeführt und insbesondere der dialogische Prozess im Rahmen der Einordnung und Interpretation der Daten intensiviert. Hier war die Phase erreicht, in der die Grundlagen eines erweiterten Sportverständnisses in ihrem Bezug zur Stadtentwicklung zu diskutieren waren. Auch die weiteren Schritte des Beratungsprozesses in dieser Phase gingen davon aus, dass eine Öffnung für das erforderliche Organisationslernen nur dann wahrscheinlich wird, wenn die Einsicht vermittelt wird, dass die Ergebnisse Ausdruck der Entwicklung postindustrieller Gesellschaften sind, also als Ergebnis der allgemeinen gesellschaftlichen Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse erscheinen. Nur durch Herausstellung der gesamtgesellschaftlichen Bezüge wächst die Bereitschaft bei den Akteuren, in verschiedenen Systemreferenzen zu denken. Es liegt an der Qualität der theoretischen Begründung, inwieweit die Akteure nachvollziehen, dass die Probleme des Strukturwandels mit den herkömmlichen Mitteln der Sportplanung und –verwaltung nur unzureichend zu bewältigen sind, und dass ein völlig verändertes Medium neue Steuerungsinstrumente benötigt. Tatsächlich bedarf es der Kombination von Daten und Datenkompetenz, die aus Daten Wissen macht und der Herausstellung von allgemeinen gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozessen, d.h. entsprechender Theoriebezüge, um die erforderlichen Veränderungen in den entscheidenden Systemreferenzen zu veranlassen, in der Beziehung der Sportorganisationen zu sich selbst, in der Beziehung zu anderen Teilsystemen und in der Beziehung zum umfassenden System, d.h. der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Phase 3: Formulierung von Empfehlungen und Umsetzungsstrategien Die Fülle der Informationen und Erkenntnisse aus den Phasen 1 und 2 drängten auf ihre Nutzbarmachung. Bevor es zur Formulierung von Empfehlungen sowie der Entwicklung eines Handlungsplans kam, waren allerdings zahlreiche Verständigungsprozesse mit den Sportakteuren der Stadt und dem Sportausschuss erforderlich. Besonderer Wert wurde darauf gelegt, dass die Akteure in unterschiedlichen Modellen und Entwicklungspfaden denken. Am Ende des Prozesses bestand in allen beteiligten Gruppen Konsens hinsichtlich der Empfehlungen zur kommunalen Sportpolitik, die dem Stadtrat der Stadt Borken übergeben wurden.
Einführung: Kommunale Sportpolitik im Wandel | 17
Phase 4: Beginn und Begleitung der Umsetzung sowie Implementierung der Empfehlungen In dieser Phase haben sich die erarbeiteten Instrumente zu bewähren. Die Umsetzung konnte im Rahmen des Forschungsprojektes in Borken nur eingeleitet werden.
Erläuterungen zu den Untersuchungsergebnissen | 18
2 Erläuterungen zu den Untersuchungsergebnissen In den nachfolgenden Kapiteln 3 bis 7 werden die zentralen Ergebnisse aus den zwischen April 2011 und Mai 2012 durchgeführten Analysen und Befragungen des Instituts für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln, wie z.B.
• Bevölkerungsbefragung (n=2.683) • Sportvereinsbefragung (n=23 – Rücklauf: 62,2) • Befragung Schulsportbeauftragte (n=15 – Rücklauf: 76,2%) • Befragung Kindergärten (n=21 – Rücklauf: 91,3%) • Analyse der Sportinfrastruktur • Daten zur Stadtentwicklung • Daten zur Gesundheitsentwicklung • Demographische Daten
gebündelt und innerhalb verschiedener Themenbereiche aufbereitet und dargestellt. Diese Daten lieferten dann die Grundlage für die Arbeit der Lenkungsgruppe Sportentwicklung Borken. In einem durch das Institut für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln moderierten Prozess wurden dabei zwischen Februar und Juli 2012 in insgesamt fünf Sitzungen der Lenkungsgruppe insgesamt 51 Handlungsempfehlungen erarbeitet (siehe Kapitel 8).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 19
3 Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken
3.1 Ablauf/Vorgehen
Der Ablauf und die Rahmenbedingungen der repräsentativen Bevölkerungsbefragung wurden vom Institut für Sportsoziologie in Zusammenarbeit mit der Sportverwaltung der Stadt Borken festgelegt. Abgesprochen wurden u.a. Aspekte wie der Zeitpunkt und die Art der Durchführung der Befragung sowie die Zusammensetzung der Stichprobe. Ablauf: Juni/Juli 11: Vorbereitende Gespräche mit der Sportverwaltung und dem SSV August 11: Diskussion des Entwurfs mit der Stadtverwaltung und dem SSV 06.09.11: Pressekonferenz zur Ankündigung der Befragung 07.09.11: Bereitstellung der Druckvorlage bis 19.09.11: Druck und Vorbereitung des Versands durch die Stadt Borken 19.-23.09.11: Versand der Fragebögen 26.09.-04.11.11: Rücklaufkontrolle durch die Stadtverwaltung und
kontinuierliche Pressearbeit bis Ende Dezember 2011: Dateneingabe und Bereinigung des Datensatzes
3.1.1 Stichprobe Ziel der Untersuchung ist es, auf Stadtteilebene Aussagen zum Sportverhalten der 14 bis 79-Jährigen Bevölkerung zu treffen. Im Fall einer proportional geschichteten Stichprobe bringt dies bei kleineren Stadtteilen das Problem mit sich, dass dort eventuell die Anzahl der Fälle zu gering ist, um innerhalb dieser Bezirke differenzierte Aussagen, z.B. zu Unterschieden innerhalb verschiedener Altersklassen, zu tätigen. Um dieses Problem zu vermeiden, wurde daher in Borken die Methode der geschichteten Zufallsstichprobe gewählt. D.h., aus jedem Stadtbezirk wurde eine Mindestzahl an Personen ausgewählt, sodass bei einem zu erwartenden Rücklauf von 18 bis 25 Prozent2 gesicherte Aussagen auf Stadtbezirksebene getroffen werden können. Nach Absprache mit der Stadtverwaltung wurde, unter Berücksichtigung der vorhandenen Ressourcen, die Größe der Gesamtstichprobe auf 13.000 festgesetzt. Die Adressstichproben wurden mittels eines EDV-Standardprogramms durch die Stadt Borken im September 2011 gezogen.
2 Aus organisatorischen und finanziellen Gründen wurde auf Wunsch der Stadtverwaltung auf ein Erin-nerungsschreiben verzichtet. Bei einem einmaligen Fragebogenversand ohne Erinnerungsschreiben liegt die Rücklaufquote i.d.R. unter 20 Prozent (vgl. Porst 2001, Diekmann 1995, 441).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 20
3.1.2 Rücklauf Wie Porst3 und Diekmann4 konstatieren, liegt bei einem einmaligen Fragebogenversand ohne Erinnerungsschreiben die Rücklaufquote i.d.R. unter 20 Prozent. Vergleicht man diese Erfahrungen der sozialwissenschaftlichen Forschung mit den Ergebnissen der Befragung „Sport in der Stadt Borken“, kann man von einem Rücklauf im zu erwartenden Rahmen sprechen5. Von 13.000 Fragebögen, die an die Bevölkerung verschickt wurden, waren 30 Adressen nicht mehr gültig. Nachdem die zurückgesandten Fragebögen hinsichtlich ihrer Plausibilität überprüft wurden, ergab sich eine Nettostichprobe von 2.200. Dies entspricht einer Quote von 17 Prozent. In den Stadtteilen „Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken“ (18,2%) und Gemen (17,8%) lag die höchste Beteiligung vor, weniger interessiert waren die Bürger und Bürgerinnen in Borkenwirthe / Burlo (14,4%) (vgl. Tab. 1). Im Fragebogen konnten Eltern darüber hinaus Angaben zu sportlichen Aktivitäten ihrer Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren machen. Hier wurden insgesamt Angaben zu 483 Kindern gemacht. Dabei befanden sich vier Kinder im Alter von über 13 Jahren, welche in die Berechnung der 14-79-Jährigen mit einbezogen wurden. Drei Kinder im Alter von unter 14 Jahren, welche Angaben im Befragungsteil der 14-79-Jährigen gemacht hatten, wurden in die Berechnungen der 3-13-Jährigen mit einbezogen. Somit ergab sich am Ende eine Datengrundlage von insgesamt 2.683 Personen, davon 2.201 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Borken im Alter von 14 bis 79 Jahren sowie 482 Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren.
3 Rolf Porst (2001). Wie man die Rücklaufquote bei postalischen Befragungen erhöht. ZUMA How-to-Reihe, Nr. 09. Mannheim. 4 Diekmann, Andreas (1995). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek. 5 Allerdings hatte sich das Forschungsteam aufgrund vergleichbarer Befragungen in Aachen (Rückluaf: 22,7%) und Mönchengladbach (20,8%) eine höhere Beteiligung der Borkener Bürgerinnen und Bürger erhofft.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 21
Tab. 1: Rücklauf nach Stadtbezirk
Stadtbezirk Stichprobe Rücklauf n
Rücklaufquote (%)
Borken 4989 818 16,40
Borkenwirthe, Burlo 1497 216 14,36
Gemen (Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe)
1995 356 17,84
Grütlohn, Hoxfeld, Rhedebrügge, Westenborken
1497 272 18,17
Marbeck 1497 244 16,30
Weseke 1497 262 17,50
ohne Angabe 33
falsche Adresse 30 12.970 2.200 16,96
3.1.3 Qualität der Stichprobe Die Repräsentativität der Stichprobe kann anhand der Betrachtung von sogenannten Populationsparametern beschrieben und beurteilt werden. Um die Qualität der Stichprobe zu prüfen, werden soziodemographische Merkmale herangezogen. Im Folgenden werden dazu die aktuellen Grunddaten des Einwohnermeldeamtes der Stadt Borken, die zur Zeit der Erhebung vorlagen (Stand: 27.07.2011), zur Überprüfung der Qualität der Stichprobe herangezogen. Es gilt zu prüfen, inwieweit die reale Alters- und Geschlechtsstruktur der Bevölkerung in der Stichprobe ausreichend repräsentiert ist und inwieweit die lokalräumliche Verteilung der Stichprobe der realen Verteilung in den Stadtbezirken entspricht. Von den Befragten waren 56,39 Prozent weiblich und 43,61 Prozent männlich. Damit sind die Frauen im Vergleich zur Grundgesamtheit der Stadt Borken überrepräsentiert. Ende Juli 2011 lebten in der Stadt Borken 32.027 Menschen im Alter zwischen 14 und 79 Jahren, wovon 50,39 Prozent (-6 Prozentpunkte im Vergleich zur Stichprobe) weiblich und 49,61 Prozent männlich sind (vgl. Tab. 2). Um diese Verzerrung auszugleichen, wurde eine Gewichtung der Merkmalsausprägung Geschlecht auf Stadtbezirksebene vorgenommen. Betrachtet man die Verteilung nach Stadtbezirken, zeigt sich erwartungsgemäß auf Grundlage der Stichprobenziehung mittels einer geschichteten Zufallsstichprobe, dass in der Stichprobe die Bewohner aus dem Stadtbezirk Borken unterproportional und die die Bewohner aus den anderen Stadtbezirken hingegen leicht überproportional vertreten sind (vgl. Tab. 2). Diese Differenzen im Datensatz wurden mittels einer Gewichtung der Realverteilung angeglichen.
3. Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports | 22
Tab. 2: Repräsentativität des Datensatzes – Indikatoren Geschlecht und Wohnbezirk (Bevölkerung 14-79 Jahre)
1.Verteilung der Befragten differenziert nach Bezirken
2. Realverteilung der Bevölkerung differenziert nach Bezirken (14-79J.)
Differenz zwischen 1 u. 2
Repräsentanzwerte diff. n. Bezirken
Stich-probe in %
n* w
in % m
in %
Realverteilung Bevölkerung
in %
N (Stand
27.07.11)
w in %
m in %
Diff. in PP (w)
Diff. in PP (m)
Differenz in Prozentpunkten
Gesamt 100 2169 56,39 43,61 100 32.027 50,39 49,61 6,00 -6,00 Verteilung auf die sechs Stadtbezirke
Borken 37,67 817 58,87 41,13 49,31 15.793 50,79 49,21 8,08 -8,08 -11,64
Borkenwirthe,Burlo
9,91 215 53,02 46,98 8,88 2.845 49,07 50,93 3,95 -3,95 1,03
Gemen (Gemen,Gemenrückling, Gemenwirthe)
16,46 357 54,62 45,38 19,19 6.146 51,43 48,57 3,19 -3,19 -2,73
Grütlohn, Hoxfeld,Rhedebrügge, Westenborken
12,59 273 57,88 42,12 5,05 1.618 49,44 50,56 8,44 -8,44 7,54
Marbeck 11,30 245 55,92 44,08 5,90 1.888 49,63 50,37 6,29 -6,29 5,40
Weseke 12,08 262 52,67 47,33 11,67 3.737 48,78 51,22 3,89 -3,89 0,41
*Hier niedriger als Gesamtrücklauf, da Personen fehlen, welche keine Angaben zum Bezirk gemacht haben bzw. ihr Geschlecht nicht angegeben haben.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 23
Die Altersverteilung der Stichprobe im Vergleich zur Grundgesamtheit weist einige Abweichungen auf. Die 40 bis 49-Jährigen (+3,81 PP6) und 60 bis 69-Jährigen (+1,29 PP) sind in der Stichprobe überrepräsentiert, während die 70 bis 79-Jährigen (-3,94 PP) und die 20 bis 29-Jährigen (-1,56 PP) unterrepräsentiert sind. Die Verteilung in den übrigen Altersgruppen entspricht annähernd der Realverteilung (vgl. Tab. 3). Bezogen auf die Altersverteilung im Datensatz wurde zur Angleichung eine Gewichtung in der Merkmalsausprägung Altersgruppen auf Stadtbezirksebene vorgenommen.
Tab. 3: Stichprobe und Grundgesamtheit differenziert nach Altersklassen (Stand 27.07.2011)
n
Stichprobe in %
N Grundgesamtheit
in % Differenz
in PP
14-19 Jahre 199 9,14 2.736 8,54 +0,60
20-29 Jahre 302 13,87 4.941 15,43 -1,56
30-39 Jahre 295 13,54 4.403 13,75 -0,21
40-49 Jahre 564 25,89 7.071 22,08 +3,81
50-59 Jahre 396 18,18 5.821 18,18 0,00
60-69 Jahre 277 12,72 3.660 11,43 +1,29
70-79 Jahre 145 6,66 3.395 10,60 -3,94
14-79 Jahre 2178 100 32.027 100 Durch die oben beschriebenen Gewichtungsverfahren wurde eine Repräsentativität des Datensatzes hinsichtlich der basalen soziostrukturellen Merkmale Stadtbezirk, Geschlecht und Alter erzielt.
6 PP steht für Prozentpunkte
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 24
Ausländeranteil Von den insgesamt 32.027 Bürgern und Bürgerinnen im Alter von 14 bis 79 Jahren der Stadt Borken sind 95,34 Prozent deutscher Herkunft. Der verbleibende Anteil von insgesamt 4,66 Prozent sind ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mit Blick auf diese Merkmalsausprägung weist die Stichprobe schwache Abweichungen auf: 97 Prozent (+1,7 PP) sind deutsche und 1,7 Prozent (-2,9 PP) nichtdeutsche Bürger und Bürgerinnen. 1,2 Prozent der Befragten gaben keine Auskunft zu ihrer Nationalität (vgl. Tab. 4). Dieses Ergebnis war zu erwarten, da ein in deutscher Sprache abgefasster Fragebogen bei ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Verständigungsprobleme birgt. Hierin gründet sich der geringere Rücklauf in der Gruppe der Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund.
Tab. 4: Stichprobe und Grundgesamtheit (14-79 Jahre) differenziert nach Nationalität (Stand: 27.07.2011)
n
Stichprobe in %
N Grundgesamtheit
in % Differenz
in PP
deutsch 2.136 97,05 30.535 95,34 1,71nichtdeutsch 38 1,73 1.492 4,66 -2,93
k.A. 27 1,23Gesamt 2.201 100 32.027 100
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 25
Sportvereinsmitgliedschaft Die größte Abweichung zwischen der Realverteilung in der Bevölkerung und der Stichprobe ergibt sich beim Aspekt der Mitgliedschaft in einem Sportverein. Im Datensatz geben 53,7 Prozent der Befragten an, dass sie Mitglied in mindestens einem Sportverein sind. Vergleicht man diese Zahlen mit den Daten des Stadtsportbundes, ergeben sich deutliche Differenzen: Zum 31.12.2011 waren beim SSB 17.908 Mitgliedschaften gemeldet. Dies entspricht einer Organisationsquote von 43,34 Prozent und somit einem Prozentpunkteunterschied von knapp über 10 Prozentpunkten (vgl. Tab. 5). Man muss allerdings berücksichtigen, dass sich die Daten des Stadtsportbundes Borken auf alle Altersgruppen beziehen, wohingegen die Organisationsquote innerhalb des Datensatzes nur die Altersgruppen von 14-79 Jahren berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wurde bei der Auswertung der Daten über Gruppenvergleiche (Vereinsmitglieder vs. Nicht-Vereinsmitglieder) überprüft, ob Ergebnisse eventuell durch den überrepräsentierten Anteil der Vereinsmitglieder beeinflusst wurden. In diesen Fällen wird explizit darauf aufmerksam gemacht.
Tab. 5: Vergleich der Vereinsmitglieder in der Befragung und beim SSB Borken gemeldeten Mitgliedschaften (Stand 31.12.2011)
absolut OrganisationsquoteVereinsmitglieder im Datensatz (14-79 Jahre) 1.164 53,7% Mitgliedschaften im SSB Borken (alle Altersgruppen) 17.908 43,35% Gesamteinwohner Borken 41.323
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 26
3.2 Sportengagement
Das Sportengagement der 14- bis 79-Jährigen Borkenerinnen und Borkener liegt nach Selbstaussage der Befragten bei 80,5 Prozent (vgl. Abb. 1).
80,5%
19,5%
Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?‐ gesamt ‐
Ja
Nein
n = 2201
Abb. 1: Treiben Sie in ihrer Freizeit Sport? - gesamt
Vergleicht man die Zahl mit anderen Kommunen wie Bocholt (74,7% / 2003), Köln (58,8% / 2003), Mönchengladbach (67,6% / 2006) oder Aachen (78,3% / 2008), kann man von einer sehr hohen Aktivitätsquote sprechen7 (vgl. Abb. 2).
7 Zu berücksichtigen ist bei den Zahlen aus Bocholt, dass die Fragestellung mit „Treiben Sie Sport“ offener gestellt war als in Aachen, Köln und Mönchengladbach („Treiben Sie in ihrer Freizeit Sport?) und somit eine etwas größere Personengruppe angesprochen wurde.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 27
80,5
78,3
67,6
74,7
58,8
0 20 40 60 80 100
Borken
Aachen
M'gladbach
Bocholt
Köln
Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?‐ Vergleich der Städte Köln, Bocholt, Mönchengladbach, Aachen und Borken
‐
Köln n=4017, Bocholt n=4002, MG n=3068, Aachen n=2644, Borken n=2201
%
Abb. 2: Treiben Sie in ihrer Freizeit Sport? - Städtevergleich
Der hohe Prozentsatz an Sportaktiven ist u.a. begründbar mit einem weiten Verständnis des Sportbegriffes, der in der Fragestellung mitschwingt: Neben dem leistungsorientierten Wettkampfsport können auch Aspekte der Gesundheit, Fitness, Freizeit und Erholung sowie Erlebnis, Abenteuer und Risikoaspekte assoziiert werden. In der Befragung wurde bewusst auf eine vorgegebene, eng umgrenzte Definition des Begriffes Sport verzichtet, um den Befragten Interpretationsspielraum zu gewährleisten und allen möglichen Formen sportlicher Aktivität Raum zu lassen. Dadurch können auch verborgene Potenziale bzgl. des Sport- und Bewegungsverhaltens bei der Bevölkerung erfragt werden. Für die Sportplanung gilt ohnehin, dass die Bedürfnisse all derer relevant sind, die ihre körperliche Betätigung als sportliche Aktivität verstehen und nicht nur jene Zielgruppen als für die Sportplanung relevant angesehen werden sollten, die ’normierte’ Sportarten betreiben.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 28
3.2.1 Sportaktivität und Geschlecht Differenziert nach dem Geschlecht zeigen sich nur geringe Unterschiede. Die Frauen sind mit 80,8 Prozent minimal aktiver als die Männer mit 80,4 Prozent (vgl. Abb. 3).
Abb. 3: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Geschlecht
80,8 80,4
weiblich männlich
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?‐ Geschlecht ‐
%
n = 2138
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 29
3.2.2 Sportaktivität und Alter Betrachtet man die Aktivitätsquote im Altersverlauf, so zeigt sich in Borken mit Ausnahme der 30 bis 39-Jährigen ein stufenweiser Rückgang. Allerdings lässt sich feststellen, dass Sport zu treiben längst nicht mehr nur ein Vorrecht der Jugend ist (93,2% der Borkener im Alter von 14 bis 19 Jahren treiben in ihrer Freizeit Sport), sondern es hat sich zu einem stabilen Freizeitmuster auch bei den Erwachsenen entwickelt (20 bis 29 Jahre: 82,3% - 30 bis 39 Jahre: 82,7% - 40 bis 49 Jahre: 80,7% - 50 bis 59 Jahre: 78,4% - 60 bis 69 Jahre: 77,7%). In allen Altersgruppen gibt jeweils eine deutliche Mehrheit der Befragten an, in der Freizeit Sport zu treiben (vgl. Abb. 4). Mit dem Alter lässt das Sporttreiben zwar nach, aber auch in der Gruppe der 70 bis 79-Jährigen sind in Borken 70,9 Prozent sportlich aktiv, die sich somit zur Zielgruppe der „Aktiven Senioren“ rechnen lassen. Die Gruppe der sportlich aktiven SeniorInnen dürfte in Zukunft sowohl absolut als auch relativ zu anderen Altersgruppen weiter ansteigen. Sportanbieter sollten sich mit einer entsprechenden Angebots- und Produktpolitik darauf einstellen.
Abb. 4: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Alter
70,9
77,7
78,4
80,7
82,7
82,3
93,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
70‐79 Jahre
60‐69 Jahre
50‐59 Jahre
40‐49 Jahre
30‐39 Jahre
20‐29 Jahre
14‐19 Jahre
Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?‐ Alter ‐
n = 2178
%
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 30
3.2.3 Sportaktivität nach Stadtteilen Betrachtet man das Sportengagement der Bevölkerung aus der lokalräumlichen Perspektive, ist folgendes festzustellen: Die Werte für das Sportengagement in den einzelnen Stadtteilen weichen gegenüber dem Durchschnittswert für Gesamt-Borken (80,5%) nur geringfügig ab. Die sportlich aktivsten Stadtteile in Borken sind Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe (83,4%) sowie Weseke (81,4%) und Borken (81%), während Marbeck (75%) den niedrigsten Anteil sportlich aktiver Bewohner hat (vgl. Abb. 5).
81,078,6
83,4
75,5 75,0
81,4
Borken Borkenwirthe,Burlo
Gemen,Gemenrückling,Gemenwirthe
Grütlohn,Hoxfeld,
Rhedebrügge,Westenborken
Marbeck Weseke
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?‐ Stadbezirke‐
%
n = 2171
Abb. 5: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Stadtteilen
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 31
3.2.4 Sportaktivität und Bildungsabschluss Die Bevölkerungsbefragung offenbart, dass in Borken Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau weniger aktiv sind als Menschen mit höherem Bildungsniveau (vgl. Abb. 6). Als Ursachen kommen dabei insbesondere schichtspezifische Lebensstilkonzepte mit geringerer Wertschätzung eines gesundheitsförderlichen Verhaltens sowie das Fehlen von zielgruppengerechten Angeboten in Frage. Unabhängig von den Ursachen indizieren die Daten einen hohen Handlungsbedarf für eine Verbesserung des Zugangs zu Sport und Bewegung für einkommensschwächere und benachteiligte Bevölkerungsschichten.
55,6
55,6
70,1
80,8
82,1
84,2
87,2
93,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
sonstiger Abschluss
Schule beendet ohne Abschluss
Haupt‐/Volksschulabschluss
Realschulabschluss, Fachschulreife
Abitur, Allgemeine Hochschulreife
(Fach‐)Hochschulabschluss
Fachhochschulreife
zur Zeit Schüler(in)
Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport?‐ Bildung ‐
n = 2147
%
Abb. 6: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Bildungsabschluss
Der Trend einer zunehmend geringeren Sportbeteiligung von Menschen mit geringerer Bildungslage spiegelt sich prinzipiell auch mit Blick auf die ökonomische Lage, gemessen am Haushaltseinkommen der Bevölkerung, wieder: So kann ein fast kontinuierliches Wachstum des Sportengagements von der niedrigsten zur obersten Einkommenslage beobachtet werden, wobei nur 58,5 Prozent der Bevölkerungsgruppe mit einem Einkommen von weniger als 750 Euro/Monat sportlich aktiv sind. In einem mittleren Einkommenssegment (zw. 751 und 2500 Euro) liegt das Sportengagement zwischen 72,8 Prozent und 80,0 Prozent und in den oberen Einkommensstufen (2501 und mehr als 4000 Euro/Monat) zwischen 81,4 und 88,7 Prozent (vgl. Tab. 6).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 32
Auch hier gilt, unabhängig von der Begründungsrichtung, ob zielgruppengerechte Angebote für Menschen mit wenig Geld eher fehlen, oder ob es eine Rückwirkung aus einem ungesünderen Lebensstil von Menschen unterer sozialer Lage ist, es besteht hoher Handlungsbedarf, gerade auch für geringer verdienende Menschen angemessene organisierte Sportangebote zu generieren.
Tab. 6: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Haushaltseinkommen
Einkommen ja (in %)
unter 750 Euro (n=79) 58,5
750-1500 Euro (n=239) 72,8
1501-2500 Euro (n=563) 80,0
2501-4000 Euro (n=729) 81,4
über 4000 Euro (n=296) 88,7
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 33
3.2.5 Gründe zum Sportreiben Der Hauptgrund ‚Sport zu treiben‘ ist für die meisten Sportaktiven fitnessorientiert (94,9%). Dieses Motiv wird dicht gefolgt von dem Gedanken, etwas für die eigene Gesundheit zu tun oder einfach, weil Sport Spaß macht (90,5% resp. 85,8%). Viele Befragte sind auch sportlich aktiv, um sich entspannen oder abschalten zu können, sie treiben Sport als Ausgleich für zu wenig Bewegung im Alltag oder um etwas für ihre Figur zu tun (71,9% bis 62,8%). Auch der Ausgleich zur Arbeit/Hausarbeit und die freie Natur sind für die Befragten wichtige Gründe für ihr Sportengagement (59,1% resp. 49,0%) (vgl. Abb. 7).
28
33,6
37,1
36,2
42,2
39,3
33,6
31
21
25,5
25,7
31,8
29,7
46,5
56,9
63,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
weil man dabei in der freien Natur ist
als Ausgleich zur Arbeit/Hausarbeit
um etwas für die Figur zu tun
als Ausgleich für zu wenig Bewegung
um mich zu entspannen/abschalten zu können
weil Sport Spaß macht
um etwas für die Gesundheit zu tun
um mich fit zu halten
Gründe zum Sporttreiben‐ Ziemlich wichtig / sehr wichtig ‐
ziemlich wichtig sehr wichtign = 1555‐1717
%
Abb. 7: Die acht wichtigsten Gründe zum Sporttreiben
Differenziert nach Geschlecht zeigen sich keine großen Unterschiede. Lediglich der Erfolgsgedanke ist bei Männern etwas stärker ausgeprägt als bei Frauen. Dem gegenüber wollen Frauen die Natur intensiver erleben, „jung“ bleiben oder sie treiben Sport, um Probleme des Alltags besser bewältigen zu können. Die Unterschiede im Geschlechtervergleich sind allerdings auch in diesen Bereichen verschwindend gering. Insgesamt ist allerdings auffallend, dass Männer an erster Stelle aus Spaß am Sport aktiv sind, während für Frauen das Gesundheitsmotiv oberste Priorität hat (vgl. Tab. 7).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 34
Tab. 7: Gründe zum Sporttreiben – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte (Skala von 1=gar nicht wichtig bis 5=sehr wichtig)
Aspekte Sporttreiben weiblich (n=872-973)
männlich (n=675-732)
weil Sport Spaß macht 4,21 4,33 um nette Leute zu treffen 3,30 3,32 um mich fit zu halten 4,61 4,52 um sportliche Erfolge zu erzielen 2,27 2,70 um zu sehen, was ich leisten kann 2,86 3,14 um etwas für die Figur zu tun 3,90 3,60 um etwas für die Gesundheit zu tun 4,55 4,34 als Ausgleich für zu wenig Bewegung 3,81 3,79 als Ausgleich zur Arbeit/Hausarbeit 3,59 3,50 Die Natur intensiver erleben 3,09 2,84 weil Familienmitglieder/ Freunde auch Sport treiben 2,30 2,39
um Probleme des Alltags zu bewältigen 2,86 2,63 um „jung“ zu bleiben 3,13 2,91 um mich entspannen/ abschalten zu können 3,93 3,82 um den eigenen Körper zu erfahren 3,15 3,00 weil man dabei in der freien Natur ist 3,41 3,15 auf ärztlichen Rat 2,44 2,11
Betrachtet man nun die einzelnen Altersgruppen, fällt auf, dass der Spaßaspekt – unabhängig vom Geschlecht – mit zunehmendem Alter abnimmt, gleichwohl aber eine hohe Bedeutung in allen Altersgruppen besitzt. Ebenfalls einen hohen Stellenwert haben die Motive Gesundheit sowie Fitness, allerdings verhält es sich hier umgekehrt zum Spaßaspekt – die Bedeutung nimmt mit dem Alter zu. Auch als Ausgleich für zu wenig Bewegung und zur Entspannung werden die sportlichen Aktivitäten häufig genutzt: Vor allem die mittleren Altersgruppen (20-59 Jahre) suchen Entspannung, während ein Ausgleich für zu wenig Bewegung häufig von den 20 bis 79-Jährigen gesucht wird (vgl. Tab. 8).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 35
Tab. 8: Gründe zum Sporttreiben – differenziert nach Alter, Mittelwerte (Skala von 1=gar nicht wichtig bis 5=sehr wichtig)
Aspekte Sporttreiben
14-19 Jahre
(n=172-177)
20-29 Jahre
(n=239-245)
30-39 Jahre
(n=233-240)
40-49 Jahre
(n=412-446)
50-59 Jahre
(n=265-300)
60-69 Jahre
(n=150-204)
70-79 Jahre (n=51-
92)weil Sport Spaß macht 4,68 4,42 4,28 4,27 4,09 4,07 4,11 um nette Leute zu treffen 3,57 3,34 3,14 3,29 3,16 3,34 3,63 um mich fit zu halten 4,44 4,57 4,50 4,61 4,56 4,63 4,66 um sportliche Erfolge zu erzielen 3,41 3,18 2,49 2,29 2,04 1,81 1,83
um zu sehen, was ich leisten kann
3,65 3,40 3,02 2,82 2,76 2,58 2,75
um etwas für die Figur zu tun 3,84 3,97 3,87 3,76 3,62 3,47 3,43
um etwas für die Gesundheit zu tun
4,03 4,37 4,35 4,55 4,50 4,55 4,70
als Ausgleich für zu wenig Bewegung
3,45 3,93 3,90 3,84 3,80 3,78 3,69
als Ausgleich zur Arbeit/Hausarbeit 3,05 3,77 3,80 3,75 3,55 3,18 2,94
die Natur intensiv erleben 2,21 2,71 2,97 3,18 3,24 3,06 3,26 weil Familienmitglieder/ Freunde auch Sport treiben
2,41 2,39 2,37 2,29 2,23 2,35 2,55
um Probleme des Alltags zu bewältigen
2,62 2,77 2,82 2,83 2,81 2,50 2,59
um „jung“ zu bleiben 2,55 2,81 3,04 3,13 3,08 3,21 3,47 um mich entspannen/ abschalten zu können 3,68 3,86 4,00 3,96 4,02 3,76 3,46
um den eigenen Körper zu erfahren
2,78 2,93 3,15 3,11 3,20 3,19 3,14
weil man dabei in der freien Natur ist
2,66 3,02 3,20 3,46 3,50 3,48 3,62
auf ärztlichen Rat 1,69 1,98 2,21 2,28 2,42 2,72 3,13
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 36
3.2.6 Gründe, nicht Sport zu treiben Treiben die Menschen keinen Sport, sind es vor allem die fehlende Zeit (37,7%) und gesundheitliche Gründe (26,1%), die sie davon abhalten. 23,5 Prozent geben an, dass sie ohnehin genug Bewegung haben. Ungünstige Arbeitszeiten und –orte geben 17,9 Prozent als Grund an. Für 17,3 Prozent ist der Sport nicht die bevorzugte Freizeitaktivität und 14,5 Prozent halten sich für zu alt, um Sport zu treiben (vgl. Abb. 8).
14,5
17,3
17,9
23,5
26,1
37,7
0 5 10 15 20 25 30 35 40
aus Altersgründen
Sport liegt mir nicht, ich bevorzuge andere Freizeitaktivitäten
ich habe ungünstige Arbeitszeiten oder ‐orte
ich habe genug Bewegung
aus gesundheitlichen Gründen
ich habe zu wenig Zeit aufgrund einer hohen beruflichen oder
häuslichen Belastung
Aus welchem Grund treiben Sie keinen Sport?
‐Mehrfachnennungen möglich‐
n = 415
%
Abb. 8: Gründe, keinen Sport zu treiben – Auszug der Top 6 Antworten – Mehrfachnennungen möglich
Die Frage, ob man sich in Zukunft vorstellen könne, wieder Sport zu treiben, verneinen lediglich 21,9 Prozent. Die Mehrheit schließt nicht aus, zukünftig wieder sportlich aktiv zu werden („Ja“ 33,8% resp. „Vielleicht“ 39,0%) (vgl. Abb. 9). Dabei sind es vor allem die 20 bis 49-Jährigen, welche ein erneutes sportliches Engagement in Erwägung ziehen (vgl. Abb. 10).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 37
33,8%
21,9%
39,0%
5,3%
Beabsichtigen Sie in Zukunft (wieder) Sport zu treiben?
‐ sportlich inaktive Bevölkerung ‐
Ja
Nein
Vielleicht
Weiß nicht
n = 417
Abb. 9: Beabsichtigen Sie in Zukunft (wieder) Sport zu treiben – sportlich inaktive Bevölkerung
10,0
7,0
21,0
30,0
32,0
30,0
8,0
0 5 10 15 20 25 30 35
über 69 Jahre
60‐69 Jahre
50‐59 Jahre
40‐49 Jahre
30‐39 Jahre
20‐29 Jahre
14‐19 Jahre
Beabsichtigen Sie in Zukunft (wieder) Sport zu treiben?
‐ Sportlich inaktive Bevölkerung, differenziert nach Alter ‐
n = 413
%
Abb. 10: Beabsichtigen Sie in Zukunft (wieder) Sport zu treiben – sportlich inaktive Bevölkerung differenziert nach Alter
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 38
3.3 Ausgeübte Sportarten
Von den sportaktiven Einwohnerinnen und Einwohnern in Borken treiben 80,9 Prozent noch eine zweite Sportart, 48,8 Prozent üben weiterhin mindestens noch eine dritte Sportart aus (vgl. Abb. 11)
80,9
48,8
Zweitsportart Drittsportart
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ausübung einer Zweit‐ und Drittsportart‐ Sportaktive Befragte ‐%
n = 1760
Abb. 11: Ausübung einer Zweit- und Drittsportart
Betrachtet man die Rangliste der zehn beliebtesten Sportarten (Mehrfachnennungen möglich, vgl. Abb. 12), so stehen mit Laufen/Joggen (35%), Radfahren (30,6%) und Schwimmen (27,4%) Sportarten an erster Stelle, die alleine betrieben werden können. Diese müssen weder vereinsorganisiert sein, noch sind die Sporttreibenden hier – bezogen auf Radfahren und Laufen/Joggen – auf traditionelle Sportstätten angewiesen. Fitness (22,8%) und Gymnastik (20,5%) folgen auf den Plätzen vier und fünf der beliebtesten Sportarten. Mit Fußball rangiert eine Mannschaftssportart an sechster Stelle (15%). Die weiteren Sportarten sind mit Walking/Nordic Walking (14,3%), Tennis (6,4%), Kraftsport (6,1%) und Wandern (5,5%) ebenfalls Sportarten, die freizeitbezogen nicht unbedingt auf Vereinsangebote angewiesen sind, allerdings – mit Tennis und Kraftsport – sein könn(t)en.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 39
5,5
6,1
6,4
14,3
15
20,5
22,8
27,4
30,6
35
0 10 20 30 40
Wandern
Kraftsport
Tennis
Walking/ Nordic‐Walking
Fußball
Gymnastik
Fitness
Schwimmen
Radfahren
Laufen/Joggen
Welchen Sport üben Sie am häufigsten aus?‐ Angabe von bis zu drei Sportarten ‐
n=1754
%
Abb. 12: Die zehn am häufigsten genannten Sportarten, Mehrfachnennungen möglich
In Tab. 9 sind die prozentualen Anteile der Sportaktiven in Borken verteilt auf die Ränge 11 bis 37 abgebildet:
Tab. 9: Am häufigsten ausgeübte Sportarten in Borken – bis zu drei Nennungen möglich – ab Rang 11 (Sportaktive Bevölkerung; n=1754)
Sportart % Sportart %
11. Aquafitness 5,4 25. Golf 0,9
12. Inline/Rollsport 5,4 26. Ausdauersport 0,8
13. Reitsport 3,9 27. Angeln 0,7
14. Badminton 3,6 28. Leichtathletik 0,6
15. Tanzsport 3,6 29. Kegeln/Bowling 0,6
16. Tischtennis 2,7 30. Schach 0,5
17. Volleyball 2,7 31. Flugsport 0,3
18. Handball 2,4 32. Schießsport 0,3
19. Turnen 2,0 33. Squash 0,3
20. Basketball 1,9 34. Klettern 0,2
21. sonstiges 1,9 35. American Sports 0,1
22. Wassersport 1,8 36. Hockey 0,1
23. Kampfsport 1,5 37. Motorsport 0,1
24. Wintersport 1,3
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 40
Betrachtet man nun die Rangliste der Erstportarten – also die Sportaktivität, die von den Befragten am häufigsten ausgeübt wird – so zeigt sich ein ähnliches Bild wie bei der Gesamtübersicht. Hauptsportart Nummer 1 ist das Laufen/Joggen (13,8%), gefolgt von Fitness (12%) und Radfahren (11,4%). Auf den Plätzen vier, fünf und sechs folgen Fußball (10,1%), Gymnastik (9%) und Schwimmen (8,3%) (vgl. Tab. 10).
Tab. 10: Sportarten differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Top 20)
Erstsportart (n=1744)
% Zweitsportart (n=1420)
% Drittsportart (n=859)
%
1. Laufen/Joggen 13,8 1. Laufen/Joggen 17,1 1. Schwimmen 18,0 2. Fitness 12,0 2. Radfahren 14,7 2. Laufen/Joggen 15,4
3. Radfahren 11,4 3. Schwimmen 12,8 3. Radfahren 15,1
4. Fußball 10,1 4.
Gymnastik 9,6
4. Gymnastik 7,7 5. Gymnastik 9,0 Fitness 5. Fitness 6,3
6. Schwimmen 8,3 6. Walking/ Nordic-Walking 4,8 6.
Walking/ Nordic-Walking 5,5
7. Walking/ Nordic-Walking
7,8 7. Fußball 4,5 7. Wandern 4,0
8. Tennis 3,3 8. Inline/Rollsport 3,4 8. Kraftsport 3,6 9. Aquafitness 2,9 9. Kraftsport 3,1 9. Inline/Rollsport 3,2 10. Reitsport 2,5 10. Wandern 2,9 10. Fußball 2,5
11. Tischtennis 2,0 11.
Tennis 2,4
11. Tennis 2,4
12. Kraftsport
1,8 Aquafitness 12. Tanzsport 1,9
Handball 13. Badminton 1,8 13. Wintersport 1,9
14.
Badminton
1,4
14. Tanzsport 1,6 14. Badminton 1,6
Tanzsport 15. Reitsport 1,3 15. Wassersport 1,4
Volleyball
16.
Wassersport
0,8
16. Basketball 1,4
17. Turnen
1,2 Volleyball 17. Volleyball 1,4
Wandern Turnen 18. Aquafitness 1,3
19. Inline/Rollsport 1,1 19. Kampfsport 0,7 19. Tischtennis 0,8
20. Basketball 0,8 20.
Kegeln/Bowling 0,6 20.
Reitsport 0,7
Handball Angeln
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 41
3.3.1 Ausgeübte Sportarten nach Geschlecht Differenziert nach Geschlecht wird deutlich, dass die Top 5 der bevorzugten Sportarten der Frauen (gemessen am Indikator Häufigkeit), Laufen/Joggen, Schwimmen, Radfahren, Gymnastik und Fitness sind. Dem gegenüber ist das Ranking bei den Männern Laufen/Joggen, Radfahren, Fußball, Schwimmen und Fitness. Damit unterscheiden sich hier nur Fußball als dominanter Männersport und Gymnastik als typischer Frauensport, während die anderen Sportarten von beiden Geschlechtern häufig ausgeübt werden, wenn auch mit einer anderen Prioritätensetzung (vgl. Tab. 11).
Tab. 11: Am häufigsten ausgeübte Sportarten – bis zu drei Nennungen möglich – nach Geschlecht
Sportart
Frauen n=995
Männer n=747
Rang Anteil in
% Rang
Anteil in %
Laufen/Joggen 1. 30,4 1. 39,9
Schwimmen 2. 30,1 4. 24,6
Radfahren 3. 28,4 2. 33,0
Gymnastik 4. 28,0 6. 12,6
Fitness 5. 26,4 5. 19,0
Walking/Nordic-Walking 6. 22,5 9. 5,8
Aquafitness 7. 8,6 19. 2,1
Inline/Rollsport 8. 6,9 13. 3,9
Fußball 14. 3,6 3. 26,8
Tennis 12. 4,7 7. 8,2
Kraftsport 13. 4,5 8. 7,6
Wandern 11. 5,6 11. 5,4
Volleyball 15. 2,8 17. 2,5
Die Top 5 der am häufigsten ausgeübten Sportarten der befragten Männer und Frauen in Borken sind in der nachfolgenden Tab. 12 ersichtlich.
Tab. 12: Erstsportart – Top 5 Ranking nach Geschlecht
Sportarten weiblich (in %) Sportarten
männlich (in %)
Walking/Nordic-Walking 13,6 1. Fußball 17,8
Gymnastik 12,8 2. Laufen/Joggen 15,1
Laufen/Joggen 12,7 3. Radfahren 13,6
Fitness 12,3 4. Fitness 11,6
Schwimmen 9,7 5. Schwimmen 6,8
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 42
3.3.2 Ausgeübte Sportarten nach Alter Tab. 13 zeigt die altersspezifische Auswertung der betriebenen Sportarten (bis zu drei Nennungen) und veranschaulicht, dass Laufen/Joggen bei den 14 bis 49-Jährigen den größten Stellenwert in Borken hat. Mit zunehmendem Alter nimmt die Häufigkeit der Ausübung jedoch ab und wird durch Radfahren (50 bis 69-Jährige) respektive Gymnastik (70 bis 79-Jährige) als am häufigsten genannte Sportart ersetzt. Auch Fußball verliert mit zunehmendem Alter der Sportaktiven an Bedeutung und fällt von Platz 2 bei den 14 bis 29-Jährigen über Platz 5 bei den 30 bis 39-Jährigen stetig ab. Radfahren dagegen findet mit steigendem Alter mehr Zuspruch und klettert vom fünften Rang bis an die Spitzenposition, lediglich bei den ältesten Befragten ist ein Rückgang zu verzeichnen. Interessant ist, dass beim Schwimmen eine solche Tendenz nicht zu erkennen ist. Durch die Altersgruppen hinweg schwankt die Sportart zwischen den Rängen 2 und 5. Während die Jugendlichen eher traditionelle Vereinssportarten wie Fußball, Reitsport oder Handball bevorzugen, kommt im Segment der 20- bis 49-Jährigen vor allem dem Laufen/Joggen, dem Fitnesssport und dem Radfahren – und damit in hohem Maße individualisierte und auch informell zu betreibende Sportarten – ein besonders hoher Stellenwert zu. Dies ändert sich prinzipiell auch nicht für die älteren Sportaktiven, allerdings steigen hier Gymnastik und Schwimmen auf die Plätze 1 bzw. 2 (vgl. Tab. 14).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 43
Tab. 13: Am häufigsten ausgeübte Sportarten – bis zu drei Nennungen möglich differenziert nach Alter
14-19 Jahre
(n=181) %
20-29 Jahre
(n=246) %
30-39 Jahre
(n=242) %
40-49 Jahre
(n=454) %
50-59 Jahre
(n=307) %
60-69 Jahre
(n=244) %
70-79 Jahre (n=95)
%
1. Laufen/ Joggen
42,6 Laufen/ Joggen
50,0 Laufen/ Joggen
45,9 Laufen/ Joggen
40,6 Radfahren 38,4 Radfahren 40,0 Gymnastik 40,4
2. Fußball 37,5 Fußball 31,7 Schwimmen 36,6 Radfahren 37,1 Gymnastik 32,4 Gymnastik 33,3 Radfahren 38,6
3. Schwimmen 19,1 Schwimmen 31,1 Fitness 36,1 Fitness 27,3Laufen/ Joggen 28,5 Schwimmen 24,2 Schwimmen 32,6
4. Inline/ Rollsport
14,8 Fitness 28,2 Radfahren 24,4 Schwimmen 27,1Walking/ Nordic-Walking
25,2Walking/ Nordic-Walking
20,4Walking/ Nordic-Walking
23,4
5. Radfahren 13,6 Radfahren 18,5 Fußball 16,7 Gymnastik 21,4 Schwimmen 20,6 Laufen/ Joggen
16,3 Aquafitness 15,8
6. Reitsport 11,9 Kraftsport 12,1 Gymnastik 10,4Walking/ Nordic-Walking
17,7 Fitness 18,5 Tennis 15,5 Fitness 14,4
7. Fitness 10,8 Inline/ Rollsport
10,6 Kraftsport 8,4 Fußball 10,3 Wandern 8,5 Fitness 13,3 Tennis 8,2
8. Tennis 7,2 Gymnastik 6,1 Walking/ Nordic-Walking
6,8 Wandern 5,8 Fußball 6,4 Aquafitness 12,9 Laufen/Joggen 6,6
9. Badminton 6,7 Badminton 5,4 Inline/ Rollsport 5,0 Kraftsport 4,9 Tennis 6,4 Wandern 11,2 Wandern 5,6
10. Tanzsport 6,2 Tennis 5,1 Badminton 4,1 Inline/ Rollsport
4,7 Kraftsport 6,1 Fußball 4,1 Tischtennis 3,4
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 44
Tab. 14: Erstsportart – differenziert nach Alter
14-19 Jahre
(n=180) %
20-29 Jahre
(n=246) %
30-39 Jahre
(n=242) % 40-49 Jahre
(n=453) %
50-59 Jahre
(n=303) % 60-69 Jahre
(n=209) %
70-79 Jahre
(n=94) %
1. Fußball 27,2 Fußball 20,5 Fitness 23,4Laufen/ Joggen 20,1 Radfahren 16,6 Radfahren 20,7 Gymnastik 23,4
2. Reitsport 8,8 Fitness 15,8 Laufen/ Joggen
22,9 Fitness 12,2 Walking/ Nordic-Walking
15,4 Gymnastik 13,3 Schwimmen 19,2
3. Laufen/ Joggen 6,6
Laufen/ Joggen 13,6 Fußball 12,1 Radfahren 12,1
Laufen/ Joggen 14,1
Walking/ Nordic-Walking
10,5Walking/ Nordic-Walking
13,0
4. Handball 5,0 Schwimmen 7,3 Radfahren 8,2 Gymnastik 9,1 Gymnastik 12,8 Schwimmen 10,4 Radfahren 12,1
5. Schwimmen 5,0 Radfahren 5,0 Schwimmen 6,8 Walking/ Nordic-Walking
9,0 Fitness 8,7 Tennis 9,4 Fitness 8,0
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 45
3.3.3 Ausgeübte Sportarten nach Stadtteil Welche Sportarten in den einzelnen Stadtteilen am häufigsten betrieben werden, ist auf lokal unterschiedliche individuelle Präferenzen zurückzuführen, die etwa mit Faktoren wie der Sozial- oder Altersstruktur in Beziehung stehen. In starkem Maße beeinflusst werden die lokalen Präferenzen auch von der jeweiligen Angebotsstruktur. So steht beispielsweise der Anteil an Basketballspielern und -spielerinnen in engem Bezug zum Vorhandensein eines Basketballvereins und/oder von Basketballplätzen vor Ort. Die Existenz eines Fitnessstudios vor Ort eröffnet für viele Menschen erst die Möglichkeit, Fitnesssport zu betreiben; allerdings wird darüber hinaus sicherlich auch die ökonomische Lage ausschlaggebend sein, ob dieses Angebot – sofern es vorhanden ist – am Ende auch genutzt wird oder werden kann. Unter die Angebotsstruktur fallen weiterhin auch Sportgelegenheiten wie z.B. Parks, offene Gewässer und für Sport nutzbare Straßen, die etwa die Ausübung und den Aktivitätsgrad z.B. mit Blick auf Laufen/Jogging, Walking/Nordic Walking und Radfahren beeinflussen können. Eine Betrachtung der ortsbezogenen Verteilung der am häufigsten ausgeübten Sportarten kann also u.a. auch Hinweise darauf geben, welche Angebotsstruktur vorhanden ist, respektive wo eventuelle Schwächen der Angebotsstruktur liegen. Laufen/Joggen ist (mit einem Minimum von 26,1% in Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken und einem Maximum von 38,6% in Marbeck und Weseke) auch in dieser kleinräumlichen Betrachtungsweise die Sportart Nummer 1 bzw. 2 in den Stadtteilen; einzige Ausnahmen sind Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken, wo Schwimmen und Radfahren die vorderen Plätze belegen. Die drei genannten Sportarten sind dementsprechend auch die Beliebtesten der Borkener Bevölkerung; mit Ausnahme der Stadtteile Gemen / Gemenrückling / Gemenwirthe und Borkenwirthe / Burlo, wo Gymnastik auf Platz 2 (26,2%) resp. auf Platz 3 (26,5%) rangiert. Fitness folgt in allen Stadtteilen auf dem vierten oder fünften Platz (mit einem Minimum von 19,9% in Weseke und einem Maximum von 24,4% in Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken) gefolgt von Gymnastik (mit einem Minimum von 16,2% in Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken und einem Maximum von 26,5% in Borkenwirthe / Burlo) und Fußball (mit einem Minimum von 13,7% in Borken und einem Maximum von 21,1% in Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken). Nordic Walking belegt in allen Stadtteilen im Ranking die Plätze 6 oder 7 und wird im Schnitt von 12,4 Prozent (Borken) bis 19,9 Prozent (Borkenwirthe / Burlo) als Sportaktivität unter den drei Erstsportarten benannt. Die Sportarten Aquafitness, Reitsport, Volleyball, Wandern, Tennis, Kraftsport und Inline-Skating/Rollsport bilden die Schlusslichter der Top 10 im Ranking der häufigsten Erst-, Zweit- und Drittsportarten. Die genaue Differenzierung und Verteilung auf die einzelnen Stadtteile kann Tab. 15 entnommen werden. Die Top 5 der am häufigsten betriebenen Erstsportarten können differenziert nach den einzelnen Stadtgebieten in Tab. 16 abgelesen werden.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 46
Tab. 15: Am häufigsten ausgeübte Sportarten nach Stadtteil – bis zu drei Nennungen möglich
Borken (n=663)
% Borkenwirthe/
Burlo (n=168)
%
Gemen/ Gemenrückling/
Gemenwirthe (n=294)
%
Grütlohn/ Hoxfeld/
Rhedebrügge/ Westenborken
(n=207)
% Marbeck (n=185)
% Weseke (n=216)
%
1. Laufen/ Joggen 37,2 Radfahren 32,0 Laufen/
Joggen 31,7 Schwimmen 28,6 Laufen/ Joggen 38,6 Laufen/
Joggen 38,6
2. Radfahren 32,3 Laufen/ Joggen 29,4 Gymnastik 26,2 Radfahren 28,6 Radfahren 33,8 Radfahren 33,8
3. Schwimmen 28,3 Gymnastik 26,5 Schwimmen 25,2 Laufen/ Joggen 26,1 Schwimmen 26,1 Schwimmen 28,9
4. Fitness 24,2 Schwimmen 26,2 Radfahren 23,7 Fitness 24,4 Fitness 22,8 Fitness 19,9
5. Gymnastik 18,7 Fitness 21,8 Fitness 21,1 Fußball 21,1 Fußball 18,2 Fußball 18,6
6. Fußball 13,7 Walking/ Nordic- Walking
19,9 Walking/ Nordic- Walking
17,5 Gymnastik 16,2 Gymnastik 17,8 Gymnastik 16,3
7. Walking/ Nordic- Walking
12,4 Fußball 14,0 Fußball 14,3 Walking/ Nordic- Walking
13,3 Walking/ Nordic-Walking 14,9
Walking/ Nordic-Walking
12,9
8. Tennis 6,2 Aquafitness 10,2 Tennis 6,8 Reitsport 7,2 Tennis 10,2 Tennis 7,2
9. Wandern 5,7 Kraftsport 9,4 Aqua- fitness 6,7 Aquafitness 7,2 Aquafitness 7,8 Kraftsport 7,0
10. Kraftsport 5,4 Volleyball 6,1 Kraftsport 6,2 Wandern 6,7 Reitsport 7,1 Inline/ Rollsport 6,4
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 47
Tab. 16: Erstsport – differenziert nach Stadtteil
Borken (n=661)
% Borkenwirthe/
Burlo (n=168)
%
Gemen/ Gemenrückling/
Gemenwirthe (n=292)
%
Grütlohn/ Hoxfeld/
Rhedebrügge/ Westenborken
(n=206)
% Marbeck (n=182)
% Weseke (n=214)
%
1. Laufen/ Joggen
15,6 Walking/ Nordic-Walking
13,0 Laufen/Joggen 13,8 Fußball 16,8 Fußball 15,7 Radfahren 15,2
2. Fitness 13,4 Radfahren 13,0 Gymnastik 10,7 Fitness 12,7 Radfahren 13,6 Fußball 14,1
3. Radfahren 12,1 Laufen/Joggen 10,6 Walking/ Nordic-Walking 9,8 Radfahren 11,4 Fitness 13,6 Schwimmen 12,3
4. Schwimmen 9,0 Fitness 10,5 Fußball 9,8 Gymnastik 9,4 Laufen/ Joggen 12,6
Laufen/ Joggen 11,9
5. Gymnastik 8,8 Gymnastik 10,1 Fitness 9,7 Laufen/ Joggen
9,1 Gymnastik 8,8 Fitness 9,8
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 48
3.4 Häufigkeit und Intensität der Sportausübung
Mit Blick auf die Häufigkeit des Sporttreibens im Monatsverlauf wird folgendes Bild deutlich: Die Mehrheit der befragten sportaktiven Sportlerinnen und Sportler (25,3%) übt ihre Sportart 16- bis 20-mal pro Monat aus. Lediglich 1,4 Prozent der Sportaktiven betreiben ihren Sport eher unregelmäßig, d.h. weniger als sechs Mal pro Monat, und am oberen Ende geben 18,4 Prozent der Aktiven an, mehr als 30-mal pro Monat Sport zu treiben (vgl. Abb. 13). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass in die Sportaktivitäten auch „Spazieren gehen“ oder „mit dem Hund spazieren gehen“ eingeflossen sind und somit Angaben, die das Bild etwas verzerren. Heruntergebrochen auf die Stundenkontingente des Sportengagements wird deutlich, dass sich der zeitliche Aufwand pro Monat vor allem auf den Zeitkorridor von etwa 10 bis 25 Stunden beläuft. Immerhin 10,7 Prozent der Aktiven geben allerdings an, dass sie über 40 Stunden pro Monat sportlich aktiv sind (vgl. Abb. 14).
18,4
7,4
11,2
25,3
22,1
14,4
1,4
0 5 10 15 20 25 30
über 30 mal
26 bis 30 mal
21 bis 25 mal
16 bis 20 mal
11 bis 15 mal
6 bis 10 mal
bis 5 mal
Häufigkeit der Sportausübung pro Monat‐ gesamt ‐
n = 1750
%
Abb. 13: Häufigkeit der Sportausübung/Monat – gesamt
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 49
10,7
5,2
7,8
10,2
15,9
15,8
20,7
12,3
1,9
0 5 10 15 20 25
über 40h
35,1 bis 40h
30,1 bis 35h
25,1 bis 30h
20,1 bis 25h
15,1 bis 20h
10,1 bis 15h
5,1 bis 10h
bis zu 5h
Zeitlicher Umfang der Sportaktivität pro Monat‐ gesamt ‐
n = 1751
%
Abb. 14: Zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten/Monat – gesamt
Das Ranking der häufigsten Sportarten muss allerdings, wie in der nachfolgenden Tabelle zum zeitlichen Aufwand ersichtlich, z.T. dahingehend relativiert werden, dass die häufigsten Sportarten vom Zeitaufwand nicht unbedingt auch diejenigen sind, in die von der Borkener Bevölkerung das größte zeitliche Engagement – gemessen am Indikator Häufigkeit pro Woche, Minute pro Einheit und Dauer pro Woche in Stunden – gesteckt wird. Deutlich wird dies z.B. am Schwimm- und Laufsport, die im Ranking oben einen sehr hohen Stellenwert einnehmen, aber im Schnitt nur 1-mal pro Woche mit einem durchschnittlichen Stundenaufkommen von 1 h/Woche betrieben wird. Umgekehrt wird in das Wandern und in den Fußball, die beide von eher nicht so vielen Menschen als Hauptsport oder häufigste Sportarten ausgeübt werden, viel Zeit investiert: Gewandert wird 2 bis 3-mal pro Woche mit einem durchschnittlichen Stundenaufkommen von über 3 Stunden pro Woche, Fußball wird im Schnitt ebenfalls über zweimal pro Woche ausgeübt, mit einem Stundenaufkommen von über 3 Stunden pro Woche (vgl. Tab. 17).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 50
Tab. 17: Sportarten nach Dauer/Häufigkeit pro Monat
Sportarten Häufigkeit pro Monat
Minuten je Einheit
Dauer pro Monat in Stunden
n
Radfahren 11,20 77,68 14,51 527 Schwimmen 4,62 62,03 4,77 477 Laufen/Joggen 5,60 47,47 4,43 605 Fußball 8,47 89,66 12,65 249 Fitness 5,51 64,95 5,96 421 Gymnastik 6,01 60,11 6,03 367 Walking / Nordic-Walking
8,21 59,58 8,15 271
Tennis 5,29 89,90 7,92 108 Inline-Skating 4,18 70,06 4,88 101 Wandern 8,25 92,34 12,69 104
3.4.1 Häufigkeit und Intensität nach Geschlecht Während weibliche Befragte angaben, nur minimal weniger Sport in ihrer Freizeit zu treiben als männliche Befragte, ist der Unterschied in der Intensität relativ deutlich. Demnach treiben Männer über zwei Stunden mehr Sport pro Monat als die befragten Frauen (vgl. Tab. 18).
Tab. 18: Häufigkeit und zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten pro Monat – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte
Geschlecht Häufigkeit pro Monat
Dauer pro Monat in Stunden
weiblich 7,15 7,69 männlich 7,32 9,89
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 51
3.4.2 Häufigkeit und Intensität nach Alter Betrachtet man die Häufigkeit der Sportausübung pro Monat, so stechen vor allem die älteren Gruppen heraus. Die Gruppe der 60 bis 69-Jährigen betreibt demnach mit einer Häufigkeit von 8,19 deutlich am meisten Sport. Auch die Gruppe der 70 bis 79-Jährigen weist mit einer durchschnittlichen Häufigkeit von 7,23 eine hohe Sportaktivität auf. Die 30 bis 39-Jährigen treiben im Schnitt 4,28-mal und damit am seltensten im Monat Sport. Ein ganz ähnliches Bild zeichnet sich bezüglich des zeitlichen Umfangs des Sporttreibens ab. Auch hier sind es die 60 bis 69-Jährigen (11,00 Stunden/Monat) und die 70 bis 79-Jährigen (9,08 Stunden/Monat), welche die meiste Zeit pro Monat für ihre Sportaktivität aufwenden. Auch hier sticht die Gruppe der 30 bis 39-Jährigen mit einer durchschnittlichen Intensität von 4,44 Stunden pro Monat als Schlusslicht heraus (vgl. Tab. 19). Mindestens bedenklich ist allerdings die Sportaktivität der Jugendlichen zwischen 14 und 19 Jahren, die sowohl bei der Häufigkeit (5,56-mal) als auch bei der Dauer der Sportaktivität pro Monat (6,37 Stunden) den vorletzten Platz belegen (vgl. Tab. 19).
Tab. 19: Häufigkeit und zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten pro Monat – differenziert nach Alter, Mittelwerte
Alter Häufigkeit pro
Monat Dauer pro Monat in
Stunden
14-19 Jahre 5,56 6,37
20-29 Jahre 6,74 8,29 30-39 Jahre 4,28 4,44
40-49 Jahre 6,85 7,91
50-59 Jahre 7,57 8,72
60-69 Jahre 8,19 11,00
70-79 Jahre 7,23 9,08
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 52
3.4.3 Häufigkeit und Intensität nach Stadtteil Eine Betrachtung der Häufigkeit der Sportaktivität auf Stadtteilebene zeigt, dass die Befragten im Schnitt in Borkenwirthe / Burlo (7,75-mal) und Weseke (7,54-mal) am häufigsten Sport pro Monat betreiben. Ähnlich ist es bei der Dauer der Sportaktivität pro Monat. Mit 9,09 Stunden pro Monat wenden die Befragten aus Borken die meiste Zeit für Sport auf. Der Abstand zum Schlusslicht Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken liegt hier bei rund 1,5 Stunden pro Monat (vgl. Tab. 20).
Tab. 20: Häufigkeit und zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten pro Monat – differenziert nach Stadtteil, Mittelwerte
Stadtteil Häufigkeit pro Monat
Dauer pro Monat in Stunden
Borken 7,33 9,09
Borkenwirthe/ Burlo 7,75 8,67
Gemen/ Gemenrückling/ Gemenwirthe
6,74 8,36
Grütlohn/Hoxfeld/ Rhedebrügge/ Westenborken
6,91 7,63
Marbeck 7,22 8,19
Weseke 7,54 8,81
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 53
3.6 Organisationsform der Sportausübung
Die Ergebnisse zu den Organisationsformen der Sportausübung (vgl. Abb. 15) unterstreichen, was für die Sportausübung in Borken generell gilt: Es herrscht eine große Beliebtheit vor, Sport- und Bewegungsaktivitäten zeitlich wie räumlich flexibel zu gestalten. Bevorzugt werden daher eher „informell“ organisierbare Sportarten, die auch ohne die Mithilfe von Organisationen, wie z.B. Vereinen, betrieben werden können. In Borken geben 72,8 Prozent der Sportaktiven an, mindestens eine Sportaktivität selbständig oder mit Freunden, Verwandten und Bekannten zu betreiben. Der Prozentsatz derjenigen Sportaktiven, die mindestens eine ihrer Sportarten im Verein ausüben, liegt bei 48,3 Prozent. Mindestens eine der ausgeübten Sportarten betreiben 23,2 Prozent der Sportaktiven in kommerziellen Einrichtungen (Fitness-Studios etc.). Weitere wichtige Sportanbieter sind die öffentlichen/gemeinnützigen Träger (z.B. VHS). Hier betreiben 13,8 Prozent der Sportaktiven mindestens eine ihrer Sportaktivitäten.
12,3
1,6
2,3
13,8
23,2
48,3
72,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Sonstige
Schule
Betrieb/Firma/Dienststelle
öffentliche/gemeinnützige Träger
kommerzielle Einrichtung
Sportverein
Selbst organisiert/Freunde/Bekannte
Wer organisiert Ihre Sportaktivität in der Regel?
‐ Gesamt, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1760
%
Abb. 15: Organisationsformen der Sportausübung – gesamt
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 54
3.6.1 Organisationsformen differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart Sowohl Erst-, Zweit- als auch Drittsportart werden überwiegend selbstorganisiert und/oder mit Freunden/Bekannten ausgeübt, wobei die Selbstorganisation der Sportausübung insbesondere mit der zweiten (57,9%) und dritten Sportart (61,9%) deutlich ansteigt (Erstsportart 44,6%). Dem gegenüber fällt vor allem der Anteil der Sportvereine, welche in der Hauptsportart noch 38,1 Prozent der Sportaktiven an sich binden können, in der Zweit- (19,5%) und Drittsportart (12,6%) stark ab. Bei den kommerziellen Einrichtungen ist diesbezüglich insgesamt ebenfalls eine leichte Abnahme festzustellen. Während der Anteil der bei der Erstsportart noch bei 12,2 Prozent und bei der Zweitsportart nahezu unverändert bei 12,3 Prozent liegt, wird die Drittsportart von nur noch 11,7 Prozent der Sportaktiven in einer kommerziellen Einrichtung betrieben. Es scheint, als können die öffentlichen/ gemeinnützigen Träger die Sportaktiven sowohl über die Erst-, Zweit- als auch die Drittsportart an sich binden. Die anderen Einrichtungen spielen durchweg eine eher untergeordnete Rolle, wobei die Bedeutung des Betriebssports von Erst- zu Drittsportart leicht zunimmt (vgl. Tab. 21).
Tab. 21: Organisationsform – differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Mehrfachnennungen möglich)
Erstsportart
(in %) n=1690
Zweitsportart (in %) n=1361
Drittsportart (in %) n=815
Sportverein 38,1 19,5 12,6 kommerzielle Einrichtung (z.B. Fitness-Studio)
12,2 12,3 11,7
Selbst, Freunde, Familienangehörige oder Bekannte (gesamt)
44,6 57,9 61,9
…auf frei zugänglichen Anlagen, Orten (z.B. Park, Wege, Bolzplatz) 35,6 44,9 45,0
…auf gemieteten Anlagen (z.B. Tennishalle, Schwimmbad, Kletterhalle) 11,5 17,0 21,2
Betrieb / Firma / Dienststelle 0,6 1,1 2,7 Schule (z.B. Schulsport AGs) 1,0 0,8 0,8 öffentliche/gemeinnützige Träger (z.B. Volkshochschule, Familienbildungsstätten oder Krankenkassen)
7,3 7,2 7,1
Sonstige 6,6 7,2 7,8
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 55
3.6.2 Organisationsform nach Geschlecht Betrachtet man die Daten differenziert nach Geschlecht (vgl. Tab. 22), so zeigt sich, dass Männer ihren Sport häufiger im Sportverein ausüben als Frauen: 55,1 Prozent der sportaktiven Männer geben an, mindestens eine ihrer Sportarten im Verein zu betreiben; dem gegenüber sind nur 41,8 Prozent der Frauen Vereinsaktive. Auch betreiben Männer (26,4%) ihren Sport häufiger in kommerziellen Einrichtungen als Frauen (19,8%). Das gegenteilige Bild zeigt sich bei den öffentlichen/gemeinnützigen Trägern: Diese dienen 20,8 Prozent der Frauen für ihre sportlichen Aktivitäten, bei den Männern beläuft sich der entsprechende Anteil auf nur 6,7 Prozent. Der selbstorganisierte und/oder mit Freunden/ Bekannten ausgeübte Sport dagegen ist bei Frauen (73,7%) und Männern (72,1%) von ähnlich hoher Relevanz.
Tab. 22: Organisationsform – differenziert nach Geschlecht (Mehrfachnennungen möglich)
weiblich (in %) n=996
männlich (in %) n=752
Sportverein 41,8 55,1 kommerzielle Einrichtung (z.B. Fitness-Studio)
19,8 26,4
Selbst, Freunde, Familienangehörige oder Bekannte (gesamt) 73,7 72,1
…auf frei zugänglichen Anlagen, Orten (z.B. Park, Wege, Bolzplatz) 62,4 63,6
…auf gemieteten Anlagen (z.B. Tennishalle, Schwimmbad, Kletterhalle)
31,9 31,4
Betrieb / Firma / Dienststelle 1,1 3,4 Schule (z.B. Schulsport AGs) 1,4 1,9 öffentliche/gemeinnützige Träger (z.B. Volkshochschule, Familienbildungsstätten oder Krankenkassen)
20,8 6,7
Sonstige 12,9 11,7
3.6.3 Organisationsform nach Alter Unabhängig von den Altersgruppen zeigt sich ein eindeutiger Trend, dass das selbstorganisierte Sporttreiben die häufigste Organisationsform darstellt, wobei bei den 20 bis 29-Jährigen mit 80,9 Prozent der Spitzenwert erreicht wird (vgl. Tab. 23). Auffallend ist weiterhin, dass im Jugendalter rund 73,4 Prozent Sport in Vereinen ausüben, dieser Wert bei den 20 bis 29-Jährigen auf 51,2 Prozent abfällt und sich dann bei den 30 bis 79-Jährigen auf Werte zwischen 42,1 und 47 Prozent einpendelt. Kommerzielle Einrichtungen scheinen vor allem für die 20 bis 39-Jährigen interessant zu sein (26,6% bis 33%), aber auch ca. 23 Prozent der 40 bis 59 Jährigen nutzen dieses Sportangebot vermehrt. Grundsätzlich scheinen die öffentlichen/gemeinnützigen Träger für ältere Menschen attraktiver zu sein als für jüngere, wobei hier leichte Schwankungen festzustellen sind.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 56
Tab. 23: Organisationsform – differenziert nach Alter (Mehrfachnennungen möglich)
14-19 Jahre
(in %) n=181
20-29 Jahre (in %) n=246
30-39 Jahre (in %) n=242
40-49 Jahre(in %) n=454
50-59 Jahre (in %) n=309
60-69 Jahre(in %) n=213
70-79 Jahre (in %) n=98
Sportverein 73,4 51,2 42,1 46,1 42,8 47,0 44,0 kommerzielle Einrichtung (z.B. Fitness-Studio) 15,4 26,6 33,0 22,4 23,2 19,0 17,0
Selbst, Freunde, Familienangehörige oder Bekannte (gesamt)
68,5 80,9 76,1 77,0 70,9 71,1 54,1
…auf frei zugänglichen Anlagen, Orten (z.B. Park, Wege, Bolzplatz) 63,0 69,2 69,2 70,0 61,4 54,5 36,2
…auf gemieteten Anlagen (z.B. Tennishalle, Schwimmbad, Kletterhalle) 23,9 41,2 38,3 27,2 26,1 31,9 33,7
Betrieb / Firma / Dienststelle 0 3,3 4,4 3,6 1,1 1,2 0 Schule (z.B. Schulsport AGs) 13,0 0,3 0 0,2 0,1 0,9 0,9 öffentliche/gemeinnützige Träger (z.B. Volkshochschule, Familienbildungsstätten oder Krankenkassen)
3,4 6,5 16,0 14,2 18,8 19,1 17,6
Sonstige 11,2 13,7 14,1 11,8 11,5 9,2 15,1
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 57
3.6.4 Organisationsform nach Stadtteil Betrachtet man die Daten zur Organisationsform differenziert nach Stadtteilen (vgl. Tab. 24), so wird deutlich, dass, obwohl der selbstorganisierte Sport in allen Stadtteilen am meisten betrieben wird, Unterschiede verzeichnet werden können: So weisen Gemen / Gemenrückling / Gemenwirthe und Grütlohn / Hoxfeld /, Rhedebrügge / Westenborken relativ gesehen geringere Anteile in der Selbstorganisation auf, wohingegen Marbeck mit 83,5 Prozent den mit deutlichem Abstand höchsten Wert erzielt. Mit 52,2 Prozent respektive 51,6 Prozent weisen Gemen / Gemenrückling / Gemenwirthe und Marbeck die höchsten Aktivitätsgrade in Sportvereinen auf. Der Minimalwert in dieser Kategorie liegt in Borkenwirthe / Burlo mit 41,9%. Borken (48,0%), Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken (47,9%) und Weseke (47,6%) liegen eng beieinander dazwischen.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 58
Tab. 24: Organisationsform der Sportausübung – differenziert nach Stadtteil (Mehrfachnennungen möglich)
Borken (n=655)
in %
Borkenwirthe/Burlo
(n=169) in %
Gemen/ Gemenrückling/
Gemenwirthe (n=295)
in %
Grütlohn/Hoxfeld/ Rhedebrügge/ Westenborken
(n=208) in %
Marbeck (n=186)
in %
Weseke (n=216)
in %
Sportverein 48,0 41,9 52,2 47,9 51,6 47,6 kommerzielle Einrichtung (z.B. Fitness-Studio) 23,4 23,6 24,4 22 20,5 20,3
Selbst, Freunde, Familienangehörige oder Bekannte (gesamt) 73,1 73,6 69,8 68,8 83,5 74,1
…auf frei zugänglichen Anlagen, Orten (z.B. Park, Wege, Bolzplatz)
62,8 66,4 57,9 62,3 71,6 64,4
…auf gemieteten Anlagen (z.B. Tennishalle, Schwimmbad,
Kletterhalle) 32,5 27,2 29,8 29,9 40,6 30,3
Betrieb / Firma / Dienststelle 2,4 2,5 2,4 3,4 2,3 1,2 Schule (z.B. Schulsport AGs) 1,0 4,1 1,7 3,5 2,3 1,3 öffentliche/gemeinnützige Träger (z.B. Volkshochschule, Familienbildungsstätten oder Krankenkassen)
11,7 23,2 13,5 10,5 11,3 17,4
Sonstige 12,3 11,1 15,1 12,4 11,4 10,2
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 59
3.7 Zeitliche Verteilung der Sportaktivität auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen
Fragt man die Sportaktiven danach, zu welchen zeitlichen Anteilen sie ihren Sport in den verschiedenen Angebots- und Organisationsformen betreiben, zeigt sich folgendes Bild. Fast die Hälfte der Zeit wird laut Auskunft der Befragten der Sport privat, informell und somit unorganisiert betrieben (45,8%). Nahezu ein Drittel (31,8%) der Zeit wird im Sportverein aktiver Sport betrieben. Die restliche Zeit teilt sich auf kommerzielle und sonstige Anbieter auf (14,1% resp. 8,3%) (vgl. Abb. 16).
31,8%
14,1%
45,8%
8,3%
Aufteilung der gesamten Sportaktivität auf die verschiedenen Angebots‐ und
Organisationsformen
Sportverein
kommerzieller Anbieter
privat, unorganisiert
Sonstiges
n = 1679
Abb. 16: Nutzung der verschiedenen Organisations- und Angebotsformen
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 60
3.7.1 Verteilung der gesamten Sportaktivität nach Geschlecht Bei geschlechtsdifferenzierter Betrachtung fällt auf, dass Männer und Frauen gleichermaßen die meisten Anteile ihrer sportaktiven Zeit auf informelles Sporttreiben, das privat organisiert wird, verwenden, wobei Frauen diesem einen höheren Anteil beimessen. Männer verwenden weiterhin eher als Frauen höhere Zeitkontingente auf Vereinssport. Bei kommerziellen Sportangeboten liegen beide Geschlechter gleich auf (vgl. Tab. 25).
Tab. 25: Zeitliche Verteilung der gesamten Sportaktivität (100%) auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen – differenziert nach Geschlecht
Geschlecht Verein (in %)
komm. Anbieter (in %)
privat (in %)
sonstiges (in %)
weiblich (n=933) 27,0 13,7 47,5 11,8 männlich (n=736) 37,8 14,5 44,0 3,7
3.7.2 Verteilung der gesamten Sportaktivität nach Alter Die Jugendlichen zwischen 14-19 Jahren nutzen die meiste ihrer sportaktiven Zeit für den Vereinssport, gefolgt von informellen Sportengagements und weitab kommerziellen Sportanbietern. Die Aktiven aller anderen befragten Altersgruppen verwenden hingegen die meisten Anteile ihrer sportaktiven Zeit für privat organisiertes Sporttreiben (vgl. Tab. 26).
Tab. 26: Zeitliche Verteilung der gesamten Sportaktivität (100%) auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen – differenziert nach Alter
Alter Verein (in %)
komm. Anbieter (in %)
privat (in %)
sonstiges (in %)
14-19 Jahre (n=171) 59,3 8,9 30,3 1,5
20-29 Jahre (n=239) 36,0 18,1 40,8 5,1
30-39 Jahre (n=238) 26,1 15,5 46,3 12,1 40-49 Jahre (n=438) 25,6 15,3 49,7 9,4
50-59 Jahre (n=291) 27,6 12,2 51,2 9,0
60-69 Jahre (n=202) 30,3 12,0 48,6 9,1 70-79 Jahre (n=85) 31,0 14,6 45,4 9,0
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 61
3.7.3 Verteilung der gesamten Sportaktivität nach Stadtteil Differenziert nach den sechs Stadtteilen zeigt sich ein ähnliches Bild. Die meiste sportaktive Zeit wird für das informelle Sportengagement aufgewandt, wobei die Sportvereine vergleichbar hohe Werte erzielen; einzige Ausnahme bildet Borkenwirthe / Burlo mit lediglich 25,1 Prozent. Kommerzielle wie auch sonstige Anbieter spielen nur eine untergeordnete Rolle (vgl. Tab. 27).
Tab. 27: Zeitliche Verteilung der gesamten Sportaktivität (100%) auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen – differenziert nach Stadtteil
Stadtteile Verein (in %)
komm. Anbieter (in %)
privat (in %)
sonstiges (in %)
Borken (n=641) 31,7 14,5 47,3 6,5 Borkenwirthe, Burlo (n=158) 25,1 15,5 44,2 15,2
Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe (n=285)
35,7 14,5 42,6 7,2
Grütlohn, Hoxfeld, Rhedebrügge, Westenborken (n=192)
33,1 14,7 45,5 6,7
Marbeck (n=179) 32,0 13,0 47,0 8,0 Weseke (n=205) 30,8 10,2 48,1 10,9
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 62
3.8 Breiten-, Leistungs-/Wettkampf- oder Hochleistungssport
Die meisten befragten aktiven Sportlerinnen und Sportler ordnen die Ausrichtung ihrer sportlichen Aktivitäten im Bereich des Breitensports ein. 17,9 Prozent betreiben ihre Hauptsportart als Leistungs- und Wettkampfsport, 2,4 Prozent ordnen sie dem Hochleistungssport zu (vgl. Abb. 17). In diesem Kontext muss allerdings berücksichtigt werden, dass es möglicherweise unterschiedliche Auffassungen von Breiten-, Leistungs-/Wettkampf- und Hochleistungssport gegeben hat.
79,8%
17,9%
2,4%
Welchem der folgenden Bereiche würde Sie Ihre Aktivität im Wesentlichen
zuordnen?‐ Gesamt, Mehrfachnennung möglich ‐
Breitensport
Leistungs‐/ Wettkampfsport
Hochleistungs‐sport
n = 1711
Abb. 17: Einordnung der Sportaktivitäten nach Aktivitätsbereich
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 63
Differenziert man den Breitensport weiter nach den Dimensionen Freizeitsport, Fitness-Sport, Gesundheitssport, Funsport, Wellness-/Erholungssport und Erlebnis-/Abenteuersport, so nimmt der Freizeitsport (52,8%) im Kontext von Erst-, Zweit- und Drittsportart den größten Raum ein. Dieser wird gefolgt vom Fitnesssport (45,8%) und Gesundheitssport (44,4%) (vgl. Abb. 18).
2
2,9
7,6
7,7
44,4
45,8
52,8
0 10 20 30 40 50 60
sonstiges
Erlebnissport/Abenteuersport
Wellness/Erholung
Funsport
Gesundheitssport
Fitness‐Sport
Freizeitsport
Falls Breitensport, welchem der folgenden Bereiche würde Sie Ihre Aktivität im
Wesentlichen zuordnen?‐ Gesamt, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1387
%
Abb. 18: Bereiche des Breitensports
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 64
3.9 Orte der Sportausübung
Die Frage nach dem Ort der sportlichen Aktivitätsausübung liefert weitere essentielle Grundlagendaten für die Entwicklungsplanung des Borkener Sports. Die Datenlagen können als Informations- und Planungsgrundlage für die Schaffung neuer bzw. beim Umbau vorhandener Sportmöglichkeiten dienen. Betrachtet man sämtliche genannten Sportaktivitäten in Erst-, Zweit- und Drittsportart, so zeigt sich für Borken, dass diese zu einem etwas größeren Anteil auf bzw. in Sportanlagen als auf Sportgelegenheiten (z.B. auf Feldern/Feldwegen, in Parks, auf Straßen) ausgeübt werden (vgl. Abb. 19).
53,7%
46,3%
Wo üben Sie diesen Sport hauptsächlich aus?
Sportanlage
Sportgelegenheit
n = 1760
Abb. 19: Orte des Sportengagements: Sportanlagen / Sportgelegenheiten
Bezogen auf die Nutzung von Sportgelegenheiten zeigt sich, dass 43,9 Prozent der Sportaktiven Straßen und/oder Wege zur Sportausübung nutzen (vgl. Abb. 20). Am zweithäufigsten werden Felder, Wald und/oder Wiesen genannt (36,2%) und an dritter Stelle folgen Parks (15,1%). Unter den Sportanlagen in Borken werden Turn- und Sporthallen mit 32,5 Prozent von den Sportlerinnen und Sportlern am häufigsten genutzt (vgl. Abb. 21). Danach folgen die Hallenbäder (25,1%), Fitnessstudios (17,1%) und auf Rang 4 Spielfelder und Sportplätze (13,7%).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 65
7,3
4,9
5
5,1
11,2
15,1
36,2
43,9
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
sonstiges
Bolzplatz
Gebirge/Berge
Offenes Gewässer
Zu Hause
Park
Feld, Wiese,Wald
Straße, Weg
Wo üben Sie diesen Sport hauptsächlich aus?
‐ Sportgelegenheiten, Gesamt, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1760
%
Abb. 20: Differenzierung der Sportgelegenheiten als Orte des Sportengagements
19,6
5,2
8,7
13,7
17,1
25,1
32,5
0 5 10 15 20 25 30 35
sonstiges
Tennisanlage/‐platz
Freibad
Spielfeld/Sportplatz
Fitness‐Studio
Hallenbad
Turn‐/Sporthalle
Wo üben Sie diesen Sport hauptsächlich aus?
‐ Sportanlagen, Gesamt, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1760
%
Abb. 21: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 66
Die Anfrage, wie die sportaktiven Menschen in Borken in der Regel zur Sportanlage oder Sportgelegenheit kommen, zeigt, dass die bevorzugten Transportmittel das Fahrrad (54,3%) und motorisiert Fahrzeuge (53,2%) sind. Rund jeder Dritte kommt zu Fuß zur meistgenutzten Sportanlage/-gelegenheit (vgl. Abb. 22).
1,3
2,1
38,5
53,2
54,3
0 10 20 30 40 50 60
sonstigesVerkehrsmittel
ÖffentlichesVerkehrsmittel
zu Fuß
Auto, Mofa,Motorrad
Fahrrad
Wie kommen Sie gewöhnlich zur meistgenutzten Sportanlage/‐gelegenheit?
‐ Gesamt, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1760
%
Abb. 22: Genutzte Verkehrsmittel zur Erreichung der meistgenutzten Sportanlagen/-gelegenheiten
45,5 Prozent der Befragten müssen nur einen Kilometer zur Sportstätte respektive Sportgelegenheit zurücklegen, 27,1 Prozent fahren einen bis drei Kilometer. 10,8 Prozent müssen eine Strecke von drei bis fünf und 3,5 Prozent von fünf bis sieben Kilometern zurücklegen, um Sport zu treiben. Lediglich 13,7 Prozent fahren mehr als sieben Kilometer, um ihren Sport ausüben zu können. Hier wird deutlich, dass die Sportgelegenheiten und Sportstätten sehr wohnraumnah gelegen sind und somit eine flächendeckende Angebotsverteilung in Borken vorliegt (vgl. Abb. 23).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 67
13,1
3,5
10,8
27,1
45,5
0 10 20 30 40 50
über 7 km
5,1‐7 km
3,1‐5 km
1,1‐3 km
bis 1 km
Entfernung zur meistgenutzten Sportanlage/‐gelegenheit?‐ einfache Strecke in Kilometer‐
n = 1710
%
Abb. 23: Entfernung zur meistgenutzten Sportanlage / Sportgelegenheit
3.9.1 Sportanlagen differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart Turn- und Sporthallen sind die Anlagen, die für die Erst- und Zweitsportart am häufigsten genutzt werden. Auch bei Ausübung der Drittsportart spielen sie noch eine wichtige Rolle, fallen aber auf den zweiten Rang zurück. Die Drittsportart wird am häufigsten in Hallenbädern ausgeübt, welche bei den Erstsportarten eine noch nicht so große Rolle spielt, bei der Zweitsportart aber bereits an Position zwei rangiert. Fitness-Studios werden für die Erst-, Zweit- und Drittsportart jeweils am dritthäufigsten als Orte der sportlichen Aktivität genutzt. Spielfelder und Sportplätze werden vor allem für die Hauptsportart genutzt, verlieren aber für die zwei anderen Sportarten an Bedeutung. Tennisplätze sind für alle drei Sportaktivitäten gering frequentierte Sportanlagen, während das Freibad bei der Drittsportart leicht an Bedeutung gewinnt (vgl. Abb. 24 bis Abb. 26).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 68
17,8
4,7
5
16,3
16,7
16,9
36,8
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
sonstiges
Tennisanlage/‐platz
Freibad
Hallenbad
Fitness‐Studio
Spielfeld/Sportplatz
Turn‐/Sporthalle
Wo üben Sie diesen Sport hauptsächlich aus?
‐ Sportanlagen, Erstsportart, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1744
%
Abb. 24: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements - Erstsportart
24,8
3,8
8,2
8,7
17,1
23,6
27,1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
sonstiges
Tennisanlage/‐platz
Freibad
Spielfeld/Sportplatz
Fitness‐Studio
Hallenbad
Turn‐/Sporthalle
Wo üben Sie diesen Sport hauptsächlich aus?
‐ Sportanlagen, Zweitsportart, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 1420
%
Abb. 25: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements - Zweitsportart
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 69
28,4
4,8
7,3
11,8
14
22,4
30
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
sonstiges
Tennisanlage/‐platz
Spielfeld/Sportplatz
Freibad
Fitness‐Studio
Turn‐/Sporthalle
Hallenbad
Wo üben Sie diesen Sport hauptsächlich aus?
‐ Sportanlagen, Drittsportart, Mehrfachnennung möglich ‐
n = 859
%
Abb. 26: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements - Drittsportart
3.9.2 Nutzung von Grünanlagen, Parks und Wäldern
3.9.2.1 Nutzungsverhalten
66,8 Prozent der Befragten geben an, dass Sie für ihre sportlichen Aktivitäten Grünanlagen, Parks und/oder Wälder nutzen (vgl. Abb. 27), wobei letzteres für Frauen (69,2%) etwas häufiger zutrifft als für Männer (63,7%). Bei den Altersklassen sind es vor allem die 40 bis 49-Jährigen (71,8%), welche Grünanlagen und Parks nutzen. Am seltensten trifft man dort auf die Gruppe der 70 bis 79-Jährigen (58,7%) und der 14 bis 19-Jährigen (58,8%) (vgl. Tab. 28). Die Bewohner der Stadtteile Gemen / Gemenrückling / Gemenwirthe (72,6%) nutzen diese Sportgelegenheiten dabei am häufigsten, dicht gefolgt von Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken (69,8%) und Borken (69,6%) (vgl. Tab. 29).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 70
33,2%
66,8%
Nutzen Sie Grünanlagen/Parks/Wälder für sportliche Aktivitäten?
Nein
Ja
n = 1728
Abb. 27: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten
Tab. 28: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten –differenziert nach Altersgruppen
Altersgruppe Ja
14-19 Jahre (n=177) 58,8%
20-29 Jahre (n=244) 67,2%
30-39 Jahre (n=239) 66,1%
40-49 Jahre (n=450) 71,8%
50-59 Jahre (n=301) 69,8%
60-69 Jahre (n=209) 63,2%
70-79 Jahre (n=93) 58,7%
Tab. 29: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten – differenziert nach Stadtteil
Stadtteile Ja
Borken (n=658) 69,6% Borkenwirthe, Burlo (n=166) 63,3% Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe (n=288)
72,6%
Grütlohn, Hoxfeld, Rhedebrügge, Westenborken (n=202)
69,8%
Marbeck (n=181) 64,6% Weseke (n=213) 54,5%
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 71
Betrachtet man die einzelnen Grünanlagen, Parks bzw. Wälder, so zeigt sich, dass rund 63 Prozent der Aktiven, die in Grünanlagen, Parks oder Wäldern ihrem Sport nachgehen, die Sportgelegenheit Pröbsting mindestens einmal im Monat aufsuchen. Durchschnittlich sind diese Aktiven vier Mal im Monat dort anzutreffen. Der Klosterbusch in Burlo liegt auf dem letzten Platz der beliebtesten Orte. Ihn nutzen 12,2% zum Sportreiben (vgl. Tab. 30).
Tab. 30: Nutzung und Nutzungshäufigkeit differenziert nach Sportgelegenheit (Sportaktive, die auf Grünanlagen, Parks und Wälder ihren Sport ausüben)
Nutzung
(Mehrfachnennungen möglich; n=1154)
-Nutzungshäufigkeit pro Monat
Pröbsting (Hoxfeld)(n=723) 62,7% 4,2
Sternbusch (Gemen)(n=416) 36,0% 3,9
Ehem. Bundeswehrgel. (Borken) (n=296) 25,6% 3,6
Stadtpark (Borken)(n=288) 24,9% 4,5
Galgenberg (Marbeck)(n=163) 14,1% 4,2
Klosterbusch (Burlo)(n=141) 12,2% 6,5
3.9.2.2 Bewertung der Grünanlagen, Parks und Wälder
Bei den Nutzern von Grünanlagen, Parks und Wäldern stehen die Aspekte Sicherheit, der Zustand des Wegesystems und eine gute Erreichbarkeit im Vordergrund ihres Interesses. Ruhe/kein Lärm und das Naturerlebnis folgen in der Wichtigkeit bei der Nutzung dieser Sportgelegenheiten. Eine Möglichkeit zum Walken / Nordic-Walken steht bei den Nutzern auf dem letzten Platz der Prioritätenliste. Betrachtet man die Zufriedenheit der Nutzer mit den einzelnen Aspekten, so ist diese bezüglich der Aspekte gute Erreichbarkeit, Naturerlebnis und Ruhe/kein Lärm am höchsten, gefolgt von den Möglichkeiten zum Joggen. Am unzufriedensten sind die Aktiven mit der Beleuchtungssituation, den Möglichkeiten zum Inline-Skaten, der Sicherheit und dem Zustand des Wegesystems (vgl. Tab. 31). Bringt man diese Ergebnisse in Bezug zur Wichtigkeit, zeigen sich vor allem zwei Handlungsprioritäten: Sicherheit und Zustand des Wegesystems. Hierbei zeigt die Erfahrung, dass oft schon mit einer besseren Beleuchtung der Wege das Sicherheitsempfinden verbessert wird. Die hohe Unzufriedenheit im Bereich der Möglichkeiten zum Inline-Skaten sollte unter dem Aspekt betrachtet werden, ob in Borken ausreichend geeignete Wege zur Ausübung des Sports vorhanden sind bzw. ob es ein Optimierungspotential bei der Beschilderung oder der Bekanntmachung geeigneter Strecken gibt. Betrachtet man die Anlagen im Detail, so zeigen sich im Wesentlichen vergleichbare Ergebnisse zum Gesamteindruck. Im Komplex Sicherheit/Beleuchtung sind die Nutzer der Sportgelegenheiten Galgenberg und Klosterbusch mit der Situation am wenigsten zufrieden. Letztere schneidet auch beim Zustand des Wegesystems am schlechtesten ab (vgl. Tab. 32).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 72
Tab. 31: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald – Gesamtauswertung (Mittelwerte)
Legende: Wichtigkeit (W): 2=absolut wichtig, -2=absolut unwichtig; Zufriedenheit (Z): 2=absolut zufrieden, -2=absolut unzufrieden
Gesamt Wichtigkeit Zufriedenheit
Zustand des Wegesystems 1,35
(n=1049) 0,83
(n=1029)
Sicherheit 1,37
(n=1024) 0,59
(n=992)
Beleuchtung 0,82
(n=991) 0,07
(n=956)
Möglichkeit zum Joggen 0,97
(n=976) 1,01
(n=926)
Mögl. zum Walking/ Nordic-Walking 0,42
(n=991) 0,88
(n=935)
Möglichkeit zum Radfahren 1,02
(n=1029) 0,90
(n=989)
Möglichkeit zum Inline-Skaten 0,62
(n=944) 0,15
(n=842)
Naturerlebnis 1,2
(n=1021) 1,24
(n=984)
Ruhe/kein Lärm 1,21
(n=1019) 1,16
(n=994)
Gute Erreichbarkeit 1,34
(n=1003) 1,34
(n=992)
Gesamtzufriedenheit - 1,02
(n=965)
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 73
Tab. 32: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald – Differenziert nach Sportgelegenheiten in den einzelnen Stadtteilen (Mittelwerte)
Legende: Wichtigkeit (W): 2=absolut wichtig, -2=absolut unwichtig; Zufriedenheit (Z): 2=absolut zufrieden, -2=absolut unzufrieden
Ehem. BW-
Gelände (n=93-111)
Galgenberg (n=66-76)
Klosterbusch (n=60-81)
Pröbsting (n=343-420)
Stadtpark (n=82-98)
Sternbusch (n=154-200)
W Z W Z W Z W Z W Z W Z Zustand des Wegesystems 0,98 0,79 1,17 0,62 1,30 0,44 1,46 1,05 1,37 1,16 1,41 0,50 Sicherheit 0,97 0,41 1,22 0,29 1,30 0,35 1,47 0,76 1,63 0,68 1,30 0,54 Beleuchtung 0,14 0,11 0,63 -0,28 0,79 -0,20 1,00 0,13 1,44 0,46 0,49 -0,04 Möglichkeit zum Joggen 0,89 1,15 1,17 0,74 1,03 0,83 0,99 1,15 0,71 0,79 1,04 0,99 Mögl. zum Walking/ Nordic-Walking 0,09 0,93 0,60 0,71 0,70 0,89 0,27 0,92 0,44 0,88 0,58 0,83 Möglichkeit zum Radfahren 0,58 0,73 1,01 0,86 1,10 0,60 1,04 1,03 1,35 1,11 0,95 0,68 Möglichkeit zum Inline-Skaten -1,05 -0,32 -0,33 0,06 -0,27 -0,47 -0,59 -0,12 0,18 0,33 -1,13 -0,40 Naturerlebnis 1,27 1,36 1,08 1,01 1,21 1,14 1,24 1,30 1,05 0,95 1,14 1,34 Ruhe/kein Lärm 1,30 1,32 1,12 0,96 1,26 1,00 1,25 1,19 0,91 0,82 1,18 1,32 Gute Erreichbarkeit 1,30 1,48 1,21 1,28 1,38 1,32 1,36 1,32 1,32 1,25 1,34 1,44
Gesamtzufriedenheit 1,00 0,93 0,90 1,12 0,99 0,97
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 74
3.9.3 Nutzung städtischer Turn- und Sporthallen
3.9.3.1 Nutzungsverhalten
In Borken geben 42,8 Prozent der sportlich aktiven Bevölkerung an, städtische Sport- und Turnhallen für die Ausübung ihrer sportlichen Aktivitäten zu nutzen (vgl. Abb. 28).
57,2%
42,8%
Nutzen Sie Sport‐ oder Turnhallen zum Sporttreiben?
Nein
Ja
n = 1693
Abb. 28: Nutzung von städtischen Turn- und Sporthallen für sportliche Aktivitäten
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 75
3.9.3.2 Bewertung städtischer Sport- und Turnhallen
In Abb. 29 ist dargestellt, wie die Sportaktiven die von ihnen genutzten Sport- und Turnhallen insgesamt bewerten. Dabei wird deutlich, dass die Nutzer bezüglich der Erreichbarkeit der Hallen die größte Zufriedenheit aufweisen. Auch scheinen die Sportstätten für die Ausübung der jeweiligen Sportart geeignet zu sein. Am geringsten ist die Zufriedenheit unter den Sportaktiven mit dem Zustand der Sanitäranlagen. Der Zustand der Umkleideräume sowie der allgemeine baulich Zustand werden ebenfalls bemängelt.
0,50
‐0,14
0,05
0,19
0,41
0,45
0,61
0,65
0,88
1,27
‐2 ‐1 0 1 2
Gesamtzufriedenheit
Zustand der Sanitäranlagen
Zustand der Umkleideräume
Bauzustand
Freundliche Atmosphäre
Ausreichende zeitliche Verfügbarkeit
Geräteausstattung
Sicherheit des Zugangs
Eignung zur Ausübung der Sportart
Erreichbarkeit
Städtische Sport‐ und TurnhallenBewertung der folgende Aspekte
‐Mittelwerte ‐
n = 610‐632absolut unzufrieden absolut zufrieden
Abb. 29: Bewertung städtischer Turn- und Sporthallen für sportliche Aktivitäten - Gesamtauswertung
Im Folgenden werden die Ergebnisse für alle Hallen kurz dargestellt, welche von mindestens zehn Nutzern bewertet wurden. Hier ist allerdings aufgrund der zum Teil recht geringen Zahl der Bewertungen zu beachten, dass die Ergebnisse zuerst einmal als Tendenz zu verstehen sind, welche wichtige Hinweise liefern, aber mit der Praxis abgeglichen werden sollten. SH Johann-Walling-Schule (vgl. Tab. 33) Die Nutzer sind vor allem mit der Erreichbarkeit der Halle zufrieden. Auch die Eignung für die Ausübung der jeweiligen Sportart sowie die ausreichende zeitliche Verfügbarkeit werden eher positiv bewertet. Am schlechtesten schneidet der Zustand der sanitären Anlagen und der Umkleiden ab.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 76
SH Remigiusschule (vgl. Tab. 33) Die Gesamtzufriedenheit ist im Vergleich zu den anderen Hallen eher hoch. Gleiches gilt für die Geräteausstattung. Die Rangfolge der Kategorien ähnelt den Bewertungen der anderen Hallen. SH Duesbergschule (vgl. Tab. 33) Hier fällt zunächst die negative Gesamtbewertung auf, welche zusätzlich zu den bei vielen Hallen negativen Aspekten (Sanitäranlagen, Umkleiden, baulicher Zustand) durch die negative Bewertung der Sicherheit des Zugangs und der Atmosphäre bedingt wird. SH Gymnasium Remigianum (vgl. Tab. 33) Auch hier kommt es durch die geringe Zufriedenheit mit der Sicherheit des Zugangs und mit der Atmosphäre zu einer negativen Gesamtbewertung. Die im Vergleich geringen Zufriedenheitsgrade mit der Erreichbarkeit und der zeitlichen Verfügbarkeit tragen ebenfalls dazu bei. Gymnastikhalle Gymnasium Remigianum (vgl. Tab. 33) Zwar wird auch hier die Sicherheit des Zugangs bemängelt, doch kommt es durch eine bessere zeitliche Verfügbarkeit und eine freundlichere Atmosphäre als in der anderen Halle des Gymnasiums Remigianum zu einer insgesamt knapp positiven Bewertung. Doppel-SH im Trier (vgl. Tab. 34) Die Umkleiden und die Sanitäranlagen werden auch hier nicht gut, aber etwas besser als in anderen Hallen bewertet. Auch die Sicherheit des Zugangs stellte die Nutzer zufriedener als in anderen Hallen. SH Mergelsberg (vgl. Tab. 34) Dies ist die Halle mit der deutlich größten Gesamtzufriedenheit der Nutzer. Im Vergleich zu den anderen Hallen sticht vor allem die Zufriedenheit mit den sanitären Anlagen, den Umkleiden und dem baulichen Zustand heraus. Relativ schlecht wird dagegen die zeitliche Verfügbarkeit bewertet. Dreifach-SH Berufskolleg (vgl. Tab. 34) Die Halle des Berufkollegs liegt in allen Kategorien mehr oder weniger im Mittelfeld und weist im Vergleich zu anderen Turn- und Sporthallen bezüglich der Nutzerzufriedenheit kaum Auffälligkeiten auf. Doppel-SH Burlo (vgl. Tab. 34) Hier weicht vor allem die Zufriedenheit mit der zeitlichen Verfügbarkeit vom Mittel aller Borkener Sporthallen ab. In den übrigen Kategorien bewegt sich die Nutzerzufriedenheit im Mittelfeld.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 77
SH Cordulaschule (vgl. Tab. 35) Die Nutzer sind vor allem mit der Erreichbarkeit sowie der Eignung der Halle für die Ausübung der eigenen Sportarten zufrieden. Mit Ausnahme der Geräteausstattung liegen die übrigen Werte alle über dem Mittel der bewerteten Sporthallen. SH Nünning (vgl. Tab. 35) Bei der Sporthalle Nünning sticht lediglich (wie bei den meisten anderen Hallen auch) die Erreichbarkeit hervor. Alle übrigen Werte bewegen sich um das Mittel aller Hallen bzw. liegen leicht darüber. TH Johannesschule (vgl. Tab. 35) Diese Halle wurde mit am schlechtesten bewertet. Dabei werden vor allem die äußeren Bedingungen wie Bauzustand sowie Zustand der Umkleideräume und Sanitäranlagen stark negativ beurteilt. Lediglich die Bewertung der ausreichenden zeitlichen Verfügbarkeit der Halle erlangt einen Wert über dem Mittel aller Hallen. SH Pröbstingschule (vgl. Tab. 35) In der Gesamtbetrachtung wurde diese Halle fast durchgehend leicht negativer als die anderen Hallen bewertet. Lediglich die ausreichende zeitliche Verfügbarkeit der Halle bildet hierbei eine marginale Ausnahme. Am negativsten fällt der Zustand der Sanitäranlagen auf. SH Engelradingschule (vgl. Tab. 36) Auch wenn die Gesamtzufriedenheit mit der Halle knapp unter dem Mittelwert aller Hallen bleibt, sticht hier vor allem die Erreichbarkeit hervor. In dieser Kategorie erlangt die Halle den absoluten Spitzenwert innerhalb der Erhebung. Der Zustand der Sanitäranlagen wird allerdings auch hier negativ bewertet. SH Roncallischule (vgl. Tab. 36) Hier wird abermals der Zustand der Umkleideräume und Sanitäranlagen von den Befragten bemängelt. Auch wenn die Erreichbarkeit äußerst positiv bewertet wird, bleibt die Bewertung der Gesamtzufriedenheit unter dem Mittel aller Hallen. SH Maria-Sibylla-Merian-Realschule (vgl. Tab. 36) Negative Werte erhält hier neben den Sanitäranlagen und der freundlichen Atmosphäre vor allem der Zustand der Umkleideräumlichkeiten. Allerdings liegen auch alle anderen Werte teilweise recht deutlich unter dem Mittelwert.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 78
Tab. 33: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden
SH Johann-
Walling-Schule(n=29-32)
SH Remigius-schule
(n=23-26)
SH Duesberg-schule (n=28)
SH Gymnasium Remigianum (n=30-32)
GH Gymnasium Remigianum
(n=14) Sicherheit des Zugangs (z.B. Beleuchtung, Abgelegenheit) 0,24 0,71 -0,12 -0,66 -0,38 Zustand der Umkleideräume -0,16 -0,35 -0,56 -1,06 -0,69 Zustand der Sanitäranlagen -0,48 -0,75 -0,72 -1,15 -1,38 Eignung für die Ausübung meiner Sportart 0,68 1,15 0,72 0,63 0,77 Geräteausstattung 0,26 0,79 0,84 0,23 0,08 Ausreichende zeitliche Verfügbarkeit 0,64 0,85 0,56 0,16 1,15 Freundliche Atmosphäre 0,36 0,40 -0,12 -0,47 0,38 Bauzustand 0,04 0,05 -0,44 -0,61 -0,23 Erreichbarkeit 1,12 1,62 1,00 0,79 0,92
Gesamtzufriedenheit 0,20 0,63 -0,04 -0,30 0,33
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 79
Tab. 34: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden
Doppel-SH im Trier
(n=73-75)
SH Mergelsberg (n=48-51)
Dreifach-SH Berufskolleg
(n=52-57)
TH Borken-wirthe (n=5-8)
Doppel-SH Burlo
(n=34-35) Sicherheit des Zugangs (z.B. Beleuchtung, Abgelegenheit) 0,97 1,50 0,47 1,00 0,54
Zustand der Umkleideräume 0,24 1,45 -0,08 -0,50 -0,08 Zustand der Sanitäranlagen -0,04 1,41 -0,43 -1,57 -0,53 Eignung für die Ausübung meiner Sportart 0,99 1,59 0,88 0,88 0,74 Geräteausstattung 0,73 1,30 0,51 0,00 0,46 Ausreichende zeitliche Verfügbarkeit 0,11 0,12 0,54 0,43 0,15 Freundliche Atmosphäre 0,43 1,37 0,28 0,17 0,10 Bauzustand 0,29 1,64 0,25 0,00 0,08 Erreichbarkeit 1,17 1,61 1,13 0,57 1,36
Gesamtzufriedenheit 0,58 1,36 0,47 0,29 0,30
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 80
Tab. 35: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden
SH
Cordulaschule (n=38-39)
SH Nünning(n=29-30)
TH Johannes-schule
(n=49-62)
SH Pröbsting-
schule (n=11-13)
TH Grütlohn(n=1-2)
Sicherheit des Zugangs (z.B. Beleuchtung, Abgelegenheit) 0,89 0,88 0,19 0,47 -0,60
Zustand der Umkleideräume 0,42 0,32 -0,81 0,00 -1,50 Zustand der Sanitäranlagen 0,72 0,04 -0,64 -0,38 -0,80 Eignung für die Ausübung meiner Sportart 1,20 0,88 0,44 0,59 -0,40 Geräteausstattung 0,44 0,76 0,45 0,19 -0,80 Ausreichende zeitliche Verfügbarkeit 0,69 0,32 0,70 0,50 -0,75 Freundliche Atmosphäre 0,50 0,32 -0,03 0,40 -1,25 Bauzustand 0,29 0,44 -1,31 0,13 -1,50 Erreichbarkeit 1,47 1,33 1,05 1,00 0,00
Gesamtzufriedenheit 0,69 0,68 -0,23 0,35 -0,80
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 81
Tab. 36: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden
SH Engelrading-
schule (n=18-19)
SH Roncalli-schule
(n=34-35)
SH Maria-Sibylla-Merian-
Realschule (n=20-23)
Sicherheit des Zugangs (z.B. Beleuchtung, Abgelegenheit) 0,88 0,81 0,50
Zustand der Umkleideräume 0,31 -0,28 -0,17 Zustand der Sanitäranlagen -0,40 -0,64 -0,04 Eignung für die Ausübung meiner Sportart 0,41 0,40 0,50 Geräteausstattung 0,49 0,44 0,41 Ausreichende zeitliche Verfügbarkeit 0,33 0,22 0,09 Freundliche Atmosphäre 0,46 0,19 -0,05 Bauzustand 0,13 0,19 0,14 Erreichbarkeit 1,67 1,44 1,17 Gesamtzufriedenheit 0,44 0,31 0,24
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 82
3.10 Wichtigkeit von Rahmenbedingungen der Sportausübung
3.10.1 Sportanbieter Um sich für einen Sportanbieter zu entscheiden bzw. bei einem Sportanbieter seinen Sport auszuüben, erwarten die befragten Sportaktiven in erster Linie eine hohe Fachkompetenz der Betreuer, die zeitlich flexible Nutzung der Angebote, Räume, Geräte etc., sowie ein preisgünstiges Angebot. Möglichkeiten zum geselligen Zusammensein werden dagegen weniger erwartet (vgl. Abb. 30). Für Männer und Frauen sind die einzelnen Aspekte dabei ähnlich wichtig, wobei Männer die Fachkompetenz als wichtiger erachten als die Frauen und diese dafür die medizinische Beratung sowie familiengerechte und vielseitige Angebote als wichtiger einstufen (vgl. Tab. 37). Betrachtet man die verschiedenen Altersgruppen, so zeigt sich, dass eine hohe Fachkompetenz der Betreuer über alle Gruppen hinweg der wichtigste Aspekt bei einem Sportanbieter ist. Die Nachfrage nach zeitlich flexiblen Angeboten ist bei den 20 bis 49-Jährigen besonders hoch und familienfreundliche Angebote sind vor allem für die 30 bis 49-Jährigen von großer Bedeutung. Die Wichtigkeit moderner Angebote ist mit zunehmendem Alter tendenziell abnehmend, was mit dem Wunsch der 14 bis 29-Jährigen nach vielseitigen Angeboten einhergeht (vgl. Tab. 38).
25,0
23,6
29,4
36,6
39,6
33,2
33,7
36,8
11,6
19,8
23,9
18,8
22,6
29,7
38,9
46,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Möglichkeit zum geselligen Zusammensein
Familiengerechte Angebote
Sportmedizinische Beratung
Modernes Sportangebot
Vielseitiges Angebot
Preisgünstiges Sportangebot
Zeitlich flexible Nutzung
Hohe Fachkompetenz der Betreuung
Wie wichtig sind Ihnen bei einem Sportanbieter folgende Aspekte?
ziemlich wichtig sehr wichtign = 1560‐1631
%
Abb. 30: Wichtigkeit einzelner Aspekte beim Sportanbieter – gesamt
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 83
Tab. 37: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanbietern – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“)
Aspekte Sportanbieter weiblich
(n=875-920) männlich
(n=675-700)
hohe Fachkompetenz der Betreuung 4,39 4,00 sportmedizinische Beratung 3,69 3,34 modernes Sportangebot 3,57 3,42 vielseitiges Angebot 3,85 3,50 zeitlich flexible Nutzung 4,06 3,86 geselliges Zusammensein 3,03 3,11 preisgünstiges Sportangebot 3,90 3,63 familiengerechte Angebote 3,26 2,93
Tab. 38: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanbietern – differenziert nach Alter, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“)
Aspekte Sportanbieter 14-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70-79 Jahre
hohe Fachkompetenz der Betreuung 4,15 4,16 4,23 4,21 4,22 4,06 4,33
sportmedizinische Beratung 3,19 3,58 3,50 3,53 3,62 3,50 3,66 modernes Sportangebot 3,73 3,78 3,54 3,43 3,43 3,12 3,13 vielseitiges Angebot 3,87 3,93 3,61 3,70 3,55 3,38 3,47 zeitlich flexible Nutzung 3,79 4,29 4,14 4,00 3,90 3,56 3,50 geselliges Zusammensein 3,56 3,27 2,99 2,95 2,77 3,02 3,21 preisgünstiges Sportangebot 3,77 4,02 3,84 3,72 3,62 3,56 3,80 familiengerechte Angebote 2,71 2,88 3,44 3,43 3,05 2,85 2,63
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 84
3.10.2 Sportanlagen Auf bzw. in den Sportanlagen/-stätten sind es vor allem die sauberen Sanitäranlagen und der gepflegte Gesamteindruck, welche den Befragten wichtig sind. Weiterhin sollten die Anlagen über gute und ausreichende Geräte verfügen sowie helle und freundliche Räume haben. Auch die Wohnortnähe, gute Umkleidemöglichkeiten sowie ein sicherer und gut beleuchteter Zugang werden von der Mehrheit der Befragten als wichtig erachtet. Einzig die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und die Nähe zum Arbeitsplatz fallen in der Wichtigkeit deutlich ab (vgl. Abb. 31).
6,2
11,5
34,8
36,5
40,6
38,5
43,3
43,1
41,0
29,8
4,3
6
35
33,8
31,1
38,9
35,9
43
51,3
63,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Nähe zum Arbeitsplatz
Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
Gut beleuchteter Zugang
Sicherer Zugang
Gute Umkleidemöglichkeiten
Wohnortnähe
Helle und freundliche Räume
Gute Geräteausstattung
Gepflegter Gesamteindruck
Saubere Sanitäranlagen
Wie wichtig sind Ihnen bei einer Sportanlage/‐stätte folgende Aspekte?
ziemlich wichtig sehr wichtign = 1542‐1672
%
Abb. 31: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei einer Sportanlage/-stätte - Gesamt
Gleiches gilt auch bei geschlechtsspezifischer Betrachtung, wobei die Frauen mit Ausnahme der guten Umkleidemöglichkeiten auf alle Aspekte mehr Wert legen als die Männer, besonders im Bereich der sicheren und gut beleuchteten Zugänge (vgl. Tab. 39). Innerhalb der Altersgruppen zeigt sich das gleiche Bild. Saubere Sanitäranlagen und ein gepflegter Gesamteindruck sind über alle Altersgruppen hinweg die wichtigsten Anforderungen an Sportanlagen und -stätten. Sichere und gut beleuchtete Zugänge sowie helle und freundliche Räume gewinnen mit zunehmendem Alter an Wichtigkeit. Während eine gute Anbindung an den Nahverkehr eine größere Rolle für die 14 bis 29-Jährigen spielt, ist die Wichtigkeit der Nähe zum Arbeitsplatz in der Gruppe der 20 bis 59-Jährigen am größten (vgl. Tab. 40).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 85
Tab. 39: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanlagen/-stätten – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“)
Aspekte Sportstätte weiblich (n=867-1944)
männlich (n=666-721)
sicherer Zugang 4,16 3,66 gut beleuchteter Zugang 4,17 3,68 Wohnortnähe 4,21 3,99 Nähe zum Arbeitsplatz 2,05 1,99 Anbindung öffentl. Nahverkehr 2,30 2,17 gute Umkleidemöglichkeiten 3,86 3,93 saubere Sanitäranlagen 4,57 4,52 gute Geräteausstattung 4,28 4,19 helle und freundliche Räume 4,21 4,00 gepflegter Gesamteindruck 4,52 4,30
Tab. 40: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanlagen/-stätten – differenziert nach Alter, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“)
Aspekte Sportstätte 14-19 Jahre
20-29 Jahre
30-39 Jahre
40-49 Jahre
50-59 Jahre
60-69 Jahre
70-79 Jahre
sicherer Zugang 3,78 3,74 3,81 3,95 4,04 3,93 4,18 gut beleuchteter Zugang 3,67 3,74 3,85 3,99 4,09 4,01 4,22 Wohnortnähe 3,84 4,08 4,08 4,17 4,20 4,05 4,16 Nähe zum Arbeitsplatz 1,83 2,28 2,17 2,03 1,99 1,76 1,63 Anbindung öffentl. Nahverkehr 2,48 2,49 2,13 2,12 2,12 2,26 2,01 gute Umkleidemöglichkeiten 3,93 4,00 3,80 3,84 3,85 3,87 4,12 saubere Sanitäranlagen 4,59 4,55 4,53 4,52 4,52 4,53 4,64 gute Geräteausstattung 4,38 4,36 4,20 4,19 4,18 4,08 4,25 helle und freundliche Räume 3,85 4,07 4,08 4,11 4,17 4,28 4,25 gepflegter Gesamteindruck 4,44 4,48 4,39 4,30 4,40 4,50 4,51
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 86
3.11 Wünsche und Bedarfe
3.11.1 Bewertung der Angebotssituation Bittet man die Befragten, die Angebotssituation im eigenen Wohnumfeld zu bewerten, ergibt sich für die Erreichbarkeit von Schwimmbädern die größte Zufriedenheit. Auch sind die Bewohner mit den vorhandenen Radwegen und mit den Angeboten durch Sportvereine zufrieden. Besonders bemängelt werden dagegen die Informationsmöglichkeiten zu Sportangeboten (vgl. Abb. 32).
0,16
0,26
0,28
0,46
0,58
0,75
0,83
0,88
0,88
0,90
‐2,0 ‐1,0 0,0 1,0 2,0
Informationsmöglichkeiten zu Sportangeboten
Möglichkeiten zum Inline‐Skaten
Angebot an Bolzplätzen
Angebote durch kommerzielle Anbieter
Angebot an Kinderspielplätzen
Parks, Grünanlagen für Bewegungsaktivitäten
Strecken zum Joggen / Laufen / (Nordic‐)Walken
Angebote durch Sportvereine
vorhandene Radwege
Erreichbarkeit von Schwimmbädern
Beurteilung der Angebotssituation im Bereich Sport, Bewegung und Erholung im
Stadtteil / Wohnumfeld ‐Mittelwerte ‐
n = 1975‐2071
absolut unzufrieden absolut zufrieden
Abb. 32: Bewertung der Angebotssituation im eigenen Wohnumfeld - Gesamtauswertung
Das Angebot durch Sportvereine stimmt vor allem die Bewohner in Marbeck, Borkenwirthe / Burlo und Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken unzufrieden. Diese Stadtteile schneiden auch beim Angebot kommerzieller Anbieter am schlechtesten ab, wobei die Zufriedenheit in dieser Kategorie insgesamt niedrig ist. Während die Bewohner in Borkenwirthe / Burlo besonders mit der Erreichbarkeit von Schwimmbädern unzufrieden sind, liegt die geringste Zufriedenheit in Weseke beim Angebot an Bolzplätzen vor (vgl. Tab. 41).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 87
Tab. 41: Beurteilung der Angebotssituation im Bereich Sport, Bewegung und Erholung im eigenen Stadtteil / Wohnumfeld – differenziert nach Stadtteil, Mittelwerte auf einer Skala von „-2=absolut unzufrieden“ bis „2=sehr zufrieden“
Angebote/ Möglichkeiten
Borken (n=751-784)
Borkenwirthe, Burlo
(n=186-199)
Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe (n=336-351)
Grütlohn. Hoxfeld,
Rhedebrügge. Westenborken (n=236-254)
Marbeck (n=212-228)
Weseke (n=239-246)
Angebote durch Sportvereine 0,90 0,55 1,08 0,61 0,53 1,05
Angebote durch kommerzielle Anbieter
0,64 0,17 0,45 0,12 -0,15 0,32
vorhandene Radwege 0,94 0,91 0,94 0,99 0,42 0,63 Strecken zum Joggen / Laufen / (Nordic-)Walken 0,80 0,99 0,98 1,03 0,67 0,62
Erreichbarkeit von Schwimmbädern 1,29 -0,29 0,65 0,60 0,65 0,81
Parks, Grünanlagen für Bewegungsaktivitäten
0,94 0,40 0,85 1,02 0,40 0,05
Angebot an Bolzplätzen 0,35 0,07 0,33 0,47 0,39 -0,07 Angebot an Kinderspielplätzen 0,60 0,46 0,62 0,38 0,66 0,55
Möglichkeiten zum Inline -Skaten 0,28 0,35 0,13 0,28 0,18 0,36
Informationsmöglichkeiten zu Sportangeboten 0,18 0,01 0,22 0,04 -0,03 0,24
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 88
3.11.2 Fehlende Angebote und Möglichkeiten im Stadtteil Fragt man nach fehlenden Sportangeboten bzw. -möglichkeiten im Stadtteil, so geben die Befragten an, dass es lückenhafte Sportangebote vor allem im Trendsport (28,5%) und Gesundheitsbereich (24,7%) sowie generell bei zu Fuß zu erreichenden Angeboten (24,3%) gibt. Auch Angebote für Jugendliche (20,6%) und Senioren (18,1%) werden teilweise als fehlend empfunden (vgl. Abb. 33).
9,6
10,2
11,3
13,4
13,9
15,3
16,4
18,1
20,6
24,3
24,7
28,5
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0
Möglichkeiten zum Radfahren
Möglichkeiten zum Joggen
Angebote durch kommerzielle Anbieter
Angebote durch Sportvereine
Angebote für Mädchen
Angebote für Kinder
Angebote für Frauen
Angebote für Senioren/‐innen
Angebote für Jugendliche
Angebote, die zu Fuß zu erreichen sind
Angebote im Gesundheitsbereich
Trendsportangebote
Fehlen Ihnen einige der folgenden Sportangebote bzw. ‐möglichkeiten in Ihrem Stadtteil?‐Mehrfachnennungen möglich ‐
n = 1330‐1467
%
Abb. 33: Fehlende Angebote im Stadtteil
Betrachtet man die einzelnen Stadtteile in Borken, so zeigen sich zum Teil deutliche Unterschiede. Insgesamt betrachtet werden dabei die Defizite in Gemen / Gemenrückling / Gemenwirthe am geringsten und in Borkenwirthe / Burlo am größten von den Befragten angesehen (vgl. Tab. 42).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 89
Tab. 42: Fehlende Sportangebote/-möglichkeiten im eigenen Stadtteil – differenziert nach Stadtteil, Mehrfachnennungen möglich
Angebote/ Möglichkeiten
Borken (in %)
n=518-557
Borkenwirthe, Burlo (in %)
n=109-128
Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe
(in %) n=247-269
Grütlohn, Hoxfeld, Rhedebrügge, Westenborken
(in %) n=151-170
Marbeck (in %)
n=219-244
Weseke (in %)
n=173-186
für Kinder 12,2 30,7 9,9 20,3 27,8 19,4
für Jugendliche 17,6 33,6 16,7 23,0 28,2 26,9
für Mädchen 11,9 18,1 12,0 23,0 21,1 16,3
für Frauen 13,6 23,4 13,2 25,4 24,3 21,8
für Senioren/-innen 16,1 29,1 14,6 21,9 30,7 18,7 im Gesundheits-bereich
24,1 35,1 21,3 34,8 40,3 15,1
durch Sportvereine 11,7 26,0 8,1 18,0 24,6 14,0 durch kommerzielle Anbieter
7,8 23,0 12,2 20,3 14,5 11,5
zum Joggen 13,0 8,3 4,8 8,5 5,7 10,4
zum Radfahren 9,7 17,0 7,0 13,8 8,3 8,4
Trendsportangebote 28,0 33,3 29,8 34,5 27,9 24,7 Angebote, die zu Fuß zu erreichen sind 20,4 32,2 24,8 35,8 37,7 23,4
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 90
3.11.3 Wünsche nach neuen bzw. weiteren Sportangeboten und -stätten Im Mittelpunkt dieser Betrachtung stehen die unbefriedigten Sportbedürfnisse der Borkener Bevölkerung. Von allen Befragten – also egal, ob sportaktiv oder -inaktiv – äußern in Borken rund 40 Prozent den Wunsch, mindestens eine neue bzw. andere Sportart ausüben zu wollen. Auf den ersten fünf Plätzen liegen Badminton, Klettern, Zumba, Schwimmen und Tennis. Rund 18 Prozent der Befragten äußern zudem den Wunsch nach mindestens einer neuen bzw. weiteren Sporstätte. Am häufigsten wird hierbei ein Kunstrasenplatz gewünscht, gefolgt von einer Kletterhalle und Eissportanlage. Auf den weiteren Plätzen folgen allgemeine Sporthallen bzw. Großsportanlagen. Die Übersichten in Abb. 34 und Abb. 35 zeigen die Wünsche der Bevölkerung und somit wichtige Potentiale für die verschiedenen Sportanbieter in Borken auf.
2,5
2,6
2,8
3,3
3,6
3,8
3,8
4,1
4,1
5,1
5,8
6,1
6,3
6,7
0 1 2 3 4 5 6 7
Handball
Bogenschießen
Pilates
Fitness
Nordic Walking
Yoga
Tanzsport
Golf
Radfahren
Tennis
Schwimmen
Zumba
Klettern
Badminton
Welche neuen bzw. weiteren Sportarten würden Sie gerne ausüben?‐ Gesamt, maximal 2 Angaben ‐
n = 874
%
Abb. 34: Welche neuen bzw. weiteren Sportarten würden Sie gerne ausüben?
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 91
1,8
1,8
1,8
1,8
2,1
2,8
2,8
3,4
3,6
3,6
4,9
5,2
5,9
7,2
8,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Badmintonhalle
Basketballplätze
Boxhalle
Fitnessstudio
Turnhalle
Freibad
Tennisanlage
Kletterpark
Schwimmbad
Reitwege
Golfsportanlage
Sporthalle
Eissportanlage
Kletterhalle
Kunstrasenplatz
Welche Sportstätte(n) würden Sie sich wünschen?
‐ Gesamt, maximal 2 Angaben ‐
n = 387
%
Abb. 35: Welche Sportstätten würden Sie sich wünschen?
3.12 Sport und Sportförderung in Borken
3.12.1 Zustimmung zu Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken Befragt man die Borkener Bevölkerung bezüglich der Sportförderung in Borken, so wird deutlich, dass der Sport für 86 Prozent der Befragten ein entscheidender Faktor für die Lebensqualität in der Stadt ist. 76,5 Prozent sind der Meinung, dass in Borken viel für Sport und Bewegung unternommen wird. Aufgrund der hohen Bedeutung, die dem Sport beigemessen wird, überrascht es nicht, dass 75,8 Prozent sich für eine kostenlose Nutzung der Sportstätten durch die Sportvereine aussprechen. Obwohl viele der Befragten der Meinung sind, dass in der Stadt viel für den Sport getan wird und obwohl immerhin 68,6 Prozent die Ansicht vertreten, dass Borken für interessierte Zuschauer/innen attraktive Sportveranstaltungen bietet, vertreten nur 28,9 Prozent die Auffassung, dass Borken den Namen „Sportstadt“ verdient. Allerdings ist auch zu beachten, dass nur 19,2 Prozent einen zu geringen Stellenwert von Sport und Bewegung in Borken bemängeln (vgl. Abb. 36 und Abb. 37).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 92
46,1
45,8
55,2
36,6
61,3
49,3
5
11,3
13,4
39,2
15,2
36,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Die Sportvereine in Borken sind modern.
Borken verfügt über ausreichend Sporthallen.
Borken bietet für interessierte Zuschauer/innen viele
attraktive Sportveranstaltungen.
Sportstätten sollten den Sportvereinen kostenlos zur Verfügung gestellt werden.
In Borken wird viel für Sport und Bewegung getan.
Sportmöglichkeiten in Borken sind ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität in der Stadt.
Wie stark stimmen Sie folgende Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken zu? (1/2)
stimme eher zu stimme voll und ganz zun = 1967‐2060
%
Abb. 36: Zustimmung zu Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken – Gesamt, Kategorien „stimme eher zu“ / „stimme voll und ganz zu“ (1/2)
16,7
15,2
24,4
29,5
34,8
35,0
2,5
4,5
4,5
4,3
6,2
11,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Der Stellenwert von Sport und Bewegung in Borken ist zu
gering.
In Zeiten leerer Kassen und hoher Verschuldung muss auch
der Sport stärker in Sparmaßnahmen einbezogen …
Borken verdient den Namen „Sportstadt“.
Borken ist im Vergleich zu anderen Städten besonders
„sportfreundlich“.
Borken ist eine Stadt, die vom Sport vielfach profitiert.
Die Sportmöglichkeiten in Borken und der Region sind wichtig für den Tourismus.
Wie stark stimmen Sie folgende Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken zu? (2/2)
stimme eher zu stimme voll und ganz zun = 1967‐2060
%
Abb. 37: Zustimmung zu Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken – Gesamt, Kategorien „stimme eher zu“ / „stimme voll und ganz zu“ (2/2)
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 93
3.12.2 Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Maßnahmen zur Förderung von Sport und Bewegung in Borken
Betrachtet man die Bewertung (Mittelwerte auf einer Skala von 1 bis 5) verschiedener Maßnahmen zur Förderung von Sport und Bewegung in Borken, so zeigt sich, dass vor allem Maßnahmen zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen als wichtig erachtet werden (4,78). Außerdem wird ersichtlich, dass dem Ausbau und der Pflege der Sportinfrastruktur eine große Bedeutung beigemessen wird. So ergeben sich für die Sanierung von öffentlichen Sportanlagen (4,39), die Attraktivierung von Schulhofflächen (4,27), die Erweiterung und den Ausbau von Radwegen (4,08), die Schaffung von vielfältigen Möglichkeiten zum wohnortnahen Sporttreiben (4,07), die Verbesserung der Qualität von Parks und Grünflächen für Sport und Bewegung (4,06) sowie die Verbesserung der räumlichen Attraktivität der Kindergärten und KiTas für Sport und Bewegung (4,02) jeweils Mittewerte von über 4,0 (wichtig). Außerdem sind die Erwartungen zur Förderung des Gesundheitssports (4,28) hervorzuheben. Schließlich bleibt festzuhalten, dass auch den als weniger wichtig erachteten Maßnahmen zur Verbesserung des Streckennetzes für Inline-Skating (3,28) und für bessere Informationen über letzteres (3,27) nicht als unwichtig empfunden werden (vgl. Tab. 43).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 94
Tab. 43: Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Maßnahmen zur Förderung von Sport und Bewegung in Borken (Mittelwerte auf einer Skala von „1=absolut unwichtig“ bis „5= absolut wichtig“; n=2018-2090)
Maßnahme Mittelwert
Maßnahmen zur Bewegungsförderung von Kindern und Jugendlichen 4,78 Sanierung von öffentlichen Sportanlagen 4,39 Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitssports 4,28 Attraktivierung von Schulhofflächen (Bewegungsfreundlichkeit) 4,27 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Kindergärten / Jugendzentren und den Sportvereinen 4,12
Erweiterung und Ausbau von Radwegen 4,08 Schaffung von vielfältigen Möglichkeiten zum wohnortnahen Sporttreiben 4,07 Verbesserung der Qualität von Parks und Grünflächen für Sport und Bewegung 4,06 Verbesserung der räumlichen Attraktivität der Kindergärten / KiTas für Sport und Bewegung 4,02
Verbesserung des Informationsangebots zu den Sport- und Bewegungsmöglichkeiten in Borken 3,99
Verbesserung der Familienfreundlichkeit des Borkener Sports 3,83 Verbesserung der Internetinformationen 3,83 Öffnung von Schulhöfen für Sport und Bewegung nach Schulschluss 3,83 Verbesserung des Angebots an Lauf- und Joggingstrecken 3,70 Bessere Informationen über Lauf- und Joggingstrecken 3,66 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung / Schaffung von Bewegungsflächen 3,65 Entwicklung von Broschüren und Infomaterialien 3,65 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Sportvereinen und Migrantenorganisationen 3,61 Stärkere Unterstützung des Leistungssports 3,47 Verbesserung des Angebots an Strecken für Inline-Skating 3,28 Bessere Informationen über Strecken für Inline-Skating 3,27
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 95
3.13 Sportveranstaltungen und ihr Stellenwert in Borken
Ein Blick auf die Bewertung Borkener Sportveranstaltungen zeigt, dass der Stellenwert dieser Veranstaltungen für die Befragten relativ gering ist. Keine der Veranstaltungen schafft es bei der Bewertung über die mittlere Kategorie (3,0) hinaus. Für mehr als die Hälfte aller Sportveranstaltungen geben die Befragten sogar an, dass der Stellenwert für sie persönlich nur „gering“ ist. Schlusslicht innerhalb der Bewertung der Sportveranstaltungen ist das Schlittenhunderennen (vgl. Abb. 38).
1,73
1,81
1,85
1,87
1,95
1,96
2,12
2,15
2,53
2,59
2,80
1,0 2,0 3,0 4,0 5,0
Schlittenhunderennen
Tanzturniere
5‐Türme‐CUP Marktplatz
Ballonfahrertreff
Handball Himmelfahrts‐Turnier
Reitturniere
Drachenflugtag
Triathlon/Trimmathlon Pröbsting
Stadtmeisterschaften
Dragonboat‐CUP
Citylauf Innenstadt
Stellenwert der Sportveranstaltungen in Borken
‐Mittelwerte ‐
n = 2003‐2043
sehr gering sehr groß
Abb. 38: Bewertung des Stellenwerts der Sportveranstaltungen in Borken (Mittelwerte auf einer Skala von „1=sehr gering“ bis „5= sehr groß“; n=2003-2043)
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 96
3.14 Sportliches Engagement der 3 bis 13-Jährigen
3.14.1 Darstellung der Stichprobe Zum Ende des Fragebogens bestand die Möglichkeit, das sportliche Engagement der eigenen Kinder im Alter von 3 bis 13 Jahren in die Befragung einfließen zu lassen. Dabei ergab sich bezüglich der Geschlechter eine leicht ungleiche Verteilung zugunsten der Jungen (56,6 %) (vgl. Abb. 39). Die Altersverteilung ist Abb. 40 zu entnehmen.
43,4%
56,6%
Geschlechterverteilung Kinder 3‐13 Jahre
weiblich
männlich
n = 472
Abb. 39: Geschlechterverteilung in der Stichprobe, Kinder zwischen 3 und 13 Jahren
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 97
7,9
6,2
7,5
6,4 6,2
11,6
7,7
8,9
12,4 12,2
10,6
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0
2
4
6
8
10
12
14
Alter des Kindes%
n = 482Jahre
Abb. 40: Altersverteilung in der Stichprobe, Kinder zwischen 3 und 13 Jahren
3.14.2 Sportaktivität der 3 bis 13-Jährigen Die Erhebung des sportlichen Engagements ergab ein hohes Maß an Sportaktivität der 3 bis 13-Jährigen in Borken. 90,2 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Kind sportlich aktiv ist (vgl. Abb. 41) und 86 Prozent, dass ihr Kind Mitglied in einem Sportverein ist (vgl. Abb. 42). Auch der relativ hohe Anteil an Kindern und Jugendlichen, die mehr als eine (63,3 %) bzw. zwei (29,3 %) Sportarten ausüben, spiegelt diesen hohen Aktivitätsgrad wider (vgl. Abb. 43).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 98
90,2%
9,8%
Treibt Ihr Kind in der Freizeit Sport?
ja
nein
n = 480
Abb. 41: Treibt Ihr Kind in der Freizeit Sport? (Kinder 3 bis 13 Jahre)
86,0%
14,0%
Ist Ihr Kind Mitglied in einem Sportverein?
ja
nein
n = 444
Abb. 42: Mitgliedschaft in einem Sportverein (Kinder 3 bis 13 Jahre)
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 99
63,3
29,3
Zweitsportart Drittsportart
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ausübung einer Zweit‐ und Drittsportart‐ sportlich aktive Kinder von 3 bis 13 Jahre ‐%
n = 433
Abb. 43: Anteil der sportaktiven 3 bis 13-Jährigen, die mehr als eine Sportart betreiben
3.14.3 Ausgeübte Sportarten der 3 bis 13-Jährigen Abb. 44 zeigt die zehn insgesamt am häufigsten ausgeübten Sportarten der Kinder und Jugendlichen in Borken. Insgesamt gaben 43,4 Prozent der Eltern an, dass ihr Kind in der Freizeit schwimmt. An zweiter und dritter Stelle folgen Fußball mit 37,8 Prozent und Turnen mit 29 Prozent.
3,9
4,2
5,1
5,6
13,7
17,2
29
37,8
43,4
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Kampfsport
Inline/Rollsport
Laufen/Joggen
Tanzsport
Reitsport
Radfahren
Turnen
Fußball
Schwimmen
Welchen Sport übt Ihr Kind am häufigsten aus?‐ Angabe von bis zu drei Sportarten ‐
n = 431
%
Abb. 44: Beliebteste Sportarten bei den unter 3 bis 13-Jährigen – Mehrfachnennungen möglich
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 100
Ein leicht anderes Bild ergibt sich, betrachtet man die am häufigsten genannten Sportarten differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (vgl. Tab. 44). Bei der erstgenannten Sportart dominiert der Fußball mit 32,6 Prozent, gefolgt von Turnen (21,1%) und Schwimmen (12,4%). Dagegen erhält Schwimmen bei der Zweitsportart die meisten Nennungen (38,5%), Turnen verbleibt mit 10,6 Prozent an zweiter Position. Radfahren folgt auf Position drei (10,3%) und ist gleichzeitig die am häufigsten ausgeübte Drittsportart (26%). Schwimmen dagegen verliert hier wieder etwas an Bedeutung und fällt auf Rang zwei zurück (22,8%). Inline-Skaten/Rollsport, der es bei den Erst- und Zweitnennungen nicht in die Top 10 schaffte, belegt bei den Drittnennungen mit 8,7% den dritten Platz. Fußball steht bei der Zweit- und Drittsportart mit 5,9 bzw. 6,3 Prozent jeweils an fünfter Position.
Tab. 44: Sportarten differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Kinder 3 bis 13 Jahre, Top 10)
Erstsportart (n=427)
% Zweitsportart(n=273)
% Drittsportart (n=127)
%
1. Fußball 32,6 1. Schwimmen 38,5 1. Radfahren 26,0 2. Turnen 21,1 2. Turnen 10,6 2. Schwimmen 22,8 3. Schwimmen 12,4 3. Radfahren 10,3 3. Inline/Rollsport 8,7 4. Reitsport 8,2 4. Reitsport 7,3 4. Laufen/Joggen 7,1
5. Kampfsport
3,0 5. Fußball 5,9 5. Fußball 6,3
Radfahren 6. Laufen/Joggen 4,4 6. Turnen 4,7 Tanzsport 7. Tanzsport 2,9 7. Reitsport 3,1
8. Handball 2,8 8. Badminton 2,2 8.
Basketball 2,4 9. Basketball 2,1
9. Basketball
1,8 Tanzsport
10. Volleyball 1,9 Gymnastik Wintersport
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 101
3.14.4 Häufigkeit und Intensität der Sportausübung Anders als bei den Erwachsenen wird für die häufigsten Sportarten auch der meiste Zeitaufwand aufgebracht. Die klare Lieblings-Erstsportart Fußball wird im Schnitt über zwei Mal pro Monat betrieben und beansprucht im Monat die meiste Zeit der Kinder (13,31 Stunden). Beim Schwimmen, der Top-Zweitsportart, zeigt sich hingegen ein ähnliches Bild wie bei den Erwachsenen. Obwohl über Erst-, Zweit- und Drittsportart hinweg Schwimmen am häufigsten genannt wurde (187 Nennungen), wird der Sport weniger als einmal pro Woche mit einem Zeitaufwand von knapp über einer Stunde pro Einheit betrieben. Die im Monatsverlauf am häufigsten betriebene Sportart Radfahren (13,35 mal pro Monat) belegt bei den Drittsportarten Platz eins. Auch wenn nur für 74 Kinder angegeben wurde, dass sie den Sport betreiben, liegt der zeitlich Aufwand mit fast drei Stunden pro Woche auf dem zweiten Platz hinter dem Fußballsport. Die drittmeiste Zeit im Monatsverlauf wird für Basketball aufgewandt. Hier gilt allerdings zu beachten, dass insgesamt nur für 17 Kinder angegeben wurde, dass sie diesen Sport betreiben (vgl. Tab. 45).
Tab. 45: Sportarten nach Dauer/Häufigkeit pro Monat (Kinder 3 bis 13 Jahre, Top 10)
Sportarten Häufigkeit pro Monat
Minuten je Einheit
Dauer pro Monat in Stunden
n
Schwimmen 3,54 61,98 3,66 187 Fußball 9,59 83,24 13,31 163 Turnen 5,74 73,40 7,02 125 Radfahren 13,35 50,07 11,14 74 Reitsport 5,28 65,63 5,77 59 Tanzsport 3,79 63,13 3,99 24 Laufen/Joggen 7,5 40 5 22 Inline/Rollsport 7,83 41,56 5,43 18 Basketball 6,03 72,35 7,27 17 Kampfsport 4,79 75 5,99 17
3.14.5 Organisationsform der Sportausübung der 3 bis 13-Jährigen Der Großteil der sportaktiven Kinder und Jugendlichen in Borken übt die jeweilige Sportart in einem Sportverein aus (83,8%). Diese Organisationsform wird mit deutlichem Abstand gefolgt vom selbstorganisierten Sporttreiben (45,5%). Die Schule, andere öffentliche Träger (z.B. VHS) und kommerzielle Einrichtungen spielen bei den 3 bis 13-Jährigen mit 8,3; 6,9 bzw. 6,7 Prozent eine untergeordnete Rolle (vgl. Tab. 46). Differenziert man diese Angaben in Bezug auf die Erst-, Zweit- und Drittsportart, zeigt sich, dass der Organisationsgrad im Verein von 78,3 Prozent bei der Erstsportart über 44,7 Prozent bei der Zweitsportart auf 16,8 Prozent bei der Drittsportart abnimmt. Gleichzeitig gewinnt das selbstorganisierte Sporttreiben an Bedeutung (22,5%; 44,3% bzw. 66,1%). Auch die kommerziellen Anbieter spielen bei der Ausübung der Drittsportart (5%) eine wichtigere Rolle als bei der Erst- (3,8%) und Zweitsportart (3,4%) (vgl. Tab. 47).
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 102
Tab. 46: Organisationsform der Sportausübung (Kinder 3 bis 13 Jahre, Mehrfachnennungen möglich, gesamt)
Gesamt (n=433)
in % Sportverein 83,8 kommerzielle Einrichtung (z.B. Fitness-Studio) 6,7
Selbst, Freunde, Familienangehörige oder Bekannte (gesamt) 45,5
… auf frei zugänglichen Anlagen, Orten (z.B. Park, Wege, Bolzplatz) 33,5
… auf gemieteten Anlagen (z.B. Tennishalle, Schwimmbad, Kletterhalle) 23,6
Schule (z.B. Schulsport AGs) 8,3 öffentliche/gemeinnützige Träger (z.B. Volkshochschule, Familienbildungsstätten oder Krankenkassen)
6,9
Sonstige 11,5
Tab. 47: Organisationsform – differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Kinder 3 bis 13 Jahre, Mehrfachnennungen möglich)
Erstsportart
(n=424) in %
Zweitsportart (n=262)
in %
Drittsportart (n=119)
in % Sportverein 78,3 44,7 16,8 kommerzielle Einrichtung (z.B. Fitness-Studio) 3,8 3,4 5,0
Selbst, Freunde, Familienangehörige oder Bekannte (gesamt) 22,5 44,3 66,1
… auf frei zugänglichen Anlagen, Orten (z.B. Park, Wege, Bolzplatz) 16,5 25,6 49,6
… auf gemieteten Anlagen (z.B. Tennishalle, Schwimmbad, Kletterhalle)
6,6 21,8 22,7
Schule (z.B. Schulsport AGs) 5,0 4,6 6,7 öffentliche/gemeinnützige Träger (z.B. Volkshochschule, Familienbildungsstätten oder Krankenkassen)
4,5 3,1 2,5
Sonstige 6,4 9,5 8,4
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 103
Interessant ist auch die zeitliche Aufteilung der gesamten Sportaktivität auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen, welche in Abb. 45 dargestellt ist. Auch hier zeigt sich die zentrale Rolle des Vereinssports (69,7%) bei den Kindern und Jugendlichen zwischen 3 und 13 Jahren. 21,7 Prozent fallen auf den privaten, unorganisierten Sport und lediglich 4,3 Prozent auf kommerzielle Anbieter.
69,7%
4,3%
21,7%
4,4%
Aufteilung der gesamten Sportaktivität auf die verschiedenen Angebots‐ und
Organisationsformen‐ sportlich aktive Kinder von 3 bis 13 Jahren ‐
Sportverein
kommerzieller Anbieter
privat, unorganisiert
Sonstiges
n = 427
Abb. 45: Aufteilung der gesamten Sportaktivitäten auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen (Kinder 3 bis 13 Jahre)
3.14.6 Orte der Sportausübung der 3 bis 13-Jährigen In Abb. 46 wird die Aufteilung der sportlichen Aktivität auf die verschiedenen Sportanlagen dargestellt. Hier werden vor allem Turn- und Sporthallen genutzt (61,7%), doch auch das Hallenbad (42,7%) und Spielfelder/Sportplätze (37,9%) stellen zentrale Orte der Sportausübung dar. Weniger relevant sind dagegen Tennisplätze (2,1%) und Fitness-Studios (0,7%). Abb. 47 zeigt in gleicher Weise die Aufteilung auf die unterschiedlichen Sportgelegenheiten, bei denen Straßen und Wege mit 26,3 Prozent die Orte der häufigsten Sportausübungen sind. Zu Hause (17,1%), auf dem Bolzplatz (14,3%) und auf Feldern, Wiesen und Wegen (14,3%) wird ebenfalls relativ viel Sport getrieben. Das Gebirge (0,9%) bildet in dieser Kategorie das Schlusslicht.
Bevölkerungsbefragung zum Sportverhalten und zur Situation des Sports in Borken | 104
19,9
0,7
2,1
13,6
37,9
42,7
61,7
0 10 20 30 40 50 60 70
Sonstiges Sportanlagen
Fitness‐Studio
Tennisanlage/‐platz
Freibad
Spielfeld/Sportplatz
Hallenbad
Turn‐/Sporthalle
Wo übt Ihr Kind diesen Sport hauptsächlich aus?‐ Sportanlage, 3 bis 13‐Jährige, Mehrfachnennungen möglich ‐
n = 433
%
Abb. 46: Nutzung von Sportanlagen - Mehrfachnennungen möglich (Kinder 3 bis 13 Jahre)
8,8
0,9
4,6
6,7
14,3
14,3
17,1
26,3
0 10 20 30 40 50 60 70
Sonstige Sportgelegenheiten
Gebirge/Berge
Offenes Gewässer
Park
Feld, Wiese, Wald
Bolzplatz
Zu Hause
Straße, Weg
Wo übt Ihr Kind diesen Sport hauptsächlich aus?‐Sportgelegenheiten, 3 bis 13‐Jährige, Mehrfachnennungen möglich‐
n = 433
%
Abb. 47: Nutzung von Sportgelegenheiten - Mehrfachnennungen möglich (Kinder 3 bis 13 Jahre)
Sportanbieter in Borken | 105
4 Sportanbieter in Borken Borken bietet vielfältige Möglichkeiten zum Sportreiben. Neben den knapp 40 Borkener Sportvereinen, welche über die gesamte Stadt verteilt die wichtigsten Sportanbieter für die gesamte Bevölkerung der Stadt Borken darstellen, gibt es noch eine Reihe weiterer Anbieter in Borken. So bieten beispielsweise der Kreissportbund Borken, die Volkshochschule Borken, das Deutsche Rote Kreuz sowie die Familienbildungsstätte verschiedene Kurse vor allem im Themenbereich ‚Gesundheit und Sport’ an. Weiter gibt es in Borken diverse kommerzielle Sportanbieter – vornehmlich Fitness-Studios.
Sportanbieter in Borken | 106
4.1 Sportvereine in Borken
Im Jahr 2011 waren insgesamt 37 Sportvereine im Stadtsportverband Borken, die ein breites Spektrum an Aktivitäten abdecken. So bieten die Sportvereine den Borkener Bürgerinnen und Bürgern verschiedenste Angebote in über 40 Sportarten an (vgl. Tab. 50). Betrachtet man die Entwicklung der Mitgliedschaften8 im Stadtsportverband Borken, so zeigt sich, dass die Gesamtzahlen zwischen 2007 und 2011 um rund sieben Prozent angestiegen sind. Allerdings zeigen sich innerhalb der verschiedenen Altersgruppen große Unterschiede von einem Minus von rund elf Prozent bei den 27 bis 40-Jährigen bis zu einem Zuwachs von 21,6 Prozent bei den 19 bis 26-Jährigen (vgl. Tab. 48).
Tab. 48: Entwicklung der Sportvereinsmitgliederzahlen im Stadtsportverband Borken 2007 bis 2011 (Quelle: SSV Borken)
2007 2008 2009 2010 2011
Veränderung 2011 zu 2007 in Prozent
0-6 Jahre 1.531 1.519 1.497 1.561 1.473 -3,8
7-14 Jahre 4.001 4.130 4.060 4.112 4.043 1,0
15-18 Jahre 1.583 1.659 1.683 1.679 1.815 14,7
19-26 Jahre 1.636 1.745 1.797 1.902 1.989 21,6
27-40 Jahre 2.456 2.403 2.357 2.286 2.191 -10,8
41-60 Jahre 3.662 3.875 3.870 3.936 4.140 13,1
über 60 Jahre 1.896 2.020 2.117 2.166 2.257 19,0
Gesamt 16.765 17.351 17.381 17.624 17.908 6,8
Zum Vergleich finden sich in der nachfolgenden Tab. 49 die Entwicklungszahlen für Nordrhein-Westfalen.
Tab. 49: Entwicklung der Mitgliederzahlen im Landessportbund NRW von 2007 bis 2011 (Quelle: LSB NRW)
2007 2008 2009 2010 2011
Veränderung 2011 zu 2007
in Prozent 0-6 Jahre 294.367 293.572 282.260 290.348 284.860 -3,2
7-14 Jahre 1.047.983 1.047.380 1.029.502 1.026.053 1.000.411 -4,5
15-18 Jahre 435.552 434.619 431.072 434.248 424.711 -2,5
19-26 Jahre 459.338 460.113 457.421 479.327 487.942 6,2
27-40 Jahre 811.695 764.151 715.060 716.632 684.992 -15,6
41-60 Jahre 1.314.082 1.302.946 1.296.514 1.340.626 1.350.343 2,8
über 60 Jahre 749.098 761.988 773.550 800.120 818.382 9,2
Gesamt 5.112.115 5.064.769 4.985.379 5.087.354 5.051.641 -1,2
8 Bei den Mitgliedschaftszahlen ist zu beachten, dass Personen, die in mehreren Vereinen Mitglied sind, auch mehrfach in die Berechnung einfließen. Eigene Untersuchungen in Aachen und Mönchengladbach haben zum Beispiel gezeigt, dass in diesen Städten zwischen 18 und 25 Prozent der Vereinsmitglieder in mindestens zwei Sportvereinen Mitglied sind.
Sportanbieter in Borken | 107
Der Organisationsgrad (Mitgliedschaften im SSV Borken in Relation zur Gesamtbevölkerung) in Borken lag dabei im Jahr 2011 mit 43,4 Prozent rund 15 Prozentpunkte über dem Landesdurchschnitt (28,3%). Somit kann man von einer überdurchschnittlichen Vereinsaktivität der Borkener Bürgerinnen und Bürger sprechen, welche den hohen Stellenwert der Sportvereine für das gesellschaftliche Leben in Borken verdeutlicht.
Tab. 50: Sportangebote der Sportvereine in Borken
Sportarten Sportarten Aerobic Reiten und Fahren Akrobatik Rhythm. Sportgymnastik
Badminton Schach
Basketball Schießsport
Behindertensport/Reha-Sport Schwimmen (u.a. Rettungsschwimmen, Sportschwimmen, Wassergymnastik)
Bosseln Segelfliegen
Dragonboat Selbstbehauptung/-verteidigung
Faustball Segeln
Fußball Sportabzeichen Abnahme
Gesundheitsförderung (u.a. Walking, Altern und Bewegung, Bewegung und Stress, Entspannungstraining, Rückenschule / Wirbelsäulenschonung)
Gymnastik (u.a. Funktionsgymnastik/ funktionelle Gymnastik, Gymnastik und Spiele, Problemzonen-Gymnastik)
Taekwondo Tanzsport Handball Tennis Judo Tischtennis Kegeln Triathlon
Lauftreff Turnen
Leichtathletik Volleyball / Beachvolleyball Prellball …
Radsport
Sportanbieter in Borken | 108
4.2 Weitere Sportanbieter in Borken
Im Bereich der kommerziellen Sportanbieter stellen Fitness-/Wellness-Studios das größte Angebot dar. Bei einer Recherche im Frühjahr 2012 konnten dabei die folgenden vier Anbieter in diesem Feld in Borken ermittelt werden.
Multi-Sport
Studio B
Top-Fit-Arena
Vita-Sportstudio Die einzelnen Studios unterscheiden sich dabei zum Teil deutlich hinsichtlich ihrer Ausrichtung, Angebote und Zielgruppen. Im Bereich ‚Gesundheit und Sport’ bieten der KSB Borken, die VHS, das DRK und die Familienbildungsstätte vielfältige Kurse an.
Der Kreissportbund Borken bot im 1. Quartal 2012 insgesamt 110 Kurse in Weseke, Borken und Burlo an. Darunter waren Kurse in den folgenden Bereichen:
(Rücken-)Gymnastik
Fitness/Aerobic
Wassergymnastik
Spinning
Yoga
Wassergewöhnung
Eltern-Kind/Baby
Zumba
Qi-Gong
Nordic-Walking
Die Volkshochschule Borken bot im Winter 2011/12 in Borken und Gemen und Hoxfeld in 57 Kursen unter anderem die folgenden Aktivitäten an:
Gymnastik/Aerobic/Pilates
Mutter(Vater)-Kind-Schwimmen
Yoga
Entspannungstechniken/Autogenes Training
Orientalischer Tanz/Meditatives Tanzen
Rückenschule
Yoga / Autogenes Training für Kinder
Wing-Tsun-Kampfkunst
Wassergymnastik
Tennis für Jugendliche
Kletterabenteuer (Jugendliche)
Indianerfrühling (Jugendliche)
Sportanbieter in Borken | 109
Das Deutsche Rote Kreuz bietet im Jahr 2012 insgesamt 99 Kurse in Borken, Borkenwirthe, Burlo, Gemen und Weseke an. Die TeilnehmerInnen können dabei aus den folgenden Aktivitäten wählen:
Feldenkrais
Zumba-Fitness
Gymnastik
Yoga
Aerobic/Fitness
Aquafitness / Wassergymnastik
Pilates
Rückenschule
BIG für Kinder
Qi-Gong
Klettern Die Familienbildungsstätte Borken bietet im Jahr 2012 in 52 Kurse in Borken, Weseke und Rhedebrügge Kursen unter anderem die folgenden Aktivitäten an:
(Rücken-)Gymnastik
Yoga
Fitness/Aerobic
Pilates
Tai-Chi
Meditation
Wassergymnastik
Sportanbieter in Borken | 110
4.3 Vereinsbefragung
4.3.1 Überblick zu den antwortenden Vereinen Zur Erfassung der Situation der Sportvereine in Borken wurden im Juni 2011 37 Vereine angeschrieben. Insgesamt beteiligten sich dann 23 Vereine an der Befragung (62,2%). Von den 23 antwortenden Vereinen geben 13 Prozent an, dass sie bis zu 100 Mitglieder haben, 101-300 Mitglieder sind in 34,9 Prozent der Vereine zu finden, 8,6 Prozent geben an, 301-500 Mitglieder zu haben und 17,4 Prozent der Vereine haben 501-800 Mitglieder. In 26,1 Prozent der Vereine sind sogar über 800 Mitglieder angemeldet (vgl. Abb. 48).
13
34,9
8,6
17,4
26,1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
bis 100 Mitglieder 101 ‐ 300 Mitglieder
301 ‐ 500 Mitglieder
501 ‐ 800 Mitglieder
über 800 Mitglieder
Anzahl Mitglieder%
n = 23
Abb. 48: Größe der antwortenden Vereine
Dabei geben die Borkener Sportvereine an, dass etwa 48 Prozent der aktiven Mitglieder auf den Bereich Breitensport und 46 Prozent auf den Bereich Freizeit/Gesundheit entfallen. Nur sechs Prozent der aktiven Sportler in den befragten Vereinen betreiben Leistungssport. Stellt man die verzeichneten Ein- und Austritte der Vereine im Jahr 2010 gegenüber, so ist ein Übergewicht an Austritten festzustellen. Während der Großteil der Vereine (41%) zwar einen bis zehn mehr Ein- als Austritte verbucht hat, haben 18,2 Prozent einen Rückgang um elf bis 50 Mitglieder und 9,1 Prozent um über 50 Mitglieder zu beklagen (vgl. Abb. 49).
Sportanbieter in Borken | 111
9,1
18,2
9,1 9,1
41,0
13,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
über 50 mehr Austritte
11 ‐ 50 mehr Austritte
1 ‐ 10 mehr Austritte
weder noch 1 ‐ 10 mehr Eintritte
über 10 mehr Eintritte
Verhältnis Ein‐ zu Austritten 2010 %
Gesamteintritte: 1352
n = 22
Gesamtaustritte: 1515
Abb. 49: Verhältnis von Ein- und Austritten in 2010
4.3.2 Zwecke und Zielstellungen der Vereine Für die Borkener Sportvereine sind das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Förderung der Gesundheit mit jeweils 95,7 Prozent die wichtigsten Aspekte. Das Miteinander und soziale Kontakte werden mit 95,6 Prozent als nahezu gleichwichtig eingestuft. Während auch die Jugendarbeit, die Vermittlung von Werten, das Freizeitsport-Angebot sowie die Teilhabe der Mitglieder an Entscheidungen mit jeweils 86,9 Prozent als wichtige Aspekte betrachtet werden, sind Angebote in der Offenen Ganztagsschule für die Vereine von geringerer Bedeutung (34,7%). Als unwichtiger werden lediglich niedrige Preise bzw. günstige Gebühren (22,7%), ein nicht-sportliches Angebot (21,7%) und die Mithilfe bei sozialen Problemen im Stadtteil (18,2%) erachtet (vgl. Abb. 50 und Abb. 51).
Sportanbieter in Borken | 112
21,7
13,6
21,7
13
47,8
65,2
65,2
56,5
47,8
43,5
43,5
47,8
59,1
52,2
73,9
39,1
21,7
21,7
34,8
47,8
52,2
52,2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Modernes&effizientes Management
Gesellschaftspolitische Verantwortung
Niedrige Preise/günstige Gebühren
Teilhabe d. Mitgl. an Entscheidungen
Freizeitsport‐Angebot
Vermittlung von Werten
Jugendarbeit
Hohe Qualität des Angebots
Miteinander und soziale Kontakte
Förderung der Gesundheit
Zusammengehörigkeitsgefühl
Wichtigkeit folgender Aspekte für die Borkener Sportvereine (1/2)
sehr wichtig ziemlich wichtig
%
n = 22‐23
Abb. 50: Wichtigkeit verschiedener Aspekte für die Borkener Sportvereine (1/2)
9,1
4,3
4,5
13
18,2
18,2
8,7
8,7
17,4
22,7
21,7
9,1
17,4
18,2
21,7
18,2
27,3
39,1
39,1
30,4
36,4
39,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Mithilfe bei sozialen Problemen im Stadtteil
Nicht‐sportliches Angebot
Politischer Einfluss des Vereins
Angebote in der Offenen Ganztagsschule
Breites Sportangebot
Professionelle Dienstleistung
Erfolge im Wettkampfsport
Pflege von Tradition
Integration von ausländischen Mitbürgern
Kooperation mit Schulen, Kindergärten u.a.
Vereinswachstum / Hohe Mitgliederzahlen
Wichtigkeit folgender Aspekte für die Borkener Sportvereine (2/2)
sehr wichtig ziemlich wichtig
%
n = 22‐23
Abb. 51: Wichtigkeit verschiedener Aspekte für die Borkener Sportvereine (2/2)
Sportanbieter in Borken | 113
4.3.3 Problemstellungen der Vereine Das Sichern bzw. Ausbauen von Einnahmen durch Spenden (56,5%) bereitet den Borkener Sportvereinen die größten Probleme. Doch auch die Gewinnung und der Erhalt von ehrenamtlichen Mitarbeitern (43,5%) sowie die zurückgehende Förderung durch öffentliche Mittel (41%) stellen große Probleme dar. Für gut ein Drittel der befragten Vereine ist zudem die Gewinnung bzw. der Erhalt von Übungsleitern problematisch. Während die Attraktivierung bestehender Angebote und der Gewinn bzw. der Erhalt von Mitgliedern für jeweils etwa ein Viertel der Vereine Probleme mit sich bringen, führen die Weiterbildung der Übungsleiter, die gewachsenen Ansprüche der Mitglieder an den Verein sowie häufige Vereinsein- und -austritte mit jeweils 13 Prozent selten zu Problemen für die Vereine (vgl. Abb. 52 und Abb. 53).
4,5
4,3
13
17,4
21,7
9,1
17,4
4,3
18,2
21,7
26,1
21,7
17,4
17,4
31,8
26,1
52,2
0 10 20 30 40 50 60
Örtliche Konkurrenz durch Sportvereine
Gewinnung / Erhalt von Mitgliedern
Bestehende Angebote attraktiver zu gestalten
Gewinnung / Erhalt von Übungsleitern
Verwaltungsaufwand / Bürokratisierung
Zeitliche Verfügbarkeit der Sportstätten
Zurückgehende Förderung durch öffentliche Mittel
Gewinnung / Erhalt von ehrenamtlichen Mitarbeitern
Einnahmen durch Spenden sichern bzw. ausbauen
Problemstellung Borkener Sportvereine (1/2)
sehr großes Problem größeres Problem
%
n = 22‐23
Abb. 52: Problemstellungen der Borkener Vereine (1/2)
Sportanbieter in Borken | 114
4,3
4,3
4,3
4,3
8,7
4,5
8,7
8,7
13
8,7
8,7
8,7
13
8,7
13,6
13
13
8,7
0 10 20 30 40 50 60
Hohe Fluktuation bzw. häufige Ein‐ und Austritte in den Verein
Gewachsene Ansprüche der Mitglieder an den Verein
Weiterbildung der Übungsleiter
Geringe oder abnehmende Wahrnehmung des Vereine in der Öffentlichkeit
Fehlende politische Unterstützung
Finanzielle Situation des Vereins
Entwicklung neuer Sportangebote
Örtliche Konkurrenz durch kommerzielle Sportanbieter
Zustand der genutzten Sportstätten
Problemstellung Borkener Sportvereine (2/2)
sehr großes Problem größeres Problem
%
n = 22‐23
Abb. 53: Problemstellungen der Borkener Vereine (2/2)
In der örtlichen Konkurrenz durch Sportvereine sehen sogar zwei Vereine ihre Existenz bedroht. Die finanzielle Situation des Vereins sowie die Gewinnung bzw. der Erhalt von Übungsleitern stellt für jeweils einen Verein eine Existenzbedrohung dar. Letzterer Aspekt hängt sicherlich auch mit einem der größten Probleme für die Sportvereine zusammen – dem Aspekt „ehrenamtliche Mitarbeit“. Betrachtet man diesen genauer, so geben ganze 64 Prozent der Vereine an, dass bei ihnen ein Mangel an ehrenamtlicher Tätigkeit vorliegt (vgl. Abb. 54).
Sportanbieter in Borken | 115
64%
36%
Gibt es in Ihrem Verein einen Mangel an ehrenamtlicher Mitarbeit?
Ja
Nein
n = 22
Abb. 54: Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern
4.3.4 Mögliche Maßnahmen der Vereine Fragt man die Vereine danach, welche Maßnahmen für sie in Frage kommen, wird deutlich, dass neben Sportangeboten im Bereich Fitness/Gesundheit vor allem die Einmischung in Fragestellungen der kommunalen Sportpolitik erwogen bzw. bereits umgesetzt werden. Dagegen kommen Angebote im Bereich der Offenen Ganztagsschule für über die Hälfte der Vereine nicht in Frage (vgl. Abb. 55 und Abb. 56).
Sportanbieter in Borken | 116
28,6
42,9
42,9
47,3
47,6
61,9
28,6
9,5
19
15,8
9,5
14,3
19
9,5
14,3
15,8
4,8
23,8
38,1
23,8
21,1
38,1
23,8
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen um Kosten zu senken/Aufgaben zu teilen
Zusammenarbeit mit anderen Vereinen um Erfolge zu erzielen
In Anspruchnahme externer Beratung
Offene Kursangebote
Veranstalten von Vereinsfesten
Einmischung in Fragestellung der kommunalen Sportpolitik
Inwiefern kommen folgende Maßnahmen für Ihren Verein in Frage (1/2)?
wird bereits durchgeführt wird im Vorstand diskutiert noch nicht drüber nachgedacht Kommt nicht in Frage
n = 19‐21
Abb. 55: Mögliche Maßnahmen der Vereine (1/2)
25
28,6
28,6
30
33,3
52,4
10
23,8
33,3
30
9,5
19
15
9,5
14,3
15
4,8
14,3
50
38,1
23,8
25
52,4
14,3
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Beteiligung an Nutzungsoptimierung kommunaler Sportstättem
Sportangebote im Bereich Reha/Gesundheit
Sponsoringkonzept
Sportangebote im Sinne der Jugendhilfe
Angebote im Bereich der Offenen Ganztagsschule
Sportangebote im Bereich Fitness/Gesundheit
Inwiefern kommen folgende Maßnahmen für Ihren Verein in Frage (2/2)?
wird bereits durchgeführt wird im Vorstand diskutiert noch nicht drüber nachgedacht Kommt nicht in Frage
n = 20‐21
Abb. 56: Mögliche Maßnahmen der Vereine (2/2)
Sportanbieter in Borken | 117
4.3.5 Finanzielle Rahmenbedingungen Betrachtet man die Mittelwerte der monatlichen Beiträge aufgeschlüsselt nach verschiedenen Gruppen, so ergeben sich deutliche Unterschiede. Während Erwachsene im Schnitt 12,60 € und Kinder bzw. Jugendliche 9,90 € pro Monat bezahlen, liegt der Familienbeitrag im Mittel bei monatlich 23,40 € und passive Mitglieder zahlen im Durschnitt jeden Monat 4,10 €. Demgegenüber ist die Aufnahmegebühr für Familien mit durchschnittlich 188,80 € deutlich am höchsten. Der entsprechende Wert beträgt für Erwachsene 57,10 € und für Kinder bzw. Jugendliche 30,10 €. Passive Mitglieder zahlen für die Aufnahme in einen Borkener Sportverein im Schnitt 15,00 €. Gut drei Viertel der Vereine unterscheiden bei der Bemessung der Beiträge nicht zwischen den unterschiedlichen Abteilungen (vgl. Abb. 57 bis Abb. 59).
12,6
9,9
23,4
4,1
20,8
0
5
10
15
20
25
Erwachsene (n=21)
Kinder/Jugendliche (n=18)
Familien (n=15)
Passiv (n=12)
Sonstige (n=9)
Monatliche Beiträge‐Mittelwerte ‐€
Abb. 57: Mittelwerte der monatlichen Beiträge
Sportanbieter in Borken | 118
57,1
30,1
188,8
15
50
0
50
100
150
200
Erwachsene (n=7)
Kinder/Jugendliche (n=7)
Familien (n=4)
Passiv (n=4)
Sonstige(n=1)
Aufnahmegebühr‐Mittelwerte ‐€
Abb. 58: Mittelwerte der erhobenen Aufnahmegebühr
24%
76%
Gibt es unterschiedliche Beiträge und Gebühren in den einzelnen Abteilungen?
Ja
Nein
n = 21
Abb. 59: Unterschiedliche Beiträge und Gebühren zwischen den Abteilungen
Sportanbieter in Borken | 119
Auch das Haushaltsvolumen fällt sehr unterschiedlich aus. Während es bei fünf Prozent der betrachteten Vereine eine Grenze von 5.000 € nicht überschreitet, rangieren jeweils ein Viertel der Vereine in den Bereichen 10.001 bis 70.000 € bzw. 70.001 bis 130.000 €. Das Haushaltsvolumen von 15 Prozent der Vereine übersteigt sogar die Marke von 190.000 €. Dabei stellen die Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren mit durchschnittlich 56 Prozent den größten Anteil an der Finanzierung der Vereine dar, gefolgt von eigenwirtschaftlicher Tätigkeit mit 16 Prozent. Unterdessen machen öffentliche Mittel bzw. Zuschüsse sowie das Sponsoring nur jeweils neun Prozent der Vereinshaushalte aus, der Spendenanteil liegt bei gerade einmal vier Prozent (vgl. Abb. 60 und Abb. 61).
5
20
25 25
10
15
0
5
10
15
20
25
30
bis 5.000 5.001‐10.000 10.001‐70.000 70.001‐130.000 130.001‐190.000 über 190.000
Haushaltsvolumen des Vereins 2010%
n = 20
Abb. 60: Haushaltsvolumen der Vereine in 2010
Sportanbieter in Borken | 120
56%
4%
9%
9%
16%
6%
Verteilung der zur Verfügung stehenden Finanzmittel auf die folgenden Bereiche
Mitgliedsbeiträge und Aufnahmegebühren
Spenden
Öffentlich Mittel / Zuschüsse
Sponsoring
eigenwirtschaftliche Tätigkeit
Sonstiges
n = 22‐23
Abb. 61: Verteilung der Finanzmittel auf die verschiedenen Bereiche
4.3.6 Sportanlagen Die Bewertung der Sportanlagen fällt insgesamt positiv aus, doch kristallisieren sich zwischen den Sportanlagen-Typen Unterschiede heraus. Mit der eigenen Turn- und Sporthallensituation sind 19,1 Prozent der befragten Vereine eher zufrieden bis sehr zufrieden. Eher unzufrieden sind dagegen nur 9,5 Prozent und kein Verein äußert sich sehr unzufrieden. Der Großteil jedoch lässt sich zu keiner dieser Kategorien zuordnen und siedelt sich in deren Mitte an (52,4%). Betrachtet man die Zufriedenheit mit der Sportplatzsituation, ergibt sich dagegen ein anderes Bild. Hier stehen insgesamt 35 Prozent zufriedene Vereine 15 Prozent unzufriedenen Vereinen gegenüber. Allerdings sahen sich 45 Prozent nicht in der Lage, die Situation bewerten zu können. Noch eindeutiger fällt die Beurteilung der Schwimmbadsituation aus, die von 45,5 Prozent der Vereine positiv eingestuft wird. Lediglich 9,1 Prozent sind anderer Meinung und mit der Situation der Schwimmbäder unzufrieden. Auch hier gaben gut 40 Prozent an, keine Einschätzung abgeben zu können (vgl. Abb. 62 bis Abb. 64).
Sportanbieter in Borken | 121
0
9,5
52,4
14,3
4,8
19
0
10
20
30
40
50
60
sehr unzufrieden
eher unzufrieden
teils, teils eher zufrieden sehr zufrieden kann ich nicht beurteilen
Zufriedenheit mit der Turn‐ und Sporthallensituation
%
n = 21
Abb. 62: Zufriedenheit mit der Turn- und Sporthallensituation
5
10
5
30
5
45
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
sehr unzufrieden
eher unzufrieden
teils, teils eher zufrieden sehr zufrieden kann ich nicht beurteilen
Zufriedenheit mit der Sportplatzsituation%
n = 20
Abb. 63: Zufriedenheit mit der Sportplatzsituation
Sportanbieter in Borken | 122
9,1
4,5
27,3
18,2
40,9
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
sehr unzufrieden
eher unzufrieden
teils, teils eher zufrieden sehr zufrieden kann ich nicht beurteilen
Zufriedenheit mit derSchwimmbadsituation
%
n = 22
Abb. 64: Zufriedenheit mit der Schwimmbadsituation
Gefragt nach den Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen antwortet über die Hälfte der Borkener Sportvereine, dass nicht ausreichend Zeit zur Verfügung steht. Lediglich 20 Prozent sind mit den ihnen zur Verfügung stehenden Zeiten zufrieden (vgl. Abb. 65).
20%
55%
25%
Stehen genügend Zeiten in Turn‐ und Sporthallen zur Verfügung?
Ja
Nein
kann ich nicht beurteilen
n = 20 Abb. 65: Bewertung der zur Verfügung stehenden Turn- und Sporthallenzeiten
Bezüglich der Nutzungszeiten der Sportplätze sind 37 Prozent der Borkener Sportvereine mit der zur Verfügung stehenden Zeit zufrieden und nur zehn Prozent geben an, dass nicht
Sportanbieter in Borken | 123
ausreichend Zeit zur Verfügung steht. 53 Prozent geben an, die Situation nicht beurteilen zu können (vgl. Abb. 66).
37%
10%
53%
Stehen genügend Zeiten auf Sportplätzen zur Verfügung?
Ja
Nein
kann ich nicht beurteilen
n = 19 Abb. 66: Bewertung der zur Verfügung stehenden Sportplatzzeiten
Während 24 Prozent der Vereine angeben, mit den Nutzungszeiten der Schwimmbäder zufrieden zu sein, antworten 14 Prozent, dass die zur Verfügung stehenden Schwimmbadzeiten nicht ausreichen. 62 Prozent der Vereine geben an, auf diese Fragestellung nicht antworten zu können (vgl. Abb. 67).
24%
14%62%
Stehen genügend Zeiten in Schwimmbädern zur Verfügung?
Ja
Nein
kann ich nicht beurteilen
n = 21 Abb. 67: Bewertung der zur Verfügung stehenden Schwimmbadzeiten
Von den befragten Sportvereinen fühlen sich 66,7 Prozent immer oder meistens rechtzeitig über ungeplante Hallenschließungen informiert und 9,5 Prozent der Vereine geben an, diese
Sportanbieter in Borken | 124
Informationen nur selten zu erhalten. Während 23,8 Prozent sagen, dass es bisher keine ungeplanten Schließungen der von ihnen genutzten Hallen gab, scheint ein völliges Versagen des Informationsflusses keinen Verein zu betreffen (vgl. Abb. 68). Tritt bei der Nutzung einer Sportanlage ein Problem auf, z.B. bei der Belegung aufgrund defekter Sportgeräte, so wissen 80 Prozent der Vereine, wer ihr zuständiger Ansprechpartner ist (vgl. Abb. 69).
9,5
57,2
9,5
23,8
0
10
20
30
40
50
60
70
immer meistens selten nie gab es bisher nicht
Fühlen Sie sich rechtzeitig informiert beiungeplanten Hallenschließungen / Platzsperren?
%
n = 21 Abb. 68: Informationsfluss bei Hallenschließungen/Platzsperren
Sportanbieter in Borken | 125
80%
5%
15%
Kennen Sie bei auftretenden Problemen den jeweils zuständigen Ansprechpartner?
Ja
Nein
Zum Teil
n = 20
Abb. 69: Kenntnis über zuständige Ansprechpartner
Im Laufe der Befragung konnten sich die Vereine außerdem zur Zufriedenheit mit den von ihnen am häufigsten genutzten Sportanlagen äußern. Betrachtet man die am meisten genutzten Sporthallen, so sind die Vereine mit dem Bereich Umkleiden/Sanitäranlagen am wenigsten zufrieden. Die Zufriedenheitswerte liegen hier zwischen 25 Prozent (Toiletten) und 46,6 Prozent (Umkleiden) (vgl. Abb. 70). Bezogen auf die Sporthalle selbst, sind über 80 Prozent der befragten Vereine mit der Sauberkeit der Sportfläche zufrieden. Auch der Zugang zu den Sportgeräten stellt die Nutzer zufrieden (78,5%). Am wenigsten zufrieden sind die Vereine in diesem Bereich mit der zeitlichen Nutzbarkeit (43,8%) und der Luftqualität/Belüftung (37,5%) (vgl. Abb. 71). Mit Blick auf das Umfeld und sonstige Aspekte ist die Zufriedenheit mit den Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, der Sicherheit des Zugangs und der Sauberkeit des Umfelds mit jeweils 81,3 Prozent am größten. Hier lässt vor allem die Zuschauerkapazität (23,1%) zu wünschen übrig (vgl. Abb. 72). Betrachtet man die Gesamtzufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sporthallen, so stehen 62,6 Prozent zufriedene Vereine 18,8 Prozent unzufriedenen Vereinen gegenüber (vgl. Abb. 73).
Sportanbieter in Borken | 126
12,5
6,3
15,4
13,3
12,5
18,8
23,1
33,3
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Toiletten
Unterbringung der eigenen Sachen
Duschen
Umkleiden
Zufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sporthallen‐ Umkleiden / Sanitärbereich ‐
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 13‐16
Abb. 70: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Umkleide/Sanitär)
25
6,7
6,3
7,1
6,3
18,8
21,4
12,5
37,5
18,8
46,7
56,3
56,3
57,1
64,3
62,5
50
57,1
68,8
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Luftqualität / Belüftung
zeitliche Nutzbarkeit
baulicher Zustand der Anlage
Lichtverhältnisses / Beleuchtung
Qualität der Sportfläche
Zustand der Sportgeräte
Anzahl der Sportgeräte
(Raum‐) Atmosphäre
Eignung für die Sportart
Zugang zu Sportgeräten
Sauberkeit der Sportfläche
Zufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sporthallen
‐ Sporthalle ‐
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 6‐25
Abb. 71: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Halle)
Sportanbieter in Borken | 127
7,7
7,7
18,8
25
6,3
12,5
31,3
15,4
30,8
50
50
75
68,8
50
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Zuschauerkapazität
Anbindung am dem öffentlichen Nahverkehr
Parkmöglichkeiten
Erreichbarkeit eines Ansprechpartners
Sauberkeit des Umfelds
Sicherheit des Zugangs
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
Zufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sporthallen
‐ Umfeld / Sonstiges ‐
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 6‐31
Abb. 72: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Umfeld/Sonstiges)
0
18,8 18,8
56,3
6,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
sehr unzufrieden eher unzufrieden teils, teils eher zufrieden sehr zufrieden
Gesamtzufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sporthallen%
n = 20 Abb. 73: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Gesamt)
Sportanbieter in Borken | 128
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Betrachtung der am meisten genutzten Sportplätze. So sind die Vereine auch hier mit dem Bereich Umkleiden/Sanitäranlagen am wenigsten zufrieden, wobei die Werte zwischen 28,6 Prozent (Unterbringung der eigenen Sachen) und 57,2 Prozent (Umkleiden) liegen (vgl. Abb. 74). Bezogen auf den Sportplatz selbst, ist die Zufriedenheit mit der Sauberkeit der Sportfläche ebenfalls am größten. Die Kategorien Anzahl und Zustand der Sportgeräte erreichen mit 85,7 Prozent einen gleich hohen Zufriedenheitswert. Am wenigsten zufrieden sind die Vereine in diesem Bereich mit der Qualität der Sportfläche und dem baulichen Zustand der Anlage (jeweils 28,6%) (vgl. Abb. 74). Mit Blick auf das Umfeld und sonstige Aspekte ist die Zufriedenheit mit der Erreichbarkeit eines Ansprechpartners mit 90 Prozent am größten. An dieser Stelle lassen die Abstellmöglichkeiten für Fahrräder (28,6%) aus Sicht der Vereine zu wünschen übrig (vgl. Abb. 76). Betrachtet man die Gesamtzufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sportplätzen, so zeigt sich ein sehr zwiespältiges Bild. Während 42,9 Prozent der befragten Sportvereine insgesamt zufrieden sind, ist die gleiche Anzahl mit der Situation unzufrieden (vgl. Abb. 77).
14,3
28,6
28,6
28,6
14,3
14,3
14,3
28,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Unterbringung der eigenen Sachen
Toiletten
Duschen
Umkleiden
Zufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sportplätzen‐ Umkleiden / Sanitärbereich ‐
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 12
Abb. 74: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Umkleide/Sanitär)
Sportanbieter in Borken | 129
14,3
14,3
16,7
14,3
14,3
28,6
33,3
25
14,3
14,3
28,6
14,3
14,3
16,7
28,6
28,6
14,3
33,3
50
71,4
71,4
57,1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
baulicher Zustand der Anlage
Qualität der Sportfläche
Lichtverhältnisses / Beleuchtung
Zugang zu Sportgeräten
Eignung für die Sportart
zeitliche Nutzbarkeit
Luftqualität / Belüftung
(Raum‐) Atmosphäre
Zustand der Sportgeräte
Anzahl der Sportgeräte
Sauberkeit der Sportfläche
Zufriedenheit mit den meistgenutzten genutzten kommunalen Sportplätzen
‐ Sportplatz ‐
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 14‐33 Abb. 75: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Platz)
14,3
14,3
14,3
28,6
28,6
28,6
14,3
40
42,9
57,1
42,9
42,9
71,4
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
Anbindung am dem öffentlichen Nahverkehr
Parkmöglichkeiten
Zuschauerkapazität
Sicherheit des Zugangs
Sauberkeit des Umfelds
Erreichbarkeit eines Ansprechpartners
Zufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sportplätzen
‐ Umfeld / Sonstiges ‐
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 14‐29 Abb. 76: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Umfeld/Sonstiges)
Sportanbieter in Borken | 130
14,3
28,6
14,3
28,6
14,3
0
5
10
15
20
25
30
35
sehr unzufrieden eher unzufrieden teils, teils eher zufrieden sehr zufrieden
Gesamtzufriedenheit mit den meistgenutzten kommunalen Sportplätzen%
n = 20 Abb. 77: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Gesamt)
4.3.7 Sportverwaltung und -politik Von den befragten Vereinen hatten 96 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten Kontakt zur Sportverwaltung der Stadt Borken (vgl. Abb. 78).
96%
4%
Hatte Ihr Verein in den letzten 12 Monaten Kontakt zur Sportverwaltung der Stadt Borken?
Ja
Nein
n = 23
Abb. 78: Kontakt mit der Sportverwaltung der Stadt Borken
Sportanbieter in Borken | 131
In Bezug auf die Freundlichkeit des Personals und die Erreichbarkeit der jeweils zuständigen Stelle sind jeweils 86,4 Prozent der Vereine eher oder sogar sehr zufrieden. 76,2 Prozent bewerten die Fachkompetenz des Personals positiv. Mit 57,1 Prozent sind die Vereine in Bezug auf die Sportverwaltung mit der Schnelligkeit und Erledigung des Anliegens am unzufriedensten (vgl. Abb. 79).
19
15,8
20
42,9
27,3
45,5
38,1
42,1
40
33,3
59,1
40,9
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Schnelligkeit und Erledigung des Anliegens
Flexibilität zur Lösung des Problems
Beitrag der Sportverwaltung zur Bewältigung der Aufgabe
Fachkompetenz des Personals
Erreichbarkeit der zuständigen Stelle
Freundlichkeit des Personals
Zufriedenheit mit der Sportverwaltung der Stadt Borken
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 19‐22
Abb. 79: Zufriedenheit mit der Sportverwaltung der Stadt Borken
Fragt man die Sportvereine nach ihrer Zufriedenheit mit den unterschiedlichen Leistungen der Stadt Borken, so zeigt sich folgendes Bild. Die Wartung und Pflege der Sportstätten (77,8%) und die Unterstützung bei Veranstaltungen (75,1%) werden mit Abstand am besten bewertet, wohingegen die Vergabe von Nutzungs-/Trainingszeiten nur von 37,5 Prozent als gerecht bzw. zufriedenstellend bezeichnet wird. Am schlechtesten schneidet die Unterstützung bei Bauvorhaben ab (36,4%) (vgl. Abb. 80).
Sportanbieter in Borken | 132
18,2
12,5
16,7
15,8
5,9
4,3
11,1
18,8
11,1
18,2
25
22,2
26,3
50
47,1
54,5
52,2
50
56,3
66,7
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Unterstützung bei Bauvorhaben
Gerechte Vergabe von Nutzungs‐/Trainingszeiten
Bau neuer Sportstätten
Bereitstellung von Sportstätten
Vermittlung bei Konflikten und Streitigkeiten
Allgemeine Informationen und Beratungsleistungen
Transparenz der Entscheidungen bzw. der Entscheidungskriterien
Finanzielle Unterstützung
Renovierung/Modernisierung von kommunalen Sportstätten
Unterstützung bei Veranstaltungen
Wartung und Pflege der Sportstätten
Zufriedenheit mit folgenden Leistungen und Hilfen der Stadt Borken
sehr zufrieden eher zufrieden
%
n = 6‐23
Abb. 80: Zufriedenheit mit den Leistungen der Stadt Borken
Vom SSV Borken wird in erster Linie eine Beratung der Vereine erwartet, diesen Aspekt stufen alle der befragten Vereine als wichtig oder teilweise wichtig ein. Doch auch die politische Lobbyarbeit sowie Fortbildungsangebote werden von den Vereinen als wichtige bzw. teilweise wichtige Hilfen und Angebote beschrieben (jeweils 89,5%). Hilfestellungen bei Kooperationen mit Schulen dagegen werden von den wenigsten Vereinen als wichtig erachtet, auch wenn der Anteil immer noch bei 75 Prozent liegt (vgl. Abb. 81). Besonders zufrieden sind die Vereine mit der Förderung von Kooperationen zwischen Vereinen durch den SSV Borken (100%). Die als weniger wichtig beurteilen Hilfestellungen bei Kooperationen mit Schulen werden gleichzeitig auch als am wenigsten zufriedenstellend (70%) bewertet (vgl. Abb. 82).
Sportanbieter in Borken | 133
44,4
45
52,7
55
55
73,7
44,4
30
36,8
25
45
15,8
11,2
25
10,5
20
10,5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Förderung Kooperation zwischen Vereinen
Hilfestellungen bei Kooperation mit Schulen
Fortbildungsangebote
Unterstützung bei Veranstaltungen
Beratung der Vereine
Politische Lobbyarbeit
Wichtigkeit folgender Hilfen und Angebote des SSV Borken
wichtig teilweise wichtig unwichtign = 18‐20
Abb. 81: Wichtigkeit verschiedener Hilfen und Angebote des SSV Borken
40
55
64,3
64,3
66,6
69,2
30
35
21,4
28,6
26,7
30,8
30
10
14,3
7,1
6,7
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Hilfestellungen bei Kooperation mit Schulen
Beratung der Vereine
Fortbildungsangebote
Unterstützung bei Veranstaltungen
Politische Lobbyarbeit
Förderung Kooperation zwischen Vereinen
Zufriedenheit mit folgenden Hilfen und Angeboten des SSV Borken
zufrieden teilweise zufrieden unzufriedenn = 10‐20
Abb. 82: Zufriedenheit mit verschiedenen Angeboten des SSV Borken
Sportanbieter in Borken | 134
4.3.8 Netzwerkstrukturen und -bedarfe
4.3.8.1 Quantität und Intensität der Vernetzung der Sportvereine mit anderen Organisationen in Borken
Die Sportvereine in Borken arbeiten am häufigsten mit anderen Sportvereinen zusammen: Annähernd drei Viertel der befragten Sportvereine (70%; n=23) geben eine Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen an. An zweiter Stelle der wichtigsten Kooperationspartner der Borkener Sportvereine stehen die Schulen (61%). Auch mit Kindergärten, Betrieben und Ärzten kooperieren viele Borkener Sportvereine (43% bzw. 35%). Je ein Viertel der Sportvereine arbeitet mit einer Kirchengemeinde, einer Jugendeinrichtung, einer Krankenkasse oder einer kulturellen Einrichtung zusammen. Noch etwas weniger häufig betrieben wird von den Sportvereinen in Borken eine Zusammenarbeit mit Senioreneinrichtungen, Trägern des Ganztags, sozialen Trägern oder der Polizei (vgl. Abb. 83).
Abb. 83: Kooperationen mit anderen Vereinen oder Einrichtungen
Betrachtet man die Zusammenarbeit der Sportvereine mit anderen Organisationen nach der Intensität, ergibt sich eine andere Rangfolge: Eine enge Zusammenarbeit erfolgt am häufigsten mit Schulen (6 Vereine). Fünf Sportvereine arbeiten eng oder sogar sehr eng mit Kindergärten zusammen. Eine enge Kooperation mit anderen Sportvereinen geben vier Sportvereine an. Auch mit Betrieben, Ärzten, Senioreneinrichtungen oder Krankenkassen
Sportanbieter in Borken | 135
findet bei sehr wenigen Borkener Sportvereinen (je 1 bis 3) eine sehr enge oder enge Zusammenarbeit statt (vgl. Abb. 84).
Abb. 84: Intensität der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen oder Einrichtungen
4.3.8.2 Gewünschte Vernetzung der Sportvereine mit anderen Organisationen in Borken
Hinsichtlich der gewünschten Zusammenarbeit der Sportvereine mit anderen Organisationen stehen ebenfalls die Schulen ganz oben in der Rangfolge. 13 Borkener Sportvereine würden gerne mehr bzw. enger mit Schulen zusammenarbeiten, zehn Sportvereine mit Trägern der Offenen Ganztagsschule. Zwischen fünf und sieben Vereinen würden gerne mehr mit Kindergärten, Betrieben, Jugendeinrichtungen, Krankenkassen, Jugendeinrichtungen oder anderen Sportvereinen kooperieren. Mit kulturellen oder kommerziellen Einrichtungen, Ärzten oder einer Kirchengemeinde würden nur ein bis zwei Sportvereine gerne mehr zusammenarbeiten (vgl. Abb. 85).
Sportanbieter in Borken | 136
1
1
1
2
5
5
6
6
6
7
10
13
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kirchen (‐Gemeinden)
Ärzte
kommerzielle Sportanbieter
Kulturelle Einrichtungen
Jugendeinrichtungen
Krankenkassen
Betriebe/Unternehmen
mit anderen Sportvereinen
Senioreneinrichtungen
Kindergärten
Träger Offener Ganztag
Schulen
Mit welchen Einrichtungen ist mehr Zusammenarbeit gewünscht?
Nennungen
n = 16
Abb. 85: Erwünschte Kooperationspartner
4.3.9 Kommentare der Vereine zu Sportverwaltung und Sportpolitik Den Borkener Sportvereinen wurde anhand einer offenen Fragestellung die Möglichkeit gegeben, Probleme darzulegen, um welche sich die Politik und die Verwaltung ihrer Ansicht nach verstärkt kümmern sollten (vgl. Anhang). Das größte Augenmerk wird hierbei auf die aktuelle Sportstättensituation und deren Verbesserung gelegt (insgesamt 13 Nennungen). Fünf dieser Nennungen beziehen sich auf einen Mangel an Sportanlagen und fordern einen Ausbau, zwei weitere beziehen sich auf die Verbesserung der Schwimmbadsituation. In vier Fällen werden Forderungen nach Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen laut und zwei Vereine erwarten eine zügige und transparente Umsetzung von Bauvorhaben. Auch die Folgen des demographischen Wandels werden besonders häufig thematisiert (insgesamt 8 Nennungen). Neben der allgemeinen Anführung der Problematik wird speziell auf den Aspekt der Integration eingegangen (2) sowie die Notwendigkeit von Gesundheits- und Präventionsmaßnahmen (1) sowie von weiteren neuen bzw. Trendsportarten (2) hervorgehoben. Ein Verein wünscht sich für die hierdurch notwendige Umorganisation die Begleitung durch Sportverwaltung und -politik. Ferner wird die Zusammenarbeit mit Schulen thematisiert (insgesamt 7 Nennungen). Hier wird eine Verzahnung von Schule und Verein in den Nachmittagsstunden verlangt (3), wofür sich ein Verein Unterstützung bei der Erarbeitung eines Konzepts zur Zusammenarbeit mit
Sportanbieter in Borken | 137
Schulen erwünscht. An dieser Stelle wird auch eine finanzielle Unterstützung bei der Einbindung der Vereine in den Offenen Ganztag gefordert. Auf der anderen Seite wird durch einen Verein kritisiert, dass es durch die Ganztagsschulen kein Vereinsdenken mehr gibt. Ein weiteres Themengebiet stellt die Förderung ehrenamtlicher Mitarbeit dar, bei welcher sich vier Vereine mehr Unterstützung erhoffen. Neben einer generellen stärkeren finanziellen Unterstützung wünschen sich die Vereine außerdem, dass Gelder gerecht verteilt werden und es insgesamt zu einer ausgewogenen Gleichbehandlung der Vereine kommt.
Sportanbieter in Borken | 138
4.4 Empfehlungen für die Vereine in Borken
Für die Sportvereine ist ein gravierender Wandel der Rahmenbedingungen zu konstatieren. Verantwortlich für diese Veränderung sind insbesondere folgende Entwicklungsdynamiken:
Demographischer Wandel (weniger Junge, mehr Ältere)
Kostendruck der öffentlichen Hand
Erosion des klassischen Ehrenamts
Neue gesellschaftspolitische Aufgabenstellungen (vor allem Ganztagsschule)
Veränderte Sportbedürfnisse der Bevölkerung (Dienstleistungsanspruch) Folgende Empfehlungen können den Vereinen in Borken auf Basis der Untersuchungen gegeben werden9:
Die Sportvereine sollten eine engere Zusammenarbeit untereinander prüfen, Kooperationen ausbauen und ggf. über Fusionen nachdenken. Mögliche Felder der Zusammenarbeit stellen zum Beispiel eine gemeinsame Übungsleitergewinnung, die Entwicklung gemeinsamer Angebote, eine Zusammenarbeit im Bereich Verwaltung, eine gemeinsame Nachwuchsarbeit und eine gemeinsame Sportstättennutzung dar.
Die Vereine sollten – unter anderem mit Hinblick auf die gestiegenen Dienstleistungsansprüche der Mitglieder – ihre Strukturen überprüfen und diese gegebenenfalls modernisieren bzw. professionalisieren. Insbesondere sind hier die Bereiche Mitgliederverwaltung und –betreuung zu nennen.
Die Sportvereine sollten prüfen, inwiefern sie schon auf veränderte Angebotswünsche der Bevölkerung reagiert haben (vgl. u.a. Kapitel 3.3 und 3.11). Dies sind unter anderem Angebote in den Bereichen Schwimmen, (Nordic-)Walking, Gymnastik, Badminton, Klettern, Fitness und Tanz. Im Allgemeinen bieten sich auch neue Angebote für spezielle Zielgruppen an: Seniorensport, Eltern und Kinder, Frauen und Mädchen, Migranten, Präventions- und Rehabilitations- sowie Gesundheitsangebote.
Die Sportvereine sollten angesichts veränderter Bedürfnisse neue Konzepte freiwilliger Mitarbeit bzw. ehrenamtlichen Engagements entwickeln. Erforderlich ist dies insbesondere auch aufgrund des hohen Altersdurchschnitts und des hohen Anteils an männlichen Sportfunktionären.
Die Sportvereine sollten prüfen, inwiefern sie mit Schulen, Kindergärten, Jugendzentren und anderen Einrichtungen kooperieren und sich in Netzwerken engagieren können. Hierdurch können sie ihre Attraktivität für die Mitglieder steigern und neue Mitglieder gewinnen, neue Ressourcen erhalten und ihr politisches Gewicht erhöhen.
Die Sportvereine sollten sich ihrer gesellschaftspolitischen Potenziale noch mehr bewusst werden und noch aktiver an der Lösung gesellschaftlicher Probleme mitwirken und eingebunden werden.
9 Aufgrund der heterogenen Struktur der Sportvereine in Borken ist davon auszugehen, dass verschiedenen Vereine schon Empfehlungen umsetzen. Daher sollten die Empfehlungen als Katalog angesehen werden, mit dem der Stand der Vereinsarbeit überprüft werden kann.
Sportanbieter in Borken | 139
Die Sportvereine sollten über spezielle Sponsorenkonzepte oder über Angebote im Sinne der Gesundheitsförderung oder der Jugendhilfe versuchen, sich neue Geldquellen zu erschließen.
KiTa und Schule | 140
5 KiTa und Schule
5.1 Ergebnisse der KiTa-Befragung
Im Juni 2011 wurden die 23 KiTas im Stadtgebiet Borkens angeschrieben und gebeten, sich an einer Umfrage zur motorischen Entwicklung in Kindergärten und Kindertagesstätten zu beteiligen. Von den 23 KiTas schickten 21 den ausgefüllten Fragebogen wieder zurück, was einem Rücklauf von 91,3 Prozent entspricht.
5.1.1 Räume für Sport und Bewegung In 90,5 Prozent der befragten Einrichtungen ist ein Mehrzweck- bzw. Turnraum für Bewegungsaktivitäten vorhanden (vgl. Abb. 86). Darüber hinaus sind in 81 Prozent der befragten Einrichtungen Flure und Verkehrsflächen für Bewegungsaktivitäten nutzbar (vgl. Abb. 87).
90,5%
9,5%
Ist ein Mehrzweck‐ bzw. Turnraum vorhanden?
ja
nein
n= 21
Abb. 86: Ausstattung mit einem Turnraum
KiTa und Schule | 141
81%
19%
Sind Flure/Verkehrsflächen für "Bewegung" nutzbar?
ja
nein
n= 21
Abb. 87: Nutzbarkeit von Fluren und Verkehrsflächen
5.1.2 Bewegungsförderung Fragt man die ErzieherInnen, ob Bewegungs- und Koordinationsprobleme bei Kindergartenkindern in den letzten Jahren zugenommen haben, so bejahen dies insgesamt 90,4 Prozent der Befragten (vgl. Abb. 88). Alle Einrichtungen geben an, dass sie eine regelmäßige Bewegungsförderung für alle Kinder bereits umsetzen. Trotzdem halten rund 94,7 Prozent der Einrichtungen eine stärkere Bewegungsförderung in ihrem Hause für sinnvoll. Allerdings sehen sich die Hälfte der KiTas nicht im Stande, eine stärkere Bewegungsförderung im Rahmen ihrer täglichen Arbeit umzusetzen (vgl. Abb. 89 bis Abb. 91).
KiTa und Schule | 142
19
71,4
4,8 4,8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
ja, bei fast allen Kindern
ja, bei einigen Kindern nein, generell nicht weiß nicht
Haben Bewegungs‐ und Koordinations‐probleme bei Kindergartenkindern in den
letzten Jahren zugenommen?%
n=21
Abb. 88: Veränderung der Koordinationsprobleme bei Kindergartenkindern in den letzten Jahren
100%
Wird in Ihrer Einrichtung eine regelmäßige Bewegungsförderung aller Kinder bereits
umgesetzt?
ja
n=21
Abb. 89: Umsetzung einer regelmäßigen Bewegungsförderung
KiTa und Schule | 143
94,7%
5,3%
Halten Sie eine stärkere Bewegungsförderung in Ihrem Kindergarten für sinnvoll?
ja
nein
n=19
Abb. 90: Halten Sie eine stärkere Bewegungsförderung für sinnvoll?
50%50%
Halten Sie eine stärkere Bewegungsförderung im Rahmen Ihrer
täglichen Arbeit für möglich?
ja
nein
n=18
Abb. 91: Halten Sie eine stärkere Bewegungsförderung im Rahmen ihrer täglichen Arbeit für möglich?
KiTa und Schule | 144
Gäbe es die Möglichkeit, sich an einem Projekt zur Bewegungsförderung zu beteiligen, so hätten 47,6 Prozent der Einrichtungen ein großes bis sehr großes Interesse an einer Teilnahme (vgl. Abb. 92).
19
28,6
42,9
9,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
sehr groß groß durchschnittlich gering
Wie groß ist Ihr Interesse, sich an einem Projekt zur Bewegungsförderung zu
beteiligen?
%
n=21
Abb. 92: Interesse zur Beteiligung an einem Projekt zu Bewegungsförderung
Während 40 Prozent der ErzieherInnen die Berücksichtigung des Bereichs der Bewegungs-förderung und Psychomotorik von Kindern in der eigenen Ausbildung als ungenügend bewertet, ist die Hälfte der Befragten der Meinung, dass dieser Bereich durchschnittlich stark berücksichtigt wird. Jeweils fünf Prozent empfinden eine starke bzw. eine völlig unzureichende Behandlung dieser Thematik (vgl. Abb. 93).
KiTa und Schule | 145
5
50
40
5
0
10
20
30
40
50
60
stark durchschnittlich ungenügend gar nicht/völlig unzureichend
Wie stark wird Ihrer Meinung nach der Bereich Bewegungsförderung /Psychomotorik in der Ausbildung von ErzieherInnen berücksichtigt ?%
n=20
Abb. 93: Berücksichtigung des Bereichs Bewegungsförderung/Psychomotorik in der Ausbildung der ErzieherInnen
Befragt nach der Initiative „Bewegungskindergärten“ der Sportjugend und des LSB NRW, geben 95,2 Prozent der Befragten an, davon schon einmal gehört zu haben, bei den übrigen 4,8 Prozent der Einrichtungen handelt es sich um zertifizierte Bewegungskindergärten (vgl. Abb. 94).
KiTa und Schule | 146
4,8%
95,2%
Kennen Sie die Initiative „Bewegungskindergärten“ der Sportjugend und
des Landessportbundes NRW?
ja, unsere Einrichtung ist zetifizierter Bewegungskindergarten
ja, ich habe davon gehört
n=21
Abb. 94: Bekanntheit der Initiative „Bewegungskindergärten“
Der Anteil der KiTas, in denen in altersgleichen bzw. in altersgemischten Gruppen geturnt wird, liegt bei jeweils 19 Prozent. 62 Prozent der KiTas geben an, dass die Gruppeneinteilung unterschiedlich ausfällt (vgl. Abb. 95).
19%
19%
62%
Wird in altersgleichen oder altersgemischten Gruppen geturnt?
in altersgleichen Gruppenin altersgemischten Gruppen (3‐6 Jahre)unterschiedlich
n=21
Abb. 95: Turnen in altersgleichen oder altersgemischten Gruppen
KiTa und Schule | 147
Betrachtet man die Maßnahmen zur Bewegungsförderung, die in den KiTas bereits umgesetzt werden, so zeigt, dass in fast allen Einrichtungen (95%) die Möglichkeit besteht, auch bei schlechtem Wetter auf dem Außengelände zu spielen. Auch wird in den meisten KiTas (90,9%) eine wöchentliche Turn-/Bewegungsstunde durchgeführt. Eine ganztägige Nutzung des Außengeländes mit freiem Zutritt je nach Wünschen der Kinder ist dagegen nur in 59,1 Prozent der Tagesstätten möglich und eine tägliche angeleitete Bewegungszeit mit einer Dauer von etwa 15 bis 20 Minuten gibt es in nur 22,7 Prozent der befragten Einrichtungen (vgl. Abb. 96).
22,7
59,1
81,8
86,4
90,9
95,5
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Durchführung einer täglichen angeleiteten Bewegungszeit mit einer Dauer von ca. 15‐20 Min.
Ganztägige Öffnung des Außenspielgeländes, freier Zutritt je nach den Wünschen der Kinder
Einbeziehung der Flure, des Eingangsbereiches oder anderer Nebenräume für Bewegungsaktivitäten der Kinder
Integration von Bewegungsspielen in den Tagesablauf, je nach den Bedürfnissen der Kinder
Durchführung einer wöchentlichen Turnstunde / Bewegungsstunde
Möglichkeit des Spielens auf dem Außengelände, auch bei schlechtem Wetter
Welche Maßnahmen zur Bewegungsförderung werden in Ihrer
Einrichtung bereits umgesetzt?
n=22
%
Abb. 96: Umgesetzte Maßnahmen zur Bewegungsförderung
Als wichtigste Maßnahmen zur Verbesserung der Bewegungsförderung werden mit je 100 Prozent eine ständige Öffnung des Turnraumes sowie die Integration von Bewegungsspielen in den Tagesablauf bezeichnet. Der Möglichkeit des Spielens auf dem Außengelände auch bei schlechtem Wetter wird mit 95,2 Prozent ebenfalls eine große Bedeutung beigemessen. Gleiches gilt für die Schaffung von Voraussetzungen für gruppenübergreifende Aktivitäten sowie für die Durchführung einer wöchentlichen Turnstunde. Diese Maßnahmen werden von jeweils 90 Prozent der KiTas als sehr bzw. äußerst wichtig eingestuft. Die Durchführung einer täglichen angeleiteten Bewegungszeit mit einer Dauer von etwa 15 bis 20 Minuten wird dagegen von nur 30 Prozent der Einrichtungen als wichtige Maßnahme erachtet (vgl. Abb. 97). Auf organisatorischer Ebene beschreiben 94,5 Prozent der befragten KiTas eine bessere räumliche Gestaltung des Kindergartens als wichtige Maßnahme zur
KiTa und Schule | 148
Bewegungsförderung. Während 85,7 Prozent der Einrichtungen eine Zusammenarbeit mit den Eltern für wichtig halten, erachtet lediglich die Hälfte aller KiTas die Durchführung von Elterninformationsveranstaltungen als eine bedeutsame Maßnahme (vgl. Abb. 98).
20
28,6
11,1
19
52,4
47,6
25
45
19
42,9
44,4
10
23,8
61,1
61,9
28,6
38,1
65
45
76,2
57,1
55,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Durchführung einer täglichen angeleiteten Bewegungszeit mit einer Dauer von ca. 15‐20 Min.
Regelmäßige Durchführung von längeren Spaziergängen
Ganztägige Öffnung des Außenspielgeländes, freier Zutritt je nach den Wünschen der Kinder
Einbeziehung der Flure, des Eingangsbereiches oder anderer Nebenräume für Bewegungsaktivitäten der Kinder
Regelmäßige Durchführung von Projekten mit Bewegungs‐bzw. Wahrnehmungsbezug in der Einrichtung
Stärkere Einbeziehung von Aktivitäten zur Förderung der sinnlichen Wahrnehmung
Durchführung einer wöchentlichen Turnstunde
Schaffung von Voraussetzungen für gruppenübergreifende Aktivitäten
Möglichkeit des Spielens auf dem Außengelände, auch bei schlechtem Wetter
Integration von Bewegungsspielen in den Tagesablauf, je nach den Bedürfnissen der Kinder
Ständige Öffnung des Turnraumes
Wichtigkeit von Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Bewegungsförderung in Kindergärten
sehr wichtig äußerst wichtig
%
n = 18‐21
Abb. 97: Wichtigkeit verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Bewegungsförderung in Kindergärten
KiTa und Schule | 149
36,8
44,4
36,8
47,4
40
55
38,1
38,9
10,5
5,6
26,3
21,1
45
30
47,6
55,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Kooperation mit einem ortsansässigen Sportverein
Durchführung von Elterninformationsveranstaltungen
Verstärkte Zusammenarbeit mit Kinderärzten
Mehr Anregungen und Hilfen zur Bewegungsförderung
Bessere Ausstattung mit Geräten/Materialien zur Bewegungsförderung
Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen "frühkindliche Bewegungsförderung"
Zusammenarbeit mit den Eltern
Bessere räumliche Gestaltung des Kindergartens
Wichtigkeit von zusätzlichen organisatorischen Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der
Bewegungsförderung
sehr wichtig äußerst wichtig
%
n = 18‐21
Abb. 98: Wichtigkeit verschiedener organisatorischer Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der Bewegungsförderung in Kindergärten
Der Umfang der angebotenen Turnstunden liegt in 80 Prozent der KiTas zwischen 41 und 60 Minuten und in 10 Prozent der Fälle übersteigt das Angebot einen Umfang von 70 Minuten. Gleichzeitig liegt der wöchentliche Umfang sonstiger Bewegungsangebote in 30 Prozent der KiTas bei über zwei Stunden. 20 Prozent der Einrichtungen bieten in diesem Bereich ein bis zwei Stunden und ebenfalls 20 Prozent der KiTas zwischen einer halben und einer Stunde wöchentlich an. In ganzen 30 Prozent der Einrichtungen liegt der Umfang sonstiger Bewegungsangebote bei unter einer halben Stunde (vgl. Abb. 99 und Abb. 100).
KiTa und Schule | 150
5
45
35
5
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
bis 40 Minuten 41‐50 Minuten 51‐60 Minuten 61‐70 Minuten über 70 Minuten
Umfang der angebotenen Turnstunden pro Woche
%
n=20
Abb. 99: Umfang der Turnstunden pro Woche
30
20
10 10
30
0
5
10
15
20
25
30
35
bis 30 Minuten 31 ‐ 60 Minuten 61 ‐ 90 Minuten 91‐ 120 Minuten über 120 Minuten
Umfang sonstiger Bewegungsangebote pro Woche
%
N=10
Abb. 100: Umfang sonstiger Bewegungsangebote pro Woche
KiTa und Schule | 151
Um das Außengelände für Bewegungsaktivitäten nutzen zu können, sollte es idealerweise bewegungsfreundlich gestaltet sein. 45 Prozent der befragten Einrichtungen geben an, in letzter Zeit in diese Gestaltung investiert zu haben. Weiterhin sagen 84,6 Prozent der befragten KiTas, dass sie Interesse daran haben, Anregungen und Informationen für eine bewegungsfreundliche Außengeländegestaltung zu bekommen (vgl. Abb. 101 und Abb. 102).
45%
55%
Haben bei Ihnen in der letzten Zeit Aktivitäten zur Gestaltung eines bewegungsfreundlichen
Außengeländes stattgefunden?
ja
nein
n=20
Abb. 101: Gestaltung eines bewegungsfreundlichen Außengeländes in letzter Zeit
In einer offenen Fragestellung wurden die KiTas gebeten, die Aktivitäten zur Gestaltung des Außengeländes näher zu beschreiben (vgl. Anhang). Neben Angaben zur generellen Sanierung und Neuplanung des Geländes (2 Nennungen) wird vor allem auf die Anschaffung von Schaukeln, Rutschen, Kletternetzen, Trampolinen usw. eingegangen (4). In einem Fall soll das Aufstellen kleinerer Spielgeräte die Kinder zusätzlich zu Bewegung animieren. Drei KiTas geben an, durch bessere Wege, Spielhügel oder Höhlen „freie Aktivitäten“ wie Rennen oder Ballspielen fördern zu wollen.
KiTa und Schule | 152
84,6%
15,4%
Haben Sie Interesse an Informationen über eine bewegungsfreundliche
Außengeländegestaltung?
ja
nein
n=13 Abb. 102: Interesse an Informationen über eine bewegungsfreundliche Gestaltung des
Außengeländes
5.1.3 Kooperationen mit Sportvereinen Grundsätzlich zeigen 65 Prozent der befragten Einrichtungen ein Interesse daran, über das Angebot von Sportvereinen im Bereich der spielerischen frühkindlichen Bewegungserziehung informiert zu werden. 94 Prozent können sich darüber hinaus eine Kooperation mit einem Sportverein vorstellen, der in diesem Bereich aktiv ist (vgl. Abb. 103 und Abb. 104).
KiTa und Schule | 153
65%
35%
Sind Sie daran interessiert, über das Angebot von Sportvereinen im Bereich der spielerischen
frühkindlichen Bewegungserziehung informiert zu werden?
ja
nein
n=20
Abb. 103: Interesse an Informationen über frühkindliche Bewegungserziehung in Sportvereinen
94%
6%
Können Sie sich eine Kooperation Ihrer Einrichtung mit einem Sportverein vorstellen, der auf dem Gebiet der spielerischen frühkindlichen Bewegungserziehung aktiv
ist?
ja
weiß nicht
n=17
Abb. 104: Möglichkeit einer Kooperation mit Sportvereinen
KiTa und Schule | 154
Um die Kooperation mit Sportvereinen realisieren zu können, braucht es natürlich auch Sportvereine und -angebote in der Umgebung der jeweiligen KiTa. Bittet man die Einrichtungen, die Sportvereinsangebote für Vorschulkinder einzuschätzen, so scheinen geeignete und preiswerte Angebote vorhanden und gut erreichbar zu sein. Zeitlich liegen sie aus Sicht der KiTas weitestgehend günstig und entsprechen außerdem den Bewegungsbedürfnissen der Kinder. Auch scheinen sie den Einrichtungen größtenteils bekannt zu sein (vgl. Tab. 51).
KiTa und Schule | 155
Tab. 51: Einschätzung der Sportvereinsangebote für Kinder im Vorschulalter
zutref-fend
(in %)
eher zutreffend
(in %)
teils-teils
(in %)
eher nicht zutreffend
(in %)
nicht zutreffend
(in %)
keine Aussage möglich (in %)
Andere Anbieter haben für Kinder im Vorschulalter bessere Angebote zur Bewegungsförderung. (n=17)
17,6 0 11,8 0 5,9 64,7
Vereine haben keine geeigneten Angebote für Kinder im Vorschulalter. (n=18)
0 5,6 11,1 22,2 38,9 22,2
Vereine arbeiten bereits im Vorschulalter leistungssportorientiert. (n=20)
20 5 30 15 10 20
Die Angebote der Vereine für Kinder im Vorschulalter sind zu wenig bekannt. (n=20)
5 15 40 5 20 15
Die Angebote der Vereine für Kinder im Vorschulalter entsprechen den Bewegungsbedürfnissen der Kinder. (n=20)
30 25 15 5 0 25
Die Angebote sind gut zu erreichen. (n=20)
30 15 20 0 5 30
Die ortsnahen Vereine verfügen über geeignete Übungsleiter. (n=19)
21,1 5,3 15,8 10,5 0 47,4
Vereine sind zu stark an veralteten Vorstellungen (z.B. Vereinsmeierei) orientiert. (n=20)
0 5 25 10 30 30
Ich kenne keine geeigneten Angebote in der Umgebung unserer Einrichtung. (n=19)
0 5,3 10,5 5,3 57,9 21,1
Die Zeiten der Vereinsangebote liegen günstig. (n=19)
31,6 15,8 21,1 0 0 31,6
Die Vereinsangebote sind preiswert. (n=20)
45 10 5 0 0 40
KiTa und Schule | 156
5.1.4 Sonstige Anmerkungen der KiTas Den KiTas stand zum Ende der Befragung die Möglichkeit offen, weitere Anmerkungen in die Erhebung einfließen zu lassen. Es wird an dieser Stelle die Bedeutung der Bewegungsförderung hervorgehoben und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass ein weiterer Ausbau dieser Angebote, in einem Fall aus räumlichen Gründen, in einem anderen Fall aufgrund anderer Schwerpunkte, nicht möglich ist. Weiter wird die Wichtigkeit von Bewegung im Alltag als Möglichkeit betont, den Kindern ein umfangreiches Bewegungsangebot zu bieten. Auch scheint es, als seien die KiTas offen für Anregungen von außen. So zeigt sich eine Einrichtung interessiert an Hospitationen in anderen KiTas oder Bewegungseinrichtungen, eine andere KiTa hält einen externen Gymnastiklehrer für mehr Angebote für sinnvoll. Ferner gibt eine Einrichtung an, sich künftig mehr mit ortsnahen Bewegungsangeboten für Vorschulkinder befassen und verstärkt Spielplätze und Waldflächen in der Umgebung nutzen zu wollen.
KiTa und Schule | 157
5.2 Befragung der Schulsportbeauftragten
Im Juni 2011 wurden 21 Schulen der Stadt Borken angeschrieben und gebeten, an der Befragung zur Situation des Schulsports in Borken teilzunehmen. An der Befragung beteiligten sich 16 Schulen, was einem Rücklauf von 76,2 Prozent entspricht.
5.2.1 Sportstätten aus der Sicht der Schulen Die Beantwortung der Frage, ob die Voraussetzungen der Sportstättensituation einen optimalen Schulunterricht zulassen, zeigt eine sehr unterschiedliche Bewertung der Sporthallen durch die Schulen. So geben 46,7 Prozent der Schulen an, dass sie mit geringen Einschränkungen ihren Schulunterricht durchführen können. 6,7 Prozent halten dies sogar ohne Einschränkungen für möglich. Allerdings sehen sich auch 26,7 Prozent in der optimalen Unterrichtsgestaltung eingeschränkt, weitere 20 Prozent erkennen sogar große bis sehr große Einschränkungen (vgl. Abb. 105). Ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass sich die Möglichkeiten und der Zustand der Sportstätten eher positiv auf die eigene Motivation auswirken. Der gleiche Anteil sieht diesbezüglich einen (eher) positiven Einfluss auf die Motivation der Schulklassen. Ebenfalls ein Drittel bewertet den Einfluss auf die eigene Motivation negativ, die Motivation der Schulklassen sehen 20 Prozent (eher) negativ beeinflusst (vgl. Abb. 106).
Lassen aus Ihrer Sicht die Voraussetzungen der Sportstättensituation einen optimalen Schulunterricht zu?
6,7
46,7
26,7
6,7
13,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
ja, uneingeschränkt
ja, mit geringen Einschränkungen
nur mit Einschränkungen
nur mit großen Einschränkungen
nur mit sehr großen
Einschränkungen
Rücklauf: 76,2%
n=15
%
Abb. 105: Möglichkeit eines optimalen Schulunterrichts
KiTa und Schule | 158
Wie wirken sich Ihrer Meinung nach Möglichkeiten und Zustand der Sportstätte(n) auf...
0
33,3 33,3 33,3
0
13,3
20
46,7
13,3
6,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
positiv eher positiv kein Einfluss eher negativ negativ
...Ihre Motivation als SportlehrerIn aus? ...die Motivation Ihrer Schulklasse aus?
n=15
%
Abb. 106: Auswirkungen des Zustands der Sportstätten
68,8 Prozent der Schulen fühlen sich meistens bis immer rechtzeitig über ungeplante Hallenschließungen bzw. Platzsperren informiert. 31,3 Prozent geben an, noch nicht in dieser Situation gewesen zu sein. Sollten Probleme mit einer Sportanlage auftreten, kennen 69 Prozent der Schulen ihren Ansprechpartner (vgl. Abb. 107 und Abb. 108).
KiTa und Schule | 159
25
43,8
0 0
31,3
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
immer meistens selten nie gab es bisher nicht
Fühlen Sie sich rechtzeitig informiert beiungeplanten Hallenschließungen / Platzsperren?
%
n = 16
Abb. 107: Informationsfluss bei ungeplanten Hallenschließungen
Kennen Sie bei auftretenden Problemen die jeweils zuständigen Ansprechpartner?
69%
31%
Ja
zum Teil
n=16
Abb. 108: Kenntnis über zuständige Ansprechpartner
KiTa und Schule | 160
5.2.2 Probleme zur Erfüllung des Stundensolls im Sportunterricht Betrachtet man die Gründe, wieso an einigen Schulen nicht das vorgegebene Soll an Sportstunden unterrichtet wird, so zeigt sich, dass aus Sicht der Schulen die Ausweitung des Sportunterrichts im Wesentlichen aufgrund anderer Nutzer der Sportstätte unmöglich ist (53,3%). Ferner wird der Mangel an Sportlehrern (43,8%) als problematisch beschrieben. Zu wenige für den Sportunterricht zur Verfügung stehende Sportstätten stellen für 40 Prozent der Befragten ein Problem dar. Den Unterrichtsausfall durch Erkrankungen sowie durch den Ausgleich von Unterrichtsausfall in anderen Fächern bewerten dagegen nur jeweils rund sechs Prozent als problematisch (vgl. Abb. 109).
46,7
56,3
60
81,3
93,3
33,3
31,3
20
12,5
20
12,5
20
6,3
6,7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Die Ausweitung des Sportunterrichts ist wegen anderer Nutzer der Sportstätte
unmöglich
Es sind zu wenig Sportlehrer vorhanden
Es stehen zu wenig geeignete Sportstätten zur Verfügung
Erkrankungen führen zu Unterrichtsausfall
Sportstunden werden zum Ausgleich von Unterrichtsausfall in anderen Fächern
genutzt
kein Problem Problem großes Problemn=15‐16
Welche Probleme bestehen im Hinblick auf die Erfüllung des Stundensolls an Sportunterricht an Ihrer Schule?
Abb. 109: Probleme zur Erfüllung des Stundensolls im Sportunterricht
67 Prozent der Schulen geben an, genügend Schwimmzeiten zur Verfügung zu haben. Dementsprechend besteht für 33 Prozent der Schulen ein Defizit an Schwimmzeiten, wobei drei Schulen einen Fehlbedarf von insgesamt 18 Stunden angeben (vgl. Abb. 110).
KiTa und Schule | 161
Stehen Ihrer Schule genügend Schwimmzeiten zur Verfügung?
67%
33%
Ja
Nein
3 Schulen haben dabei einen Fehlbedarf von insgesamt 18 Stunden angegeben.n=15
Abb. 110: Stehen genügend Schwimmzeiten zur Verfügung?
Den baulichen Zustand der Sportstätten bewerten 56,3 Prozent der Schulen als stark verbesserungswürdig. Auch in der prinzipiellen Eignung der Sportstätten für Trendsportarten sehen etwas über die Hälfte der Schulen starken Verbesserungsbedarf. Hervorzuheben ist außerdem, dass in Bezug auf kleinere Reparaturen und Instandsetzungen für 93,3 Prozent geringer bis starker Handlungsbedarf besteht. Auch die Ausstattung der Sportstätten lässt für 86,7 Prozent der Schulen zu wünschen übrig. An der Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Sportstätten muss aus Sicht der Mehrheit dagegen nichts geändert werden (vgl. Abb. 111).
KiTa und Schule | 162
18,8
25
25
26,7
33,3
33,3
53,3
56,3
31,3
18,8
43,8
60
33,3
60
33,3
43,8
50
56,3
31,3
13,3
33,3
6,7
13,3
… die Abstimmung mit anderen Nutzern der Sportstätten?
… die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Sportstätten?
… ausrechende Belegzeiten/‐ möglichkeiten der Sportstätten?
… die Ausstattung der Sportstätten für die Durchführung des Unterrichts?
… die Eignung der Sportstätten für die Durchführung des Unterrichts?
… kleinere Reparaturen und Instandsetzungen der Sportstätten
… die prinzipielle Eignung der Sportstätten für Trendsportarten?
… den baulichen Zustand der zur Verfügung stehenden Sportstätten?
starker Bedarf geringer Bedarf kein Bedarfn=15‐16
Gibt es an Ihrer Schule Verbesserungsbedarf für die Sportstätten in Bezug auf...
Prozent
Abb. 111: Verbesserungsbedarf für die Sportstätten
5.2.3 Kooperationen Von den befragten Schulen geben 25 Prozent an, in Sachen Schulsport mit anderen Schulen zu kooperieren. Dabei erfolgt die Zusammenarbeit überwiegend in Form von schulübergreifenden Sport AGs (25%), gemeinsame Sportfeste spielen mit 6,3 Prozent kaum eine Rolle (vgl. Abb. 112 und Abb. 113).
KiTa und Schule | 163
Gibt es an Ihrer Schule in Sachen Schulsport übergreifende Kooperationen mit anderen Schulen?
25%
75%
Ja
Nein
n=16
Abb. 112: Kooperationen mit anderen Schulen
Wie sieht Ihre Kooperation mit anderen Schulen aus?
6,3
25
100
100
93,8
75
gemeinsamer Sportunterricht
schulübergreifende Wettkämpfe
gemeinsame Sportfeste
schulübergreifende Sport AGs
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja Neinn=16
Abb. 113: Formen der Kooperation mit anderen Schulen
KiTa und Schule | 164
Kooperationen mit Vereinen oder anderen Anbietern finden nur geringfügig häufiger statt als Kooperationen mit anderen Schulen. Es zeigt sich, dass 31,3 Prozent der befragten Schulen in diesem Bereich aktiv sind. Meist geschieht die Zusammenarbeit durch Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreuung (56,3%). Der Talentförderung bzw. dem Wettkampfsport kommen dagegen genauso wie dem kompensatorischen Sport mit jeweils 12,5 Prozent kaum Bedeutung zu. So gibt die Hälfte der Schulen an, dass im Rahmen der Ganztagsschule bereits Vereinsangebote durchgeführt werden, weitere 21,4 Prozent planen dies. Während der gleiche Prozentsatz angibt, sich mit dieser Frage noch nicht auseinandergesetzt zu haben, kommt eine solche Maßnahme für lediglich 7,1 Prozent nicht in Frage (vgl. Abb. 114 bis Abb. 116).
Gibt es im Rahmen des Schulsports Kooperationen Ihrer Schule mit Vereinen oder anderen Anbietern?
31,3%
68,8%
Ja
Nein
n=16
Abb. 114:Kooperationen mit Vereinen / anderen Anbietern
KiTa und Schule | 165
In welchen Bereichen findet die Kooperation statt?
12,5
12,5
56,3
87,5
87,5
43,8
kompensatorischer Sport
Talentförderung / Wettkampfsport
Angebote im Rahmen der Ganztagsbetreung
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Ja Neinn=16
Abb. 115: Formen der Kooperation mit Vereinen / anderen Anbietern
Können Sie sich vorstellen, dass im Rahmen der Ganztagsschule Sportangebote von Vereinen an Ihrer Schule durchgeführt werden?
50
21,4
0
21,4
7,1
0
10
20
30
40
50
60
ja, gibt es bereits an unserer Schule
ja, wir planen dies wir diskutieren dies im Kollegium/in der Schulleitung
wir haben noch nicht darüber nachgedacht
nein, das kommt für uns nicht in
Frage
n=14
%
Abb. 116: Können Sie sich Kooperationen mit Vereinen / anderen Anbietern vorstellen?
KiTa und Schule | 166
5.3 Offener Ganztag
Wie in anderen Kommunen in Nordrhein-Westfalen wurde in Borken das Angebot der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS) stark ausgebaut. Die Offene Ganztagsschule wird in Borken an allen Grundschulen, außer in Hoxfeld und Marbeck, angeboten. Im Schuljahr 2012/13 wird das Angebot von 412 Kindern wahrgenommen. Darüber hinaus ist die Entwicklung der Ausweitung der Schulzeiten an weiterführenden Schulen auf den Nachmittag („gebundener“ Ganztag) auch für die Stadt Borken absehbar. Dieser wird in Borken bereits an den Realschulen Nünning und Maria-Sybilla-Merian in den Klassenstufen 5 bis 7 durchgeführt. Zudem bietet die Remigius-Hauptschule und die Schönstätter Marienschule ein freiwilliges/offenes Nachmittagsangebot an. Der stetige Ausbau der offenen und gebundenen Ganztagsschule geht von Seiten vieler Sportvereine einher mit Bedenken und Zukunftsängsten, dass diese Entwicklung sich negativ für sie auswirken könnte. Vor diesem Hintergrund wurde in einer eigenen Erhebung in Oberhausen die Frage untersucht, inwiefern Ganztagsunterricht an Gesamtschulen Einfluss auf die Sportaktivität und die Vereinsmitgliedschaft von Schülern nimmt. An Gesamtschulen ist Nachmittagsunterricht die Regel. Es fand dabei eine schriftliche Befragung von 1.500 Schülerinnen und Schülern der 6., 8. und 10. Klassen der Oberhausener Gesamtschulen Heinrich-Böll, Osterfeld und Weierheide statt. Der Rücklauf betrug 1.122 Fragebögen. Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:
95 Prozent der Schüler treiben mindestens einmal pro Woche außerhalb des Sportunterrichts Sport (die meisten dreimal pro Woche (40%) oder zweimal (24%)).
44 Prozent der befragten Gesamtschüler sind Mitglied in einem Sportverein (weitere 36 Prozent waren schon einmal Mitglied in einem Sportverein).
15 Prozent der Schüler nehmen regelmäßig an einer Sport-AG teil.
83 Prozent der befragten Schüler hätten gerne mehr Sport in der Woche. 67 Prozent hätten gerne mehr Sport in der Schule, 22 Prozent gerne mehr Sport im Verein.
43 Prozent der befragten Gesamtschüler geben an, nach der Schule am Nachmittag keine Lust oder Power mehr für andere Aktivitäten zu haben.
59 Prozent der Schüler, die Sport treiben, geben an, durch die Schule am Nachmittag nicht in ihrer Teilnahme am Vereinssport beeinflusst zu werden.
Circa 15 bis 20 Prozent der Schüler der Gesamtschule (in den Klassen 6 bis 10) haben sich aufgrund des Schulunterrichts am Nachmittag abgemeldet.
Eine durch das Institut für Sportsoziologie Ende 2011 durchgeführte Befragung von Eltern im Rhein-Kreis Neuss zeigte einen geringen Einfluss des Ganztags auf das Sportreiben ihrer Kinder in Vereinen. So waren 12 Prozent der Eltern der Meinung, dass ihr Kind aufgrund der Bewegungsangebote im offenen Ganztag nicht mehr nachmittags im Verein Sporttreiben
KiTa und Schule | 167
muss. Rund 9 Prozent der Eltern sagten, dass ihr Kind aufgrund des Ganztages gar keine Zeit mehr hat Sport im Verein zu betreiben (vgl. Abb. 117).
Abb. 117: Elternbefragung zum Thema Einfluss des Ganztags auf Sportreiben im Verein
Das Ergebnis, wonach der Ganztagsunterricht lediglich schwache Auswirkungen auf das Sporttreiben und die Sportaktivität im Verein hat, bestätigt auch eine langfristige Untersuchung des Willibald Gebhardt Instituts Essen (2009) im Auftrag des Landessportbundes NRW. Auch hier wurden die häufig artikulierten Risiken und Chancen des Offenen Ganztags für Sportvereine untersucht und auf die Rückwirkungen auf die Struktur der örtlichen Sportvereine eingegangen. Laut dieser Studie verlieren Sportvereine, die im Rahmen der Ganztagsschule aktiv sind, weniger Mitglieder als Sportvereine, die sich nicht am Ganztag beteiligen. Demnach verlieren die im Ganztag engagierten Vereine bei den 7 bis 14-Jährigen ein Prozent, hingegen Vereine, die sich im Ganztag nicht engagieren, bis zu sieben Prozent ihrer jungen Mitglieder. Die Studie kommt zu folgenden Schlussfolgerungen:
Kooperationen mit Ganztagsschulen durchweg positiv
Steigerung des Bekanntheitsgrades
KiTa und Schule | 168
Erschließung neuer Zielgruppen und Stabilisierung der Mitglieder Somit sollte es Ziel der Borkener Sportvereine – im Rahmen ihrer Möglichkeiten – sein, sich aktiv mit Angeboten im Offenen Ganztag zu engagieren.
KiTa und Schule | 169
5.4 Kinder- und Jugendgesundheit
In den westlichen Industriegesellschaften hat sich die Lebens- und Bewegungswelt von Kindern und Jugendlichen grundlegend verändert. Kennzeichen dieses sozialen Wandels sind:
veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen (Zunahme der sozialen Ungleichheit),
Wandel der Familienstruktur (u.a. Tendenz zu alleinerziehenden Eltern und Einzelkindern),
Verlust an Bewegungsräumen (Einschränkung von unkontrollierten Spiel- und Bewegungsgelegenheiten),
Mediatisierung (der mediale Einfluss führt zu einer verstärkten Reizüberflutung, wodurch Kinder immer mehr Erfahrungen aus 'zweiter Hand' machen),
Verhäuslichung (die Straßenkindheit löst sich zunehmend auf und Kindern werden geschützte, abgeschlossene und umbaute Räume zugewiesen) und
Verinselung der Kinder v.a. in städtischen Räumen.
Zwischen dem schnellen sozialen Wandel und zunehmendem Bewegungsmangel besteht ein enger Zusammenhang. Ein ausreichendes Maß an Bewegung ist für die gesunde Entwicklung von Kindern unabdingbar. Dies scheint jedoch bei vielen Kindern nicht mehr gewährleistet zu sein. So werden regelmäßig, z. B. im Rahmen von Schuleingangsuntersuchungen durch das Kreisgesundheitsamt Borken, hohe Inzidenzraten von Koordinationsstörungen festgestellt. Ebenfalls stellen Übergewicht und Adipositas im frühen Kindesalter ein Problem dar (vgl. Abb. 118). Wobei die Stadt Borken in den letzten Jahren unter den Gesamtwerten des Kreises lag. In gleicher Weise beunruhigend ist darüber hinaus der Sachverhalt, dass sich mit den motorischen Defiziten im Kindesalter die Dispositionen für chronisch-degenerative Krankheiten im Erwachsenenalter ausbilden und das Mortalitäts-, stärker aber noch das Morbiditätsspektrum in modernen Industriegesellschaften bestimmen. So stellt Bewegungsmangel im höheren Lebensalter unter anderem einen bedeutenden Risikofaktor für die Entstehung chronisch-degenerativer Erkrankungen dar (insb. Herz-Kreislauf-Erkrankungen / Erkrankungen des muskulo-skelettalen Systems). Die gelungene Sozialisation für regelmäßige Sport- und Bewegungsaktivitäten muss im Kindes- und Jugendalter erreicht werden. Wer als Kindergarten- und später als Schulkind schlechte und/oder unzureichende Bewegungserfahrungen macht, wird als Erwachsener kaum regelmäßige Sportaktivitäten entwickeln. Bereits in der frühen Kindheit fallen demnach wichtige Entscheidungen für den Gesundheitsstatus eines Menschen.
Sportstätten | 171
6 Sportstätten
6.1 Allgemeine Entwicklungen und Bedarfe
In diesem Kapitel werden allgemeine Tendenzen dargestellt, die kurz illustrieren sollen, dass sich für Städte als Folge gesellschaftlicher Entwicklungen völlig veränderte Anforderungen an ihren Sport- und Bewegungsraum ergeben. Als zentrale Entwicklungen für den Bereich Sportanlagen/Sportgelegenheiten können dabei identifiziert werden: 1. Eine Vergrößerung und Veränderung der Nachfrage spezieller Zielgruppen. Dies gilt insbesondere für die Zielgruppen
Weibliche Bevölkerung
Ältere Bevölkerung
Migranten und Migrantinnen
2. Damit einher gehen neue Anforderungen an die Sportstätten hinsichtlich veränderter
Gesundheits- und Wellnessansprüche
„Eventisierungsansprüche“
Zeitlicher Ansprüche („Flexibilisierung“) 3. Als besondere Herausforderung stellt sich im Themenbereich „Sport- und Bewegungsraum Stadt“ die Entwicklung der raschen Veränderung der Sportnachfrage und die stete Genese neuer Sportarten dar. Im Bereich der gedeckten Anlagen entstehen durch die veränderten Ansprüche und Bedürfnisse vor allem folgende Raumbedarfe10:
a) Bedarf nach zielgruppengerechten Sporträumen hinsichtlich
Raumgröße (Kleinsporträume)
Raumatmosphäre (Farbgestaltung, Helligkeit, Lüftung, Beschallung etc.)
Raumumfeld/-gestaltung
- Kommunikation (Wartezonen, Kinderpflegeräume, Eventmöglichkeiten)
- Sicherheit (Parkplätze, Wegeführung, Beleuchtung etc.)
- Erreichbarkeit (Anbindung ÖPNV, Fuß- und Radwege) b) Bedarf nach Multifunktionalität und Rückbaubarkeit von Sportstätten. Aufgrund des raschen Wechsels der Sportbedürfnisse werden multifunktionale bzw. veränderbare Räume erforderlich.
10 Der Erfolg der kommerziellen Sportanbieter basiert u.a. auf einem Raumkonzept, dass in vielen Bereichen – im Gegensatz zu den i.d.R. sehr funktional geplanten kommunalen Sportstätten – auf die veränderten Ansprüche der Nutzer eingeht.
Sportstätten | 172
6.2 Allgemeine Kennzeichen der Sportstättensituation
Mit den folgenden charakteristischen Problemen müssen sich die Mehrzahl der Städte und Gemeinden auseinandersetzen. Wie in vielen anderen Städten und Gemeinden in Deutschland stellt auch in der Stadt Borken die Sanierung der vorhandenen Anlagen die Hauptaufgabe im Bereich Sportstätten dar. Neu- und Umbauten sowie umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen sind vor dem Hintergrund der veränderten Sportnachfrage zwar dringend erforderlich, können angesichts der knappen Mittel jedoch nicht allein von den Kommunen gestemmt werden. Notwendig erscheint eine höhere Partizipation der Beteiligten, insbesondere der Sportvereine11. Als Folgen der Mittelknappheit und veränderter Aufgabenstellungen im Sportstättenbereich zeigen sich in deutschen Kommunen drei wesentliche Entwicklungen:
1) Ausgliederung von Fachressorts in andere Rechtsformen, 2) Übergabe von Verantwortung an Sportvereine, 3) Erhebung von Sportstättennutzungsgebühren.
Derzeit können bei den Turn- und Sporthallen in vielen Kommunen notwendige Sanierungen aufgrund fehlender Mittel nicht durchgeführt werden. Der „Sanierungsstau“ ist dabei vor allem auf das hohe durchschnittliche Alter der Sportstätten zurückzuführen – die meisten kommunalen Hallen in Deutschland wurden in den 60er und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts erbaut. Als typisches, grundlegendes Problem im Umgang mit den Turn- und Sporthallen werden in Gesprächen mit Experten unterschiedliche Interessen von Schulen und Vereinen genannt. Als typisches Problem des kommunalen Sportstättenmanagements offenbart sich in vielen Kommunen, vor allem zur Behebung kleinerer Mängel, ein optimierbares „lokales“ Informationsmanagement zwischen den Nutzern (Sportvereine, Schulen), zuständigen Personen (Schulhausmeister, Hallenwarte) und den verantwortlichen Verwaltungsstellen (Gebäudemanagement/-wirtschaft, Hochbauamt, Sportamt etc.). Als problematisch erweist sich zum Teil das Fehlen von kurzfristig einsetzbaren Mitteln der verantwortlichen Verwaltungsstellen zur Behebung von kleineren Mängeln. Es zeigt sich dabei, dass die Informationsweitergabe über auftretende Mängel und Beschädigungen in den Hallen sowohl von Seiten der Schulen als auch von Seiten der Vereine häufig lückenhaft ist. Auch Informationen über Vorhaben werden von den Schulen häufig nicht adäquat weitergegeben. Grundsätzlich scheinen dabei zwischen Schul- und Vereinssport nur wenige Kontakte zu bestehen.
11 Bei der Betrachtung der kommunalen Sportstättensituation gilt jedoch zu berücksichtigen, dass ein Großteil der Sportstätten – vor allem Hallen – in Zusammenhang mit einer Nutzung für den Schulsport stehen. Diese Tatsache erscheint in der Diskussion um die Zukunft von Sportstätten und den notwendigen Beitrag der Sportvereine hierzu häufig zu wenig berücksichtigt zu werden.
Sportstätten | 173
Im Sektor Sportstätten besteht in der überwiegenden Mehrzahl der deutschen Kommunen eine Verflechtung von Zuständigkeiten unterschiedlicher Ämter. Es entsteht hierdurch ein hoher Kommunikationsbedarf, der von den Ämtern häufig nicht adäquat erfüllt wird. Vorhandene Ressourcen werden auf diese Weise nicht optimal genutzt. Die intersektorale Zusammenarbeit bzw. Kommunikation zwischen den involvierten Fachämtern kann somit als weiteres typisches Problem des kommunalen Sportstättenmanagements diagnostiziert werden. Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Kluft zwischen den Raumangeboten von kommerziellen Anbietern und Sportvereinen ist eine hohe Bereitschaft der Sportvereine zur eigenverantwortlichen Schaffung/Attraktivierung von Sporträumen zu erwarten, zeigt sich jedoch nur sehr bedingt. Innovative Modelle zur eigenverantwortlichen Lösung der Sportraumproblematik können nur vereinzelt gefunden werden. Als hemmend für eine innovative Sportraumpolitik der Vereine erweist sich eine über Jahre gewachsene Anspruchshaltung der Vereine gegenüber den Kommunen. Eigenverantwortliche Lösungen werden gegenüber kommunalen Lösungen häufig erst nachrangig gesucht. Die Einsicht in die Probleme der kommunalen Haushaltssituation und die daraus resultierende Notwendigkeit einer zunehmenden Eigenverantwortung im Sportstättenbereich kann bei den Sportvereinen nur eingeschränkt erkannt werden. Die Sportvereine zeigten hier bislang nur eingeschränkte Gesprächsbereitschaft bzw. problemadäquate Handlungsansätze.
6.3 Demographischer Wandel in Borken
Die Nachfrage nach Sportangeboten, Umfang und Art wird zentral von der demographischen Entwicklung beeinflusst. Daher wird nachfolgend kurz auf die Bevölkerungsprognose des Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) für Borken eingegangen. Insgesamt prognostiziert der IT.NRW einen leichten Bevölkerungsrückgang von rund zwei Prozent bis 2030 (im Vergleich zum Jahr 2012). Betrachtet man die verschiedenen Altersgruppen, so zeigt sich, dass die Gruppen der bis unter 20-Jährigen (-15,9%), der 20 bis unter 40-Jährigen (-10,4%) und die 40 bis 60-Jährigen (-27,2%) kleiner und die der 60 bis unter 80-Jährigen (+60,3%) und ab 80-Jährigen (+51,5%) größer werden. Insgesamt stellen dann die 60 bis unter 80-Jährigen auch die größte Bevölkerungsgruppe mit einem Anteil von 30,7 Prozent (vgl. Abb. 119).
Sportstätten | 174
Abb. 119: Bevölkerungsvorausberechnung 2010-2030 für Borken
Aufgrund des Wandels der Altersstruktur der Borkener Bevölkerung ist eine Veränderung der Nachfrage nach Sportanlagen zu erwarten. Zum einen ist davon auszugehen, dass vor allem Ballsportarten wie z.B. Fußball, Basketball, Volleyball, Handball oder Badminton, unter dem Rückgang der unter 20-Jährigen leiden werden und somit die Nachfrage nach Fußballplätzen und Mehrfach-Sporthallen sinken wird. Zum anderen ist durch die Zunahme älterer Bürgerinnen und Bürger mit einem Anstieg der Nachfrage nach Gesundheits- und Fitnessangeboten zu rechnen. Dadurch wird die Nachfrage nach „kleineren“ Sporträumen steigen.
Sportstätten | 175
6.4 Turn- und Sporthallen
6.4.1 Überblick Turn- und Sporthallen Die Stadt Borken verfügt über 18 Gymnastik-, Turn- und Sporthallen, die sich folgendermaßen aufteilen: vier Gymnastikhallen, zehn Einfachhallen, drei Zweifachhallen sowie eine Dreifach-Sporthalle. Die Hallenanlagen wurden im Zeitraum zwischen 1956 und 2004 erbaut. Somit „feiert“ die älteste Halle im Jahr 2012 ihren 56. Geburtstag und die jüngste den 8. Geburtstag. Das Durchschnittsalter der Borkener Hallenanlagen liegt bei über 41,5 Jahren (vgl. Tab. 54). Darüber hinaus gibt es u.a. drei weitere nichtstädtische Schulsporthallen (vgl. Tab. 52) sowie fünf Vereinsgymnastikräume in Borken (vgl. Tab. 53), welche im weiteren Prozess allerdings nicht näher betrachtet werden.
Tab. 52: Nicht-stadteigene Schulsporthallen
Name Maße Eigentümer Sporthalle Berufskolleg 27 x 45 x 7 m Kreis Borken Sporthalle Schönstätter Marienschule 12 x 24 x 5 m Schönstätter Marienschule Gymnastikraum Neumühlenschule k.A. Kreis Borken
Tab. 53: Vereinsgymnastikräume in Borken
Name Maße Verein G.u.F.i. Borken 11,5 x 13 m SG Borken TV B.-Center 6,4 x 9,8 m TV Borken (angemietet) TV B.-Center 6,4 x 9,8 m TV Borken (angemietet) Gymnastikraum SV Burlo 7,5 x 8,3 m SV Burlo "wib" Gymnastikhalle 10 x 12 x 3,8 m SV Westfalia Gemen
Sportstätten | 176
Tab. 54: Übersicht städtische Turn- und Sporthallen in Borken
Name Stadt-teil Baujahr Maße Schulnutzung
Auslastung (%) Sommer / Winter
TH Johann-Walling Grundschule Borken 1956 12,4 x 24,9 x 5,8 m ja / 8.00–14.00 98,2 / 97,5
TH Gymnasium Remigianum
Borken 1963 14,0 x 28,0 x 5,9 m ja / 8.00–17.30 100 / 100
GH Gymnasium Remigianum
Borken 1963 16,0 x 18,7 x 4,8 m ja / 8.00–15.00 99,0 / 99,0
TH Remigius Grund- und Hauptschule
Borken 1968 14,0 x 27,1 x 5,5 m ja / 8.00–15.30 97,1 / 97,1
TH Duesberg Hauptschule
Borken 1968 14,1 x 27,1 x 5,9 m ja / 8.00–16.00 99,3 / 92,1
SH Im Trier Borken 1963 21,0 x 42,3 x 7,0 m ja / 8.00–15.30 99,3 / 99,3
SH Mergelsberg Borken 2004 27,8 x 47,1 x 7,7 m ja / 8.00–1530 97,3 / 97,3
TH Borkenwirthe Borken-wirthe 1961 12,5 x 25,0 x 5,7 m ja / 8.00–13.00 66,9 / 66,9
SH Astrid-Lindgren GS / GY Mariengarden
Burlo 1977 21,0 x 45,0 x 7,0 m ja / 8.00–16.00 89,1 / 93,0
TH Cordula-Grundschule Gemen 1964 13,9 x 28,0 x 5,5 m ja / 8.00–13.30 100 / 100
SH Nünning Realschule
Gemen 1982 24,1 x 44,8 x 7,0 m ja / 8.00–15.30 100 / 100
TH Zentraleinrichtung Sonderschule
Gemen 1976 15,6 x 26,9 x 6,5 m ja / 8.00–15.30 100 / 100
GH Zentraleinrichtung Sonderschule
Gemen 1976 10,1 x 13,0 x 3,2 m ja k.A.
GH Pröbsting Grundschule
Hoxfeld 1965 9,8 x 14,9 x 3,8 m ja / 8.00–14.00 93,6 / 93,6
TH Engelrading Grundschule
Marbeck 1973 12,0 x 24,0 x 5,4 m ja / 8.00–13.15 93,9 / 96,1
TH Roncalli Grundschule Weseke 1979 15,0 x 27,0 x 5,5 m ja / 8.00–13.15 89,3 / 89,3
TH Maria-Sybilla-Merian Realschule
Weseke 1961 14,0 x 28,1 x 5,4 m ja / 8.00–15.15 86,4 / 98,9
[GH Grütlohn* Grütlohn 1965 9,2 x 12,2 x 4,1 m nein k.A.] Erläuterung: SH=Sporthalle; TH=Turnhalle; GY=Gymnastikhalle; k.A.=keine Angaben *Die Turnhalle Grütlohn ist aufgrund ihrer Nutzung, Größe, Zustand, Ausstattung eher als Versammlungsraum / Mehrzweckraum zu bezeichnen und nicht im klassischen Sinne als Sportstätte. Die Räumlichkeiten werden/wurden maximal 1x/pro Woche von der Polizei zum Tischtennisspielen genutzt und gelegentlich als Notausweichort einer F-Jugendmannschaft der TuS jetzt SG Borken.
Sportstätten | 177
6.4.2 Zustand Der Zustand der Turn- und Sporthallen in Borken befindet sich auf einem insgesamt befriedigenden bis guten Niveau, allerdings mit zum Teil deutlichen Ausschlägen nach oben (SH Mergelsberg) und nach unten (u.a. TH Duisbergschule). Dies spiegelt sich auch in den Bewertungen der Schulen und Vereine wider. Es gibt dabei aber konkrete Hinweise, wie dieser Zustand noch zu verbessern ist. Diese Hinweise stellen gleichzeitig ein Warnsignal hinsichtlich der Unterhaltung der Hallen und der Sorge um ihren Zustand dar. Aus Sicht der beiden Nutzergruppen werden insbesondere die Umkleide- und Sanitärbereiche häufig als Problemfelder empfunden. Es ist festzuhalten, dass – vor allem aufgrund des Alters der Borkener Sporthallen – bei über der Hälfte der Anlagen ein baulicher und/oder energetischer Sanierungsbedarf vorliegt. Hier ist der Stadt Borken zu empfehlen, eine differenzierte Bestandsaufnahme zum Zustand der städtischen Sporthallen durchzuführen und darauf aufbauend eine konkrete Sanierungsplanung mit Priorisierung zu erstellen. Positiv hervorzuheben ist, dass die Stadt Borken in den letzten Jahren (unter anderem mit Mitteln des Konjunkturpakets 2) schon einige Sporthallen (teil-)saniert hat.
6.4.3 Nutzung und Auslastung Die meisten Turn- und Sporthallen in Borken stehen bis zum späten Nachmittag dem Schulsport zur Verfügung. Die restliche Zeit kann im Wesentlichen vom Vereinssport genutzt werden. Betrachtet man die Auslastung laut Belegungsplänen (Stand August 2011, periodische Belegung), so zeigt sich in Borken eine durchschnittliche Auslastung von rund 95 Prozent (Mo-Fr, ausgehend von einer möglichen Belegung von 8 bis 22 Uhr) (vgl. Abb. 120). Somit kann man bei fast allen Hallen – zumindest laut Belegungsplan – von einer Vollauslastung sprechen. Die geringste Auslastung mit 67 Prozent hat die Turnhalle Borkenwirthe. Erfahrungen zeigen aber, dass gebuchte Zeiten nicht immer in Anspruch genommen werden oder dass eine Belegung mit einer nur sehr kleinen Teilnehmerzahl stattfindet. Zur Erhebung der realen Auslastung ist grundsätzlich eine Überprüfung der tatsächlichen Hallenbelegungen, inklusive der Teilnehmerzahlen, zu empfehlen. Die Erfahrungen aus anderen Kommunen zeigen, dass sich im Zuge einer flächendeckenden Belegungskontrolle bisher nicht bekannte „freie Zeiten“ identifizieren lassen, und somit unbefriedigte Bedarfe, zumindest teilweise, gedeckt werden können.
Sportstätten | 178
Abb. 120: Auslastung Hallenanlagen Im Bereiche der Schulbedarfe zeigen sich in Borken aufgrund der Sporthallenstruktur nicht immer optimale Voraussetzungen für den Schulsport. Grundannahme für eine optimale Versorgung sind dabei der Bedarf einer Übungseinheit (15x27m) je angefangene zehn (bis zwölf) Klassen, wobei im Folgenden alle zur Verfügung stehenden Sporthallen – unabhängig von der Größe – berücksichtigt wurden. Darüber hinaus sollten grundsätzlich die Sporthallenkapazitäten in Verbindung mit der Schule liegen. Ist dies in Ausnahmefällen nicht möglich, so sollte die Halle maximal fünf Wegeminuten von der Schule entfernt sein (vgl. Bundesinstitut für Sportwissenschaft (Hrsg.) (2002). Planung und Bau von Hallen und Räumen für Sport- und Mehrzwecknutzung. Bonn). Neben den Turn- und Sporthallen stehen für den Schulunterricht in Borken das Schwimmbad Aquarius, die Schwimmhalle Weseke, das Schwimmbecken der Johannesschule sowie verschiedene Außenanlagen für den Sportunterricht zur Verfügung. In Borken Zentrum teilen sich die Grundschulen Josef und Remigius, die Hauptschule Remigius (incl. des Teilstandorts Duesbergschule) sowie das Gymnasium Remigianum mit rund 110 Klassen knapp neun Übungseinheiten (vgl. Tab. 55). Dabei kann nur ein Teil des Sportunterrichts direkt an den jeweiligen Schulstandorten durchgeführt werden. Die fußläufige Entfernung zu den übrigen Hallen liegt dabei im Bereich von 5-8 Minuten. Problematisch stellt sich der Zustand der Sporthalle der ehemaligen Duesberg Hauptschule dar. Hier muss kurz- bis mittelfristig ein Konzept zum Ersatz der Halle erstellt werden. Dabei
Sportstätten | 179
sollte, unter Berücksichtigung der Entwicklung der angrenzenden Schulen sowie der nicht optimalen Struktur und des Zustands der Sporthallen des Gymnasiums Remigianum, der Bau einer Doppelhalle geprüft werden. In Gemen sollte im Zuge der Neuerrichtung der Sporthalle Zentraleinrichtung (Johannesschule) ebenfalls der Bau einer Doppelhalle diskutiert werden. Der angrenzenden Nünning-Realschule stehen direkt am Standort für aktuell 34 Klassen nur zwei Übungseinheiten an der Schule zur Verfügung. Die fehlenden Stunden werden in der Turnhalle Borkenwirthe (Entfernung 5 km) sowie in der Sporthalle Mergelsberg (3,5 km) durchgeführt (vgl. Tab. 56). Dabei ist anzumerken, dass die Turnhalle Borkenwirthe – unter anderem aufgrund der Struktur der Halle und des Verbots des Fußball-, Handball- und Basketballspiels – nur eingeschränkt für den Schulsport geeignet ist. Dies spiegelt sich auch in der sehr schlechten Bewertung von „4,7“ auf einer Skala bis 5=„sehr unzufrieden“ durch die nutzenden Schulen wider. Der Bau einer Doppelhalle würde zum einen die Bedingungen des Schulsports der Nünning Realschule an diesem Standort deutlich verbessern und zum anderen würden mehr Kapazitäten in der Sporthalle Mergelsberg (zurzeit 13 Stunden) den anderen Schulen zur Verfügung stehen. Weiter könnten dadurch gegebenenfalls die Bedingungen des Schulsports der drei Borkener Schulen in privater Trägerschaft (Grundschule An der Aa Montessori, Gesamtschule Montessori und Realschule Schönstätter Marienschule) verbessert werden.
Sportstätten | 180
Tab. 55: Übersicht Schulbedarf Turn- und Sporthallen in Borken (1/2)
Schule Anzahl Klassen im Schuljahr 2012/13
Anzahl Klassen im Schuljahr 2016/17*
(Prognose)
zur Verfügung stehende Übungs-einheiten
genutzte Turn- und Sporthallen
KGrS Johann-Walling 11 9 1 SH Johann-Walling GrundschuleKGrS Josef 7 7
9
SH Duesberg HauptschuleKGrS Remigius 14 13 SH Remigius Grund- und HauptschuleGHS Remigius 19 21
SH Remigius Grund- und Hauptschule, SH Mergelsberg, DH Im Trier, SH Duesberg
Hauptschule
GHS Remigius –Teilstandort Duesbergschule
9 0
GY Remigianum 59 (Sek. I: 29 u. Sek. II: 30)
58 (Sek. I: 29 u. Sek. II: 29)
SH Gymnasium Remigianum, GH Gymnasium Remigianum, DH Im Trier, SH Mergelsberg
GGrS An der Aa Montessori 4 4 Borkenwirthe
GE Montessori 6 6 SH Maria-Sybilla-Merian Realschule /
Borkenwirthe / Cordula-Schule / Berufskolleg RS Schönstätter Marienschule
20 19 1 Sporthalle Schönstätter Marienschule u. Mehrzweckraum (+8h Berufskolleg,)
*Quelle: Schulentwicklungsplanung Stadt Borken (Stand: Oktober 2011)
Sportstätten | 181
Tab. 56: Übersicht Schulbedarf Turn- und Sporthallen in Borken (2/2)
Schule Anzahl Klassen im Schuljahr 2012/13
Anzahl Klassen im Schuljahr 2016/17*
(Prognose)
zur Verfügung stehende Übungs-einheiten
genutzte Turn- und Sporthallen
KGrS Astrid-Lindgren Burlo 7 62 SH Astrid-Lindgren GS / GY Mariengarden
GY Mariengarden Burlo 16 16KGrS Roncalli Weseke 11 7 1 SH Roncalli GrundschuleRS Maria-Sibylla-Merian Weseke
15 14 1 SH Maria-Sybilla-Merian Realschule
KGrS Pröbsting Hoxfeld 4 3 1 SH Pröbsting Grundschule (nur 10x15m)KGrS Engelrading Marbeck 5 4 1 SH Engelrading GrundschuleKGrS Cordula Gemen 12 12 1 SH Cordula-Grundschule
RS Nünning Gemen 34 31 2(3) SH Nünning Realschule / TH Borkenwirthe
(5km entfernt) / SH Mergelsberg (13h) FöS LE Johannesschule Gemen 10 8
ca. 2 SH Zentraleinrichtung, GH Zentraleinrichtung, Gymnastikraum Neumühlenschule FöS GE Neumühlen-Schule
Gemen 13 12
*Quelle: Schulentwicklungsplanung Stadt Borken (Stand: Oktober 2011)
Sportstätten | 182
6.5 Sportanlagen / Fußballplätze
6.5.1 Überblick Spielfelder Die Stadt Borken verfügt über 27 Spiel- und Trainingsflächen, davon sieben Tennengroßspielfelder, welche für den Fußballsport genutzt werden (vgl. Tab. 57)12.
Tab. 57: Übersicht Fußballplätze in Borken
Anlage Belag Art Maße Flutlicht
Im Trier / SG Borken Rasen GSF 68 x 105 m Ja Tenne GSF 68 x 105 m Ja Rasen KSF 3200 m2 Ja Rasen GSF 68 x 105 m Ja Rasen TF / GSF 6200 m2 Nein „Am Aquarius“ / SG Borken Tenne GSF 68 x 105 m Ja Rasen KSF 1800 m2 Ja RC Borken-Hoxfeld Rasen GSF 68 x 105 m Nein Tenne GSF 70 x 110 m Ja Rasen GSF 53 x 90 m Ja Rasen GSF 60 x 88 m Ja Rasen KSF 30 x 70 m Nein FC Marbeck Rasen GSF 68 x 108 m Nein Tenne GSF 65 x 100 m Ja Rasen KSF
3000 m2 Ja
Rasen KSF Ja SV Adler Weseke Rasen GSF 68 x 105 m Nein Tenne GSF 68 x 104 m Ja Rasen TF / GSF 8000 m2 Ja SV Burlo Rasen GSF 70 x 109 m Nein Rasen TF / GSF 7700 m2 Nein Tenne GSF 67 x 105 m Ja Rasen KSF 1500 m2 Nein SV Westfalia Gemen Rasen GSF 68 x 105 m Nein Rasen GSF 68 x 108 m Ja Tenne GSF 68 x 105 m Ja Rasen TF / ~2 KSF 5000 m2 Ja
Erläuterung: GSF=Großspielfeld; KSF=Kleinspielfeld; TF=Trainingsfläche
Bei der Besichtigung der Fußballanlagen in Borken konnte augenscheinlich bei den Tennenplätzen zum Teil eine Verhärtung – und eine damit verbundene reduzierte Wasserdurchlässigkeit des Belags – festgestellt werden. Dies führt letztendlich zu einer
12 Hinzu kommt noch ein Rasenspielfeld der Sportanlage Nünning-Realschule, welches aber nicht von Vereinen zum Fußballspielen genutzt wird.
Sportstätten | 183
Einschränkung der Sport- und Schutzfunktion des Belags. Daher ist mittelfristig eine ingenieurstechnische Überprüfung des Zustands der Plätze, und darauf aufbauend die Erstellung eines Sanierungskonzepts, zu empfehlen.
6.5.2 Nutzungssituation Im Hinblick auf den Fußballsport liegt das größte Augenmerk bei der Analyse der Bevölkerungsentwicklung in der Regel auf dem Bereich der 6 bis 19-Jährigen. Diese Altersgruppe stellt den größten Anteil an den Fußballaktiven in Borken dar (86 von 120 Mannschaften) (vgl. Tab. 58). Der Landesbetrieb Information und Technik NRW kommt für die Stadt Borken zu der Prognose, dass die Anzahl der unter 20-Jährigen bis 2020 um 11 Prozent und bis 2030 um 16 Prozent abnehmen wird (Ausgangsjahr 2012 / vgl. Kapitel 6.3). Somit kann man mittelfristig davon ausgehen, dass sich die Anzahl der Fußballaktiven und somit die Bedarfe an Platzkapazitäten leicht verringern werden. Im Hinblick auf die Nutzung der Sportanlagen ergeben sich im Wesentlichen im Winterhalbjahr (vorrangig November bis Februar) aufgrund des hohen Anteils an Naturrasenspielfeldern zum Teil Engpässe bei den zur Verfügung stehenden Trainingszeiten. Um einen groben Anhaltspunkt zur Trainingssituation im Winterhalbjahr zu erhalten, wurden die Trainingszeiten (Mo-Fr) den zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten gegenübergestellt. Die Trainingszeiten wurden dabei anhand der bekannten Anzahl an Mannschaften und den auf den Homepages der Vereine zu entnehmenden Zeiten entnommen. Dabei wurde für jede Mannschaft ein eigener Trainingsumfang berücksichtigt, auch wenn das Training mehrerer Mannschaften, z.B. im Kinderbereich oder Alte Herren, oft gemeinsam stattfindet. Somit wird der angenommene Trainingsumfang tendenziell über dem tatsächlichen Trainingsumfang liegen. Unter Berücksichtigung des dargestellten Aspekts, dass zum Teil verschiedene Mannschaften gemeinsam trainieren, in den Ferienwochen das Training der Jugendmannschaften nicht stattfindet und dass Trainingseinheiten auch aus verschiedensten Gründen gelegentlich ausfallen, wurde in einem zweiten Modell nur 80 Prozent des berechneten Bedarfs zugrunde gelegt. Dem wurden die zur Verfügung stehenden Trainingsstunden gegenübergestellt. Dabei wurden nur Plätze mit einer Trainingsbeleuchtung berücksichtigt und für Tennenplätze eine durchschnittliche tägliche Benutzbarkeit von drei Stunden und für Rasenplätze von 1,5 Stunden zugrunde gelegt13. Diese Nutzungsstunden wurden dann mit dem Faktor 1,5 multipliziert, da davon auszugehen ist, dass in den unteren Spielklassen sowie im Kinder- und Jugendbereich für das Training eine Platzhälfte pro Mannschaft ausreichend ist. Legt man das 100-Prozent-Modell zugrunde, gibt es einen Engpass an Trainingszeiten bei allen Vereinen. Dabei liegt die größte Unterdeckung bei der SG Borken (-22 Stunden) und dem FC Marbeck (-26 Stunden) vor. Betrachtet man das 80-Prozent-Rechenmodell, so liegt
13 Vgl. Uhlenberg, A. (2006). Kunststoffrasen oder andere Beläge? Gegenüberstellung verschiedener Sportbeläge. Gemeinde und Sport (1), 99-116.
Sportstätten | 184
rechnerisch nur noch eine leichte Unterdeckung bei der SG Borken (-3 Stunden) sowie nach wie vor ein größeres Defizit beim FC Marbeck (-15 Stunden) vor (vgl. Tab. 59). Dieses Defizit kann der FC Marbeck durch die Nutzung der Turnhalle der Engelrading-Grundschule Marbeck in der Zeit von November bis Februar kompensieren. In diesem Zeitraum steht die Halle für das Training der Altersklassen bis einschließlich D-Jugend sowie das Training der Alten Herren zur Verfügung.
Sportstätten | 185
Tab. 58: Übersicht Fußballmannschaften und Trainingsumfang (Saison 2012/13)
SG Borken RC Borken-Hoxfeld SV Burlo 1949 SV Westfalia Gemen FC Marbeck 58 SV Adler Weseke 1925
Mann-
schaften
Trainings-umfang
(h/Woche)
Mann-schaften
Trainings-umfang
(h/Woche)
Mann-schaften
Trainings-umfang
(h/Woche)
Mann-schaften
Trainings-umfang
(h/Woche)
Mann-schaften
Trainings-umfang
(h/Woche)
Mann-schaften
Trainings-umfang
(h/Woche)
Bambini / G 1 1,5 2 3 1 1 1 1,5 1 1,5 1 1 F-Jugend 3 9 3 9 2 3 4 8,5 2 6 1 1,5 E-Jugend 4 12 3 9 1 3 3 9 2 6 3 7,5 D-Jugend 4 14,5 1 3 1 3 3 9 2 6 2 6 C-Jugend 2 7,5 1 3 1 3 2 6 1 3 1 3 B-Jugend 2 9 1 3 0 1 4,5 0 0 2 6 A-Jugend 2 7,5 1 3 1 3 1 4,5 1 3 1 3 Senioren 4 13,5 4 10,5 2 7,5 4 10,5 2 9 3 10,5
Alte Herren 2 4 1 1,5 2 1,5 2 1 2 1,5 2 2
F-Mädchen 0 1 1,5 E-Mädchen 1 3 1 1,5 D-Mädchen 1 3 1 3 1 3 C-Mädchen 1 3 1 3 1 3 1 3 B-Mädchen 1 3 2 3 1 3 A-Mädchen 0 0
Damen 1 4,5 2 6 1 3 Gesamt 29 95 19 51 11 25 21 54,5 21 54 19 49,5
Sportstätten | 186
Tab. 59: Gegenüberstellung von Trainingsumfang und zur Verfügung stehender Trainingszeiten (Montag bis Freitag) im Winterhalbjahr
Anlage Tennen-
spielfelder mit Beleuchtung
Nutzungs-zeit in
Stunden
Rasen-spielfelder mit Beleuchtung
Nutzungs-zeit in
Stunden
Nutzungs-zeit
gesamt
Mann-schaften
Trainings-zeit in
Stunden
Trainings- zu Nutzungszeit in Stunden
Trainingszeit -20 Prozent in
Stunden
Trainings- zu Nutzungszeit in Stunden
SG Borken 2 45 2,5 28,125 73,125 29 95 -21,875 76 -2,875 RC Borken-Hoxfeld 1 22,5 2 22,5 45 19 51 -6 40,8 4,2 SV Burlo 1 22,5 - - 22,5 11 25 -2,5 20 2,5 SVW Gemen 1 22,5 2 22,5 45 21 54,5 -9,5 43,6 1,4 FC Marbeck 1 22,5 0,5 5,625 28,125 21 54 -25,875 43,2 -15,075 [FC Marbeck* 1 22,5 0,5 5,625 28,125 9 27 1,125 ] SVA Weseke 1 22,5 1,25 14,063 36,563 19 49,5 -12,938 39,6 3,038 * Im Winter (November bis Februar) findet das Training der Altersklassen bis einschließlich D-Jugend sowie das Training der Alten Herren in der Turnhalle der Engelradingschule statt.
Sportstätten | 187
6.6 Kunststoffrasendiskussion14
In den letzten Jahren wurden immer mehr Kunststoffrasenplätze – fast ausschließlich als Ersatz für Tennenspielfelder – in Deutschland gebaut. Die Vorteile des neuen Belags, wie z.B. eine weitgehend witterungsunabhängige Nutzung oder der hohe Aufforderungscharakter, stehen dabei außer Frage. Dem gegenüber stehen sehr hohe Investitionskosten für den Neubau einer Anlage. Als Grundlage für die auch in Borken stattfindende Diskussion zum möglichen Bau von Kunststoffrasenspielfelder, werden im Nachfolgenden die verschiedenen Beläge und deren Kosten kurz dargestellt.
6.6.1 Tennenflächen: Tennenflächen werden in der Regel überall dort erstellt, wo aufgrund einer starken Frequentierung/Nutzung des Platzes ein Sportrasen zu stark beansprucht werden würde. Darüber hinaus entstehen für einen Tennenplatz i.d.R. die geringsten Gesamtkosten (Herstellung & Unterhalt) im Vergleich zu anderen Belägen. Weiter bietet ein Tennenplatz bei optimalem Zustand und Wassergehalt ein günstiges Gleitverhalten sowie einen günstigen Kraftabbau für den Sportler. Demgegenüber stehen ein hoher Pflegeaufwand, vor allem in der ersten Zeit der Nutzung, sowie die Tatsache, dass Tennenflächen bei ungenügender Pflege schnell zerstört werden. Weiter stellen alte, verhärtete Beläge eine erhebliche Verletzungsgefahr für die Sportler dar. Betrachtet man die zeitliche Benutzbarkeit von Tennenflächen, so zeigt sich, dass diese vor allem im Winterhalbjahr in nicht unbedeutendem Maße Witterungseinflüssen unterliegen. Bei einer Aufweichung der Platzdecke durch starke Niederschläge bzw. durch einen nicht gewährleisten Abfluss des Wassers in der Frost-Tau-Periode dürfen Tennenflächen nicht bespielt werden, da es sonst zu einer Zerstörung des Deckschichtbelages kommen würde. Ulenberg kommt unter Berücksichtigung von Ausfallzeiten durch z.B. Witterung, Feiertage und Ferien und einer realistischen Belastungsfrequenz im Sommerhalbjahr von ca. 5-6 Stunden und im Winterhalbjahr von ca. 2,5-3 Stunden auf eine Gesamtbelastung von rund 1.500 Stunden im Jahr (365 x 4,125h).
6.6.2 Kunststoffrasen Unter wirtschaftlichen Aspekten haben Kunststoffrasenbeläge vor allem dort eine große Bedeutung, wo die Nutzungsintensität eines Platzes bei über 1.500 Stunden pro Jahr liegt.
14Vgl. dazu: Ulenberg, A. & Illgas, M. (2011). Kunststoffrasen oder andere Beläge? Gegenüberstellung verschiedener Sportbeläge. Aktualisierung und Überarbeitung Oktober 2011. Letzter Zugriff am 07.11.2012 unter http://www.ulenberg.de/veroeffentlichungen.html?file=tl_files/uploads/images/Kunststoffrasen_Rasen_Tenne_10_11.pdf
Sportstätten | 188
Weitere Vorteile, die ein Kunststoffrasenplatz bietet, sind u.a. (vgl. DFB, 2006, S.51)15:
gleichmäßige Spieleigenschaften auf dem gesamten Platz,
eine weitgehend witterungsunabhängige, ganzjährige Nutzung (keine Probleme bei Frost-/Tauwechselperioden und Starkregenzeiten und somit eine Minimierung von Spielausfällen, Platzsperrungen und Trainingsbeschränkungen),
geringe Pflegeaufwendungen gegenüber anderen Belägen,
eine hohe Nutzungsintensität und
ein hoher Aufforderungscharakter. Demgegenüber stehen im Wesentlichen hohe Baukosten und eine begrenzte Lebensdauer von durchschnittlich zwölf bis 15 Jahren je nach Pflege und Belastung. Theoretisch ist ein Kunststoffrasenplatz 24 Stunden am Tag bespielbar, allerdings werden Sportplätze durch den Vereinssport in der Regel nur in einem Zeitraum von ca. 15.30 bis 21.30 Uhr genutzt. Daher wird als Grundlage für die weiteren Berechnungen eine realistische Belegungszeit von 6,5 Stunden pro Tag angesetzt. Abzüglich möglicher Ausfallzeiten kommt man somit auf eine Jahresbelastung von rund 2.000 Stunden (365 x 5,5h).
6.6.3 Belastbarkeit von Sportrasen Sportrasenplätze gehören zu den Anlagen mit der geringsten Nutzenintensität. In der Vegetationszeit von April bis Oktober kann der Platz ca. 3,5 bis 4,5 Stunden pro Tag und in der Vegetationsruhezeit von November bis März ca. 1 bis 2 Stunden pro Tag bespielt werden. Unter der Berücksichtigung von Ausfallzeiten ergibt sich somit eine jährliche Gesamtbelastung von rund 800 Stunden (365 x 2,2h).
Tab. 60: Belastbarkeit von Sportbelägen
Nutzungsintensität
im Jahr Nutzungsintensität pro Tag -Sommerhalbjahr
NI pro Tag -Winterhalbjahr /
Schlechtwetterperiode
Tenne 1500h 5-6h 2,5-3h
Sportrasen 800h 3,5-4,5h 1-2h
Kunststoffrasen 2000h 6,5h 6,5h
15Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.)(2006). DFB-Empfehlungen für Kunststoffrasenplätze. Frankfurt/ Main.
Sportstätten | 189
6.6.4 Kosten-Analyse Die nachfolgenden Berechnungen wurden im Oktober 2011 durch das Sachverständigenbüro Alfred Ulenberg berechnet. Berücksichtig wurden dabei alle Kosten ab Oberkante Erdplanum für den Bau eines Spielfeldes der Maße 68 x 105m zzgl. jeweils zwei Meter Sicherheitsabstand und zwei Meter hindernisfreier Raum an den Stirnseiten und ein Meter Sicherheitsabstand und ein Meter hindernisfreier Raum an den Längsseiten.
6.6.4.1 Herstellungskosten
€ % Tennenflächen 364.716,79 100,00 Sportrasen 366.013,39 100,36 Kunststoffrasen, sandverfüllt 611.071,00 167,55 Kunststoffrasen, sand-/EPDM verfüllt 626.143,99 171,68 Kunststoffrasen, sand-/TPE verfüllt 661.296,00 181,32
6.6.4.2 Pflegekosten pro Jahr
€/m2 € %
Tennenflächen 2,47 20.076,73 100 Sportrasen 4,07 33.108,37 164,91 Kunststoffrasen, sandverfüllt 1,41 10.795,92 53,77 Kunststoffrasen, sand-/EPDM verfüllt 1,76 13.410,94 66,80 Kunststoffrasen, sand-/TPE verfüllt 1,87 14.243,94 70,95
6.6.4.3 Investitionskosten pro Jahr und Nutzungsstunde (über 20 Jahre)
Die Berechnung der folgenden Summen erfolgte im Rahmen einer dynamischen Investitionsrechnung, die in den jährlichen Haushalt eingestellt werden müssen, um die Anlage über einen Zeitraum von 20 Jahren zu erhalten.
Kosten/Jahr€ %
Nutzungs-stunden
Kosten/Std. € %
Tennenflächen 53.129,17 100 1500 35,42 100 Sportrasen 63.281,38 119,11 800 79,10 223,32 Kunststoffrasen, sandverfüllt
67.166,40 126,42 2000 33,58 94,81
Kunststoffrasen, sand-/EPDM verfüllt
73.713,54 138,74 2000 36,86 104,07
Kunststoffrasen, sand-/TPE verfüllt
77.527,09 145,92 2000 38,76 109,43
Sportstätten | 190
6.6.5 Fazit Grundsätzlich zeigt sich, dass sich aus wirtschaftlichen Gründen ein Kunststoffrasenplatz nur dort rechnet, wo aufgrund einer hohen Nutzungsintensität (Rasen- bzw.) Tennenplätze an ihre Belastungsgrenzen stoßen. Darüber hinaus hat man mit einem Kunststoffrasenplatz die Möglichkeit, die Attraktivität einer Sportanlage zu steigern. Grundsätzlich empfiehlt es sich insbesondere bei Tennenplätzen, die mit einem hohen Investitionsvolumen saniert bzw. modernisiert werden müssen, abzuwägen, ob sie ggf. durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden könnten. Voraussetzung sollte in diesem Fall aber sein, dass eine jährliche Auslastung des Platzes von mindestens 1.500 Stunden gewährleistet ist. Ein anderes Szenario stellt der Ersatz zweier Tennenspielfelder durch ein Kunststoffrasenspielfeld dar. Idealerweise sollte bei beiden Szenarien eine Schulnutzung des Kunststoffrasenplatzes möglich sein bzw. erfolgen, um den Vorteil der hohen Belastbarkeit des Belags ausnutzen zu können. Dieser Aspekt sollte immer bei der Planung von Kunstrasenspielfeldern berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollte darauf hingewiesen werden, dass beim Bau von Kunststoffrasenplätzen auf die Verwendung von Recyclinggranulat (SBR-Granulat) verzichtet werden sollte. Zum einen ist die Umweltverträglichkeit umstritten und zum anderen kommt es durch den Gummiabrieb zu Verfärbungen von Bällen, Schuhen, Torpfosten, Banden etc.
Sportstätten | 191
6.7 Bewertung von Vereinsanträgen im Bereich Sportstätten
Das Institut für Sportsoziologie wurde gebeten, im Rahmen der durchgeführten Sportentwicklungsplanung eine Priorisierung von vorliegenden Sportvereinsanträgen durchzuführen. Die folgenden Anträge bzw. Wünsche wurden dabei berücksichtigt:
1. das Konzept der „Initiative Sportzentrum Borken“ / SG Borken zur Entwicklung der Sportanlage im „Im Trier“ / Sportpark Borken,
2. das grundsätzliche Interesse der Borkener Fußballvereine an Kunststoffrasenspielfeldern,
3. der Wunsch des SV Burlo zur Ausstattung des Rasentrainingsplatzes mit einer Flutlichtanlage,
4. der Antrag des Leichtathletik Club Borken zum Ausbau der Nünning-Sportanlage zu einer Vollkunststoffanlage,
5. der Wunsch nach Planungssicherheit bezüglich ausreichendem Trainingsraum für den Tanzsportclub Borken Rot-Weiß,
6. der Antrag des Tennisclubs Blau-Weiß Borken auf finanzielle Unterstützung bei der Sanierung (Hallenböden, Hallendach, insbesondere Regenrinnen und -rohre, Heizung, Kanalisation der vereinseigenen Tennishalle),
7. der zurückgestellte Antrag des SV Westfalia Gemen zur finanziellen Unterstützung bei der Modernisierung der vereinseigenen Tennishalle sowie
8. der Antrag des Zucht-Reit-und Fahrvereins Borken auf finanzielle Unterstützung bei der Renovierung des Reithallendachs
Sportpark Borken Da die Anträge 1 bis 4 aus Sicht der Gutachter im Zusammenhang mit einer Weiterentwicklung des Sportparks Borken stehen, werden diese verknüpft im Weiteren näher beleuchtet. Das Konzept der „Initiative Sportzentrum Borken“ / SG Borken zur Entwicklung der Anlage „Im Trier“ / Sportpark Borken lässt sich in zwei Bereiche unterteilen: a) der Erneuerung der Umkleidekabinen und b) dem Bau zweier Kunststoffrasenspielfelder. Zu Punkt a): Die aktuellen Umkleidegebäude befinden sich in einem desolaten, stark sanierungsbedürftigen Zustand. Der nutzende Verein, die SG Borken, ist der größte Fußballverein der Stadt. Auf der Sportanlage liegt eine hohe Schullast und ist auch insgesamt die Freianlage mit der größten Nutzung in Borken. Alle anderen Fußballstandorte wurden schon saniert/erneuert bzw. ist dies in Planung (Hoxfeld). Auf Grundlage der Rahmenbedingungen ist daher eine Erneuerung der Umkleidegebäude dringend zu empfehlen.
Sportstätten | 192
Zu Punkt b): Als Rahmenbedingungen können festgehalten werden, dass (1) die SG Borken mit aktuell 29 Mannschaften und einem Trainingsumfang von rund 95 Stunden (vgl. Kapitel 6.5.2) die größte Fußballabteilung der Stadt Borken stellt. (2) Aufgrund der demographischen Entwicklung ist perspektivisch in den nächsten 10 bis 20 Jahren von einem leichten Rückgang der Aktivenzahlen auszugehen (vgl. Kap. 6.3). (3) Durch die umliegenden Schulen eine Nutzung des Kunststoffrasenplatzes auch am Vormittag gegeben ist. Im Folgenden sollen nun zwei Szenarien betrachtet werden:
1) Ersatz der zwei Tennenspielfelder durch ein Kunstrasenspielfeld 2) Ersatz der zwei Tennenspielfelder durch zwei Kunstrasenspielfelder
Dabei wurden, wie in Kapitel 6.5.2 dargestellt, die Trainingszeiten der SG Borken den Platzkapazitäten gegenübergestellt. Hier wurde ebenfalls aufgrund des gemeinsamen Trainings verschiedener Mannschaften und Ausfallzeiten in einem zweiten Modell nur 80 Prozent des berechneten Bedarfs zugrunde gelegt. Die Berechnung der Platzkapazitäten wurde ebenfalls analog zu Kapitel 6.5.2 durchgeführt. Bezogen auf die Nutzungsdauer im Winterhalbjahr (Mo-Fr; es werden Plätze nur mit einer Trainingsbeleuchtung berücksichtigt) kann ein Tennenplatz täglich durchschnittlich drei Stunden, Naturrasenplätze 1,5 Stunden und Kunststoffrasenplätze theoretisch 24 Stunden bespielt werden. Im Hinblick auf eine realistisch mögliche Auslastung durch den Vereinssport kann man hier rund 6,5 Stunden pro Tag ansetzen. Diese Nutzungsstunden wurden dann mit dem Faktor 1,5 (Variante 2: Kunststoffrasen Faktor 2) multipliziert, da davon auszugehen ist, dass in den unteren Spielklassen für das Training eine Platzhälfte pro Mannschaft ausreichend ist. Die Berechnung zeigt, dass die aktuellen Bedarfe, legt man dass 80-Prozent-Modell zugrunde, mit einem Kunstrasenplatz gedeckt werden können. Und dies – im Vergleich mit den Tennenplätzen – bei einer deutlichen Qualitätssteigerung des Sportbelages. Geht man davon aus, dass für eine Mannschaft jeweils eine Platzhälfte für das Training ausreicht, so können sogar sämtliche Bedarfe nach dem 100-Prozent-Modell gedeckt werden. Beim Bau von zwei Kunstrasenplätzen würden deutliche Überkapazitäten entstehen (vgl. Tab. 61). Daher ist das Szenario 1, der Bau eines Kunststoffrasenspielfeldes, zu empfehlen. Durch die Pflege nur noch eines Kunstrasenspielfeldes, im Vergleich zu zwei Tennenspielfeldern, können darüber hinaus Pflegekosten eingespart werden.
Sportstätten | 193
Tab. 61: Szenario Platzkapazitäten Winter Anlage „Im Trier“
Natur–rasen
TenneKunst–rasen
Gesamt
Trainings- zu Nutzungszeit (h)
100% (95h)
80% (76h)
Anzahl Plätze mit
Trainingsbeleuchtung (IST) 2,5 2 0
Kapazität in Stunden (IST) 28,125 45 0 73,125 -21,875 -2,875
Szenario 1 Anzahl Plätze 2,5 0 1
Kapazität in Stunden 28,125 0 48,75 76,875 -18,125 0,875 Kapazität Kunstrasen Faktor 2 28,125 0 65 93,125 -1,875 17,125
Szenario 2
Anzahl Plätze 2,5 0 2 Kapazität in Stunden 28,125 0 97,5 125,625 30,625 49,625 Kapazität Kunstrasen Faktor 2 28,125 0 130 158,125 63,125 82,125 Bei der Planung der neuen Umkleidegebäude sowie des Geländes sollten perspektivisch folgende Aspekte bzw. Anträge berücksichtigt werden. Bezugnehmend auf den Wunsch verschiedener Borkener Fußballvereine nach einem Kunststoffrasenplatz, macht – aufgrund der aktuellen Gesamtdefizite (vgl. Kapitel 6.5.2) – nur die gemeinsame Nutzung eines Kunstrasenspielfeldes Sinn. Als Standort kommt diesbezüglich für Borken, aufgrund der Lage, der Schulnutzung und im Zuge der Weiterentwicklung des Sportparks Borken, nur die Anlage „Im Trier“ in Frage. Hier könnten darüber hinaus Synergien bei der Pflege von zwei angrenzenden Kunststoffrasenplätzen erreicht werden. Auch mit Hinblick auf eine „Chancengleichheit“ hinsichtlich der Trainingsmöglichkeiten und –bedingungen im Winterhalbjahr ist eine zentrale Spielmöglichkeit zu empfehlen. Der Wunsch des SV Burlo nach Ausstattung der Rasentrainingsfläche mit einer Flutlichtanlage kann aus folgenden beiden Gründen nur eine sehr geringe bis keine Priorität eingeräumt werden. Erstens stehen aktuell mit dem vorhandenen Tennenplatz genügend Trainingszeiten im Winter zur Verfügung (vgl. Kap. 6.5.2) und zweitens würden mit dem möglichen Bau eines zentralen Kunstrasenplatzes dem Verein ausreichende und deutlich bessere Spielmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bezugnehmend auf den Antrag des Leichtathletik Clubs Borken zum Ausbau der Nünning-Sportanlage zu einer Vollkunststoffanlage kann man grundsätzlich mit nachrangiger Priorität den Bau einer Vollkunststoffanlage für die Stadt Borken unterstützen.
Sportstätten | 194
Allerdings würde aus Sicht des Gutachters der Bau einer Leichtathletik-Kunststoffanlage für Borken nur Sinn machen, wenn diese am Standort "Im Trier" errichtet werden würde. Erstens kann hier – im Vergleich zum beantragten Standort „Nünning Realschule“ – aufgrund der hohen Schuldichte von einer deutlich höheren Nutzung der Anlage ausgegangen werden. Zweitens liegt im Sportpark die bessere Infrastruktur für die Ausrichtung von größeren Veranstaltungen vor. Und drittens würde dies ein weiterer Baustein zur Entwicklung des Sportparks Borken darstellen. Zur Sportanlage „Im Trier“ / zum „Sportpark Borken“ lassen sich abschließend folgende Empfehlungen geben:
1. Ersatz der beiden Tennenplätze durch ein Kunststoffrasenspielfeld (bei Erhalt einer beleuchteten Trainingswiese);
2. Berücksichtigung des möglichen späteren Baus eines weiteren Kunststoffrasenspielfeldes bei den Planungen;
3. Berücksichtigung der möglichen späteren Umwandlung der leichtathletischen Anlagen in Kunststoff;
4. Erneuerung der Umkleidegebäude unter Berücksichtigung der Punkte 2 und 3; 5. Aufgabe der Schießsportanlage und Verlagerung des Standorts des
Schießsportvereins nach Raesfeld in die dort vorhandene moderne Schießanlage. Dabei sollten dem Verein keine Kosten entstehen.
Unter Berücksichtigung aller vorliegender Informationen kann der folgende Vorschlag für eine Prioritätenliste gemacht werden (vgl. Tab. 62 und Tab. 63).
Sportstätten | 195
Tab. 62: Prioritätenliste Anträge Sportvereine (1/2)
Verein Antrag Kommentar Priorität
„Initiative Sportzentrum Borken“ / SG Borken
Bau zweier Kunstrasenspielfelder Aufgrund der hohen Belastung, des schlechten Zustands der vorhandenen Tennenplätze sowie der Schulnutzung, ist der Bau eines Kunstrasenspielfeldes – als Ersatz für die beiden vorhandenen Tennenplätze – zu empfehlen.
1
„Initiative Sportzentrum Borken“ / SG Borken
Erneuerung/Sanierung Funktionsgebäude
Die Gebäude befinden sich in einem desolaten Zustand. SG Borken ist der größte Fußballverein der Stadt. Alle anderen Fußballstandorte wurden schon saniert/erneuert. Auf der Sportanlage liegt eine hohe Schullast.
1
Tanzsportclub Borken Rot-Weiß
Schaffung einer Planungssicherheit bezüglich ausreichendem Trainingsraum
Der TSC Borken ist eines der sportlichen "Aushängeschilder" Borkens. Der Verein benötigt einen entsprechenden Trainingsraum, um weiter auf diesem hohen Niveau den Sport ausüben zu können. Zum Zeitpunkt der Erstellung der SEP zeigte sich eine Lösung zwischen dem TSC Borken und den Stadtwerken Borken, zur Überlassung von Räumlichkeiten über einen längeren Zeitraum.
2
Tennisclub Blau-Weiß Borken
Sanierungsbedarf: Hallenböden, Hallendach, insb. Regenrinnen und -rohre, Heizung, Kanalisation
Die Stadt Borken sollte den Erhalt einer Tennishalle für Borken unterstützen. Aufgrund des Alters und des Zustands macht dies nur am Standort des TC BW Borken Sinn. Hier sollte eine Kooperation mit dem SV Westfalia Gemen angestrebt werden. Es besteht eine betriebliche Notwendigkeit zum Erhalt der Anlage.
3
SV Westfalia Gemen Modernisierung Tennishalle siehe Antrag TC Blau-Weiß Borken -
Zucht-Reit- und Fahrverein Borken
Renovierung Hallendach
Der Verein hat rund 220 Jugendliche Mitglieder, von denen rund 90 bis 95 Prozent weiblich sind. Der Verein fördert das Erlernen des Reitens auf vereinseigenen Pferden zu einem moderaten Preis (105 Euro Jahresbeitrag für Jugendliche zzgl. 5 Euro pro Reitstunde). Bei einer Förderung des Antrags würde eine Unterstützung des Mädchensports erfolgen.
4
Sportstätten | 196
Tab. 63: Prioritätenliste Anträge Sportvereine (2/2)
Verein Antrag Kommentar Priorität
diverse Fußballvereine Interesse an Kunstrasenplätzen am jeweiligen Vereinsstandort
Aufgrund der aktuellen Gesamtdefizite macht hier nur die gemeinsame Nutzung eines Kunstrasenspielfeldes Sinn. Als Standort kommt diesbezüglich für Borken, aufgrund der Lage, der Schulnutzung und im Zuge der Weiterentwicklung des Sportparks Borken, nur die Anlage „Im Trier“ in Frage.
5
SV Burlo 1949 e.V. Für Zukunft: Rasentrainingsplatz soll mit Flutlichtanlage versehen werden
Zurzeit stehen mit dem vorhandenen Tennenplatz genügend Trainingszeiten im Winter zur Verfügung.
6
Leichtathletik Club Borken
Ausbau der Nünning-Sportanlage zu einer Vollkunststoffanalge
Der Bau einer Leichtathletik-Kunststoffanlage würde für Borken nur Sinn machen, wenn diese am Standort "Im Trier" errichtet werden würde (aufgrund der hohen Schuldichte und unter dem Aspekt der Weiterentwicklung des Sportparks Borken). Dieser Aspekt sollte bei den Planungen der Erneuerung/Sanierung der Anlage "Im Trier" berücksichtigt werden.
6
Sportgelegenheiten in Borken | 197
7 Sportgelegenheiten in Borken
7.1 Nutzung und Bewertung von Grünanlagen, Parks und Wäldern
Die nähere Borkener Umgebung bietet der Bevölkerung ausgezeichnete Möglichkeiten zum Sporttreiben. Auf Land- und Forstwirtschaftswegen sowie auf gut ausgebauten Radwegen entlang der Landstraßen besteht die Möglichkeit zu Joggen, zu Walken, Radzufahren oder Spazieren zu gehen. Zudem können einige Park- und Waldgebiete aufgrund ihrer natürlichen Umgebung und der Abgeschiedenheit vom Straßenverkehr sehr gut als Sportgelegenheiten genutzt werden. Zunächst soll die Bedeutung solcher Sportgelegenheiten für das Sporttreiben in Borken herausgestellt werden, indem das allgemeine Nutzungsverhalten der Bevölkerung dargelegt wird. Nach einer allgemeinen Nutzerbewertung soll speziell auf einzelne Gebiete eingegangen werden, welche von den Nutzern separat bewertet und außerdem im Rahmen einer Bestandserhebung begutachtet worden sind.
7.2 Nutzungsverhalten
66,8 Prozent der Befragten geben an, dass Sie für ihre sportlichen Aktivitäten Grünanlagen, Parks und/oder Wälder nutzen (vgl. Abb. 121), wobei letzteres für Frauen (69,2%) etwas häufiger zutrifft als für Männer (63,7%).
33,2%
66,8%
Nutzen Sie Grünanlagen/Parks/Wälder für sportliche Aktivitäten?
Nein
Ja
n = 1728
Abb. 121: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten
Sportgelegenheiten in Borken | 198
Bei den Altersklassen sind es vor allem die 40 bis 49-Jährigen (71,8%), welche Grünanlagen und Parks nutzen. Am seltensten trifft man dort auf die Gruppe der 70 bis 79-Jährigen (58,7%) und der 14 bis 19-Jährigen (58,8%) (vgl. Tab. 64).
Tab. 64: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten –differenziert nach Altersgruppen
Altersgruppe Ja
14-19 Jahre (n=177) 58,8%
20-29 Jahre (n=244) 67,2%
30-39 Jahre (n=239) 66,1%
40-49 Jahre (n=450) 71,8%
50-59 Jahre (n=301) 69,8%
60-69 Jahre (n=209) 63,2%
70-79 Jahre (n=93) 58,7%
Die Bewohner der Stadtteile Gemen / Gemenrückling / Gemenwirthe (72,6%) nutzen diese Sportgelegenheiten dabei am häufigsten, dicht gefolgt von Grütlohn / Hoxfeld / Rhedebrügge / Westenborken (69,8%) und Borken (69,6%) (vgl. Tab. 65).
Tab. 65: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten – differenziert nach Stadtteil
Stadtteile Ja
Borken (n=658) 69,6%
Borkenwirthe, Burlo (n=166) 63,3%
Gemen, Gemenrückling, Gemenwirthe (n=288) 72,6%
Grütlohn, Hoxfeld, Rhedebrügge, Westenborken (n=202)
69,8%
Marbeck (n=181) 64,6%
Weseke (n=213) 54,5%
Betrachtet man die einzelnen Grünanlagen, Parks bzw. Wälder, so zeigt sich, dass über 70 Prozent der Aktiven, die in Grünanlagen, Parks oder Wäldern ihrem Sport nachgehen, die Sportgelegenheit Pröbsting mindestens einmal im Monat aufsuchen. Durchschnittlich sind diese Aktiven drei Mal im Monat dort anzutreffen. Der Klosterbusch in Burlo liegt auf dem letzten Platz der beliebtesten Orte. Ihn nutzen nur 15,3% zum Sportreiben (vgl. Tab. 66).
Sportgelegenheiten in Borken | 199
Tab. 66: Nutzung und Nutzungshäufigkeit differenziert nach Sportgelegenheit
Nutzung
(Mehrfachnennungen möglich; n=1760)
-Nutzungshäufigkeit pro Monat
Pröbsting (Hoxfeld) 70,3% 3,0 Sternbusch (Gemen) 43,3% 1,7 Ehem. Bundeswehrgel. (Borken)
31,4% 1,1
Stadtpark (Borken) 31,3% 1,4 Galgenberg (Marbeck) 17,7% 0,8 Klosterbusch (Burlo) 15,3% 1,0
7.3 Allgemeine Bewertung der Grünanlagen, Parks und Wälder
Bei den Nutzern von Grünanlagen, Parks und Wäldern stehen die Aspekte Sicherheit, der Zustand des Wegesystems und eine gute Erreichbarkeit im Vordergrund ihres Interesses. Ruhe/kein Lärm und das Naturerlebnis folgen in der Wichtigkeit bei der Nutzung dieser Sportgelegenheiten. Eine Möglichkeit zum Walken / Nordic-Walken steht bei den Nutzern auf dem letzten Platz der Prioritätenliste. Betrachtet man die Zufriedenheit der Nutzer mit den einzelnen Aspekten, so ist diese bezüglich der Aspekte gute Erreichbarkeit, Naturerlebnis und Ruhe/kein Lärm am höchsten, gefolgt von den Möglichkeiten zum Joggen. Am unzufriedensten sind die Aktiven mit der Beleuchtungssituation, den Möglichkeiten zum Inline-Skaten, der Sicherheit und dem Zustand des Wegesystems (vgl. Tab. 67). Bringt man diese Ergebnisse in Bezug zur Wichtigkeit, zeigen sich vor allem zwei Handlungsprioritäten: Sicherheit und Zustand des Wegesystems. Hierbei zeigt die Erfahrung, dass oft schon mit einer besseren Beleuchtung der Wege das Sicherheitsempfinden verbessert wird. Die hohe Unzufriedenheit im Bereich der Möglichkeiten zum Inline-Skaten sollte unter dem Aspekt betrachtet werden, ob in Borken ausreichend geeignete Wege zur Ausübung des Sports vorhanden sind bzw. ob es ein Optimierungspotential bei der Beschilderung oder der Bekanntmachung geeigneter Strecken gibt.
Sportgelegenheiten in Borken | 200
Tab. 67: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald - Gesamtauswertung
Legende: Wichtigkeit (W): 2=absolut wichtig, -2=absolut unwichtig; Zufriedenheit (Z): 2=absolut zufrieden, -2=absolut unzufrieden
7.4 Nutzerbewertungen und Ergebnisse der Begehung
Nachfolgend soll auf die Nutzerbewertung (vgl. Tab. 68) sowie die Eindrücke der Begehung ausgewählter Gebiete eingegangen werden, welche aufgrund ihrer natürlichen Umgebung und der Abgeschiedenheit vom Straßenverkehr sehr gut als Sportgelegenheiten genutzt werden können.
Gesamt Wichtigkeit Zufriedenheit
Zustand des Wegesystems 1,35
(n=1049)
0,83
(n=1029)
Sicherheit 1,37
(n=1024)
0,59
(n=992)
Beleuchtung 0,82
(n=991)
0,07
(n=956)
Möglichkeit zum Joggen 0,97
(n=976)
1,01
(n=926)
Mögl. zum Walking/ Nordic-Walking 0,42
(n=991)
0,88
(n=935)
Möglichkeit zum Radfahren 1,02
(n=1029)
0,90
(n=989)
Möglichkeit zum Inline-Skaten 0,62
(n=944)
0,15
(n=842)
Naturerlebnis 1,2
(n=1021)
1,24
(n=984)
Ruhe/kein Lärm 1,21
(n=1019)
1,16
(n=994)
Gute Erreichbarkeit 1,34
(n=1003)
1,34
(n=992)
Gesamtzufriedenheit - 1,02
(n=965)
Sportgelegenheiten in Borken | 201
Tab. 68: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald – Differenziert nach Sportgelegenheiten in den einzelnen Stadtteilen
Legende: Wichtigkeit (W): 2=absolut wichtig, -2=absolut unwichtig; Zufriedenheit (Z): 2=absolut zufrieden, -2=absolut unzufrieden
Ehem. BW-
Gelände (n=93-111)
Galgenberg
(n=66-76)
Klosterbusch(n=60-81)
Pröbsting
(n=343-420)
Stadtpark
(n=82-98)
Sternbusch
(n=154-200)
W Z W Z W Z W Z W Z W Z
Zustand des Wegesystems 0,98 0,79 1,17 0,62 1,30 0,44 1,46 1,05 1,37 1,16 1,41 0,50
Sicherheit 0,97 0,41 1,22 0,29 1,30 0,35 1,47 0,76 1,63 0,68 1,30 0,54
Beleuchtung 0,14 0,11 0,63 -0,28 0,79 -0,20 1,00 0,13 1,44 0,46 0,49 -0,04
Möglichkeit zum Joggen 0,89 1,15 1,17 0,74 1,03 0,83 0,99 1,15 0,71 0,79 1,04 0,99
Mögl. zum Walking/ Nordic-Walking 0,09 0,93 0,60 0,71 0,70 0,89 0,27 0,92 0,44 0,88 0,58 0,83
Möglichkeit zum Radfahren 0,58 0,73 1,01 0,86 1,10 0,60 1,04 1,03 1,35 1,11 0,95 0,68
Möglichkeit zum Inline-Skaten -1,05 -0,32 -0,33 0,06 -0,27 -0,47 -0,59 -0,12 0,18 0,33 -1,13 -0,40
Naturerlebnis 1,27 1,36 1,08 1,01 1,21 1,14 1,24 1,30 1,05 0,95 1,14 1,34
Ruhe/kein Lärm 1,30 1,32 1,12 0,96 1,26 1,00 1,25 1,19 0,91 0,82 1,18 1,32
Gute Erreichbarkeit 1,30 1,48 1,21 1,28 1,38 1,32 1,36 1,32 1,32 1,25 1,34 1,44
Gesamtzufriedenheit 1,00 0,93 0,90 1,12 0,99 0,97
Sportgelegenheiten in Borken | 202
7.4.1 Pröbsting Zunächst ist das über 120 ha große Gebiet rund um den Pröbsting-See zu nennen, da es dem Besucher eine natürliche Atmosphäre bietet und außerdem durch die vielen Aktivitätsmöglichkeiten, den guten Zustand und seine Größe besticht. Direkt neben dem großen Parkplatz befindet sich ein gut ausgestatteter Spielplatz. Der über 10 ha große See ist von einem in gutem Zustand befindlichen Wegenetz umgeben, welches eine Umrundung des Sees ermöglicht und Anschluss an den benachbarten Wald bietet. Meist handelt es sich hierbei um Parkwege, teils aber auch um asphaltierte Wege. Viele Bänke bieten ausreichende Möglichkeiten für Ruhepausen. Auf dem See sind verschiedene Wassersportarten wie Tretbootfahren (Bootsverleih), Paddeln oder Surfen möglich und auch ein Segel- und ein Drachenbootverein sind hier angesiedelt. Zudem besteht die Möglichkeit zu angeln. In einem künstlich angelegten See besteht die Möglichkeit zu baden (DLRG-Überwachung in der Saison, in den Ferien und an Wochenenden; abgegrenzter Nichtschwimmer-Bereich in der Saison). Hier schließen sich eine große Liegewiese sowie ein Sandstrand an. In unmittelbarer Nähe hierzu befinden sich ein weiterer Spielplatz, eine Minigolf-Anlage, eine Tischtennisplatte, ein Beachvolleyball-Feld sowie ein Basketball-Korb (Rasen). Im Freizeithaus Pröbsting stehen kostenlose Duschen, Umkleidekabinen und Schließfächer zur Verfügung. Am Pröbsting-See startet außerdem der 6 km lange Planetenweg, welcher an der Josef-Bresser-Sternwarte endet und die Dimensionen des Sonnensystems für die Besucher erfahrbar machen soll. In der Gaststätte Pröbstinger See sowie in der Gaststätte und im Biergarten des Freizeithauses Pröbsting besteht die Möglichkeit zur gastronomischen Versorgung. In unmittelbarer Nähe gibt es außerdem einen Sportplatz, einen Tennisplatz und Reithalle. Der sehr positive Gesamteindruck deckt sich auch mit der Bevölkerungsbefragung, in der die Gesamtbewertung mit 1,12 (auf einer Skala von -2 bis 2) im Vergleich mit allen anderen Sportgelegenheiten am besten ausfällt. Die Bewertungen der einzelnen Kriterien decken sich ebenfalls mit den Eindrücken der Begehung. Neben den üblichen Aspekten Erreichbarkeit, Naturerlebnis und Ruhe sind vor allem die positiven Bewertungen der Möglichkeiten zum Joggen und des Zustandes des Wegesystems auffällig. Somit werden auch die Möglichkeiten zum Radfahren überdurchschnittlich gut bewertet. Berücksichtigt man die Wichtigkeit der betrachteten Aspekte, lässt lediglich die Beleuchtung zu wünschen übrig. Dies sollte angesichts der beschränkten Möglichkeiten allerdings relativiert werden (vgl. Tab. 68).
Sportgelegenheiten in Borken | 203
Abb. 122: Das gut ausgebaute und beschilderte Wegesystem rund um den Pröbsting-See
Abb. 123: Pröbsting-See mit Sandstrand und Liegewiese
7.4.2 Ehemaliges Bundeswehrgelände (Fliegerberg) Der Fliegerberg ist eine 84,7 m hohe Erhebung im Höhenzug der Borken-Ramsdorfer Berge. Er diente als Startplatz für die Segelflugzeuge der Borkener Segelfluggruppe, welche 1931
Sportgelegenheiten in Borken | 204
einen Segelflugplatz in Betrieb nahm. 1957 wurde auf dem Gelände die Hendrik-de-Wynen-Kaserne errichtet. Zwischen den 70er Jahren und 2006 dienten etwa 230 ha der Berge als Standortübungsplatz der Bundeswehr mit Schießstand und Munitionsdepot. 2009 wurde das Gebiet zu einem Naturschutzgebiet erklärt. Die Begehung des Gebiets ergab, dass hier gute Voraussetzungen für Sport und Erholung vorliegen. Für die das Gelände durchkreuzenden Wege sind Radrouten ausgeschildert. Allerdings lässt der Zustand der Wege zu wünschen übrig. Vor allem die Sandwege, welche einen Großteil des Wegesystems ausmachen, sind sehr uneben. Doch auch die Asphalt-/Plattenwege sind nicht immer gut zu befahren. Da es sich um ein Naturschutzgebiet handelt, müssen sich die Nutzer auf den großen Wegen halten und z. B. das Mountainbikefahren abseits der Wege ist nicht gestattet. Sehr attraktiv wirkt dagegen die Weitläufigkeit des Gebiets, welches durch das viele Grün einen natürlichen Charakter erhält und den Besuchern Ruhe verspricht. Im Hotel-Restaurant Waldesruh besteht für die Besucher die Möglichkeit zur gastronomischen Versorgung. Die Eindrücke der Begehung decken sich mit den Ergebnissen der Nutzerbefragung. Dabei ähnelt die Bewertung des Gebiets denen anderer Sportgelegenheiten in Borken: Die Nutzer sind mit dem Gelände insgesamt zufrieden, besonders mit der Erreichbarkeit, dem Naturerlebnis, der Ruhe und den Möglichkeiten zum Joggen. Diese Aspekte werden auch als wichtig erachtet. Weiterhin wichtig sind für die Nutzer der Zustand des Wegesystems und die Sicherheit, welche jedoch weniger gut bewertet werden. Zwar ist die Zufriedenheit mit der Beleuchtung ebenfalls gering, doch wird diese auch nicht als besonders wichtig eingestuft. Letzteres ist unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Beleuchtung eines so großen und bewaldeten Gebiets nachvollziehbar (vgl. Tab. 68).
Abb. 124: Sehr unterschiedliche Zustände des Wegesystems im ehemaligen Bundeswehrgelände am Fliegerberg
Sportgelegenheiten in Borken | 205
Abb. 125: Ausgeschilderte Radrouten im ehemaligen Bundeswehrgelände am Fliegerberg
7.4.3 Sternbusch Das ehemals für die Jagd angelegte Gelände verbindet die Stadtteile Gemen und Weseke und wird von einer Vielzahl an in gutem Zustand befindlichen langen und geraden Wald- und Schotterwegen durchkreuzt. Diese laden ebenso wie die umgebenden Land- und Forstwirtschaftswege sowie der Radweg entlang der Landstraße zu Radtouren, Läufen oder Spaziergängen ein. Die Umgebung bietet dem Besucher außerdem ein Naturerlebnis und Ruhe, was auch aus der Bevölkerungsbefragung hervorgeht, in der die Erreichbarkeit, das Naturerlebnis und die Ruhe die Nutzer besonders zufrieden stellen. Es überrascht jedoch, dass die Nutzerbefragung zwischen Wichtigkeit und Zufriedenheit mit dem Zustand des Wegesystems große Differenzen erkennen lässt. Gleiches gilt für den Aspekt der Sicherheit, was in einem unbeleuchteten Waldgebiet aber nicht weiter verwundert. Zwar stimmt die mangelnde Beleuchtung noch unzufriedener, doch wird sie auch als unwichtiger angesehen und eine Beleuchtung dieses Gebiets wäre ohnehin nicht zu realisieren. Die Möglichkeiten zum Joggen werden im Vergleich zu anderen Sportgelegenheiten eher gut bewertet, die Möglichkeiten zum Radfahren dagegen eher schlecht, was mit Blick auf die Unzufriedenheit mit dem Zustand des Wegesystems logisch erscheint, sich jedoch nicht mit den Eindrücken der Begehung deckt (vgl. Tab. 68). In der Nähe des Sternbuschs befindet sich außerdem das seit 1994 bestehende Naturschutzgebiet Bocholter-Aa-Niederung, welches ebenfalls für sportliche Aktivitäten genutzt werden kann. Abgegrenzt wird es durch die Burg Gemen, welche dem Stadtteil Gemen seinen Namen gab und aus dem allmählichen Umbau einer mehr als 900 Jahre alten Wasserburg entstand. Es handelt sich um ein Schloss, welches vom Edelherren von Gemen,
Sportgelegenheiten in Borken | 206
einem der einflussreichsten westfälischen Adelsgeschlechter seiner Zeit, erbaut wurde. Seit 1946 ist die Jugendburg Gemen durch den Bischof von Münster insbesondere für die Jugendarbeit gepachtet und zählt mit 230 Betten und 27 Gruppenräumen zu den großen katholischen Jugendbildungseinrichtungen in Deutschland. Für Jugendliche und junge Erwachsene ist sie ein Ort der Begegnung, der Information, des gemeinsamen Erlebens und der Besinnung. Ein Niedrigseilgarten sowie ein Beachvolleyball-, ein Streetball- und ein Fußball-Feld ermöglichen außerdem eine Reihe sportlicher Aktivitäten, die allerdings an die Jugendburg Gemen gebunden sind. Auch ein Kinderspielplatz befindet sich in der Nähe.
Abb. 126: Der Sternbusch ist geprägt durch lange und gerade Waldwege
Abb. 127: Auch das Gelände um die Jugendburg Gemen lädt zum Sporttreiben ein
Sportgelegenheiten in Borken | 207
7.4.4 Stadtpark Das heutige Gebiet des Stadtparks unterliegt nach Weddeling (2000) bereits seit mehr als 600 Jahren einer mehr oder minder starken Nutzung durch den Menschen. So ist für den Bereich der Vennegärten durch Urkunden belegt, dass die Flächen schon 1361 als Gärten vor den Toren der Stadt Borken genutzt wurden. Die Parkanlagen nördlich des Vogelgeheges sind nach dem Krieg wieder instand gesetzt und später nach Süden mit der Festwiese und Sportanlagen erweitert worden. Der Borkener Stadtpark ist die einzige innerstädtische der untersuchten Sportgelegenheiten. Dementsprechend überrascht es nicht, dass hier das Naturerlebnis und die Ruhe im Vergleich etwas schlechter abschneiden als in den anderen Gebieten. Dennoch gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, sportlich aktiv zu werden. Neben den sehr guten Park- und Asphaltwegen zum Laufen, Radfahren oder Walken gibt es im Park eine Skating-Anlage sowie am benachbartem Gymnasium Remigianum einen Basketball-Platz, welcher an den Wochenenden allerdings nicht genutzt werden kann. Ferner gibt es einen gut ausgestatteten Spielplatz und eine Outdoor-Fitnessanlage mit verschiedenen kraft- und koordinationsfördernden Übungen. Das Vogelgehege, die weiten Rasen- und Grünflächen, der alte Baumbestand sowie die vielen Bänke für Ruhepausen laden zudem zum Verweilen ein. Es verwundert somit nicht, dass die Nutzer mit der Anlage insgesamt zufrieden sind und dass bezüglich der Zufriedenheit auf den Plätzen zwei und drei nach der Erreichbarkeit der Zustand des Wegesystems und die Möglichkeiten zum Radfahren folgen. Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit bilden die Aspekte Sicherheit und Beleuchtung die Schlusslichter, obwohl entlang der Wege Laternen vorhanden sind. Zwar wird den Möglichkeiten zum Inline-Skaten hier keine große, im Vergleich aber mit den anderen Sportgelegenheiten die größte Wichtigkeit beigemessen (vgl. Tab. 68).
Abb. 128: Das gut ausgebaute Wegenetz im Stadtpark bietet viele Möglichkeiten zum Sporttreiben
Sportgelegenheiten in Borken | 208
Abb. 129: Spielplatz und Bewegungspark bieten einer breiten Zielgruppe die Möglichkeit zu körperlicher Aktivität
7.4.5 Galgenberg Das Gelände um den Galgenberg ist vor allem für Sporttreibende attraktiv, welche das Gebiet als Ergänzung zu den Sportanlagen Im Trier oder zum Stadtpark betrachten. Ist die Bundesstraße von dort aus überquert, bieten sich auf den vielen kleinen und von Wald umschlossenen Straßen zahlreiche Möglichkeiten zum Joggen oder Radfahren, da sie wenig befahren sind. Auch für Inline-Fahrer, Walker oder Reiter ist das Gebiet attraktiv, obwohl es für die sportliche Nutzung wenig erschlossen ist. Vereinzelt gibt es kleine Stichwege und Trampelpfade durch den Wald. Diese sind zwar in der Regel kurz und für ortsunkundige nicht sofort ersichtlich, doch können sie für eine angenehme Abwechslung für die Sporttreibenden sorgen. Der Galgenberg ist auch per ÖPNV mit der Buslinie 850 (Haltestellen „Ahlmann“ und „Galgenberg“) sowie mit einem Anrufsammeltaxi zu erreichen. Dies könnte neben der Anbindung an die Sportanlagen Im Trier und an den Stadtpark ein weiterer Grund dafür sein, dass die Nutzer mit der Erreichbarkeit am zufriedensten sind. Es folgen das Naturerlebnis und die Ruhe. Auch kann man insgesamt von zufriedenen Nutzern sprechen. Unter Berücksichtigung der Wichtigkeit lassen vor allem die Sicherheit und der Zustand des Wegesystems zu wünschen übrig, was angesichts der Abgeschiedenheit und der Tatsache, dass neben den kleinen Straßen ausschließlich Trampelpfade vorhanden sind, zu erwarten war. Somit wünschen sich die Befragten auch bessere Möglichkeiten zum Joggen. Zwar besteht auch Unzufriedenheit mit der Beleuchtung, doch ist es fraglich, inwieweit diese verbessert werden kann (vgl. Tab. 68).
Sportgelegenheiten in Borken | 209
Abb. 130: Am Galgenberg zweigen mehrere Stichwege von der Straße ab
Abb. 131: Teilweise sind die Stichwege am Galgenberg durch Trampelpfade miteinander verbunden
Sportgelegenheiten in Borken | 210
7.4.6 Klosterbusch Das Kloster Mariengarden ist ein katholisches Kloster in Burlo. Zur Abgrenzung vom Kloster Kleinburlo wird es häufig auch als Kloster Großburlo bezeichnet. Im Zuge der Säkularisation wurde das Kloster 1803 aufgehoben. Bereits im 19. Jahrhundert wurden Teile des Klosters schulisch genutzt. 1920 besiedelten die Oblaten der makellosen Jungfrau Maria das Kloster Mariengarden neu und gründen hier eine Privatschule, das Gymnasium Mariengarden. Dieses besteht bis heute und es gliedern sich ein Gästehaus, eine Pfarrei und ein Jugendzentrum an. Für Kinder und Jugendliche gibt es hier verschiedene Angebote, Projekte, Sommercamps, Jugendmessen und Abendgebete. Nördlich an den Klostersee schließt sich ein kleines Waldgebiet an, welches von zwei sich etwa mittig kreuzenden Schotterwegen durchzogen ist. Diese bilden den Ausgangspunkt für mehrere kleine Wege und Trampelpfade, befinden sich aber in relativ schlechtem Zustand. Insgesamt ist das Gebiet zum Radfahren zu klein und auch für Jogger bietet das Strecknetz nicht viel Abwechslung. Dies spiegelt sich auch in der Nutzerbefragung wider, welche für den Klosterbusch im Vergleich zu anderen Sportgelegenheiten die geringste Gesamtzufriedenheit ergibt. So wird der Zustand des Wegesystems schlechter als in allen anderen Gebieten bewertet, was auch dem Eindruck der Begehung entspricht. Um das Gebiet diesbezüglich zu attraktivieren, müsste das Wegesystem den See umspannen. Das östliche Ufer ist jedoch durch Bebauung und das westliche Ufer durch die Landstraße zum Sporttreiben weniger geeignet. Lediglich auf der Südseite des Sees kann die Badestelle als Sportgelegenheit dienen. Ferner wünschen sich die Befragten vor allem eine bessere Beleuchtung und dadurch mehr Sicherheit. Ein Parkplatz befindet sich nördlich des Gebiets. Von dort wird der Zugang über einen schmalen Waldweg ermöglicht. Außerdem sind dort drei gastronomische Betriebe angesiedelt (vgl. Tab. 68).
Abb. 132: Im Klosterbusch bilden zwei in schlechtem Zustand befindliche Wege die sich kreuzenden Achsen
Sportgelegenheiten in Borken | 211
Abb. 133: Das Gelände zwischen den beiden Hauptwegen des Klosterbusches ist von Trampelpfaden durchzogen
7.5 Gesamteindruck der Sportgelegenheiten
Insgesamt verfügt Borken sowohl innerhalb als auch außerhalb des Stadtkerns über attraktive Parkanlagen und Waldgebiete, die als Sportgelegenheiten genutzt werden können. Diese stehen darüber hinaus durch das attraktive Umland und die vielen Land- und Forstwirtschaftswege bzw. die guten Radwege teilweise miteinander in Verbindung, was die Attraktivität gerade für Radfahrer nochmals steigern kann. Beispielsweise besteht die Möglichkeit, vom Fliegerberg im alten Bundeswehrgelände über den Forellenteich, an dem sich auch ein Spielplatz befindet, durch die Aa-Niederung vorbei an der Burg Gemen mit mittelalterlichem Flair in den Sternbusch zu gelangen, welcher Anschluss nach Weseke bietet. Derartige Möglichkeiten sollten über ausgeschilderte Routen und eine internetbasierte Plattform besser zugänglich gemacht werden. Ferner könnten in einigen Gebieten Verbesserungen erzielt werden, indem die Wegesysteme ausgebessert und mit Routenvorschlägen und Kilometerangaben versehen werden. Eine verbesserte Wegebeleuchtung würde gewiss das Sicherheitsgefühl der Nutzer – vor allem im Winterhalbjahr – erhöhen.
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 212
8 Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken
8.1 Einführung
Sportentwicklungsplanung in der heutigen Zeit ist mehr als in vergangenen Jahrzehnten ein Vergewisserungsprozess über Veränderungsfaktoren und deren Folgen. Der zunehmende Bedeutungsverlust der richtwerteorientierten Planung hat zu einer Suche nach den neuen Instrumenten und wissenschaftlichen Verfahren geführt, um eine richtungsweisende, tragfähige und zugleich umsetzungsfähige Sportentwicklungsplanung beschreiten zu können. Da heutzutage die Orientierung an Bevölkerungsdaten nicht mehr ausreichend ist, um zu konkreten politischen Entscheidungen im Kontext veränderter gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und gesellschaftspolitischer Entscheidungszwänge zu kommen, haben sich die Akteure des Borkener Sportentwicklungsprozesses darauf verständigt, gemeinsam zielgerichtete Handlungsempfehlungen für den kommunalen Sport zu erarbeiten. Diese zukunftsfähige Entwicklung gründet nicht zuletzt auch in den Ergebnissen einer Analyse der Sportpolitik und Sportförderung der Stadt Borken, die ergab, dass bislang keine langfristige Zielvorstellung und entsprechende Strategien zur Erreichung der Ziele vorliegen. Mit den Handlungsempfehlungen der Sportentwicklungsplanung wird darauf abgezielt, dem Handeln der Akteure im Borkener Sport eine verbesserte Orientierung zu geben und eine wichtige Grundlage für die Überprüfung des Handelns zu schaffen. Die Handlungsempfehlungen wurden in einem durch das Institut für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln moderierten Prozess zwischen Februar und Juli 2012 in insgesamt fünf Sitzungen der Lenkungsgruppe Sportentwicklung Borken erarbeitet und auf der letzten Sitzung am 30. August 2012 verabschiedet. Die Ergebnisse aus den von April 2011 bis Mai 2012 durchgeführten Analysen und Befragungen des Instituts für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln, wie z.B.
Bevölkerungsbefragung (n=2.683)
Sportvereinsbefragung (n=23 – Rücklauf: 62,2)
Befragung Schulsportbeauftragte (n=15 – Rücklauf: 76,2%)
Befragung Kindergärten (n=21 – Rücklauf: 91,3%)
Analyse der Sportinfrastruktur
Daten zur Stadtentwicklung
Daten zur Gesundheitsentwicklung
Demographische Daten lieferten dabei die Grundlagen für die Entwicklung der Handlungsempfehlungen durch die Lenkungsgruppe.
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 213
8.2 TeilnehmerInnen der Lenkungsgruppe Sportentwicklung Borken
Name Organisation
Herr Bunse SPD
Herr Demming FDP
Herr Dirks FDP
Frau Ebbing UWG
Herr Fellerhoff CDU
Herr Finke SSV Borken
Herr Friedrich Stadt Borken
Frau Gliem B`90/DIE GRÜNEN
Herr Kaiser SPD
Frau Kindermann SPD
Herr Kindermann SPD
Herr Klemm-Terfort Fraktionslos
Herr Lask Stadt Borken
Herr Lührmann Stadt Borken
Herr Nubbenholt SSV Borken
Herr Pfeffer Stadt Borken
Herr Pöpping Stadt Borken
Herr Richter CDU
Herr Schlagheck Stadt Borken
Frau Schulze Hessing Stadt Borken
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 214
8.3 Handlungsempfehlungen (verabschiedet in der Sitzung der Lenkungsgruppe Sportentwicklung Borken am 30.08.12)16
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
1 Kita
Zunahme von Bewegungsstörungen und Übergewicht im Kindes- und Jugendalter
Der Bereich Bewegungsförderung im Kindes- und Jugendalter wird in der Bevölkerungsbefragung als wichtigstes Handlungsfeld beurteilt
94% der Kitas können sich eine Kooperation mit einem Sportverein im Bereich der frühkindlichen Bewegungserziehung vorstellen
85% der Kitas haben Interesse an Informationen über eine bewegungsfreundliche Außengeländegestaltung
Ausbau und Verbesserung der Bewegungs- und Gesundheitsförderung in Kindertagesstätten
Verringerung der Auffälligkeiten bei den Schuleingangsuntersuchungen
Kooperationen/Partnerschaften zwischen Sportvereinen und KiTas ausbauen
Sportvereine als beratende Einrichtung für Sport- und Bewegung in der Kita
Schaffung von Qualifizierungsangeboten im Bereich „Bewegung und Sport“ für Erzieher-Innen - Unterstützung von Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen - Organisation/Unterstützung von zentralen
Schulungsmaßnahmen
2 ab
07/2013 Jugend-
amt
2 Kita Initiierung eines Runden Tisches/Gesprächsrunde zwischen Sportvereinen und Kitas
1 bis
06/2013 SSV
3 Kita Durchführung von Schnupperangeboten von Sportvereinen in Kitas
1 ab
07/2013 SSV
4 Kita
Erfassung der konkreten Bedarfe für Unterstützungsmaßnahmen im Bereich Bewegung (u.a. Außengeländegestaltung, Qualifizierungsmaßnahmen „Bewegung“…)
2 bis Ende
2013 Jugend-
amt
16 Die Spalte „Koordination“ wurde als Vorschlag vom Institut für Sportsoziologie nach der Sitzung am 30.08.2012 ergänzt.
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 215
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
5 Schule
Zunahme von Bewegungsstörungen und Übergewicht im Kindes- und Jugendalter
Der Bereich Bewegungsförderung im Kindes- und Jugendalter wird in der Bevölkerungsbefragung als wichtigstes Handlungsfeld beurteilt
Bewegungsfreundliche Schulhöfe sind z.T. vorhanden
Es lässt sich beobachten, dass ein nicht unerheblicher Anteil der Schüler/innen motorisiert zur Schule kommen/gebracht werden
Vereine haben die Sorge, dass sich die OGS negativ auf die Mitgliederzahlen und den Leistungssport auswirkt
Vision: Sport und Bewegung sind integraler Bestandteil des Schulalltags
Ausbau und Verbesserung der Qualität von Sport und Bewegung in der Nachmittagsbetreuung bzw. der offenen Ganztagsschule
Bessere Zusammenarbeit zwischen OGS, Jugendarbeit und Sport
Verstärkte Kooperationen zwischen Schulen und Vereinen, u.a. vor dem Hintergrund der Einführung des Ganztags in weiterführenden Schulen
Förderung von Fort-und Weiterbildungsmaßnahmen für Fachkräfte / ÜbungsleiterInnen, die Bewegungsangebote in der OGS durchführen
1 ab 2013 Schulamt
6 Schule Förderung von Vereinsangeboten in der OGS durch FSJ´ler – Prüfung der Einrichtung weiterer Stellen
2 bis
06/2013 SSV
7 Schule Prüfung der Umsetzbarkeit von Sportangeboten in der OGS räumlich außerhalb der Schule (fußläufig)
2 bis
06/2013 Schulamt
8 Schule Umsetzung/Weiterentwicklung des Konzepts „Schüler zum Verein“ (SSV)
2 ab 2013 SSV
9 Schule Weiterer Ausbau bewegungsfreundlicher Schulhöfe (Themenräume)
2-3 ab 2013 Bauamt
10 Schule
Erfassung des Ist-Zustands der Schulhöfe (unter dem Gesichtspunkt der Bewegungsfreundlichkeit) und Erstellung eines Prioritätenplans
1 bis 2014 Bauamt
11 Schule Förderung/Initiierung von Projekten/Initiativen für einen „aktiven Schulweg“, wie z.B. den „Walking-bus“
1 ab 2013 Schulamt
12 Schule Sensibilisierung der Schulleitungen für Konzepte der „Bewegten Schule“ im Grundschulbereich
3 bis 2014 Schulamt
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 216
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
13 Kinder- und Jugendliche
Nicht alle Kinder und Jugendlichen treiben Sport im Verein (v.a. mit Migrationshintergrund sowie aus niedrigen sozialen Schichten), da sie spontanes, ungebundenes Sportreiben bevorzugen
Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund sind signifikant weniger häufig Vereinsmitglied (vgl. Jugendstudie)
Das Angebot der „Offenen Turnhalle“ (01.11.-31.03.)wird gut angenommen
Breite Palette an offenen Sportangeboten durch Jugendtreffs/-häuser
Verringerung der Zugangsbarrieren zu Sport- und Bewegung durch niederschwellige Angebote
Offene Sport- und Bewegungsangebote sollen dauerhaft etabliert und ausgeweitet werden
Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Jugendarbeit und Sport
Durchführung/Initiierung von offenen Angeboten in Kooperation zwischen Jugend-(Schule)-Verein
1 ab 2013 Jugend-
amt
14 Kinder- und Jugendliche
Mehr offene Angebote durch Sportvereine (z.B. durch Zusammenarbeit mit anderen Sportvereinen)
1 ab 2013 SSV
15 Kinder- und Jugendliche
Durchführung von „Sportnächten“ (und ggf. anderer Events)
3 ab
09/2013
Jugend-amt / SSV
16 Kinder- und Jugendliche
Bessere Abstimmung der Vereine hinsichtlich ihrer Angebote im Rahmen ihrer Ferienangebote (z.B. „Ferienkoffer“, Fußballcamps...)
2 ab 2013 Jugend-amt / SSV
17 Kinder- und Jugendliche
Umsetzung „Offener Sportplatz“ (01.04.-31.10.) analog zur „Offenen Turnhalle“
2 ab 2013 SSV
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 217
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
18 Sportstätten
Laut Belegungsplan liegt eine sehr hohe Auslastung der meisten Sporthallen vor.
Es existiert ein Sanierungsstau/-druck bei den städtischen Turn- und Sporthallen.
Es liegt zurzeit kein gesamtstädtisches Konzept zur Entwicklung der Sportstätten vor
Den Sportaktiven steht ein möglichst optimaler Sportraum in Hinblick auf Zustand und Raumbedürfnisse zur Verfügung
Optimale Auslastung der Turn- und Sporthallen
Bei den Turn- und Sporthallen sollte zumindest der erreichte Status der Sportversorgung erhalten bleiben
Weiterführung des Sanierungsprogramms
Erstellung eines Sanierungskonzepts (incl. Prioritätenliste)– unter Einbeziehung aller zuständigen Stellen – für Turn- und Sporthallen. Dabei müssen veränderte Bedürfnisse der Aktiven, Veränderungen in der Gesellschaft und nachhaltige Kriterien berücksichtigt werden
älter werdende Gesellschaft, Gesundheitsorientierung, Bedarfsorientierung wohnortnah Wohlfühlqualität Energieeffizienz etc.
1 bis Ende
2013 Bauamt
19 Sportstätten
Transparente Darstellung der Sportstättenbelegungszeiten, auch als Informationsmöglichkeit von Sportangeboten für die Bevölkerung (vgl. Punkt 39) Schritte:
- Begutachtung von Angeboten - Entscheidung zur Einführung
1 bis Mitte
2013 Sportamt
20 Sportstätten Systematische Erfassung der unbefriedigten Nachfragen nach Hallenzeiten
3 ab 2013 Sportamt
21 Sportstätten Überprüfung der Ursachen bei Hallen, bei denen im Rahmen der Untersuchung eine hohe Unzufriedenheit festgestellt wurde
2 bis
03/2013 Bauamt
22 Sportstätten Optimierung des Informationsmanagements bei Reparaturbedarfen
3 ab 2013 Bauamt
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 218
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
23 Sportstätten
Im Bereich der Sportplätze wurden in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (v.a. der Umkleidegebäude) durchgeführt.
Das Sportzentrum im Trier ist die letzte Anlage, die noch nicht saniert wurde. Sie ist die Anlage mit der höchsten Nutzung (u.a. aufgrund einer hohen Schulnutzung) in Borken.
Optimale Auslastung der Sportplätze
Den Sportaktiven steht ein möglichst optimaler Sportraum in Hinblick auf Zustand und Raumbedürfnisse zur Verfügung
Überprüfung der tatsächlichen Belegungszeiten durch die Sportvereine (Auflage für die Vereine zur regelmäßigen Übermittlung dieser Daten an die Sportverwaltung)
2 ab 2013 Sport-amt / SSV
24 Sportstätten Entwicklung des Sportzentrums im Trier 1 baldmöglic
hst Bauamt
25 Sportstätten Entwicklung eines Gesamtentwicklungskonzepts „Sportpark Borken“, auch unter Berücksichtigung der Thematik „Leistungssport“
3 bis 2015 Bauamt
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 219
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
26 Vereinssport
Der Organisationsgrad lag im Jahr 2011 mit 43,3% deutlich über dem Landesdurchschnitt (28,3%); Trotzdem erschwert eine Unübersichtlichkeit der Angebote eine Koordination
Vereine klagen über Konkurrenz durch sonstige Sportanbieter, wie VHS, FABI, KSB etc.
Für die Sportvereine ist ein gravierender Wandel der Rahmenbedingungen zu konstatieren. Verantwortlich für diese Veränderung sind insbesondere folgende Entwicklungsdynamiken: Demographischer Wandel
(weniger Junge, mehr Ältere) Kostendruck der öffentlichen
Hand Erosion des klassischen
Ehrenamts Neue gesellschaftspolitische
Aufgabenstellungen (vor allem Ganztagsschule)
Veränderte Sportbedürfnisse der Bevölkerung (Dienstleistungsanspruch)
Für eine optimale Sportversorgung ist es sinnvoll, die bestehende Situation zu überprüfen
Vereine sind gerüstet für die Herausforderungen der Zukunft (sind sich über die Veränderungen bewusst)
Vereine beteiligen sich aktiv an der Lösung gesellschaftspolitischer Probleme
Schaffung von professionellen Geschäftsstellen
Überprüfung/ Vergleich ähnlicher Angebote von sonstigen Sportanbietern, wie VHS, FABI, KSB etc., und Sportvereinen. Was ist bedarfsorientiert und was Konkurrenz?
2 bis
06/2013 SSV
27 Vereinssport Prüfen möglicher Kooperationen zwischen Sportverein und „städtischen Anbietern“.
- Initiierung einer Gesprächsrunde
2 bis
06/2013 SSV
28 Vereinssport Ausbau von Kursangeboten durch Vereine 1 ab
10/2012 SSV
29 Vereinssport
Problembewusstsein in Vereinen schaffen (Veränderungen, Notwendigkeit/Vorteile von Kooperationen, Fusionen...) und aufzeigen von Lösungsansätzen im Bereich der Vereinsentwicklung (z.B. Vereinsberatungsangebote LSB)
1 ab
10/2012 SSV
30 Vereinssport Optimierung der Infos über Angebote (alle Bereiche); v.a. „neue Medien“ (vgl. Punkt 39)
1 bis Mitte
2013 SSV
31 Vereinssport Verteilung von Fördergelder (Investitionen) über einen Kriterienkatalog
3 bis 2015 Bauamt
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 220
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
32 Senioren Im Seniorenbereich lassen sich
Defizite im Angebotsbereich feststellen bzw. hier besteht noch nicht ausgeschöpftes Potential für die Sportvereine.
Durch den demographischen Wandel wird die Bedeutung der Zielgruppe in Zukunft weiter steigen.
Zielgruppengerechte Angebote für Senioren
Vereine sind gerüstet
Sportvereine: Überprüfung und ggf. Anpassung ihrer Angebote und Konzepte
1 bis
03/2013 SSV
33 Senioren Initiierung von organisierten (offenen) Angeboten in der Outdoor-Fitness-Anlage im Stadtpark
2 Sommer
2013 SSV
34 Menschen mit Behinderung
Es besteht eine schlechte Angebotsübersicht für die Zielgruppe
Sportangebote für Menschen mit Behinderung / mit Einschränkungen sollten ausgebaut bzw. besser kommuniziert werden
Erstellung einer speziellen Angebotsübersicht sowie Sensibilisierung der Sportvereine für diese Thematik (vgl. Punkt 39)
1 Mitte 2013
SSV
35 Familien
Es besteht ein hoher Bedarf von Eltern, mehr Sport zu treiben
Es fehlen Betreuungsangebote für Kinder, während Eltern Sport treiben
Verbesserung der Familienfreundlichkeit des Sports in Borken
Initiierung von „Bewegten Familiensonntagen“ als gemeinsame Veranstaltung von sozialräumlichen Akteuren
2 2014 Jugend-
amt
36 Familien Betreuungsangebote anbieten/schaffen für Kinder, während Eltern Sport treiben
3 2014 SSV
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 221
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
37 Migranten
Personen mit Migrationshintergrund zeigen eine niedrigere Sportaktivitätsquote
Zielstellung sollte es sein, Personen mit Migrationshintergrund verstärkt für Bewegungsangebote zu begeistern und verstärkt in Sportvereine zu integrieren/einzubinden.
Dies sollte u.a. über sozialraumorientierte Ansätze sowie offene Angebote umgesetzt werden.
3 2014 Jugend-
amt
38 sozial-
benachteiligte MitbürgerInnen
sozial-benachteiligte MitbürgerInnen zeigen eine niedrigere Sportaktivitätsquote
Zielstellung sollte es sein, sozial-benachteiligte MitbürgerInnen verstärkt für Bewegungsangebote zu begeistern und verstärkt in Sportvereine zu integrieren/einzubinden.
Dies sollte u.a. über sozialraumorientierte Ansätze sowie offene Angebote umgesetzt werden.
2 2014 Jugend-
amt
39 Informations-management
Es existiert keine zentrale Informationsplattform für Sport- und Bewegungsangebote in Borken
Prüfung der Einführung einer Internetinformationsplattform für Sport und Bewegung
1 bis Mitte
2013 SSV
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 222
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Koordi-nation
40 Sportgelegenheiten /Selbstorganisierter
Sport
73% der sportaktiven Borkener treiben selbstorganisiert Sport
Laufen/Joggen und Radfahren liegen auf Platz 1 und 2 der beliebtesten Sportarten
46% der Sportaktivitäten werden auf Sportgelegenheiten durchgeführt
Förderung einer Infrastruktur für Sportgelegenheiten
Schaffung optimaler Voraussetzungen zum Sporttreiben
Gezielte Ausweisung von Strecken für Radfahren/Mountainbiking, Joggen und (Nordic-)Walking, Pferdesport
1 ab 2013 Bauamt
41 Sportgelegenheiten /Selbstorganisierter
Sport
Ausbau/Verbindung/Lückenschließung bestehender Routenangebote u.a. für Radfahren/Mountainbiking, Joggen und (Nordic-)Walking, Pferdesport
3 ab 2013 Bauamt
42 Sportgelegenheiten /Selbstorganisierter
Sport
Regelmäßige Aktualisierung und Verbesserung der bestehenden Informationen zum Thema Sportgelegenheiten (Internet, Karten, Infoblätter etc.) / Erstellung von Karten mit Übersichten zu Jogging-, (Nordic )Walking-Strecken etc.
1 ab 2013 Bauamt
43 Sportgelegenheiten /Selbstorganisierter
Sport
Weiterentwicklung von Bolz- und Spielplätzen in Borken / Erstellung einer Entwicklungsplanung
3 bis 2015 Bauamt
44 Sportgelegenheiten /Selbstorganisierter
Sport
Berücksichtigung neuer Ansätze wie „Motorikparks“ oder „Vita-Parcours“ bei zukünftigen Planungen
3 ab 2013 Bauamt
45 Sportgelegenheiten /Selbstorganisierter
Sport
Erhalt von Freiflächen im urbanen Raum als natürliche Spielflächen für Kinder und Jugendliche. Berücksichtigung bei Planungsmaßnahmen.
1 ab
10/2012 Bauamt
Handlungsempfehlungen zur Sportentwicklung in Borken | 223
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Zustän-digkeit
46 Politik /
Verwaltung
Es fehlen bislang Schwerpunktsetzungen / Prioritäten im Sportbereich
Hohe Akzeptanz des SSV in der Stadt bei Politik und den Vereinen
Hohe Bereitschaft der Politik und Verwaltung für Veränderung
Fehlen von Förderrichtlinien für Großprojekte
Sport und Bewegung wird als wichtige Querschnittsaufgabe in der Borkener Politik und Verwaltung betrachtet und noch stärker bei allen Entscheidungen in Politik und Verwaltung berücksichtigt
Die Bedeutung von Sport- und Bewegung als weicher Standortfaktor für die Stadt Borken wird anerkannt
Verabschiedung eines Kriterienkatalogs zur Bewertung von investiven Maßnahmen / Baumaßnahmen.
1 06/2013 Politik
47 Politik /
Verwaltung
Optimierung der Darstellung/Übersicht der verschiedenen Förderrichtlinien/Leitlinien der Stadt Borken im Sportbereich
1 Ende 2013
Sportamt
48 Politik /
Verwaltung Stärkere Berücksichtigung des Themas Bewegung bei Stadtentwicklungsmaßnahmen
2 ab 2013 Politik
Nr. Bereich /
Aufgabenfeld (Daten-)Grundlage / Ist-
Zustand Ziel Empfehlung / Maßnahme
Priorität
Zeit-rahmen
Zustän-digkeit
49 Nachhaltigkeit
SEP
Die Stadt Borken hat mit dem Projekt „Sportentwicklungsplanung Borken“ und der Entwicklung konkreter Handlungsempfehlungen den ersten Schritt für eine zukunftsorientierte, aktivierende kommunale Sportpolitik getan.
Nachhaltigkeit der Sportentwicklungsplanung sichern
Einrichtung einer Steuerungsgruppe "Sportentwicklung" (ca. 2 Treffen pro Jahr), welche den Umsetzungsprozess weiter begleitet und in regelmäßigen Abständen die Handlungsempfehlungen überprüft und gegebenenfalls anpasst
1 ab 2013 Bürger-meister-
büro
50 Nachhaltigkeit
SEP
Überprüfung der Bereitstellung personeller Ressourcen zur Koordinierung und Umsetzung der Sportentwicklungsplanung
2 2013 Politik
51 Nachhaltigkeit
SEP
Verabschiedung eines „Handlungsprogramms Sport in Borken“ in Anlehnung an die Prioritätenliste
2 03/2013 Politik
Ausblick | 224
9 Ausblick Wie in vielen anderen Städten haben/hatten die überholten Konzepte in Borken mit ihrer Orientierung an feststehenden Sportarten und Sportbedürfnissen einen weitgehend „verwaltenden“ Charakter. Dies erwies sich zunehmend als problematisch. Bezogen auf einen Gegenstand Sport, der in der traditionellen Weise nicht mehr existiert, wurden die überkommenen Konzepte und Richtlinien in weiten Teilen nicht nur untauglich, sondern vor allem auch dysfunktional, d.h. ineffizient, unwirtschaftlich und darüber hinaus kontraproduktiv zum Gemeinwohlanspruch des Sports. Tatsächlich erfordern die Individualisierungs- und Pluralisierungsprozesse des Sports mittlerweile – so auch „state of the art“ der wissenschaftlichen Diskussion – aktivierende und steuernde Elemente, d.h. eine aktive und gestaltende kommunale Sportpolitik. Ausgangslage für das Projekt Sportentwicklung in der Stadt Borken war demnach die Einsicht, dass die kommunale Sportpolitik und Sportentwicklungsplanung nicht länger den Blick davor verschließen kann, dass die Bedeutungssteigerung des Sports in den kommunalen Handlungsfeldern und seine gleichzeitige Veränderung in einer engen Beziehung stehen. Der Sport der Gegenwart ist nur unter der Bedingung vielfältiger Metamorphosen zu einem zentralen Merkmal der Alltagskultur in der postindustriellen Gesellschaft geworden. Der Kommunalpolitik in Borken war klar, dass die Erfüllung unverzichtbarer Aufgaben, wie des Sports in der Kinder- und Jugendpolitik sowie Gesundheitspolitik, neue Konzepte und Instrumente erfordert. Dabei fehlt es nicht an Konzepten, wohl aber an entsprechenden kommunalen Strategien und dem Aufbau entsprechender Netzwerke im Sinne der Public-Health-Strategien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Gleiches gilt für Zielsetzungen, die den Sport zu einem zentralen Medium sozialer Integration nutzen. Die Stadt Borken hat nunmehr mit dem Projekt „Sportentwicklungsplanung Borken“ den ersten Schritt hin zu einer zukunftsorientierten, aktivierenden kommunalen Sportpolitik vollzogen. Insbesondere mit den vorliegenden Handlungsempfehlungen liegen ideale Grundlagen für eine kreative kommunale Sportpolitik vor, die u.a. Lösungsstrategien gemeinsam mit anderen Bereichen entwickelt. Hier sei noch einmal darauf hingewiesen, dass eine kontinuierliche Abstimmung mit anderen Fachämtern und Fachplanungen der Stadt Borken, wie z.B. der Sozialentwicklungsplanung, Schulentwicklungsplanung oder Grünplanung, ein Grundpfeiler für eine gelingende Sportplanung darstellt. Die Zielsetzungen und Handlungsempfehlungen der „Sportentwicklungsplanung Borken“ dürfen, auch unter anderem aus diesem Aspekt, nicht als starres Instrument gesehen werden. Sie müssen immer wieder überprüft und gegebenenfalls an neue Veränderungen und Zielsetzungen angepasst werden. Nicht zuletzt hängt der Erfolg entscheidend an den Personen, die mit der Umsetzung der Maßnahmen betraut sind, und an der Unterstützung, welche Sie von Seiten der Politik und aus der Verwaltung erhalten.
Literatur | 225
10 Literatur Breuer, C. (2005). Steuerbarkeit von Sportregionen. Schorndorf. Breuer, C. & Rittner, V. (2002). Berichterstattung und Wissensmanagement im Sportsystem.
Zum Aufbau einer Sportverhaltensberichterstattung für das Land Nordrhein-Westfalen. Köln.
Bundesinstitut für Sportwissenschaften (Hrsg.)(2000). Leitfaden für die Sportstättenent-wicklungsplanung. Schorndorf.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (2003). Gender Mainstreaming. Was ist das? Berlin.
Deutscher Fußball-Bund (Hrsg.)(2006). DFB-Empfehlungen für Kunststoffrasenplätze. Frankfurt am Main.
Diekmann, A. (1995). Empirische Sozialforschung. Grundlagen, Methoden, Anwendungen. Reinbek.
Eulering, J. (2001). Neue Sporträume – Neue Chancen für den Sport in NRW – Grundzüge eines Handlungskonzepts des LandesSportBundes Nordrhein-Westfalen. In LandesSportBund Nordrhein-Westfalen (Hrsg.), Neue Sporträume – Chancen für Vereine (S. 8-12). Duisburg.
Eulering, J. (2002). Die Bedeutung der Sportstättenentwicklungsplanung für die Zukunft des Sports. In Landessportbund Hessen (Hrsg.), Zukunftsorientierte Sportstätten-entwicklung, Sportstättenentwicklungsplanung und Sportamt der Zukunft (S. 7-11). Frankfurt am Main.
Evers, A. & Olk, T. (1996). Wohlfahrtspluralismus – Analytische und normativ-politische Dimensionen eines Leitbegriffs. In A. Evers, A. & T. Olk (Hrsg.), Wohlfahrts-pluralismus. Vom Wohlfahrtsstaat zur Wohlfahrtsgesellschaft (S. 9-60). Opladen.
Jägemann, H. (2005). Der Sanierungsbedarf von Sportstätten: Wie ist mit der gegenwärtigen Situation umzugehen? Zugriff am 10.7.06 unter http://www.dsb.de/fileadmin/fm-dsb/downloads/GoldenerPlan3.pdf
Lynch, K. (1989). Das Bild der Stadt. Berlin. Mayntz, R. (1992). Interessenverbände und Gemeinwohl - Die Verbändestudie der
Bertelsmann Stiftung. In R. Mayntz (Hrsg.), Verbände zwischen Mitgliederinteressen und Gemeinwohl (S. 11-35). Gütersloh.
Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen (Hrsg.). (2003). Mädchen- und frauengerechter Sportstättenbau. Düsseldorf.
Pankoke, E. (2002). Sinn und Form freien Engagements. Soziales Kapital, politisches Potential und reflexive Kultur im Dritten Sektor. In H. Münkler & K. Fischer (Hrsg.), Gemeinwohl und Gemeinsinn. Rhetoriken und Perspektiven sozial-moralischer Orientierung, Bd. II (S.265-287). Berlin.
Rittner, V. & Breuer, C. (2000). Soziale Offensive im Jugendsport. Frankfurt am Main. Rittner, V. & Förg. R. (2006). Ergebniszusammenfassung. Projekt „Sport in Metropolen –
Dargestellt am Beispiel der Stadt Köln“. Projektbericht. Köln.
Literatur | 226
Rittner, V., Förg, R. & Fuhrmann, H. (2006). Grundlagen innovativer Sportentwicklung und Sportförderung in Bocholt. Datengrundlage, Leitbild und Umsetzungskonzept. Projektbericht. Köln.
Rittner, V & Keiner R. (2006). Kooperationen der Sportvereine und kommunale Integration. In C. Breuer (Hrsg.), Sportentwicklungsbericht 2005/2006. Analyse zur Situation der Sportvereine in Deutschland (S. 226-258). Köln.
Rittner, V. & Roth, R. (2004). Zukunftsorientierte Sportanlagen. Expertise. Köln. Schemel, H.J. & Strasdas, W (1998). Bewegungsraum Stadt: Bausteine zur Schaffung
umweltfreundlicher Sport- und Spielgelegenheiten. Bad Honnef. Sieverts, T. (1994). Kulturgut Stadt. Überlegungen zur Zukunft der europäischen Stadt
(Schriftenreihe Cappenberger Gespräche Bd. 27). Köln. Sportministerkonferenz (2002). Sportstättenstatistik der Länder. Berlin. Uhlenberg, A. (2006). Kunststoffrasen oder andere Beläge? Gegenüberstellung verschiedener
Sportbeläge. Gemeinde und Sport (1), 99-116. Willibald Gebhardt Instituts Essen (2009). Zusammenfassung des Abschlussberichts der
Essener Pilotstudie im Rahmen des Evaluationsprojektes „Evaluation des BeSS-Angebotes an offenen Ganztagsschulen im Primarbereich in seinen Auswirkungen auf die Angebote und Struktur von Sportvereinen, Koordinierungsstellen und die Ganztagsförderung des LandesSportBundes NRW in Nordrhein-Westfalen“. Essen.
Tabellenverzeichnis | 227
Tabellenverzeichnis Tab. 1: Rücklauf nach Stadtbezirk ............................................................................. 21 Tab. 2: Repräsentativität des Datensatzes – Indikatoren Geschlecht und Wohnbezirk
(Bevölkerung 14-79 Jahre) ................................................................................ 22 Tab. 3: Stichprobe und Grundgesamtheit differenziert nach Altersklassen (Stand 27.07.2011)
..................................................................................................................... 23 Tab. 4: Stichprobe und Grundgesamtheit (14-79 Jahre) differenziert nach Nationalität
(Stand: 27.07.2011) ......................................................................................... 24 Tab. 5: Vergleich der Vereinsmitglieder in der Befragung und beim SSB Borken gemeldeten
Mitgliedschaften (Stand 31.12.2011) .................................................................. 25 Tab. 6: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Haushaltseinkommen ....... 32 Tab. 7: Gründe zum Sporttreiben – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte (Skala von
1=gar nicht wichtig bis 5=sehr wichtig) .............................................................. 34 Tab. 8: Gründe zum Sporttreiben – differenziert nach Alter, Mittelwerte (Skala von 1=gar
nicht wichtig bis 5=sehr wichtig) ....................................................................... 35 Tab. 9: Am häufigsten ausgeübte Sportarten in Borken – bis zu drei Nennungen möglich –
ab Rang 11 (Sportaktive Bevölkerung; n=1754) .................................................... 39 Tab. 10: Sportarten differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Top 20) ................. 40 Tab. 11: Am häufigsten ausgeübte Sportarten – bis zu drei Nennungen möglich – nach
Geschlecht ...................................................................................................... 41 Tab. 12: Erstsportart – Top 5 Ranking nach Geschlecht ................................................. 41 Tab. 13: Am häufigsten ausgeübte Sportarten – bis zu drei Nennungen möglich differenziert
nach Alter ....................................................................................................... 43 Tab. 14: Erstsportart – differenziert nach Alter ............................................................ 44 Tab. 15: Am häufigsten ausgeübte Sportarten nach Stadtteil – bis zu drei Nennungen
möglich .......................................................................................................... 46 Tab. 16: Erstsport – differenziert nach Stadtteil .......................................................... 47 Tab. 17: Sportarten nach Dauer/Häufigkeit pro Monat .................................................. 50 Tab. 18: Häufigkeit und zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten pro Monat – differenziert
nach Geschlecht, Mittelwerte ............................................................................. 50 Tab. 19: Häufigkeit und zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten pro Monat – differenziert
nach Alter, Mittelwerte ..................................................................................... 51 Tab. 20: Häufigkeit und zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten pro Monat – differenziert
nach Stadtteil, Mittelwerte ................................................................................ 52 Tab. 21: Organisationsform – differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart
(Mehrfachnennungen möglich) ........................................................................... 54 Tab. 22: Organisationsform – differenziert nach Geschlecht (Mehrfachnennungen möglich) 55 Tab. 23: Organisationsform – differenziert nach Alter (Mehrfachnennungen möglich) ....... 56 Tab. 24: Organisationsform der Sportausübung – differenziert nach Stadtteil
(Mehrfachnennungen möglich) ........................................................................... 58
Literatur | 228
Tab. 25: Zeitliche Verteilung der gesamten Sportaktivität (100%) auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen – differenziert nach Geschlecht ....................... 60
Tab. 26: Zeitliche Verteilung der gesamten Sportaktivität (100%) auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen – differenziert nach Alter................................ 60
Tab. 27: Zeitliche Verteilung der gesamten Sportaktivität (100%) auf die verschiedenen Angebots- und Organisationsformen – differenziert nach Stadtteil .......................... 61
Tab. 28: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten –differenziert nach Altersgruppen ........................................................................ 70
Tab. 29: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten – differenziert nach Stadtteil ............................................................................... 70
Tab. 30: Nutzung und Nutzungshäufigkeit differenziert nach Sportgelegenheit (Sportaktive, die auf Grünanlagen, Parks und Wälder ihren Sport ausüben) .................................. 71
Tab. 31: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald – Gesamtauswertung (Mittelwerte) ................................................................................................... 72
Tab. 32: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald – Differenziert nach Sportgelegenheiten in den einzelnen Stadtteilen (Mittelwerte) ............................... 73
Tab. 33: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden .................................................... 78
Tab. 34: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden .................................................... 79
Tab. 35: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden .................................................... 80
Tab. 36: Bewertung der städtischen Turn- und Sporthallen – Mittelwerte auf einer Skala von 2=absolut zufrieden bis -2=absolut unzufrieden .................................................... 81
Tab. 37: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanbietern – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“) ......................... 83
Tab. 38: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanbietern – differenziert nach Alter, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“) ......................... 83
Tab. 39: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanlagen/-stätten – differenziert nach Geschlecht, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“) ........ 85
Tab. 40: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei Sportanlagen/-stätten – differenziert nach Alter, Mittelwerte (Skala von 1=“gar nicht wichtig“ bis 5=“sehr wichtig“) ......................... 85
Tab. 41: Beurteilung der Angebotssituation im Bereich Sport, Bewegung und Erholung im eigenen Stadtteil / Wohnumfeld – differenziert nach Stadtteil, Mittelwerte auf einer Skala von „-2=absolut unzufrieden“ bis „2=sehr zufrieden“..................................... 87
Tab. 42: Fehlende Sportangebote/-möglichkeiten im eigenen Stadtteil – differenziert nach Stadtteil, Mehrfachnennungen möglich ............................................................... 89
Tab. 43: Bewertung der Wichtigkeit verschiedener Maßnahmen zur Förderung von Sport und Bewegung in Borken (Mittelwerte auf einer Skala von „1=absolut unwichtig“ bis „5= absolut wichtig“; n=2018-2090) ......................................................................... 94
Literatur | 229
Tab. 44: Sportarten differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Kinder 3 bis 13 Jahre, Top 10) ........................................................................................................ 100
Tab. 45: Sportarten nach Dauer/Häufigkeit pro Monat (Kinder 3 bis 13 Jahre, Top 10) .... 101 Tab. 46: Organisationsform der Sportausübung (Kinder 3 bis 13 Jahre, Mehrfachnennungen
möglich, gesamt) ........................................................................................... 102 Tab. 47: Organisationsform – differenziert nach Erst-, Zweit- und Drittsportart (Kinder 3 bis
13 Jahre, Mehrfachnennungen möglich) ............................................................ 102 Tab. 48: Entwicklung der Sportvereinsmitgliederzahlen im Stadtsportverband Borken 2007
bis 2011 (Quelle: SSV Borken) .......................................................................... 106 Tab. 49: Entwicklung der Mitgliederzahlen im Landessportbund NRW von 2007 bis 2011
(Quelle: LSB NRW) .......................................................................................... 106 Tab. 50: Sportangebote der Sportvereine in Borken .................................................... 107 Tab. 51: Einschätzung der Sportvereinsangebote für Kinder im Vorschulalter ................. 155 Tab. 52: Nicht-stadteigene Schulsporthallen ............................................................. 175 Tab. 53: Vereinsgymnastikräume in Borken ............................................................... 175 Tab. 54: Übersicht städtische Turn- und Sporthallen in Borken .................................... 176 Tab. 55: Übersicht Schulbedarf Turn- und Sporthallen in Borken (1/2) .......................... 180 Tab. 56: Übersicht Schulbedarf Turn- und Sporthallen in Borken (2/2) .......................... 181 Tab. 57: Übersicht Fußballplätze in Borken ............................................................... 182 Tab. 58: Übersicht Fußballmannschaften und Trainingsumfang (Saison 2012/13) ........... 185 Tab. 59: Gegenüberstellung von Trainingsumfang und zur Verfügung stehender
Trainingszeiten (Montag bis Freitag) im Winterhalbjahr ....................................... 186 Tab. 60: Belastbarkeit von Sportbelägen .................................................................. 188 Tab. 61: Szenario Platzkapazitäten Winter Anlage „Im Trier“ ....................................... 193 Tab. 62: Prioritätenliste Anträge Sportvereine (1/2) .................................................. 195 Tab. 63: Prioritätenliste Anträge Sportvereine (2/2) .................................................. 196 Tab. 64: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten –
differenziert nach Altersgruppen ...................................................................... 198 Tab. 65: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten –
differenziert nach Stadtteil ............................................................................. 198 Tab. 66: Nutzung und Nutzungshäufigkeit differenziert nach Sportgelegenheit .............. 199 Tab. 67: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am
häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald - Gesamtauswertung ........... 200 Tab. 68: Wichtigkeit/Zufriedenheit mit den folgenden Aspekten in Bezug auf die am
häufigsten genutzte Grünanlage, genutzten Park/Wald – Differenziert nach Sportgelegenheiten in den einzelnen Stadtteilen ................................................ 201
Tab. 69: Notenskala der Hallenbewertung ................................................................. 234
Abbildungsverzeichnis | 230
Abbildungsverzeichnis Abb. 1: Treiben Sie in ihrer Freizeit Sport? - gesamt .................................................... 26 Abb. 2: Treiben Sie in ihrer Freizeit Sport? - Städtevergleich ......................................... 27 Abb. 3: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Geschlecht ..................... 28 Abb. 4: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Alter ............................. 29 Abb. 5: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Stadtteilen ..................... 30 Abb. 6: Treiben Sie in Ihrer Freizeit Sport? – differenziert nach Bildungsabschluss ........... 31 Abb. 7: Die acht wichtigsten Gründe zum Sporttreiben ................................................. 33 Abb. 8: Gründe, keinen Sport zu treiben – Auszug der Top 6 Antworten –
Mehrfachnennungen möglich ............................................................................. 36 Abb. 9: Beabsichtigen Sie in Zukunft (wieder) Sport zu treiben – sportlich inaktive
Bevölkerung .................................................................................................... 37 Abb. 10: Beabsichtigen Sie in Zukunft (wieder) Sport zu treiben – sportlich inaktive
Bevölkerung differenziert nach Alter ................................................................... 37 Abb. 11: Ausübung einer Zweit- und Drittsportart ........................................................ 38 Abb. 12: Die zehn am häufigsten genannten Sportarten, Mehrfachnennungen möglich ...... 39 Abb. 13: Häufigkeit der Sportausübung/Monat – gesamt .............................................. 48 Abb. 14: Zeitlicher Umfang der Sportaktivitäten/Monat – gesamt .................................. 49 Abb. 15: Organisationsformen der Sportausübung – gesamt .......................................... 53 Abb. 16: Nutzung der verschiedenen Organisations- und Angebotsformen ....................... 59 Abb. 17: Einordnung der Sportaktivitäten nach Aktivitätsbereich ................................... 62 Abb. 18: Bereiche des Breitensports .......................................................................... 63 Abb. 19: Orte des Sportengagements: Sportanlagen / Sportgelegenheiten ....................... 64 Abb. 20: Differenzierung der Sportgelegenheiten als Orte des Sportengagements ............. 65 Abb. 21: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements ...................... 65 Abb. 22: Genutzte Verkehrsmittel zur Erreichung der meistgenutzten Sportanlagen/-
gelegenheiten ................................................................................................. 66 Abb. 23: Entfernung zur meistgenutzten Sportanlage / Sportgelegenheit ........................ 67 Abb. 24: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements - Erstsportart ... 68 Abb. 25: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements - Zweitsportart . 68 Abb. 26: Differenzierung der Sportanlagen als Orte des Sportengagements - Drittsportart .. 69 Abb. 27: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten ..... 70 Abb. 28: Nutzung von städtischen Turn- und Sporthallen für sportliche Aktivitäten .......... 74 Abb. 29: Bewertung städtischer Turn- und Sporthallen für sportliche Aktivitäten -
Gesamtauswertung ........................................................................................... 75 Abb. 30: Wichtigkeit einzelner Aspekte beim Sportanbieter – gesamt ............................. 82 Abb. 31: Wichtigkeit einzelner Aspekte bei einer Sportanlage/-stätte - Gesamt ................ 84 Abb. 32: Bewertung der Angebotssituation im eigenen Wohnumfeld - Gesamtauswertung .. 86 Abb. 33: Fehlende Angebote im Stadtteil ................................................................... 88 Abb. 34: Welche neuen bzw. weiteren Sportarten würden Sie gerne ausüben? .................. 90 Abb. 35: Welche Sportstätten würden Sie sich wünschen? ............................................. 91
Abbildungsverzeichnis | 231
Abb. 36: Zustimmung zu Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken – Gesamt, Kategorien „stimme eher zu“ / „stimme voll und ganz zu“ (1/2) ............................. 92
Abb. 37: Zustimmung zu Aussagen zum Sport und zur Sportförderung in Borken – Gesamt, Kategorien „stimme eher zu“ / „stimme voll und ganz zu“ (2/2) ............................. 92
Abb. 38: Bewertung des Stellenwerts der Sportveranstaltungen in Borken (Mittelwerte auf einer Skala von „1=sehr gering“ bis „5= sehr groß“; n=2003-2043) .......................... 95
Abb. 39: Geschlechterverteilung in der Stichprobe, Kinder zwischen 3 und 13 Jahren ....... 96 Abb. 40: Altersverteilung in der Stichprobe, Kinder zwischen 3 und 13 Jahren ................. 97 Abb. 41: Treibt Ihr Kind in der Freizeit Sport? (Kinder 3 bis 13 Jahre) ............................ 98 Abb. 42: Mitgliedschaft in einem Sportverein (Kinder 3 bis 13 Jahre) ............................. 98 Abb. 43: Anteil der sportaktiven 3 bis 13-Jährigen, die mehr als eine Sportart betreiben .. 99 Abb. 44: Beliebteste Sportarten bei den unter 3 bis 13-Jährigen – Mehrfachnennungen
möglich .......................................................................................................... 99 Abb. 45: Aufteilung der gesamten Sportaktivitäten auf die verschiedenen Angebots- und
Organisationsformen (Kinder 3 bis 13 Jahre) ...................................................... 103 Abb. 46: Nutzung von Sportanlagen - Mehrfachnennungen möglich (Kinder 3 bis 13 Jahre)
................................................................................................................... 104 Abb. 47: Nutzung von Sportgelegenheiten - Mehrfachnennungen möglich (Kinder 3 bis 13
Jahre) .......................................................................................................... 104 Abb. 48: Größe der antwortenden Vereine ................................................................ 110 Abb. 49: Verhältnis von Ein- und Austritten in 2010 .................................................. 111 Abb. 50: Wichtigkeit verschiedener Aspekte für die Borkener Sportvereine (1/2) ............ 112 Abb. 51: Wichtigkeit verschiedener Aspekte für die Borkener Sportvereine (2/2) ............ 112 Abb. 52: Problemstellungen der Borkener Vereine (1/2) ............................................. 113 Abb. 53: Problemstellungen der Borkener Vereine (2/2) ............................................. 114 Abb. 54: Mangel an ehrenamtlichen Mitarbeitern ....................................................... 115 Abb. 55: Mögliche Maßnahmen der Vereine (1/2) ...................................................... 116 Abb. 56: Mögliche Maßnahmen der Vereine (2/2) ...................................................... 116 Abb. 57: Mittelwerte der monatlichen Beiträge ......................................................... 117 Abb. 58: Mittelwerte der erhobenen Aufnahmegebühr ................................................ 118 Abb. 59: Unterschiedliche Beiträge und Gebühren zwischen den Abteilungen ................ 118 Abb. 60: Haushaltsvolumen der Vereine in 2010 ........................................................ 119 Abb. 61: Verteilung der Finanzmittel auf die verschiedenen Bereiche ........................... 120 Abb. 62: Zufriedenheit mit der Turn- und Sporthallensituation .................................... 121 Abb. 63: Zufriedenheit mit der Sportplatzsituation .................................................... 121 Abb. 64: Zufriedenheit mit der Schwimmbadsituation ................................................. 122 Abb. 65: Bewertung der zur Verfügung stehenden Turn- und Sporthallenzeiten .............. 122 Abb. 66: Bewertung der zur Verfügung stehenden Sportplatzzeiten .............................. 123 Abb. 67: Bewertung der zur Verfügung stehenden Schwimmbadzeiten .......................... 123 Abb. 68: Informationsfluss bei Hallenschließungen/Platzsperren ................................. 124 Abb. 69: Kenntnis über zuständige Ansprechpartner .................................................. 125 Abb. 70: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Umkleide/Sanitär) ... 126
Abbildungsverzeichnis | 232
Abb. 71: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Halle) .................... 126 Abb. 72: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Umfeld/Sonstiges) ... 127 Abb. 73: Zufriedenheit mit meistgenutzter kommunaler Sporthalle (Gesamt) ................. 127 Abb. 74: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Umkleide/Sanitär) . 128 Abb. 75: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Platz) .................. 129 Abb. 76: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Umfeld/Sonstiges) 129 Abb. 77: Zufriedenheit mit meistgenutztem kommunalem Sportplatz (Gesamt) ............... 130 Abb. 78: Kontakt mit der Sportverwaltung der Stadt Borken ........................................ 130 Abb. 79: Zufriedenheit mit der Sportverwaltung der Stadt Borken ................................ 131 Abb. 80: Zufriedenheit mit den Leistungen der Stadt Borken ....................................... 132 Abb. 81: Wichtigkeit verschiedener Hilfen und Angebote des SSV Borken ...................... 133 Abb. 82: Zufriedenheit mit verschiedenen Angeboten des SSV Borken ........................... 133 Abb. 83: Kooperationen mit anderen Vereinen oder Einrichtungen ............................... 134 Abb. 84: Intensität der Zusammenarbeit mit anderen Vereinen oder Einrichtungen ......... 135 Abb. 85: Erwünschte Kooperationspartner ................................................................ 136 Abb. 86: Ausstattung mit einem Turnraum ................................................................ 140 Abb. 87: Nutzbarkeit von Fluren und Verkehrsflächen ................................................. 141 Abb. 88: Veränderung der Koordinationsprobleme bei Kindergartenkindern in den letzten
Jahren ......................................................................................................... 142 Abb. 89: Umsetzung einer regelmäßigen Bewegungsförderung ..................................... 142 Abb. 90: Halten Sie eine stärkere Bewegungsförderung für sinnvoll? ............................ 143 Abb. 91: Halten Sie eine stärkere Bewegungsförderung im Rahmen ihrer täglichen Arbeit für
möglich? ...................................................................................................... 143 Abb. 92: Interesse zur Beteiligung an einem Projekt zu Bewegungsförderung ................ 144 Abb. 93: Berücksichtigung des Bereichs Bewegungsförderung/Psychomotorik in der
Ausbildung der ErzieherInnen .......................................................................... 145 Abb. 94: Bekanntheit der Initiative „Bewegungskindergärten“ .................................... 146 Abb. 95: Turnen in altersgleichen oder altersgemischten Gruppen ................................ 146 Abb. 96: Umgesetzte Maßnahmen zur Bewegungsförderung......................................... 147 Abb. 97: Wichtigkeit verschiedener Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der
Bewegungsförderung in Kindergärten ................................................................ 148 Abb. 98: Wichtigkeit verschiedener organisatorischer Maßnahmen zur Verbesserung der
Situation der Bewegungsförderung in Kindergärten ............................................. 149 Abb. 99: Umfang der Turnstunden pro Woche ............................................................ 150 Abb. 100: Umfang sonstiger Bewegungsangebote pro Woche ....................................... 150 Abb. 101: Gestaltung eines bewegungsfreundlichen Außengeländes in letzter Zeit ......... 151 Abb. 102: Interesse an Informationen über eine bewegungsfreundliche Gestaltung des
Außengeländes .............................................................................................. 152 Abb. 103: Interesse an Informationen über frühkindliche Bewegungserziehung in
Sportvereinen ................................................................................................ 153 Abb. 104: Möglichkeit einer Kooperation mit Sportvereinen ........................................ 153 Abb. 105: Möglichkeit eines optimalen Schulunterrichts ............................................. 157
Abbildungsverzeichnis | 233
Abb. 106: Auswirkungen des Zustands der Sportstätten .............................................. 158 Abb. 107: Informationsfluss bei ungeplanten Hallenschließungen ................................ 159 Abb. 108: Kenntnis über zuständige Ansprechpartner ................................................. 159 Abb. 109: Probleme zur Erfüllung des Stundensolls im Sportunterricht .......................... 160 Abb. 110: Stehen genügend Schwimmzeiten zur Verfügung? ........................................ 161 Abb. 111: Verbesserungsbedarf für die Sportstätten ................................................... 162 Abb. 112: Kooperationen mit anderen Schulen .......................................................... 163 Abb. 113: Formen der Kooperation mit anderen Schulen ............................................. 163 Abb. 114:Kooperationen mit Vereinen / anderen Anbietern ......................................... 164 Abb. 115: Formen der Kooperation mit Vereinen / anderen Anbietern ........................... 165 Abb. 116: Können Sie sich Kooperationen mit Vereinen / anderen Anbietern vorstellen? . 165 Abb. 117: Elternbefragung zum Thema Einfluss des Ganztags auf Sportreiben im Verein .. 167 Abb. 118: Ergebnisse Schuleingangsuntersuchung – Übergewicht/Adipositas ................. 170 Abb. 119: Bevölkerungsvorausberechnung 2010-2030 für Borken ................................. 174 Abb. 120: Auslastung Hallenanlagen ........................................................................ 178 Abb. 121: Nutzung von Grünanlagen, Parks und/oder Wäldern für sportliche Aktivitäten . 197 Abb. 122: Das gut ausgebaute und beschilderte Wegesystem rund um den Pröbsting-See 203 Abb. 123: Pröbsting-See mit Sandstrand und Liegewiese ............................................ 203 Abb. 124: Sehr unterschiedliche Zustände des Wegesystems im ehemaligen
Bundeswehrgelände am Fliegerberg .................................................................. 204 Abb. 125: Ausgeschilderte Radrouten im ehemaligen Bundeswehrgelände am Fliegerberg 205 Abb. 126: Der Sternbusch ist geprägt durch lange und gerade Waldwege ....................... 206 Abb. 127: Auch das Gelände um die Jugendburg Gemen lädt zum Sporttreiben ein ......... 206 Abb. 128: Das gut ausgebaute Wegenetz im Stadtpark bietet viele Möglichkeiten zum
Sporttreiben .................................................................................................. 207 Abb. 129: Spielplatz und Bewegungspark bieten einer breiten Zielgruppe die Möglichkeit zu
körperlicher Aktivität...................................................................................... 208 Abb. 130: Am Galgenberg zweigen mehrere Stichwege von der Straße ab ...................... 209 Abb. 131: Teilweise sind die Stichwege am Galgenberg durch Trampelpfade miteinander
verbunden .................................................................................................... 209 Abb. 132: Im Klosterbusch bilden zwei in schlechtem Zustand befindliche Wege die sich
kreuzenden Achsen ........................................................................................ 210 Abb. 133: Das Gelände zwischen den beiden Hauptwegen des Klosterbusches ist von
Trampelpfaden durchzogen .............................................................................. 211
Anhang | 234
Anhang
Übersicht Sportanlagen in Borken
Städtische Sport- und Turnhallen Erläuterung zur Sportstättenbegehung Alle städtischen Turn-, Sport- und Gymnastikhallen im Stadtgebiet Borkens wurden im Januar 2011 begangen und per Augenscheinnahme bewertet. Der Fokus wurde dabei auf den baulichen Zustand (Sportfläche, Sporthalle und Nebenräume), sportspezifische Charakteristika (Verletzungsgefahr, Eignung des Hallenbodens) sowie die Ausstattung der Sportstätten gerichtet. Begleitet wurden die Mitarbeiter des Instituts für Sportsoziologie der Deutschen Sporthochschule Köln dabei durch Herrn Nubbenholt (SSV Vorsitzender), z.T. eines Vertreters des Sportamtes (Herr Janzen), den jeweils für die Liegenschaft zuständigen Sachbearbeitern des Fachbereichs Gebäudewirtschaft (Herr Nieland, Herr Schroer) sowie i.d.R. durch die zuständigen Hausmeister, welche bei Fragen zu Rate gezogen werden konnten. Die Hallen wurden in Anlehnung an das Schulnotensystem bewertet. Wenn Hallen sich in einem optimalen Zustand präsentierten, wurden sie mit sehr gut bewertet. Die Bewertung gut wurde vergeben, wenn keine oder nur unbedeutende Mängel vorlagen, die im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können. Wenn Mängel erkannt wurden, die größere Reparaturen erforderlich machen bzw. der allgemeine Zustand der Anlage so einzuschätzen ist, dass in den nächsten 3-5 Jahren größere Erneuerungen anstehen, erhielt die Halle die Note befriedigend. Lagen erhebliche Mängel vor, die zudem eine möglichst zeitnahe Beseitigung erfordern, z.B. eine Erneuerung des Hallenbodens, die Sanierung von Nebenräumen, wurde mit ausreichend bewertet. Mit der Note fünf sollten Sportstätten eingestuft werden, wenn sie einen desolaten Zustand offenbarten und zur Zeit nahezu unbrauchbar sind (vgl. Tab. 69).
Tab. 69: Notenskala der Hallenbewertung
Zustand Note Die Halle befindet sich in einem optimalen Zustand. Sehr gut (1)Es liegen keine oder nur unbedeutende Mängel vor, welche im Zuge der laufenden Instandhaltung beseitigt werden können.
Gut (2)
Es liegen Mängel vor, welche größere Reparaturen erforderlich machen oder der allgemeine Zustand der Anlage ist so einzuschätzen, dass in den nächsten 3-5 Jahren größere Erneuerungen anstehen.
Befriedigend (3)
Es liegen erhebliche Mängel vor, die z.B. eine Erneuerung von Sportböden, der Sanierung von Nebenräumen, möglichst Zeitnah erfordern.
Ausreichend (4)
Die Sportstätte ist unbrauchbar. Mangelhaft (5)
Anhang | 235
Sporthalle Johann-Walling Grundschule Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Damaschkestraße 12
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1956
Maße: B=12,39 m x L=24,92 m x H=5,78 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Parkett
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 14:00 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 98,2% / Winter 97,5%
Hausmeister: Herr Rademacher (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Aufarbeitung Sporthallenboden - Erneuerung der Emporenbrüstung
Geplante bauliche Maßnahmen - Erneuerung der Lüftungsanlage - Austausch Scheiben (Rissbildung) - Austausch Tür Duschraum
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden nur ein Duschraum (für Vereine daher nur eingeschränkt
nutzbar) 2 Umkleiden, davon eine „Notumkleide“ (oben)
Bewertung Begehung gut bis befriedigend (2,5)
Anhang | 236
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Johann-Walling Grundschule Schulen
n=1 Vereine
n=2
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 4,0 2,5
Zustand der Duschen 4,0 4,0
Zustand der Toiletten 3,0 3,0
Unterbringung der eigenen Sachen - 3,0
Turnhalle/Sportplatz
baulicher Zustand der Anlage 3,0 2,0
Eignung für den Schulsport / die Sportart 2,0 3,0
zeitliche Nutzbarkeit 1,0 2,0
Qualität der Sportfläche 3,0 3,0
Sauberkeit der Sportfläche 3,0 2,5
(Raum-) Atmosphäre 3,0 2,5 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
2,0 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,0 2,0
Zustand der Sportgeräte 3,0 2,0
Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 2,0
Luftqualität / Belüftung 4,0 2,5
Umfeld/Sonstiges
Zuschauerkapazität - 3,5
Sicherheit des Zugangs - 1,5
Parkmöglichkeit - 3,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 3,5
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 1,5
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 2,0 3,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
3,0 3,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 3,0 3,0
Anhang | 237
Sporthalle Gymnasium Remigianum Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Josefstraße 6
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1963
Maße: Sporthalle: B=14,01 m x L=28,03 m x H= 5,88 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: Flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 17:30 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 100% / Winter 100%
Hausmeister: Herr Schlegel, Herr Schlücker (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Sporthalle: Erneuerung des Flachdaches zum Walmdach - Sporthalle: Sanierung des vorhandenen Schwingbodens
Geplante bauliche Maßnahmen: - Sanitäreinrichtungen
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden nur zwei Umkleideräume für Sporthalle und Gymnastikhalle keine Geräteraumtore Sanitärbereich (und Umkleiden) sanierungsbedürftig
Bewertung Begehung befriedigend (3,3)
Anhang | 238
Gymnastikhalle Gymnasium Remigianum Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Josefstraße 6
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1963
Maße: Gymnastikhalle: B=16,01 m x L=18,74 m x H=4,80 m
Typ: Gymnastikhalle
Bodenaufbau: Flächenelastisch
Oberbelag: Parkett
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 15:00 (Mo & Di bis 16:40 Uhr) Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 99,0% - Winter 99,0%
Hausmeister: Herr Schlegel, Herr Schlücker (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Geplante bauliche Maßnahmen: - Flachdachsanierung - Erneuerung des Schwingbodens - Sanitäreinrichtungen
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Sportboden: viele Dead-Spots (Boden federt nicht zurück;
Unterboden in vielen Bereichen defekt) nur zwei Umkleideräume für Sporthalle und Gymnastikhalle Sanitärbereich (und Umkleiden) sanierungsbedürftig
Bewertung Begehung ausreichend (3,7)
Anhang | 239
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Gymnastikhalle Gymnasium Remigianum Schulen
n=0 Vereine
n=1 Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume - 3,0
Zustand der Duschen - 3,0
Zustand der Toiletten - 3,0
Unterbringung der eigenen Sachen - 3,0
Turnhalle/Sportplatz
baulicher Zustand der Anlage - 2,0
Eignung für den Schulsport / die Sportart - 2,0
zeitliche Nutzbarkeit - 2,0
Qualität der Sportfläche - 2,0
Sauberkeit der Sportfläche - 2,0
(Raum-) Atmosphäre - 3,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
- 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) - 2,0
Zustand der Sportgeräte - 2,0
Lichtverhältnisse / Beleuchtung - 2,0
Luftqualität / Belüftung - 2,0
Umfeld/Sonstiges
Zuschauerkapazität - 4,0
Sicherheit des Zugangs - 2,0
Parkmöglichkeit - 4,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 2,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 4,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
- -
Sauberkeit des Umfelds - 3,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
- 2,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage - 2,0
Anhang | 240
Sporthalle Remigius Grund- und Hauptschule Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Im Großen Esch 10-12
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1968
Maße: B=14,02 m x L=27,05 m x H=5,54 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 15:30 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 97,1% / Winter 97,1%
Hausmeister: Herr Bone (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: keine Geplante bauliche Maßnahmen:
- Schwingboden sanierungsbedürftig - Austausch Heizkessel - Austausch der Eingangstür - Dach tlw. Defekt - Fenster gesprungen (Sportplatzseite) - Prallwandschutz z.T. Beschädigt
Bemerkung Brandschutztechnische Mängel vorhanden Baulicher Zustand: mittlere Mängel
Bewertung Begehung gut bis befriedigend (2,5)
Anhang | 241
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Remigius Grund- und Hauptschule Schulen
n=1 Vereine
n=2 Umkleiden/Sanitärbereich
Zustand der Umkleideräume 5,0 2,5
Zustand der Duschen 5,0 3,0
Zustand der Toiletten 5,0 3,5
Unterbringung der eigenen Sachen 5,0 3,0
Turnhalle/Sportplatz
baulicher Zustand der Anlage 4,0 3,0
Eignung für den Schulsport / die Sportart 2,0 2,0
zeitliche Nutzbarkeit 3,0 2,5
Qualität der Sportfläche 3,0 2,0
Sauberkeit der Sportfläche 4,0 2,0
(Raum-) Atmosphäre - 2,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
2,0 3,5
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,0 2,5
Zustand der Sportgeräte 3,0 3,5
Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 3,5
Luftqualität / Belüftung 3,0 3,0
Umfeld/Sonstiges
Zuschauerkapazität - 2,5
Sicherheit des Zugangs - 2,5
Parkmöglichkeit - 3,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 3,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 1,5
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 2,0 2,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
3,0 1,5
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 3,0 2,5
Anhang | 242
Sporthalle Duesberg Hauptschule Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Duesbergstraße 16-20
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1968
Maße: B=14,05 m x L=27,09 m x H=5,88 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Parket
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 16 Uhr (Fr bis 14:30 Uhr) Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 99,3% / Winter 92,1%
Hausmeister: Herr Schäfer (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Heizungsanlage wurde 2002 erneuert
Bemerkung Baulicher Zustand: Gebäude ist abgängig Umkleiden, Sanitärbereich sanierungsbedürftig Feuchtigkeits-/Schimmelprobleme Unterboden an mehreren Stellen defekt (Dead-Spots: Boden
federt nicht zurück) Vandalismusprobleme im Außenbereich
Bewertung Begehung ausreichend bis mangelhaft (4,5)
Anhang | 243
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Remigius Grund- und Hauptschule Schulen
n=1 Vereine
n=0 Umkleiden/Sanitärbereich
Zustand der Umkleideräume 5,0 -
Zustand der Duschen 5,0 -
Zustand der Toiletten 5,0 -
Unterbringung der eigenen Sachen 4,0 -
Turnhalle/Sportplatz
baulicher Zustand der Anlage 5,0 -
Eignung für den Schulsport / die Sportart 4,0 -
zeitliche Nutzbarkeit 2,0 -
Qualität der Sportfläche 4,0 -
Sauberkeit der Sportfläche 4,0 -
(Raum-) Atmosphäre 2,0 - Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 5,0 -
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 3,0 -
Zustand der Sportgeräte 3,0 -
Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 -
Luftqualität / Belüftung 2,0 -
Umfeld/Sonstiges
Zuschauerkapazität - -
Sicherheit des Zugangs - -
Parkmöglichkeit - - Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - -
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - -
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 3,0 - Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 2,0 -
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 3,0 -
Anhang | 244
Doppelsporthalle Im Trier Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Feldmark 5
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1963
Maße: B=21,01 m x L=42,34 m x H=6,96 m
Typ: Zweifachsporthalle (mit Tribüne)
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Parkett
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 15:30 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 99,3% - Winter 99,3%
Hausmeister: Herr Seeger (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Sanierung Sportboden 2003 Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren:
- Erneuerung der Hallendecke einschl. Beleuchtung - Erneuerung der Prallschutzwände - Austausch Treppengeländer - Austausch Glasbausteine
Geplante bauliche Maßnahmen: - Erneuerung Hallendach - Austausch Eingangstür - Auflagen Brandschau
Tribüne (210 Zuschauersitzplätze) Bemerkung Baulicher Zustand: schwere Mängel
Brandschutztechnische Mängel vorhanden Keine Geräteraumtore Prallschutz Seitenwände (Tribüne) fehlt (Quernutzung bei
Teilung der Halle) Bewertung Begehung gut bis befriedigend (2,5)
Anhang | 245
Sporthalle Mergelsberg Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Parkstraße 9
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 2004
Maße: B=27,75 m x L=47,07 x H i. Mittel 7,71 m (8-12m)
Typ: Dreifachhalle mit Tribüne
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Parkett
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 15:30 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 97,3% / Winter 97,3%
Hausmeister: Herr Seeger
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - keine
Geplante bauliche Maßnahmen: - Umrüstung Schließanlage
Tribüne / Zuschauerplätze gesamt: 826 - Sitzplätze: 576 - Stehplätze: 250
Schulungsraum Bemerkung Baulicher Zustand: Leichte Mängel
Brandschutztechnische Mängel vorhanden Halle wurde für den Schulsport konzipiert. Aufgrund einer
höheren Belastung durch Turniersport gab es Probleme mit dem Unterbau. Dieser wurde verstärkt und somit den höheren Belastungen angepasst.
Bewertung Begehung sehr gut (1,3)
Anhang | 246
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Mergelsberg Schulenn=1
Vereinen=2
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 1,0 1,0 Zustand der Duschen 1,0 1,0 Zustand der Toiletten 1,0 2,5 Unterbringung der eigenen Sachen 1,0 2,0 Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 1,0 1,5 Eignung für den Schulsport / die Sportart 1,0 1,5 zeitliche Nutzbarkeit 1,0 3,0 Qualität der Sportfläche 1,0 1,5 Sauberkeit der Sportfläche 1,0 1,5 (Raum-) Atmosphäre 1,0 1,5 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 1,0 1,5
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,0 1,5 Zustand der Sportgeräte 2,0 2,0 Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 4,5 Luftqualität / Belüftung 2,0 3,5 Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 1,0 Sicherheit des Zugangs - 1,5 Parkmöglichkeit - 2,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - 2,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - 1,5
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 2,0 -
Sauberkeit des Umfelds 2,0 1,5 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 1,0 2,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 1,0 1,5
Anhang | 247
Turnhalle Borkenwirthe Stadt-, Ortsteil: Borken-Borkenwirthe
Anschrift: Engeland Esch 35
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1961 / 2003
Maße: B=12,50 m x L=25,03 m x H=5,74 m
Typ: Einfachhalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Parkett
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 13:00 Uhr (Mi bis 15:00 Uhr)
Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 66,9% / Winter 66,9%
Hausmeister: Herr Hölter (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Erneuerung der Hallenfenster
Geplante bauliche Maßnahmen: - Sanierung der Sanitäreinrichtungen - Beleuchtung (gesamt) sanierungsbedürftig - Wärmedämmung Dachboden - Innentüren - Feuchtigkeitsprobleme Außenwände - Dacheindeckung Halle sanierungsbedürftig - Feuchtigkeitsprobleme Keller - Kellerfenster und Lichtschäfte sanierungsbedürftig - Haustechnik instandsetzungsbedürftig - Sanierungsbedarf Lüftung - Abwasser- und Regenentwässerungsleitungen sanierungsbedürftig - Reparatur Schwingboden
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Gesamtbetrachtung: Sanitärbereich nicht mehr zeitgemäß, da
keine Geschlechtertrennung vorhanden Boden/Unterboden vor der Bühne defekt
Bewertung Begehung befriedigend (3,3)
Anhang | 248
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Turnhalle Borkenwirthe Schulenn=3
Vereinen=1
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 4,0 3,0 Zustand der Duschen 4,7 3,0 Zustand der Toiletten 4,0 3,0 Unterbringung der eigenen Sachen 4,0 3,0 Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 4,7 4,0 Eignung für den Schulsport / die Sportart 5,0 2,0 zeitliche Nutzbarkeit 3,0 2,0 Qualität der Sportfläche 4,3 3,0 Sauberkeit der Sportfläche 4,0 2,0 (Raum-) Atmosphäre 4,0 2,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 4,3 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 5,0 3,0 Zustand der Sportgeräte 4,0 3,0 Lichtverhältnisse / Beleuchtung 3,7 2,0 Luftqualität / Belüftung 4,3 2,0 Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - - Sicherheit des Zugangs - 2,0 Parkmöglichkeit - 2,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 4,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 2,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 5,0 -
Sauberkeit des Umfelds 3,0 2,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 3,3 2,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 4,7 2,0
Anhang | 249
Sporthalle Astrid-Lindgren Grundschule / Gymnasium Mariengarden Stadt-, Ortsteil: Borken-Burlo
Anschrift: Vennweg 3
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1977
Maße: B=20,99 m x L=45,00 m x H=7,00 m
Typ: Zweifachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 16:00 Uhr
Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 89,1% / Winter 93,0%
Hausmeister: Herr Hölter (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: keine Geplante bauliche Maßnahmen:
- Sanierung Flachdach - Sanierung Schwingboden - Austausch Heizkessel - Erneuerung Eingangstür - Teilsanierung Sanitärbereich - Austausch Türen im Duschbereich
Fitnessraum Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel
Brandschutztechnische Mängel vorhanden Beschädigungen des Oberbelags (Schweißnähte lösen sich,
Risse) Es fehlt eine Damenumkleide für Sportlehrerinnen
Bewertung Begehung befriedigend (2,7)
Anhang | 250
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“ Sporthalle Astrid-Lindgren Grundschule /
Gymnasium Mariengarden Schulen
n=2Vereine
n=1Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 2,5 2,0 Zustand der Duschen 2,5 2,0 Zustand der Toiletten 4,0 3,0 Unterbringung der eigenen Sachen 4,0 4,0 Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 3,5 3,0 Eignung für den Schulsport / die Sportart 3,0 3,0 zeitliche Nutzbarkeit 3,0 1,0 Qualität der Sportfläche 4,5 4,0 Sauberkeit der Sportfläche 3,5 3,0 (Raum-) Atmosphäre 3,0 3,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 4,0 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 3,5 4,0 Zustand der Sportgeräte 3,5 2,0 Lichtverhältnisse / Beleuchtung 3,0 3,0 Luftqualität / Belüftung 4,0 3,0 Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 5,0 Sicherheit des Zugangs - 5,0 Parkmöglichkeit - 1,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - 4,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - 2,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 2,5 -
Sauberkeit des Umfelds 2,0 2,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 2,0 2,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 3,5 4,0
Anhang | 251
Sporthalle Cordula-Grundschule Stadt-, Ortsteil: Borken-Gemen
Anschrift: Röwekamp 25
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1964
Maße: B=13,90 m x L=28,01 m x H=5,50 m
Typ: Einfachsporthalle (Tribüne aus Brandschutzgründen z.Zt. nicht nutzbar)
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 13:30 Uhr (Di & Do bis 15 Uhr)
Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 100% / Winter 100%
Hausmeister: Herr Rohls (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Austausch Glasbausteine gegen Grillodurelemente - Erneuerung der Beleuchtung (mit Präsenzmeldern) in den Umkleiden - Erneuerung der Elektroverteilung
Geplante bauliche Maßnahmen: - Sanierung Sportboden - Dach inkl. Entwässerung - Notausgänge Schulhofseite - Betonpfeiler Süd- und Ostseite
Bemerkung
Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Fugen/Linien des Oberbelags lösen sich vereinzelt Lüftung sehr lau
Bewertung Begehung befriedigend (2,7)
Anhang | 252
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Cordula-Grundschule Schulenn=2
Vereinen=1
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 4,5 3,0 Zustand der Duschen 1,5 2,0 Zustand der Toiletten 2,5 3,0 Unterbringung der eigenen Sachen 4,5 4,0 Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 4,5 5,0 Eignung für den Schulsport / die Sportart 3,5 4,0 zeitliche Nutzbarkeit 3,0 3,0 Qualität der Sportfläche 3,5 4,0 Sauberkeit der Sportfläche 3,5 4,0 (Raum-) Atmosphäre 4,0 4,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 3,0 4,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 4,5 4,0 Zustand der Sportgeräte 3,0 4,0 Lichtverhältnisse / Beleuchtung 4,0 3,0 Luftqualität / Belüftung 4,0 3,0 Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 5,0 Sicherheit des Zugangs - 3,0 Parkmöglichkeit - 4,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - -
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - 4,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 2,0 4,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 1,5 2,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 4,0 4,0
Anhang | 253
Sporthalle Nünning Realschule Stadt-, Ortsteil: Borken-Gemen
Anschrift: Neumühlenallee 140
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1982
Maße: B=24,05 m x L=44,78 m x H=7,04 m
Typ: Dreifachsporthalle (mit Tribüne)
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Parkett
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 15:30 Uhr
Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 100% / Winter 100%
Hausmeister: Herr Kaß (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: keine Geplante bauliche Maßnahmen:
- Setzrisse Technikkellerraum und Außenfassade Ostseite - Verfugung Westseite - Deckenverkleidung Zugang Umkleidekabinen - Setzrisse an Fenster und Tür R-303 - Abkastung defekt, Zugang Halle - Holzabkantung zersetzt, Duschen - 3 Türrahmen loste, Abgang Halle - Setzrisse vor der Tür Lehrerkabinen - Fliesen loste in Kabine 1 und 4 - Riss im Beton, Kabine 1 Eingang - defekte Glasscheibe, Eingang 1, Ausgang Sportplatz 2 - lose Steine Treppenabgang, Ausgang zum Sportplatz - Spielanzeige abgängig - ELA-Anlage abgängig
Tribüne (298 Zuschauersitzplätze) Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel
Brandschutztechnische Mängel vorhanden Handballtore nicht „kippgesichert“ (01.12.2011) leichte Beschädigungen des Oberbelags Bodenaufbau um Stabhochsprungeinstichkasten defekt
Bewertung Begehung gut (2,0)
Anhang | 254
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Nünning Realschule Schulenn=2
Vereinen=2
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 2,5 1,5 Zustand der Duschen 2,0 1,5 Zustand der Toiletten 2,0 1,5 Unterbringung der eigenen Sachen 3,5 2,5 Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 2,5 2,0 Eignung für den Schulsport / die Sportart 1,5 3,0 zeitliche Nutzbarkeit 1,5 4,0 Qualität der Sportfläche 1,5 3,0 Sauberkeit der Sportfläche 2,0 2,0 (Raum-) Atmosphäre 2,0 2,5 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 2,0 1,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 1,5 2,0 Zustand der Sportgeräte 2,0 2,0 Lichtverhältnisse / Beleuchtung 1,5 2,0 Luftqualität / Belüftung 2,0 2,0 Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 2,5 Sicherheit des Zugangs - 2,0 Parkmöglichkeit - 2,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - 3,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - 1,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 1,5 2,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 2,5 2,5
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 2,0 2,5
Anhang | 255
Zentraleinrichtung Sonderschule (Bestehend aus Gymnastikhalle und Sporthalle) Stadt-, Ortsteil: Borken-Gemen
Anschrift: Mozartstraße 25
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1976
Maße: Gymnastikhalle: 10,10 m x 13,02 m x 3,20 mSporthalle: 15,64 m x 26,92 m x ca. 6,50 m
Typ: Gymnastikhalle und Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Gymnastikhalle: PVCSporthalle: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 14:00 Uhr
Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 98,2% / Winter 97,5%
Hausmeister: Herr Hadder (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Besonderheiten: -Mensa, Betreiber: Kreis Borken
Bemerkung Baulicher Zustand: Gebäude ist abgängig Bewertung Begehung mangelhaft (5,0)
Anhang | 256
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Zentraleinrichtung Sonderschule Schulenn=1
Vereinen=0
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 5,0 - Zustand der Duschen 4,5 - Zustand der Toiletten 4,5 - Unterbringung der eigenen Sachen 4,5 - Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 5,0 - Eignung für den Schulsport / die Sportart 3,0 - zeitliche Nutzbarkeit 3,0 - Qualität der Sportfläche 3,5 - Sauberkeit der Sportfläche 2,5 - (Raum-) Atmosphäre 3,0 - Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore) 2,0 -
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,0 - Zustand der Sportgeräte 2,0 - Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,5 - Luftqualität / Belüftung 4,0 - Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - - Sicherheit des Zugangs - - Parkmöglichkeit - - Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - -
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder - -
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß) 1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 1,5 - Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.) 1,5 -
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 4,0 -
Anhang | 257
Sporthalle Pröbsting Grundschule Stadt-, Ortsteil: Borken-Hoxfeld
Anschrift: Hoxfelder Esch 7
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1965
Maße: B=9,84 m x L= 14,86 m x H= 3,80 m
Typ: Gymnastikhalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 14:00 Uhr (Do & Fr bis 17:00) Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 93,6% / Winter 93,6%
Hausmeister: Frau Huvers (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Sanierung der Blitzschutzanlage - Einbau 2. Rettungsweg - Beleuchtung
Geplante bauliche Maßnahmen: - Erneuerung Schwingboden - Austausch der Glasbausteine - Beseitigung von Wärmebrücken
Bemerkung Baulicher Zustand: leichte Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Nur ein Umkleide-/Sanitärbereich vorhanden Halle ist eigentlich zu klein für Schulunterricht
Bewertung Begehung gut bis befriedigend (2,5)
Anhang | 258
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Pröbsting Grundschule Schulen
n=1 Vereine
n=0 Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 3,0 - Zustand der Duschen 4,0 - Zustand der Toiletten 4,0 - Unterbringung der eigenen Sachen 3,0 - Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 3,0 - Eignung für den Schulsport / die Sportart 3,0 - zeitliche Nutzbarkeit 1,0 - Qualität der Sportfläche 3,0 - Sauberkeit der Sportfläche 3,0 - (Raum-) Atmosphäre 3,0 - Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
3,0 -
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 3,0 - Zustand der Sportgeräte 2,0 - Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 - Luftqualität / Belüftung 2,0 - Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - - Sicherheit des Zugangs - - Parkmöglichkeit - - Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- -
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- -
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 2,0 - Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
2,0 -
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 2,0 -
Anhang | 259
Sporthalle Engelrading Grundschule Stadt-, Ortsteil: Borken-Marbeck
Anschrift: Schulstraße 1
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1976
Maße: B=12,00 m x L=24,00 m x H=5,39 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, Mo & Di 08:00 bis 13:15 Uhr; Mi 08:00 bis 14:00 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 93,9% / Winter 96,1%
Hausmeister: Herr Hölter (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Flachdacherneuerung Umkleidetrakt
Geplante bauliche Maßnahmen: - Erneuerung der Hallenfenster - Sanierung Dach - Sanierung Hallenboden - Austausch der Geräteraumtore
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Geräteraumtor (links): Klemmgefahr für Hände im oberen
Anschlag Bewertung Begehung gut (2,0)
Anhang | 260
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Engelrading Grundschule Schulen n=0
Vereinen=1
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume - 3,0
Zustand der Duschen - 3,0
Zustand der Toiletten - 3,0
Unterbringung der eigenen Sachen - 3,0
Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage - 3,0
Eignung für den Schulsport / die Sportart - 2,0
zeitliche Nutzbarkeit - 3,0
Qualität der Sportfläche - 2,0
Sauberkeit der Sportfläche - 2,0
(Raum-) Atmosphäre - 2,0Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
- 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) - 2,0
Zustand der Sportgeräte - 2,0
Lichtverhältnisse / Beleuchtung - 2,0
Luftqualität / Belüftung - 2,0
Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 4,0
Sicherheit des Zugangs - 2,0
Parkmöglichkeit - 2,0Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 3,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 2,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
- -
Sauberkeit des Umfelds - 2,0Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
- 3,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage - 2,0
Anhang | 261
Sporthalle Roncalli Grundschule Stadt-, Ortsteil: Borken-Weseke
Anschrift: Borkenwirther Str. 31
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1979
Maße: B=15,00 m x L=26,96 m x H=5,50 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 13:15 Uhr Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 89,3% / Winter 89,3%
Hausmeister:: Herr Rottstegge (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: - Dachsanierung
Geplante bauliche Maßnahmen: - Stilllegung von Wasserleitungen (stehendes Wasser) - Erneuerung Heizungsanlage - Sanierungsbedarf Sanitäreinrichtungen - Schwingbodensanierung
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Bodenaufbau: viele Dead-Spots (Boden federt nicht zurück -
Unterboden z.T. defekt), leichte Beschädigungen des Oberbelags
Bewertung Begehung befriedigend (2,7)
Anhang | 262
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Roncalli Grundschule Schulen
n=1 Vereine
n=1 Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 2,0 3,0
Zustand der Duschen 2,0 3,0
Zustand der Toiletten 2,0 4,0
Unterbringung der eigenen Sachen 2,0 3,0
Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 1,0 3,0
Eignung für den Schulsport / die Sportart 1,0 2,0
zeitliche Nutzbarkeit 1,0 4,0
Qualität der Sportfläche 1,0 3,0
Sauberkeit der Sportfläche 1,0 2,0
(Raum-) Atmosphäre 1,0 2,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
1,0 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 3,0 2,0
Zustand der Sportgeräte 1,0 2,0
Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 2,0
Luftqualität / Belüftung 2,0 3,0
Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 5,0
Sicherheit des Zugangs - 2,0
Parkmöglichkeit - 2,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- -
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 4,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 1,0 2,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
2,0 1,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 1,0 3,0
Anhang | 263
Sporthalle Maria-Sybilla-Merian Realschule Stadt-, Ortsteil: Borken-Weseke
Anschrift: Im Thomas 2-4
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1961
Maße: B=14,02 m x L=28,09 m x H=5,44 m
Typ: Einfachsporthalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Ja, 08:00 bis 15:15 Uhr (Mo bis 14:00 Uhr) Auslastungsfaktor: Schule & Verein: Sommer 86,4% / Winter 98,9%
Hausmeister: Herr Rottstegge (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren - Erneuerung Hallenboden
Geplante bauliche Maßnahmen: - Anbindung an die neue Heizungsanlage der Realschule - Prallschutzwand - Zwangsbelüftung Duschen - Dachsanierung Umkleidetrakt
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Schweißnähte des Oberbelags gehen z.T. auf (erst 2006
erneuert) Bewertung Begehung gut (1,7)
Anhang | 264
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Maria-Sybilla-Merian Realschule Schulen
n=0 Vereine
n=1
Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume - 3,0
Zustand der Duschen - 3,0
Zustand der Toiletten - 3,0
Unterbringung der eigenen Sachen - 2,0
Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage - -
Eignung für den Schulsport / die Sportart - 1,0
zeitliche Nutzbarkeit - 1,0
Qualität der Sportfläche - 2,0
Sauberkeit der Sportfläche - 1,0
(Raum-) Atmosphäre - 2,0Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
- 2,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) - 3,0
Zustand der Sportgeräte - 3,0
Lichtverhältnisse / Beleuchtung - 2,0
Luftqualität / Belüftung - 3,0
Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - 3,0
Sicherheit des Zugangs - 2,0
Parkmöglichkeit - 2,0Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 2,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 2,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
- -
Sauberkeit des Umfelds - 2,0Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
- 1,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage - 2,0
Anhang | 265
Gymnastikhalle Grütlohn Stadt-, Ortsteil: Borken-Grütlohn
Anschrift: Grütlohner Weg 82
Eigentümer Stadt Borken
Baujahr: 1965
Maße: B=9,21 m x L= 12,21 m x H= 4,07 m
Typ: Gymnastikhalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: PVC
Schulnutzung: Nein Zuständiger Mitarbeiter:
Georg Schroer (FB Gebäudewirtschaft)
Weitere Informationen zur Anlage:
Bauliche Maßnahmen in den letzten 5 Jahren: keine Geplante bauliche Maßnahmen:
- Schwingboden sanierungsbedürftig - Sanitäranlagen teils instandsetzungsbedürftig - Sanierungsbedarf Turnhallenfenster - Notausgangstür reparaturbedürftig - Feuchtigkeitsprobleme im Keller - Kellertür reparaturbedürftig - Haustechnische Installationen teils instandsetzungsbedürftig- Beleuchtung teilweise reparaturbedürftig - Abwasser-/Regenentwässerungsleitungen teilweise marode
Bemerkung Baulicher Zustand: mittlere Mängel Brandschutztechnische Mängel vorhanden Keine Geschlechtertrennung im Umkleide-/Sanitärbereich keine Duschen vorhanden
Bewertung Begehung ausreichend bis mangelhaft (4,5)Die Turnhalle Grütlohn ist aufgrund ihrer Nutzung, Größe, Zustand, Ausstattung eher als Versammlungsraum / Mehrzweckraum zu bezeichnen und nicht im klassischen Sinne als Sportstätte. Die Räumlichkeiten werden/wurden maximal 1x/pro Woche von der Polizei zum Tischtennisspielen genutzt und gelegentlich als Notausweichort einer F-Jugendmannschaft der TuS jetzt SG Borken.
Anhang | 266
Sporthalle Berufskolleg Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Josefstr. 10, Borken
Eigentümer Kreis Borken
Baujahr: 1975
Maße: 27x45x7m
Typ: Dreifachhalle
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Linoleum
Schulnutzung: ja
Weitere Informationen zur Anlage:
Sanierung Hallendecke im Jahr 2000 Erneuerung Sportboden im Jahr 2003
Bemerkung mittleres Tribühnenteil defekt => Boden wird beschädigt Vandalismusprobleme im Eingangsbereich
Bewertung Begehung gut (2,3)
Anhang | 267
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Berufskolleg Schulen
n=2 Vereine
n=1 Umkleiden/Sanitärbereich
Zustand der Umkleideräume 3,0 2,0
Zustand der Duschen 3,5 3,0
Zustand der Toiletten 4,0 3,0
Unterbringung der eigenen Sachen 4,0 3,0
Turnhalle/Sportplatz
baulicher Zustand der Anlage 2,5 2,0
Eignung für den Schulsport / die Sportart 2,0 3,0
zeitliche Nutzbarkeit 2,5 2,0
Qualität der Sportfläche 3,5 2,0
Sauberkeit der Sportfläche 3,0 2,0
(Raum-) Atmosphäre 3,5 2,0 Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
2,0 1,0
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,5 2,0
Zustand der Sportgeräte 2,5 2,0
Lichtverhältnisse / Beleuchtung 2,0 3,0
Luftqualität / Belüftung 3,5 3,0
Umfeld/Sonstiges
Zuschauerkapazität - 3,0
Sicherheit des Zugangs - 2,0
Parkmöglichkeit - 1,0 Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- 2,0
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- 2,0
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
2,0 -
Sauberkeit des Umfelds 3,0 2,0 Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
2,5 2,0
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 2,0 2,0
Anhang | 268
Sporthalle Schönstätter Marienschule Stadt-, Ortsteil: Borken
Anschrift: Jahnstr. 11, Borken
Eigentümer Schönstätter Marienschule
Baujahr: k.A.
Maße: 12x24x5m
Typ: Einfachsporthalle (Mehrzweckhalle)
Bodenaufbau: flächenelastisch
Oberbelag: Linoleum
Schulnutzung: ja
Weitere Informationen zur Anlage:
2003 – Erneuerung Sportboden 2009 – Sanierung Fensterfront
Bemerkung Mehrzwecknutzung (Sporthalle / Aula) nur eingeschränkt für Ballsportarten nutzbar Fahrbare BB-Körbe und Tore müssen aufgebaut werden
Bewertung Begehung gut (2,3)
Anhang | 269
Bewertungsskala von 1=„sehr zufrieden“ bis 5=„sehr unzufrieden“
Sporthalle Schönstätter Marienschule Schulen
n=1 Vereine
n=0 Umkleiden/Sanitärbereich Zustand der Umkleideräume 3,0 -
Zustand der Duschen 4,0 -
Zustand der Toiletten 4,0 -
Unterbringung der eigenen Sachen 2,0 -
Turnhalle/Sportplatz baulicher Zustand der Anlage 2,0 -
Eignung für den Schulsport / die Sportart 3,0 -
zeitliche Nutzbarkeit 2,0 -
Qualität der Sportfläche 2,0 -
Sauberkeit der Sportfläche 2,0 -
(Raum-) Atmosphäre 2,0 -
Ausstattung mit Großgeräten (z.B. Turngeräte, Tore)
2,0 -
Ausstattung mit Kleingeräten (z.B. Bälle) 2,0 -
Zustand der Sportgeräte 2,0 -
Lichtverhältnisse / Beleuchtung 1,0 -
Luftqualität / Belüftung 1,0 -
Umfeld/Sonstiges Zuschauerkapazität - -
Sicherheit des Zugangs - -
Parkmöglichkeit - -Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
- -
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
- -
Erreichbarkeit der Sportanlage vom Schulgelände aus (zu Fuß)
1,0 -
Sauberkeit des Umfelds 1,0 -
Erreichbarkeit eines Ansprechpartners (z.B. Platzwart, Hausmeister u.a.)
1,0 -
Gesamtzufriedenheit mit der Sportanlage 2,0 -
Anhang | 270
Städtische Sportplätze
Sportanlage Im Trier / SG Borken Stadt, Ortsteil: Borken
Anschrift: Feldmark 5, 46325 Borken
Schulnutzung: ja
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße Flutlicht
Hauptplatz Rasen 68x105m Ja Stadion Tenne 68x105m Ja Trainingsfläche „Rosendreieck“ Rasen 3200 m2 Ja Rasenplatz „Im Park“ Rasen 68x105m Ja Trainingsfläche Feldmark Rasen 6200 m2 (ca. 55x106m) Nein
Leichtathletikanlagen: 4x400m Bahn (Tenne) Hochsprunganlage Weitsprunganlage (2x) Kugelstoßanlage (3x)
Infrastruktur: Umkleidegebäude mit 4 Kabinen befindet sich in einem, desolaten Zustand; Auf dem Gelände befindet sich darüber hinaus der KK Schießstand des SchießSportVereins Borken
Anhang | 271
Sportanlage „Am Aquarius“ Stadt, Ortsteil: Borken
Anschrift: Feldmark 24, 46325 Borken
Schulnutzung: nein
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht
„Am Aquarius“ Tenne 68x105m
schlechter Zustand, uneben, Dränageprobleme
Ja
Trainingsplatz Rasen 1800m2 Ja
Leichtathletikanlagen: Die leichtathletische Anlagen (Rundlaufbahn, 2 Weitsprunganlagen) sind aufgrund des Zustands eigentlich nicht mehr nutzbar
Infrastruktur: 4 Umkleidekabinen in 2 Gebäuden
Anhang | 272
Platzanlage RC Borken-Hoxfeld Stadt, Ortsteil: Hoxfeld
Anschrift: Professor-Menzel-Straße, 46325 Borken
Schulnutzung: nein
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht Hauptplatz Rasen 68x105m Nein Tennenplatz Tenne 70x110m Ja
Trainingsplatz Rasen 60x88m Ja Trainingsplatz Rasen 53x90m Ja
Trainingsplatz / hinter Tennenplatz
Rasen 30x70m Nein
Leichtathletikanlagen: -
Infrastruktur: Neubau Umkleidegebäude geplant (2013)
Anhang | 273
Platzanlage FC Marbeck Stadt, Ortsteil: Marbeck
Anschrift: Nordholter Heide 12, 46325 Borken
Schulnutzung: ja / 3-4x pro Jahr
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht
Rasenspielfeld Rasen 68x108m Nein Tennenspielfeld Tenne 65x100m Ja Trainingsplatz Rasen
3000 m2 Ja
Trainingsplatz Rasen Ja
Leichtathletikanlagen: Weitsprunganlage
Infrastruktur: Umkleidegebäude mit 5 Kabinen (2006 errichtet) Weitere Informationen zur Anlage:
Training bis D-Jugend erfolgt im Winter in der Halle;
Anhang | 274
SV Adler Weseke Stadt, Ortsteil: Weseke
Anschrift: Prozessionsweg 34, 46325 Borken-Weseke
Schulnutzung: nein
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht Hauptplatz Rasen 68x105m Nein Tennenplatz Tenne 68x104m Ja
Trainingsplatz Rasen 8000 m2 Ja Leichtathletikanlagen: (Nutzung für Sportabzeichen)
Umlaufbahn ca. 380m (2-3 Bahnen) Weitsprunganlage
Infrastruktur: seit 2007 neues Vereinsheim mit 6 Kabinen 2 Beachvolleyballplätze
Weitere Informationen zur Anlage:
Kippsicherung fehlte an vielen mobilen Toren bei Begehung (10.01.2012)
Anhang | 275
Sportplatzanlage SV Burlo Stadt, Ortsteil: Burlo
Anschrift: Vennweg 5, 46325 Borken-Burlo
Eigentümer Pachtgelände vom Fürst Salm-Salm
Schulnutzung: ja
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht Hauptplatz Rasen 70x109m Nein
Trainingsplatz Rasen 7700 m2 Nein Tennenplatz Tenne 67x105m Ja
Bolzplatz Rasen 1500 m2 Nein
Leichtathletikanlagen: (am Tennenplatz)
6x100m Bahn Weitsprunganlage Kugelstoßanlage
Infrastruktur: Umkleidegebäude mit 4 Kabinen (3 Fußball und 1 für Gymnastikraum) sowie Gymnastikraum (8,3x7,5m) im 2009 neu errichtet (Rasenplätze)
Altes Vereinsheim mit 2 Umkleideräumen am Tennenplatz 3 Beachvolleyballfelder
Anhang | 276
Platzanlage SV Westfalia Gemen Stadt, Ortsteil: Gemen
Anschrift: Coesfelder Straße 17, 46325 Borken-Gemen
Schulnutzung: ja / Cordula-Schule (v.a. Bundesjugendspiele); Montessori-Schule (Fußball AG)
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht
Hauptplatz (Rasen 1) Rasen 68x105m Nein Rasen 2 Rasen 68x108m Ja
Tennenplatz Tenne 68x105m Ja Trainingsplatz Rasen 5000m2 Ja
Leichtathletikanlagen: 4x400m Bahn (Tenne) Weitsprunganlage
Infrastruktur: Umkleidegebäude mit 7 Kabinen, 6 Kabinen wurden 2011 grundsaniert
Weitere Informationen zur Anlage:
Volleyballanlage (1 Feld) Bei der Begehung fehlten an vielen mobilen Toren die
Kippsicherung (09.01.2012)
Anhang | 277
Sportanlage Nünning-Realschule Stadt, Ortsteil: Borken-Gemen
Anschrift: Neumühlenallee 140
Schulnutzung: ja
Spielfelder Bezeichnung Belag Maße (Breite x Länge) Flutlicht
Rasen 68x105m Nein
Leichtathletikanlagen: 4x400m Bahn (Tenne) 4x100m Bahn (Kunststoff) Hochsprunganlage (2x) Stabhochsprunganlage Weitsprunganlage Diskusanlage Kugelstoßanlage
Infrastruktur: Mitbenutzung der Umkleiden und Sanitäranlagen der angrenzenden Sporthalle
Anhang | 278
Sonstige Sportanlagen
Name Art der Anlage / Ausstattung
Eigentümer bzw. nutzende
Organisation Anschrift
Beachvolleyball Turnieranlage im Vennestadion Burlo 3 Felder SV Burlo
Vennweg 546325 Borken-Burlo
Beachvolleyballanlage am Gymnasium Remigianum 2 Felder RC Borken-Hoxfeld Josefstr. 6
46325 Borken
Beachvolleyballanlage SVA Weseke 2 Felder SV Adler Weseke
Prozessionsweg 34, 46325 Borken
Multi-Sport - Sport- und Gesundheitszentrum 1 Feld Multi Sport Borken
GmbH
Heinrich Hertz Str. 20 46325 Borken
Fitness, Gymnastik
Vital Sportstudio Fitnessstudio Vital Sportstudio Boumannstrasse 28 46325 Borken
Top Fit-Arena Fitnessstudio Top Fit-Arena Nina-Winkel-Str. 2 46325 Borken
Studio B Fitnessstudio Studio B Heinrich-Hertz-Str. 846325 Borken
Multi-Sport - Sport- und Gesundheitszentrum
Fitnessstudio Sporthalle (u.a. für 4
Badminton-Felder)
Multi Sport Borken GmbH
Heinrich Hertz Str. 20 46325 Borken
Qualifizierungszentrum KSB Borken
2 Gymnastikräume Kreissportbund Borken Hoher Weg 19 - 2146325 Borken
Flugsport
Flugplatz Borken-Hoxfeld Landebahn: 740 m x 30 m (Gras)
Luftsportverein Borken e.V. (Betreiber)
Zum Flugplatz 1946325 Borken-Hoxfeld
Modellflugplatz Borken Modellflugsportanlage Modellfluggruppe Borken e.V.
Heideweg 11, 46325 Borken
Fußball
STURM Hallenfußball Soccer Halle mit 3 Plätzen STURM Hallenfußball Hansestraße 21 a
46325 Borken Kampfsport
WingTsun-Schule Borken Kampfkunstschule WingTsun-Schule Borken
Raesfelder Straße 2846325 Borken
Anhang | 279
Name Art der Anlage / Ausstattung
Eigentümer bzw. nutzende
Organisation Anschrift
Reiten
Reitanlage ZRFV Borken
2 Reithallen: 30 x 60 m 20 x 40 m
Dressurplatz: 20 x 60 m
Springplatz: 60 x 60 m
Zucht-Reit- und Fahrverein Borken
Pröbstinger Allee 46308 Borken
Reitanlage Gestüt Forellenhof
Reithalle (70 x 32 m)
Gestüt Forellenhof Zum Homborn 9 46325 Borken
Reitanlage RSV Borken-Marbeck
Reithalle: 20 x 60 m
Außenreitplatz
Reitsportverein Borken-Marbeck
Beckenstrang 4 46325 Borken-Marbeck
Schießsport
LG Schießstand 10m SchießSportVerein Borken
Im Großen Esche 10 46325 Borken
KK Schießstand 25m und 50m SchießSportVerein Borken
Feldmark 15 46325 Borken
Schwimmen
Erlebnisbad Aquarius
u.a. Sportbecken (25m) Lehrschwimmbecken Freibad
Stadtwerke Borken Parkstraße 20 46325 Borken
Schwimmhalle Weseke Hallenbad (17,5m) Stadtwerke Borken Im Thomas 15, 46325 Borken
Johannesschule Kleinschwimmhalle
Lehrschwimmbecken (wird aufgrund von Baumängeln geschlossen)
Stadt Borken Mozartstraße 23, 46325 Borken
Badesee im Freizeitpark Pröbsting Naturbadesee Stadt Borken
Pröbstinger Busch, 46325 Borken
Squash
TV B.-Center 2 Courts TV Bocholt Parkstraße 1046325 Borken
Tanzsport
TAK - Tanz am Kino 1 Tanzfläche Tanzsportclub Borken Rot-Weiß
Johann-Walling-Straße 26, 46325 Borken
Stadtwerkehalle 1 Tanzfläche Tanzsportclub Borken Rot-Weiß
Ostlandstr., 46325 Borken
Anhang | 280
Name Art der Anlage / Ausstattung
Eigentümer bzw. nutzende
Organisation Anschrift
Tennis
Tennisanlage SG Borken 5 Plätze SG Borken Parkstraße 16 46325 Borken
Tennisanlage TC BW Borken
6 Plätze Tennishalle mit 3
Plätzen TC Blau-Weiß Borken Pröbstinger Allee 5,
46325 Borken
Tennisanlage SV Burlo 3 Plätze SV Burlo Vennweg 5, 46325 Borken
Tennisanlage SVW Gemen
8 Plätze Tennishalle mit 2
Plätzen Bouleanlage
SV Westfalia Gemen Mozartstraße 33 46325 Borken-Gemen
Tennisanlage FC Marbeck 4 Plätze FC Marbeck Beckenstrang 4 b46325 Borken-Marbeck
Tennisanlage SVA Weseke 6 Plätze SV Adler Weseke Prozessionsweg 3446325 Borken-Weseke
Anhang | 281
Mögliche Kriterien einer Bedarfsanalyse
Kategorie Fragen an geplante Maßnahmen
Auslastung bestehender Anlagen
Ist die bestehende Anlage, unter Berücksichtigung von Stoßzeiten und sonstigen Einschränkungen (z.B. Witterung), vollständig ausgelastet?
Fehlbedarf Liegt der Fehlbedarf in einer Größenordnung, welche die Maßnahme rechtfertigt?
Zukünftiger Bedarf Besteht der Bedarf langfristig (min. 10 Jahre)?
Wie groß ist das Einzugsgebiet?
Welche Bevölkerungsstruktur liegt vor? Bevölkerungsprognose?
Baulicher Zustand der vorhandenen Anlagen
Rechtfertigt der Zustand der vorhandenen Anlage einen Umbau/Neubau?
Schulnutzung Können Schulen den Standort mitbenutzen bzw. nutzen Schulen den Standort?
Alternativen/ Ausweichmöglichkeiten Besteht eine Alternative in zumutbarer Entfernung?
Umbau Kann der Umbau einer bestehenden Anlage statt eines Neubaus den Bedarf decken?
Anbieteranalyse Könnte der Bedarf durch einen anderen Anbieter gedeckt werden?
Standortsicherheit Eignet sich die Anlage für die Zusammenlegung zukünftiger Ressourcen?
Verkehrsanbindung / Erreichbarkeit
Wie gut ist die vorhandene Anlage mit verschiedenen Verkehrsmitteln zu erreichen?