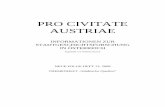SS EL FARO SS EL FARO Stability and Structures Stability ...
Ringvorlesung SS 2013: Radfahren in der Stadt
Transcript of Ringvorlesung SS 2013: Radfahren in der Stadt
RINGVORLESUNG SS 2013:
RADFAHREN IN DER STADT
BEITRÄGE ZU EINER ÖKOLOGISCH UND SOZIAL VERTRÄGLICHEN VERKEHRSPLANUNG
Institut für VerkehrswissenschaftenForschungsbereich für
Verkehrsplanung und VerkehrstechnikTechnische Universität Wien
Herausgeber
Heinrich J. ZukalTadej Brezina
Ausgewählte Vorträge
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Herausgeber: Institut für Verkehrswissenschaften
Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
Technische Universität Wien, A-1040 Wien
Redaktion: Univ. Lektor Heinrich J. Zukal, MAS MSc
Druck: Grafisches Zentrum HTU GmbH., A-1040 Wien
ISBN 978-3-9503375-2-5
Gedruckt auf BIOTOP 3
Die in den Arbeiten wiedergegebenen Abbildungen wurden von den Autoren zur Verfügung gestellt.
Seite 1
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Inhaltsverzeichnis
Radfahren in der Stadt – ein Vorwort ............................................................ 5 (Josef Michael Schopf)
1 Ringvorlesungen am IVV ................................................................................................ 7
2 Historisch gesehen eroberte das Fahrrad die Nähe ........................................................ 7
3 Radfahren als Gebot der Stunde .................................................................................... 8
4 Mehr Radverkehr – auch in Wien .................................................................................... 9
5 Eine Ringvorlesung auch für den Radverkehr ............................................................... 10
Radfahren und Recht: Status Quo und Verbesserungsbedarf ................. 13 (Johannes Pepelnik)
1 Geltungsbereich der StVO ............................................................................................ 15
2 Fahrradbegriff ............................................................................................................... 15
3 Erforderliche Ausstattung .............................................................................................. 15
4 Mehrspurige Fahrräder ................................................................................................. 16
5 Rennfahrräder............................................................................................................... 16
6 Begriffsabgrenzung ....................................................................................................... 16
7 Alkoholgrenze ‰ .......................................................................................................... 18
8 Aktuelle Veränderungen in der StVO ............................................................................ 18
9 Exkurs Shared Space ................................................................................................... 20
10 Besonderheiten / Ungleichheiten .................................................................................. 21
11 Nebeneinanderfahren in Verbänden ............................................................................. 21
12 Auswirkungen des Rechtssystems auf Radfahrer-/innen .............................................. 22
13 Verwaltungsübertretung / Strafe ................................................................................... 23
14 Schmerzensgeld – Beispiele ......................................................................................... 23
15 Reformbedarf der StVO ................................................................................................ 23
Gesund und fit oder verunfallt und verletzt – ein Balanceakt mit dem
Rad? ............................................................................................................... 25 (Sylvia Titze und Paul Pfaffenbichler)
1 Gesundheitswirksame Aspekte des Radfahrens ........................................................... 27
2 Kann die Gesundheit beim Radfahren durch die Schadstoffbelastung negativ
beeinflusst werden? ...................................................................................................... 31
3 Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit beim Radfahren durch einen Verkehrsunfall
verletzt oder getötet zu werden? ................................................................................... 33
4 Wie sieht die Bilanz der gesundheitlich positiven und negativen Effekte aus? .............. 34
5 Danksagung ................................................................................................................. 36
"Wenn Sie wollen, dass ich Rad fahre, dann müssen Sie ..." ................... 39 (Ralf Risser)
1 An wen wendet man sich hier? ..................................................................................... 41
2 Die Kunden ................................................................................................................... 41
3 Die Kunden verstehen .................................................................................................. 42
Seite 2
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
4 Wo man im System eingreift ......................................................................................... 42
5 Marketing ...................................................................................................................... 43
6 Fakten und Gefühle ....................................................................................................... 44
7 Das Nahverhältnis zu einem Produkt / zu einer Idee ..................................................... 44
8 Die Brauchbarkeit ist relevant........................................................................................ 45
9 Wer kann sich für das Radfahren einsetzen und wer muss das tun?............................. 45
10 Einige Ideen für Produkte / zu schaffende Voraussetzungen ........................................ 46
11 Kommunikation ............................................................................................................. 46
12 Anreize .......................................................................................................................... 47
13 Verteilung (Distribution) ................................................................................................. 47
14 Man muss seine Kunden kennen! ................................................................................. 47
15 Die Bedeutung eines ganzheitlichen (holistischen) Ansatzes ........................................ 48
16 Zum Schluss ................................................................................................................. 48
Urbane Radverkehrsplanung am Praxisbeispiel Esch-sur-
Alzette/Luxemburg ........................................................................................ 49 (Romain Molitor)
1 Die Ausgangslage ......................................................................................................... 51
2 Die Analyse des Radverkehrs ....................................................................................... 54
3 Prinzipielle Herangehensweise ..................................................................................... 54
4 Die Planung .................................................................................................................. 56
5 Die Öffentlichkeitsarbeit ................................................................................................ 58
6 Die Umsetzung ............................................................................................................. 60
Wiener Fahrradverkehr und Verkehrspolitik in historischer Sicht ........... 67 (Sandor Bekesi)
1 Periodisierung der städtischen Radverkehrsentwicklung ............................................... 69
2 Bestimmungsfaktoren der Verkehrsgenese ................................................................... 79
Bike Sharing Systeme ................................................................................... 89 (Hans-Erich Dechant)
1 Geschichte der öffentlichen Fahrradverleihsysteme ...................................................... 91
2 Die Erfindung des Bike-Sharing .................................................................................... 94
3 Ausbau und Vergrößerung ............................................................................................ 95
4 Verdichtung des Stationen-Netzwerkes ......................................................................... 95
5 Verteilung der Räder über die Stadt .............................................................................. 98
Garagen und Highways: Ein Best-of Parken und Fahren ........................ 101 (Tadej Brezina)
1 Parken ........................................................................................................................ 103
2 Fahren ........................................................................................................................ 109
3 Conclusio .................................................................................................................... 117
Die Vortragenden ......................................................................................... 121
Seite 4
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 5
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Radfahren in der Stadt – ein Vorwort
Josef Michael Schopf
Seite 6
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 7
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Radfahren in der Stadt – ein Vorwort Im Namen des Forschungsbereiches für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik (IVV) der TU
Wien darf ich mich herzlich für Ihr Interesse an der Ringvorlesung „Radfahren in der Stadt“
und am gleichnamigen Band der Institutsreihe bedanken, auch für das IVV besitzt der Rad-
verkehr hohe Priorität.
1 Ringvorlesungen am IVV
Der verantwortungsvolle Umgang mit Lebensgrundlagen bildet seit langem die Basis von Leh-
re und Forschung an unserem Forschungsbereich. Ringvorlesungen bieten die Möglichkeit, in
diesem Sinn auf spezielle Themen vertieft einzugehen und haben daher am IVV Tradition.
Erst 2012 startete die Ring-VO „Barrierefrei im öffentlichen Raum“, schon 2008 „Ethik und
Technik“. „Radfahren in der Stadt“ setzte 2013 diese Tradition fort. Wieder sollte es nicht nur
um die Technik, sondern um die Beziehung zwischen Verkehr, Mensch und Umwelt gehen.
Die Ringvorlesung soll konkret einen Überblick über die vielen Facetten von (sub-)urbanem
Radverkehr vermitteln sowie die (historische) Entwicklung und die heutige Bedeutung des
städtischen Radverkehrs als Transportmittel für die Freizeit und im sozialen Kontext darstel-
len.
2 Historisch gesehen eroberte das Fahrrad die Nähe
Bis hin zum Zeitalter der Industrialisierung bildete der Mensch als Fußgeher die Basis der
Mobilität und bei der Gestaltung seines Bewegungsraumes sowie der Strukturen. Die geringe
Geschwindigkeit des Fußgehers sorgte für ein organisches Wachstum der Siedlungen. Im 19.
Jahrhundert trat dann mit dem Fahrrad ein neues Verkehrsmittel auf den Plan, wobei um die
Wende zum 20. Jahrhundert durch die erschwinglichen Fahrradpreise eine wahre Fahrradbe-
geisterung ausbrach.
Abbildung 1: Auch beim Fahrrad gilt: besitzen ist nicht unbedingt notwendig, auch
„Bike-sharing“ ist möglich (Foto: Schopf).
Seite 8
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Im Gegensatz zum Auto öffnete das Fahrrad lediglich den lokalen Raum. Der Radfahrer konn-
te sich über die „Zugänglichkeit der Nähe“ erfreuen [1] und sich als Herr über die Heimat füh-
len. Die damit verbundene kleinteilige Mobilität hat die Fußgeherstrukturen nicht zerstört, je-
doch den lokalen Aktionsraum beträchtlich erweitert. Das Fahrrad machte dem Fußgeher
sozusagen „Beine“, ohne dessen ökologische Qualitäten zu schmälern. Radfahren ist damit
gesund, umweltfreundlich und optimal für den Innerortsverkehr geeignet. Das Rad spart als
einziges Verkehrsmittel Zeit und schädigt nicht die Siedlungsstrukturen.
3 Radfahren als Gebot der Stunde
Der Erfolg des Automobils und die damit einhergehende Massenmotorisierung in den vergan-
genen Jahrzehnten haben im Mobilitätsbereich zu einem tief greifenden Wertewandel bei der
Gestaltung der Straßenräume geführt. Allerdings teilen sich speziell in Städten viele Men-
schen den begrenzten Raum. Diesbezüglich sind die BürgerInnen in den letzten Jahren ihrem
Lebensraum gegenüber sensibler geworden und wollen die vielfältigen Umweltbelastungen
durch den Verkehr bis hin zu den Treibhausgasen nicht mehr einfach hinnehmen. Zusätzlich
bedeutet der motorisierte Straßenverkehr für die Kommunen gewaltige Kosten und massive
Probleme. Neben den Kommunen ist auch das bmvit (Bundesministerium für Verkehr, Innova-
tion und Technologie) bestrebt, den Anteil des Fuß- und Radverkehrs an der Verkehrsmittel-
wahl durch Verbesserung der Rahmenverbindungen für diese Verkehrsarten zu erhöhen. [2]
Abbildung 2: Das Fahrrad als Gebot der Stunde wirft seine Schatten voraus (Foto: Schopf).
Der Personenverkehr in Österreich ist durch kurze Wege gekennzeichnet. Etwa 50% aller
Wege sind kürzer als 5 km und damit prädestiniert für den Radverkehr. Aber auch bei der in-
telligenten Verknüpfung von Verkehrssystemen [3] hat der Radverkehr seine Chancen.
Seite 9
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 3: Radverkehr intermodal, hier gemeinsam mit dem öffentlichen Verkehr
(Foto: Schopf).
Dementsprechend bietet die österreichische Verkehrspolitik innovative Lösungen die Fahr-
radmobilität zu stärken, wie zum Beispiel mit dem Fahrradpaket. So gibt es erstmals in Öster-
reich die Möglichkeit, Fahrradstraßen oder Begegnungszonen zu implementieren.
4 Mehr Radverkehr – auch in Wien
Die Stadt Wien [4] erwartet durch „mehr Radverkehr mehr Lebensqualität in der Stadt“. Dem-
entsprechend möchte die Stadt Wien Radfahren noch attraktiver machen und den Radver-
kehrsanteil am gesamten Verkehrsaufkommen in Wien bis 2015 verdoppeln. Gelingen kann
dies, gemessen an ausländischen Beispielen, allerdings nur auf der Basis einer entsprechen-
den Infrastruktur und nicht auf Sparquerschnitten oder auf Kosten der Fußgeher.
Abbildung 4: Eine attraktive Infrastruktur bildet die Basis des Radverkehrs (Foto: Schopf).
Seite 10
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Wenn es um die Planung von Radwegenetzen und insgesamt um die Integration des nicht
motorisierten Verkehrs in den öffentlichen Raum geht, sind die österreichischen Gemeinden
gefordert. Sie sorgen im Zuge der lokalen Verkehrsplanung dafür, dass es ausreichende Ver-
kehrsflächen für Rad fahrende Personen gibt. Auch örtliche Entwicklungskonzepte müssen
die Interessen der Nichtmotorisierten berücksichtigen. Zusätzlich ist bei der Siedlungsplanung
einerseits und in der Folge bei der Straßenplanung andererseits schon in der Planungsphase
auf die spätere Befahrbarkeit des Erschließungsraumes durch den Radverkehr zu achten.
Einen wesentlichen Beitrag zur Förderung des Radverkehrs leisten weiters Radabstellanlagen
z.B. an Stationen des ÖV oder in Wohnhausanlagen. Die jeweiligen Bauordnungen der öster-
reichischen Bundesländer können hier – einige Bundesländer tun dies bereits – Bestimmun-
gen vorsehen, um die Gestaltung dieser Verkehrsflächen auf Privatgrund zu regeln.
Damit die Gestaltung der Radinfrastruktur verkehrssicher und technisch auf dem letzten Stand
ausgeführt ist, können die Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) bei der
Projektierung herangezogen werden. Für den Radverkehr ist dies die RVS 03.02.13 „Radver-
kehr“ (Februar 2014). Die RVS ist allerdings nur als Grundlage für eigenständige und mit
Sachkenntnis durchgeführte Planungen zu verstehen und anzuwenden, ein weitgreifendes
Verständnis für das Thema Radfahren erleichtert die Anwendung jedenfalls.
Abbildung 5: Radabstellmöglichkeiten sind ein wesentlicher Teil der Radinfrastruktur [5]
(Foto: Schopf).
5 Eine Ringvorlesung auch für den Radverkehr
Als das IVV vor 7 Jahren die erste Ringvorlesung plante, wussten wir nicht, mit welcher Nach-
frage wir rechnen konnten – wie groß sollte z.B. der Hörsaal sein? Auch bei „Radfahren in der
Stadt“ standen wir vor diesen Fragen. Immerhin fand 2013 die Velo-City Konferenz in Wien
statt und zusätzlich wurde das Jahr 2013 von der Stadt Wien als „Radjahr“ proklamiert. [6]
Zumindest bei Insidern sollten diese Umstände eine gute Basis sein und auch für die Stadt
Wien Rückenwind bezüglich Werbung für den Radverkehr mit sich bringen.
Seite 11
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Alle Ringvorlesungen werden für sämtliche Disziplinen der Technischen Universität Wien und
für sonstige InteressentInnen angeboten. Die Nachfrage für „Radfahren in der Stadt“ war in
der Folge überwältigend und in dieser Quantität nicht erwartet. Insgesamt haben 2013 etwa
300 TeilnehmerInnen die Lehrveranstaltung abgeschlossen. Jede Woche platzte der Hörsaal
aus allen Nähten – ein Beweis für die Qualität der Vorträge und das große Interesse der Stu-
dentinnen und Studenten.
In der Ringvorlesung konnten und können wir das Thema „Radverkehr“ aus vielerlei Blickwin-
keln durch führende Fachleute beleuchten und die verschiedensten Aspekte urbanen Radfah-
rens darstellen. Im Namen des Forschungsbereichs für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik
sowie der Organisatoren der Ringvorlesung möchte ich mich auf diesem Weg bei allen Vor-
tragenden für Ihre Mühe und die eindrucksvollen Vorträge herzlich bedanken.
In diesen Dank möchte ich ganz besonders Univ.-Ass. DI Tadej Brezina von unserem Institut
einschließen, der die Ringvorlesung zum Thema Radfahren ins Leben rief und zusätzlich für
die Organisation zuständig war und ist – auch für die Werbung. Er war damit sowohl letztes
Jahr wie auch heuer äußerst erfolgreich. Weiterer Dank gebührt Dr. Paul Pfaffenbichler, der
an der Konzeption und Organisation maßgeblich beteiligt war.
Ich denke, dass die BesucherInnen von „Radfahren in der Stadt“ ihr Kommen nicht bereut
haben und auch heuer nicht bereuen werden. In diesem Sinn wünsche ich eine ergiebige
Ringvorlesung auch für das Sommersemester 2014.
Wien, im April 2014 J.M. Schopf
Quellen
[1] Sachs, W. (1984); Die Liebe zum Automobil. Rowohlt Verlag. Reinbeck bei Hamburg.
[2] http://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/ziele.html
[3] http://www.bmvit.gv.at/verkehr/ohnemotor/position.html
[4] http://www.wien.gv.at/verkehr/radfahren/
[5] RVS 03.07.11 „Organisation und Anzahl der Stellplätze für den Individualverkehr
(Mai 2008)“
[6] http://www.fahrradwien.at/blog/2013/06/04/wien-wird-radhauptstadt/
Seite 12
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 13
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Radfahren und Recht: Status Quo und Verbesserungsbedarf
Johannes Pepelnik
Seite 14
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 15
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Radfahren und Recht: Status Quo und Ver-besserungsbedarf
1 Geltungsbereich der StVO
Die Straßenverkehrsordnung gilt für Straßen mit öffentlichem Verkehr. Für Straßen ohne öf-
fentlichen Verkehr gilt dieses Bundesgesetz insoweit, als andere Rechtsvorschriften oder die
Straßenerhalter/-innen nichts anderes bestimmen. Die Befugnisse der Behörden und Organe
der Straßenaufsicht erstrecken sich auf diese Straßen nicht.
2 Fahrradbegriff
Gem. § 2 Abs. 1 Z 22 StVO ist ein Fahrrad
a) ein Fahrzeug, das mit einer Vorrichtung zur Übertragung der menschlichen Kraft auf
die Antriebsräder ausgestattet ist;
b) ein Fahrzeug nach lit. a, das zusätzlich mit einem elektrischen Antrieb gemäß § 1
Abs. 2a KFG 1967 ausgestattet ist (Elektrofahrrad);
c) ein zweirädriges Fahrzeug, das unmittelbar durch menschliche Kraft angetrieben wird
(Roller); oder
d) ein elektrisch angetriebenes Fahrzeug, dessen Antrieb dem eines Elektrofahrrads im
Sinne des § 1 Abs. 2a KFG 1967 entspricht.
3 Erforderliche Ausstattung
(1) mit zwei voneinander unabhängig wirkenden Bremsvorrichtungen, mit denen auf trocke-
ner Fahrbahn eine mittlere Bremsverzögerung von 4 m/s2 bei einer Ausgangsgeschwin-
digkeit von 20 km/h erreicht wird;
(2) mit einer Vorrichtung zur Abgabe von akustischen Warnzeichen;
(3) mit einem hellleuchtenden, mit dem Fahrrad fest verbundenen Scheinwerfer, der die
Fahrbahn nach vorne mit weißem oder hellgelbem, ruhendem Licht mit einer Lichtstärke
von mindestens 100 cd beleuchtet;
(4) mit einem roten Rücklicht mit einer Lichtstärke von mindestens 1cd;
(5) mit einem weißen, nach vorne wirkenden Rückstrahler mit einer Lichteintrittsfläche von
mindestens 20 cm2; der Rückstrahler darf mit dem Scheinwerfer verbunden sein;
(6) mit einem roten, nach hinten wirkenden Rückstrahler mit einer Lichteintrittsfläche von
mindestens 20 cm2; der Rückstrahler darf mit dem Rücklicht verbunden sein;
(7) mit gelben Rückstrahlern an den Pedalen; diese können durch gleichwertige Einrichtun-
gen ersetzt werden;
(8) mit Reifen, deren Seitenwände ringförmig zusammenhängend weiß oder gelb rückstrah-
lend sind, oder an jedem Rad mit mindestens zwei nach beiden Seiten wirkenden gel-
ben Rückstrahlern mit einer Lichteintrittsfläche von mindestens 20 cm2 oder mit anderen
rückstrahlenden Einrichtungen, die in der Wirkung den zuvor genannten entsprechen;
(9) wenn das Fahrrad für den Transport mehrerer Personen bestimmt ist, für jede Person
mit einem eigenen Sitz, mit einer eigenen Haltevorrichtung und eigenen Pedalen oder
Abstützvorrichtungen.
Seite 16
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Bei bestimmungsgemäßer Verwendung von Fahrrädern abseits der Fahrbahn muss die
Bremsverzögerung – unbeschadet des Abs. 1 Z 1 – einen Wert erreichen, der einen sicheren
Gebrauch des Fahrrades gewährleistet. Sofern Scheinwerfer oder Rücklicht mit einem Dyna-
mo betrieben werden, gilt Abs. 1 Z 3 und Z 4 mit der Maßgabe, dass die dort genannte Wir-
kung ab einer Geschwindigkeit von 15 km/h erreicht werden muss. Bei Tageslicht und guter
Sicht dürfen Fahrräder ohne die in Abs. 1 Z 3 und 4 genannte Ausrüstung verwendet werden.
Bei Tageslicht und guter Sicht ist keine Lichtanlage mehr vorgeschrieben; F-VO § 1 Abs. 4.
D. h. man braucht weder Scheinwerfer noch Rücklicht, jedoch alle vorgeschriebenen Reflek-
toren! Der Handel ist jedoch verpflichtet, mit dem Verkauf eines jeden Fahrrades eine Lichtan-
lage mitzuliefern.
4 Mehrspurige Fahrräder
Es müssen jeweils zwei Rücklichter und Rückstrahler in gleicher Höhe so angebracht sein,
dass sie die seitliche Begrenzung des Fahrrades erkennen lassen;
(1) die Bremsen müssen auf alle Räder und innerhalb einer Achse gleichzeitig und gleich-
mäßig wirken;
(2) wenn das Fahrrad für den Transport mehrerer Personen bestimmt ist, muss abweichend
von § 1 Abs. 1 Z 9 F-VO für jede beförderte Person lediglich ein eigener Sitz vorhanden
sein.
5 Rennfahrräder
Als Rennfahrrad gilt ein Fahrrad mit folgenden technischen Merkmalen:
(1) Eigengewicht des fahrbereiten Fahrrades höchstens 12 kg;
(2) Rennlenker;
(3) äußerer Felgendurchmesser mindestens 630 mm und
(4) äußere Felgenbreite höchstens 23 mm.
Rennfahrräder dürfen ohne die in § 1 Abs. 1 Z 2 bis 8 genannte Ausrüstung in Verkehr ge-
bracht werden; bei Tageslicht und guter Sicht dürfen Rennfahrräder ohne diese Ausrüstung
verwendet werden.
6 Begriffsabgrenzung
6.1 Überholen
Überholen ist das Vorbeibewegen eines Fahrzeuges an einem auf derselben Fahrbahn in der
gleichen Richtung fahrenden Fahrzeug. Nicht als Überholen gelten das Vorbeibewegen an
einem auf einem Verzögerungs- oder Beschleunigungsstreifen fahrenden Fahrzeug oder an
auf Radfahrstreifen fahrenden Radfahrer/-innen. Hierbei handelt es sich vielmehr um Neben-
einanderfahren. Überholen darf man nur links – Ausnahme: Schienenfahrzeuge bei ausrei-
chendem Abstand und links eingeordnete Linksabbieger. Beim Überholen muss ein ausrei-
chender Abstand zu dem zu überholenden Fahrzeug eingehalten werden. Wie groß der
Seitenabstand zwischen dem Überholenden und dem Überholten sein muss, hängt von den
Umständen des Einzelfalles ab. Nach der Judikatur (2 Ob 25/87), ist bei normalen Sicht-, Wit-
terungs-, Straßen-, und Verkehrsverhältnissen beim Überholvorgang ein Seitenabstand von
Seite 17
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
einem Meter grundsätzlich ausreichend. Wird jedoch ein einspuriges Fahrzeug überholt, wird
mit hoher Geschwindigkeit überholt, oder liegt gar beides vor, dann ist ein größerer Seitenab-
stand einzuhalten, da das Überholen mit hoher Geschwindigkeit ein größeres Gefahrenpoten-
zial birgt und einspurige Fahrzeuge eine geringere Spurstabilität haben als mehrspurige Fahr-
zeuge und jederzeit ein Ausschwenken möglich ist.
6.2 Nebeneinanderfahren
Das Nebeneinanderfahren von Fahrzeugreihen, auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit,
auf Fahrbahnen mit mehr als einem Fahrstreifen für die betreffende Fahrtrichtung und das
Nebeneinanderfahren, auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit, im Sinne des § 7 Abs. 3a
StVO gelten ebenfalls nicht als Überholen.
6.3 Vorbeifahren
Vorbeifahren ist das Vorbeibewegen eines Fahrzeuges an einer sich auf der Fahrbahn befin-
denden, sich nicht fortbewegenden Person oder Sache. Vorbeifahren ist nur erlaubt, wenn
dadurch andere Straßenbenützer/-innen nicht gefährdet oder behindert werden. Vorbeigefah-
ren werden darf sowohl auf der rechten Seite als auch auf der linken Seite. Wie beim Überho-
len hängt der ausreichende Seitenabstand von den Umständen des Einzelfalles ab. Es kann
jedoch beim Vorbeifahren grundsätzlich ein geringerer Seitenabstand, als er beim Überholen
angemessen wäre, eingehalten werden. Auch hier ist wiederum beim Vorbeifahren an einspu-
rigen Fahrzeugen und beim Vorbeifahren mit hoher Geschwindigkeit ein größerer Seitenab-
stand einzuhalten.
6.4 Vorfahren
Vorfahren ist eine Sonderform des Vorbeifahrens. Müssen Fahrzeuge vor Kreuzungen, Stra-
ßenengen, schienengleichen Eisenbahnübergängen und dergleichen angehalten werden, so
dürfen die Lenker/-innen einspuriger, später ankommender Fahrzeuge nur dann neben oder
zwischen den bereits angehaltenen Fahrzeugen vorfahren, um sich mit ihren Fahrzeugen wei-
ter vorne aufzustellen, wenn für das Vorfahren ausreichend Platz vorhanden ist und die Len-
ker/-innen von Fahrzeugen, die ihre Absicht zum Einbiegen angezeigt haben, dadurch beim
Einbiegen nicht behindert werden. Als Radfahrer/-innen können Sie, wenn eine Situation vor-
liegt, die das Vorfahren gestattet (rote Ampel etc.) sowohl links als auch rechts an den Fahr-
zeugen vorfahren. Auch das Vorschlängeln (abwechselnd links, rechts, vor oder hinter Fahr-
zeugen vorfahren), dies aber nur mit Schrittgeschwindigkeit, ist erlaubt. Dem Gesetz ist im
Unterschied zum Überholen und zum Vorbeifahren keine Verpflichtung zur Einhaltung eines
Seitenabstands zu entnehmen. Dass kein Seitenabstand einzuhalten ist wird aber wohl nur
beim Vorschlängeln zutreffend sein, beim „normalen“ Vorfahren hat der OGH in einer Ent-
scheidung (2 Ob 262/05a) sehr wohl geprüft, ob das vorfahrende Mofa einen ausreichenden
Seitenabstand eingehalten hat und das in diesem Fall (hier wurden 45 cm bei einer Ge-
schwindigkeit von 20 km/h – 25 km/h eingehalten) bejaht. Zu Ihrer eigenen Sicherheit würde
ich stets zu einem Sicherheitsabstand anraten.
Achtung: Wenn Sie rechts an der Kolonne vorfahren und sich diese wieder in Bewegung
setzt, müssen Sie zwar nicht sofort anhalten, jedoch dürfen Sie nicht schneller fahren als die
Fahrzeuge der Kolonne, da Sie ansonsten unzulässiger Weise rechts überholen (2 Ob
262/05a) – 2:1 Verschulden zugunsten eines hiergegen verstoßenden Mofafahrers, der mit
einem plötzlich rechts zufahrenden KFZ zusammenstieß. Wenn Sie also rechts vorfahren,
Seite 18
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
achten Sie darauf, dass Sie nicht schneller fahren als die wieder losfahrenden Fahrzeuge
links neben Ihnen.
Fahren Sie links vor, so müssen Sie dies nicht beachten, da Sie dann ordnungsgemäß links
überholen könnten. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass Sie sich bei fließendem Verkehr so
weit rechts wie gefahrlos möglich ist, einzuordnen haben. Fließender Verkehr wird wohl nicht
vorliegen wenn sich bei einem Stau die Kolonne nur wenige Meter fortbewegt. Lockert sich
die Kolonne und besteht damit die Möglichkeit, dass die Fahrzeuge der Kolonne auf mehr als
wenigen Metern schneller fahren als Sie und Sie somit nicht überholen können, so werden Sie
sich wieder rechts einordnen müssen.
7 Alkoholgrenze ‰
Die Grenze liegt bei 0,8 ‰. Wird diese überschritten, erfolgt keine Unterscheidung mehr zwi-
schen Autofahrer/-innen und Radfahrer/-innen. Dies ist verfassungsrechtlich sehr bedenklich!
Verwaltungsstrafe;
0,8 ‰ – 1,6 ‰ = 800 – 4.400,- EUR;
über 1,6 ‰ und Verweigerung des Alkotests = bis zu 5.900,- EUR;
Lenkverbot;
Zwangsmaßnahmen;
Entzug der Lenkerberechtigung;
Sonstige Rechtsverluste.
8 Aktuelle Veränderungen in der StVO
8.1 Radwegbenützungspflicht
Abbildung 6, links: § 53/27 "Radweg ohne Benützungspflicht", rechts: § 53/29 „Ende eines Rad-
wegs ohne Benützungspflicht“; Quelle: http://www.wien.gv.at/verkehr/verkehrszeichen/.
In Einzelfällen wird die Aufhebung der Radwegbenützungspflicht erlaubt. Es wird nun der Be-
hörde ermöglicht, einzelne Radwege von der Benützungspflicht auszunehmen, wo es die Si-
cherheit und Flüssigkeit des Verkehrs erlauben und somit das Fahrbahnverbot für Radfahrer/-
innen aufzuheben. Die Radwege und Geh- und Radwege können von den Radfahrer/-innen
benützt werden, sie sind jedoch nicht verpflichtet.
Seite 19
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
8.2 Fahrradstraßen
Abbildung 7, links: § 53/26 "Fahrradstraße", rechts: § 53/29 „Ende einer Fahrradstraße“; Quelle:
http://www.wien.gv.at/verkehr/verkehrszeichen/.
Künftig dürfen Straßenerhalter/-innen eigene Fahrradstraßen schaffen. Fahrradstraßen sind
Straßen oder Straßenabschnitte, die Fußgänger/-innen und Radfahrer/-innen vorbehalten
sind. Autos sind hier nur ausnahmsweise – etwa für Zu- und Abfahren – erlaubt. Ob und wo
solche Fahrradstraßen tatsächlich geschaffen werden, obliegt den Städten und Gemeinden,
die die örtlichen Gegebenheiten am besten kennen.
8.3 Telefonieren
Am Fahrrad soll ein Handyverbot gelten, telefonieren mit Freisprecheinrichtung bleibt erlaubt.
Das Strafausmaß orientiert sich an den Strafen für Telefonieren im Auto ohne Freisprechanla-
ge (50 EUR).
8.4 Begegnungszonen
Abbildung 8, links: § 53/9e "Begegnungszone", rechts: § 53/9f "Ende einer Begegnungszone";
Quelle: http://www.wien.gv.at/verkehr/verkehrszeichen/.
Das sind Bereiche, die von Fahrzeugen und Fußgängern gleichberechtigt im Mischverkehr
genutzt werden können. Wichtig dabei ist: Vorrang haben grundsätzlich die schwächsten Ver-
kehrsteilnehmer/-innen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 20 km/h, nur im Ausnahmefall
und wenn keine Verkehrssicherheitsbedenken dagegen stehen, sind auch 30 km/h erlaubt.
Als Begegnungszone wird in dieser Novelle eine für die gemeinsame Nutzung durch Fahr-
zeuge und Fußgänger bestimmte und als solche gekennzeichnete Fahrbahn bezeichnet, die
eine Förderung des Radverkehrs und eine Gleichstellung der verschiedenen Verkehrsteil-
nehmer/-innen zum Ziel hat. Sowohl der Anfang als auch das Ende einer solchen Begeg-
nungszone wird durch Schilder gekennzeichnet. Fahrzeuge und Fußgänger/-innen dürfen
diese Zone benutzen, jedoch müssen sie in erhöhtem Ausmaß Rücksicht aufeinander neh-
Seite 20
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
men und jegliche mutwillige Behinderung und Gefährdung anderer Verkehrseilnehmer/-innen
unterlassen. Diesbezüglich werden gegenseitige Gefährdungs- und Behinderungsverbote
festgelegt. Dem Konzept liegt die Idee einer Begegnung der Verkehrsteilnehmer/-innen auf
einer gleichen, rechtlichen Ebene zugrunde. Somit soll sowohl für Fußgänger/-innen als auch
für Radfahrer/-innen ein attraktives Verkehrsumfeld geschaffen werden. Diese Begegnungs-
zone setzt einen außergewöhnlichen Grad der Interaktion und Aufmerksamkeit zwischen den
unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer/-innen voraus und fördert somit die gegenseitige Rück-
sichtnahme untereinander. In Begegnungszonen haben die Fahrzeuglenker/-innen von orts-
gebundenen Gegenständen oder Einrichtungen einen entsprechenden Abstand zu halten und
dürfen eine Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h nicht überschreiten. Ebenso dürfen Radfah-
rer/-innen von Kraftfahrzeugen nicht gefährdet werden. Aufgrund der Mischverkehrsfläche soll
das Halten nur an gekennzeichneten Stellen erlaubt sein. Dies deshalb, weil aufgrund des
erlaubten Durchzugsverkehrs und der höheren Geschwindigkeit einer Freihaltung des
Sichtraums höhere Bedeutung zukommt.
9 Exkurs Shared Space
Das „Shared Space Konzept“ versucht an die Verantwortung der einzelnen Verkehrsteilneh-
mer/-innen zu appellieren. Der Mangel von einer hohen Zahl an Verkehrszeichen soll die
Eigenverantwortlichkeit der Verkehrsteilnehmer/-innen stärken. Dennoch sei darauf hingewie-
sen, dass ein Straßenraum ohne Regeln jedenfalls im Spannungsverhältnis des Legalitäts-
prinzips und des Bestimmtheitsgebotes steht. Daher wird zumindest der Anfang und das Ende
eines solchen Raumes einer Verordnungskundmachung bedürfen, die die Verkehrsteilneh-
mer/-innen darauf hinweist, dass nunmehr eben ein derartiger Verkehrsbereich beginnt. Da
die Straßenverkehrsordnung grundsätzlich auf allen öffentlichen Verkehrsflächen gilt, muss
die Regelung innerhalb der Straßenverkehrsordnung angesiedelt sein. Insoweit ist die Dis-
kussion des Shared Space Konzepts im politischen Raum jedenfalls falsch, als es ein Regime
ohne Regeln sein soll. Ein derartiges Konzept wäre rechtlich nicht durchsetzbar. Auch die im
In- und Ausland tatsächlich umgesetzten Shared Space Konzepte sind nicht solche ohne Re-
geln. Das Konzept des Shared Space folgt somit im breiteren Rahmen dem bereits früher ge-
forderten Paradigma der Aufhebung der Radwegebenützungspflicht. Die Radwege, die ab-
seits der Straßen und somit visuell nicht sichtbar von Autofahrer/-innen geplant und errichtet
worden sind, haben zumindest in den Kreuzungsbereichen das Radfahren nicht sicherer ge-
macht. Radfahrer/-innen auf dem Radweg wiegen sich in der vermeintlichen Sicherheit, dass
sie am autozentristischen Verkehrsgeschehen nicht teilnehmen, während Autofahrer/-innen
auf die Straße fokussiert sind und im Wesentlichen andere Verkehrsteilnehmer/-innen wie
beispielsweise Radfahrer/-innen ausschließlich als Hindernis wahrnehmen. Diese wechselsei-
tigen Ausblendungen der anderen Verkehrsteilnehmer/-innen führen an Kreuzungsbereichen
zu Überraschungen. Wird der Radweg nunmehr auf die Straße verlagert, sehen sich die Ver-
kehrsteilnehmer/-innen, wenn auch nicht immer gerne, nehmen aber hier wechselseitig Rück-
sicht, da die absichtliche Körperverletzung bei der Verkehrsteilnahme glücklicherweise noch
untergeordnet ist. Die sich daraus resultierende Forderung der Aufhebung der Radewegebe-
nützungspflicht wurde in einigen europäischen Ländern bereits umgesetzt und wird nunmehr
in Österreich im Rahmen des Unterausschusses Radverkehr diskutiert und führte im Rahmen
der letzten StVO-Novelle zumindest zu einer wesentlichen Aufweichung der derzeitigen Be-
nützungspflicht. Wie bereits erwähnt, ermöglicht die mit März 2013 in Kraft tretende StVO-
Novelle, dass jede/r Straßenerhalter/-in oder zumindest die Gemeinden im eigenen Wirkungs-
bereich entscheiden können, inwieweit sie die Benützungspflicht aufheben wollen oder nicht.
Rechtlich zuständig für die Umsetzung eines Shared Space Projektes sind diejenigen Behör-
den und diejenigen Verordnungsgebietskörperschaften, die ursprünglich die Regeln für die
Seite 21
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
jeweiligen Verkehrsflächen aufgestellt haben. Dieselben Gebietskörperschaften könnten ein
Shared Space Konzept rechtlich umsetzen. In der Regel wird eine Verordnung samt Kundma-
chung zur Revision der derzeit geltenden Kundmachungen ausreichen. Insbesondere hinge-
wiesen sei auf die Verpflichtung derartige Verordnungen turnusmäßig sowieso auf ihre
Zweckmäßigkeit für die Flüssigkeit und Sicherheit des Verkehrs hin zu überprüfen.
Das in die Straßenverkehrsordnung neu aufgenommene Rücksichtsnahmegebot könnte eine
Leitschnur für die Regeln auf derartigen Shared Space Verkehrsflächen darstellen, allerdings
lassen sich auch mit dem bestehenden StVO Instrumentarium Shared Space Projekte umset-
zen, ja wäre es sogar die Pflicht der Straßenerhalter/-innen zu prüfen, ob derartige Projekte
nicht durch Verkehrsunfallzahlen indiziert wären.
Dennoch sollten bei der Umsetzung von Shared Space Projekten einerseits großflächige
Parkverbote, andererseits wenige aber deutliche Bodenmarkierungen bzw. bauliche Änderun-
gen die Verkehrsteilnehmer/-innen darauf hinweisen, dass hier erhöhte Vorsicht geboten ist.
In diesem Zusammenhang wird auch die Straßenerhaltungsbehörde von allfälligen Anpas-
sungsansprüchen freizustellen sein, wenn die Verkehrsteilnehmer/-innen hier allenfalls Un-
klarheiten zeigen. Grundsätzlich geht es im Shared Space Modell jedoch darum, dass die
öffentlichen Räume sich selbst erklären und durch die Absenz von Regelungen eine höhere
Sicherheit geschaffen wird.
10 Besonderheiten / Ungleichheiten
Personen die ihr Fahrrad schieben gelten als Fußgänger/-nnen.
Differenzierung im Bereich der Alkoholgrenze nur bis 0,8 ‰;
Parken / Halten bedarf einer Restgehsteigbreite von mind. 1,5 m.
Halten: 1.) bis 10 Min., dass nicht durch verkehrsübliche Umstände erforderlich wird und
2.) das Halten zum Zweck der Durchführung einer Ladetätigkeit.
Parken: wird die 10-minütige Frist überschritten, handelt es sich um Parken. Sowohl das Hal-
ten als auch das Parken von Fahrrädern und Fahrradrikschas ist in der Fußgänger-
zone verboten.
Banketthalten: Halte- und Parkverbote gem. § 24 StVO können sich ex lege nicht auf Ban-
kette, sondern lediglich auf Fahrbahnen oder zumindest Teile von Fahrbahnen be-
ziehen.
11 Nebeneinanderfahren in Verbänden
Rechtslage:
§ 29 Abs. 1 StVO: Geschlossene Züge von Straßenbenützer/-innen, insbesondere Kinder-
und Schülergruppen in Begleitung einer Aufsichtsperson, geschlossene Verbände des Bun-
desheeres oder des Sicherheitsdienstes (einschl. der dazugehörigen Fahrzeuge), Prozessio-
nen und Leichenzüge, dürfen nicht von Lenker/-innen von Einsatzfahrzeugen (§ 2 Abs. 1 Z
25) und wenn dies aus Gründen der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs dringend erfor-
derlich ist und keine andere Maßnahme ausreicht, von Organen der Straßenaufsicht unterbro-
chen oder in ihrer Fortbewegung behindert werden.
Seite 22
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Daraus folgt: Radfahrer/-innen sind Straßenbenützer/-innen, daher darf ein „geschlossener
Zug“ nicht unterbrochen werden. Aber: VwGH 91/02/0122 RS: „Der § 29 Abs. 1 StVO enthält
keine Ausnahme von der Bestimmung des § 68 Abs. 2 StVO, die das Nebeneinanderfahren
von Radfahrer/-innen (ausgenommen auf Radwegen und in Wohnstraßen) verbietet.
Geschlossene Züge von Fußgänger/-innen insbesondere geschlossene Verbände des Bun-
desheeres oder des Sicherheitsdienstes, Prozessionen, Leichenbegängnisse und sonstige
Umzüge haben die Fahrbahn zu benützen. Für geschlossene Kinder- und Schüler/
-innengruppen gilt dies jedoch nur dann, wenn Gehsteige, Gehwege, oder Straßenbankette
nicht vorhanden sind. Geschlossen Züge von Fußgänger/-innen dürfen über Brücken und
Stege nicht im Gleichschritt marschieren. Bei der Benützung der Fahrbahn durch solche Züge
gelten die Bestimmungen des II. Abschnittes sowie die Bestimmungen über die Bedeutung
der Arm- oder Lichtzeichen sinngemäß.
Die Rechtsprechung des VwGH zu den einzelnen Begriffen:
„Geschlossener Verband“, setzt voraus, dass sich die einzelnen Glieder in einem engen
Abstand zueinander befinden, wobei der Abstand je nach Fahrgeschwindigkeit und
Fahrzeugart verschieden sein kann.
„Geschlossene Züge von Fußgänger/-innen“ nur bei Zusammengehörigkeit, nicht bloß
bei dichtem Fußgänger/-innenverkehr.
„Geschlossen Kinder- und Schüler/-innengruppe“ sind bereits ab 3 Kinder gegeben.
Forderungen aus Radverkehrssicht:
Verbände-Bestimmung ausdrücklich auf Radfahrer/-innen erweitern!
Was ist ein Verband?
Anzahl der Radfahrer/-innen festlegen: Vorschlag ab 6 Personen – keine Maximalgröße
Erkennbarkeit des Verbandes;
Was gilt für den Verband?
Ausnahme von der Radwegbenützungspflicht;
kein Verbot des Nebeneinanderfahrens;
darf geschlossen auch z.B. über rote Ampel fahren (hängt von Größe ab);
muss den rechten Fahrstreifen verwenden;
muss als Verband gekennzeichnet sein.
12 Auswirkungen des Rechtssystems auf Radfahrer-/innen
Laut Aristoteles bedarf es der Epikie, also der Billigkeit. Aristoteles untersuchte die Epikie in
ihrer Verbindung zum Recht. Das Gesetz kann nicht alle Fälle voraussehen und deshalb kann
nicht alles durch das Gesetz erfasst werden. Hier könne das Recht bei mechanischer Anwen-
dung leicht unmenschlich und damit ungerecht werden. Das genaueste Recht könnte leicht
das ungerechteste Recht werden. Die Epikie passt das Recht an die Tatsachen an und nicht
umgekehrt. Milderungsgründe sind:
Unbescholtenheit;
ordentlicher Lebenswandel;
Seite 23
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
achtenswerte Beweggründe;
Schuldeinsicht;
Verschuldensausmaß;
Rechtsirrtum;
Wer sich selbst gestellt hat, obwohl er leicht hätte entfliehen können oder es wahr-
scheinlich war, dass er unentdeckt bleiben werde.
Wer eine Tat unter Umständen begangen hat, die einem Schuldausschließungs- oder
Rechtfertigungsgrund nahekommen.
13 Verwaltungsübertretung / Strafe
Verwaltungsübertretung Strafe
Alkoholgehalt von 0,8 mg/l oder mehr Von 800,- bis 4.400,- EUR
Verweigerung des Tests Bis zu 5.900,- EUR (bei Uneinbringlichkeit Arrest von 2 – 6 Wochen)
Verstoß gegen die StVO unter besonders gefähr-lichen Verhältnissen bzw. bes. Rücksichtslosigkeit geg. andere Straßen-benützer/-innen
Von 36,- bis 2.180,- EUR (bei Uneinbringlichkeit Arrest von 24 h – 6 Wo-chen)
Gefährdung oder Behinderung von Fußgänger/-innen oder Radfahrer/-innen die Schutzwegen bzw. Radfahrüberfahren benutzen
Von 72,- bis 2.180,- EUR (bei Uneinbringlichkeit Arrest von 24 h – 6 Wo-chen)
Lenken eines Fahrrades entgegen des Verbots gem. § 59 StVO
Von 36,- bis 2.180,- EUR (bei Uneinbringlichkeit Arrest von 24 h – 6 Wo-chen)
Alle Verstöße gegen die StVO und die Fahrrad-verordnung, die keiner anderen Strafe unterste-hen
Bis zu 726,- EUR (bei Uneinbringlichkeit Arrest bis 2 Wochen)
Unterlassene Hilfeleistung bei einem Verkehrs-unfall als Beteiligter
Von 36,- bis 2.180,- EUR (bei Uneinbringlichkeit Arrest von 24 h – 6 Wo-chen)
14 Schmerzensgeld – Beispiele
Rissquetschwunde am Kinn, Teilbeschädigungen von 2 Zähnen, Verstauchungen im Bereich des rechten Handgelenks des Armes sowie Hautabschürfungen
850,- EUR
Schulter ausgekugelt und das rechte Knie geprellt 945,- EUR
15 Reformbedarf der StVO
Vorrangregeln überarbeiten;
Radfahrüberfahrt überarbeiten;
RVS für verbindlich erklären;
Seite 24
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
kombinierte Schutzweg-Radfahrer/-innenüberfahrten einführen;
Radfahren gegen Einbahnen untersuchen;
Radwegbreite erhöhen:
Ampelschaltungsproblem;
Verbandbestimmung auf Radfahrer/-innen erweitern.
Weiterführende Links
StVO
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10011336
Fahrradverordnung
http://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001272
Argus
http://www.argus.or.at
Versicherungsverband
http://www.vvo.at
Seite 25
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Gesund und fit oder verunfallt und verletzt –
ein Balanceakt mit dem Rad?
SylviaTitze und Paul Pfaffenbichler
Seite 26
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 27
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Gesund und fit oder verunfallt und verletzt – ein Balanceakt mit dem Rad? Wer dem Radfahren gegenüber positiv eingestellt ist, findet viele gute Gründe, das Fahrrad zu
verwenden, um von A nach B zu gelangen: Radfahren ist umweltschonend, weil weder Treib-
hausgase noch Schadstoffe emittiert werden; es verursacht keinen Lärm; nimmt wenig Raum
ein, verursacht keinen Stau; kostet wenig und trägt dazu bei, aktive Bewegung ins Leben zu
bringen. Von vielen werden aber auch Argumente, die gegen das Radfahren sprechen, ange-
führt. Der Körper sei bei einem Unfall ungeschützt und die Verletzungen können daher sehr
schwer sein. Häufig wird auch argumentiert, dass die während des Radfahrens eingeatmete
schlechte Umgebungsluft gesundheitsschädigend sei. In diesem Beitrag wollen wir aus ge-
sundheitlicher Sicht auf das Für und Wider des Radfahrens eingehen. Im ersten Abschnitt
werden die gesundheitswirksamen Aspekte des Radfahrens beschrieben. Es wird dargestellt,
welchen Einfluss körperliche Aktivität auf die Gesundheit hat. Daran anschließend wird die
Bewegungsdosis des Alltagsradelns quantifiziert. Schließlich werden Studien, in welchen der
Zusammenhang zwischen Radfahren und Gesundheit explizit analysiert wurde, ausgewertet
und der Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung dargestellt. Im zweiten Abschnitt wer-
den gesundheitliche negative Auswirkungen durch die Schadstoffbelastung beim Radfahren
untersucht. Der dritte Abschnitt widmet sich dem Thema des Risikos, beim Radfahren durch
einen Verkehrsunfall verletzt oder getötet zu werden. Abschließend werden in Abschnitt 4 die
positiven und negativen Auswirkungen verschiedener Szenarien in Form gewonnener oder
verlorener Lebenszeit bilanziert.
1 Gesundheitswirksame Aspekte des Radfahrens
1.1 Wie hängen körperliche Aktivität und Gesundheit zusammen?
Im Jahr 2008 wurde vom „U.S. Department of Health and Human Services“ ein Bericht über
die Gesundheitswirksamkeit von Bewegung und Sport herausgegeben, der von einem Team
aus internationalen Forscherinnen und Forschern erstellt wurde [1]. In diesem Bericht wird
eindrücklich der positive Zusammenhang zwischen Bewegung und Gesundheit dokumentiert.
Um die in Tabelle 1 dargestellten Zusammenhänge zwischen Bewegung und Gesundheit be-
urteilen zu können, ist es notwendig, Begriffe abzugrenzen.
In Österreich werden die Begriffe „körperliche Aktivität/Bewegung“ und „Sport“ häufig syno-
nym verwendet. Wenn jemand z.B. die Empfehlung erhält, er/sie solle mehr Bewegung ma-
chen, wird häufig mit dem Wort „Bewegung“ Wettkampfsport oder zumindest leistungsorien-
tierter Sport assoziiert. Umgekehrt ist mit der Aussage, „machen Sie mehr Sport“ nicht unbe-
dingt Wettkampfsport gemeint, sondern mit dieser Empfehlung könnte gemeint sein, Wege zu
Fuß oder mit dem Rad zurückzulegen. In der englischen Sprache ist körperliche Aktivität
(physical activity) ein Sammelbegriff und „umfasst jede Form von Bewegung, die durch Kon-
traktion der Skelettmuskulatur verursacht wird und mit einem erhöhten Energieverbrauch ein-
hergeht“ [1: S. C-1]. In diesem Beitrag werden die Begriffe „Bewegung“ und „körperliche Akti-
vität“ synonym und im Sinne der obigen Definition verwendet.
Für die Entwicklung von Maßnahmen zur Förderung körperlicher Aktivität wird zum einen der
Kontext der Bewegung berücksichtigt: Bewegung in der Freizeit, Bewegung, um von A nach B
zu gelangen, Bewegung im und ums Haus und Bewegung bei der Arbeit. Zum anderen unter-
Seite 28
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
scheidet man in Public Health1 zwischen Bewegungen mit leichter, mittlerer und höherer In-
tensität. Mittlere Intensität bedeutet, dass die Atmung etwas beschleunigt ist, während der
Bewegung aber noch gesprochen werden kann. Radfahren als Verkehrsmittel wird üblicher-
weise mit mittlerer Intensität ausgeübt. Höhere Intensität bedeutet, dass man tief(er) atmen
muss und nur noch kurze Wortwechsel möglich sind. Skilanglaufen, mit dem Rad bergauf fah-
ren usw. werden häufig mit höherer Intensität durchgeführt. Personen, die sich regelmäßig
bewegen und die Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung erfüllen, erhöhen ihre
Lebensqualität und reduzieren ihr Risiko, chronisch zu erkranken (Tabelle 1).
Lebenserwartung Koronare Herzkrankheit
Kardiorespiratorische Fitness Bluthochdruck
Muskuläre Fitness Herzschlag
Gesunder BMI Diabetes Typ II
Knochengesundheit Dickdarmkrebs
Schlafqualität Brustkrebs
Depression Legende. Verbessert diesen Gesundheitsaspekt, Abnahme des Risikos für diese Krankheit.
Tabelle 1: Gesundheitseffekte von Bewegung bei Erwachsenen, in Anlehnung an: [2].
International und national gelten für gesunde Erwachsene (18 – 64 Jahre) folgende Bewe-
gungsempfehlungen:
„Erwachsene sollten jede Gelegenheit nützen, körperlich aktiv zu sein. Jede Be-
wegung ist besser als keine Bewegung, weil der Wechsel vom Zustand ‚körperlich
inaktiv‘ zum Zustand ‚etwas körperlich aktiv‘ ein wichtiger erster Schritt ist.
Um die Gesundheit zu fördern und aufrecht zu erhalten, …
sollten Erwachsene mindestens 150 Minuten (2 ½ Stunden) pro Woche Bewegung mit
mittlerer Intensität oder 75 Minuten (1 ¼ Stunden) pro Woche Bewegung mit höherer In-
tensität oder eine entsprechende Kombination aus Bewegung mit mittlerer und höherer
Intensität durchführen. Idealerweise sollte die Aktivität auf möglichst viele Tage der Wo-
che verteilt werden. Jede Einheit sollte mindestens 10 Minuten am Stück dauern.
sollten Erwachsene – für einen zusätzlichen und weiter reichenden gesundheitlichen
Nutzen – eine Erhöhung des Bewegungsumfanges auf 300 Minuten (5 Stunden) pro
Woche Bewegung mit mittlerer Intensität oder 150 Minuten (2 ½ Stunden) pro Woche
Bewegung mit höherer Intensität oder eine entsprechende Kombination aus Bewegung
mit mittlerer und höherer Intensität anstreben.
sollten Erwachsene an zwei oder mehr Tagen der Woche muskelkräftigende Bewegung
mit mittlerer oder höherer Intensität durchführen, bei denen alle großen Muskelgruppen
beansprucht werden“2 [3: S. 30].
1 Das Ziel der Public Health Forschung ist, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln und zu implementie-
ren, um Gesundheit in der Bevölkerung zu fördern bzw. zu erhalten und um Erkrankungen vorzubeugen.
2 Als generelle Sicherheitsempfehlung gilt, dass Männer und Frauen ab 35 Jahren sowie Personen mit
chronischen Erkrankungen oder Übergewicht, die in der Vergangenheit keine Bewegung mit höherer In-
tensität durchgeführt haben und nun damit beginnen möchten, vor Trainingsbeginn mit einem Arzt oder
Seite 29
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Wenn Radfahrerinnen und Radfahrer zusammenzählen, wie viele Minuten sie mit dieser Be-
wegungsform pro Woche verbringen, so werden sie erkennen, dass damit bereits ein guter
Teil der Bewegungsempfehlungen erfüllt wird. Wenn jemand beispielsweise fünf Mal in der
Woche 10 Minuten zur Schule, Universität, Arbeit oder zu Geschäften fährt und 10 Minuten für
den Rückweg benötigt, dann bewegte sie/er sich bereits 100 Minuten mit mittlerer Intensität
pro Woche. Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, dass die bewegungsaktive Mobilität eine aus-
gezeichnete zeitschonende Maßnahme ist, um regelmäßig mit zumindest mittlerer Intensität
körperlich aktiv zu sein.
1.2 Dauer und Umfang der körperlichen Aktivität beim Alltagsradfahren
Bevor auf jene Studien eingegangen wird, in denen die Wirkung des Radfahrens auf die Ge-
sundheit explizit untersucht wurde, wird kurz das Radfahren selbst thematisiert. In der Stadt
Graz wurde im Jahr 2005 eine repräsentative Stichprobe von 1.000 Bewohnerinnen und Be-
wohnern im Alter zwischen 15 und 60 Jahren zu ihrem Mobilitätsverhalten interviewt. [4] Bei
der Telefonbefragung wurde den Teilnehmerinnen und Teilnehmern folgende Frage gestellt:
„Wenn Sie an die Wege denken, die Sie regelmäßig in der Stadt Graz zurücklegen, welchen
Ort haben Sie während der letzten 7 Tage von zu Hause aus am häufigsten aufgesucht? Ge-
meint sind nur Orte, die zumindest 300 m bzw. 5 Gehminuten von zu Hause entfernt sind“. Bei
der Beantwortung der Frage: „Welches Verkehrsmittel haben Sie hierfür hauptsächlich ver-
wendet“ nannten rund ein Viertel der Interviewten das Fahrrad.
Gesamt (N = 69) Frauen (n = 39) Männer (n = 30)
M SD M SD M SD
Distanz [km] 3,1 2,4 2,9 2,0 3,4 2,4
Fahrzeit [Min] 10,8 7,2 10,5 6,8 11,1 7,7
Geschwindigkeit [km/h] 17,1 4,0 15,9 3,6 18,6 3,9
Herzfrequenz [Schläge/Minute] 121 35 131 15 109 48
Legende: M=Mittelwert, SD=Standardabweichung3
Tabelle 2: Merkmale der gefahrenen Radstrecken (N = 69), in Anlehnung an [5: S. 83].
Bei einer Substichprobe (N = 69) wurden die Distanz, die Dauer der Fahrt, die Geschwindig-
keit und die Herzfrequenz während der Fahrradfahrt gemessen. Von den 69 Personen waren
32 (46 %) Männer und 37 (54 %) Frauen. Das durchschnittliche Alter betrug 39 Jahre (SD =
13 Jahre). Tabelle 2 zeigt die gemessenen Daten.
Vergleicht man die vor der Fahrt erfragte Länge der Strecke und die dafür benötigte Zeit, mit
der objektiv gemessenen Distanz und Zeit, zeigt sich ein sehr starker Zusammenhang zwi-
einer Ärztin für Allgemeinmedizin bzw. mit einem Sportmediziner oder einer Sportmedizinerin ein Abklä-
rungsgespräch führen sollten. [3: S. 33]
3 Die Standardabweichung (SD) ist ein Maß der Streuung. Wenn man vom Mittelwert die SD sowohl ad-
diert als auch subtrahiert erhält man einen Bereich um den Mittelwert, in dem sich rund 68% der Fälle
befinden.
Seite 30
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
schen diesen beiden Informationen (r 0,93). Das bedeutet, dass Radfahrerinnen und Rad-
fahrer bei häufig gefahrenen Strecken gut Auskunft über die Distanz und die benötigte Fahr-
zeit geben können. Für zukünftige Befragungen ist dieses Ergebnis von Bedeutung, weil man
davon ausgehen kann, dass die Distanz- und Zeitinformationen über häufig mit dem Rad zu-
rückgelegte Wege von den Radfahrerinnen und Radfahrern korrekt berichtet werden.
1.3 Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen Radfahren und Gesundheit
In einem systematischen Übersichtsartikel, für den in sieben Literaturdatenbanken bis zum
Jahr 2010 nach Artikeln gesucht wurde, fanden Oja et al. [6] 16 Artikel mit Originaldaten über
den Zusammenhang zwischen Radfahren und Gesundheit.
Zusammengefasst zeigen die Ergebnisse von Querschnitts- und Längsschnittstudien einen
positiven Zusammenhang zwischen Radfahren und der Herzkreislauffitness Jugendlicher. Aus
den Ergebnissen der Längsschnittstudien lässt sich ablesen, dass Radfahren das Risiko re-
duziert, vorzeitig zu sterben, an Krebs zu erkranken oder an Krebs zu sterben. Die Ergebnisse
der Interventionsstudien werden detaillierter beschrieben, weil sie auch als Anregung für ähn-
liche Interventionen genützt werden können.
In der Interventionsstudie – eine randomisierte kontrollierte Studie – von Oja et al. (1991)4
wurde der Effekt von bewegungsaktiver Mobilität (Zufußgehen und Radfahren) auf die Herz-
kreislauffitness und auf das Blutfettprofil untersucht. Die Studienteilnehmerinnen und -
teilnehmer waren gesunde Frauen (n = 30) und Männer (n = 38), die bisher den Weg zur Ar-
beit mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegten, die sich in der Freizeit
nicht öfter als zweimal pro Woche bewegten und deren Distanz zur Arbeit für das Rad bzw.
das Zufußgehen geeignet war. Die Intervention dauerte 10 Wochen, die durchschnittliche Dis-
tanz des Hinweges betrug 10 km, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer radelten mit 62 % bis
65 % ihrer maximalen Sauerstoffaufnahme (was bei Personen mit einem mittleren Fitnessni-
veau „Bewegung mit höheren Intensität“ entspricht) und taten dies an durchschnittlich 3,8 Ta-
gen pro Woche. Mit dieser Intervention konnte die aerobe Leistungsfähigkeit der Radfahrerin-
nen und Radfahrer um 7 % verbessert und im Vergleich zur Kontrollgruppe das „high intensity
lipoprotein“ (HDL) statistisch signifikant erhöht werden5.
Eine ähnliche Interventionsstudie wurde in den Niederlanden von Hendriksen et al. (2000)6
durchgeführt. An dieser randomisierten Studie nahmen 35 Frauen und 87 Männer teil, die
während 6 Monaten gebeten wurden die Strecke zur Arbeit mit dem Rad zurückzulegen. Die
durchschnittliche Distanz einer Strecke betrug 8,5 km und die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer radelten durchschnittlich dreimal pro Woche mit 60 % ihrer maximalen Sauerstoffaufnah-
me (was bei Personen mit einem mittleren Fitnessniveau „Bewegung mit mittlerer Intensität“
entspricht). Nach der Intervention war die maximale Sauerstoffaufnahme (ein sehr guter Indi-
kator für die aerobe Fitness) bei den Frauen und Männern um 6 % höher.
4 Zitiert nach [6].
5 HDL wird eine schützende Funktion gegen Gefäßwandveränderungen wie Verdickung, Verhärtung oder
Elastizitätsverlust, was zu einer Verengung des Gefäßquerschnittes (Arteriosklerose) führt, nachgesagt
[7].
6 Zitiert nach [6].
Seite 31
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
In Belgien wurde eine ein Jahr dauernde Interventionsstudie mit 65 Erwachsenen mittleren
Alters durchgeführt. Die TeilnehmerInnen radelten im Durchschnitt 2,5 Tage pro Woche mit
mittlerer Intensität und die durchschnittliche Distanz einer Strecke betrug 7 km. Bei den Rad-
fahrerInnen gab es keine statistisch signifikante Veränderung der maximalen Sauerstoffauf-
nahme nach einem Jahr. Eine Vermutung ist, dass bei dieser Intervention der Bewegungsum-
fang für eine Fitnessverbesserung zu gering war.
1.4 Gibt es einen Zusammenhang zwischen Dosis und Wirkung?
Für die Propagierung des Radfahrens zur Förderung der Gesundheit kann es hilfreich sein,
über die Dosis-Wirkungs-Beziehung zwischen Radfahren und Gesundheit zu informieren.
Hendriksen et al. (1999)7 konnten mit Hilfe Ihrer Ergebnisse berechnen, wie viel Erwachsene
mit einem niedrigen Fitnessniveau radeln müssen, um einen Fitnessgewinn zu erzielen. Als
minimale Dosis bei Personen mit einer niedrigen Ausgangsleistung dürfte regelmäßiges Rad-
fahren mit mittlerer Intensität, mit Distanzen von zumindest 6 km pro Tag an zumindest 3 Ta-
gen der Woche zu einer Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit führen.
Die Ergebnisse der Shanghai Women’s Health Study [8] und eine andere chinesische Studie
über das Radfahren und Dickdarmkrebs [9] zeigen, dass das Risiko für die Gesamtsterblich-
keit und Krebssterblichkeit mit ansteigender Radfahrdosis kontinuierlich abnimmt. Auch das
Risiko an Darmkrebs zu erkranken, sank mit ansteigender Radfahrdosis [10: S. 16].
Was die funktionellen und gesundheitlichen Verbesserungen anbelangt, gibt es in Bezug auf
das Geschlecht und Lebensalter keine Unterschiede.
2 Kann die Gesundheit beim Radfahren durch die Schadstoff-belastung negativ beeinflusst werden?
Schadstoffe in der Atemluft rufen gesundheitlich negative Auswirkungen hervor. Vor allem die
Belastung mit Feinstaub, Stickoxiden und Ozon wird dafür verantwortlich gemacht. Erhöhte
Feinstaubkonzentrationen („Particulate Matter“) erhöhen das Risiko von Atemwegserkrankun-
gen, Lungenkrebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Neben der Toxizität der im Feinstaub
enthaltenen Partikel hängt das Ausmaß der gesundheitlichen Auswirkungen von der Größe
der Partikel ab. Sehr kleine Teilchen gelangen beim Einatmen bis in die Lungenbläschen und
können vom Körper von dort nur sehr langsam oder gar nicht mehr entfernt werden. Staub ist
ein komplexes und heterogenes Gemisch. Staub setzt sich sowohl aus festen als auch aus
flüssigen Teilchen unterschiedlicher Größe und Toxizität zusammen. Die Staubbelastung wird
im Allgemeinen nach dem Massenanteil der verschiedenen Größenfraktionen unterteilt. Die
als PM10 und PM2,5 bezeichneten Staubfraktionen enthalten 50 % Teilchen mit einem Durch-
messer von 10 µm bzw. 2,5 µm und einen jeweils höheren Anteil kleinerer Teilchen und einen
kleineren Anteil größerer Teilchen8. Im deutschen Sprachraum hat es sich eingebürgert, die
Fraktionen PM10 und PM2,5 als Feinstaub zu bezeichnen. Im Rahmen des vom Verkehrssi-
cherheitsfonds des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie und dem
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft geförderten
Projekts „BikeRisk - Risiken des Radfahrens im Alltag“ wurde die PM2,5-Belastung als für das
Radfahren repräsentative Schadstoffbelastung untersucht [11]. Als erster Schritt wurde dazu
7 Zitiert nach [6].
8 Quelle: http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/luft/luftschadstoffe/staub/, Zugriff: 21.11.2013
Seite 32
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
unter der Leitung des österreichischen Umweltbundesamtes eine Literaturstudie zum Thema
Schadstoffbelastung im Verkehr durchgeführt [12]. Darauf aufbauend wurden mit einem vom
Umweltbundesamt angeschafften mobilen Feinstaubmessgerät die PM2,5-Konzentrationen
auf realen Wegen mit den Verkehrsmitteln Fahrrad, öffentlicher Verkehr, Moped und Pkw ge-
messen. Für innerstädtische Fahrten mit dem Fahrrad wurde dabei eine mittlere PM2,5-Kon-
zentration von 31,3 μg/m³ bei einer in Wien im Jahr 2010 durchschnittlichen Hintergrundbelas-
tung von 22 μg/m³ gemessen. Die in Wien gemessenen Werte liegen innerhalb der in der
Literatur gefundenen Bandbreite von Messergebnissen aus anderen Städten von 28–72 μg/m³
(siehe Abbildung 9).
37 38
49
7881
28
34
45
72
29
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
London, UK (2001)
London, UK (2005)
11 Niederländische
Städte (2009)
Arnhem, NL (2010)
Wien, AT (2011)
Ge
me
sse
ne
PM
2.5
-Ko
nze
ntr
atio
n a
us
vers
chie
de
ne
n S
tud
ien
(µ
g/m
³)
Pkw Fahrrad
Abbildung 9: Vergleich von beim Radfahren gemessenen PM2,5-Konzentrationen; Quellen:
[11, 13 – 17].
In der im Projekt BikeRisk durchgeführten Auswertung wurden sowohl Vergleiche zwischen
den Verkehrsmitteln als auch zwischen verkehrsberuhigten und stark belasteten Routen
durchgeführt. Aufgrund der geringen Zahl der Messungen im öffentlichen Verkehr und in Pkws
ist ein direkter Vergleich allerdings nur eingeschränkt aussagekräftig. Die durchgeführten
Messungen zeigen aber, dass die PM2,5-Konzentrationen auf verkehrsberuhigten Routen
statistisch signifikant niedriger sind als auf stark befahrenen Routen. Die gemessenen Unter-
schiede in der PM2,5-Konzentration bewegen sich dabei im Bereich von rund -10 % bis zu
rund -30 %. Mit Hilfe gemessener Daten über die Herzfrequenz und Daten aus der Literatur
wurde auf den Atmungsumfang und die eingeatmete PM2,5-Dosis rückgeschlossen. Die ein-
geatmete Dosis beim Radfahren beträgt je nach Szenario zwischen 3,2 μg/km und 6,7 μg/km.
Bei einer Pkw-Fahrt beträgt die eingeatmete PM2,5-Dosis je nach Szenario zwischen
0,5 μg/km und 0,8 μg/km.
Seite 33
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
3 Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit beim Radfahren durch einen Verkehrsunfall verletzt oder getötet zu werden?
Unter der Leitung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit wurde eine detaillierte Analyse des
Unfallgeschehens in Österreich durchgeführt [18]. Neben den Daten über die polizeilich ge-
meldeten Unfälle mit Personenschaden aus der Verkehrsunfallstatistik wurden auch die Daten
aus der Injury Database (IDB Austria) in die Analyse mit einbezogen. Es wurde damit ver-
sucht, die Größenordnung der vermuteten hohen Dunkelziffer vor allem bei Fahrradalleinun-
fällen zu bestimmen. Ein besonderes Augenmerk bei der Analyse galt weiters den Themen
Helmtragen und Alkoholunfälle. Mit Hilfe der aus hochgerechneten Daten der Mobilitätsbefra-
gungen ermittelten Fahrleistungen wurde eine Risikoanalyse durchgeführt, d.h. es wurden die
Verunglückten- und Getötetenraten bzw. die Verunglückten- und Getötetenzeitraten für ver-
schiedene Verkehrsmittel und Altersgruppen berechnet (siehe Tabelle 3 und Tabelle 4).
Alter 6-14
Jahre
15-24
Jahre
25-34
Jahre
35-49
Jahre
50-64
Jahre
65 und
älter
Gesamt
Fußgeher 1,005 4,847 1,449 2.028 2,207 7,260 3,308
Radfahrer 0,782 2,679 1,192 1,450 3,069 8,752 2,848
MIV-Lenker n.a. 2,702 0,718 0.610 0,654 1,503 0,908
MIV-Mitfahrer 0.280 1,298 1,308 0,456 0,426 0,707 0,681
ÖV-Fahrgast n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,007
Total 0,181 0,842 0,598 0,467 0,524 1,641 0,661
Tabelle 3: Getötetenrate nach Verkehrsbeteiligung und Altersklassen pro 100 Mio. Kilometer
Verkehrsaufwand (Durchschnitt 2005 – 2009); Quelle: [18].
Alter 6-14
Jahre
15-24
Jahre
25-34
Jahre
35-49
Jahre
50-64
Jahre
65 und
älter
Gesamt
Fußgeher 0,42 2,73 0,59 0,95 0,98 2,86 1,44
Radfahrer 0,81 3,88 1,63 2,03 3,39 8,26 3,38
MIV-Lenker n.a. 11,63 3,22 2,49 2,62 4,45 3,65
MIV-Mitfahrer 0,91 6,24 5,51 2,08 1,79 2,46 2,75
ÖV-Fahrgast n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. n.v. 0,02
Total 0,32 2,74 1,92 1,56 1,60 3,09 1,91
Tabelle 4: Getötetenzeitrate nach Verkehrsbeteiligung und Altersklassen pro 10 Mio. Stunden
Verkehrsbeteiligungsdauer (Durchschnitt 2005 – 2009); Quelle: [18].
Eine Literaturstudie und die Auswertung vorhandener Daten haben weiters gezeigt, dass stei-
gende Radnutzung zu einer Senkung des Unfallrisikos für Radfahrer führt („Safety by Num-
bers“). Die Förderung des Radfahrens im Alltag führt also zumindest längerfristig zu einer Re-
duktion des Unfallrisikos (siehe Abbildung 10).
Seite 34
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 10: „Safety by numbers“ – Zusammenhang zwischen der Entwicklung der zurückge-
legten Fahrradkilometer je Einwohner und Tag und der Verunglücktenrate in Wien 2002 - 2008;
Quellen: [19], www.kfv.at/unfallstatistik/, Bevölkerungsstatistik, eigene Darstellung.
4 Wie sieht die Bilanz der gesundheitlich positiven und negati-ven Effekte aus?
Die Arbeiten des Projekts BikeRisk wurden in enger Abstimmung und Kooperation mit dem
vom Fonds Gesundes Österreich geförderten Projekt „Gesundheitlicher Nutzen des Radfah-
rens als Transportmittel“ durchgeführt [11]. Da im Projekt BikeRisk die gesundheitlich positi-
ven Effekte des Radfahrens nicht untersucht wurden, wurde für die abschließende Bilanzie-
rung der gesundheitlich positiven und negativen Effekte des Radfahrens auf die Ergebnisse
dieser Studie zurückgegriffen. Die Bilanzierung erfolgte mit Hilfe der Berechnung der gewon-
nenen bzw. verlorenen Lebenszeit. Zur Berechnung der verlorenen bzw. gewonnenen Le-
benszeit (siehe Formel 1) wird eine gekürzte Sterbetafel verwendet.
Formel 1: Verlorene bzw. gewonnene Lebenszeit; nach [20].
Legende: ΔL(x)...Gewonnene bzw. verlorene Lebenszeit im Altersintervall x bis x+n (d);
q(x) ...Sterbewahrscheinlichkeit im Altersintervall x bis x+n; RR(x)...Relatives Risiko im Alters-
intervall x bis x+n; e(x)...Fernere Lebenserwartung im Altersintervall x bis x+n.
Für eine Änderung des Verkehrsverhaltens der ausgewählten Altersgruppen wurde das relati-
ve Risiko durch die aus der Verhaltensänderung resultierenden Veränderung der Schadstoff-
belastung, des Unfallrisikos und der körperlichen Fitness berechnet. Die Berechnung des rela-
tiven Risikos der Schadstoffbelastung basiert auf der ermittelten bzw. berechneten Tages-
dosis der Schadstoffkomponente PM2,5. Die Auswirkungen auf das relative Risiko durch
Verkehrsunfälle in den verschiedenen Altersgruppen werden aus den Gesamtmortalitätsraten
und den Mortalitätsraten durch Verkehrsunfälle berechnet. Als Basis zur Bestimmung der ge-
Seite 35
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
sundheitlich positiven Effekte des Radfahrens wurden die sogenannten MET-Stunden ge-
wählt9. MET-Stunden sind ein Konzept, mit dem der Energieverbrauch durch körperliche Akti-
vitäten quantifiziert werden kann. Aus der Dosis in Form von MET-Stunden können Hazard
Ratios10 abgeleitet werden, welche als eine Näherung für das relative Risiko verwendet wer-
den können. Insgesamt wurden zehn verschiedene Szenarien eines Umstiegs vom Pkw-
Fahren auf Fahrradfahren untersucht.
Nr.
En
tfern
un
g [
km
/d]
Ind
ivid
uell/-
Ko
llekti
v a
)
Sch
ad
sto
ffko
n-
zen
trati
on
b)
To
xiz
ität
c)
Sch
ad
sto
ffb
ela
s-
tun
g [
Mo
nate
]
Un
fälle
[W
och
en
]
Ph
ysis
ch
e F
itn
ess
[Mo
nate
]
Gesam
t [M
on
ate
]
1a 7,5 km/d Individuell hoch 5-fach -3,2 -1 12,2 8,7
1b 7,5 km/d Kollektiv hoch 5-fach -3,2 -0,7 12,2 8,8
1c 7,5 km/d Individuell niedrig 5-fach -2,5 -1 12,2 9,4
1d 7,5 km/d Individuell hoch 1-fach -0,6 -1 12,2 11,3
1e 7,5 km/d Kollektiv niedrig 1-fach -0,5 -0,7 12,2 11,5
2a 15 km/d Individuell hoch 5-fach -6,6 -2,1 12,5 5,3
2b 15 km/d Kollektiv hoch 5-fach -6,6 -1,3 12,5 5,5
2c 15 km/d Individuell niedrig 5-fach -5,1 -2,1 12,5 6,8
2d 15 km/d Individuell hoch 1-fach -1,2 -2,1 12,5 10,7
2e 15 km/d Kollektiv niedrig 1-fach -1 -1,3 12,5 11,1
a) Individuell = Änderung des Verhaltens eines einzelnen Verkehrsteilnehmers, Fahrrad-km pro Person und Tag bleiben gleich,
kein „Safety by Numbers“-Effekt, Unfallraten bleiben gleich; Kollektiv = Änderung des Verhaltens des gesamten Kollektivs, Fahr-
rad-km pro Person und Tag erhöhen sich entsprechend den Annahmen, „Safety by Numbers“-Effekt reduziert die Unfallraten.
b) hoch = die Fahrradfahrer nutzen das allgemeine Straßennetz, das Verhältnis der PM2,5-Konzentration Fahrrad zu Pkw beträgt
0,87; niedrig = die Fahrradfahrer nutzen vorwiegend das verkehrsberuhigte Straßennetz, das Verhältnis der PM2,5-Konzentration
Fahrrad zu Pkw beträgt 0,74 (der Effekt von Umwegen ist darin schon berücksichtigt).
c) 1-fach = PM2,5 im Verkehrsraum hat gleiche Toxizität wie PM2,5 der Hintergrundbelastung; 5-fach = PM2,5 im Verkehrsraum
hat die fünffache Toxizität wie PM2,5 der Hintergrundbelastung.
Tabelle 5: Zusammenfassung der Ergebnisse der Berechnung der gewonnenen und verlorenen
Lebenszeit nach Szenario
Neben der täglich zurückgelegten Entfernung wurden dabei Annahmen über die Entwicklung
der Unfallraten, die gewählten Routen und die Toxizität der Schadstoffbelastung im Verkehrs-
raum im Vergleich zur Hintergrundbelastung variiert. Tabelle 5 gibt einen Überblick über die
Ergebnisse der Berechnung der gewonnenen und verlorenen Lebenszeit. Je nach Szenario
verkürzt die Schadstoffbelastung die Lebenszeit um einen halben Monat bis zu knapp sieben
Monaten. Durch Unfälle verkürzt sich die Lebenszeit je nach Szenario um 0,7 bis 2,1 Wochen.
9 „Das metabolische Äquivalent (MET) beschreibt den Energieumsatz als ein Vielfaches des Ruheumsat-
zes (= 1 MET). Für Zufußgehen ins Büro werden durchschnittlich 3,5 METs veranschlagt, für Radfahren
ins Büro bereits 6 METs; z. B. ergeben fünfmal pro Woche 30 Minuten Radfahren ins Büro und wieder
zurück pro Tag 6 MET-Stunden (6 MET x 1 Stunde) und pro Woche 30 METStunden (6 MET x 1 Stunde
x 5)“ [10: S. 22].
10 Hazard Ratios sind ein „Effektmaß für Überlebensdaten, das die Überlebensraten von zwei Gruppen,
(z. B. körperlich aktive versus körperlich inaktive Personen) miteinander vergleicht“ [10: S. 21].
Seite 36
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Dem steht je nach Szenario eine gewonnene Lebenszeit von 12,2 bis 12,5 Monaten gegen-
über. Generell können die Ergebnisse wie folgt zusammengefasst werden: Die positiven Ef-
fekte der durch das Radfahren verbesserten körperlichen Fitness wiegen für eine durch-
schnittliche Person unter fast allen denkbaren Umständen die Risiken durch eine erhöhte
Schadstoffbelastung und ein erhöhtes Unfallrisiko auf. Die Förderung des Radfahrens im All-
tag ist daher nicht nur aus verkehrsplanerischer, sondern auch aus gesundheitspolitischer
Sicht zu empfehlen. Nichtsdestotrotz existiert ein signifikantes Potential zur Senkung des be-
stehenden Risikos des Radfahrens. Wie die durchgeführten Feinstaubmessungen gezeigt
haben, liegt die Belastung in verkehrsberuhigten Straßen signifikant unter jener in stark befah-
renen Straßen. Umwege können den Effekt der niedrigeren Schadstoffkonzentration durch die
längere Exposition aber wieder ausgleichen oder sogar umkehren. Es muss daher die Aufga-
be der Verkehrsplanung sein, möglichst viele verkehrsberuhigte, direkte Radverbindungen
ohne Zwang zu Umwegen zur Verfügung zu stellen.
5 Danksagung
Unser Dank gilt jenen Stellen und Organisationen, welche die diesem Beitrag zugrunde lie-
genden Projekte ermöglicht haben. Es sind dies der Fonds Gesundes Österreich für das Pro-
jekt „Das Rad als Transportmittel – Gesundheitlicher Nutzen und Einflussfaktoren“ und der
Österreichische Verkehrssicherheitsfonds des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation
und Technologie und das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft für das Projekt „BikeRisk - Risiken des Radfahrens im Alltag“.
Quellen
[1] Physical Activity Guidelines Advisory Committee, Physical Activity Guidelines Advisory
Committee Report, 2008, Washington, DC: U.S. Department of health and Human Ser-
vices, 600. (www.health.gov/paguidelines. Zugriff am 26. August 2013).
[2] Bundesamt für Sport BASPO, Bundesamt für Gesundheit BAG, Gesundheitsförderung
Schweiz, Netzwerk Gesundheit und Bewegung Schweiz, Gesundheitswirksame Bewe-
gung, 2009, Magglingen: BASPO.
[3] Titze, S., Ring-Dimitriou, S., Schober, P.H., Halbwachs, C., Samitz, G., Miko, H.C., Ler-
cher, P., Stein, K.V., Gäbler, C., Bauer, R., Gollner, E., Windhaber, J., Bachl, N., Dorner,
T.E. und Arbeitsgruppe Körperliche Aktivität/Bewegung/Sport der Österreichischen Ge-
sellschaft für Public Health (2012). Bundesministerium für Gesundheit, Gesundheit Ös-
terreich GmbH, Geschäftsbereich Fonds Gesundes Österreich (Hrsg.). Österreichische
Empfehlungen für gesundheitswirksame Bewegung. Wien: Eigenverlag.
http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/wissen/bewegungsempfehlungen/
2012-10-17.1163525626. Zugriff am 11.9.2013.
[4] Titze, S., Stronegger, W. J., and Oja P.; Rad-freundliche Stadt x 2. Längsschnittstudie in
der Stadt Graz, 2010, Graz: Eigenverlag.
[5] Muralter, R.; Validitätsstudie zur Erfassung des Radfahrverhaltens der Grazerinnen und
Grazer (objektive vs. subjektive Messung), (2007), Unveröffentlichte Diplomarbeit, Uni-
versität Graz, Graz.
Seite 37
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
[6] Oja, P., Titze, S., Bauman, A., de Geus, B., Krenn, P., Reger-Nash, B., and Kohlberger,
T.; Health benefits of cycling; a systematic review. Scandinavian Journal of Medicine &
Science in Sports, (2011), 21: p. 496-509.
[7] De Marées, H., Sportphysiologie, 2003, Köln: Sport & Buch Strauss.
[8] Matthews, C. E., Jurj, A. L., Shu, X. O., Li, H. L., Yang, G., Li, Q., et al.; Influence of ex-
ercise, walking, cycling, and overall nonexercise physical activity on mortality in Chinese
women. American Journal of Epidemiology, 2007, 165: p. 1343-1350.
[9] Hou, L., Ji, B-T., Blair, A., Dai, Q., Gao, Y-T., and Chow, W-H., Commuting physical ac-
tivity and risk of colon cancer in Shanghai, China. American Journal of Epidemiology,
2004,160, 860-867.
[10] Oja, P., Titze, S., Kohlberger, T. and Samitz, G., Das Rad als Transportmittel - gesund-
heitlicher Nutzen und Einflussfaktoren, 2011, Wien: Geschäftsbereich Fonds gesundes
Österreich, 53. (http://www.fgoe.org/presse-publikationen/downloads/wissen/radfahren-
gesundheitlicher-nutzen-und-einflussfaktoren/2012-02-23.7625592503. Zugriff am
9.9.2013)
[11] Pfaffenbichler, P., Unterpertinger, F., Lechner, H., Simader, G. and Bannert, M.; Bike-
Risk - Risiken des Radfahrens im Alltag, Forschungsarbeiten des Österreichischen Ver-
kehrssicherheitsfonds, Band 3, Österreichischer Verkehrsicherheitsfonds, (2011), Bun-
desministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, Wien.
[12] Ibesich, N.; "Projekt Risiken des Radfahrens im Alltag (BikeRisk), Arbeitspaket: Risiken
durch Schadstoffe - Endbericht." KfV Sicherheit Service GmbH, Bereich Präventionsbe-
ratung, Im Auftrag des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft und des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie,
(2011), Wien.
[13] Adams, H. S., Nieuwenhuijsen, M. J., Colvile, R. N., McMullen, M. A. S. and Khandelwal,
P.; Fine particle (PM2.5) personal exposure levels in transport microenvironments, 2001,
London, UK: Science of the Total Evironment, (279) 29-44.
[14] Boogard, H., Borgman, F., Kamminga, J. and Hoek, G.; Exposure to ultrafine and fine
particles and noise during cycling and driving in 11 Dutch cities, Atmospheric Environ-
ment, 2009, 43: p. 4234-4242.
[15] Zuurbier, M., Hoek, G., Oldenewening, M., Lenters, V., Meliefste, K., van den Hazel, P.
and Brunekreef, B.; Commuters' exposure to particulate matter air pollution is affected
by mode of transport, fuel type and route, Environmental Health Perspectives, 2010,
(118): p. 783-789.
[16] de Hartog, J. J., Boogard, H., Nijland, H. and Hoek, G.; Do the health Benefits of Cycling
Outweigh the Risks?, Environmental Health Perspectives, 2010, 118 (8): p. 1109-1116.
[17] Kaur, S., Nieuwenhuijsen, M. J. and Colvile, R. N.; Pedestrian exposure to air pollution
along a major road in Central London, UK, Atmospheric Environment, (2005), 39 (38): p.
7307-7320.
[18] Hildebrandt, B., Mayer, E., and Schweninger, M.; "Projekt Risiken des Radfahrens im
Alltag (BikeRisk), Arbeitspaket: Risiken durch Verkehrsunfälle - Endbericht." KfV Sicher-
heit Service GmbH, Bereich Präventionsberatung, Im Auftrag des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministeri-
ums für Verkehr, Innovation und Technologie, 2011, Wien.
Seite 38
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
[19] BMVIT; "Radverkehr in Zahlen.", 2010, Bundesministerium für Verkehr, Innovation und
Technologie, Wien;
www.bmvit.gv.at/service/publikationen/verkehr/strasse/downloads/ riz.pdf.
[20] Hanika, A., und H. Trimmel (2005): Sterbetafel 2002/2002 für Österreich. Statistische
Nachrichten, 60(2), S. 121-131.
Seite 39
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
"Wenn Sie wollen, dass ich Rad fahre, dann müssen Sie ..."
Ralf Risser
Seite 40
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 41
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
"Wenn Sie wollen, dass ich Rad fahre, dann müssen Sie ..." Dieses Papier befasst sich mit den Fragen, welche Zielgruppen im Rahmen einer Förderung
des Radfahrens angesprochen werden sollen, von wem und wie. Unterschiedliche Modelle
werden besprochen, die darstellen, wie Kommunikation mit den Zielgruppen strukturiert wer-
den soll ("Marketing"), aus welchen Bereichen man sich Argumente holt ("Diamant"), wie man
die unterschiedliche Nähe zum Radfahren bzw. den Bewusstseinsstand der Zielgruppen be-
rücksichtigt ("Transtheoretisches Modell") und wie wichtig in der Kommunikation mit Zielgrup-
pen die Beziehungsebene ist (nach Paul Watzlawick). Ein zentrales Anliegen bei allen Bemü-
hungen gegenüber den Zielgruppen ist, diese so gut wie möglich kennen zu lernen, um ihre
Bedürfnisse, Wünsche und auch Abneigungen und Barrieren zu erkennen und zu verstehen.
Die Erhebung dieser Aspekte hat professionell zu erfolgen und nur auf einer soliden Verste-
hensbasis wird eine Förderung des Radfahrens, die diesen Namen verdient, möglich sein,
1 An wen wendet man sich hier?
"Wenn Sie wollen, dass ich Rad fahre, dann müssen Sie was tun!" Aber was muss jemand,
der an der Förderung des Radfahrens interessiert ist, und der/die Möglichkeiten der Einfluss-
nahme hat, tun? Wer hat denn diese Möglichkeiten überhaupt? Und für wen muss was getan
werden? Zusammengefasst: wer muss was tun, für wen und was genau? Die Gruppe, die im
"für wen" steckt, das sind alle, wir alle, unterteilt in Radler und in "Andere". "Andere" sind jene,
die (noch-) nicht Rad fahren.
2 Die Kunden
Diese beiden Gruppen sind zunächst die „Kunden“: Radler sind die Kunden, die man schon
hat und (Noch-)Nicht-Radler sind die potentiellen Kunden. Aus der Sicht des Kaufmanns be-
trachten wir die Radfahrer als die Kunden, die man behalten möchte; und wir verstehen wei-
ters, dass Kaufleute solche Leute, die noch nicht bei ihnen "einkaufen", als Kunden gewinnen
möchten.
Was haben wir also? Leute die schon radeln, also solche, die schon Kunden sind und Leute,
die (noch) nicht radeln, und die wir gerne als Kunden gewinnen möchten, oder genauer: Sie
möchte die Gesellschaft als „Kunden“ gewinnen, weil das im Sinne der Nachhaltigkeit gesell-
schaftlich wünschenswert ist.
Bei dieser Betrachtungsweise sind Kunden, die man schon hat zu "pflegen"; man will sie ers-
tens nicht verlieren und man will sie zweitens auch nicht verärgern. Ersteres ist klar, zweiteres
ist ebenfalls relevant: Verärgerte Kunden können Schwierigkeiten bereiten. Wenn sie z.B.
Kunden bleiben möchten, trotz widriger Umstände, dann werden sie sich beklagen, andere
aufstacheln, den Respekt vor dem Anbieter verlieren und – wie in unserem Fall bekannt – die
Regeln des Anbieters missachten. Aber verärgerte Kunden kann man schließlich eben auch
verlieren, und wenn sie im Zorn "abspringen", dann kann das dazu führen, dass sie auf Dauer
und vehement negative Stimmung machen.
Radfahrer als "Kunden" verliert man also, wenn sie über eine gewisse Zeit hinweg mit dem
Angebot unzufrieden sind. In Abhängigkeit vom Grad ihrer Unzufriedenheit können sie dazu
beitragen, dass man auch noch andere Kunden verliert: Eben wenn jede/r "Abgesprungene"
Seite 42
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
übers Radfahren vehement schimpft.
Ich meine als Radfahrer, dass es schwer sein wird, mir das Radfahren auszutreiben, aber ich
bin vielleicht einer der Verärgerten, die Schwierigkeiten machen. Damit gehöre ich vielleicht
zu einer tatsächlich existenten Gruppe, die z.B. die Behörden und deren Regeln nicht respek-
tieren.
Neue Kunden dagegen gewinnt man, wenn man versteht, was sie zum „Kauf des Produktes“
– in unserem Fall zum Radfahren – anregt. Man gewinnt sie nicht, wenn ihnen das Angebot,
welches man hat, nicht passt. Aber um herauszufinden, was für den Kunden wünschenswert
ist, muss man wieder zwischen Radlern und Noch-Nicht-Radlern differenzieren: Radler beur-
teilen die Situation auf der Basis praktischer Erfahrungen; diese sind zwar subjektiv, aber sie
reflektieren die Wirklichkeit des Radfahrens in der Praxis, u.a. die gefühlsmäßige Wirklichkeit
im Zusammenhang mit der Ausübung des Radelns. Wenig- oder Nichtradler haben keine oder
wenig praktische Erfahrung und damit besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit eines verzerr-
ten Bildes, oder auch nur eines kleinen Bildausschnittes, was die Gefühle beim Radeln an-
langt und von Vorurteilen bzgl. des Funktionierens des Radfahrens in der Praxis (im Alltag).
Was gefällt und was attraktiv erscheint, wird sich jedenfalls bei den beiden Gruppen unter-
scheiden. Bei Radlern spielt die praktische Erfahrung eine Rolle, vor allem das Fühlen. Nicht-
oder Wenig-Radler werden vom Hörensagen, von Vorstellungen, von Überlegungen berich-
ten; aber eigenes Fühlen, das auf konkreten Erfahrungen basiert, fehlt bzw. ist eingeschränkt
auf einige Gefühlsaspekte wie z.B. die Angst. Das ist eine der Schwierigkeiten beim „Verkauf“
des Radfahrens. Vorurteile können dabei beim Umstieg auf das Rad stören. Natürlich gibt es
auch positive Vorurteile. Das Problem dabei: wenn man‘s dann ausprobiert, dann gibt es mög-
licherweise schwere Enttäuschungen und evtl. "Boomerang-Effekte".
3 Die Kunden verstehen
Wie findet man nun, methodisch richtig, heraus was beim Radfahren – oder die Vorstellungen
vom Radfahren – stört? Und wie findet man heraus, was anregt? Dazu muss man zunächst
die Literatur studieren, zur Unterstützung der Entwicklung von theoretischen Überlegungen
und Hypothesen. Auf so einer guten Basis kann – oder soll – dann Empirie (Motivforschung)
betrieben werden.
4 Wo man im System eingreift
Die folgende Abbildung 11 – der Diamant – stellt deskriptiv dar, in welchen Bereichen des
Verkehrssystems, dessen Teil wir als Individuen sind, sowohl unseren Wünschen und Bedürf-
nissen entgegenkommende als auch diesen widersprechende Elemente und Aspekte zu fin-
den sind bzw. sein können. Was wir wollen und was nicht, was uns stört und was nicht, was
wir uns wünschen und was nicht, entscheiden wir zwar als die Individuen, die wir derzeit sind,
mit allen Erfahrungen, Überlegungen, Vorurteilen, etc. die derzeit für uns typisch sind. Aber
wie wir uns als Individuen entwickelt haben und wie wir so geworden sind, wie wir jetzt sind,
hat u.a. damit zu tun, wie uns Umweltfaktoren beeinflusst haben: Die Kommunikation mit an-
deren Menschen, die Gesellschaft rund um uns herum in all ihren Äußerungsformen, die phy-
sische Gestaltung der Umwelt und die Infrastruktur, sowie die Erfahrungen, die wir mit unter-
schiedlichen Fortbewegungsarten gemacht haben, als Ausübende oder in Interaktion mit
anderen Ausübenden.
Seite 43
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 11: Der Diamant; gestaltet nach [1].
5 Marketing
Eine aktive Einflussnahme auf die Menschen, um ihre Verkehrsmittelwahl zu beeinflussen –
z.B. im Sinne einer Förderung des Radfahrens – sollte sinnvoller Weise Verbesserungen in
den Bereichen des Diamanten anstreben. Vorstellen kann man sich eine solche versuchte
Einflussnahme als einen Marketingprozess (siehe u.a. [2]). Dieser umfasst laut Lehrbuch die
folgenden Bereiche von Maßnahmen:
Produktgestaltung: geeignete Produkte/Voraussetzungen müssen angeboten bzw. zur
Verfügung gestellt werden.
Kommunikation in engerem Sinn: Über Produkte/Voraussetzungen ist zu informieren,
sie müssen beworben werden.
Anreize sollen gegeben werden, dass bestimmte Angebote angenommen werden; wenn
Zielpersonen dann Geschmack am Angebot finden, dann wird aus einer von außen
kommenden Motivation eine sogenannte intrinsische Motivation, d.h. es entsteht eige-
nes Interesse an der Nutzung bestimmter Angebote.
Distribution: P und K und A sind richtig zu verteilen bzw. zu platzieren, sodass möglichst
viele Zielpersonen erreicht werden.
Die eben genannten 4 Marketingschritte müssen aber gut vorbereitet werden. Insbesondere
müssen sie auf der Information über die Zielgruppe basieren: Wer ist Zielgruppe, wie ist sie
segmentiert, was wird von der Zielgruppe bzw. ihren unterschiedlichen Segmenten gewünscht
und was nicht? Welche Barrieren für den Zugang zu Produkten/Angeboten gibt es?. Was sind
die Gründe für mögliches "Abspringen" von Kunden (warum hören Leute auf, Rad zu fahren),
was macht die Attraktivität des Radfahrens aus, was spricht für das Radeln etc.
Alle Maßnahmen müssen also auf einer sorgfältigen Erforschung der Wünsche und Vorstel-
lungen der Zielgruppen basieren. Dazu muss man sich selbstverständlich geeigneter Befra-
gungsmethoden bedienen. Aber diese sind nicht Thema dieses Papiers.
Individuum mit momentanen Eigenschaften entscheidet auf-grund dieser, wird aber ständig auch von “außen” beeinflusst
Interaktion zwischen Individuen: Erfahrungen von Autofahrern dass sie Radfahrer nicht mögen &
daher nicht radeln; Radfahrern kann Interaktion mit Autofahrern sauer
aufstoßen Reaktanz
Fahrzeug: Auto bietet Schutz & Komfort; Radlern macht das nichts, Nicht-Radler wollen das nicht auf-
geben; Rad war aber bei technischer Entwicklung bisher unterprivilegiert
(Schlösser, Licht usw)
Gesellschaft: Gesetze, Regelungen, Medien, öffentliche Diskussion erge-
ben zusammen Eindruck, wie Rad-fahren gesehen wird kann Radler
zornig machen und Nicht-Radler abhalten – oder Gegenteil?
Infrastruktur: Reflektiert sehr schön wie Gesellschaft zum Rad steht Autoorientiertheit, Schlamperei im
Finish bei Radfahrinfrastruktur, Lieblosigkeit, Gedankenlosigkeit oder
einfach nur kühles Hintanstellen
Seite 44
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
6 Fakten und Gefühle
Im Zusammenhang mit dem Marketingprozess, der nichts anderes ist als ein mehr oder weni-
ger strukturierter Kommunikationsprozess, ist aber besonders auf einen Aspekt hinzuweisen,
auf den Watzlawick et al. [3] aufmerksam gemacht haben: Wenn sachliche Kommunikation –
die Vermittlung von Wissen, Instruktion, auch Motivation – funktionieren soll, dann bedarf es
einer soliden emotionalen Basis: In einer guten Beziehung funktioniert die Kommunikation
leicht(er). Ist die Beziehung schlecht, fehlt es an Respekt und ähnlichem, dann wird eine
Kommunikation, wo einer auf die Ideen des anderen einsteigt, schwierig bis unmöglich.
Abbildung 12: Zwei Dimensionen der Kommunikation [3].
7 Das Nahverhältnis zu einem Produkt / zu einer Idee
Ein weiterer psychologischer Aspekt, den man bedenken muss, wenn man jemandem etwas
"verkaufen" will, ganz egal, ob es sich um ein physisches Produkt ("kauf ein Fahrrad") oder
um eine Idee ("steig um aufs Fahrrad") handelt, ist das Nahverhältnis der Zielperson zu die-
sem Produkt oder zu dieser Idee: Wie man sich an unterschiedliche Zielgruppen oder deren
Segmente wenden muss, hängt davon ab. Die folgende Darstellung (Abbildung 13) enthält
unterschiedliche Stufen, auf denen man sich zwischen dem „Nicht-einmal-dran-Denken“ und
dem gewohnheitsmäßigen Radfahren befinden kann. Diese Darstellung zeigt das sogenannte
Transtheoretisches Modell von Prochaska & DiClemente:
Abbildung 13: Stufen der Bereitschaft für den "Kauf" eines Produktes, einer Idee [4].
Emotionale/konnotative Dimension
Jede Kommunikationsprozess hat eine emotionale und eine rationale (oder faktische) Dimension. Deshalb ist relevant nicht nur was kommuniziert wird, aber auch wie es kommuniziert wird und was der Kommunikationsinhalt auf der konnotativen Ebene = Gefühlsebene bedeutet
Rationale – oder faktische - Dimension
Seite 45
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Diesem Modell folgend muss man, nach sorgfältiger Segmentierung der Zielgruppen, die
Kommunikation mit ihnen an ihren Bewusstseinsstand anpassen. Prochaska und Velica ma-
chen einige Vorschläge, wie das zu geschehen hat und es gibt weiterführende Literatur zum
Thema in großem Umfang. Wesentlich ist, dass man bei der Zusammenstellung von Maß-
nahmen vom dort zusammengefassten Wissen Gebrauch macht bzw. dass man die entspre-
chenden Disziplinen in die Arbeit einbindet.
8 Die Brauchbarkeit ist relevant
Das bisher Gesagte kann man so zusammenfassen, dass dabei das Prinzip der Brauchbarkeit
("usability") enthalten ist; das Angebot soll demzufolge effektiv, effizient und befriedigend sein:
Leute, die schon jetzt radeln, sollen sich wertgeschätzt und bestätigt fühlen; sie sollen in ihrer
Haltung bestärkt werden, Radfahren als brauchbar anzusehen:
Radfahren soll als effektiv wahrgenommen werden (man erreicht damit Ziele);
Es soll effizient funktionieren, d.h. man soll damit Ziele leicht erreichen, ohne unnötige
Mühe und Schwierigkeiten;
Es soll zufriedenstellend sein, im Sinne des Wortes Spaß machen.
Radler (also die "Kunden, die wir schon haben") sollen das Radfahren in diesem Sinn als
brauchbare Fortbewegungsart erleben, potentielle Radfahrer sollen sukzessive davon über-
zeugt werden, dass Radfahren vermutlich etwas Brauchbares ist: Sie sollen es ausprobieren
und zu positiven Schlüssen gelangen.
9 Wer kann sich für das Radfahren einsetzen und wer muss das tun?
Abbildung 14: Wer kann/sollte mit Zielgruppen kommunizieren.
Beim bisher aus mehreren Perspektiven angesprochenen Kommunikationsprozess ist die
Frage nach dem Kommunikator nicht ganz trivial: Wer ist denn für die Kommunikation mit den
Zielgruppen verantwortlich? Wer soll die Initiative ergreifen? Wenn es z.B. heißt "man muss
gute Voraussetzungen schaffen", dann erhebt sich die Frage: Wer "muss" das tun? Die Ant-
Andere Verkehrsteilneh-
mer
Personen die sich für
Radfah- ren einsetzen
(NGOs, Forscher)
Kommilitonen, Kollegen
Planer, Archi-tekten,
Gestalter der Infrastruktur
Öffentlichkeit, Medien (Einstel-
lung gg. Rad-lern)
Akteure mit politischen
Zielen, Politiker
Radler & Nicht-Radler
Seite 46
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
wort lautet aus meiner Sicht: Wem das ein Anliegen ist, der/die kann das Thema Radfahren in
einem jeweils passenden Rahmen ansprechen. Das gilt für viele unterschiedliche Gruppen,
von denen die vorherige Darstellung (Abbildung 14) einige zeigt. Für einige Gruppen in der
Darstellung gilt aber: Sie haben hier Pflichten, soll das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung
unserer Gesellschaft umgesetzt werden: Für Politiker, Verwaltungsbeamte, Planer im öffentli-
chen Dienst bzw. für alle Personen, die sich in öffentlichen Funktionen mit dem Verkehr be-
fassen, kann man den Einsatz für das Radfahren also als ein Muss ansehen.
10 Einige Ideen für Produkte / zu schaffende Voraussetzungen
Ohne weiter auf Methodisches einzugehen folgen nun einige Vorschläge, die in der Literatur
häufig als Maßnahmen zur Verbesserung der Voraussetzungen für das Radfahren bzw. zur
Attraktivierung des Radfahrens angegeben werden (also "Produkte" im Marketingjargon). Man
sorge unter anderem für:
Guten Zugang/gute Erreichbarkeit von Zielen;
flächendeckende Wegenetze;
bewährtes Design der Infrastruktur;
einfache/verständliche Wegweisung;
freundliches und gut ausgebildetes offizielles Personal (z.B. Polizei);
gutes soziales Klima und Sicherheit (z.B. Infrastrukturplanung);
Erleichterung des Umganges mit KFZ: Geschwindigkeit, Parken, Abbiegemanöver der
Kfz regulieren/kontrollieren;
kurze Wege, Netzwerk mit kürzeren Knoten;
gutes Serviceniveau (Räumung, Reinigung, Reparatur, etc.);
Schulwegepläne fürs Radfahren für Schulkinder;
Abstellmöglichkeiten, intelligente Absperrmöglichkeiten.
Als "Produkte" im engeren Sinn werden in der Diskussion oft noch Ausrüstungsaspekte ange-
geben, wie z.B. High technology Produkte (Beleuchtung, Navigationssysteme, Sperrmöglich-
keiten, Datenerhebung und Speicherung – km, physiologische Daten usw.) sowie sogenannte
Assets (Einkauf, Kindertransport, Sattelschutz, Pumpen usw.).
11 Kommunikation
Die Möglichkeiten des Einsatzes von Kommunikationsmaßnahmen sind vielfältig und alle
dadurch gekennzeichnet, dass man sich mit Worten, Bildern und Symbolen an die unter-
schiedlichen Zielgruppen wendet. Folgende Aktivitäten können darunter fallen:
Information über Angebote im obigen Sinn (Produkte, Netze, Neuerungen etc.);
Professionelle Reklame, Entschärfung von mentalen Barrieren fürs Radeln; das „Pro-
dukt Radfahren" mit positivem Image versehen; Argumente für das Radfahren zusam-
menstellen und verbreiten, Gegenargumente debattieren im Sinne einer "Inokulation",
einer Impfung also;
Erklärung und Diskussion der Nachteile, Schwächen und der Dinge, die man nicht än-
dern kann mit Humor und Vergleiche mit Nachteilen der weniger erwünschten Alternati-
ven;
Seite 47
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Sensibilisierungsmaßnahmen durch Information über Fakten, z.B. über reale Kosten von
Autos für den Besitzer, aber auch für die Gesellschaft bzw. für die Steuerzahler;
Hervorhebung der Brauchbarkeit des Fahrrades, wobei nicht nur rationale Aspekte son-
dern auch Spaßaspekte zum Ausdruck kommen sollen (siehe "Brauchbarkeit" weiter
oben);
Zeigen von Rollen-Modelle; prominente oder einflussreiche Persönlichkeiten (Schau-
spieler, Radiosprecher, bekannte Politiker) zeigen, sie radeln (ABER: das muss glaub-
würdig sein, und kein Wahlkampfgag, denn das wird von der Öffentlichkeit sehr schnell
durchschaut);
Werbung mit Hinweisen auf die Kombination des Radfahrens mit neuen Trends (Fit-
ness, Urbanität, Entschleunigung, Lebensqualität, Sportlichkeit – unterschiedliche Grup-
pen sprechen hier auf unterschiedliche Attribute an; siehe "Segmentierung" weiter
oben).
12 Anreize
Der Sinn von Anreizen besteht hauptsächlich darin, Personen, die ein bestimmtes Produkt
noch nicht (so gut) kennen, die Möglichkeit zu geben, dieses auszuprobieren. Die Tasse Kaf-
fe, die einem im Supermarkt gratis angeboten wird, ist wohl allen bekannt. Dieses Angebot
(Motivation von außen oder „extrinsische“ Motivation) soll dann dazu führen, dass man am
angebotenen Kaffee Geschmack findet und ihn dann später aus eigenem Antrieb („intrinsi-
sche“ Motivation) kauft. Gratis-Leihräder folgen dem gleichen Prinzip. Einige einfache Regeln
für Anreize wären also folgende:
Man lasse potentielle Nutzer ein Produkt probieren – die eben genannten Gratisleihrä-
der wären so ein Anreiz, um das Radfahren auszuprobieren (und hoffentlich auf den
Geschmack zu kommen, wenn die Voraussetzungen stimmen, also die weiter oben dis-
kutierten Produkte "brauchbar" sind);
Aber man muss auch jetzige Nutzer motivieren, damit sie bei der Stange bleiben. Dafür
eignen sich z.B. unterschiedliche Belohnungsformen, wie z.B. die folgenden:
o Spezialpreise für bestimmte Gruppen (Angestellte in Betrieben, die mit dem
Rad zur Arbeit kommen) etwa in Form von Urkunden, Urlaubsreisen, u.ä.
o Mehr Urlaubstage für Mitarbeiter, die den Arbeitsweg mit dem Rad zurücklegen
(in Dänemark in der Praxis umgesetzt);
o Steuerliche Unterstützung in Form von km-Geld wirkt als Anreiz ebenfalls recht
gut.
13 Verteilung (Distribution)
Die einfachste und recht allgemeine Regel für die Distribution (Verteilung) schließlich lautet:
Unterbreite und verbreite deine Angebote, deine Kommunikation, deine Argumente, deine
Reklame, deine Motivation etc. in solcher Weise, dass du möglichst viele Kunden und potenti-
elle Kunden erreichst.
14 Man muss seine Kunden kennen!
Die geeignete Basis für alle Maßnahmen zur Förderung des Radfahrens erhält man aber nur,
wenn man sich über die Kunden und potentiellen Kunden informiert, sie sinnvoll segmentiert,
Seite 48
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
unterschiedliche Wünsche, Tendenzen, Abneigungen und Ängste versteht und darauf ent-
sprechend zielgruppenspezifisch reagieren kann. Zu erheben ist also:
Wer sind die Zielgruppen?
Wie sind diese Zielgruppen („Kunden“) segmentiert?
Bedürfnisse und Widerstände verschiedener Untergruppen (z.B. grob Radler und poten-
tielle Radler);
Motive, die sie leiten; Werte, die sie anstreben bzw. verteidigen wie etwa Umweltschutz;
Bedingungen der „Zusammenarbeit“: Man muss verstehen, unter welchen Bedingungen
die unterschiedlichen Gruppen bereit sind, auf Angebote und Vorschläge "einzusteigen".
15 Die Bedeutung eines ganzheitlichen (holistischen) Ansatzes
Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass bei einer Vorgangsweise, die den Prinzipien
des Marketings folgt – bzw. wohl generell, wenn man jemanden von etwas überzeugen will –
ein holistischer Ansatz notwendig ist: Wenn man die Zielgruppen nicht gut kennt bzw. nicht
gut erforscht hat, dann besteht das Risiko von Effektivitäts-, Effizienz- und Zufriedenheits-
mängeln; die Brauchbarkeit wird dann nicht richtig deutlich. Wenn man gute Produkte zur Ver-
fügung stellt, die aber nicht oder zu wenig bekannt sind, dann werden diese nicht ausreichend
verwendet. Ohne gute Kommunikation kommen die besten Produkte dann nur suboptimal
zum Einsatz. Fährt man hingegen ein gutes Kommunikationsprogramm und bietet wirkungs-
volle Anreize, wobei das Produkt aber nicht die Zustimmung der Kunden findet oder als
schlecht angesehen wird, dann besteht das Risiko eines Boomerangs: Man probiert das Rad-
fahren aus, findet es schlecht und kommt zu dem Schluss, dass man das eigentlich nicht
mehr machen will – und reißt möglicherweise andere, die noch unsicher sind mit seiner Mei-
nung mit.
16 Zum Schluss
Der Halbsatz, der den Titel dieses Artikels darstellt, ist folgendermaßen zu vervollständigen:
Wenn Sie wollen, dass ich Rad fahre, statt mit dem Auto, und dass ich diese Gewohnheit
auch beibehalte, dann stellen Sie Bedingungen zur Verfügung, die mir das Radeln angenehm
machen bzw. überzeugen Sie mich, dass sich der Umstieg auf das Radfahren lohnt.
Quellen
[1] Chaloupka-Risser Ch., Risser R., Zuzan W.-D. 2011, Verkehrspsychologie: Grundlagen
und Anwendungen, Wien: Facultas-Verlag
[2] Kotler Ph., Armstrong G., Wong V. & Saunders J. 2010, Grundlagen des Marketing, 5.
Aufl., Pearson Studium, München 2010
[3] Watzlawick P., Beavin J., Jackson D.D., 2011, Menschliche Kommunikation – Formen,
Störungen, Paradoxien, 12. unveränderte Auflage, Bern: Huber Verlag
[4] Prochaska J. O. & Velicer W. F. 1997, The transtheoretical model of health behavior
change. American Journal of Health Promotion, 12, 1997, S. 38–48
Seite 49
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Urbane Radverkehrsplanung am Praxisbeispiel
Esch-sur-Alzette/Luxemburg
Romain Molitor11
11 Der vorliegende Beitrag basiert auf einem Vortrag, der im April 2013 im Rahmen der Ringvorlesung
“Radfahren in der Stadt” an der TU Wien gemeinsam mit Lucien Malano, Stadt Esch und Félix Braz,
ehemaliger verantwortlicher Stadtrat der Stadt Esch abgehalten wurde.
Seite 50
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 51
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Urbane Radverkehrsplanung am Praxisbei-spiel Esch-sur-Alzette/Luxemburg
1 Die Ausgangslage
Die Stadt Esch-sur-Alzette, zweitgrößte Stadt Luxemburgs, ist durch die Stahlindustrie ge-
prägt; gleich drei Stahlwerke mit Hochöfen in und rund um Esch waren Motor der Entwicklung:
Terres Rouges (1872 in Betrieb genommen, 1977 stillgelegt, nach wie vor Industriebrache),
Esch-Schifflange (1870 in Betrieb genommen, 2012 temporär stillgelegt) und Esch-Belval
(1909 in Betrieb genommen; Hochöfen 1998 stillgelegt und Inbetriebnahme der Elektroöfen,
ein Teil des Industrieareals wird in der Folge für die Entwicklung eines neuen Stadtteils freige-
geben). Parallel dazu wuchs die Zahl der Einwohner der Stadt (siehe Tabelle 6) und nahm als
Folge der „Stahlkrise“ in den 70er und 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts wieder ab.
Jahr Einwohner
1851 1.489
1871 3.946
1890 6.855
1900 10.971
1910 16.461
1922 20.437
1930 29.429
1947 26.851
1960 27.954
1970 27.574
1981 25.144
1991 24.018
2001 27.146
2013 31.898
Tabelle 6: Einwohnerentwicklung Esch-sur-Alzette 1851 bis 2013; Quelle: [1].
Den Aufschwung der Schwerindustrie führte zu einem sehr raschen Anwachsen der Stadt
Esch bis zu ihrer Ausdehnung innerhalb von nur 50 Jahren. Aufgrund dieser spezifischen
Entwicklung ist Esch eine sehr kompakte Stadt mit einer Fläche von nur 14,35 km2 und einem
Durchmesser von nur etwas mehr als 3 km. Folglich ist die Einwohnerdichte mit 2.242 Ein-
wohner/km2 relativ hoch [2].
Nach der sukzessiven Stilllegung der drei Hochöfen in Esch-Belval12 wird rund die Hälfte des
Industriegeländes nicht mehr benötigt; Ideen, die nunmehr frei werdenden Flächen einer an-
derswertigen Nutzung zuzuführen, werden entwickelt. Im Jahr 2000 gründen der Eigentümer
des Stahlwerks Arcelor (heute Arcelor-Mittal) und der luxemburgische Staat eine gemeinsame
Verwertungsgesellschaft („agora s. à r.l. & Cie“), mit dem Ziel, das freiwerdende Gelände des
Werks Esch-Belval mitsamt den Reserveflächen für eine urbane Neunutzung vorzubereiten.
Damit war die Stadt Esch gefordert: Das zu Rekonversion vorgesehene Gebiet mit rund
12 1997 wurde der letzte der verbleibenden drei Hochöfen; Hochofen B, stillgelegt. Der leistungsfähigste
Hochofen C wurde 1995 nach einer Panne stillgelegt, der Hochofen A als stille Reserve wurde bereits
1986 stilgelegt. Zwei Hochöfen, A und B, werden als Denkmal der Nachwelt erhalten. Der Hochofen C
wurde nach China verkauft und 1996/1997 abgebaut. Siehe [3: S. 228ff ].
Seite 52
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
120 ha, zusätzlich in zwei Gemeinden gelegen (Esch-sur-Alzette und Sanem), sieht im ersten
Masterplan eine Entwicklung im Endausbau 2021 von rund 20.000 Arbeitsplätzen und Ein-
wohnern vor. Laut Masterplan sind auf 70 ha bebaubarer Fläche rund 1,3 Mio m2 BGF vorge-
sehen. Der Staat hat insgesamt 27,34 ha Fläche (ca. 40 % der bebaubaren Fläche) für den
Bau von Forschungseinrichtungen (Cité des Sciences: Université du Luxembourg, Centre de
Recherches Publics, Centre National de la Culture de l’Industrie) gekauft [3].
Abbildung 15: Esch-sur-Alzette; Quelle: ACT – Administration du Cadastre et de la Topographie,
http://map.geoportail.lu/.
Diese Ausgangslage – kompakte Stadt aus der Gründerzeit und vorgesehener neuer Stadtteil
ungefähr gleicher Größe mit einem politischen Willen, ca. 1 Mrd. EUR an öffentlichen Geldern
zu investieren – waren die beiden Eckpfeiler für das neue, auszuarbeitende Verkehrskonzept.
Dabei sollten alle relevanten Verkehrsmittel (Fußgänger, Radfahrer, ruhender und fließender
Individualverkehr, straßen- und schienengebundener Öffentlicher Nahverkehr etc.) berück-
sichtigt und parallel in enger Abstimmung mit dem Stadtentwicklungsplan ausgearbeitet wer-
den. Der Bearbeitungszeitraum für die Erstellung des Verkehrskonzeptes wurde mit Septem-
ber 2000 bis Juli 2001 festgelegt.
Die Entwicklung der Industriebrache Belval kann als Chance und Bedrohung zugleich ange-
sehen werden. Die Anforderung an das Verkehrskonzept war, die Erschließung beider Stadt-
teile in der Form zu gewähreisten, dass sich beide Stadtteile gleichermaßen entwickeln kön-
nen. Eine Anbindung des neuen Stadtteils Belval an die Stadt Esch kann im Umweltverbund
nur über den ÖV und das Rad erfolgen; zwischen dem neuen Stadtteil und der „alten“ Stadt
befindet sich ein in Betrieb stehendes Stahlwerk mit einer der größten Walzstraßen weltweit.
Im ÖV wird der Stadtteil Belval über den Bahnhof „Belval-Université“ von Süden und mit Regi-
onal- und Stadtbuslinien von Norden angebunden. Im Radverkehr soll die Anbindung sowohl
von Süden als auch von Norden erfolgen.
Seite 53
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 16: Belval Ouest 2010, Blickrichtung Osten, im Hintergrund das bestehende Stahl-
und Walzwerk Esch-Belval und die Stadt Esch; Quelle: Wikipedia (2013).
Eine weitere städtebauliche Forderung war generell die Aufwertung des öffentlichen Raumes,
die nur über eine konsequente Mobilitätspolitik möglich ist. Dabei sollte auch geprüft werden,
inwiefern Stadtplätze von der ansässigen Bevölkerung wieder stärker als Aufenthalts- und
Begegnungsort statt als Parkplatz genutzt werden können. Als weiteres Ziel wurde die Errei-
chung eines signifikant höheren Anteils des Umweltverbundes formuliert (siehe Abbildung 17).
60%
35%
77.100 49.000
69%
22%
9%0,5%
4%0,8%
83%
17%
60.900
Bestand BestandBestand
Wohnbev.
Esch
Sonstige
(Nicht Escher)
57%
22%
15%
6%
47%
35%
9%
9%
75%
25%
Ziel
Ziel
Ziel
Wohnbev.Esch
Sonstige(Nicht Escher)
Au
to
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
Um
we
ltv
erb
un
d
Binnen-
verkehr
Ziel-Quell-
V e r k e h r
We ge p ro Tag(beide Richtungen)
Wohnbevölkerung Esch
gesamt(Ziel-Quell- und
Binnenverkehr)
Abbildung 17: Ziele im Modal Split; Quelle: [5].
Seite 54
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Ein wichtiger Baustein im Verkehrskonzept war die Entwicklung eines Radwegenetzes, auf
das wir uns in der Folge konzentrieren werden.
2 Die Analyse des Radverkehrs
Die Ausgangslage im Fahrradverkehr war, dass dieser in Esch nur eine sehr geringe Bedeu-
tung hatte. Zählungen oder Erhebungen betreffend Fahrradverkehr waren nicht vorhanden. In
Esch fehlte ebenfalls ein durchgängiges Radroutennetz, weshalb der geringe Fahrradverkehr
in Esch vorwiegend im Mischprinzip mit dem Kfz-Verkehr geführt wurde. Obwohl im Rahmen
früherer Verkehrskonzepte [6] bereits ein Radverkehrsnetz konzipiert wurde, war kaum eine
Infrastruktur für Radfahrer vorhanden.
Die bestehende Infrastruktur für Radfahrer umfasste im Jahr 2000 Radwege in folgenden
Straßenzügen:
Penetrante de Lankelz (vzul = 70 km/h): Radweg (baulich getrennt, ca. 800 m Länge);
Boulevard Charles de Gaulle (vzul = 70 km/h): Radweg (baulich getrennt, ca. 800 m Län-
ge) im nordwestlichen Abschnitt in Richtung Raemerich;
und bildete damit kein zusammenhängendes Netz.
3 Prinzipielle Herangehensweise
Durch die kompakte Siedlungsform sind ideale Voraussetzungen für das Fahrrad als Alltags-
verkehrsmittel im Binnenverkehr und als Zubringer zum Öffentlichen Verkehr gegeben. Bei
Entfernungen bis etwa 5 km ist das Fahrrad das schnellste „Tür-zu-Tür“ Verkehrsmittel (siehe
z.B. [7]).
3.1 Vorgangsweise
Die prinzipielle Vorgangsweise sah zuerst eine Potenzialabschätzung vor, in der geklärt wer-
den sollte wieviel Radverkehr zu erwarten ist und wo bzw. auf welchen Routen dieser zu er-
warten ist. Die Potenzialabschätzung baut auf den vorher festgelegten Zielsetzungen auf (s.
Abbildung 17). Die Bestimmung der frequentiertesten Routen ist wichtig, um einerseits das
Netz entsprechend logisch aufbauen zu können, und um andererseits eine Prioritätenreihung
der Stadt vorschlagen zu können.
Ausgehend von der Potenzialabschätzung werden Wunschlinien (Verkehrsverteilung) be-
stimmt (siehe Abbildung 19), die dann auf ein Straßennetz umgelegt werden. Die Festlegung
der Netzhierarchie (Haupt- und Nebenrouten) baut auf den Ergebnissen der Umlegung der
Wunschlinien auf. Nach der Festlegung der Netzhierarchie werden die prinzipiellen Anlagear-
ten (Radwege, Radstreifen, Angebotsstreifen („voie suggestive“) auf Basis der zu dem Zeit-
punkt geltenden Richtlinien festgelegt [8, 9] sowie ein Maßnahmenplan mit einer Zeitachse
der Umsetzung der jeweiligen Infrastruktur vorgeschlagen.
3.2 Potenzialabschätzung
Die Potenzialabschätzung baut auf Analogieschlüssen aus Städten vergleichbarer Größe und
der Ausgangssituation auf. Für die Verkehrserzeugung wurde ein Anteil der Wege mit dem
Fahrrad von 6 % an allen Wegen der Einwohner (Binnen-, Ziel- und Quellverkehr) normativ
festgelegt. Unter der Annahme, dass die Mobilitätsrate in Esch bei 3,1 Wegen pro Einwohner
Seite 55
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
über 6 Jahre und Normwerktag liegt – eine Mobilitätserhebung lag leider nicht vor und war
auch aus Kostengründen im Projekt nicht vorgesehen – ergibt dies 0,17 Wege pro Einwohner
über 6 Jahre und Tag mit dem Fahrrad oder in Summe 4.600 Wege, die werktäglich mit dem
Fahrrad zurückgelegt werden. Unter der Annahme, dass Wege mit dem Fahrrad im Wesentli-
chen nur innerhalb der Stadtgrenzen zurückgelegt werden, würde der Anteil der Wege mit
Fahrrad im Binnenverkehr von unter 1 % auf ca. 9 % steigen. Im Ziel- und Quellverkehr, also
für Wege über die Stadtgrenze hinaus, wurde der Anteil des Radverkehrs signifikant niedriger
angesetzt. Die Verteilung der Wege erfolgte mit Hilfe des Gravitationsgesetzes [10], Formel
(1).
ijC
ijiiij eCZQkF (1)
Mit Fij… Anzahl an Fahrten von Zelle i zu Zelle j; Qi...Quellverkehr aus Zelle i; Zj...Zielverkehr
nach Zelle j; Cij...generalisierte Kosten, im vorliegenden Fall nur Distanz im Radverkehr;
α, β...Parameter der Widerstandsfunktion, k...Konstante.
Die erzeugten Wege mit dem Fahrrad wurden auf die einzelnen Zwecke (Arbeit, Ausbildung,
Einkauf, Freizeit) aufgeteilt. Je nach Zweck wurden die Attraktoren für die Quelle und das Ziel
angepasst, etwa Zahl der Einwohner über 6 Jahre in der Verkehrszelle i und Zahl der Arbeits-
plätze in der Zelle j oder Zahl der Einwohner über 6 Jahre in der Verkehrszelle i und Verkaufs-
fläche in der Zelle j (siehe auch [10]). Die Verkehrsbeziehungsmatrix muss anschließend auf
ein Straßen- und Radwegenetz umgelegt werden. Ziel ist es, eine nachvollziehbare Grundla-
ge für die Prioritätenreihung der zu bauenden Radwegeinfrastruktur zu schaffen.
Abbildung 18: Verteilung der Radwege – Ergebnisse der Modellierung; Quelle: [5].
Seite 56
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Der Netzgraph baut auf dem Straßennetz von Esch auf, das digitalisiert wurde. Um die Wider-
stände im Netz korrekt abzubilden, wurden die Steigungen der Straßenzüge, die Verkehrsbe-
lastungen in Form des DTV bei der Parametrisierung der Streckenwiderstände der einzelnen
Streckenabschnitte berücksichtigt. Die Umlegung erfolgte nach dem „Best-Weg-Route“ Ver-
fahren. Das Ergebnis ist in Abbildung 18 visualisiert.
Abbildung 19: Umlegung der Radwege auf das Straßennetz – Ergebnisse der Modellierung;
Quelle: [5].
4 Die Planung
4.1 Stadtnetz
Die Planung des Radwegenetzes folgte ebenso wie für andere Verkehrsmittel einer Hierar-
chie. Folglich wurde für den Aufbau des Netzes eine zweigeteilte Netzhierarchie entwickelt:
Ein Hauptnetz mit dem Titel „Stadtnetz“ und ein Sammel- und Erschließungsnetz mit dem Titel
„Nachbarschaftsnetz“.
Das Stadtnetz hat die Funktion, die Hauptverbindung zwischen den Stadtteilen und zu den
Zielen gesamtstädtischer Bedeutung, etwa dem Bahnhof, zu garantieren. Auf diesem Netz
sollen auch die Ströme gebündelt werden; die Infrastruktur ist entsprechend auszugestalten.
Die Funktion dieses Netzes ist Verbinden und Durchleiten. Die Hierarchie bestimmt desweite-
ren die Maschenweite des Netzes; als Mindestmaß wurden 1.000 m und als zu erreichende
Qualitätsstufe ein „Optimalmaß“ von 500 m normativ festgelegt. Anhand dieser normativen
Festlegung ergibt sich eine abgeleitete Netzlänge für das Stadtnetz von 9 km bei 1.000 km
Maschenweite und von 17 km bei 500 km Maschenweite des Stadtnetzes.
Seite 57
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 20: Vorschlag des Stadtnetzes; Quelle: [5].
Das Stadtnetz wurde auf Basis der Ergebnisse der Verkehrsumlegung entwickelt; dabei wurde
das Netz „routenorientiert“ aufgebaut (siehe Abbildung 20). Dieser Ansatz basiert darauf, dass
in der Umsetzung immer idealerweise ganze Routen gleichzeitig umgesetzt werden sollen.
Das wurde ebenfalls im Maßnahmen- und Zeitplan berücksichtigt. Für jede Route wurde pro
Abschnitt der Infrastrukturtyp in der Maßnahmentabelle als Grundlage für die spätere Umset-
zung festgelegt (Radwege, Radstreifen oder Angebotsstreifen). Im Endausbau soll das Stadt-
netz insgesamt eine Länge von 19,8 km aufweisen.
4.2 Nachbarschaftsnetz
Das sogenannte Nachbarschaftsnetz ist in seiner Funktion eine Hierarchiestufe unter dem
Stadtnetz und dient der Erschließung der einzelnen Stadtteile. Entsprechend dieser Funktion
handelt es sich um Sammelradwege, teilweise auch um Erschließungsradwege – in Analogie
zur Hierarchie des Straßennetzes einer Stadt (vgl. etwa [11]).
Die vorgeschlagenen Maßnahmen im Nachbarschaftsnetz werden kleinteiliger (bis hin zu An-
passungen an Kreuzungen und Einmündungen, Absenken von Bordsteinen o.ä.) und mussten
bereits detaillierter für die Maßnahmenliste, die die Grundlage für die Umsetzung ist, ausgear-
beitet werden. Im Gegensatz zum Stadtnetz ist das Nachbarschaftsnetz nicht mehr „routen-
orientiert“, sondern mehr „(Einzel-)maßnahmenorientiert“ (siehe Abbildung 21).
Seite 58
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 21: Vorschlag des Nachbarschaftsnetzes; Quelle: [5].
Im Zuge der Ausarbeitung des Nachbarschaftsnetzes wurden auch Vorschläge für Abstellan-
lagen für Fahrräder und deren Standorte ausgearbeitet.
5 Die Öffentlichkeitsarbeit
Der Radverkehr war, wie in so vielen Städten, nach dem 2. Weltkrieg so weit zurückgegan-
gen, dass er quasi keine Rolle mehr spielte (siehe [12]) und mehr oder weniger aus dem
Stadtbild verschwunden war. Die Öffentlichkeitsarbeit musste daher „bei Null“ beginnen und
zunächst Bewusstseinsbildung schaffen sowie die Vorzüge des Radfahrens der Bevölkerung
kommunizieren (siehe Abbildung 22).
Seite 59
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 22: Auszug aus dem Flyer „Esch bewegt“; Quelle: [13].
Nach Realisierung der ersten beiden Routen (siehe unten), wurde eine Radkarte für Esch
erstellt (Abbildung 23).
Abbildung 23: Radkarte Esch; Quelle: [14].
Seite 60
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
6 Die Umsetzung
6.1 Chronologie
Nach Diskussion und Beschlussfassung durch den Gemeinderat ging es an die Umsetzung.
Die Chronologie der einzelnen Umsetzungsschritte:
2001 – 2003: Planung und Bewusstseinsbildung auf politischer und technischer Ebene;
Planungsphase;
ab 2003: Umsetzung der ersten infrastrukturtechnischen Maßnahmen und konsequente
Inbetrachtnahme der Belange des Radverkehrs bei der Erneuerung der Straßen;
Nord-Süd-Route als erste Route (R1, R7), Lallange – Bahnhof; Eröffnung Sommer
2003;
Ost-West-Route als zweite Route (R6, R2), Belval – Kreisverkehr – rue du Canal – rue
du Fossé; Eröffnung 2004;
Einrichtung eines Leihrad-Systems (2004), 1. Generation mit 2 EUR („Einkaufswagen-
prinzip“) als Sozialprojekt mit Langzeitarbeitslosen;
ab 2007: Einführung des Verleihsystems vel’ok (Referenz: Kopenhagen), 2. Generation
mit Registrierung und elektronischer Sicherung, System Deceaux (siehe Citybike Wien);
Einführung der Mobilitäts-Karte Esch;
2008: „Bypad“-Zertifizierung (www.bypad.org) der Radverkehrspolitik;
2009: Festschreiben von Stellplatzkennzahlen für Fahrräder in der städtischen Bauver-
ordnung (z.B. 1 Stellplatz pro Bett in Studentenwohnheim);
2013: Ergänzung des Verleihsystems velok’ durch Elektrofahrräder (Pedelec);
Laufend: Erweiterungsmaßnahmen (infrastrukturell, reglementarisch) und Monitoring der
umgesetzten Maßnahmen.
6.2 Beispiel Route R6, R2
Die Ost-West-Achse als zweite wichtige Route wurde 2004 im Zuge der Sanierung der in Ost-
West-Richtung verlaufenden Hauptstraße rue du Canal umgesetzt. Da der Querschnitt keine
eigene Radinfrastruktur erlaubte und die Stellplätze zumindest mittelfristig erhalten werden
mussten (kaum eines der historischen Wohnhäuser aus der Gründerzeit hat eine Garage und
der Bau der Tiefgarage mit einem Teil als Wohnsammelgarage an der place de la Résistance
war erst für nach 2010 vorgesehen), musste auf Radstreifen in den Abschnitten mit ausrei-
chender Breite und einseitigen Angebotsstreifen in den schmäleren Abschnitten ausgewichen
werden. In der Gegenrichtung behalf man sich mit Piktogrammen auf der Fahrbahn, um den
Radverkehr auch dann sichtbar zu machen, wenn gerade niemand mit dem Fahrrad dort ver-
kehrt (Abbildung 24, Abbildung 25 und Abbildung 26).
Seite 61
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 24: Auszug aus dem Plan rue du Canal; Quelle: [15].
Abbildung 25: Realisierter Abschnitt rue du Canal 2004; Foto: Molitor (2004).
Seite 62
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 26: Realisierter Abschnitt rue du Canal 2004; Foto: Molitor (2004).
6.3 Beispiel Maßnahmen im Zuge von Straßenerneuerungen
Im Zug der erforderlichen Erneuerung des schadhaften Straßenbelags am Boulevard Pierre
Dupong, der im Zuge der 70er Jahre des vergangenen Jahrhunderts entsprechend „autoge-
recht“ mit überbreiten Querschnitten (ca. 9 m für 2 Richtungsfahrbahnen) ausgebaut worden
war, wurde mit einfachen Maßnahmen die Querschnittsbreite reduziert und eine Infrastruktur
für den Radverkehr geschaffen (Abbildung 27 und Abbildung 28).
Abbildung 27: Boulevard Pierre Dupong Blickrichtung Westen Ausgangsbasis 2001; Quelle: [5].
Seite 63
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 28: Boulevard Pierre Dupong 2008; Foto: Malano.
6.4 Bilanz
Die Bilanz nach rund 10 Jahren Umsetzung zusammengefasst dargestellt:
Insgesamt wurden 12,5 km realisierte Radinfrastruktur (Radwege, Radstreifen) bei einer
Gesamtlänge des städtischen Straßennetzes von 80 km geschaffen. Dabei ist zu beach-
ten, dass rund ein Viertel des städtischen Straßennetzes (ca. 20 km) in die Zuständig-
keit des Staates („route nationale“, „chemin repris“) fällt und eine Abstimmung mit der
verantwortlichen Verwaltung (Administration des Ponts et Chaussées) erforderlich ist.
Das Investitionsvolumen in die Radinfrastruktur über 10 Jahre (2003 bis 2013) lag bei
ca. 1 Mio. EUR; dies entspricht im Mittel einem jährlichen Budget von ca. 100.000,-
EUR. Die durchschnittlichen spezifischen Kosten der Radinfrastruktur lagen bei 80
EUR/m. Diese niedrigen Kosten waren auch nur durch pragmatische Lösungen – z.B.
Abmarkieren von Radstreifen bei Erneuerungen – möglich. Unter Berücksichtigung des
Budgets ist der erzielte Radverkehrsanteil beachtlich.
Der Radverkehrsanteil liegt in Esch bei ca. 5 % aller Wege; das Ziel von 6 % aller Wege
bzw. 9 % aller Wege im Binnenverkehr aus dem Jahr 2001 wurde noch nicht erreicht.
Im Zuge der Umsetzung im Rahmen der Neubaugebiete und -projekte werden konse-
quent Radabstellanlagen geschaffen.
Das seit 2007 in Betrieb befindliche Radverleihsystem „velok“ wies 2013 2.400 re-
gistrierte Benutzer auf, dies entspricht einem Anteil von ca. 8 % der Bevölkerung, von
denen 2013 38.000 Verleihvorgänge registriert wurden.
Seite 64
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 29: Radverleihssystem „velok“ am Bahnhof; Foto: Molitor 2012.
Abbildung 30: Radweg entlang des Boulevard Kennedy am neuen Busbahnhof; Foto: Molitor
2012.
Der Ausblick sieht ein
Monitoring der Effekte der umgesetzten Massnahmen;
sowie die Inbetrachtnahme der Belange des Radverkehrs bei allen infrastrukturellen
Planungen vor.
Quellen
[1] Statec (2013), Bevölkerungsstatistik Luxemburg (Online Datenbank, www.statec.lu,
Zugriff Dezember 2013)
Seite 65
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
[2] Goedert J. (1990), Stadtplanung in Esch-Alzette, forum nr. 121, Juli 1990, S. 25-29, Lu-
xembourg
[3] Masterplan précisé Belval Ouest (2001), Zwischenbericht “Projet de PAG”, Luxembourg
[4] Scuto D., Knebeler C. (201), Belval, Passé, présent et avenir d’un site luxembourgeois
exceptionnel (1991 - 2011), Esch
[5] Molitor R., Arndt M., Burian E., Groff A., Koch H., Maier B., Perez M., Pfeiler D., Schragl
E., Sparmann U., Wagner W., (2001), Verkehrskonzept Esch-sur-Alzette, Wien, Karlsru-
he im Auftrag der Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette
[6] Topp H.H. et al. (1989), Gesamtverkehrskonzept Esch-sur-Alzette, Darmstadt
[7] Knoflacher H. (1995), Fußgeher- und Fahrradverkehr, Wien.
[8] Ministère des Transports (2001), Avis de la Commission de circulation de l’Etat, La circu-
lation cycliste sur la voie publique, Luxembourg
[9] FGSV (1995), Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 95), Köln
[10] CERTU (2003), Modélisation des déplacements urbains de voyageurs, Guide des
pratques, Lyon
[11] FGSV (2010), Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen (RAST 2010), Köln,
[12] Molitor R. (2010), Das Fahrrad als Verkehrsmittel?, in LVI (Hrsg., 2010), „Mam Velo do!“,
Eine Radtour durch die Luxemburger Zeigeschichte, S. 153 – 171, Luxembourg
[13] Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette (2003), Flyer „Esch bewegt“
[14] Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette (2006), Mam Velo an Esch,
Radkarte Esch
[15] Molitor R., Clees L., Wagner W., Pfeiler D. (2003), Detailplanungen Radrouten im Auf-
trag der Administration Communale de la Ville d’Esch-sur-Alzette.
Seite 66
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 67
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Wiener Fahrradverkehr und Verkehrspolitik in historischer Sicht
Sandor Bekesi
Seite 68
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 69
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Wiener Fahrradverkehr und Verkehrspolitik in historischer Sicht Die Geschichte der Verwendung des Fahrrades als Alltagsfahrzeug in der Stadt und seine
Behandlung in Politik und Planung ist für Wien immer noch relativ wenig erforscht.[1] Im fol-
genden Beitrag sollen zu diesem Thema einige historische Eckdaten, eine Periodisierung und
erste Erklärungsversuche zur Verkehrsgenese geboten werden. Dabei werde ich zunächst die
Entwicklung des Fahrrads als innerstädtisches Verkehrsmittel in Wien seit Ende des 19. Jahr-
hunderts zwischen Nutzung, Planung und Politik beschreiben, um darauf folgend die mögli-
chen Ursachen für diese Entwicklung aufzulisten und zu gewichten. Ansatzweise soll dabei
auch die Frage erörtert werden, ob und inwieweit wir es hier mit einem Wiener Sonderweg zu
tun haben.
1 Periodisierung der städtischen Radverkehrsentwicklung
1.1. Der erste Boom 1895 - 1905
Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts weltweit ein Fahrrad-Boom einsetzte, sagte man die-
sem Verkehrsmittel auch in den Großstädten eine große Zukunft voraus.
„The effect (of bicycles) upon the development of cities will be nothing short of
revolutionary.”
Der leise Drahtesel würde, so hieß es, neben dem Dreck all den Lärm und jene Nervosität, die
dem Stadtleben eigen ist, beseitigen [2]. Hierzulande meinte Theodor Herzl 1896 in einem
Feuilleton der Neuen Freien Presse [3]:
“Schon ist klar, wie das Fahrrad gewaltig auf die Zustände der Menschen einwir-
ken, wie es das Aussehen der Städte und viele Bedingungen unseres Lebens ver-
ändern muss. (...) Wenn wir das Zweirad so betrachten, dämmert in uns die Ah-
nung auf, dass es das Heilmittel sei gegen die gefährliche Hypertrophie der
großen Städte.“
Auch der österreichische Ethnologe und Kulturwissenschaftler Michael Haberlandt beschwor
damals die Potentiale des neuen alltagstauglichen Verkehrsmittels [4]:
"Die Bewegung, welche das Zweirad in die civilisierte Menschheit gebracht hat, ist
heute schon ungeheuer und wird immer unübersehbarer. Sie ist, obwohl in ganz
anderem Sinne, nur mit der riesenhaften Verkehrsentfesslung (sic) zu vergleichen,
welche das Eisenbahnwesen gebracht hat."
Die Utopie einer Fahrradstadt um 1900 hat der Architekt und Designer Josef Urban in seinem
Entwurf einer „Rad-Stadt-Hoch-Bahn“ grafisch und kreativ umgesetzt [5]. Dabei zeichnete er
ein verschlungenes Radwegenetz auf Stelzen und mit repräsentativ gestalteten Stationsge-
bäuden, welches die Stadt als prägende Raumstruktur überziehen sollte (siehe Abbildung 31).
Das Aufkommen des alltagstauglichen Niederrades (auch Sicherheitsrad genannt) ab ca.
1890 löste in bürgerlichen Kreisen eine regelrechte Euphorie aus. Diese Begeisterung und die
große mediale Aufmerksamkeit werden verständlich, wenn man bedenkt, dass das Fahrrad zu
diesem Zeitpunkt das billigste Individualverkehrsmittel und vorübergehend gar das schnellste
Verkehrsmittel in der Stadt war. Zur Erinnerung: Die erste elektrische Straßenbahn fuhr in
Seite 70
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Wien erst ab 1897, die dampfbetriebene Stadtbahn ab 1898, das heißt, bis dahin herrschte in
Wien der animalische Betrieb in Form von Pferde-Omnibussen, Pferdetramway, Fiaker und
Einspänner vor. In diesem Umfeld bot das Fahrrad nun neue und ungeahnte Möglichkeiten
der räumlichen Mobilität – nicht zuletzt für Frauen.
Abbildung 31: Utopie einer „Rad-Stadt-Hoch-Bahn“ von Josef Urban, 1898, aus: Wiener Radfahr-
Club Künstlerhaus (Hg.); Radlerei! (Ausschnitt, Wien Museum).
Seite 71
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Die juristischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen fürs Stadtradeln sahen jedoch
anfangs weniger günstig aus. Die Behörden reagierten auf das neue Fahrzeug im Straßen-
verkehr zunächst mit zahlreichen Fahrverboten und Reglementierungen, die sukzessive erst
bis zur Jahrhundertwende aufgehoben wurden. Ab Mitte der 1880er Jahre hatte man einzelne
Straßen zum Radfahren freigegeben, allerdings mit verpflichtendem Lichtbildausweis, Num-
merntafel und Fahrprüfung. Man musste sich als Radfahrer/-in mit zum Teil recht komplizier-
ten Regeln herumschlagen: So waren enge und/oder verkehrsreiche Straßen wie z.B. die
Wiedner Hauptstraße bis zur Schleifmühlgasse oder die Alser Straße bis zum Gürtel von 7 bis
19 Uhr nicht befahrbar, am Ring durfte man beispielsweise nur in gewissen Abschnitten oder
in den Seitenfahrbahnen fahren [6]. Nichtsdestotrotz waren in Wien 1896 bereits rund 12.500
Erlaubnisscheine für Radfahrer/-innen ausgestellt. Die eigentliche Wende kam dann ein Jahr
später, als praktisch alle Straßen in Wien fürs Radeln freigegeben und die Erfassung der
Radbesitzer/-innen aufgegeben wurden [7]. Mit dieser Liberalisierung war nun das Fahrrad
formalrechtlich als vollwertiges Verkehrsmittel anerkannt.
Doch der Alltag im damals noch vergleichsweise wenig regulierten, aber stark zunehmenden
Straßenverkehr dürfte für die ersten Stadtradler/-innen nicht ganz einfach gewesen sein. Eine
Illustrierte etwa übertitelte ihren praxisnahen Bericht über das „Radfahrerleben in Wien“ mit
der Bezeichnung „Eingezwickt“ [8]. Insofern überrascht es nicht, wenn die Radfahrervereine
damals schon "Fahrrad-Trottoire" oder "Fahrradbanketts", wie Radfahrwege damals hießen,
forderten [9], wenn auch ihre Motive sich von den heutigen unterschieden: Der war der Si-
cherheitsaspekt weniger bedeutsam, in erster Linie ging es um die Bequemlichkeit der Rad-
fahrer/-innen (feingeschotterte Begleitwege an Stelle von Kopfsteinpflaster) und das ungestör-
te Vorankommen inmitten von meist langsameren Verkehrsmitteln. In der Tat entstanden
zwischen 1898 und 1913 in Wien innerhalb der heutigen Stadtgrenzen rund 40 km Radwege
[10]. Ein Infrastrukturumfang, der sowohl im damaligen internationalen Vergleich wie auch in
der lokalen Langzeitperspektive bemerkenswert ist [11]. Denn bis um 1980(!) hat sich an die-
ser Länge von Radverkehrsanlagen hierzulande kaum etwas geändert, zeitweise verfügte
Wien sogar über weniger Radwege. Die ersten Wiener Radverkehrsanlagen entstanden ent-
lang der neu ausgestalteten Gürtelstraße (siehe Abbildung 32) oder begleitend zu den Aus-
fallstraßen wie der Simmeringer Hauptstraße oder Triester Straße bzw. im Prater. Die dicht
besiedelte Stadt und den Alltagsverkehr hatte man damit also weniger angepeilt, vielmehr den
Freizeitverkehr. Errichtet wurden die Radwege hauptsächlich durch die Gemeinde und teilwei-
se sogar in Zusammenarbeit mit den Radfahrervereinen und vermutlich auch unter Beteili-
gung der NÖ-Statthalterei.
Das neue Verkehrsmittel Fahrrad sorgte in der Stadt aber auch für Konflikte und war nicht
selten in Unfälle verwickelt. Dabei erwiesen sich Radfahrer/-innen sowohl als Opfer wie auch
als Täter. Vor allem der spezifische Charakter des Velocipes als ein relativ geräuschloses
Verkehrsmittel war für andere Verkehrsteilnehmer – vor allem für Fußgänger/-innen – gewöh-
nungsbedürftig und in manchen Situationen eine neue Gefahrenquelle [12].
Seite 72
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 32: Querprofil der Gürtelstraße mit einem der ersten Wiener Radwege, 1905, aus:
Goldemund, H., Straßenwesen, S. 169.
Als Interessensvertretung der Radfahrer/-innen fungierten von Anbeginn an vor allem Vereine
verschiedenster Art. Allein in Wien gab es um die Jahrhundertwende mehrere Hundert Rad-
fahrervereinigungen. Neben bürgerlich-aristokratischen Klubs, die teilweise schon länger be-
standen, formierten sich ab 1893 auch die Arbeiterradfahrer und gründeten 1899 den landes-
weiten „Verband der Radfahrvereine Österreichs“ (später ARBÖ), die bald wichtigste
Interessensvertretung der Radfahrenden.[13] Einen wichtigen Unterstützer fand die neue Mo-
bilitätsbewegung in der Spitzenpolitik und in der Person des niederösterreichischen Statthal-
ters Erich Kielmansegg, der selbst ein leidenschaftlicher Radfahrer (gleichzeitig aber auch
Automobilist) war. Etwa vergleichbar mit einem heutigen Landeshauptmann war er auch für
Wien, das damals noch Teil Niederösterreichs war, zuständig. Die Aufhebung des Nummern-
zwanges und die Abschaffung der einst unerlässlichen Prüfung für Radfahrer/-innen wurden
auf seine Initiative zurückgeführt [14]. Eine Maßnahme, die aber wohlgemerkt zur gleichen
Zeit auch in zahlreichen anderen Städten durchgeführt wurde.
Diese Aufbruchsstimmung und der Boom um 1900 ums Fahrrad ist, wie schon angedeutet,
nicht nur von Mobilitäts- und Nützlichkeitsaspekten her zu betrachten, sondern auch als eine
Modeerscheinung und ein Teil von Lifestyle. Bis zum Ersten Weltkrieg verlor das Fahrrad al-
lerdings seine Exklusivität und seine ausschließliche Bedeutung als Sport- oder „Vergnüg-
nungsvehikel“. Die mediale Aufmerksamkeit ging daraufhin bald zurück und wendete sich dem
aufkommenden Automobil zu. In einem repräsentativen technischen Führer für Wien stellte
man 1905 lapidar fest [15]:
“Das Reitpferd und das Fahrrad kommen in Wien als Verkehrsmittel wenig in Be-
tracht.”
Doch die Zahl der Radfahrer/-innen in Wien nahm stetig zu. Dies wird nicht zuletzt durch die
steigende Zahl von Radunfällen ersichtlich [16]. In Wirklichkeit nutzten mehr und mehr Boten-
dienste, Ärzte oder die Post das neue Fahrzeug für ihre beruflichen und geschäftlichen Zwe-
cke.
1.2. Zwischenkriegszeit: Ignoranz und Restriktionen
Nach dem Ersten Weltkrieg bot sich in Wien grundsätzlich eine günstige Ausgangssituation
für die Verbreitung des Stadtradelns. Die Stadt war ab 1921 ein eigenes Bundesland gewor-
den und genoss dadurch mehr Gestaltungsmöglichkeiten auch in der Siedlungs- und Ver-
Seite 73
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
kehrspolitik. Zudem machte die fortschreitende Verbilligung der Preise das Fahrrad für weitere
Kreise der Arbeiterschaft und für kleine Angestellte erschwinglich. Nicht zuletzt übernahm die
Sozialdemokratie im Zeitraum 1918 bis 1934 die politische Macht im Rathaus. Wer jedoch
aufgrund der mittlerweile errungenen praktischen und symbolischen Bedeutung dieses Ver-
kehrsmittels für die Arbeiterbewegung vielleicht erwartet hatte, dass Wien nun bald zur „Rad-
fahrerstadt“ werde, wurde enttäuscht.
Denn im sogenannten „Roten Wien“ unterblieb der weitere Ausbau der Radinfrastruktur, und
überdies ließ man jede Art der Fahrradförderung im Alltag vermissen. Das Fahrrad spielte
lediglich für propagandistische, demonstrative Zwecke eine Rolle, so im Sport oder bei orga-
nisierten, feierlichen Aufmärschen der Arbeiterschaft [17]. Den Schwerpunkt kommunaler Zu-
wendungen bildeten damals bekanntermaßen Wohnbau und soziale Wohlfahrt. Im Verkehrs-
wesen setzte man vor allem auf den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und die Verbilligung
der Fahrpreise. Auf diese Weise wurde Wien bis Ende der 1920er-Jahre quasi zu einer „Stra-
ßenbahnstadt“. Die Grundsatzdebatte „Superblock“ versus Gartenstadt-„Siedlung“ wurde spä-
testens Mitte der 1920er-Jahre zugunsten der großen kommunalen Wohnhöfe entschieden.
Im Gegensatz hätten weitläufige Siedlungen am Stadtrand die Mobilität mittels Fahrrad be-
günstigt, während Großwohnanlagen in relativ zentralen Lagen leichter mit der Straßenbahn
zu erschließen waren [18]. Wie wenig Bedeutung dem Fahrrad in der damaligen kommunalen
Planung zukam, zeigt auch die Tatsache, dass die berühmten Gemeindebauten des „Roten
Wien“ in vorbildlicher Weise zwar Gemeinschaftseinrichtungen wie Zentralwaschanlagen,
Kindergärten, Gesundheits- und Bildungseinrichtungen enthielten, aber über keine Radab-
stellräume verfügten.
Und dennoch empfiehl der Arbeiter Radfahrer-Bund das Fahrrad („Das Stiefkind der Behör-
den“) als Zubringer zu den Straßenbahnen und forderte entsprechende Infrastrukturmaßnah-
men, konnte sich jedoch innerhalb der Partei offenbar nicht durchsetzen [19]. Die Forderung
nach dem Bau getrennter Radwege wurde allgemein lauter. Die Motivation hierfür war jedoch
bereits anders gelagert: Der sprunghaft angestiegene Lkw-Verkehr wurde in der Zwischenzeit
zu einer massiven Gefährdung für Radfahrer/-innen, Autofahrer wiederum empfanden die
Radfahrenden mehr und mehr als Hindernis. Das Sicherheitsbedürfnis machte die Entmi-
schung der unterschiedlichen Kategorien von Straßenbenützern offenbar zu einer infrastruktu-
rellen Voraussetzung fürs Radfahren. Radwegebau war (und ist) freilich nicht die einzige oder
immer die beste Möglichkeit, den Fahrradverkehr zu fördern [20]. Hierzulande kann er jedoch
aus Gründen einer traditionell eher normativ und territorial ausgeprägten Verkehrsmentalität
als zentraler Indikator für den kollektiven Umgang mit diesem Verkehrsmittel angesehen wer-
den. Die damalige Situation in Wien bilanzierten die Arbeiter-Radfahrer ernüchtert [21]:
„Es gibt ja auch kaum eine Großstadt, die so wenig den Bedürfnissen der Radfah-
rerschaft entgegenkommen würde, wie dies in Wien der Fall ist.“
Wiederholt verwies man auf Berlin, wo der Ausbau der Radwege trotz Wirtschaftskrise weiter-
ging [22]. Die Bestimmungen der neuen Straßenverkehrsordnung von 1930, welche unter
anderem die Benützungspflicht für Radwege (wieder) einführte, soll in Wiener Radfahrerkrei-
sen angesichts weitgehend fehlender Radwege eher nur für höhnische Kommentare gesorgt
haben [23].
Diesen Tatsachen zum Trotz lebt im kollektiven Gedächtnis – nicht zuletzt durch die ersten
einschlägigen historischen Abhandlungen genährt – das Bild einer „Radfahrerstadt“ im Wien
der Zwischenkriegszeit bis heute weiter. Demnach hätten damals die "Räder die Straßen do-
miniert" [24]. Dies mag in einigen anderen mittel-, west- oder nordeuropäischen Städten tat-
Seite 74
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
sächlich der Fall gewesen sein. Doch auf einen hohen Verkehrsanteil von Radfahrer/-innen in
Wien lässt sich aus den vorhandenen Quellen kaum schließen [25]. Verkehrszählungen im
heutigen Sinne gibt es erst ab 1925. Und lediglich um die Mitte der 1930er-Jahre zeigt sich
ein deutlicher Anstieg des Fahrradverkehrs in Wien [26]. Damals entstand jedoch kein media-
ler Hype um dieses Phänomen, da der Anstieg dieser Mobilitätsform diesmal eher aus der
Wirtschaftskrise und einem verschlechterten Angebot der Straßenbahnen resultierte und da-
her höchstens im negativen Sinn ein Ausdruck von „Lifestyle“ war. Im Vergleich zu manchen
deutschen Großstädten wie Berlin oder Hamburg (von Kopenhagen und Amsterdam ganz zu
schweigen) erzielte Wien immer noch geringe Radverkehrsdichten. Der Radverkehrsanteil
dürfte sich selbst am Höhepunkt der Entwicklung im Jahr 1937 erst im mittleren einstelligen
Prozentbereich – ähnlich wie heute – bewegt haben [27].
Abbildung 33: Ausweiskarte für Radfahrer/-innen mit Erläuterungen über die Fahrradabgabe,
1937 (Wien Museum).
Dieser kurze Boom des Stadtradelns um 1935 wurde jedoch – ähnlich anderen Städten in
Österreich [28] – von einer neuen Form von Reglementierung begleitet. Die mittlerweile
austrofaschistisch regierte Stadtverwaltung führte ab Juni 1937 erneut eine verpflichtende
Ausweiskarte und Fahrradkennzeichen ein. Hinzu kam eine Fahrradabgabe von 6 Schilling
pro Jahr. (siehe Abbildung 33) Das entsprach an sich nur einem Zehntel vom Wochenlohn
eines ungelernten Industriearbeiters, was aber unter den damaligen wirtschaftlichen Verhält-
nissen und Haushaltsbudgets mehr bedeutete als heute. Als Begründung für diese Maßnah-
men hatte man allgemeine fiskalische Argumente, die notwendige Identifizierung von Radfah-
rern bei Unfällen und auch die Zweckbindung der Abgabe für Radfahrwege angeführt.
Möglicherweise war ihre Einführung aber auch parteipolitisch motiviert, da vor allem die An-
hängerschaft der Sozialdemokratie davon betroffen war. Arbeitslose erhielten keine Ermäßi-
Seite 75
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
gung, und im ersten Entwurf sollten sogar Lasträder und damit Gewerbetreibende von der
Steuer ausgenommen werden [29]. Die sogenannte Fahrradsteuer war jedoch nur von kurzer
Dauer, bald nach dem Anschluss an das nationalsozialistische Deutschland wurde sie abge-
schafft.[30]
Dank der neuerlichen behördlichen Erfassung von Fahrrädern in Wien wissen wir, dass in der
zweiten Hälfte der 1930er-Jahre rund 140.000 Radfahrer – auch oder vor allem in der Stadt –
unterwegs waren. Im ständestaatlichen Wien entstanden auch die einzigen wenigen Radwe-
gebauten der Zwischenkriegszeit: entlang der Lasallestraße, der Triester Straße und der Wi-
entalstraße (letztere schon vor der Fahrradabgabe). Bezeichnenderweise führt das Statisti-
sche Jahrbuch der Stadt Wien aber erst ab 1939, also vermutlich nach reichsdeutschen
Vorgaben, Radwegelängen an. Und diese betrugen damals lediglich 32 Kilometer und damit –
obwohl aufgrund der Bauweise vermutlich nur bedingt vergleichbar – keineswegs mehr als
noch zu Zeiten der Monarchie [31]. Trotz einer insgesamt restriktiven Radverkehrspolitik wäh-
rend der Zwischenkriegszeit nahm also die Zahl der Radfahrer/-innen zu, das Fahrrad blieb
bis in die Nachkriegszeit das wichtigste Individualverkehrsmittel auch in Wien. Noch im Jahr
1947 waren fast 160.000 Fahrräder registriert [32].
1.3. 1955 bis 1975: Niedergang
Mitte der Fünfzigerjahre schätzte der ARBÖ den Anteil des Radverkehrs in Wien nur noch auf
ein Prozent. Damals begann der Motorisierungsgrad durch zunehmenden Automobil- und
Motorradbesitz rapide anzusteigen. Die Situation auf den Straßen spitzte sich zu, man sprach
vom „Schlachtfeld Straße“ [33]. Die Stadt wies österreichweit den größten Anteil der Rad-
fahrerunfälle auf, was großteils auf die Zunahme der Kollisionen mit Personenkraftwagen zu-
rückging (siehe Abbildung 34).
Die Österreichische Gesellschaft für Straßenwesen sprach sogar von einer "Verschärfung der
allgemeinen Verkehrslage in Wien" und plädierte für Verkehrsentmischung sowie erhöhte Si-
cherheit durch den Bau von Radverkehrsanlagen [34]. Selbst im Rahmen der international
besetzten 1. Wiener Straßenverkehrsenquete ging man davon aus, dass das Fahrrad auch
künftig ein wichtiges Straßenverkehrsmittel bleiben werde, und empfahl die Errichtung von
Radfahrwegen. Dadurch sollten Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrsablaufes im Interesse
aller Verkehrsteilnehmer erhöht werden [35]. Doch diese Vorschläge wurden in Wien in keiner
Weise befolgt. Im Gegenteil: Sogar die wenigen bestehenden Radwege (rund 50 km) mussten
der Verbreiterung der Fahrbahn und damit dem motorisierten Verkehr weichen. So entstand in
der ersten Hälfte der 1950er-Jahre auf dem Westgürtel die „erste moderne Betonstraße“
Wiens [36], indem man die Fahrbahnen erneuerte bzw. verbreiterte und aus diesem Grund
den noch aus der Monarchie stammenden Zweirichtungsradweg entfernte. Das heißt, dass
man zeitgleich mit einer rapide zunehmenden Motorisierung und ungeachtet der hohen Un-
fallzahlen in Wien das Radwegenetz bzw. seinen Ausbau zur Gänze aufgab und dadurch dem
städtischen Radverkehr praktisch die Grundlage entzog. Selbst wer nicht auf Auto oder Mo-
ped umsteigen konnte oder wollte, wurde somit vom Radfahren in der Stadt abgehalten. Das
Fahrrad wurde somit nicht nur durch die Konkurrenz des motorisierten Verkehrs aus dem
Straßenbild verdrängt, sondern auch infolge struktureller Gewalt.
Seite 76
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 34: Diagramm über Radweglängen, Unfälle mit Beteiligung von Radfahrer/-innen und
MIV-Quotient in Wien 1946-1970 (erstellt von Békési, S.; Quelle: Statistische Jahrbücher der
Stadt Wien).
In den Zukunftsentwürfen und Technikvisionen der Wiener Nachkriegszeit hatte das muskel-
getriebene Zweirad offensichtlich keinen Platz. Dem Fahrrad haftete bereits der Makel der
körperlichen Anstrengung und das Image des „Arme-Leute“-Vehikels an. In den programmati-
schen Schriften zu Stadtplanung und Verkehrspolitik scheint dieses Verkehrsmittel nur am
Rande und mitunter als bloßes Verkehrshindernis auf [37]. Das Leitbild war vielmehr die neue
autogerechte Stadt amerikanischer Prägung. In dieser hatten sich Fußgänger wie öffentlicher
Verkehr den Bedürfnissen des steigenden Autoverkehrs anzupassen. Das Fahrrad mutierte
für Jahrzehnte zum ausschließlichen Kinderspielzeug und Sportgerät. Die Diskriminierung und
der niedrige Stellenwert dieses Verkehrsmittels lassen sich auch an manchen Alltagspraktiken
ablesen: So waren Autoparkplätze im Wiener Stadionbad damals gratis, während Kinder für
ihre Fahrräder Abstellgebühr bezahlen mussten [38].
Können wir für die sozialistische Kommunalpolitik Wiens in der Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen noch mit Einschränkungen geltend machen, dass sie sich einseitig auf die Förde-
rung des öffentlichen Verkehrs konzentrierte und aus diesem Grund den Radverkehr vernach-
lässigte, so lässt sich für die fünfziger und sechziger Jahre nicht einmal dies behaupten. Denn
gleichzeitig mit der Fahrradinfrastruktur wurde auch das Angebot der öffentlichen Verkehrsmit-
tel zurückgeschraubt. Bis 1970 reduzierten die Wiener Verkehrsbetriebe ihre Fahrleistung pro
Stadtbewohner/-in auf den Stand der frühen zwanziger Jahre [39]. Der Weg war nun für das
Automobil frei.
Seite 77
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
1.4. 1975 bis 2010: Renaissance und verhaltene Förderung
Die realen Auswirkungen dieses Verdrängungsprozesses einer muskelgetriebenen Verkehrs-
technologie lassen sich sehen: Das Fahrrad verschwand praktisch aus dem Straßenbild. Die
Radwegelängen schrumpften bis Mitte der siebziger Jahre auf den historischen Tiefstand von
11 Kilometern [40]. Ende der 1970er Jahre entfielen in Wien 0,4 Prozent Radwege auf das
Straßennetz. Im Vergleich betrug dieser Anteil in München, Frankfurt oder Hamburg zu dieser
Zeit rund 20 %. Der starke Rückgang im Radverkehr zwischen 1950 und 1970 ist an sich nicht
Wien spezifisch, vielmehr die extrem niedrige Talsohle, die damals erreicht wurde [41].
Doch durch die Sensibilisierung der Gesellschaft für Ökologie- und Umweltfragen trat allmäh-
lich auch in Wien ein Image-Wandel des Fahrrades ein. Die Wende kam ab Mitte der 1970er-
Jahre sozusagen „von unten“ mit den ersten Radfahrer/-innen-Demonstrationen (siehe Abbil-
dung 35). Die 1979 gegründete „Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr“ (AR-
GUS) stellte nach langer Zeit wieder die erste konsequente Interessensvertretung für Radfah-
rer/-innen in Wien dar [42]. Als Reaktion darauf setzte auch bei den Stadtverantwortlichen
bald ein Umdenken ein. Im Wiener Verkehrskonzept von 1980 wurde die Förderung des Rad-
verkehrs auf der Planungsebene erstmals normativ festgelegt. Ein Ausbau der Radinfrastruk-
tur mit über 800 Kilometer Radverkehrsanlagen bis zur Jahrtausendwende sowie Hunderten
von Abstellanlagen in der ganzen Stadt folgten. Weitere wichtige Stationen dieses erneuten
Aufschwungs waren die Einbindung von ARGUS in die Planungen und die Einrichtung eines
Radwegkoordinators beim Magistrat oder nicht zuletzt die StVO-Novelle 1988 (Radfahren
gegen die Einbahn wurde möglich – vorher schon in Graz eingeführt – oder die Bestimmung,
wonach ein geschobenes Fahrrad als Fahrzeug galt, abgeschafft). Ab 2002 wurden sukzessi-
ve städtische Leihfahrräder installiert, ab 2006 begann die Initiative Critical Mass, mit regel-
mäßigen, demonstrativen Radler-Rundfahrten den Straßenraum auch symbolisch zurückzu-
erobern [43].
Doch von einem Durchbruch in der Radverkehrspolitik und in der Fahrradnutzung können wir
in Wien in diesem Zeitraum nicht sprechen. Denn erst nach 1990 erreichte das Wiener Rad-
wegenetz (bestehend aus Radwegen, Radfahrstreifen und Radrouten) jenen Stand, den deut-
sche Großstädte im Durchschnitt bereits in den siebziger Jahren aufwiesen [44]. Beim Rad-
verkehrsaufkommen bildete Wien im Vergleich mit anderen Landeshauptstädten oder struk-
turell vergleichbaren Großstädten im Ausland vor kurzem noch das Schlusslicht. Während in
Graz, Innsbruck oder Salzburg durchschnittlich jeder siebente bis sechste Weg mit dem Rad
zurückgelegt wird – ähnlich in München, Berlin oder Hamburg – verwendet man in Wien ledig-
lich fast nur für jeden 20. Weg das Fahrrad [45]. Dieser Befund überrascht aber nicht, wenn
wir uns die Ausgaben der Stadt Wien im Zusammenhang mit Fahrradverkehr vor Augen füh-
ren. Diese bewegten sich nämlich im deutschsprachigen Vergleich eindeutig im unteren Be-
reich und betrugen in der Zeit 1986-1999 durchschnittlich 1,5 Millionen EUR im Jahr, das
heißt, weniger als einen(!) EUR pro Kopf [46]. Während der Anteil des Radverkehrs in der
Stadt – nach rund 30 Jahren Förderung – um lediglich fünf % herum stagnierte, war die ein-
schlägige Öffentlichkeitsarbeit der Stadt gleichzeitig von einer kaschierenden Erfolgsrhetorik
und bloßer Ankündigungspolitik geprägt. Das Ausbleiben der anvisierten Zuwächse blieb
meist ohne Folgen, mutige Maßnahmen mit Signalwirkung wurden nicht unternommen.
Seite 78
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 35: Radfahrer/-innen-Demonstration Praterstraße/Ringstraße/Rathausplatz mit der
Forderung nach Radwegen in Wien, 9. Juni 1979 (Foto: P. u. W. Hirsch, Wien Museum).
Als besonders problematisch gilt in Wien nicht nur die geringe Quantität, sondern auch die
fragwürdige Qualität des Radwegebaues. Bis heute gibt es in Wien kein flächendeckendes
Radwegenetz: wichtige Radialrouten und „Hochleistungskorridore“ fehlen, zudem weist das
Netz teilweise große Lücken auf. So ist etwa in Wien-Brigittenau zwischen Augarten – Brigit-
tenauer Lände – Leipzigerstraße und Nordwestbahnstraße oder in Wien-Favoriten zwischen
Triesterstraße – Raxstraße – Landgutgasse und Ettenreichgasse (in einem Gebiet von der
Größe der Bezirke 7. und 8. zusammen) noch immer keine wie auch immer geartete Radver-
kehrsanlage vorhanden [47]. Zudem gingen neuere Konzepte der Fahrradförderung bereits
um 1990 von der strikten Trennung der verschiedenen Verkehrsarten wieder ab und verfolg-
ten eine Vermischung mit dem Kfz-Verkehr bei gleichzeitiger Verkehrsberuhigung [48]. Davon
war aber in Wien nicht viel zu sehen. Hierzulande baute man weiterhin bevorzugt gemeinsa-
me Geh- und Radwege, deren Anlage häufig lediglich darin bestand, bestehende Gehsteige
bloß durch Markierungen zweizuteilen. Auf diese Weise ging die Errichtung von „Radverkehrs-
infrastruktur“ vielfach auf Kosten der schwächsten Verkehrsteilnehmer, nämlich der Fußgän-
ger/-innen.[49] Das folgende Zitat aus der Steiermark aus dem Jahr 1996, teils Tatsachen-
feststellung, teils Programmatik, lässt sich ohne weiteres auf die Wiener Radverkehrspolitik
der letzten Jahrzehnte übertragen [50]:
„Bisher haben wir Glück gehabt. Wir haben Radrouten dort angelegt, wo es wirk-
lich relativ einfach war, weil wir dort niemanden verdrängen mussten. Und wenn
jemand verdrängt wurde, war es der Fußgänger. Aber jetzt geht es ans Einge-
machte. Jetzt geht es an die Reviere der Autofahrer.
Eine wenig bekannte und in manchen statistischen Darstellungen ausgeblendete Tatsache ist,
dass der ohnehin verhaltene Radverkehrsanteil in Wien seit ca. 1980 keineswegs kontinuier-
lich gewachsen war. Während dieser in der zweiten Hälfte der 1990er-Jahre vier Prozent be-
Seite 79
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
trug, halbierte er sich bis 2002, um bis heute wieder auf 5 - 6 Prozent anzuwachsen [51]. Das
bedeutet, dass wir es hier mit einem nur wenig gefestigten Verkehrsverhalten und mit einer
durchaus sensiblen Entwicklung zu tun haben, die bei nicht entsprechenden Maßnahmen
leicht Rückschläge erleiden kann.
Insgesamt zeigt sich also in einer Langzeitbetrachtung, dass hierzulande die Potentiale des
Fahrrades als innerstädtisches Verkehrsmittel bislang nur wenig genutzt wurden. Wien wurde
nie zu einer „Radfahrerstadt“. Wenn, dann höchstens um 1900 fiel die Stadt mit einem für da-
malige Verhältnisse intensiven Radwegebau auf. Die eingangs zitierten Prophezeiungen und
großen Erwartungen von damals haben sich kaum bewahrheitet. Das Fahrrad hat die Stadt –
zumindest in Wien – nicht verändert (höchstens durch die Präsenz mancher Radwege und
Abstellanlagen), das Leben in der Stadt ist dadurch nur wenig geprägt. Viel versprechende
Ansätze wie die „autofreie Siedlung“ in Wien-Floridsdorf blieben punktuelle Pionierprojekte
ohne Breitenwirkung [52]. Dies liegt jedoch nur zum Teil an der Konkurrenz durch das Auto-
mobil. Eine offensive Radverkehrsförderung und entsprechende Verkehrspolitik ist in Wien im
Laufe der letzten rund hundert Jahre praktisch zu keinem Zeitpunkt festzustellen. Die Ver-
nachlässigung des Fahrrades als innerstädtisches Alltagsfahrzeug hat somit in der Donau-
Metropole eine lange Tradition.
2 Bestimmungsfaktoren der Verkehrsgenese
Wie läßt sich nun der traditionelle Wiener Weg einer schwachen Förderung beziehungsweise
Nutzung des Fahrrades im innerstädtischen Verkehr erklären? Die möglichen Gründe, warum
sich ein bestimmtes Verkehrsmittel in einer Stadt mehr oder minder durchsetzt, sind komplex.
Verkehrsgenese und Verkehrsverhalten werden noch immer als nicht zur Gänze erklärbar
erachtet [53]. Akteure und Akteurinnen im Verkehrsgeschehen sind in ein vielfältiges und spe-
zifisches Geflecht von physischen, sozioökonomischen, politischen und kulturellen Rahmen-
bedingungen eingebettet. Im Folgenden sollen einige dieser primären oder sekundären Be-
stimmungsfaktoren kurz erläutert und es soll versucht werden, ihre mögliche Relevanz für
unsere Fragestellung auszuloten.
2.1. Physische Gegebenheiten
Die relativ schwache historische Präsenz dieses Verkehrsmittels in Wien wird gern mit der
Ungunst des Terrains begründet, die vom einstigen, berüchtigten Kopfsteinpflaster bis zum
hügeligen Relief und der ungünstigen Witterung reicht. In der Tat zeigt der Radverkehr in
Wien eine starke Abhängigkeit von den Wetterverhältnissen, vor allem bei anhaltendem Re-
gen oder winterlichen Verhältnissen. Ein möglicher Grund dafür wird in den relativ großen
Weglängen gesehen. Denn im Unterschied zu klassischen „Radfahrerstädten“ mit ca. drei
Kilometern beträgt die durchschnittliche Distanz, die in Wien mit dem Fahrrad zurückgelegt
wird, um die vier Kilometer [54]. Doch ein solcher kausaler Zusammenhang sollte nicht über-
schätzt werden und könnte außerdem erst einigermaßen plausibel behauptet werden, wenn
der Fahrradverkehr trotz intensiver Fördermaßnahmen (etwa in Form von günstigen Mitnah-
memöglichkeiten in öffentlichen Verkehrsmitteln, geräumten Radwegen bei Schneelage usw.)
nicht in Gang kommen sollte. Aber im Gegenteil: Man nutzte solche Argumente vermutlich in
legitimatorischer Absicht häufig eher dazu, den Fahrradverkehr nicht zu fördern. In Wirklich-
keit ist der physische beziehungsweise natürliche Standortnachteil Wiens hinsichtlich Klima
und Morphologie auf verkehrsplanerischer Ebene längst kein relevantes Thema mehr [55].
Auch in internationalen Vergleichsstudien vermögen solche, letztlich geodeterministischen
Ansätze nur eingeschränkt die Unterschiede in der Fahrradnutzung zu erklären [56].
Seite 80
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Relevanter scheint das Argument mit anderen raumstrukturellen Faktoren wie etwa Sied-
lungsdichte und Siedlungsstruktur zu sein. Wien ist (immer noch) eine relativ kompakte, nicht
zu große Stadt mit einer hohen Nutzungsmischung. All das kommt einer Erschließung durch
öffentliche Verkehrsmittel oder durch das Fahrrad entgegen – aber auch dem Zufußgehen. In
der Tat wurden in Wien bis um die Mitte des 20. Jahrhunderts, als für viele das Geld für den
Fahrschein oder gar für ein eigenes Fahrrad noch häufig fehlte, auf dem Weg in die Arbeit
oder zu Freizeitdestinationen selbst lange Wegstrecken zu Fuß zurückgelegt. Sogenannte
„gewachsene Stadtstrukturen“ mit verhältnismäßig engen Straßenbreiten können andererseits
für den Ausbau von Radverkehrsanlagen hinderlich sein, respektive man ist mehr dazu ange-
halten, Prioritäten zwischen motorisiertem Individualverkehr und dem Radverkehr zu treffen.
So gesehen erscheinen diese raumstrukturellen Faktoren insgesamt ebenfalls nur bedingt
geeignet, die Besonderheiten der Wiener Radverkehrsentwicklung zu erklären. Gleichzeitig
sind sie bereits vielfach mit sozio-ökonomischen Faktoren verwoben.
2.2. Sozio-ökonomische Rahmenbedingungen
Die Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln hängt wesentlich von ihrer Leistbarkeit ab. Vor allem im
Wien der Zwischenkriegszeit dürfte die besonders schlechte ökonomische Lage und die ge-
ringe Kaufkraft der Bevölkerung den Erwerb eines Fahrrades in Wien – zumal für die Arbeiter-
schaft als potentiellen Hauptnutzer – erschwert haben, und die relativ geringe Radfahrerdichte
schon im damaligen Vergleich etwa mit Deutschland, Dänemark oder Holland mit erklären.
Zudem war Wien von ihrer Bevölkerungsgröße her seit den 1920er Jahren für lange Zeit eine
schrumpfende oder stagnierende Stadt. Und eine hohe Altersstruktur ist für die Verbreitung
einer muskelgetriebenen Fortbewegungsart bekanntermaßen nicht gerade förderlich. Was
dieses Argument wiederum abschwächt: Dieses demographische Merkmal teilt Wien mit an-
deren österreichischen Landeshauptstädten, die gleichzeitig ein deutlich höheres Radver-
kehrsaufkommen verzeichnen [57].
2.3. Technologie und Konkurrenz von Verkehrsmitteln
Das Fahrrad war als Niederrad mit Luftbereifung bereits in den 1890er-Jahren als Verkehrs-
mittel technisch im Wesentlichen ausgereift. Seit dem sind seine verkehrstechnischen Poten-
tiale weiter ausgebaut und verbessert worden. So können etwa Steigungen mit moderneren
Fahrrädern wesentlich leichter bewältigt werden. Das Fahrrad eignet sich vor allem für die
schnelle Überwindung kurzer Distanzen (bis 5 km), die gerade in einer Großstadt zwei Drittel
aller Wege ausmachen. All das würde also eine stärkere Nutzung dieses Verkehrsmittels in
einer relativ kompakten Stadt wie Wien nahe legen. Dass dies nur sehr eingeschränkt zutrifft,
muss also andere als technologische Gründe haben.
Jedes Verkehrsmittel steht mit anderen auch in einem Konkurrenzverhältnis. Dieser Wettbe-
werb ist vielfach durch das jeweilige Mobilitätsangebot, den Preis, die Verfügbarkeit, aber
auch durch nicht-materielle Aspekte wie Symbolkraft oder Prestige eines Fahrzeugs bedingt.
Dabei lässt sich zwischen direkter und indirekter Konkurrenz unterscheiden, die wiederum
jeweils hinsichtlich Nutzergruppen, Raumanspruch oder Fördervolumen betrachtet werden
kann. Eine unmittelbare Konkurrenz zwischen verschiedenen Fortbewegungsarten ist etwa
gegeben, wenn man dabei direkt das Verkehrsmittel wechselt und in der täglichen Praxis zum
Beispiel vom öffentlichen Verkehr auf das Fahrrad „umsteigt“ oder umgekehrt. Ein solches
Verhältnis ist zwischen Fahrrad- und Pkw-Nutzung seltener gegeben. Diese konkurrieren mit-
einander vielmehr einerseits direkt um ihren Platz im Straßenraum und andererseits indirekt
um ihren Stellenwert in der Verkehrspolitik.
Seite 81
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Eine direkte Konkurrenz zwischen Automobil und Fahrrad im Straßenraum taucht relativ spät
auf. Um 1900 nahm die Zahl der Radfahrenden trotz der beginnenden Verbreitung des Auto-
mobils weiter zu, lediglich die Elite stieg (in einer anderen Form direkter Konkurrenz) nach und
nach auf das nunmehr prestigeträchtigere Automobil um. Zu einem wichtigen Konkurrenten
für das Fahrrad im motorisierten Individualverkehr wurde ab der Zwischenkriegszeit das Mo-
torrad und erst nach 1945 das Automobil auf eine Weise, wie wir sie heute kennen. Konkur-
renz bekam das Fahrrad aber zuweilen auch durch Bim und Bus. Mobilitätszuwächse im Wien
der Zwischenkriegszeit, die aus der zunehmenden Entfernung zwischen Wohn- und Arbeitsort
resultierten, absorbierte zunächst vielfach der öffentliche Verkehr.
Verschiedene Verkehrsmittel und Fortbewegungsarten können aber miteinander nicht nur
konkurrieren, sondern sich auch ergänzen oder gar in einem kooperativen Verhältnis zuein-
ander stehen. Letzteres wird etwa im sogenannten Umweltverbund, einem jüngeren Begriff
aus der Verkehrsplanung, angestrebt. Die meisten Wege in der Stadt setzen sich ohnehin aus
einer Kombination diverser Mobilitätsformen zusammen. Doch die Möglichkeiten eines kombi-
nierten Verkehrs zwischen dem nicht-motorisierten Individualverkehr (vor allem Fahrrad) und
dem öffentlichen Verkehr wurden in Wien bislang kaum genutzt bzw. gefördert. Wie schon
erwähnt, schlug der ARBÖ bereits um 1930 das Fahrrad als Zubringer zu den Straßenbahnen
vor. Eine Mitnahme von Fahrrädern in der Straßenbahn oder in Autobussen ist – im Unter-
schied zu manchen anderen Städten – bis heute nicht erlaubt und in der zweiten Garnituren-
generation der U-Bahn noch weniger(!) als vorher möglich. Seitens der Verkehrsbetriebe sieht
man in Radfahrer/-innen traditionell meist einen Störfaktor und keinen potentiellen Partner.
Man verweist immer wieder gern auf den relativ hohen Anteil des öffentlichen Verkehrs (ÖV)
in Wien, wenn es darum geht, warum die Stadt nicht mehr Mittel für die Förderung des Fahr-
radverkehrs aufwendet. Gleichsam nach der Logik: Wir haben einen hohen ÖV-Anteil, des-
wegen fahren in Wien nur wenige mit dem Fahrrad, aber wir brauchen ohnehin nicht mehr
Radverkehr, weil wir eine gute Versorgung mit U-Bahn und Straßenbahn haben. Dabei könn-
ten wir uns fragen, inwieweit die starke Benützung des öffentlichen Verkehrs in Wien praktisch
erzwungen ist, weil die Rahmenbedingungen für das Radfahren unattraktiv sind. Zudem stellt
sich die Kosten- und Kapazitätsfrage. Denn jeder per Fahrrad zurückgelegte Kilometer käme
der Kommune billiger als ein Straßenbahn- oder gar U-Bahnkilometer. Und nicht zuletzt könn-
te der Fahrradverkehr in den nächsten Jahren dazu beitragen, den ÖV in Wien zu entlasten,
der angesichts des anhaltenden Bevölkerungswachstums und des Wandels des Modal Splits
zugunsten dieser Mobilitätsform voraussichtlich bald an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen wird.
2.4. Politik und Planung
Kommen wir nun zu möglichen politischen Faktoren in der Verkehrsgenese. Eine Besonder-
heit bildet ja hierzulande die langjährige stadtpolitische Hegemonie einer einzigen Partei. Eine
Tatsache, die an sich schon Paradigmenwechsel und Experimente vermutlich nicht gerade
fördere. Ohne eine enge Korrespondenz zwischen einer bestimmten politischen Richtung und
der jeweiligen Radverkehrspolitik voraussetzen zu können [58], stellt sich angesichts der eins-
tigen hohen symbolischen Bedeutung des Velocipeds für die Arbeiterkultur allerdings die Fra-
ge, wie sich dies in der tatsächlichen Radverkehrspolitik sozialdemokratischer Stadtregierun-
gen in Wien niederschlug. Noch bis in die Fünfzigerjahre bildeten etwa Arbeiter-Radfahrer/
-innen einen unerlässlichen Teil der feierlichen Aufmärsche vor dem Rathaus. Indes wurde
der „proletarische Drahtesel“, abgesehen vom Fahrradsport, bereits vom „Roten Wien“ wäh-
rend der Ersten Republik als Verkehrsmittel praktisch ignoriert. Die Stadt setzte ähnlich wie in
der Siedlung- und Wohnbaupolitik offenbar auch hier eher auf zentralistische Lösungen [59].
Und diesen stand das tendenziell individualistische und anarchische Verkehrsmittel Fahrrad
Seite 82
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
wohl entgegen.
Dass auch nach 1945 auf der Angebotsseite zu wenig für den Fahrradverkehr geschah, dürfte
neben dem planerischen und verkehrspolitischen Paradigma einer autogerechten Stadt eben-
so mit dem Nachlassen seiner Interessensvertretung zu tun haben. Die bis dahin wichtigste
Radfahrerorganisation ARBÖ entwickelte sich im Laufe der 1950er-Jahre endgültig zum Lob-
byisten des motorisierten Verkehrs. Zwar wurde wiederholt auch vom ARBÖ der Bau von
Radwegen gefordert. Dabei ging es jedoch bald weniger um den Schutz von Radfahrenden,
sondern immer mehr um die Interessen des Gesamtsystems Verkehr [60]. Und in diesem
diente die Entflechtung des Verkehrs im Endeffekt eher den Autofahrern, indem sie die Fahr-
bahn von langsameren Verkehrsteilnehmern frei machte [61].
Doch die Entwicklung zur praktisch fahrradfreien Stadt war nicht alternativlos. Denn etwa in
West-Deutschland, wo sich die Stadt- und Verkehrsplanung in der Hauptsache ebenfalls dem
Automobilismus verschrieb, schloss der Straßenbau die Anlage von begleitenden Radwegen
nicht aus.[62] In Wien übernahm man allerdings den deutschen Radwegebau trotz Empfeh-
lung in- und ausländischer Experten – wie wir gesehen haben – nicht [63].
Verkehrsentwicklung lässt sich daher nicht nur mit stummen Sachzwängen und unbeeinfluss-
baren technisch-ökonomischen Faktoren erklären. Eine häufige Form von Determinismus ist
der mehr oder weniger explizite Hinweis auf die (scheinbar) unbeeinflussbare Eigendynamik
der Motorisierung. Doch das Verschwinden des Fahrrades aus dem Stadtverkehr ab den
Fünfzigerjahren lässt sich nicht linear aus der Motorisierungswelle und aus der Ideologie der
"autogerechten Stadt“ erklären. Trotz übergreifender Trends gab es auch damals Hand-
lungsoptionen für lokale Politik und Verwaltung: so etwa bei den Mitteln für Straßenbau, bei
der Parkraumbewirtschaftung usw. So gesehen war das Verdrängen des Fahrrades aus dem
Straßenverkehr auch eine Folge von Planungsstrategien sowie – direkt oder indirekt – von
Verkehrspolitik: z.B. durch das Herunterfahren des öffentlichen Verkehrs, durch eine Sied-
lungspolitik, welche die Entmischung und Entdichtung der Stadt vorantrieb usw. Ebenso war
das Fachwissen um die Vorteile des öffentlichen Verkehrs vorhanden, gleichzeitig gab es
auch schon öffentliche Kritik und Widerspruch gegen die sog. Zwangsmobilität und die hohen
Kosten der Automotorisierung. Im Sinne einer kontrafaktischen Geschichte [64] können wir
also fragen, welche Weichenstellungen auf welcher Wissensbasis und zu wessen Interessen
vorgenommen worden waren, und ob es nicht auch andere plausible Möglichkeiten gab. Kon-
kret gefragt: Hätte man bei entsprechenden Maßnahmen die Praxis des städtischen Radfah-
rens nicht in die Zeit nach der Energiekrise 1973 – zumindest für bestimmte Benutzergruppen
– hinüberretten können? Hätte dadurch die Fahrradrenaissance und Förderung um 1980 nicht
auf einem anderen Niveau einsetzen können? Hätten wir heute dadurch nicht möglicherweise
eine positivere Einstellung anderer Verkehrsteilnehmer/-innen gegenüber Radfahrenden? So
ist aber davon auszugehen, dass die komplette Verdrängung des Fahrrades aus dem Stra-
ßenverkehr – im Unterschied etwa zu Deutschland – zur Festigung und Verstärkung von
"fahrradfeindlichen" Attitüden bei Verkehrsplanern wie bei Verkehrsteilnehmer/-innen beitrug,
dessen Folgen die Stadt heute noch trägt.
Es gab in Wien im Laufe der letzten hundert Jahre keinen einflussreichen Planer oder Archi-
tekten, der sich für diese Fortbewegungsart besonders eingesetzt hätte. Somit fehlt hier –
abgesehen vom ersten Boom um 1900 – der wichtige Faktor Vorbildwirkung. Für die kulturelle
oder politische Elite in Wien war und ist das Fahrrad kaum ein Thema. Von den Spitzenpoliti-
kern waren es bis jetzt nur wenige gewesen, die sich öffentlich fürs Radfahren in der Stadt
engagierten oder gar selbst in die Pedale traten: So der bereits erwähnte niederösterreichi-
Seite 83
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
sche Statthalter Hermann Kielmansegg, Vizebürgermeister Erhard Busek oder Bürgermeister
Helmut Zilk.
Positive Wechselwirkungen zwischen Verkehrsangebot und -nachfrage sind vielfach belegt.
So konnten auch in Städten wie Paris oder Barcelona, die lange Zeit nicht gerade als Hoch-
burgen des Stadtradelns galten, in jüngster Zeit bemerkenswerte Radverkehrszuwächse er-
zielt werden. Trends wie einer sich selbst verstärkenden Negativspirale oder negativen Rück-
kopplungen kann eine entsprechende (Verkehrs)Politik also durchaus gegensteuern. Die
möglichen Maßnahmen sind freilich auch von den jeweiligen, mehr oder minder günstigen
Rahmenbedingungen abhängig [65]. Aber es kann, wie wir gesehen haben, sogar Phasen in
der Geschichte geben, in denen die Fahrradnutzung trotz politischer Restriktionen und Dis-
kriminierung wächst.
2.5. Kulturelle Faktoren: Image, Werthaltung, Tradition
Für die relativ schwache historische Präsenz des Fahrrades in Wien scheinen vordergründig
und unmittelbar die Konkurrenz mit dem öffentlichen Verkehr, mancher sozio-ökonomischer
Faktor und nicht zuletzt die Vernachlässigung seitens der Planung und der (Verkehrs)Politik
ausschlaggebend zu sein. Vor allem letztere könnte aber auch mit einer tiefer liegenden Ur-
sache, nämlich mit dem Image des Fahrrades in der Gesellschaft zu tun haben. Und dieses
scheint speziell in Wien nur wenig positiv ausgeprägt zu sein.
Einen möglichen Ansatz für die Entstehung und Wirkungsweise solcher kollektiven Denkmus-
ter bietet das Konzept von der Eigenlogik oder vom Habitus der Städte. Demnach verdichten
sich lokalspezifische Besonderheiten, die sich aus der Geschichte herleiten, zu einem Wahr-
nehmungs- und Handlungsschema und damit zu einem organisierenden Prinzip, das nicht
zuletzt in Geschmackspräferenzen und sozialen Konventionen wirksam wird. Derart bildet sich
eine spezifische Eigenlogik als dominantes Muster politischen Handelns in Institutionen und
Akteursnetzwerken heraus, das so auch das Handeln von Individuen und weiteren Gruppen
beeinflusst [66].
So mag auch die traditionelle Distanz der Wiener Sozialdemokratie zum Fahrrad in der Stadt
zunächst mit ideologischen Ursachen zu tun haben. Um die Jahrhundertwende von 1900 gab
es zwar noch führende Sozialdemokraten, die im Alltag Rad fuhren, so Victor Adler, Engelbert
Pernerstorfer oder Friedrich Austerlitz. In dieser Zeit verwendete auch Franz Schuhmeier,
einer der ersten sozialdemokratischen Gemeinderäte Wiens, das Fahrrad, um aufs Land zu
fahren und für die Sozialdemokratie und die sozialistische Idee zu werben [67]. Die meisten
dieser Persönlichkeiten waren allerdings um 1920, als die Zeit für das „Rote Wien“ anbrach,
bereits tot. Zudem hatte die Sozialdemokratie bereits früh begonnen, sich kulturell an bürgerli-
chen Normen zu orientieren. Zwischen sozialistischer Führung und Basis entstand eine deutli-
che Distanz, eine austromarxistische Gegenkultur scheiterte [68]. Und diese ideologisch be-
dingte Distanz zum muskelgetriebenen Zweirad verdichtete sich in der Folge zu einer
wirkmächtigen Tradition.
So können wir im Hinblick aufs Radfahren in der Stadt und im Kontext vergleichbarer deut-
scher, niederländischer oder dänischer Städte insgesamt von einem Wiener Sonderweg und
von der Tradition einer nur wenig fahrradaffinen kollektiven Eigenlogik sprechen. Doch damit
sollen gegebene Verhältnisse nicht essentialistisch festgeschrieben werden. Ein ortsspezifi-
scher Habitus mag zwar über eine bemerkenswerte Persistenz verfügen, ist aber als ein Pro-
dukt von Geschichte grundsätzlich veränderbar [69].
Seite 84
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
In diesen Komplex gehören aber auch die Faktoren Lifestyle und Mode, welche die Verbrei-
tung und Akzeptanz eines Verkehrsmittels nicht unwesentlich beeinflussen können. Ohne sie,
das heißt, den symbolischen Mehrwert eines Fahrzeugs über den praktischen Verkehrsnutzen
hinaus, wäre der erste Wiener Fahrradboom um 1900 ebenso wenig zu verstehen wie der
gegenwärtige. Derzeit ist ja zu beobachten wie ein schickes Fahrradfachgeschäft nach dem
anderen aufmacht, und das nicht nur in den günstigeren Vorstadtbezirken, sondern selbst in
den besten Lagen der Innenstadt. Doch solche Modewellen können recht kurzlebig sein. So
ist zu befürchten, dass auch in Wien, sollten infrastrukturelle und andere Maßnahmen nicht
eine entsprechende Basis fürs Alltagsradeln schaffen, der durch Lifestyle-Faktoren mit ausge-
löste, relative Fahrradboom bald wieder verschwinden wird.
Quellen
[1] Vgl. Hachleitner, B. et al. (Hg.); Motor bin ich selbst. 200 Jahre Radfahren in Wien, Wien
2013; Zappe M. et al.; Wiener Mechanikerräder. Eine Rundfahrt durch mehr als 100
Wiener Fahrradmarken 1930–1980 (Österreichische Technikgeschichte; 2) Purkersdorf
2013; Békési, S.; Fahr-Rad in Wien? Zum historischen Verhältnis von Stadt und muskel-
getriebenem Zweirad, in; Dérive. Zeitschrift für Stadtforschung, Heft 13, 2003, S. 21-26.
[2] Baxter, S.; Economic and social influences of the bicycle, in: Arena v. 6 (October 1892)
p. 578-83, zit. n. Herlihy, D.V.; Bicycle. The History, New Haven and London, 2004,
p. 259.
[3] Herzl, Th.; Radfahren, in: Neue Freie Presse, 1. Nov. 1896, S. 1-4, hier S. 3.
[4] Haberlandt, M.; Das Fahrrad, in: Ders., Cultur im Alltag. Gesammelte Aufsätze, Wien
1900, S. 126-132, hier 127.
[5] Wiener Radfahr-Club "Künstlerhaus" (Hg.); Radlerei! 40 Kunsttafeln, Wien 1897, S. 8.
Siehe auch Kristan, M.; Joseph Urban. Die Wiener Jahre des Jugendstilarchitekten und
Illustrators 1872-1911 (Veröffentlichungen der Albertina, 43), Wien u.a. 2000, S. 154-
156.
[6] Fahrordnung für Radfahrer im Wiener Polizei-Rayon, 1895, S. 14.
[7] Hochmuth, A.; Kommt Zeit, kommt Rad. Eine Kulturgeschichte des Radfahrens, Wien
1991, S. 43; Sandgruber, R.; Cyclisation und Zivilisation, Fahrradkultur um 1900, in:
Glücklich ist, wer vergißt...? Das andere Wien um 1900, hg. Hubert Ch. Ehalt – Gernot
Heiß – Hannes Stekl (= Kulturstudien, 6), Wien-Köln-Graz 1986, S. 285-303, hier 295
und Hachleitner, B.; Radfahren als Konfliktfeld, in: ders. (Hg.); Motor bin ich selbst,
S. 151.
[8] Wiener Bilder, 1897, Nr. 43, S. 5-6.
[9] Illustrierte Allgemeine Radfahrer-Zeitung, 11 (1895) Nr.10, S. 1.
[10] Eigene Berechnungen nach Belánez, F.G. v. (Hg.); Wiener Organisation und Instruktion
für die Wiener k.k. Sicherheitswache, 3. Bd.; Verkehrs- und Straßenpolizei, dritte erneu-
erte und verm. Aufl., Wien 1913, S. 125f.
[11] Horn, B.; Geschichte der städtischen Radverkehrsplanung, in: Handbuch der kommu-
nalen Verkehrsplanung, Nr. 2.1.1.2, 8/2002, S. 1-19.
Seite 85
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
[12] Hachleitner; Radfahren als Konfliktherd, in: ders. et al.; Motor bin ich selbst, S. 150-153.
Strubreiter, M.; Regeln und Vorschriften, ebd., S. 168-171 und Hachleitner, B.; „Die Fra-
ge der Radfahrwege wird brennender“. Ein neues, altes Konzept, in: ebd. S. 164-167.
[13] Norden, G.; Wiener Radfahrvereine um 1900. Ihre strukturelle Vielfalt und ihre Aktivitä-
ten, in: Hachleitner et al, Motor bin ich selbst, S. 56-61 und Ulreich, W.; Adel am Radel,
in: ders.; Fahrrad = Weg/Zeit. Anmerkungen zur österreichischen Fahrradgeschichte
(Katalog zur Sonderausstellung des Technischen Museums Wien), Wien 1990, S. 60.
[14] Siehe Kraus, K., in: Die Fackel, 4 (1902) H. 113, S. 1.
[15] Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein (Hg.); Wien am Anfang des XX.
Jahrhunderts. Ein Führer in technischer und künstlerischer Richtung (red. v. Paul Kortz,
Bd. 1), Wien 1905, S. 83.
[16] Hachleitner, B., Motor bin ich selbst, S. 151.
[17] Dennoch widmete selbst der führende Sozialdemokrat Julius Deutsch, ab 1926 Vor-
sitzender des „Arbeiterbundes für Sport und Körperkultur Österreich“ (ASKÖ), in seinen
Lebenserinnerungen dem Fahrrad weder als Sport- noch als Freizeitgerät nennen-
swerter weise Platz. Hierbei dürfte es freilich auch eine Rolle gespielt haben, daß seine
Memoiren um 1960 erschienen waren, also zu einem Zeitpunkt als das Fahrrad symbo-
lisch wie alltagspraktisch bereits auf dem Rückzug war. Siehe Deutsch, J.; Ein weiter
Weg. Lebenserinnerung, Zürich ; Wien [u.a.] 1960.
[18] Schacht, R.; Bedeutung und Zukunft des Radfahrverkehrs, in: Verkehrstechnik, H. 19,
5.10.1934, S. 522-523 (hier 523). Siehe dazu auch Herzl; Radfahren, S. 2f.
[19] Arbeiter Rad- u. Kraftfahrer, 22 (1931) H. 12, S. 2 und ebd. 1932 H 12, S. 1.
[20] Siehe dazu Ebert, A.-K.; Verkehrspolitik im Vergleich. Radfahrwege in Deutschland und
in den Niederlanden 1910-1940, in: Blätter für Technikgeschichte 71 (2009), S. 45-70.
[21] Radfahrwege – eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Ein Antrag des Arbeiter-
Radfahrerbundes im Sportbeirat der Gemeinde Wien, in: Der Arbeiter-Radfahrer, Nov.
1929, S. 1.
[22] Radfahrwege in Berlin, in: Verkehrstechnik, H. 19, 5.10.1934, S. 524.
[23] Hachleitner, B.; Gegen den Wind der Politik. Radfahren im Roten Wien und im Austrofa-
schismus, in: ders.; Motor bin ich selbst, S. 84-91 (hier 86); Siehe auch Bundespolizeidi-
rektion Wien; Fahrordnung für Radfahrer in Wort und Bild (hg. v. Das Kleine Blatt), Wien
1936, S. 3.
[24] Sandgruber, R.; Das Fahrrad, in: Beiträge zur Historischen Sozialkunde 2/87, S. 57-63
(hier 62). Siehe auch Hochmuth; Kommt Zeit, kommt Rad, S. 96.
[25] Widespread Use of Bicycles in Europe, in: Transit Journal, March 1935, p. 81; Békési,
S., Fahr-Rad in Wien?, S. 24; Kreuzer, B.; 1 Fahrrad = 0,25 PKW-Einheiten: Das
Fahrrad im Stadtverkehr zwischen verpaßten Chancen und gewollter Marginalisierung,
Pfadabhängigkeiten und Gestaltungsspielräumen, in: Pammer M. / Neiß, H. / John, M.
(Hg.), Erfahrung der Moderne, Stuttgart 2007, S. 465-481 (hier 471).
[26] Rund die Hälfte der im Zeitraum 1930-1980 überlieferten Fahrradmarken in Wien ent-
stand während der 1930er Jahre, und die meisten davon erst ab 1935. Eigene Berech-
nungen nach Zappe, U. et al.; Mechanikerräder.
[27] Vgl. Békési, S.; Fahr-Rad in Wien?, S. 24 und Kreuzer; Fahrrad im Stadtverkehr, S. 471.
Seite 86
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
[28] Wehap, W.; Frisch, radln, steirisch: eine Zeitreise durch die regionale Kulturgeschichte
des Radfahrens, Graz 2005, S. 135ff.
[29] Seliger, M.; Scheinparlamentarismus im Führerstaat: "Gemeindevertretung" im Austro-
faschismus und Nationalsozialismus. Funktionen und politische Profile Wiener Räte und
Ratsherren 1934-1945 im Vergleich, Wien [u.a.] 2010, S. 106-110 und Sandgruber, R.;
Geld und Geldwert, in: Schusser, A. / Aichelburg, W. (Hg.); Vom Pfennig zum Euro: Geld
aus Wien (Katalog zur Sonderausstellung des Historischen Museums der Stadt Wien;
281), Wien 2002, S. 62ff.
[30] Siehe mehr dazu bei Müllner, R.; Mobilitätsversprechen und „Verkehrsgemeinschaft“.
Alltagsradeln im Nationalsozialismus, in: Hachleitner, B. et al. (Hg.); Motor bin ich selbst,
S. 108-111.
[31] Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien für 1939-42, Wien 1946.
[32] Hachleitner, B.; Das Verschwinden des Fahrrads. Die bürokratische Gesellschaft des
gelenkten Konsums setzt aufs Auto, in: ders. et al.; Motor bin ich selbst, S. 130-133
(hier 132).
[33] Jonas, F.; Schlachtfeld Straße, in: ders.: Wiener Probleme. Eine Sammlung der Radio-
reden des Bürgermeisters der Stadt Wien 1954/1955, Wien 1955, S. 7-12.
[34] Vgl. Österreichische Gesellschaft für Straßenwesen: Radwegebau im Frem-
denverkehrsland Österreich (unter Mitwirkung v. Josef Daum), Wien 1958, S. 18.
[35] Vgl. Ergebnisse der 1. Wiener Straßenverkehrsenquete, Empfehlung Nr. 37, Kommissi-
on II, in: Der Aufbau 11(1956), H. 2, S. 63.
[36] Rathauskorrespondenz Wien, 9.8.1950.
[37] Siehe Musil, F.: Bedeutung und Wandel des Grosstadtverkehrs, in: Der Aufbau 6/1950,
S. 285-287; Brunner, Stadtplanung für Wien, S. 28, 140 u. 142; Rainer, R.: Automobil-
verkehr und städtebauliche Gestaltung, in: Der Aufbau 9/1952, S. 351-62; Musil, F.: Zu
den Wiener Verkehrsproblemen, in: Stadtbauamt der Stadt Wien (Hg.): Wiener Stras-
senverkehrsprobleme. Unterlagen zur 1. Wiener Strassenverkehrsenquete (= Der Auf-
bau, Monographie 6), Wien 1955, S. 159; Rainer, R.: Planungskonzept Wien 1962, S.
90. Im Zeitraum 1950 bis 1960 erschien in der Zeitschrift „Der Aufbau“, dem führenden
Organ der Wiener Stadtplanung, kein eigener Beitrag zum Thema Fahrradverkehr. Das
einzige Verkehrsmittel, das solcherart explizit bedacht wurde, war das Automobil.
[38] Portenschlag, R.: Konzept für den öffentlichen Verkehr in Wien, in: City-in: Öffentlicher
Verkehr in Wien, Wien 1975, S. 118.
[39] Siehe mehr dazu bei Békési, S.; Die befahrbare Stadt. Über Mobilität, Verkehr und
Stadtentwicklung in Wien 1850-2000, in: Pro Civitate Austriae. Informationen zur Stadt-
geschichtsforschung in Österreich, N.F. Heft 9, 2004, S. 3-46 (hier 23)
[40] Fellner et al.: Radwegegrundnetz für Wien (Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwick-
lung und Stadtgestaltung; 11), Wien 1983, S. 2.
[41] Vgl. Knoflacher, H. / Kloss H.P.: Verkehrskonzeption für Wien, Teil C, Konsulentengu-
tachten (MA 18, Geschäftsgruppe Stadtplanung), Wien 1980, S. 15f u. Diagr. 5 sowie S.
161. Siehe zur Entwicklung der Radverkehrsanteile in ausgewählten europäischen
Städten 1920-1990 in Oldenziel, R. and de la Bruhèze, A. A.; Contested Spaces. Bicycle
Lanes in Urban Europe, 1900-1995, in: Transfers 1(2), Summer 2011, 29-49 (hier 33).
Seite 87
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
[42] Vgl. „Wien den Radlern!“ (v. Anton Bina), Kurier, 20.03.1976; „Radfahrer sind immer
noch Stiefkinder“ (v. Gerhard Krause), Kurier, Juni 1979; Hawlik, Johannes: Bürger, die
der Lethargie den Kampf angesagt haben. Von Radfahrern, Aktionen für Spielplätze und
gegen Autostraßen, in: Unterberger, Andreas (Hg.): A... wie alternativ. Alternative Le-
bensformen in Österreich, Wien-München 1981, S. 73f.
[43] Siehe Radwegegrundnetz für Wien (Beiträge zur Stadtforschung, Stadtentwicklung und
Stadtgestaltung, MA 18, Bd. 11), Wien 1983. Hager, A. / Pepelnik, J.; Radfahren in
Wien. Fahrradgeschäfte (...), Rechtsratgeber, Verkehrspolitik, Wien 2009, S. 213, 221-
231 und Mauch, U. / Lang, M. / Wurnig, Chr.; Ausgenommen Radfahrer. Auf zwei Rä-
dern durch den Wiener Großstadtdschungel, Wien 2011.
[44] Vgl. Stat. Jahrbuch d. Stadt Wien f. 1992, S. 297; FahrRad in Wien. Mobilität für alle.
Überblick über die aktuelle Situation des Radverkehrs (Magistratsabteilung 18, Werk-
stattberichte 45), Wien 2002, S. 12; Knoflacher / Kloss, S. 15.
[45] Radverkehrserhebung Wien. Entwicklungen, Merkmale und Potenziale (Magistratsabtei-
lung 18, Werkstattberichte 114), Wien 2010, S. 72 und VCÖ-Untersuchung: Österreichs
Radfahrhauptstadt vom 25.03.2010 (http://www.vcoe.at/de/presse/aussendungen-
archiv/details/items/2010-55, 13.1.2013).
[46] Vgl. FahrRad in Wien, S. 15.
[47] Vgl. Radkarte Wien 2013 (hg. v. Mobilitätsagentur Wien), Verlag Schubert & Franzke.
[48] Bauer, H. et al.; Stadtverkehr. Aktuelle Fragen, erreichte Lösungen, offene Probleme
(Kommunalwissenschaftliches Dokumentationszentrum), Wien 1990, S. 32.
[49] Siehe dazu auch Risser, R. et al.; Konflikte. Fußgänger–Radfahrer am Beispiel Wien
(MA 18, Werkstattberichte, 1) Wien 1992.
[50] Alois Schützenhöfer, Leiter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit in der Steiermark, zit.
n. Wehap, W.; Regionale Kulturgeschichte des Radfahrens, S. 235.
[51] Radverkehrserhebung Wien. Entwicklungen, Merkmale und Potenziale (Magistratsabtei-
lung 18, Werkstattberichte 114), Wien 2010, S. 13 und Rathauskorrespondenz vom
15.02.2012.
[52] Vgl. Chorherr, Chr.; Verändert! Über die Lust, Welt zu gestalten, Wien 2011, S. 167-176.
[53] Lanzendorf, M. / Scheiner, J.; Verkehrsgenese als Herausforderung für Transdiszipli-
narität – Stand und Perspektiven der Forschung. In: Dalkmann, H. / Lanzendorf, M. /
Scheiner, J.; Verkehrsgenese – Entstehung von Verkehr sowie Potenziale und Grenzen
der Gestaltung einer nachhaltigen Mobilität (Studien zur Mobilitäts- und Verkehrsfor-
schung, 5), Mannheim 2004, S. 11-38, hier 32.
[54] Vgl. Radverkehrserhebung Wien, S. 27, 48 und 53.
[55] Vgl. Blaha, F.; Radfahren in Wien – gestern, heute, in: Perspektiven 1995, H. 8-9, S. 78
und FahrRad in Wien, S. 8-10.
[56] Haefeli, U.; Verkehrspolitik und urbane Mobilität. Deutsche und Schweizer Städte im
Vergleich 1950–1990 (Beiträge zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsforschung, 8),
Stuttgart: Steiner, 2008, S. 307.
[57] Meschik, M.; 'Cycling in Vienna - Where are the cyclists?, in: Proceedings, Velo-City
2003 Conference, Paris, 23-26. September 2003.
Seite 88
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
[58] Siehe zum Verhältnis verschiedener politischer Parteien zum Fahrrad in der Gegenwart
bei Hager, A./ Pepelnik, J.; Radfahren in Wien, S. 219-221.
[59] Vgl. dazu Békési, S.; Shrinking City? Stadtbilder und Stadtentwicklung im Wien der Zwi-
schenkriegszeit, in: Wolfgang Kos (Hg.): Kampf um die Stadt. Politik, Kunst und Alltag
um 1930, Wien 2010, S. 98-107 (hier 101f).
[60] Siehe u.a. „Die Entflechtung des Verkehrs“, in: ARBÖ. Rad- und Kraftfahrer-Zeitung
(1955) 9; „Dringendstes Wiener Erfordernis: ein Radwegnetz“, in: ebd. (1955) 12, S. 1-2;
„Radwege im Interesse aller“, in: ebd. (1956) 6; „Wien braucht Schnellverkehrsstraßen“,
in: ebd. (1956) 3, S. 4-5.
[61] Siehe mehr dazu in Békési, S.; Stürmisch und unaufhaltsam? Motorisierung und Politik
im Wien der 50er Jahre, in: Rapp, Chr. (Hg.): Spurwechsel. Wien lernt Auto fahren (Buch
zur gleichnamigen Sonderausstellung im Technischen Museum Wien), Wien 2006, S.
76-83.
[62] Vgl. „Mehr Rad- und Mopedwege – mehr Sicherheit“, in: ARBÖ. Rad- und Kraftfahrer-
Zeitung, 1958, Nr.1, S. 4.
[63] Vgl. „Mehr Rad- und Mopedwege – mehr Sicherheit“, in: ARBÖ. Rad- und Kraftfahrer-
Zeitung, 1958, Nr.1, S. 4. Horn; Geschichte der städtischen Radverkehrsplanung, S. 10.
Bardua, S.; Straßenverkehr: Verkehrsteilnehmer im Dauerkonflikt, in: Bardua, S. / Käh-
ler, G.; Die Stadt und das Auto. Wie der Verkehr Hamburg veränderte (hg. v. der Ham-
burgischen Architektenkammer und dem Museum für Arbeit), München-Hamburg 2012,
S. 100-117 (hier 109).
[64] Siehe Békési, S.; Die subversive Kraft des Kontrafaktischen. Zur politischen Geschichte
des Stadtverkehrs, in: dérive. Zeitschrift für Stadtforschung, Okt.-Dez. 2006, H. 25, S. 8-
12.
[65] Siehe zur Vielfalt der möglichen Maßnahmen bei Meschik, M.; Planungshandbuch Rad-
verkehr, Wien – New York 2008.
[66] Siehe Musner, L.; Der Geschmack von Wien. Kultur und Habitus einer Stadt (Inter-
disziplinäre Stadtforschung, 3), Frankfurt / New York 2009, S. 8, 24f, 31 u. 47; Löw, M.;
Soziologie der Städte, Frankfurt am Main: 2010, S. 65f und 76.
[67] Vgl. Strubreiter M.; Von Bienen und Tourenfahrern. Die Anfänge von ARBÖ und
ÖAMTC, in: Hachleitner, B. et al. (Hg.); Motor bin ich selbst, S. 92-95 (hier 93) und Gröl-
ler, H.D.; Im Spannungsfeld von Klio und Kalliope: Der "Schuhmeier"-Roman von Robert
Ascher, Frankfurt/M. 2010, S. 256.
[68] Vgl. Frei, A. G.; Rotes Wien. Austromarxismus und Arbeiterkultur. Sozialdemokratische
Wohnungs- und Kommunalpolitik 1919-1934, Berlin (West) 1984, S. 63f und Gruber, H.;
Red Vienna. Experiment in Working-Class Culture 1919-1934, New-York/Oxford 1991,
S. 112f.
[69] Vgl. Musner, L., Geschmack von Wien, S. 47; Kemper, J. / Vogelpohl, A. (Hg.); Loka-
listische Stadtforschung, kulturalisierte Städte. Zur Kritik einer "Eigenlogik der Städte".
Münster: 2011, S. 8f.
Seite 89
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Bike Sharing Systeme
Hans-Erich Dechant
Seite 90
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 91
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Bike Sharing Systeme In den letzten Jahren haben immer mehr Städte öffentliche Fahrradverleih-Systeme als Mög-
lichkeit zur Förderung des Radverkehrs erkannt.
1 Geschichte der öffentlichen Fahrradverleihsysteme
In diesem Kapitel soll kurz auf die wesentlichen Ereignisse unter besonderer Berücksichtigung
der Ereignisse in Wien eingegangen werden, um das Verständnis der Entwicklung der heuti-
gen Bike Sharing Systeme zu wecken. Die Geschichte der Fahrradverleihsysteme internatio-
nal und in Wien wurde von Schneeweiß im Detail zusammengefasst. [1]
1.1 Amsterdam 1965 – erste Generation
Die Idee des Bike Sharing lässt sich auf ein Projekt in Amsterdam 1965 zurückführen. Damals
hat eine Studentengruppe mit dem bezeichnenden Namen „Provo“ Räder weiß angemalt und
proklamiert, dass diese von nun an für jedermann zur freien Verwendung in den Straßen zur
Verfügung stehen sollten. Ziele des unter dem Titel „White Bikes“ bekannt gewordenen Pro-
jektes waren nur in zweiter Linie verkehrspolitische, vor allem wollte man die Bedeutung des
privaten Besitzes in Frage stellen. Das Projekt war von zeitlich sehr begrenzter Ausdehnung,
schon nach 2 Tagen waren alle Räder von der Polizei sichergestellt worden. Argumentation
war dabei, dass es in Amsterdam nicht gestattet ist, Räder nicht abgesperrt im öffentlichen
Raum abzustellen. Das wäre Beihilfe zum Diebstahl. So kurz der Erfolg in Amsterdam auch
war, die Idee des Bike Sharing war geboren und sollte sich über Jahrzehnte halten.
1.2 Anfänge in Wien: „Public Velo“ 1991
Es sollte einige Zeit dauern bis die Idee auch Wien erreichte. 1991 schließlich ließ der Fahr-
radbotendienst Veloce mit einem Projekt aufhorchen. Dieses wurde im Bicycle Research Re-
port No.27 der European Cyclist Federation 1992 veröffentlicht [2]. Bemerkenswert daran vor
allem, dass bereits damals von einem „öffentlichen Individualverkehrsmittel“ gesprochen wur-
de. Ein Begriff, der sich erst viel später als eine der zentralen Eigenschaften für öffentliche
Radverleihsysteme durchsetzen sollte. Außer dem zukunftsweisenden Konzept konnten aller-
dings keine Erfolge erzielt werden. Für eine Umsetzung fehlte es sowohl an der Finanzierung
als auch an der nötigen Unterstützung durch die Politik.
1.3 „Das Gratis Stadt-Radl“ 1997
Einige Jahre später wurde ein neuer Anlauf unternommen. Akteur war diesmal die bis heute in
Wien ansässige Firma Siems & Klein KG, spezialisiert auf Automatisierungssysteme und
Werkstatteinrichtung. Hier gingen die Planungen bereits mehr ins Detail, es gab eine Karte mit
den geplanten Stationen und auch die Politik begann sich für die Idee zu erwärmen. Dennoch
wurde das Projekt mangels Finanzierung nie umgesetzt.
1.4 Viennabike 2002
2002 schließlich wurde mit Viennabike das erste Wiener Fahrradverleihsystem auf die Straße
gestellt. Bei diesem Projekt wurden 1.500 Räder an 237 Stationen bereitgestellt.
Seite 92
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Es handelte sich dabei um ein System der 2. Generation wie es beispielsweise in Kopenha-
gen jahrelang verfügbar war. Bei Systemen dieser Generation geht man davon ab, die Räder
unabgesperrt im öffentlichen Raum stehen zu lassen, sondern stellt die Räder an speziellen
Verleihstationen zur Verfügung. An diesen Stationen sind die Räder mit einfachen Schlössern
wie etwa jenen an Einkaufswagen in Supermärkten abgesperrt. Durch Einwurf eines Pfandes
von 2,- EUR kann jede/-r ein Rad entlehnen und an jeder anderen Station im Stadtgebiet wie-
der zurückgeben, wobei das Pfand zurückerstattet wird. Die korrekte Nutzung der Räder wur-
de in Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgehalten, die an jedem Rad nachzulesen wa-
ren. Das Projekt erhielt sehr große öffentliche Aufmerksamkeit und wurde über den ganzen
Sommer 2002 intensiv von den Medien beobachtet und dokumentiert. Schnell nahmen dabei
negative Kritikpunkte die Überhand: Zumeist waren an den Stationen keine Räder verfügbar,
oft waren die Räder in bedauernswertem Zustand. Während die Medien dafür Diebstahl, die
schlechte Gesinnung oder mangelnde Intelligenz der Wiener sowie die Nähe Wiens zu den
ehemaligen Ostblockländern verantwortlich machten, sind objektiv betrachtet Mängel im Kon-
zept als Ursache für die Probleme auszumachen.
1.4.1 Problem Viennabike: überlange Entlehndauern
Unbestritten war es eine Seltenheit, an einem Viennabike-Ständer ein Viennabike anzutreffen.
Als Ursache dafür wurde in der öffentlichen Meinung schnell Diebstahl angesehen. Betrachtet
man allerdings die individuellen Räder, die täglich von den ServicetechnikerInnen an den Sta-
tionen gefunden wurden (und deren Radnummern immer notiert wurden), so zeigt sich, dass
zwar täglich nur wenige Räder gefunden wurden, aber zum Großteil andere Radnummern als
an den Tagen zuvor.
Abbildung 36: Verlauf der ‚Sichtungen‘ von individuellen Viennabikes über Wochen.
Werden die Räder, die so über die Zeit gesichtet wurden, aufsummiert, so ergibt sich, dass
die Anzahl der gefundenen Räder pro Zeiteinheit über den Sommer 2002 relativ konstant war.
In Abbildung 36 sind die gefundenen Räder für die letzten 8 Wochen vor dem 15. September
2002 dargestellt. Ähnliche Kurven ergaben sich für die anderen Tage, die Anzahl der Vien-
nabikes auf den Straßen Wiens war also relativ konstant, Diebstahl nicht das eigentliche Prob-
Seite 93
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
lem. Errechnet man aus diesen Sichtungen der Räder eine durchschnittliche Entlehndauer, so
ergibt sich, dass ein Viennabike durchschnittlich etwa 3 Wochen für das Serviceteam nicht
auffindbar war. Derart lange Entlehndauern waren zwar nach den AGB’s nicht zulässig (die
Räder durften nur von Station zu Station verwendet werden, Entfernung aus dem öffentlichen
Raum war nicht zulässig, Absperren der Räder außerhalb der Stationen war nicht zulässig),
allerdings gab es zur Durchsetzung dieser Regeln keinerlei Sanktionsmöglichkeiten.
1.4.2 Ende nach einer Saison
Aufgrund der Probleme mit der Verfügbarkeit der Räder sowie dem schlechten Zustand der
Räder musste das Projekt Viennabike nach nur einer Saison aufgegeben werden. Allerdings
hatte das Viennabike-Jahr gezeigt, dass ein großes Interesse an einem Gratis-Stadtrad Pro-
jekt vorhanden war und die öffentliche Aufmerksamkeit durchaus ein Kapital war, das genutzt
werden konnte.
1.5 Citybike Wien
Als Außenwerbefirma interessierte sich aufgrund der großen öffentlichen und medialen Auf-
merksamkeit bald die Gewista für das Konzept des Gratis-Stadtradsystems. Mit den Erfahrun-
gen von Viennabike und einem bei der Konzernmutter JCDecaux existierenden Grundkonzept
wurde 2003 das Citybike Wien entwickelt. Die wesentlichen, aus den Erfahrungen mit Vien-
nabike resultierenden, Neuerungen waren:
Identifikation der Benutzer
progressives Tarifsystem
1.5.1 Identifikation der Benutzer
Um den Benutzern der Räder die Verantwortung für das von ihnen entlehnte Rad übertragen
zu können, musste die Anonymität fallen. Gleichzeitig musste aber verhindert werden, dass
ein komplizierter und langwieriger Anmeldevorgang der Nutzung im Wege steht und potentiel-
le Citybiker abschreckt. Um diese beiden Kriterien bestmöglich zu vereinen, wurde nach ei-
nem Identifikationsmerkmal gesucht, dass möglichst viele Wiener und Wienerinnen bereits bei
sich tragen und das automatisiert genutzt werden kann. Hier wurden die neuen Betreiber zu-
nächst in der Bankomatkarte fündig. Diese Karte ist in Österreich sehr weit verbreitet und
kann mit speziellen Kartenlesern ausgelesen und zur Identifikation verwendet werden. Um
sicherzustellen, dass der rechtmäßige Besitzer der Karte vor dem Terminal steht, ist bei der
Erstanmeldung die Bezahlung einer Anmeldegebühr erforderlich. Im Zuge der Bezahlung die-
ser Anmeldegebühr muss der korrekte PIN-Code der Karte eingegeben werden, womit si-
chergestellt ist, dass keine unberechtigte Person die Karte nutzt. Bei späteren Entlehnungen
wird die Identifikation durch ein bei der Erstanmeldung gewähltes und der Karte zugeordnetes
Passwort sichergestellt, wodurch keine weiteren PIN-Eingaben (und Zahlungen) erforderlich
sind. In der Folge wurde noch die Citybike Wien Card eingeführt, um Menschen ohne Banko-
matkarte das Entlehnen von Citybikes zu ermöglichen. Dabei handelt es sich um eine eigene
Magnetstreifenkarte, die Fahrten werden mittels Bankeinzug abgerechnet. Zuletzt wurde noch
für Touristen der Zugriff mit internationalen Kreditkarten ermöglicht. Die 2004 eingeführte Ent-
lehnung mit Handy wurde nach wenigen Jahren wegen der sehr geringen Nutzung (etwa
1,3 % der Entlehnungen) und der hohen Erhaltungskosten für den Zugriff wieder eingestellt.
Seite 94
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
1.5.2 Progressives Tarifsystem
Da sich die Einschränkung der Art der Nutzung des Viennabikes (von Station zu Station fah-
ren, nicht absperren) als nicht exekutierbar erwiesen hat, wurde bei Citybike Wien der Weg
über die Einschränkung der Entlehndauer gewählt. Um in Wien mit dem Rad von einem Ort zu
jedem beliebigen anderen Ort zu fahren, ist eine Stunde in aller Regel ausreichend. Daher
wurde die Gratis-Nutzung auf eine Stunde eingeschränkt. Danach sollten zunächst moderate
Gebühren anfallen, um die Nutzer zu motivieren, das Rad bald zurückzugeben. Diese Gebüh-
ren sollten dann jedoch zunehmend ansteigen, um zum einen die Motivation zur Rückgabe zu
erhöhen. Zum anderen sollten die Gebühren aber auch derart ansteigen, dass für Fahrten ab
etwa 6 Stunden der klassische, touristische Radverleih günstiger und somit attraktiver sein
sollte.
2 Die Erfindung des Bike-Sharing
Abbildung 37 zeigt die Häufigkeit der Fahrten über die Entlehndauer bei Citybike Wien. Ganz
anders als bei Viennabike (durchschnittlich 3 Wochen ‚Entlehnzeit‘) konnten mit den oben
genannten Maßnahmen die Entlehnzeiten auf durchschnittlich 22,5 Minuten reduziert werden.
Mehr noch, die häufigste Entlehndauer betrug jetzt sogar nur noch 10 Minuten. Die Räder
wurden nun also offensichtlich tatsächlich hauptsächlich dazu verwendet, um mit dem Citybike
möglichst direkt von einer Station zu einer anderen zu fahren. Somit standen die Räder
schnell wieder für andere Benutzer zur Verfügung. Leere Stationen an jeder Ecke gehörten
nun der Vergangenheit an.
Abbildung 37: Häufigkeit der Fahrten über die Entlehndauer bei Citybike Wien.
Somit konnte die Anzahl der täglichen Nutzungen pro Rad erheblich gesteigert werden. Nut-
zungszahlen größer als 10 Entlehnungen pro Rad und Tag sind in Systemen, die nach die-
sem Vorbild betrieben werden, heute keine Seltenheit mehr. Dies war die Geburtsstunde des
Bike Sharing im eigentlichen Sinn des Wortes! Mehr noch lässt sich aus der Grafik herausle-
sen: Obwohl 1 Stunde Gratis-Nutzung zur Verfügung steht, fällt die Häufigkeit der Nutzung
bereits bei 20 Minuten stark ab und ist bei Entlehndauern von 30 Minuten bereits der Großteil
der Fahrten abgeschlossen. Hier haben die Benutzer den Betreibern gezeigt, wie Bike-
Sharing wirklich funktioniert: Auf kurzen Distanzen von 2 bis 3 Kilometern wird das Citybike
Seite 95
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
am besten eingesetzt, für längere Distanzen wird es meist mit dem übergeordneten Öffentli-
chen Verkehr (U-Bahn, Schnellbahn) kombiniert. Das bestätigen auch Umfragen durch den
Betreiber von Citybike Wien. Diese Lektion haben die Betreiber neuerer Bike-Sharing Syste-
me bereits gelernt, heute wird die Gratis-Nutzung in der Regel auf eine halbe Stunde einge-
schränkt.
3 Ausbau und Vergrößerung
Das Stationen-Netz von Citybike Wien wurde in drei Phasen ausgebaut. Diese sind in Abbil-
dung 38 dargestellt. Zuerst wurde ein Grundsystem mit 50 Stationen von der Gewista finan-
ziert und umgesetzt (Abbildung 38 a)). Diese Phase wurde 2007 abgeschlossen. Danach
wurden mit Unterstützung der Stadt Wien weitere 12 Stationen errichtet, mit dem Ziel touristi-
sche Ziele anzubinden. Angeschlossen wurden das Prater-Stadion anlässlich der Fußball-EM,
Schönbrunn und der Bahnhof Meidling sowie die Millenium City (Donauinsel). Dieser Ausbau
war im Wesentlichen 2008 abgeschlossen (Abbildung 38 b)). Schließlich wurde ein Vertrag
mit der Stadt Wien über den weiteren Ausbau von Citybike Wien auf insgesamt 120 Stationen
abgeschlossen. Mit diesem Ausbau wurde 2010 begonnen (Abbildung 38 c): 2012, Abbildung
38 d): Juni 2013).
Abbildung 38: Ausbau von Citybike Wien: a) 2007: 50 Stationen; b) 2008: 62 Stationen;
c) 2012: 100 Stationen; d) Juni 2013: 109 Stationen.
4 Verdichtung des Stationen-Netzwerkes
Im Zuge des Ausbaus des Citybike Wien-Netzes konnte die Beobachtung gemacht werden,
Seite 96
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
dass Stationen, in deren Umfeld neue Citybike-Standorte errichtet wurden, von diesen neuen
Standorten profitierten und die Nutzung der bereits bestehenden Stationen zusätzlich erhöht
wurde. Der Umkreis, in dem eine neue Station diesen positiven Einfluss auf andere Standorte
ausübt, entspricht jener Distanz, die mit den Citybikes hauptsächlich zurückgelegt wird und
beträgt etwa 2 bis 3 Kilometer. In Abbildung 39 ist dieser Zusammenhang anhand von Echt-
daten aus dem Jahr 2008 dargestellt.
Abbildung 39: Auswirkung der Anzahl an Zielstationen im Einflussbereich einer Citybike
Station: a) Stationen im Einflussbereich einer Citybike Station (hier: Umkreis von 3,5 km);
b) die Nutzungsfrequenz einer Citybike Station steigt mit der Anzahl der Zielstationen.
In Abbildung 39 a) ist der Einflussbereich einer Citybike Station und die Stationen in diesem
Bereich dargestellt. In diesem Beispiel wurde 3,5 Kilometer als Einflussbereich gewählt, was
in etwa dem maximalen Einflussbereich entspricht. Bei größeren Distanzen bricht die Nut-
zungshäufigkeit rapide ab. In späteren Jahren und im internationalen Vergleich hat sich her-
ausgestellt, dass es sinnvoller ist, den durchschnittlichen Einflussbereich einer Citybike Stati-
on mit etwa 2 Kilometer Radius als Vergleichsbasis heranzuziehen – zum einen, weil in
diesem Distanzbereich die Nutzungsfrequenz erheblich höher ist, zum anderen, weil Randef-
fekte (Randstationen haben in einer Richtung überhaupt keine Nachbarstationen) dadurch
kleiner gehalten werden. Im Besonderen gibt es kleine Systeme, in denen es bei Verwendung
von 3,5 Kilometern als Radius für den Einflussbereich nur noch Randstationen gäbe. Abbil-
dung 39 b) zeigt die Anzahl der Entlehnungen pro Citybike Wien Station für alle Wiener Stati-
onen, aufgetragen über der Anzahl der jeweiligen Zielstationen im Einflussbereich. Es zeigt
sich klar, dass Stationen mit einer höheren Anzahl an Zielstationen in der Umgebung
(= höheren Stationendichte im Umkreis) erheblich höhere Nutzungsfrequenzen aufweisen.
Dieser Zusammenhang steigt stärker als linear an, vermutlich quadratisch.
4.1 Vergleich mit Internationalen Systemen
Die obigen Erkenntnisse über den Einfluss der Dichte eines Netzwerkes an Citybike Stationen
wurden in den meisten der seit 2005 umgesetzten Systemen berücksichtigt. Abbildung 40 a)
zeigt als Beispiel das System von Wien und jenes von Paris (Abbildung 40 c), Systemstart
2007) im selben Maßstab dargestellt. Es ist offensichtlich, dass in Paris wesentlich mehr Sta-
tionen pro Flächeneinheit errichtet wurden. Dasselbe Bild zeigt sich in Abbildung 40 b) für das
erst 2013 umgesetzte System Citibike in New York.
Seite 97
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 40: Vergleich der Stationendichte in Wien mit jener in anderen Metropolen: a) Wien,
umgesetzt ab 2003, 102 Stationen (Stand Ende 2012); b) New York, umgesetzt 2013,
420 Stationen; c) Paris, umgesetzt 2007, 1.500 Stationen.
Dieser Eindruck kann durch den Vergleich der durchschnittlichen Anzahl von Stationen im
Einflussbereich über alle Citybike Stationen eines Systems noch erhärtet werden. Tabelle 7
zeigt die durchschnittliche Anzahl der Entleih-Stationen in einem Einflussbereich von 2 Kilo-
metern für einige der erfolgreichsten Bike Sharing Systeme. Es zeigt sich, dass der Großteil
der erfolgreichen Systeme etwa 60 bis 90 Stationen im Umkreis von 2 Kilometern um eine
Station haben. Paris ist nicht nur bei der Anzahl der Stationen, sondern auch bei der Dichte
der Stationen ein herausragendes Beispiel. Erwähnt muss werden, dass Dublin mit 33,9 Sta-
tionen zwar eher am Ende der Liste zu finden ist, da in dieser Stadt allerdings insgesamt nur
46 Stationen errichtet wurden, ist dieser Wert durch die oben beschriebenen Randeffekte er-
heblich herabgesetzt. Wien ist mit durchschnittlich 21,87 Stationen im Einflussbereich einer
Citybike Station am Ende der Liste zu finden.
Seite 98
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Stadt Ø Anzahl Stationen im Einflussbereich von 2,0 km
Paris 122,91
London 86,31
Toulouse 83,15
Lyon 79,02
Nantes 71,70
Valencia 69,50
Seville 67,02
Marseille 54,87
Brüssel 46,92
Dublin 33,90
Wien 21,87
Tabelle 7: Durchschnittliche Anzahl Stationen im Einflussbereich von 2 Kilometern für einige der
erfolgreichsten Citybike Systeme. Die Sortierung erfolgt absteigend nach der Anzahl der
Stationen. Eigene Berechnungen Ende 2012.
5 Verteilung der Räder über die Stadt
Für das Funktionieren eines Bike Sharing Systems ist es außerdem wichtig, dass es an jeder
Station zuverlässig sowohl verfügbare Räder, als auch leere Rückgabeboxen gibt. Würden
beispielsweise in Wien die Citybikes gleichmäßig über alle Stationen verteilt und dann sich
selbst überlassen werden, so würden sich an manchen Stationen Räder sammeln und an an-
deren Stationen würde es zu einem Mangel an Rädern kommen. Diese Ungleichverteilung
von Rädern verringert das Funktionieren des Systems, da an leeren Stationen keine Räder
entlehnt und an vollen Stationen keine Räder zurückgegeben werden können. Diese Un-
gleichverteilung folgt daraus, dass viele Nutzer das Citybike für Einwegfahrten verwenden.
Diese Einwegfahrten verteilen sich nicht ideal stochastisch über das System, sondern es gibt
gewisse Tendenzen, die tages- und tageszeitabhängig sein können. Grundsätzlich können
dabei zwei Hauptbewegungen ausgemacht werden, denen die Verteilung der Räder im Sys-
tem unterliegt:
(1) Es gibt eine täglich, vor allem werktags, pulsierende Bewegung am Morgen von den
außenliegenden Wohnbezirken in das Stadtzentrum, sowie abends und in der Nacht zu-
rück vom Stadtzentrum in die Wohnbezirke. Dabei zeigt sich, dass die Bewegung in der
Nacht zurück in die Wohnbezirke im allgemeinen stärker ausfällt als jene morgens ins
Stadtzentrum;
Seite 99
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
(2) Es gibt grundsätzlich eine etwas größere Bereitschaft mit dem Rad von einer höherge-
legenen Station bergab zu einer tiefer gelegenen Station zu fahren als umgekehrt. Auch
wenn der Anteil der Bergab-Fahrten nur geringfügig höher ist als jener der Bergauf-
Fahrten, so sammeln sich dadurch die Räder des Systems doch an tiefer gelegenen
Stationen an.
Um dieser Ungleichverteilung der Räder entgegenzuwirken, werden in Wien zwei grundsätzli-
che Strategien verfolgt:
Information der Benutzer;
Umverteilung der Räder durch Service-Personal.
5.1 Information der Benutzer
Durch die Information der Benutzer über den aktuellen Befüllungsstand der Stationen kann
zum einen die Verteilung der Räder über das System verbessert werden, da Benutzer, die ein
Rad entlehnen möchten, schlecht besetzte Standorte eher meiden werden und stattdessen
Stationen aufsuchen, an denen sie verlässlich ein Rad vorfinden. Zum anderen lindert die
Information die Unannehmlichkeiten für die Benutzer, da sie sich rechtzeitig auf die Situation
einstellen können. Selbe Überlegungen gelten selbstverständlich auch für volle Stationen und
die Rückgabe der Räder. Um die Benutzer über die aktuellen Füllstände der Stationen zu in-
formieren, stehen folgende Kommunikations-Kanäle zur Verfügung:
Stationenplan auf der Citybike Wien Internetseite;
Open-Data Schnittstelle, um anderen Plänen und Angeboten die Anzeige der aktuellen
Füllgrade der Stationen zu ermöglichen;
eine Auswahl an Smartphone-Applications für alle gängigen Plattformen;
interaktiver Stationenplan an allen Citybike Wien Terminals;
automatische Anzeige eines Umgebungs-Planes auf der Startseite des Terminals, wenn
die Station voll oder leer ist.
5.2 Umverteilung der Räder durch Service-Personal
Um die Umverteilung der Räder durch das Servicepersonal optimal zu planen, müssen die
Stationen kategorisiert und ihnen Grenzwerte zugeordnet werden, ab welchen Füllständen der
Eingriff durch die Servicetechniker erfolgen soll. Füllstandschwankungen können im Wesentli-
chen vier verschiedenen Mustern folgen:
Tagesschwankungen, ausgeglichen;
Tagesschwankungen, überlastet;
Tagesschwankungen, absteigend;
Tagesschwankungen, ansteigend.
In Abbildung 41 sind die vier unterschiedlichen Typen dargestellt. Abbildung 41 a) zeigt den
Idealzustand: es gibt Schwankungen aufgrund der täglichen Entlehnungen und Rückgaben
von Rädern, doch es sind jederzeit genügend Räder und freie Bikeboxen an der Station vor-
handen. Abbildung 41 b) zeigt den Zeitverlauf einer zu klein dimensionierten Station. Hier
kann durch Umverteilen der Räder durch das Servicepersonal kaum Verbesserung erzielt
werden: Während zu einem Zeitpunkt mehr Räder benötigt werden, sind wenige Stunden spä-
Seite 100
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
ter bereits zu viele Räder an der Station. Die Servicefahrzeuge würden immer zu spät kom-
men, die Station müsste mehrmals täglich angefahren werden. Eine Verbesserung der Situa-
tion ist vor allem durch Kapazitätserhöhung zu erzielen – Vergrößerung der Station oder Er-
öffnen einer weiteren Station in der Nähe zur Entlastung.
Abbildung 41: Füllstandschwankungen im Zeitverlauf; a) der Idealzustand: Tagesschwankun-
gen, ausgeglichen; b) zu klein dimensioniert: Tagesschwankungen, überlastet; c) Befüllen not-
wendig: Tagesschwankungen, absteigend; d) Entleeren notwendig: Tagesschwankungen, an-
steigend.
Abbildung 41 c) zeigt die Füllgradschwankungen einer Station, bei der die Tagesschwankun-
gen überlagert sind von einem Überhang an Entlehnungen gegenüber den Rückgaben. Dies
würde dem typischen Bild einer höhergelegenen Station etwa im 15. oder 16. Bezirk entspre-
chen. An einer solchen Station kann oder soll das Serviceteam durch Befüllen mit Rädern das
Ungleichgewicht ausgleichen. Der Grenzwert ab dem befüllt werden soll, ist aufgrund der zu
erwarteten Höhe der Tagesschwankungen zu wählen. Die Abbildung 41 d) hingegen zeigt den
Füllgrad einer Station bei der die Anzahl der Räder über die Tage ansteigt. Das würde dem
typischen Bild einer tiefergelegenen Station etwa im 2. oder 3. Bezirk entsprechen. Diese Sta-
tion muss durch das Serviceteam entleert werden.
Quellen
[1] Schneeweiß, H.; Das Fahrradverleihsystem Citybike Wien; Diplomarbeit BOKU Wien;
2012
[2] Brandstätter, P.; Veloce Fahrradbotendienst: Public Velo; Bicycle Research Report No.
27, 1992
Seite 101
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Garagen und Highways: Ein Best-of Parken und Fahren
Tadej Brezina
Seite 102
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 103
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Garagen und Highways: Ein Best-of Parken und Fahren Radverkehrsinfrastrukturen (RVI) sind in den letzten zwei Jahrzehnten laufend errichtet
worden – dem Boom folgend, den Radverkehr (RV) fördern zu wollen. An vielen Orten
geschah dies jedoch mit zu starken Konzessionen an den motorisierten Individualverkehr oder
in Unkenntnis kritischer Designparameter, sodass Erfolge und Benutzbarkeit vielerorts oft
gering blieben oder gar ausblieben. Anhand dieser exemplarischen Zusammenschau soll die
Messlatte für kompromissloses RVI-Design ausgelotet werden. Für das Parken werden
Anforderungen, Designelemente und spezielle Features von Fahrradstationen beleuchtet.
Beim Fahren werden Grundbedürfnisse wesensgerechter RVI-Planung beschrieben und vier
Beispiele exemplarisch vorgestellt.
1 Parken
„Why should anyone steal a watch when he could steal a bicycle?“
Dieses Zitat von Flann O'Brien13 umreißt elegant die Vorzüge des Fahrrades (FR) und die
Verlockung, die das Radfahren auf den Menschen ausübt. Warum eine Straftat begehen, um
möglicherweise über die vergängliche Zeit präzise Bescheid zu wissen, wenn man sich mit
dem Rad aus der Energieersparnis gegenüber dem Zu-Fuß-Gehen mit Sicherheit neue Frei-
heiten ergaunern kann? Eine Vorrichtung, die so große Verlockungen ausstrahlt, gehört auch
gut gesichert abgestellt, damit auch die rechtmäßigen Benützer deren Vorzüge genießen
können – zumindest vorübergehend. Dafür bedarf es dem Zweck und der Dauer angepasste
Abstellmöglichkeiten.
1.1 Anforderungen
Die Parkdauer und der Zweck des Weges bestimmen die Anforderungen an Fahrradabstell-
anlagen. Die Anwendungsfälle decken dabei ein breites Spektrum ab, vom (nachrüstbaren)
Einzelstellplatz über (nachrüstbare) Anlagen für Mehrfamilienhäuser bis zu Großanlagen an
ÖV-Knoten mit Zusatzfunktionen. Das zu erfüllende Minimum der Anforderungen ist dabei
[1-3]:
Ausreichende Anzahl und Qualität ist vorhanden;
die Beherbergung von allen Rädern (groß & klein, teuer und billig) ist möglich;
Diebstahl- und Vandalismusschutz ist gegeben;
Witterungsschutz ist vorhanden;
einfache Bedienung ist möglich;
Außenanlagen sind fahrend erreichbar;
Zugangsbreiten und Manövrierplatz sind ausreichend dimensioniert (siehe Abbildung 42).
Die Abbildung 43 zeigt das zunehmende Sicherheitsbedürfnis mit zunehmender Abstelldauer
– und die dazu passenden technischen Einrichtungen, um diesem nachkommen zu können.
13 eigentlich Brian O'Nolan, Irischer Schriftsteller.
Seite 104
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 42, links: Der Platzbedarf für das Abstellen und Manövrieren von Fahrrädern; rechts:
Abschätzungshilfe des benötigten Platzbedarfs als Funktion der Anzahl der Fahrräder
sowie der Anordnungsart [4].
Abbildung 43: Zusammenhang von Abstelldauer und Entfernung vom Zielort sowie
mögliche/notwendige Sicherungsmaßnamen [4].
Benutzerfreundliche Abstellanlagen weisen die notwendigen Designelemente in zweckdien-
licher Anordnung und Anlageverhältnissen auf. Im Optimalfall sind Abstellanlagen samt ihrer
Zugangswege bidirektional befahrbar. Das Abstellen von Fahrrädern hat bereits in vielen
Normungen – technischen und rechtlichen – Einzug gehalten. Tabelle 8 zeigt anhand dreier
exemplarischer Nutzungen die Tiefe und Vielfalt der Regelungen in Europa. Hier ist auch die
Oberösterreichische Bautechnikordnung von 1994 idgF. angeführt. Sie stellt neben den Bun-
desländern Steiermark und Vorarlberg eine Ausnahme der sonst bei Fahrradabstellplätzen
sehr tristen österreichischen Gesetzeslage dar (siehe Tabelle 9). Bei der Bereitstellung von
Abstellplätzen ist eine Aufteilung dieser zwischen der Lage „im Gebäude“ und „außerhalb des
Gebäudes“ als Funktion der Gebäudenutzung zu beachten. Es ergibt sich auch ein
unterschiedlicher Bedarf an Kurzfrist- und Langfristabstellplätzen. Damit geht auch das Be-
dürfnis einher, über das „Wegsperren“ statt des „Absperrens“ allein, den Diebstahlschutz zu
erhöhen (sieheTabelle 10).
Seite 105
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Nutzung
Normen, Richt- und Leitlinien
SN 640 065 (Stufe B, 8–15;
Schweiz)
Hinweise zum Fahrradparken (FGSV, BRD)
Oberösterr. BauTV 1994
Fahrradparken in Berlin
Bicycle parking manual
(Dänemark)
1. Wohnen 0,5–0,6
Abstellfelder/ZI
1 Stk./30m²
GesamtWFL
1 Stk./50m²
WohnNFL 2 Stk./Whg.
2–2,5
Stk./100m²
WohnFL
2. Arbeiten 1 Stk./12,5AP 1 Stk./3,3 AP 20 AP 1 Stk./100m²
Brutto-BüroFL
1 Stk./2,5 arb.
Pers.
3. Geschäfte
(sonstige)
1 Stk./25–50m²
VFL
1 Stk./25–40m²
VFL
1 Stk./50
Kunden
1 Stk./100m²
BGF
1–2 Stk./100m²
VFL
Tabelle 8: Der Fahrradabstellbedarf in unterschiedlichen (internationalen) Normen an drei
exemplarischen Nutzungen dargestellt. WFL…Wohnfläche, ZI…Zimmer, AP…Arbeitsplatz,
NFL…Nutzfläche, VFL…Verkaufsfläche, BGF…Brutto-Geschoßfläche [3, 5].
Bundesland Fahrrad in der BauO? Anzahl?
Burgenland Nein -
Kärnten Nein -
Niederösterreich Ja (BautechnikVO
§112(1))
Gebäude mit > 4 Wohnungen müssen einen Kin-
derwagen und Fahrradabstellraum haben.
Oberösterreich Ja (BauTechG §44, Bau-
TechVO, §16) Detailliert nach Nutzungen
Salzburg Ja (BautechnikG §25(1)) 2 pro Wohnung bei mehr als 5 Wohnungen pro Ge-
bäude.
Steiermark Ja (BauG §92) Detailliert nach Nutzungen
Tirol Ja (BauO §10) Durch GEM-VO festlegbar
Vorarlberg Ja (BauG §13a) Detailliert nach Nutzungen (StellplatzVO §3)
Wien Ja, GaragenG §50(10),
BauO §119(5), §120(1)
Ab 2 Wohnungen ein der Wohnungsanzahl entspre-
chend großer Fahrradabstellraum; „entsprechendes
Ausmaß“ für Wohn-, Büro- und Geschäftsgebäude
Tabelle 9: Fahrradabstellen in den Ö Bauordnungen; (www.ris.bka.gv.at).
Seite 106
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Anteil Abstellplätze [%]
Nutzung im Gebäude außerhalb des Gebäudes
Wohnen 70 30
Arbeiten 30 70
Kunden 0 100
Soziale Infrastruktur 0 100
Sport, Freizeit 0 100
Tabelle 10: Aufteilungsschlüssel von Abstellplätzen nach Art der Nutzung [6].
1.2 Designelemente
Absperrschlaufen und -bügel stellen die einfachsten, aber wirkungsvollsten Absperranlagen
für den (halb)öffentlichen Raum dar – ob fix eingeplant oder zur effektiven Nachrüstung von
Bestandsplanungen (siehe Abbildung 44). Bei Abstellanlagen mit einer größeren Anzahl an
Stellplätzen sind der ausreichende Platzbedarf seitlich und genügend Manövrierfläche in den
Zugangsgängen zu beachten. Begegnungsbreiten müssen ausreichend groß für eine gleich-
zeitige Befahrbarkeit in beiden Richtungen ausgelegt werden. Wichtig ist die funktionelle und
leicht zugängliche Anordnung der Designelemente und notwendigen Funktionen. Abbildung
45 zeigt ein Beispiel eines Funktionsdiagramms für einen Abstellraum im Inneren eines
Wohnhauses samt der Verknüpfung zu den zusätzlich angebotenen Funktionen.
Abbildung 44: Bestehende Elemente des öffentlichen Raumes können mit innovativen Methoden
schnell zu sicheren Radabstellplätzen umfunktioniert werden; Fotos: www.cyclehoop.com.
Seite 107
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Abbildung 45: Ein beispielhaftes Funktionsdiagramm eines optimalen Fahrradabstellraumes in
Wohngebäuden. Mindestanforderung an die Reparaturstation sind Werkzeugkasten
und Pumpe [7].
1.3 Großanlagen und Fahrradstationen
Großanlagen sind am besten an Orten mit großem Zielverkehr einsetzbar. Häufig sind dies
mittlere bis große ÖV-Knotenpunkte, die auch einen starken lokalen bis regionalen Fahrrad-
einzug haben. Gibt es zum reinen Abstellen noch andere Servicefunktionen, so spricht man
von Fahrradstationen, in der Schweiz auch von Velostationen. Der State-of-the-Art für große
Abstellanlagen, insbesondere für den Anwendungsfall Fahrradstation, beinhaltet folgende
Qualitätsmerkmale [1-3]:
Auch Innenanlagen sind fahrend erreichbar;
die Organisationsform sieht eine gute Mischung aus Stellplätzen im Gemeinschaftsraum
und Individualabteilen vor;
Direktfahrt zu und aus Innenräumen, am besten in der Hauptrelation, ist möglich;
Reparaturbasis ist mit Personal besetzt oder wird in Selbstbedienungsform angeboten
(Vandalismusschutz!);
Ablagen und Schließfächer für Utensilien sind vorhanden, z.B. für Ersatzgewand;
Umkleide- und Duschmöglichkeit ist gegeben;
die Zufahrt beinhaltet einen Vorraum als Schmutz- und Feuchtigkeitsfang;
Stellplätze für Sonderfahrzeuge sind vorhanden, das sind Lastenfahrräder, Tandems
aber auch normale Räder mit einem Lasten- oder Kinderanhänger.
Eine mögliche Anordnung von funktionellen Bereichen von Fahrradstationen zeigt Abbildung
46. Das ist bei Fahrradstationen von besonderer Wichtigkeit, da im Vergleich zu reinen Ab-
stellanlagen auch zusätzliche Funktionen und eine große Nutzerzahl (oft stark ausgeprägte
Spitzenbelastungen) in Einklang gebracht werden müssen. In Tabelle 11 sind Anlagepara-
meter von Designelementen für die maximal fahrradfreundliche Gestaltung angeführt, deren
Einhaltung zwar notwendig, aber nicht automatisch hinreichend ist.
Seite 108
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 46: Raumprogramm für Fahrradstationen; (www.velostation.ch).
Tabelle 11: Ausrüstung und Anlageparameter von Fahrradstationen [8].
Bereich Funktionen, zu beachten Fläche [m²]
Vorzone Zu-/Abfahrt, Absteigen; Wartefläche für 5 Fahrräder; Ebenheit
und gute Beleuchtung 10 – 20
Ein-/ Ausgang bMIN=2,50m (2 Fahrräder); hMIN=2,20m; Anmeldeterminal;
Ebenheit u gute Beleuchtung 10 – 15
Verteilzone Bewegungsraum für 5 Fahrräder; helle und klar orientierende
Gestaltung 10 – 20
Korridor bMIN=2,20m; hMIN=2,30m; Übersichtlichkeit; Winkel- und
Eckenfreiheit -
Loge Bewachung und Kontrolle; Arbeitsplatz für Auskünfte,
Administration und Überwachung; Personalraum 5 – 10
Rampe/ Treppe bMIN=2,50m; sMAX=15%; sTREPPE,MAX=30%; Gerade bzw.
Wendelung; Länge – Zwischenpodeste; Schieberillen -
Abstellanlagen
bGANG,MIN=2,20m für Manövrierraum; hMIN=2,80m für
doppellagige Aufbewahrung; Einfache Zufahrt; Beleuchtung
und Witterungsbedeckung; Schutz gegen Kippen, Rollen,
Fallen
2 – 3 / FR
Dienstleistungen
Toiletten 5 – 9 / Stk.
Schließfächer 2 pro Stk.
Serviceräume (Reparatur, Reinigung, Vermietung) 10 – 15
Seite 109
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
2 Fahren
“Nothing beats the simple joy of a bicycle ride.”
Dieser Ausspruch von John F. Kennedy zeigt deutlich, dass Fahrräder nicht nur vor den
besitzansprüchlichen Begehrlichkeiten anderer geschützt werden sollten, sondern dass auch
die Entfaltbarkeit des Fahrvergnügens eine wesentliche Komponente erfolgreicher Radver-
kehrspolitik ist. Die oftmalig stiefmütterliche und nicht wesensgerechte Ausgestaltung von RVI
steht jedoch vielerorts dem „simple joy“ im Weg – und macht Radfahren dort zu einer
barrierebehafteten, demotivierenden Angelegenheit. Grundlage von erfolgreicher Radver-
kehrspolitik ist das Vorsehen von RVI – ob getrennt oder inkludiert –, die den Grundansprü-
chen der wesensgerechten Fortbewegung mit dem Fahrzeug Fahrrad entspricht. Wesens-
gerecht ist die Fortbewegung als Fahrzeug und nicht als imaginierter „Fußgänger mit Rädern“,
die vielerorts als vermeintliche Designgrundlage anzutreffen ist (siehe Abbildung 47). Die
Ansprüche bezüglich Geschwindigkeit, Bevorrangung und Geradlinigkeit der Linienführung
variieren jedoch stark nach dem Wegezweck. Die Ausgestaltung für Transitwünsche sollte
möglichst wenig dem Bedarf nach kleinräumiger Anbindung widersprechen.
Abbildung 47: Rechtwinkeliges Gehsteig-Radweg-Design in Valencia, Spanien; Foto: T. Brezina.
2.1 Ansprüche
Das Wesen des Radverkehrs erhebt Ansprüche, deren Einhaltung eine notwendige, aber
nicht zwingendermaßen hinreichende Bedingung für attraktiven und umfangreichem
Radverkehr ist. Der Genuss und die Vorzüge des Radverkehrs können sich nur dann
entfalten, wenn möglichst viele der folgenden Ansprüche erfüllt sind:
Netzwerk mit geringen Umwegen ist gegeben, das ist vor allem im urbanen Alltagsver-
kehr wichtig;
Nähe dieses Netzwerks zu besonders radaffinen Quellen und Zielen;
Seite 110
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Kontinuität der Befahrbarkeit ist gegeben (Belag, Anlageform und Organisation);
verlorene Höhen sind minimiert;
aufenthaltsminimierende Organisationsformen, z.B. Grüne Wellen oder Bike Boxes, sind
vorhanden;
„safe & secure“ … die Anlagen und Organisationsformen liefern den Benutzern objektiv
und subjektiv Sicherheit – nicht nur den subjektiven Eindruck davon;
die Straßenräume sind (MI)V-beruhigt, aber für Radfahrer zügig befahrbar;
ein möglichst bedarfsgerechtes Maß von direkte Anbindung einerseits und flüssiger
Befahrbarkeit ist gegeben – Erschließung vs. Transit.
2.2 Parameter
Der Energieverbrauch beim Radfahren und die notwendige Leistung des Fahrers (PR) sind
neben anderen Einflussgrößen abhängig vom zu überwindenden Höhenunterschied ∆h und
der Steigung s. Für möglichst attraktive Radverkehrsverbindungen ist daher eine Minimierung
von verlorenen Höhenunterschieden – ∆h in Formel (1) – wichtig. Formel (1) berechnet die
Veränderung der potentiellen Energie des Gespannes Fahrrad und Radfahrer zusätzlich noch
in Abhängigkeit seiner totalen Masse und der Erdbeschleunigung. Die Leistung des Rad-
fahrers – Formel (2) – ist abhängig von der Geschwindigkeit v, ihrer Veränderung, der Stei-
gung s, der gesamten Masse mTOT sowie der effektiven Masse mEFF, die auch die Rotation der
Räder mitberücksichtigt. Zudem spielen noch der mechanische Wirkungsgrad ηMECH, cR, die
Windgeschwindigkeit vW und kA in die Leistung hinein. Da der Energieverbrauch auch linear
von der zurückgelegten Entfernung abhängt, leitet sich daraus auch zwangsweise eine
Vermeidung von Umwegen ab. Darüber, welcher Umweg von Radfahrern noch akzeptiert
wird, ist in der Literatur aber eine große Streubreite zwischen 8 und 67 Prozent zu finden.
Diese Werte hängen von der Fragestellung der sie ergebenden Untersuchung ab – siehe
Tabelle 12.
Umwegfaktor Quelle a...gegenüber parallelen Hauptverkehrsstraßen b...gegenüber der kürzestmöglichen Verbindung c...Durchschnitt für Fußgänger d...Zufahrt zu Fahrradkorridor
1,08d [9]
1,10a [10]
1,20b [10]
1,25 [11]
1,30 Alrutz in [3]
1,42c [12]
1,67d [9]
Tabelle 12: Literaturwerte für akzeptable Umwegfaktoren.
hgmEPOT (1)
Seite 111
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
vmcsgmvvkv
P EFFRTOTWA
MECH
R
2
(2)
Eine praktische Umsetzung nicht sachkundig gestalteter Fahrradinfrastruktur zeigt die Abbil-
dung 48. Hier wurde auf einem Teilstück der Dammgasse in Baden, das eine Brücke über den
Fluss Schwechat beinhaltet, ein baulich getrennter, kombinierter Geh- und Radweg gebaut.
Dessen Brücke hat jedoch im Vergleich zur Straßenbrücke eine deutliche zusätzliche
Fahrbahnhöhe, da eine Konstruktion mit Tragwerk unter der Fahrbahn, statt daneben, gewählt
wurde. So wird den Radfahrern dauerhaft die Barriere eines höheren Energieverbrauchs
entgegengestellt.
Abbildung 48: Unsachgemäße Infrastrukturplanung kann zusätzliche verlorene Höhenunter-
schiede produzieren. Hier eine Radweg-Brücke (linker Bildrand) deren Tragwerk sich unter der
Fahrbahn befindet. Im Gegensatz zur Fahrbahn ist ein deutlicher, zusätzlicher Höhenunter-
schied gut erkennbar; Foto: T. Brezina.
Aus den Grenzwerten der Literatur ergibt sich der Zusammenhang von Fahrgeschwindigkeit
und Kurvenradius – und somit übertragbarer Seitenreibung zwischen Reifen und Oberflächen-
belag (siehe Abbildung 49).
Seite 112
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Abbildung 49: Zusammenhang von Radius und fahrbarer Geschwindigkeit in der Literatur für
asphaltierte und wassergebundene Oberflächen [13].
Abbildung 50: Leistungsfähigkeit von Radverkehrsanlagen [13].
Geschotterte Oberflächen, die oft in ökologisch sensiblen Abschnitten bevorzugt werden,
bedürfen bei gleicher Fahrgeschwindigkeit größere Radien als Bitumenoberflächen. Will man
höhere Fahrgeschwindigkeiten ermöglichen, so sind entsprechende Radien vorzusehen, z.B.
v = 30 km/h rASPHALT > 20 m. Die Leistungsfähigkeit von RVI ist in der westlichen Literatur
bis zu einer maximalen Breite von 3 m angegeben. Will man jedoch für Radhighways
(b ≥ 4,0 m) Richtwerte ermitteln, so kann man sich des Tricks bedienen und tatsächliche
Messungen von asiatischen Straßen heranziehen. Dazu sind Straßen am besten geeignet,
bei denen Autos einen ganz geringen Teil ausmachen und der überwiegende Teil des
Verkehrs sich aus harmonisch fließendem Rad- und Mopedverkehr zusammensetzt. Abbil-
Seite 113
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
dung 50 zeigt zwei Interpolationskurven (strichlierte Linie: linear; ausgezogene Linie: Potenz-
funktion) zwischen Asiatischen und Europäischen Leistungsfähigkeitswerten als Funktion der
Breite.
2.3 Fahrradstraßen
Fahrradstraßen haben mit April 2013 auch in die Österreichische Straßenverkehrsordnung
Einzug gefunden. In weitaus fahrradaffineren Ländern (DE, DK, NL … siehe Abbildung 51)
sind sie jedoch schon lange ein bewährtes verkehrspolitisches Instrumentarium, das in engem
Zusammenhang mit baulichen und organisatorischen Komponenten steht. Kerneigenschaften
von Fahrradstraßen sind aus verkehrsplanerischer Sicht:
Vorrang für den RV – das KFZ ist „nur“ zu Gast;
restriktiver Zugang für KFZ;
geringe KFZ-Anzahl;
geringe (KFZ-)Geschwindigkeiten;
Bevorrangung in legistischer und/oder baulicher Form;
Sonderrechte für RV gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern sind möglich;
rechtliche und/oder bauliche Entität;
wesentlicher Netzbestandteil;
Wiedererkennungswert durch Corporate Identity.
Abbildung 51: Fahrradstraße in Nijmegen, NL. 30 km/h Beschränkung. Schilder, die auf den
Gaststatus des Automobils hinweisen und auch eine radfahrfreundliche Gestaltung sind
wesentliche Merkmale [14].
Seite 114
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Die Österreichische StVO legt im § 67 die Eigenschaften für Fahrradstraßen, wie folgt, fest:
Zur Sicherheit, Leichtigkeit oder Flüssigkeit des Fahrradverkehrs oder zur Entflechtung
des Verkehrs verordenbar;
aufgrund von Lage, Widmung oder Beschaffenheit von Gebäuden und Gebieten;
hat dauerhafte oder zeitweilige Gültigkeit;
Kraftfahrzeugverkehr prinzipiell verboten, Ausnahme: Zu- und Abfahrt und Fahrzeuge,
die auch Fußgängerzonen befahren dürfen (StVO § 76a Ab. 1). Eine Querung ist er-
laubt;
Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h;
Radfahrer dürfen von KFZ weder gefährdet noch behindert werden.
Elemente, wie man Fahrradstraßen physisch über das rechtliche Instrument hinaus noch
attraktiver gestalten kann, sind:
Rückbau, Einengungen an Einmündungen;
bauliche Durchfahrtssperren für PKW, aber durchlässig für Fahrräder;
lückenlose Wegweisung;
gehäufte Bodenmarkierungen;
Bike Boxes bei VLSA;
Kontaktschleifen im Boden für VLSA-Anmeldung;
Wartezeitindikator für RV an VLSA.
Lichtzeichen als Indikatoren für eine Grüne Welle.
2.4 Radhighways
Radhighways sind auch unter dem Namen Radschnellwege (BRD), Cycling super highways
(UK), fietssnellwegen (NL) oder cykelsuperstier (DK) bekannt. Man versteht darunter
möglichst kreuzungsfrei und besonders auf die Bedürfnisse des flotten Vorankommens aus-
gelegte Radfahranlagen. Diese laufen meistens baulich von Straßen abgesetzt und sollen in
der Regel eine attraktive Verbindung zwischen Orten oder aus Umlandgemeinden in größere
Städte ermöglichen. Neben der Kreuzungsfreiheit ist auch die große Breite, die ein Nebenein-
anderfahren pro Fahrtrichtung ermöglichen soll, ein markantes Gestaltungselement.
Der erste Radhighway wurde 1900 in Kalifornien als gebührenpflichtiger und aufgeständerter
Weg errichtet und sollte dem damaligen Radfahrboom gerecht werden14. Er kam jedoch zu
spät, das Automobil begann im Großraum Los Angeles gerade das Zepter an sich zu reißen.
Heute erleben Radhighways einen zweiten Boom. Nach niederländischem Vorbild, dort sind
Radhighways mittlerweile ein erprobtes Infrastrukturangebot, findet die Radhighway-Idee nun
vermehrt Anwendung, z.B. im Vorarlberger Rheintal, in London, Kopenhagen, dem Ruhrge-
biet, der Metropolregion Hannover oder dem Korridor Frankfurt/M. – Darmstadt [15-18].
London und Kopenhagen haben sich ambitionierte Pläne gesetzt, eine große Anzahl – 12
respektive 28 (siehe Abbildung 52) – an radialen und tangentialen Radhighways zu errichten,
wobei schon erste Erfolge verzeichnet werden konnten. Der Praxistest für London hat jedoch
gezeigt, dass, neben einem mustergültigen Marketing, in Teilbereichen die Ausführung den
14 http://en.wikipedia.org/wiki/California_Cycleway
Seite 115
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
geschürten Erwartungen hinsichtlich Linienführung, Priorisierung, Geradlinigkeit und Erkenn-
barkeit noch nicht gerecht werden konnte15. Ähnlich wie Fahrradstraßen weisen Radhighways
in der Anwendung eine gemeinsame Bildsprache in Bodenmarkierung und Wegweisung auf,
die die Wiedererkennbarkeit ermöglichen und die Priorisierung, wenn baulich und organi-
satorisch ausgeführt, unterstützen soll.
Abbildung 52: Geplantes Netz an Radschnellwegen in Kopenhagen – Cykel superstier;
(http://www.supercykelstier.dk/).
2.5 Grüne Welle
Grüne Wellen haben sich zur Priorisierung von RVIs mit viel Radverkehr als ganz besonders
gut geeignet erwiesen. Empirische Messungen der Geschwindigkeit von Radfahrern in euro-
päischen Städten haben gezeigt, dass der Großteil der Durchschnittsgeschwindigkeiten bei
geringem Wind und weniger als 1 % Gefälle zwischen 18 und 22 km/h liegt [19]. Dies legt für
die Grüne Welle eine Progressionsgeschwindigkeit von 20 km/h nahe, die auf langsamere
Fahrer stimulierend wirkt und für Fahrer mit höherer Wunschgeschwindigkeit nicht zu langsam
ist [20]. Grüne Wellen für den Radverkehr sind städtisch gut anwendbar, da die Durchschnitts-
geschwindigkeit des Busverkehrs aber auch des MIV ähnlich groß ist wie eine für den
Radverkehr zumutbare Progressionsgeschwindigkeit. Grüne Wellen wurden bereits in einigen
Städten an ausgewählten Straßenabschnitten umgesetzt. In Kopenhagen z.B. auf der Straße
15 Persönliche Auskunft Beatrice Stude.
Seite 116
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Norrebrogade wurde über 2,2 km Länge und 12 signalisierte Kreuzungen eine Grüne Welle
für 20 km/h installiert. Die Abbildung 53 zeigt die Wirkung der Grünen Welle auf die Rad-
fahrergeschwindigkeit. Da kein Abbremsen vor Ampeln und das nachfolgende Beschleunigen
mehr notwendig sind (oberes Diagramm), harmonisiert sich die Geschwindigkeit bei knapp
über 20 km/h (unteres Diagramm). Das Radfahren wird in Summe ergonomischer. In Odense
(DK) wurde für die Grüne Welle eine wegseitige Signalisierung in Form von 45 Pfosten mit
Lichtern umgesetzt. Die Grüne Welle bewegt sich in Form eines grünen Lichts auf diesen
Pfosten und zeigt so dem Radfahrer, ob er sich innerhalb befindet, oder nicht. Andere
Installationen in Odense zeigen den Radfahrern ihre aktuelle Geschwindigkeit an, damit diese
ihr Verhalten an die Grüne Welle anpassen können. In der Amsterdamer Raadhuisstraat
wurde eine Geschwindigkeit von 18 km/h der Grünen Welle zugrunde gelegt. Hier wird den
Radfahrern keinerlei Information zur Lage der Grünen Welle oder der aktuellen Geschwindig-
keit gegeben, die Radfahrer müssen dies selbst herausfinden.
Abbildung 53: Auswirkung der Grünen Welle auf das Geschwindigkeitsniveau; oberes
Diagramm: davor, unteres Diagramm: danach [21].
2.6 Radfahrstreifen Soest
Eine kreative Anwendung von klassischen Radinfrastrukturelementen findet gar nicht so
selten statt. Im Regelfall jedoch ist kreativ unter Anführungszeichen zu lesen, denn die
Planung findet dominierend unter den Prämissen des Automobilverkehrs statt, dem Radver-
Seite 117
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
kehr bleiben viel zu oft „kreative“ – lies wenig alltagstaugliche – Insel- oder Randlösungen
übrig. Anders ist das Beispiel von Soest, einer mitteldeutschen Kleinstadt (ca. 47.000
Einwohner) mit mittelalterlich verwinkeltem Stadtkern. In der Jakobistraße wurde auf einem
450 m langen Abschnitt der Radfahrstreifen nicht an den Fahrbahnrand der einspurigen
Straße gezwängt, sondern in deren Mitte platziert (siehe Abbildung 54). Dies holt nicht nur
den Radverkehr vom Fahrbahnrand in die Mitte der Aufmerksamkeit zurück, sondern erhöht
dadurch auch die Sicherheit. Motorisierte Fahrzeuge können sich auf beengten Kernfahr-
bahnen nicht mehr an Radfahrern zu knapp vorbeizwängen. Und dies kann auch nicht mehr
mit zu hohen Geschwindigkeiten passieren, womit das Geschwindigkeitsprofil der gesamten
Straße ein ausgewogeneres ist. Die deutsche Straßenverkehrsordnung verbietet so eine
Markierung nicht ausdrücklich. Die Rückmeldungen sind nach Aussage des städtischen Fahr-
radbeauftragten ausgesprochen positiv, was für die Verträglichkeit dieser Lösung bei den
verkehrlichen Rahmenbedingungen (Buslinie im 30 Minuten-Takt und DTV: 4.000 PKW, 200
LKW/Bus und 900 RF) spricht16. Dieses einzige bisher bekannte Beispiel in Deutschland ge-
wann im Frühjahr 2013 auch den deutschen Fahrradpreis in der Kategorie „Alltagsmobilität“.
Abbildung 54: Mittig abmarkierter Fahrradstreifen in der Jakobistraße in Soest (DE);
Foto: T. Brezina.
3 Conclusio
Optimale Infrastruktur ist eine Funktion des Zwecks, den sie erfüllen soll. Jedoch sollte immer
mit bedacht werden, dass der Radverkehr im Regelfall ein Nahdistanz-Verkehrsmittel ist und
der Erfolg in Siedlungsgebieten von einer dichten Erschließung abhängt. „Isolierte“ Lang-
distanzverbindungen sind eher bei regionalen und peri-urbanen Verbindungen zu bevorzugen.
16 Mailauskunft Manfred Scholz, Fahrradbeauftragter Stadt Soest.
Seite 118
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Beim Parken ist der Sicherungsgrad abhängig von der Parkdauer. Gerade die Möglichkeit,
das Gefährt gesichert an Quelle und Ziel einsatzbereit vorzuhalten beeinflusst wesentlich, ob
das Fahrrad als Verkehrsmittel gewählt wird. Diebstahls- und Witterungsschutz sind hierbei
die wichtigsten Komponenten, die jedoch in ihrer Massivität von der zu erwartenden Abstell-
dauer abhängen. In diesem Kapitel sind die wichtigsten Anforderungen und Designparameter
zusammengetragen worden – sowohl zum Abstellen generell als auch für Fahrradstationen im
Speziellen.
Beim Fahren gilt mit allerhöchster Wichtigkeit: Der Planer, die Planerin hat den Radfahrer, die
Radfahrerin als umwegsensitives Fahrzeug zu verstehen und demgemäß seine, ihre Planun-
gen zu gestalten. Mit den Infrastrukturkonzepten Fahrradstraße, Radhighway, Grüne Welle
und progressive Anwendung traditioneller RVIs wurden in Kommunen mit hohem Radver-
kehrsanteil erprobte Instrumente zusammengefasst, die einer Nachahmung in beim Radver-
kehr noch nicht so erfolgreichen Ländern, z.B. Österreich, harren.
Abschließend ist festzuhalten, dass es in Österreich ein deutliches Entwicklungspotential nach
oben gibt, vor allem an Punkten der Raumkonkurrenz mit anderen Verkehrsmitteln. Auch die
planerische und behördliche Genehmigungskompetenz ist in Sachen Radverkehr mit hohem
Entwicklungspotential versehen, wie der hier erbrachte Vergleich mit der BRD, den NL und
DK umgehend nahe legt.
Quellen
[1] AGFS, ... und wo steht ihr Fahrrad? Hinweise zum Fahrradparken für Architekten und
Bauherren., Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte und Gemeinden in NRW",
2003.
[2] T. Franke, Tagungsbericht "Die fahrradfreundliche Stadt", in: Die fahrradfreundliche
Stadt: eine lösbare Aufgabe der Kommunalpolitik; eine Tagung der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Erlangen, 1995
[3] M. Meschik, Planungshandbuch Radverkehr, Springer Verlag, 2008.
[4] P. Celis und E. Bolling-Ladegaard, Bicycle parking manual, The Danish Cyclists
Federation, 2008.
[5] VSS, SN 640 065 - Leichter Zweiradverkehr. Abstellanlagen, Bedarfsermittlung,
Vereinigung Schweizer Strassenfachleute, 1996.
[6] Spath + Nagel, Fahrradparken in Berlin - Leitfaden für die Planung, Senatsverwaltung
für Stadtentwicklung, Stadt Berlin, 2008.
[7] H. Frey, T. Brezina und J.M. Schopf, Aspern Seestadt - Step2: Radabstellräume. Bericht
zu 5.3.11.i, Wien 3420 Aspern Development AG, 2010, S. 13.
[8] C. Merkli, J. Garcia und M. Wälti, Leitfaden - Für die Planung und Umsetzung von
Velostationen, Büro für Mobilität AG, 2004.
[9] M. Winters, K. Teschke, M. Grant, E.M. Setton und M. Brauer, How far out of the way
will we travel? Built influences on route selection for bicycle and car travel., Transport
Research Record, 2190 (2010), S. 1-10.
Seite 119
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
[10] FGSV, Empfehlungen für Radverkehrsanlagen - ERA 2010, Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen, 2010.
[11] H. Richard, Handbuch für Radverkehrsanlagen und Radverkehr, Otto Elsner
Verlagsgesellschaft, 1981.
[12] H. Boesch und B. Huber, Der Fußgänger in der Siedlung: Fußweg-Planung unter
besonderer Berücksichtigung der Haltestellen-Zugänge, ETH Zürich, 1989, S. 143.
[13] R. Molitor, M. Niegl, T. Brezina, N. Ibesich und H. Lemmerer, su:b:city (suburbia bike
city) - Endbericht, 2011, S. 59.
[14] M.J. teLintelo, The Nijmegen Cycling Experience - 8 years of progressive bicycle policy
in the Netherlands, in: Velo-city global 2010, Copenhagen, 2010
[15] A. Reidl, Fahrradautobahnen für Pendler, in: Zeit Online, 20.08.2012
[16] M. Harting, Zwischen Frankfurt und Darmstadt: Bundesweit erster Schnellweg für
Radler, in: www.faz.net, 28.02.2014
[17] P. Rohner, Grünliberale fordern eine Velo-Schnellstrasse im Limmattal, in:
www.limmattalerzeitung.ch, 07.03.2013
[18] J. Berger, Schnellradwege als Anreiz zum Umsteigen, in: derStandard.at, 08.04.2010
[19] F. Beyer, Koordinierung von Lichtsignalanlagen auf innerstädtischen Radrouten in Wien
anhand der Bedürfnisse der Radfahrer, Technische Universität Dresden, 2009
[20] K. Mensik und F. Beyer, Koordinierung von Lichtsignalanlagen für den Radverkehr,
Straßenverkehrstechnik, 57 (2013), S. 621-627.
[21] N.R. Hoegh, Green Waves for Cyclists in Copenhagen, in: Velo-city 2007 - From Vision
to Reality, ECF, München, 2007
Seite 120
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 121
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Die Vortragenden
Seite 122
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 123
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Die Vortragenden
Johannes Pepelnik
Geboren im Juni 1970, promovierte 1996 an der Universität Wien nach Abschluss des rechts-
wissenschaftlichen Studiums zum Dr.iur. Im Anschluss an Studium und Gerichtsjahr trat er als
Rechtsanwaltsanwärter in die Kanzlei Schönherr Barfuss Torggler & Partner ein und wirkte
maßgeblich an der Eröffnung der Büros der Kanzlei in Bukarest und Sofia mit. Im November
1999 wechselte Dr. Johannes Pepelnik in die Rechtsabteilung der AGRANA Beteiligungs-AG.
Nach erfolgreicher Ablegung der Rechtsanwaltsprüfung gründete er im März 2004 eine eige-
ne Rechtsanwaltskanzlei in Wien mit Niederlassungen in Hamburg und Bukarest. Zurzeit be-
kleidet er in diversen Gesellschaften Funktionen als Geschäftsführer bzw. Prokurist.
Vater von zwei RadfahrerInnen. Beschäftigt sich nicht nur beruflich mit Rechtsfragen rund
ums Radfahren sowie Vereinsrecht. Autor des Buches „Rechts-Berater für Radfahrer“ und
Mitautor von „Radfahren in Wien“. Ehrenmitglied in zahlreichen Fahrradverbänden.
Alexander “Alec” Hager
Mag., 41; ist Obmann der Wiener Radlobby IG Fahrrad und Sprecher sowie Geschäfstführer
des Bundesverbandes Radlobby Österreich. Er war Chefredakteur des Radkultur-Magazins
„Velosophie“ und organisiert seit 2007 das International Bicycle Film Festival Vienna, das er
2012 in das einwöchige Radkultur-Festival „Radkult Wien“ umgewandelt hat. 2009 hat er ge-
meinsam mit Dr. Johannes Pepelnik den Radgeber “Radfahren in Wien” für den Falter Verlag
veröffentlicht. Die bundesweite Kampagne „Österreich radelt zur Arbeit“ wurde von ihm konzi-
piert und sorgt seit 2011 für Radmobilisierung.
Offensichtlich dreht sich für Alec Hager alles ums Rad: Als Experte für Radverkehr, Advokat
für unmotorisierte Mobilität, Kenner der internationalen Facetten von urbaner Radkultur, be-
geistertem Radreisenden und autolosem Stadtbewohner.
Ursprünglich wurde er als Autonutzer im oberösterreichischen Mühlviertel sozialisiert, nun legt
er (fast) alle seine Wege in Wien und weltweit mit Fahrrädern zurück – davon hat er ja (nie)
genug.
SylviaTitze
Ao. Univ.-Prof. Dr. Sylvia Titze, MPH leitet das Institut für Sportwissenschaft der Universität
Graz. Im Forschungsbereich „Bewegung und Gesundheit“ erforscht sie Einflussfaktoren auf
das Bewegungsverhalten und plant Bewegungsinterventionen für unterschiedliche Zielgrup-
pen. Im Speziellen untersucht sie, welche bauliche Infrastruktur die aktive Mobilität positiv
bzw. negativ beeinflusst.
Seite 124
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Berufliche Laufbahn
Studium in Biologie und Sportwissenschaft
Doktoratstudium an der Universität Graz
3-jähriger Forschungsaufenthalt in der Schweiz (Bern und Magglingen)
Postgraduale Ausbildung zum Master of Public Health (MPH) an den Universitäten Ba-
sel, Bern und Zürich
Habilitationsschrift 2003 mit dem Titel: Promotion of health-enhancing physical activity.
An individual, social and environmental approach
Leitung der Arbeitsgruppe für die Erstellung der “Österreichischen Empfehlungen für
gesundheitswirksame Bewegung”
Mehrmonatige Forschungsaufenthalte in den Niederlanden und in Australien
Sportliche Aktivitäten
Staatsmeisterin im Turmspringen; bevorzugte Sportarten: u.a. Radfahren, Bergsteigen, Orien-
tierungslauf, Skitourengehen und Skilanglaufen.
Paul Pfaffenbichler
Geburtsjahr: 1963
Derzeitige Position: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Forschungsbereich für Verkehrsplanung
und Verkehrstechnik, Institut für Verkehrswissenschaften, Technische Universität Wien
Berufliche Tätigkeiten
2009-2011 Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Österreichische Energieagentur, Fach-
bereich Mobilität und Verkehr und Lehrbeauftragter Institut für Ver-
kehrswissenschaften, Technische Universität Wien
2008-2009 Teilzeit Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Österreichische Energieagentur,
Fachbereich Mobilität und Verkehr und Assistent am Institut für Ver-
kehrsplanung und Verkehrstechnik, TU Wien
2005-2008 Assistent am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, TU Wien
2004-2005 Gastprofessor an der ETSI Caminos, Canales y Puertos, Universidad
Politécnica de Madrid , Spanien
2000-2004 Universitätsassistent am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstech-
nik, TU Wien, 2000 bis 2004
1997-2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Karenzvertretung am Institut für Ver-
kehrsplanung und Verkehrstechnik, TU Wien
1995-1997 Selbständig als technischer Zeichner, tätig für MOVIECAM, Schrack Ae-
rospace, Werner & Pfleiderer und andere
Ausbildung
1997-2003 Doktoratstudium Technische Wissenschaften, Technische Universität
Wien
Seite 125
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
1984-1995 Studium an der Technischen Universität Wien Maschinenbau, Studien-
richtung Verkehrstechnik
1978-1983 HTBLVA Steyr, Fachrichtung Maschinenbau - Kraftfahrzeugbau, Ab-
schluss mit Matura Juni 1983
Mitgliedschaften
ÖVK (Österreichischer Verein für Kraftfahrzeugwesen), www.övk.at/
Argus (Arbeitsgemeinschaft umweltfreundlicher Stadtverkehr), www.argus.or.at/
Tätigkeitsschwerpunkte
Integrierte Flächennutzungs- und Verkehrsmodellierung, dynamische Modellierung, System
Dynamics, Grundlagen der Verkehrsmittelwahl, Antriebstechnologien, Elektromobilität, Bewer-
tungsmethoden, Radverkehrsplanung, Verkehrssicherheit
Relevante Erfahrung
seit 1997: 99 Veröffentlichungen (Bücher und im Druck erschienene Originalbeiträge), 31 na-
tionale und 29 internationale Projekte, 145 Vorträge, Lehrveranstaltungen „Grundlagen der
Verkehrsplanung“ und „Methoden der Verkehrsplanung“ (TU Wien), „Planificación del trans-
porte” und „Economía en Transportes” (UPM Madrid), „Urban and Transportation Planning”
(Universidade de São Paulo), „Traffic Planning” (UBT Prishtina)
Ralf Risser
Geboren 1949 in Lienz/Osttirol; Eigner des Forschungsinstitutes FACTUM Chaloupka & Ris-
ser OHG, zusammen mit Dr. Christine Chaloupka.
Dr. phil. an der Universität Wien (Psychologie und Soziologie), Dozent für Verkehrssoziologie
an der Universität Wien seit 1988, seitdem jährliche Vorlesung dort und von 1995 bis 2012
auch an der TU Wien.
Seit 1988 Kooperation mit dem Institut für Technologie und Gesellschaft der Technischen
Universität Lund, Schweden, 2005 bis 2012 adjungierter Professor.
1993 – 2003 Vorsitzender des Komitees Verkehrspsychologie der Europäischen Föderation
der Psychologen-Verbände EFPA, derzeit dort Repräsentant des Berufsverbandes österreich-
sicher Psychologinnen und Psychologen.
Seit 1988 Sekretär und seit Oktober 2011 Präsident des Vereines International Co-operation
on Theories and Concepts in Traffic safety ICTCT.
Vorstandsmitglied der NORBIT-Gruppe (Nordic Organisation for Behaviour in Traffic).
Schwerpunkt der Tätigkeiten auf den sozialpsychologischen Themen Einstellungen, Akzep-
tanz, Motivforschung und Marketing, angewandt in den Bereichen Mobilität und Verkehrssi-
cherheit.
Seite 126
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Felix Braz
Geboren am 16. März 1966 in Differdange (Luxemburg)
01.1991 – 09.2001: Fraktionssekretär der Grünen im Luxemburger Parlament
03.1995 - 11.2011: Mitglied des Stadtrats von Esch/Alzette
06.2000 - 11.2011: 1. stellvertretender Bürgermeister von Esch/Alzette
07.2000 – 12.2005: Vize-Präsident des TICE, interkommunaler Busbetrieb des Luxem-
burger Südens
06.2004 – heute: Mitglied des Luxemburger Parlaments
06.2004 – 05.2009: Vize-Präsident des Transportausschusses des Luxemburger Parla-
ments
10.2011 – heute: Mitglied des Europarates
Lucien Malano
1992: Abschluss des Bauingenieurstudiums an der Universität (TH) Fridericiana zu
Karlsruhe mit dem Titel des Diplombauingenieurs in der Fachrichtung
Verkehr- und Raumplanung
1992 - 2003: Bauingenieur im Bereich Tiefbau und Verkehr des Ingenieurbüros Luxcon-
sult in Luxemburg
2003 - 2008: Bauingenieur am Tiefbau- und Verkehrsamt der Stadt Esch-sur-Alzette
2008 - heute: Beigeordneter Direktor des Stadtbauamtes der Stadt Esch-sur-Alzette,
zuständig für Strassen- und Tiefbau, Mobilität und Hygiene
Romain Molitor
Dipl.-Ing. Dr.techn.; geboren am 12. Oktober 1959 in Luxemburg
1979 – 1987 Studium des Bauingenieurwesens (Studienzweig Verkehrswesen und –
wirtschaft) an der TU Wien;
1988 – 1996 Assistent am Institut für Straßenbau und Verkehrswesen sowie Assistent
am Institut für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik an der TU Wien
seit 1996 freischaffender Ingenieur in Wien (komobile Wien, vormals Trafico) und in
Luxemburg (komobile Luxembourg)
1997-1998 Lektor an der TU-Wien, 2003-2004; Lektor an der FH Wien und
seit 2008 Assistant Professeur Associé an der Université du Luxembourg.
Romain Molitor ist als Planer und Berater national und international tätig, u.a. in Frankreich,
Deutschland, Luxemburg, Italien, der Schweiz, Rumänien, Albanien, Uganda, Tansania sowie
für internationale Organisationen.
Seite 127
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Jüngste Publikationen
2012: Traficem, Eine Applikation für die Nachfragerechnung im Personenverkehr, die
Steuerung des Vierstufenalgorithmus‘ und als Tool für das Datenmanagement In: ÖZV,
Heft 1-2/12, Wien, gemeinsam mit. C. Obermayer, D. Pfeiler
2011: Verkehr und Infrastruktur; In: Chilla, T.; Schulz C. (Hrsg.); Raumordnung in Lu-
xemburg / Aménagement du Territoire au Luxembourg. Luxemburg, S. 96-121
2010: Das Fahrrad als Verkehrsmittel? In: Wagner R. et al. (Hrsg.), Mam Velo do! Eine
Radtour durch die Luxemburger Zeitgeschichte, Luxemburg, S. 155-173
2009: Die Rückkehr der Tram; In: Schulz C. et al. (Hrsg.); Der Luxemburg Atlas - Atlas
du Luxembourg: Vielfalt und Wandel Luxemburgs im Kartenbild, Köln, S. 150-151
2009: Sanfte Mobilität im Tourismus; Öffentlicher Verkehr in peripheren Räumen; In:
ÖAV (Hrsg.), Jahresheft Bergsteigerdörfer, Innsbruck
2009: Policy Instruments on Cars Energy Efficiency; in: World Energy Council (Hrsg.),
Energy Efficiency Policies around the World: Review and Evaluation, London, ge-
meinsam mit P. Czermak , H. Koch
Sandor Bekesi
Mag. Dr.; geb. 1962 in Budapest, Studium der Geschichte und Absolvent des Interdisziplinä-
ren Post-Graduate-Projektstudiums "Kultur und Umwelt" 1996-98 in Wien. Research Fellow
am Internationalen Forschungszentrum Kulturwissenschaften (IFK) 2005. Seit 2004 Kurator
am Wien Museum im Department Topografie und Stadtentwicklung, Forschungsarbeiten zum
Thema Stadt-, Umwelt- und Verkehrsgeschichte.
Verhältnis zum Fahrrad ist in etwa: gelegentlicher Stadtradler (1-2 mal pro Woche, v.a. April-
Oktober), gelegentlicher Radwanderer (1-2 mal im Monat), Verfechter des kombinierten Ver-
kehrs (in Wien allerdings relativ schwierig). Derzeit im Reviewing-Team der Konferenz Velo-
City und mit Wien Museum als einer der geplanten "Hotspots". Anfang der 1990er Jahre 2-3
Jahre Veloce-Fahrer, und 3-4 Jahre lang Redakteur im Radwanderführer-Verlag Esterbauer.
Auswahl einschlägiger Publikationen
Vom Luftreservoir zur Verkehrshölle und Kulturmeile? Beiträge zu Geschichte und
Wahrnehmung des Wiener Gürtels, in: Wiener Geschichtsblätter, 55 (2000) H. 2, S. 73-
101.
Wien -Stadt der Radfahrer? Zum historischen Umgang mit einer Fortbewegungsart, in:
Wiener Zeitung EXTRA, 16. August 2002.
FahrRad in Wien? Zum historischen Verhältnis von Stadt und muskelgetriebenem Zwei-
rad, in: Dérive. Zeitschrift für Stadtforschung, Heft 13, 2003, S. 21-26.
Die befahrbare Stadt. Über Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung in Wien 1850-2000,
in: Pro Civitate Austriae. Informationen zur Stadtgeschichtsforschung in Österreich, N.F.
Heft 9, 2004, S. 3-46.
Mit dem Rad in Wien. Zur Geschichte einer unterschätzten Verkehrstechnologie, in:
Brunner, Karl / Schneider, Petra (Hg.): Umwelt Stadt. Geschichte des Natur- und Le-
bensraumes Wien (Wiener Umweltstudien, 1), Wien 2005, S. 116-123.
Seite 128
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Stürmisch und unaufhaltsam? Motorisierung und Politik im Wien der 50er Jahre, in:
Christian Rapp (Hg.): Spurwechsel. Wien lernt Auto fahren (Buch zur gleichnamigen
Sonderausstellung im Technischen Museum Wien, 12. Okt. 2006 - 28. Feb. 2007), Wien
2006, S. 76-83.
Von der fußläufigen zur befahrbaren Stadt. Eine Skizze der Mobilitätsgeschichte Wiens
seit dem 19. Jahrhundert, in: Österreichisches Ökologie-Institut (Hg.): Mobilität visionär
gestalten. Impulse für eine nachhaltige Stadtmobilität von der AGENDA 21 am Alser-
grund, Wien 2008, S. 19-23.
Stadt der unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Auf dem Wiener Pflaster - einmal an-
ders, in: Hubert C. Ehalt, Wilhelm Hopf, Konrad P. Liessmann (Hg.): Kritik und Utopie:
Positionen und Perspektiven, München 2009, S. 31-35.
Vernachlässigung des Radverkehrs in Wien hat lange Tradition, in: Der Standard online,
11. August 2009
Das Scheitern im Verkehrswesen oder Die Potentiale des Kontrafaktischen: ein histori-
scher Rückblick, in: Gut gescheitert. Was können wir aus Misserfolgen in der Planung
lernen? (hg. v. Öst. Forschungsgesellschaft Strasse - Schiene - Verkehr), FSV-Schrif-
tenreihe 009/2012, S. 9-15.
Roland Girtler
Dr., Professor am Institut für Soziologie. Geboren 1941 in Wien Ottakring. Aufgewachsen als
Sohn eines Landarztehepaares unter Bergbauern, Wilderern, Holzknechten und Sennerinnen.
Seit 1959 in Wien. Seit den siebziger Jahren als passionierter Radfahrer in Wien unterwegs –
zu einer Zeit, als in Wien kaum jemand mit dem Fahrrad unterwegs war. Forschungen bei
Dirnen, Ganoven, Bergbauern, Wilderern, Kellnern, Tierärzten, Schmugglern, usw. Radtouren
in die Pyrenäen, nach Paris, zur Ostsee usw.
Anne-Katrin Ebert
Dr., M.A.; geboren 1974 in Berlin, seit 2009 Leiterin der Sammlungsbereichs Verkehr im
Technischen Museum Wien; davor Mitarbeiterin im Deutschen Technikmuseum Berlin; Marie
Curie Fellow in the European Doctorate „Social History of Europe and the Mediterranean“ in
Bielefeld und Groningen, Niederlande; ihre Dissertation „Radelnde Nationen. Die Geschichte
des Fahrrads in Deutschland und den Niederlanden bis 1940“ gewann 2010 den Prize for Y-
oung Scholars des International Comittee for the History of Technology; zahlreiche Publikatio-
nen zur Geschichte des Radfahrens in vergleichender Perspektive; Vortragende auf der Velo
City 2013 und im Scientists for Cycling Netzwerk
Auswahl einschlägiger Publikationen
gemeinsam mit Trine Agervig Carstensen, Cycling Cultures in Northern Europe: From
'Golden Age' to 'Renaissance', in: John Parkin (Hg.): Cycling and Sustainability. London
2012, S. 23-58.
Seite 129
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
„When cycling get political: building cycling paths in Germany and the Netherlands,
1910-1940“, The Journal of Transport History 33, 1 (2012), S. 115-137.
„Konsumenten als nationale Systembauer: Deutsche und niederländische Radfahrer-
verbände, 1900-1940“, Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und vergleichende
Gesellschaftsordnung 21,3 (2011), S. 32-48.
Radelnde Nationen. Die Geschichte des Fahrrads in Deutschland und den Niederlanden
bis 1940 (Historische Studien 52), Frankfurt am Main, New York (Campus Verlag) 2010.
„Liberating Technologies? Of Bicycles, Balance and the ‚New Woman‘ in the 1890s“,
ICON. Journal of the International Committee for the History of Technology 16 (2010), S.
25-52.
„Verkehrspolitik im Vergleich. Radfahrwege in Deutschland und in den Niederlanden
1910- 1940”, Blätter für Technikgeschichte 71 (2009), S. 45-70.
„Nationales Design? Auf der Suche nach dem ‚Holland-Rad’, 1900 – 1940”, Technikge-
schichte 76,3 (2009), 211-231.
Konrad Paul Liessmann
Dr.; geb. 1953, ist Professor für Methoden der Vermittlung von Philosophie und Ethik an der
Universität Wien sowie wissenschaftlicher Leiter des "Philosophicum Lech" und Herausgeber
der gleichnamigen Buchreihe im Zsolnay-Verlag. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in
der Ästhetik und Kulturphilosophie sowie in der Gesellschafts- und Bildungstheorie. Er erhielt
zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik,
den Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln, den
Danubius-Sachbuchpreis sowie den Vize 97 der Vaclav Havel-Foundation Prag. Im Jahre
2006 wurde er zum Österreichischen Wissenschafter des Jahres gewählt. Zuletzt sind unter
anderem erschienen: Theorie der Unbildung. Die Irrtümer der Wissensgesellschaft (2006);
Ästhetische Empfindungen (2008); Schönheit (2009); Das Universum der Dinge. Zur Ästhetik
des Alltäglichen (2010); Bildung ist ein Lebensprojekt (2011); Lob der Grenze. Kritik der politi-
schen Unterscheidungskraft (2012)
Michael Meschik
Dipl.-Ing. Dr.; unterrichtet an der Universität für Bodenkultur u.a. Fuß- und Radverkehr sowie
Umweltauswirkungen des Verkehrs seit mehr als 20 Jahren. Er forscht international in den
Bereichen Mobilitätsverhalten, Mobilitätsmanagement, Nachhaltigkeit, Verkehrsberuhigung,
Verkehrssicherheit usw. mit einem Schwerpunkt im Fußgeher- und Radverkehr. Er tritt für
eine viel stärkere Förderung dieser nichtmotorisierten Verkehrsarten ein, in dem Wissen, dass
deren Bedeutung für die Lösung zahlreicher (innerörtlicher) Probleme z.B. im Verkehrs-, Um-
welt-, Finanz- und Gesundheitsbereich noch nicht ausreichend erkannt wird.
Seite 130
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Hans-Erich Dechant
Dipl.-Ing. Dr.techn.;
VELOCE ab 1988; danach auch Botenfahrer bei VeloBlitz (Graz, 1990/91) und Hermes
(1992); ARGUS-Journaldienste ab 1989.
Aktiv in der Fahrrad.Selbsthilfe.Werkstatt seit 1991, seit 2002 im Vorstand.
Diplomarbeit: „Spannungs-, Deformations- und Stabilitätsverhalten von Hochradlaufrä-
dern“ 1997
Dissertation: “Mechanical properties and finite element simulation of spider tactile hairs”,
2001
2002: Werkstatt- und Logistikleiter bei Viennabike
Ab 2003: Betriebsleiter bei Citybike Wien, seit 2010 für das gesamte Projekt verantwort-
lich.
Tadej Brezina
Dipl.-Ing.; geboren 1976 in Ljubljana, heutiges Slowenien. Zweisprachig aufgewachsen, Ab-
solvierung der HTL für Tiefbau in Mödling und Studium des Bauingenieurwesens an der TU
Wien mit Vertiefung in Verkehr und kommunaler Infrastruktur.
Schon seit während des Studiums (2002) am Forschungsbereich Verkehrsplanung und
Verkehrs als Projektassistent mit breitgefächerten Projekten
Mitglied des Arbeitskreises „Öffentlicher Verkehr“ der Österr. Verkehrswissenschaftli-
chen Gesellschaft von 2008 bis 2011.
Mitglied des Arbeitskreises „Programm in Vorbereitung der Velo-city 2013 Konferenz“,
Wien
Mitbegründer von Radlobby Niederösterreich und Radlobby Österreich
Fachliche Interessensgebiete: Wirkung von technischen Systemen auf die Gesellschaft,
Verkehrsstrukturen – Siedlungsstrukturen, Öffentlicher Verkehr, Radverkehr
Auswahl radverkehrsbezogener Publikationen
Knoflacher, Hermann, Brezina, Tadej; "A Cycling Highway for Vienna - Applying Survey
Methods for the Estimation of Potential Users"; Slovak Journal of Civil Engineering, Vol-
ume XV (2007), 1; S. 40 - 44.
Brezina, Tadej: Gehsteigradler? Beobachtungen zu einem Phänomen; velosophie. Ma-
gazin für Fahrradkultur, 03-2010 Herbst (2010), S. 22.
Brezina, Tadej: Der Verkehr in Valencia aus der Fahrradperspektive; Fahrradzukunft, 12
(2010), S. 19 - 23.
Brezina, Tadej: In der Politik ist das Fahrrad noch nicht angekommen; Die Presse, 20.
Juni 2011 (2011), S. 27.
Brezina Tadej, Niegl, Martin, Ibesich, Nikolaus, Lemmerer, Herlmut: Requirements for
high quality cycling infrastructure design; in: Road and Rail Infrastrcture II, S. Lakusic
(Hrg.); (2012), ISBN: 978-953-6272-50-1; S. 953 - 960.
Seite 131
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Brezina, Tadej: Fahrrad-Pendeln in die Smart City; Die Presse, 2. November 2012
(2012), S. 30.
Pfaffenbichler, Paul, Brezina, Tadej, Bat-Ochir, Mungunbayar; "Measuring the Quality of
the Viennese Bicycle Network"; Vortrag: Velo-city 2007, München/D; 12.06.2007 -
15.06.2007; in: "Conference Programme", (2007), S. 41.
Brezina, Tadej, Castro Fernández, Alberto: Recycling rail right-of-way for bicycle use:
Vienna's first Cycling Highway (poster nr. 004); Poster: Velo City 2009, Brussels;
12.05.2009 - 15.05.2009.
Brezina, Tadej: Von der fahrradfreundlichen Straße zur Fahrradstraße; Vortrag: Die
Grundlagen der Verkehrsplanung erfolgreich umsetzen, Seminarhotel Springer Schlößl,
Wien; 14.06.2011 - 16.06.2011.
Seite 132
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Seite 133
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
In der Reihe "BEITRÄGE ZUR VERKEHRSPLANUNG" sind bisher folgende Titel erschienen:
Nr. 1/1984 Seminar: Geschwindigkeit, Verkehrssicherheit und Straßenraumgestaltung EUR 10,90
Nr. 2/1984 Seminar: Rückbau von Straßen vergriffen
Nr. 1/1985 Seminar: Straße - Umwelt - Raumordnung EUR 14,53
Nr. 2/1985 Energie im Straßenverkehr EUR 7,26
Nr. 1/1986 Seminar: Ruhender Verkehr vergriffen
Nr. 2/1986 Lösung von Verkehrsproblemen: Luxemburg, Niederlande, Bundesrepublik Deutschland vergriffen
Nr. 1/1987 Seminar: Umweltgerechter Verkehrswegebau vergriffen
Nr. 1/1988 Seminar: Öffentlicher Verkehr in österreichischen Städten EUR 8,72
Nr. 1/1989 Seminar: Bahn und/oder Straße - die Zukunftsfrage der Gemeinden EUR 10,90
Nr. 1/1990 Seminar: Finanzierungsstrukturen im Verkehrswesen und ihre Auswirkungen EUR 10,90
In der Reihe "BEITRÄGE ZU EINER ÖKOLOGISCH UND SOZIAL VERTRÄGLICHEN
VERKEHRSPLANUNG" sind bisher folgende Titel erschienen:
Nr. 1/1991 Seminar: Veränderungen der verkehrspolitischen Rahmenbedingungen in Europa EUR 15,98
Nr. 1/1992 Seminar: Das richtige Maß im Verkehrswesen EUR 14,53
Nr. 2/1992 J. Michael Schopf: Die Geschwindigkeit im Straßenverkehr EUR 23,98
Nr. 1/1993 Seminar: Lösungsansätze im öffentlichen Personennahverkehr EUR 15,98
Seite 134
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Nr. 1/1994 Seminar: Verkehr und Tourismus in der Alpenregion EUR 10,90
Nr. 1/1995 Thomas Spiegel: Die Empfindung des Widerstandes von Wegen unterschiedlicher Verkehrsmittelbenützung und deren Auswirkung auf das Mobilitätsverhalten EUR 14,53
Nr. 1/1996 René Schreyer: Quantifizierung des Zeitbedarfs von Umschlagseinrichtungen im Güterverkehr EUR 10,90
Nr. 1/1997 Markus Mailer: Untersuchungen zur Leistungsfähigkeit von Minikreisverkehren EUR 13,08
Nr. 1/1998 Paul Christian Pfaffenbichler: Energie- und Schadstoffbilanz bei der Herstellung und Verteilung verschiedener Verkehrsmittel bis zur Auslieferung an den Kunden EUR 29,06
Nr. 1/1999 Rainer Kolator: Systemuntersuchung der Verkehrsinfrastrukturausbauten am Semmering EUR 10,90
Nr. 1/2000 Thomas Macoun: Bewertungen und Bewertungsmethoden in komplexer Umwelt mit besonderer Berücksichtigung der Verkehrsplanung EUR 25,00
Nr. 2/2000 Festseminar Prof. Knoflacher zum 60. Geburtstag und zu 25 Jahren Ordinarius für Verkehrsplanung: Verkehrsplanung – über den Tellerrand geblickt EUR 12,00
Nr. 1/2001 Günter Emberger: Interdisziplinäre Betrachtung der Auswirkungen verkehrlicher Maßnahmen auf sozioökonomische Systeme EUR 10,00
Nr.1/2002 Hermann Knoflacher: Maßnahmenkonzept für die Sicherung der Verkehrsfunktion von Wien EUR 10,00
Nr. 1/2003 Paul Pfaffenbichler: The strategic, dynamic and integrated urban land use and transport model MARS (Metropolitan Activity Relocation Simulator) EUR 20,00
Nr. 1/2004 Jakob Egger: Verkehrsaufkommen und Beschäftigungseffekte von kleinräumigen innerstädtischen Strukturen im Vergleich zu großräumigen außerstädtischen peripheren Strukturen (am Beispiel ausgewählter Wiener Einzelhandelsstandorte) ISBN 3-9501909-0-2 EUR 10,00
Nr. 1/2005 Festschrift Prof. Knoflacher zum 65. Geburtstag und zu 30 Jahren Ordinarius für Verkehrsplanung: Lebendige Fische schwimmen gegen den Strom ISBN 3-9501909-1-0 EUR 20,00
Seite 135
Beiträge zu einer ökologisch und sozial verträglichen Verkehrsplanung 1/2014
Nr. 2/2005 Günter Emberger: Freight Transport – A Holistic Approach ISBN 3-9501909-2-9 vergriffen
Nr. 1/2006 Hermann Knoflacher, Josef Michael Schopf, Markus Mailer, Paul Pfaffenbichler: Auswirkungen realisierter Verkehrsmaßnahmen auf die Reduktion des Energieverbrauchs im städtischen Gebiet ISBN 978-3-9501909-3-9 EUR 18,00
Nr. 1/2007 Hermann Knoflacher, Josef Michael Schopf, Wolfgang Gatterer, Romain Molitor, Günther Schwab, Robert Thaler, Peter Glasl: Die Auswirkungen des Transitverkehrs für Tirol ISBN 978-3-9501909-4-6 EUR 10,00
Nr. 1/2008 Hermann Knoflacher, Markus Mailer, Josef Michael Schopf, Peter Fischer, Günter Emberger, Paul Pfaffenbichler: Multimodale Dimensionierung von Straßen aus der Beschreibung des Verkehrsablaufes, der funktionellen Bedeutung sowie der verkehrlichen Auswirkungen ISBN 978-3-9501909-5-3 EUR 12,00
Nr. 2/2008 Festseminar Prof. Knoflacher zur Emeritierung als Ordinarius für Verkehrsplanung: Verkehrswesen – von der Zunft zur Wissenschaft ISBN 978-3-9501909-6-0 EUR 30,00
Nr. 1/2009 Michael Schumich: Inventarisierung der österreichischen Fußgängerzonen ISBN 978-3-9501909-7-7 EUR 8,00
Nr. 1/2010 Harald Frey: Analytisch-empirische Vergleichsuntersuchung der Wachstumsparameter von transnationalen Konzernstrukturen und Tumoren in lebenden Organismen unter besonderer Berücksichtigung des Verkehrssystems ISBN 978-3-9501909-8-4 EUR 18,00
Nr. 1/2011 J. Michael Schopf, Reinhard Haller, Helmut Lemmerer, Anna Mayerthaler, unter Mitarbeit von Günter Essl und Daniel Bell: Grundlagen zur Weiter-entwicklung von Aus- und Weiterbildung im Bereich der barrierefreien Mobilität (GABAMO) Harald Frey, Günter Emberger, Anna Mayerthaler: Stadtauto e-Mobil – Chancen und Risiken für Wien ISBN 978-3-9501909-9-1 EUR 10,00
Nr. 1/2012 WCTRS – SIG10 Workshop: Emerging Urban Transport Policies towards Sustainability. 14th to 16th March 2012, Vienna ISBN 978-3-9503375-0-1 EUR 15,00
Seite 136
Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik TU
Nr. 1/2013 Peraphan Jittrapirom, Günter Emberger unter Mitarbeit von Tadej Brezina und Takeru Shibayama: Chiang Mai City Mobility and Transport Survey (CM-MTS) 2012 ISBN 978-9503375-1-8 EUR 10,00
Nr. 1/2014 Ringvorlesung SS 2013: Radfahren in der Stadt. Hrsg: Heinrich J. Zukal und Tadej Brezina ISBN 978-3-9503375-2-5 EUR 10,00
Bestellungen bei: Technische Universität Wien Institut für Verkehrswissenschaften Forschungsbereich für Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, Gußhausstraße 30 - E 230/1 A-1040 Wien Tel.: (+43 1) 588 01 - 23101 Fax: (+43 1) 588 01 - 23199 e-mail: [email protected]











































































































































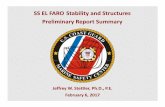

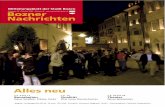
![Der Herrscher in der Stadt (The Emperor/King in the Medieval [Italian] Town)](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631c02b8665120b3330ba551/der-herrscher-in-der-stadt-the-emperorking-in-the-medieval-italian-town.jpg)