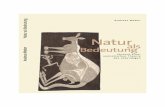Ritschls Gemeindekonzeption als systematisch-theologischer Grundfaktor - Versuch einer strukturellen...
Transcript of Ritschls Gemeindekonzeption als systematisch-theologischer Grundfaktor - Versuch einer strukturellen...
RITSCHLS GEMEINDEKONZEPTION ALS SYSTEMATISCH-THEOLOGISCHER GRUND-
FAKTOR
Versuch einer strukturellen Begriffskritik
..........................................................Einleitung: ein theologisches Nadelöhr 2
........................................................................1. Das System des Unterrichts 5
.................................................................................1.1 Vorbetrachtungen 5
...............................................................1.2 Der theologische Standpunkt 6
.........................................................1.3 Spielarten des Gemeindebegriffs 7
..................................2. Der Gemeindebegriff als notwendiges Erfordernis 11
........................2.1 Wissenschaftlichkeit und theologische Authentizität 11
..................................2.2 Zur Methodik der theologischen Wissenschaft 14
........................3. Strukturprobleme der Ritschlschen Gemeindekonzeption 16
......................................................3.1 Das Individuum in der Gemeinde 16
..............................3.2 Sittliche Überhöhung und religiöse Vereinzelung 17
...............................4. Das Spannungsverhältnis in Glauben und Theologie 19
..............................................................................................5. Literaturliste 21
....................................................................................5.1 Primärliteratur 21
................................................................................5.2 Sekundärliteratur 21
ABSTRACT. Die vorliegende Arbeit untersucht die systematisch-theologischen Konsequenzen des
Ritschlschen Gemeindebegriffs für die Darstellung der materialdogmatischen Inhalte seines Unterrichts. Auf die Analyse der Begriffsbestimmung (1) folgt auf dem Hintergrund von Ritschls Verständnis der
Theologie (2) die kritische Einschätzung innerhalb der sich durch diesen Terminus ergebenden Schwie-rigkeiten in der Darstellung der christlichen Lehrinhalte (3). Sie gelangt zu dem vorläufigen Ergebnis,
dass durch Ritschls Gemeindebegriff eine systematisch angelegte Spannung zwischen der Bestimmung der sittlichen Berufs und der religiösen Gewissheit im Glauben des einzelnen Christen hervorgerufen
werden.
EINLEITUNG: EIN THEOLOGISCHES NADELÖHR
Betrachtet man den dogmatischen Ansatzpunkt des „Unterricht[s] in der christlichen
Religion“1 von Albrecht Ritschl (1822-89), so scheint auf den ersten Blick der Schluss
nahe zu liegen, dass er diesen innerhalb des Reich Gottes, als höchstes Gut2 der Ge-
meinde, rein kollektivistisch veranlagt hat; und damit etwa zu Friedrich Schleiermacher
(1768-1834), der mit der Erhebung des „Gefühls schlechthinniger Abhängigkeit“3 zum
Ursprung der menschlichen Religiosität einen vermeintlicherweise individualistischen
Glaubensansatz verfolgt, in einem äußerst differenten Verhältnis steht. Das mag im Hin-
blick auf die enge (zeitliche) Kontinuität, in der beider Theologen zueinander stehen,
verwunderlich wirken. Beginnt man also dann, Ritschls Werk eingehender zu untersu-
chen, so ergibt sich vielmehr, dass dessen Standpunkt trotz der präsenten Stellung des
Gemeindebegriffs in seinem theologischen System4 nicht einfach dem Katholizismus
oder etwa Offenbarungspositivsmus überführt werden kann.5 Denn die versöhnenden
Aspekte der Gemeinde bilden in Ritschls Theologie keinen starren Heilsmechanismus6,
sondern stehen als der eine Brennpunkt der Ellipse, unter der religiösen Be-stimmung
als Kirche, immer in Spannung zur sittlichen Tätigkeit des einzelnen Christen im Reich
Gottes, die durch seinen Glauben motiviert wird.7 Nichtsdestotrotz stellt sich bei der
Beschäftigung mit dem Unterricht, aber auch in dem Hauptwerk von Ritschl8 der Ge-
meindebegriff signifikant als eine Art „theologisches Nadelöhr“ zur seiner Dogmatik
heraus, welches sich jedoch, um zu den dogmatischen Inhalten vorzudringen, nicht ohne
weiteres durchschreiten lässt. Erst durch das In-Beziehung-setzen jenes Begriffs zu die-
sen Inhalten wird der systematische Gehalt des Ritschlschen Ansatzpunktes in seiner
- 2 -
1 Die erste Auflage wird im Folgenden mit Paragraphenverweis, die zweite bzw. dritte Auflage mit Sei-tenangabe der [UcR] zitiert.2 Vgl. UcR 13.3 Siehe GL §4 bzw. 32ff.4 Zu Ritschls Systembegriff vgl. Schäfer 174.5 Zu diesem Einwand vgl. Grewel 306.6 Vgl. dazu auch Courth 413.7 Siehe z.B. §46 c), sowie §49 a).8 „Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung“ - [RuV]Im Verhältnis zu diesem Hauptwerk Ritschls ist uns mit dem Unterricht „die einzige authentische Ge-samtdarstellung seines Systems, in welchem Reich Gottes und Kirche gleichgewichtig zur Geltung kom-men“, gegeben. Er stellt die kompakte, in für die Lehre geeignete „Paragraphenknödel“ gebrachte Kurz-fassung des Ritschlschen Systems dar. - Vgl. ARB 40, Scheliha 90, TRE1 229, sowie UcR 3.
spezifischen Ausformulierung deutlich. So muss der „Standpunkt der mit Gott versöhn-
ten Gemeinde“9 nach Ritschl zwar die Ausgangsposition der Theologie sein10, gleichzei-
tig zeigt sich aber, dass er in einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis zu seinem
Material steht: Die formgebende Funktion des in den Prolegomena erhobenen Stand-
punktes geht gewissermaßen erst in den dogmatischen Inhalten auf und wird also erst in
diesen vollkommen legitimiert.11
Dem sich daraus ergebenden Anspruch, ein Verständnis für die Originalität von Ritschls
theologischem Entwurf, der „Lehre von der Gemeinde“12 und ihrer Tragweite für sein
dogmatisches System zu entwickeln, geht diese Untersuchung auf folgende Art nach:
Indem sie im 1. Abschnitt eine interne, d.i. im Rahmen des Unterrichts erfolgende Ana-
lyse des Gemeindebegriffs vornimmt, stellt sie die grundlegenden systematisch-theolo-
gischen Aspekte heraus, die sich aus dessen inhaltlichen Funktionen ergeben. Daran
schließen sich, mit der Fragestellung, aufgrund von welchem Motiv Ritschl seine Theo-
logie derart konzipiert hat, unter 2) Betrachtungen zur methodischen Funktion des Ge-
meindebegriffs und sein daran gekoppeltes Verständnis der Theologie als Wissenschaft
an. Daraufhin sollen im 3. Abschnitt die Folgen der erarbeiteten Zusammenhänge mit
der Frage: Was hat diese Grundverortung für systematische Konsequenzen in Ritschls
Darstellung seines theologischen Systems und wie verhalten sich diese zum einzelnen
Christen bei den theologischen Wirkzusammenhängen13 zueinander? beleuchtet werden.
Die Arbeit mündet dabei schließlich in die skeptischen Frage, inwiefern die Glaubensre-
alität des Einzelnen innerhalb der Anerkennung des Ritschlschen Gemeindebegriffs (als
grundlegender Standpunkt der theologischen Darstellung der christlichen Dogmatik)
überhaupt adäquat dargestellt werden kann. Abschließend folgt unter 4) ein Fazit, wel-
ches versucht, die Grundproblematik des Ritschlschen Ansatzes zu benennen. Die vor-
- 3 -
9 Damit das spezifisch Christliche überhaupt erst christlich wird, ist eine der „christlichen Religion eigen-tümliche“, also eine interne Perspektive auf die christlichen Lehrinhalte erforderlich. Diese Perspektive wird bestimmt als der „Standpunkt der mit Gott versöhnten Gemeinde“. - Vgl. UcR 3f., sowie §3.10 Vgl. UcR §1.11 Darauf deutet auch der allgemeine Schreibstil Ritschls hin. - Vgl. TRE1 221, Z. 39-42.12 Diese Bezeichnung ist Schäfer entnommen, mit der er das 4. Kapitel seiner Ritschl-Monografie betitelt. Vgl. Schäfer, VIIf. - Die „Lehre von der Gemeinde“ ist insofern von Ritschl neu eingeführte dogmatische Disziplin, als dass sie die christliche Ethik mit verschiedenen klassischen Teilgebieten unter dem Aspekt der Gemeinde verbindet.13 Damit sind alle im der theologischen Darstellung thematisierten religiösen Vollzüge des christlichen Glaubens gemeint; also die Beziehung zu Gott und Christus, Offenbarungswirklichkeit, Gotteserkenntnis, Sündenvergebung, Erlösung, etc.
liegende Arbeit konzentriert sich dabei auf die interne Perspektive von Ritschls theolo-
gischen System und die sich aus ihr ergebenden Schwierigkeiten.
Als hypothetischer Impuls für die weitere Bearbeitung soll vorläufig dienen: Der Ge-
meindebegriff stellt, in seiner spezifischen Konzeption, die Grundlage des Ritschlschen
Systems dar und eröffnet durch dessen eingehende Untersuchung erst den Zugang zu
einem differenzierten Verständnis seines dogmatischen Systems. Die anschließende
Anwendung des so bestimmten Gemeindebegriffs auf die einzelnen Lehrinhalte zeigt,
dass Ritschl grundlegende Momente des christlichen Glaubens nur noch bedingt inner-
halb seines Systems abbilden kann.
Die folgende Abhandlung geht somit im Kern der Frage nach, welche Qualitäten und
Konsequenzen aus der Eigenart der Theologie Ritschls zu deduzieren sind und versucht
sich einer Antwort auf die Frage anzunähern, aus welchen Gründen der dogmatische
Entwurf Ritschls genau dieses Gepräge entwickelt hat. Ihr Ziel wird es sein, dadurch 1.
eine differenzierte Begriffsbestimmung der „Gemeinde“ in der Theologie Albrecht
Ritschls anhand der Analyse des Unterrichts vorzunehmen und 2. die sich daraus erge-
benden theologische Auswirkungen in der vermittelten Gesamtdarstellung und -an-
schauung des Christentums, speziell auf dem Hintergrund des Verhältnisses von Ge-
meinde und einzelnem Christen, in Umrissen herauszustellen. Die Arbeit versucht auf
diesem Wege, den Anforderungen an eine eingehende Beschäftigung mit der Grundlage
des theologischen Systems von Ritschl gerecht zu werden. Wie sich bereits andeutete,
wird sie sich maßgeblich im Horizont des Unterrichts entfalten und nur vereinzelte As-
pekte der anderen Schriften Ritschls, vornehmlich des Hauptwerks, berücksichtigen.
Auch können andere, im Bezug auf Ritschls Person wichtige Persönlichkeiten14 , auf-
grund des Umfangs dieser Arbeit (mit Ausnahme von Schleiermacher) keinerlei Beach-
tung finden.
- 4 -
14 Zu nennen sind hier etwa Baur, Hegel, Kant und Luther, aber auch Anhänger der sogenannten „Ritschl-schen Schule“.
1. DAS SYSTEM DES UNTERRICHTS
1.1 Vorbetrachtungen
Auch wenn oft das Reich Gottes als erstes Schlagwort zur Charakterisierung von
Ritschls Theologie angeführt wird,15 stellt die darin ausgedrückte sittliche Dimension
der christlichen Religion neben der religiösen Dimension nur einen der integralen Funk-
tionen von dessen inhaltlicher Bestimmung dar. Denn, wie in der Fachliteratur gemein-
hin anerkannt ist, muss der Begriff des Reich Gottes differenziert bzw. zwischen dem
Begriff des Reich Gottes und der Kirche unterschieden werden.16 Diese bilden die zwei
Brennpunkte der Ritschlschen Ellipse.17 Weiterhin werden beide Begriffe, als in ihrem
ethischen und dogmatische Aspekt differenziert, vorausgesetzt.18 Die sich daraus erge-
bende Begriffskonstellation in dem theologischen System Ritschls sei damit
angeführt:19 Das Reich Gottes (im engeren Sinne) wird bei Ritschl als unsichtbarer Zu-
sammenschluss der Gläubigen, die durch den religiös-sittlichen Grundgedanken geeint
sind, verstanden. Er bildet die Gemeinschaft der Christen innerhalb der ethisch-motivie-
renden Glaubensrealität ab. Der Begriff der Kirche wird als die sichtbare Ausprägung
der dogmatisch-religiösen Idee gefasst; sie repräsentiert die Gemeinschaft der Christen
innerhalb der religiös-wirksamen Glaubensrealität. Insofern diese beiden theologischen
loci in dem Gemeindebegriff ihren Ausdruck finden bzw. insofern er innerhalb dieser
beiden Aspekte bestimmt werden kann, stellt er (unterhalb der Vorstellung von Gott und
Christus) die Spitze der Begriffshierarchie in dem von Ritschl entwickelten System dar.
Nachfolgend soll dieser Sachverhalt in der Anwendung auf den Unterricht gegengeprüft
werden, da, wie sich zeigen wird, mit der soeben gewonnenen begrifflichen Struktur
auch sein Aufbau begründet werden kann.20
- 5 -
15 Vgl. Grewel 303.16 Vgl. dazu ARL 221f., Grewel 303f., Schäfer 116, sowie auch Scheliha 92., UcR 19, Fn. 22.17 Grewel 305f.: „In der distinktiven Verbundenheit beider Elemente (Reich Gottes und Erlösung, Reich Gottes und Kirche) gründet die Einheit des Ritschlschen Systems.“18 Grob gesagt beleuchtet der ethische Aspekt die Perspektive des Menschen, der dogmatische hingegen die göttliche Perspektive auf Reich Gottes und Kirche. - Vgl. ARL 221f., Grewel 303f., Schäfer 116f, sowie TRE1 229. 19 Vgl. dazu im Folgenden auch mit dem beiliegenden Schema.20 Vgl. Grewel 305, Fn. 11.
1.2 Der theologische Standpunkt
Die Problematik der Bestimmung des Verhältnisses von Prolegomena (§1-4)21 und ma-
terialer Dogmatik (§5-90) wurde in der Einleitung dieser Arbeit schon angesprochen. In
Anbetracht der postulierten Schlüsselrolle, die die §§1-4 für das Verständnis den Ge-
meindebegriff Ritschls darstellen, sind sie ein entscheidender Bestandteil des Gegen-
standes dieser Arbeit. Der §1 ist in Prämisse („Da“), Folgerung („so“), Zweckbestim-
mung („damit“) und schließlich Konklusion im zweiten Satz des Paragraphen unterglie-
dert. Er setzt zwei fundamentale Grundkonstanten der christlichen Religion ihrem We-
sen nach als unbedingt gegeben: die Offenbarung als ihre Quelle und die Gemeinde als
Subjekt der Wertschätzung.22 Daraus wird der theologische Standpunkt der Gemeinde
als notwendige Bedingung für die richtige Darstellung der christlichen Lehrinhalte, als
die allein angemessene Perspektive des Theologen deduziert.23 Ritschl weißt somit
schon zu Beginn des Unterrichts eindeutig den kollektivistischen Charakter seines An-
satzes aus: Zunächst wird nur davon gesprochen, dass die christliche Religion in einer
Gemeinde „da“ ist; das Verhältnis des einzelnen Christen zu ihr wird vorerst offen ge-
lassen. Im §2 wird jetzt der Gemeindebegriff innerhalb eines Hierarchiemodells, der
Dreiheit des Gott-Christus-Gemeinde24, mit dem Anspruch auf die Vollständigkeit der
Gotteserkenntnis in der Einteilung der positiven Religionen (in Stufen und Arten) nach
Schleiermacher25 verknüpft. Die Gemeinde hat über Christus als Mittler Zugang zur
Gotteserkenntnis. §3 bezieht eingangs die zwei vorangegangenen Paragraphen aufei-
nander, um dann den Gemeindebegriff einer Kritik zu unterziehen: Die christliche Ge-
meinde ist nicht an sich Garant für die Wahrung der Identität der christlichen Religion,
da es im Verlauf der Geschichte zu internen (bzgl. der Gestaltung der Frömmigkeit) und
externen (bzgl. der Mitgliedschaft) Verfälschungen der christlichen Gemeinde kam; ihr
Bestand muss sich der christlichen Lehre nach an den Schriften der Bibel überprüfen.
Neben einer schematischen Verhältnisbestimmung von AT und NT wird wiederum an-
hand des Gemeindebegriffs der reformatorische Grundsatz des sola scriptura erläutert:
- 6 -
21 Die Quellverweise bezüglich des Unterrichts erfolgen direkt im Text und in Klammern.22 Vgl. auch UcR 120, Fn. 309, sowie Courth 387.23 Vgl. RuV III 1-8; Scholz 133: „Theologie ist die Wissenschaft von der Frömmigkeit der christlichen Gemeinde, nichts anderes.“ 24 Siehe Grewel 294.25 Vgl. GL §7, Hauptsatz.
Die Evangelien auf der einen Seite gelten als Grundimpuls für die Bildung und Ausfor-
mung der christlichen Religion, die Briefe auf der anderen Seite stellen die authentische
Abbildung der Urgemeinde in ihrer ungetrübten Form dar.26 Im §4 wird nochmals die
Rangstellung der im §1 aufgestellten Voraussetzungen betont. Nun erst folgt erstmals
die Bezugnahme auf den einzelnen Christen: Dieser soll immer nur vermittelt über die
„gemeinschaftlichen Bedingungen“ in den jeweiligen Teilen der Lehre mit einbezogen
werden, da andernfalls nach §1 die Lehre ihrer Darstellung nach „fehlerhaft ausfallen“
(§1) müsste.
Es ergibt sich insgesamt folgende Grundlegung des theologischen Standpunktes in den
„Prolegomena“ des Unterrichts (§§1-4): Gott offenbart sich der Menschheit in Jesus
Christus. Mit der Verkündigung des Evangeliums stiftet dieser wiederum die
Urgemeinde.27 Durch die Geschichte hindurch kam es jedoch zur Verfälschung der
christlichen Lehre in der christlichen Gemeinde und damit zum Verfall ihrer Autorität
(§3).28 In den neutestamentlichen Schriften sind nun die heils- und kirchengeschichtli-
chen Geschehnisse adäquat abgebildet. Mithilfe dieser kann daher der Ursprungszustand
der christlichen Gemeinde und damit ihrer theologischen Autorität wiederhergestellt
werden. Mit den Prolegomena ist so derjenige theologische Grundsatz Ritschls gewon-
nen, welcher in der Formel des „Standpunktes der mit Gott versöhnten Gemeinde“ bzw.
in der der Dreiheit Gott-Christus-Gemeinde seinen geschlossenen Ausdruck findet.
1.3 Spielarten des Gemeindebegriffs
An dieser Stelle ist der inhaltliche Übergang von Prolegomena und der materialen Dar-
stellung zu setzen. Der Grobgliederung des Unterrichts zufolge, die Ritschl am Ende
von §4 vornimmt, „zerfällt“ dieser gemäß den „aufgestellten Bedingungen“ (§4) des
einleitenden Paragraphen in die Lehre vom Reich Gottes, d.i. die Bestimmung der
christlichen Gemeinde ihrer religiös-sittlichen Dimension nach, sowie in die Lehre von
der Kirche, d.h. ihrer dogmatisch-religiösen Dimension nach. Die vier Hauptstücke des
Unterrichts ergeben sich durch die Differenzierung dieser beiden loci hinsichtlich ihres
- 7 -
26 Beide Male wird der „gemeinschaftliche“ Charakter dieser Aspekte hervorgehoben: Ritschl spricht von der „gemeinschaftlichen Religion“ und vom „gemeinschaftlichen Glauben“. - Vgl. UcR §3.27 Scholz spricht von der „Abzweckung seines [sc. Jesu, Anmerkung des Autors] Lebens auf die Stiftung der christlichen Gemeinde“. - Vgl. Scholz 94f. Diese Grundvoraussetzung Ritschls, Jesu Absicht und Werk bestehe darin, eine Gemeinde zu gründen, lässt sich durchaus problematisierten. 28 Vgl. dazu UcR §84ff.
dogmatischen und ethischen Aspekts.29 Durch die so gewonnene Verhältnisbestimmung
von Prolegomena und materialer Dogmatik soll der Fokus auf die Gemeinde konsequent
durch den gesamten Unterricht beibehalten und darüber hinaus die konstitutive Bezüg-
lichkeit von Religion und Sittlichkeit garantiert werden. Die folgende Untersuchung der
dogmatischen Lehrinhalte soll dies anhand einer übersichtlichen Analyse der in den 4
Hauptteilen dargestellten Spielarten des Gemeindebegriffs erproben.
In den §§5-2530 wird die theologischen Souveränität der christliche Gemeinde durch die
Darstellung ihrer spezifischen Relation zu Gott innerhalb des Reich Gottes beleuchtet.
Gott richtet seine „besondere Absicht“31 auf die Gemeinde (§12), deren „höchstes Gut“
das von ihr hervorgebrachte Reich Gottes ist (§5). Ihre Gründung war „vor der Schöp-
fung“ beschlossen (§14) und stellt die Absicht Christi dar (§25), welcher ihre Stiftung
erst möglich gemacht hat (§19). Indem Ritschl die Gemeinde mit diesen Attributen ver-
sieht, verdeutlicht er ihren Vorrangstatus (gegenüber dem Einzelnen), der direkte Zweck
der göttlichen Wirkungsabsicht zur Aufrichtung des Reich Gottes, sowie legitimes Sub-
jekt der Verwirklichung desselben in der berufstätigen Nachfolge von Jesus Christus zu
sein. Sie stellt damit gewissermaßen die kleinste Konzeptionseinheit vom Reich Gottes
dar.
Die „Lehre von der Versöhnung durch Christus“ (§§34-5432) geht nun dazu über, die
Gemeinde als theologischen Ort des religiösen Bewusstseins und damit unbedingte Be-
zugsgröße der Heilsgewissheit durch Christus zu bestimmen: Im §43 ist die Gemeinde
als Ort des Schuldbewusstsein und der gleichzeitigen Versöhnungsgewissheit darge-
stellt, da in ihr die Getrenntheit von Gott ins Bewusstsein tritt, gleichzeitig aber auch
durch Christi Opfertod als überwunden wahrgenommen werden kann.33 Die Erlösung
bezieht sich also nicht direkt „auf die Beseitigung der die Einzelnen beherrschende
Macht der Sünde“ (§44); Jesus Christus wird als Versöhner der Gemeinde vorgestellt
(§52). Die Sündenvergebung des Einzelnen wird als „Rückfall in die katholische Auf-
fassung“ abgelehnt (§47). Die Versöhnung ist eine positive Grundbedingung der christ-
- 8 -
29 In der 2. und 3. Auflage wird diese Unterteilung noch deutlicher. Vgl. dazu Grewel 305, sowie beilie-gendes Schema.30 Siehe UcR 13-41.31 Vgl. UcR 23, Fn. 49.32 Siehe UcR 51-74.33 In §58 wird nochmals das Bewusstsein der Sündlosigkeit in der Gemeinde betont. Vgl. auch §80: „durch Sündenvergebung oder Versöhnung mit Gott“ verbundene Gemeinde.
lichen Gemeinde (§47f), da nur im Reich Gottes der Zustand der „Unfreiheit zum Gu-
ten“, d.i. Sünde als überwunden „sichergestellt ist“ (§39). Ihr kommt durch Jesus Chris-
tus die Gotteskindschaft dadurch zu, dass er als herausgehobenes Mitglied der Gemein-
de eingestuft wird (§54). Die Entfaltung des christlichen Heils wird als wirklich aus-
schließlich an der Gemeinde dargestellt, da allein sie der direkte Adressat der Heilsbot-
schaft ist.
Während die ersten beiden Teile der inhaltlichen Dogmatik aus der göttlichen Perspek-
tive entworfen sind, schließen die beiden folgenden Teile mit der Darstellung des Wir-
kens der christlichen Botschaft von dem menschlichen Standpunkt her an. Die §§55-
7734 entwickeln (im Bezug auf die Bestimmung des Gemeindebegriffs) die grundlegen-
den Bedingungen für die Kompetenz des einzelnen Christen, seiner christlichen Berufs-
tätigkeit in der Erfüllung der Tugenden und Pflichten befähigt zu werden. Die Gemein-
de vertritt gegenüber dem Einzelnen eine gehobene Sichtweise, da sich in ihrer Ausge-
staltung der Heilige Geist als Selbstoffenbarung Gottes manifestiert (§55). Sie ist somit
der einzig zulässige Träger der Offenbarungswirklichkeit.35 Nach der genetischen Rei-
henfolge der Christwerdung aufgefasst, entspricht die Aufnahme in der Gemeinde der
Wiedergeburt des Christen (§56), welcher unter deren „Erziehungswirkungen“ (ebenda)
zur Erfüllung seiner Tugenden und Pflichten und damit zum Erreichen der christliche
Vollkommenheit verholfen wird (§59). Ritschl erwartet daher von dem Einzelnen, dass
er sich der Gemeinde unterordnet (§73). Die sowohl sittlichen, als auch religiösen An-
forderungen werden durch die Grundsätze der „Liebespflichten“ (§72) motiviert. Eine
Erholung von ihnen wird dabei nur bedingt eingeräumt (§71). Weiterhin entspringt das
ewige Leben aus Versöhnung durch Christus (§77), die, wie oben herausgestellt wurde,
nur innerhalb der Gemeinde wirklich ist.
Der vierte Hauptteil (§§78-9036) schließlich konzipiert die Gemeinde durchgehend als
kirchliche Einheit im Gebet (§81) und bei der Vergabe der Sakramente (§83), sowie als
unmittelbar handelndes Subjekt: Gebet und Sakrament sind nach §83 „Kultushandlun-
gen“ bzw. „Akt der (ganzen) Gemeinde“ (§89f) und daher außerhalb von ihr „gar nicht
denkbar“ (§83). Die Gemeinde fasst Ritschl auch insofern als Subjekt auf, dass sie sich
für „die Fortdauer der sündenvergebenden Gnade Gottes, in deren Kraft Christus die
- 9 -
34 Siehe UcR 75-104.35 Vgl. Courth 383.36 Siehe UcR 105-123.
Gemeinde gestiftet hat“ verbirgt (ebenda).37 In ihrer Tätigkeit vertritt sie dabei Jesus
Christus: Sie verbirgt die Sündenvergebung an Christi statt (§90) und regt den Sinn für
die Gemeinschaft im Einzelnen an. Im Zusammenhang der Bejahung der Kindertaufe,
wird in der Verwahrung gegen den Baptismus die „Ausbildung christlicher Persönlich-
keit“ außerhalb der Gemeinde ausgeschlossen (§89). Insgesamt wird der christlichen
Gemeinde damit die kirchliche Autorität zugestanden, da sie als legitimer Vertreter
Christi in seinem Wirken verstanden wird.
Ritschl hält in seiner inhaltlichen Darstellung den „Standpunkt der mit Gott versöhnten
Gemeinde“ konsequent durch.38 Die Grobgliederung des Unterrichts in die 4 Hauptteile
entspricht dabei den Unterbestimmungen des Gemeindebegriffs in den jeweils ethischen
und religiösen Aspekt von Reich Gottes und Kirche. Die Gemeinde ist der grundlegende
Ausgangspunkt der christlichen Dogmatik:39 Als alleiniges Subjekt der theologischen
Wirkzusammenhänge kommen ihr folgende exklusive Eigenschaften zu: Sie ist 1) sou-
veräne, von Gott legitimierte Vertreterin Christi, 2) Adressatin der Heilsbotschaft, 3)
Trägerin der Offenbarungswirklichkeit und 4) Verwalterin der Sakramente. Sie ist das
theologisch-souveräne Subjekt, das sich in der Nachfolge von Jesus Christus durch die
tätige Verwirklichung des Reich Gottes die Rechtfertigung und Versöhnung erwirbt und
diesen Status mit der Vergabe der Sakramente ausweißt. Die christliche Gemeinde ist
aus menschlicher Perspektive das alleinige Subjekt des religiös-sittlichen Handelns als
Reich Gottes und alleiniges Objekt der Rechtfertigung und Erlösung als Kirche; sie ist
so betrachtet die Ellipse selbst.
- 10 -
37 Vgl. Courth 414f.38 Nach Grewel schreibt Ritschl diesen Standpunkt „der Theologie als conditio sine qua non“ vor. - Vgl. Grewel 294.39 Um diesen Ansatz hervorzuheben hat Ritschl in späteren Auflagen die Bedeutung des Gemeindebe-griffs noch verstärkt. - Vgl. z.B. UcR §12, 14, 54 der verschiedenen Auflagen.
2. DER GEMEINDEBEGRIFF ALS NOTWENDIGES ERFORDERNIS
2.1 Wissenschaftlichkeit und theologische Authentizität
Als methodischer Grundsatz hat der Gemeindebegriff Ritschls Auswirkungen auf sämt-
liche Teilgebiete der Dogmatik 40 ; dennoch wird im Unterricht kein eindeutiger Grund
für die in den Prolegomena herausgestellte Unumstößlichkeit des „Standpunktes der mit
Gott versöhnten Gemeinde“41 genannt. Im §1 stellt Ritschl zwar die Behauptung auf,
dass jede Lehrdarstellung „fehlerhaft ausfallen“ muss, die den grundlegenden Bezug zu
Offenbarung und Gemeinde verkennt. Hiermit sind aber erst einmal nur sein biblisch-
normierter Ausgangspunkt, also die Bibel als Quelle theologischer Aussagen, sowie die
veranschlagte Notwendigkeit angedeutet, aus einer speziellen, internen Perspektive he-
raus, die Darstellung der christlichen Dogmatik zu entwickeln. Diese Behauptung bleibt
durch den Unterricht hindurch in ihrem Status der festgestellten Prämisse unverändert,
da ihr Geltungsanspruch nicht thematisiert wird. So stellt sich die Frage, welches Motiv
bzw. welche Motive Ritschl veranlassten, (neben der Bibel als Offenbarung) den theo-
logischen Standpunkt innerhalb der Gemeinde mit dieser Bestimmtheit zu setzen. Zur
Beantwortung kann es auf der einen Seite hilfreich sein, andere seiner Schriften heran-
zuziehen. Auf der anderen Seite erscheint es sinnvoll, Ritschl bei dieser Frage im histo-
risch-theologischen Kontext zu betrachten, da seine klare Bestimmung des methodi-
schen Ansatzes sich in der Kritik übenden Abgrenzung von anderen theologischen Ent-
würfen bzw. als die Reaktion auf die Umstände seiner Zeit im Allgemeinen ausdrückt.
Daher soll jetzt der maßgebliche Grund für seinen spezifischen, theologischen Ansatz,
also warum Ritschl dem Gemeindebegriff diese zentrale Rolle zuspricht, einmal sofern
er sie in seinen anderen Schriften anführt, festgestellt und daraufhin exemplarisch an
seiner Rezeption von Schleiermacher, seiner Interpretation und davon abgeleiteten Kri-
tik, nachvollzogen werden.
In Bezug auf die Bestimmung des Gemeindebegriffs bemerkt Grewel, es sei Ritschls
Verdienst, mit dem durch den Standpunkt der Gemeinde gegebenen Aufbau seines theo-
logischen Systems einen konsequenten Mittelweg zwischen Offenbarungspositivismus
und natürlicher Theologie eingeschlagen und somit gleichermaßen der Darstellung der
- 11 -
40 Dazu Grewel 293: „Die Bedingung des Standpunktes der Gemeinde gilt also nicht nur für die Lehre von der Rechtfertigung und Versöhnung, sondern für alle Glieder des christlichen Vorstellungskreises.“41 Siehe Fußnote 38.
christlichen Glaubensrealität, sowie dem wissenschaftlichen Anspruch an die Theologie
keinen Schaden angetan zu haben.42 - Doch inwiefern trifft das zu? Offensichtlich will
Ritschl mit der in den Prolegomena vorgenommenen Festlegung die Notwendigkeit ei-
ner bestimmten methodischen Prämisse für die Darstellung der christlichen Lehrinhalte
ausdrücken - nämlich die Notwendigkeit der internen, intersubjektiven Perspektive, also
der der christlichen Gemeinde, bei der Darstellung der dogmatischen Lehrinhalte. Wie
kein anderes Prinzip durchdringt der Gemeindestandpunkt des Theologen die Ritschl-
sche Dogmatik im Unterricht und der Rechtfertigung und Versöhnung.43 „Der Glaube
der Gemeinde [...] ist das unmittelbare Objekt des theologischen Erkennens.“44 Der
Gemeindebegriff, als Konsequenz des methodischen Grundsatzes, soll nun die Funktion
erfüllen, die Wissenschaftlichkeit und damit die theologische Authentizität der Lehrdar-
stellung zu garantieren: „[...] die individuelle Selbsterkenntnis, welche der Theolog an
seinem Christenthum übt, wird niemals wissenschaftlich sein, außer wenn der Theolog
in seiner Absicht, das allgemeine Christenthum zu erkennen, seine Beobachtungen an
sich selbst mit den ausgesprochenen Erfahrungen Anderer vergleicht.“45 In der Konse-
quenz folgt daraus die Kritik an der wissenschaftlichen Souveränität aller subjektiv-reli-
giösen Phänomene (z.B. in Gestalt mystischer oder pietistischer Lehrelemente). Der
aufgrund seines aspekthaften Charakters durch Unvollständigkeit gekennzeichnete, sub-
jektive Standpunkt wird also in Anbetracht der Ermangelung an Objektivität als der wis-
senschaftlichen Darstellung nicht fähiger Ansatz strikt ausgeschlossen.46 Auch was die
Heilige Schrift als Quelldokument betrifft sollte der Gemeindebegriff als „objektives
Auslegungskriterium“47 Anwendung finden. Die Theologie hat nach Ritschl in der Bibel
ihre Quelle, die Perspektive der Gemeinde ist ihre Auslegungsnorm, der einheitliche
theologische Standpunkt. Daraus erhellt, dass nach Ritschl die Wirklichkeit des christli-
chen Lebens ausschließlich an der Gemeinde dargestellt werden kann. In Hinsicht auf
die Forderung der Wissenschaftlichkeit unterscheidet Ritschl demzufolge auch konse-
- 12 -
42 Vgl. Grewel 311.43 Vgl. UcR 3.44 Siehe RuV III 3.45 Siehe RuV II 8.46 Die Reaktion Ritschls auf die Entkirchlichung bzw. den Kulturkampf im 19. Jahrhundert kommt nur als sekundärer Faktor für die Ausbildung des Ritschlschen Gemeindebegriffs in Betracht. - Vgl. dazu Scheli-ha 81, sowie dagegen Grewel 309.47 Vgl. Courth 384.
quent „zwischen Theologie und Religion, Andacht und Wissenschaft“, was den „Aus-
schluss religiöser Unmittelbarkeit aus der Theologie“48 bedeutet. Die Darstellung der
christlichen Religion innerhalb eines theologischen Systems muss klar von der subjekti-
ven Beschreibung der christlichen Glaubensrealität unterschieden werden, da sie sich,
was den wissenschaftlichen Anspruch an sie betrifft, grundlegend von einander unter-
scheiden. 49 Eine solche wissenschaftliche Darstellung erhebt also gar nicht den An-
spruch die christliche Glaubensrealität vollständig abzubilden.
Für Ritschl stellte es innerhalb seiner wissenschaftstheoretischen Überlegungen damit
eine grundlegende Problematik dar, die Möglichkeit eines wissenschaftlich konsistenten
Systems der Theologie herauszustellen. Als Garant dieser Möglichkeit hat er daher den
Gemeindebegriff als methodischen Grundsatz systematisch konstruiert, 50 um diese
Funktion für das ganze dogmatische System zu erfüllen: „ Diesen Standpunkt [sc. der
Gemeinde, Anmerkung des Autors] einzunehmen ist der Theologie geboten, und nur so
kann es gelingen ein System der Theologie auszuführen, welches diesen Namen
verdient.“51 Die „Lehre von der Gemeinde“ bzw. das „Gemeindeprinzip“52 ergab sich
für Ritschl somit als notwendiger Grundbestandteil seines theologischen Systems.
Weiterhin lässt sich beobachten, dass der Gemeindebegriff auch als Kriterium für die
Interpretation und Beurteilung anderer theologischer Entwürfe Anwendung fand. Etwa
bei Ritschls Auseinandersetzung mit Schleiermacher ist auffällig, dass bei aller ver-
meintlich „differenzierten Zustimmung“53, aber auch Ablehnung54 gegenüber seiner
Theologie, Ritschl ihn genau an den Punkten, wo er einer individualistischen Perspekti-
ve den Vorzug gibt, seinen Ansatz kritisiert. Ritschl wollte, wie soeben herausgestellt,
innerhalb der Darstellung seiner Dogmatik alle vermeintlich subjektiv-religiösen Leer-
stellen, d.h. alle individuellen Glaubenserfahrungen konsequent ausschließen.55 Durch
diesen strikten Ausschluss aller, nach seinem Ermessen „unwissenschaftlichen“ Elemen-
- 13 -
48 Vgl. Grewel 300, Fn. 7.49 Vgl. dazu Grewel 309. Ritschl wollte damit aber nicht die unmittelbare Gottesbeziehung des Einzelnen leugnen. - Vgl. dazu ARL 225f.50 Vgl. Grewel 311, Fn. 16.51 Siehe RuV III 4. Vgl. auch UcR 3.52 Vgl. Grewel 299.53 Vgl. Zachhuber 27.54 Weinhardt problematisiert die vermeintliche Nähe beider Theologen. - Vgl. ARB 59.55 Damit geht eine grundlegende Kritik an der christlichen Mystik und dem Pietismus einher.
te musste es aber stellenweise zu einer eigentümlichen Interpretation bis hin zu einer
Abwertung der theologischen Aussagen Schleiermachers kommen. 56 Dies lässt sich
beispielhaft am Hauptsatz des §28 der Glaubenslehre57 zeigen: Ritschl bezeichnet die
Aussage Schleiermachers schlicht als falsch,58 wodurch angezeigt ist, dass er jedes indi-
viduelle Verhältnis zu Christus nur vermittelt über die Kirche als möglich erachtet, den-
noch aber nicht dem Katholizismus zugerechnet werden will. 59 Die Abgrenzung vom
Katholizismus meint Ritschl dadurch zu erreichen, dass er seinen Gemeindebegriff nicht
als Rechtsgemeinschaft, sondern als Reich Gottes als eine ausschließlich religiös-sittli-
che Gemeinschaft konzipiert. Doch damit hat er sich lediglich von dem katholischen
Kirchenbegriff abgegrenzt, nicht aber von den gemeinschaftlicher Erlösungsvorstellun-
gen, die der katholischen Lehrvorstellung eigen sind. Die sich aus dem Gemeindebegriff
ergebenden kollektivistischen Tendenzen und damit solcher, die eine vermeintliche Nä-
he zum Katholizismus herstellen, lassen sich also innerhalb von Ritschls Standortbe-
stimmung nicht ausschließen. Daher rührt der gegen Ritschl oft geführte Katholizismus-
Vorwurf:60 Wenn Ritschl der Gemeinde die einzige Erlösungswirklichkeit zuspricht,
steht das in direktem Widerspruch zu der protestantischen Vorstellung der Möglichkeit
der individuellen Heilsgewissheit durch den Glauben.
2.2 Zur Methodik der theologischen Wissenschaft
An dieser Stelle scheint es einige kritische Überlegungen wert zu sein, inwiefern der
von Ritschl entwickelte Gemeindebegriff seine Funktion als Garant wissenschaftlicher
Objektivität überhaupt erfüllen kann. Ritschl geht es um allgemeine und objektive Er-
kenntnis, die sich letztendlich in einer „Theorie des Christentums“61 ausdrücken lässt.
Zwei Aspekte gilt es hier zu beleuchten: 1) die Notwendigkeit der internen Perspektive
- 14 -
56 Ritschl beansprucht gegenüber den ausgewiesenen Anhängern von Schleiermacher eine authentischere, nicht so wie bei ihnen entstellte Interpretation von Schleiermachers Aussagen zu besitzen.Vgl. Zachhuber 23.57 GL 541 (Leitsatz des §28 der 1. Auflage): „Vorläufig möge man den Gegensatz so fassen, daß der Pro-testantismus das Verhältniß des Einzelnen zur Kirche abhängig macht von seinem Verhältniß zu Christo, der Katholizismus aber umgekehrt das Verhältniß des Einzelnen zu Christo abhängig macht von seinem Verhältnis zur Kirche.“58 Vgl. Scheliha 77.59 Vgl. UcR § 84.60 Dieser versucht Ritschls theologischem Entwurf katholisierende Tendenzen zuzuschreiben und ist u.a. zu finden bei: Weiß (397) und Courth (470).61 Vgl. Zachhuber 36.
bei der Aussage von christlichen Lehrinhalten,62 sowie 2) die Intersubjektivität, in der
das dogmatische Material innerhalb der Gemeinde erhoben wird.
1) Dass ein wissenschaftlicher Gegenstand der Theologie nur aus der internen Perspek-
tive dieser Wissenschaft richtig erkannt werden kann, ist allgemein anerkannt. Nur als
Christ können theologische Aussagen getroffen werden, andernfalls bewegen sie sich
automatisch in dem Bereich der Religionswissenschaft.
2) Der Theologe gelangt nach Ritschl aber erst dann zu der geforderten „allgemeingilti-
gen Erkenntnis des Christenthums“63, wenn er durch alleinige Berufung auf die Bibel64
einen einheitlichen Standpunkt gewinnt, indem er sich innerhalb der Gemeinde mit an-
deren Theologen über deren religiöse Erfahrungen ausspricht.65 D.h. durch die Samm-
lung individuell aufgenommener Glaubenserfahrungen soll ein einheitlicher Standpunkt
gewonnen werden. Ritschl scheint damit einer empiristischen Wissenschaftskonzeption
zu verfallen, deren maßgebliche Schwäche die Annahme der notwendigen Schlüssigkeit
des Induktionsprinzips ist: Es wäre mit unüberbrückbaren Schwierigkeiten verbunden,
aus der Systematisierung von Einzelbeobachtungen in einen einheitlichen Standpunkt
auf das Wesen des Christentums zu schließen. Es sind z.B. zwei verschiedene Gemein-
den vorstellbar, die einen unterschiedlichen Auffassung vertreten, was die Bestimmung
dieses Wesens oder der Auslegungsmöglichkeiten der Bibel betrifft. Auch gelangt er mit
der Gemeinde als Vertreter eines einheitlichen Standpunktes zu keinem Ausschluss irra-
tionaler Momente, was etwa an mancher spiritistischen Gemeinden gezeigt werden
könnte. Daraus folgt offenbar, dass die Theologie, wenn sie mit dem Anspruch der Ob-
jektivität auftreten will, keine rein empirische Wissenschaft sein kann. Der wissen-
schaftliche Ort der Theologie liegt vielmehr zwischen spekulativem Geisteswissen-
schaften und empirischen Naturwissenschaften.66 Der reale Unterschied zwischen sys-
tematisch-wissenschaftlicher Darstellung theologischer Aussagen und deren religiös-
motiviertem Erzählen liegt nicht in deren vorhandener bzw. nicht vorhandener Intersub-
jektivität, sondern in der Verbindung von induktiver und spekulativer Methode, in der
- 15 -
62 Vgl. dazu S. 3.63 Vgl. RuV II 9.64 Zuvorderst ist zu bemerken, dass die Setzung des Gemeindebegriffs als methodische Prämisse schon die erste wissenschaftliche Handlung ist. Deren Objektivität will Ritschl nun in der These, Jesus wollte eine Gemeinde gründen, biblisch legitimieren. - Vgl. dazu RuV II 9ff.65 Vgl. S.13, Fn. 54.66 Vgl. TRE2 201.
das religiöse Erfahrungsmaterial zur wissenschaftlichen Erkenntnis erhoben wird.
Ritschl gelangt daher mit seiner Konzeption des Gemeindebegriffs nicht über die Ga-
rantiefähigkeit einer konsensfähigen, intersubjektiven Erkenntnis hinaus.
3. STRUKTURPROBLEME DER RITSCHLSCHEN GEMEINDEKON-
ZEPTION
3.1 Das Individuum in der Gemeinde
Der mit dem Wissenschaftlichkeitsanspruch an die Theologie begründete Ausschluss
aller individuell-religiöser Leerstellen aus dem dogmatischen System Ritschls wirkt sich
auch maßgeblich auf die Verhältnisbestimmung von Gemeinde und Individuum aus.
Demgemäß lässt sich aus dem Unterricht auch eine entsprechend unterschiedene Positi-
on des Einzelnen in Beziehung zu der Gemeinde extrahieren: Das Vorhandensein des
Reich Gottes ist, insofern es als „übernatürlich“ und „überweltlich“ vorgestellt wird
(§8), „Gegenstand des religiösen Glaubens“ (§9). Gemäß diesem Glauben erfüllt der
Einzelne durch die Aneignung des „Endzwecks Gottes“ (§46) seine sittliche Aufgabe
durch die Ausübung seines Berufs „zum gemeinen Nutzen“ (§28). Nur in dieser Tätig-
keit nimmt er sein „Handeln aus Liebe gegen den Nächsten“ als „letzter Beweggrund
des Handelns“ (§27) an, wodurch erst eine „vollständige gegenseitige Verbindung der
Einzelnen durch das Handeln aus Liebe“ (§13) stattfindet. Mit diesen Ausführungen
macht Ritschl die Voraussetzung, dass der Einzelne nur durch die Einrechnung in die
Gemeinde seiner sittlichen Aufgabe gerecht werden kann. Diese Position verstärkt
Ritschl anhand einer Reihe von Forderungen innerhalb der Bestimmung eines strengen
christlichen Ethos, der sich in dem aufgestellten Katalog der Tugenden und Pflichten in
den §§60-62 und 65-68 zeigt. Die einen sind Ausdruck für die aktiv-unentwegten (das
sind z.B. die Tugend der Entschlossenheit und der Beharrlichkeit), die anderen dagegen
für die passiv-erwartenden (religiöse Tugenden: Demut, Glaube, Geduld; sittliche Tu-
genden: Selbstbeherrschung, Besonnenheit, Dankbarkeit) Aspekte der Berufstätigkeit
des Einzelnen.67 Hierin drückt sich aus, dass der Einzelne nicht nur der Möglichkeit
nach der sittlichen Aufgabe gerecht werden kann, wenn er sich unter die Gemeinde sub-
- 16 -
67 Vgl. auch Courth 474f.
sumiert; er soll dies als seine Pflicht tun, da die Unterordnung auch der Zweck eines
Großteils seiner religiösen und sittlichen Tugenden ist. Damit ergibt sich eine zirkuläre
Bestimmung der sittlichen Aufgabe des Einzelnen: Die Einordnung des Individuums in
die Gemeinde ist zugleich Mittel und Zweck. Ritschl unterstreicht so noch einmal, dass
der einzelne Christ fortwährend in einem einseitigen Abhängigkeitsverhältnis gegenüber
der Gemeinde steht. Darüber hinaus ist er innerhalb dieser Wirkzusammenhänge eben-
falls einer Reihe von Anfechtungen seines Glaubens ausgesetzt: Einerseits soll er an die
Verwirklichung des Reich Gottes glauben, da diese nicht unmittelbar wahrgenommen
werden kann (§9f.).68 Auf der anderen Seite wird er in seinem Gewissen durch das
Schuldgefühl (§40) mit seiner „Unfreiheit zum Guten“ konfrontiert (§39). Denn die Er-
lösung bezieht sich nicht direkt „auf die Beseitigung der die einzelnen Beherrschende
Macht der Sünde“ (§45). So ist er dazu angehalten, die in der Gemeinde zugestandene
„Gnadenwirkung zugleich als Antrieb“ für die berufsgemäße Ausübung seiner sittlichen
Tätigkeit aufzunehmen (§55).
Es lässt sich zusammenfassend festhalten: In der Ausübung des Berufs, d.i. der Bereich
der christlichen Ethik, soll sich das Individuum der Gemeinschaft unterordnen (§73),
was sich in den „Liebespflichten“ des Einzelnen gegen sie ausdrückt. Diese „Liebes-
pflichten“, welche das Bestehen und die Anerkennung der Gemeinde als Träger der Ver-
söhnungs- und Offenbarungswirklichkeit zur Abzweckung haben, werden nun zum
christlichen Tugendideal aufgebaut. Es zeigt sich, dass Ritschl die Glaubensrealität des
Einzelnen immer nur in dem Maße thematisiert, wie es für die Eingliederung in die
Gemeinde der Bestimmung seines sittlichen Berufs nach erforderlich ist - also immer
nur indirekt: „Der gegenwärtige Glaube des einzelnen ist nicht einmal Medium theolo-
gischer Erkenntnis, geschweige denn relativ selbstständiger Gegenstand der Theolo-
gie.“69
3.2 Sittliche Überhöhung und religiöse Vereinzelung
Das eben zum Ausdruck gekommene, deutlich einseitige Verhältnis von Gemeinde und
einzelnem Christen lässt sich zur Veranschaulichung vorläufig in folgendem Bild be-
schreiben: Während sich Gott (vermittelt durch Christus) im Heiligen Geist für Ge-
- 17 -
68 Vgl. S. 16.69 Siehe Schäfer 137. Vgl. dazu auch Schäfer 180f.
meinde offenbart (deus revelatus), ist er demgegenüber für das Individuum stets verbor-
gen (deus absconditus). „Einerseits verkehrt Gott nicht direkt mit dem Christen, sondern
nur durch die Vermittlung des in Christus gesetzten Bundes. Andererseits muß der
Christ ohne Rücksicht auf die Genossen des Bundes seinen Glauben und Vertrauen auf
Gott richten, also ohne den Umweg über die Gemeinde zu nehmen.“70 Die Möglichkeit
der unmittelbaren Teilnahme des einzelnen Christen an den theologischen Wirkzusam-
menhängen wird damit, wie etwa bezüglich der Erlösung, ausgeschlossen: „Ohne Ein-
ordnung in die nach Gottes Willen ausgezeichnete Gemeinde wäre der Gedanke der
Sündenvergebung reine Illusion.“71 Hier deuten sich nun zwei entscheidende Konse-
quenzen an: 1) die Unterbestimmung des individuellen Glaubens,72 und 2) die von der
Gemeinde abhängige Heilsgewissheit.73
Wenn Ritschl also aus dem von ihm entworfenen christlichen Ethos eine so umfassende
Bestimmung der Tugenden und Pflichten des Einzelnen aufgrund seiner Beziehung zur
Gemeinde festlegen will, muss er einen Ausgleich hinsichtlich seiner religiösen Ge-
wissheiten, die aus seinem Glauben entstehen, finden. Denn andernfalls bliebe der ein-
zelne Christ, im fortwährenden Streben, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, im „sitt-
lichen Hamsterrad“ des Reich Gottes gefangen. Er wäre nämlich immer auf die Ge-
meinde angewiesen, ihm die Gewissheit, die er selbst nicht erlangen kann, zu vermit-
teln, ob er den sittlichen Ansprüchen an ihn innerhalb Ritschls Berufsbestimmung ge-
recht geworden ist.74 Das diesbezüglich Zwischenfazit von Weiß lautet: „Es ist also die
Aufgabe, das Wesen des Christenstandes so zu fassen, daß einerseits die Selbstständig-
keit im sittlichen Handeln auch noch an dem Gepräge der religiösen Abhängigkeit von
Gott teilnehme, anderseits aber die persönliche Selbstständigkeit des Gläubigen auch in
der grundlegenden specifisch-religiösen Funktion sichergestellt werde.“75 D.h. die mit
der Gewissheit der beruflichen Zweckerfüllung einhergehende Rechtfertigung muss
dem Individuum unvermittelt zugestanden werden. Der aus der dogmatischen Darstel-
lung auf die Wirklichkeit des christlichen Heils übertragene Gemeindebegriff führt so
- 18 -
70 Siehe Schäfer 143.71 Siehe Courth 414f.72 Vgl. Schäfer 180f.73 Ferner wirft Weiß Ritschl ein Gottesbild, das sich dem Deismus nähert, vor. Vgl. dazu Weiß 395f.74 Vgl. Courth 416f., vor allem aber 418.75 Siehe Weiß 390.
zu einer vehementen Spannung in der Glaubensrealität des einzelnen Christen bzw. in
dem Verhältnis von sittlicher und dogmatischer Bestimmung. Der Ritschlsche Gemein-
debegriff führt zur sittlichen Überhöhung des christlichen Ethos und zur religiösen Ver-
einzelung des Individuums in seiner Heilsungewissheit. Der Katholizismus-Vorwurf
gegen Ritschl wird, wenn er diesen Missstand gelten machen will, erst jetzt wirksam, da
sich nur durch diese Argumentation das gefährliche Potenzial zum religiösen Kollekti-
vismus im Ungleichgewicht von Gemeinde und Individuum offenbart.
4. DAS SPANNUNGSVERHÄLTNIS IN GLAUBEN UND THEOLOGIE
Ritschls Programm in seinem theologischen Entwurf ist es, jeglichen Subjektivismus in
der Darstellung seines dogmatischen Systems auszumerzen, um subjektive Störfaktoren
in der Theologie ausschließen zu können. Doch die Objektivität der christlichen Lehre
ist mit der Einführung des Gemeindebegriffs nicht garantiert, sondern führt der Tendenz
nach zur dogmatischen Bestimmung von Kernbegriffen der christlichen Lehre. Vor al-
lem im Ritschlschen Verständnis der Heilsgewissheit des Einzelnen durch die Gemein-
de, welche immer an die sittliche Berufstätigkeit zur Verwirklichung des Reich Gottes
gekoppelt bleibt, kann dieser die Gewissheit der Versöhnung immer nur relativ auf sich
beziehen und hat so notwendigerweise nie die Möglichkeit, aus dem sich ergebenden
Spannungsverhältnis auszutreten. Dass ein theologisches System nur Elemente der
christlichen Lehre enthalten darf, die innerhalb des wissenschaftlichen Anspruchs dar-
stellbar sind, ist die eine Seite; auf der anderen Seite ist ein solches System, welches in
der Konsequenz seiner Setzung die individuelle Glaubensrealität nur typisiert auftreten
lassen kann, als dogmatisch zu bezeichnen. Gerade durch Ritschls Anliegen mit dem
Unterricht ein Lehrwerk für Gymnasiasten zu veröffentlichen, ist es offensichtlich, dass
dieser seiner Intention nach auf den Glauben des Einzelnen einwirkt und ihn gestaltet.
Wenn er dann eine solch strenge Ethik und die alleinige Gültigkeit der kollektivistischen
Perspektive proklamiert, ohne zu beleuchten aus welchem Grund, dann ergeben sich
dadurch dogmatische Tendenzen in Richtung Biblizismus, vor allem aber Katholizismus
in dem Bewusstsein der Christen.
Darüber hinaus muss - bei aller vermeintlichen, theologischen Konsequenz, die Ritschl
in der Konzeption seines Gemeindebegriffs anwendet - die starke Abhängigkeit des ein-
- 19 -
zelnen Christen von der Gemeinde dem heutigen Christen auf dem geschichtlichen Hin-
tergrund der Gefahren des Totalitarismus und der damit verbundenen Aufgabe der Ei-
genbestimmtheit als abständig erscheinen. Denn polemisch ausgedrückt ist das grundle-
gende Ritschlsche Diktum die Einordnung des einzelnen Gläubigen in der Gemeinde, in
dessen Konsequenz sich alle weitere Entwicklung des Christenstandes mit der Rechtfer-
tigung in der Gemeinde usw. quasi in notwendiger Abfolge zu ergeben scheint; immer
unter der Bedingung, dass sich der einzelne Christ wohlgesonnen in die Gemeinde ein-
gliedert und seinen Pflichten nachkommt. Damit eine dogmatische Lesart des Gemein-
debegriffs von Ritschl, die zu einer Annäherung der Ritschlschen Gemeinde und der
katholischen Kirche führen würde, ausgeschlossen werden kann, muss die Heilsgewiss-
heit des Einzelnen in der Gemeinde unter der Bedingung stehen, dass dieser den sittli-
chen Erfordernissen bei der Ausübung der christlichen Berufstätigkeit gerecht werden
kann. Denn wenn die Gemeinde als objektives Kriterium für die Versöhnung mit Gott,
etc. behauptet werden soll, ergibt sich in der Folge das Problem, dass wiederum kein
objektives Kriterium für die Anerkennung des Erfolges des Einzelnen bei der Verwirkli-
chung des Reich Gottes vorhanden ist, sondern maßgeblich von der subjektiven Zu-
schreibung dieses Erfolges durch andere oder auch den Einzelnen selbst abhängt. Damit
geriete der einzelne Christ in das weiter oben angebrachte „sittliche Hamsterrad“ des
Reich Gottes. Es muss also ein Element der individuellen Gewissheit der unmittelbaren
Beziehung zu Gott im Menschen zugestanden werden. Andernfalls verkehrt sich die in
der christlichen Religion angestrebten Erlösung in ihr genaues Gegenteil: innere Gespal-
tenheit und Entfremdung.
Es zeigt sich, dass die Schwierigkeit von Ritschls Ansatz darin besteht, einen Ausgleich
zwischen sittlichen Forderungen und religiöser Eigenständigkeit, die sich in einer Form
der individuellen Heilsgewissheit zeigt, zu finden, um dogmatisch-totalitäre Perversio-
nen ausschließen zu können. Dieses Element der individuellen Gewissheit steht freilich
immer in Spannung mit der Ausartung der Heilsgewissheit in willkürlichen Subjekt-
ivismus. Doch es scheint so, als wäre dieses Spannungsverhältnis zwischen religiösem
Zweifel und Gewissheit innerhalb der Glaubensrealität des einzelnen Christen nicht auf-
zulösen. Und eben darin liegt vielleicht auch die Authentizität von Schleiermachers
Darstellung des christlichen Glaubens in seiner Glaubenslehre - dass sie diese Spannung
im Glauben in den theologischen Entwurf integriert und damit auszuhalten vermag.
- 20 -
5. LITERATURLISTE
Die in den Fußnoten verwendeten Abkürzungen bzw. Siglen finden sich in den eckigen Klammer zu Beginn der jeweiligen Literaturangabe.
5.1 Primärliteratur
[RuV I-III] Ritschl, Albrecht: Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Versöh-nung. - Bd. 1: Die Geschichte der Lehre, Bonn, 18893; - Bd. 2: Der biblische Stoff der Lehre, Bonn, 18893; - Bd. 3: Die positive Entwicklung der Lehre, Bonn, 18883.
[UcR] Axt-Piscalar, Christine (Hrsg.): Ritschl, Albrecht: Unterricht in der christlichen Religion. Studienausgabe nach der 1. Auflage von 1875 nebst den Abweichungen der 2. und 3. Auflage, Tübingen, 2002.
[GL] Schäfer, Rolf (Hrsg.): Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst: Der christliche Glaube. nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange darge-stellt. Zweite Auflage (1830/31), Berlin, 2008.
5.2 Sekundärliteratur
[ARB] Weinhardt, Joachim: Albrecht Ritschls Briefwechsel mit Adolf Harnack 1875-1889, Tübingen, 2010.
[ARL] Ritschl, Otto: Albrecht Ritschls Leben, Bd. 2: 1864 - 1889, S. 221-236.
[Courth] Courth, Franz: Das Wesen des Christentums in der Liberalen Theologie darge-stellt am Werk Fr. Schleiermachers, Ferd. Chr. Baur und A. Ritschls, Frankfurt (Main), 1977, S. 383-89, 413-18, 470-75.
[Grewel] Grewel, H.: Kirche und Gemeinde in der Theologie Albrecht Ritschls, in: NZSTh 11 (1969), 292-311.
[Schäfer] Schäfer, Rolf: Ritschl. Grundlinien eines fast verschollenen dogmatischen Systems, Tübingen, 1968.
[Scholz] Scholz, H.: Kirche und Gemeinde in Schleiermachers und Ritschls Erlösungs-lehre; in: Theologische Studien und Kritiken (ThSK), Gotha, 1908, 1. Heft, S.84-138.
[Scheliha] Scheliha, A. v.: Protestantismus und Kirche. Albrecht Ritschls ekklesiologi-sche Interpretation von Schleiermachers Wesensformel, in: ders./ Schröder, M. (Hgg.): Das protestantische Prinzip. Historische und systematische Studien zum Protestantis-musbegriff, Stuttgart, 1998, S. 77-101.
- 21 -
[TRE1] Art.: Schäfer, Rolf: Ritschl, Albrecht; in: Theologische Real Enzyklopädie (TRE), Bd. XXIX, Berlin, 1998, S. 220-238.
[TRE2] Art.: Maurer, Ernstpeter: Wissenschaft/ Wissenschaftsgeschichte/ Wissen-schaftstheorie. II. Systematisch-theologisch; in: Theologische Real Enzyklopädie (TRE), Bd. XXXVI, Berlin, 2004, S. 200-209.
[Weiß] Weiß, Herrmann: Über das Wesen des persönlichen Christenstandes; in: Theolo-gische Studien und Kritiken (ThSK), 1881, S. 377-417.
[Zachhuber] Zachhuber, Johannes: Friedrich Schleiermacher und Albrecht Ritschl. Kon-tinuitäten und Diskontinuitäten in der Theologie des 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Neuere Theologiegeschichte, 12. Bd., S. 16-46.
- 22 -