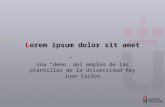Rechtsgutachten zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Rechtsgutachten zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem ...
Landtag Nordrhein-Westfalen • Postfach 10 11 43 • 40002 Düsseldorf
Landtag NRW • Platz des Landtags 1 • 40221 Düsseldorf • Telefonzentrale: (0211) 884-0
Bankverbindung: Helaba - Niederlassung Düsseldorf • BLZ 300 500 00 • Kto.-Nr. 4 054 011
IBAN DE80300500000004054011 • SWIFT/BIC WELADEDDXXX
Internet: www.landtag.nrw.de
Rechtsgutachten zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in Nordrhein-Westfalen Bearbeitung: Univ.-Prof. Dr. Christoph Gröpl
Datum: 5. Oktober 2020
17
INFORMATION
17/279Alle Abg
Parlamentarischer Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-Westfalen
LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN
. WAHLPERIODE
Dieses Gutachten hat der Parlamentarische Beratungs- und Gutachterdienst im Auf-trag des Ausschusses für Haushaltskontrolle erstellen lassen.
Die Gutachten des Parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienstes des Landtags Nordrhein-Westfalen sind urheberrechtlich geschützt. Die weitere Verarbeitung, Verbreitung oder Veröffentlichung - auch auszugsweise - ist nur unter Angabe der Quelle zulässig. Jede Form der kommerziellen Nutzung ist untersagt.
von
Univ.-Prof. Dr. Christoph Gröpl,
St. Ingbert, 5. Oktober 2020
Rechtsgutachten
zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren
in Nordrhein-Westfalen
erstattet im Auftrag
des Landes Nordrhein-Westfalen,
vertreten durch den Präsidenten des Landtags,
dieser vertreten durch den
Parlamentarischen Beratungs- und Gutachterdienst
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 2
…
Inhaltsverzeichnis
A. Auftrag ................................................................................................................................................... 4
B. Sachstand .............................................................................................................................................. 5
I. Besuch des Ausschusses für Haushaltskontrolle in der Schweiz ............................................................ 5
II. Bitte um rechtliche Prüfung ..................................................................................................................... 7
III. Wiederkehr des Themas ......................................................................................................................... 7
C. Rechtliche Würdigung
Zu Frage Nr. 1
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass der zuständige Ausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen Prüfaufträge an den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen erteilt? ............................ 8
I. Zulässigkeit von Prüfaufträgen nach geltendem Recht (de lege lata) ..................................................... 8
1. Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen .................................................................................. 9
a) Aufgaben des Landtags, insbesondere in Bezug auf den Landeshaushalt .................................. 9
b) Rechtsstellung und Aufgaben des Landesrechnungshofs ......................................................... 10
aa) Prüfungsaufgaben .............................................................................................................. 10
bb) Sachliche Unabhängigkeit .................................................................................................. 11
cc) Persönliche Unabhängigkeit der Rechnungshofmitglieder ................................................. 12
dd) Weisungsfreiheit und „Parlamentsfreiheit“ ......................................................................... 12
ee) Zwischenergebnis .............................................................................................................. 14
2. Einfaches Landesrecht .................................................................................................................... 14
a) Landesrechnungshofgesetz ....................................................................................................... 14
b) Landeshaushaltsordnung ........................................................................................................... 16
aa) Konkretisierung der Landesverfassung .............................................................................. 16
bb) Prüfung durch den Landesrechnungshof ........................................................................... 17
cc) Beratung des Landtags ...................................................................................................... 17
(1) Unselbständige Beratung.............................................................................................. 17
(2) Selbständige Beratung.................................................................................................. 18
dd) „Laufende Beratung des Landtags“ .................................................................................... 20
(1) Gesetzesentwicklung .................................................................................................... 20
(2) Auslegung ................................................................................................................. 23
ee) Jahresbericht; Unterrichtung bei besonderer Bedeutung ................................................... 25
3. Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen ................................................................... 27
a) Parlamentarisches Binnenrecht ................................................................................................. 27
b) Organisation und Verfahren der parlamentarischen Ausschüsse .............................................. 28
c) Ausschluss einer Überschreitung des Binnenrechts durch Umgehung ...................................... 29
4. Ergebnis .......................................................................................................................................... 29
II. Zulässigkeit von Prüfaufträgen aufgrund von Rechtsänderungen (de lege ferenda) ............................. 30
1. Kompetenz ...................................................................................................................................... 31
2. Vorgaben ......................................................................................................................................... 31
a) Unionsrecht ................................................................................................................................ 31
b) Bundesrecht ............................................................................................................................... 31
aa) Kompetenz zur Haushaltsgrundsatzgesetzgebung .............................................................. 31
bb) Gesetzgebungsaufträge im Sinne von § 1 HGrG ................................................................. 32
cc) Einheitlich und unmittelbar geltende Vorschriften ................................................................ 33
dd) Bundesrechtlich garantierte Rechtsstellung der Landesrechnungshöfe ............................. 34
c) Landesrecht ............................................................................................................................... 35
3. Rechtsvergleich: Haushaltsordnungen des Bundes und der anderen Bundesländer ...................... 36
4. Empfehlung der Konferenz der deutschen Landesparlamente aus dem Jahr 1971 ........................ 37
5. Bewertung ....................................................................................................................................... 38
a) Vorschriften in anderen Bundesländern ..................................................................................... 38
b) Verfassungslage in Nordrhein-Westfalen ................................................................................... 39
aa) Beratungen des Verfassungsausschusses ........................................................................ 39
bb) Schrifttum zur Landesverfassung: „Parlamentsfreiheit“ und Weisungsfreiheit ................... 39
cc) Schrifttum zum Bundesrecht .............................................................................................. 40
6. Ergebnis .......................................................................................................................................... 41
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 3
…
Zu Frage Nr. 2
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass sich der zuständige Ausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen während des laufenden Haushaltsjahres mit Fragen der Ausführung des Haushaltsplans befasst?................................................................................................................... 42
I. Zulässigkeit nach geltendem Recht (de lege lata) ................................................................................. 42
1. Zustimmungsvorbehalte bei der Ausführung des Haushaltsplans im engeren Sinne ...................... 42
2. Beteiligungsvorbehalte im Übrigen .................................................................................................. 43
3. Beschlussfassungskompetenz des zuständigen Ausschusses ....................................................... 44
II. Zulässigkeit aufgrund von Rechtsänderungen (de lege lata) ................................................................ 44
1. Haushaltskreislauf mit Kompetenzen und Funktionen ..................................................................... 44
2. Gewaltenteilung als tragendes Verfassungsprinzip ......................................................................... 46
3. Gewaltenverschränkung: Bedingungen und Grenzen ..................................................................... 46
4. Insbesondere zu Einflussmöglichkeiten der Legislative auf den Haushaltsvollzug .......................... 48
III. Ergebnis ................................................................................................................................................ 49
Zu Frage Nr. 3
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dem Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen Vorgaben für die Art und Weise seiner Aufgabenerfüllung zu machen? .............................................................. 50
I. Vorgaben in Form von Weisungen ........................................................................................................ 50
1. Weisungen in einem hierarchischen Organisationsverhältnis .......................................................... 50
2. Weisungen außerhalb eines hierarchischen Organisationsverhältnisses ........................................ 51
a) Allgemeines ............................................................................................................................... 51
b) Insbesondere Stellung des Landesrechnungshofs .................................................................... 51
II. Vorgaben in Form von Gesetzen........................................................................................................... 52
1. Landeshaushaltsordnung ................................................................................................................ 52
2. Landesrechnungshofgesetz ............................................................................................................. 53
3. Maßstäbe ......................................................................................................................................... 53
a) Landesverfassung ...................................................................................................................... 53
b) Bundesrecht ............................................................................................................................... 53
c) Verfassungsmäßigkeit und Regelungskonzept .......................................................................... 54
III. Ergebnis ................................................................................................................................................ 54
Zu Frage Nr. 4
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, in den Landesministerien ein Risikomanagementsystem einzuführen? ............................................................................................................................................. 55
I. Begriff des Risikomanagementsystems ................................................................................................ 55
II. Kompetenz zur Einführung auf Landesebene ....................................................................................... 57
1. Leitungskompetenz von Landesregierung, Ministerpräsidenten und Landesministerien – Gesetzesvorbehalt ........................................................................................................................... 57
a) Einführung aufgrund untergesetzlicher Bestimmung ................................................................. 57
b) Einführung aufgrund eines Landesgesetzes – Vorbehalt des Gesetzes .................................... 57
2. Vorbehalt der Bundeskompetenz..................................................................................................... 58
III. Materielle Maßstäbe .............................................................................................................................. 59
1. Gleichmäßigkeit der Ausführung der Gesetze ................................................................................. 59
2. Grundsätze der Bestimmtheit und der Rechtssicherheit .................................................................. 60
3. Verpflichtungen des objektiven Rechts ............................................................................................ 61
IV. Ergebnis ................................................................................................................................................ 62
Ergebnisse – Zusammenfassung – ......................................................................................................... 63
Anhang: Schrifttum ..................................................................................................................................... 67
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 4
…
A. Auftrag
Der Auftraggeber bittet um die rechtsgutachtliche Prüfung folgender
Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in
Nordrhein-Westfalen:
1. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass der zuständige Ausschuss des
Landtags Nordrhein-Westfalen Prüfaufträge an den Landesrechnungs-
hof Nordrhein-Westfalen erteilt?
2. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass sich der zuständige Ausschuss
des Landtags Nordrhein-Westfalen während des laufenden Haushalts-
jahres mit Fragen der Ausführung des Haushaltsplans befasst?
3. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dem Landesrechnungshof Nordrhein-
Westfalen Vorgaben für die Art und Weise seiner Aufgabenerfüllung zu
machen?
4. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, in den Landesministerien ein Risiko-
managementsystem einzuführen?
Das Rechtsgutachten wird politisch neutral und ergebnisoffen erstattet.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 5
…
B. Sachstand
I. Besuch des Ausschusses für Haushaltskontrolle in der Schweiz
Ende Mai 2019 haben die Mitglieder des Ausschusses für Haushaltskon-
trolle des Landtags Nordrhein-Westfalen eine Reise in die Schweiz unter-
nommen. In diesem Rahmen wurden in Bern Gespräche mit Abgeordneten
des Schweizer Parlaments und des Parlaments des Kantons Bern („Gros-
ser Rat“) sowie mit Vertretern des Schweizer Finanzministeriums (Eidge-
nössisches Finanzdepartement) und der Rechnungsprüfungsbehörde (Eid-
genössische Finanzkontrolle) über die dortigen Haushaltskontrollverfahren
geführt. Dabei erhielten die Ausschussmitglieder Informationen über Sach-
verhalte, die nach ihrer Ansicht von der geübten Praxis in Nordrhein-West-
falen, in anderen Bundesländern und im Bund abweichen:
1. So soll es in der Schweiz sowohl auf kantonaler Ebene als auch auf
Bundesebene zulässig sein, dass die entsprechenden parlamentari-
schen Ausschüsse für Haushaltskontrolle (die Finanzkommissionen des
Nationalrats und des Ständerats) oder ein qualifizierter Teil dieser Aus-
schüsse (Finanzdelegation) Prüfaufträge an die dortigen Rechnungs-
prüfungsbehörden erteilen.
Nach Ansicht des Ausschusses für Haushaltskontrolle sei dies in Nord-
rhein-Westfalen derzeit nicht vorgesehen.
2. Zudem sollen die jeweils zuständigen parlamentarischen Gremien für
Haushaltskontrolle offenbar auch in Fragen des Haushaltsvollzugs ein-
gebunden sein, insbesondere wenn für bestimmte Projekte Budgetüber-
schreitungen festgestellt werden oder wenn bestimmte Tranchen des
Budgets zur Projektrealisierung freigegeben werden sollen.
In Nordrhein-Westfalen befasst sich der Ausschuss für Haushaltskon-
trolle nach dessen Schilderung ausschließlich nach Ablauf des jeweili-
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 6
…
gen Haushaltsjahres auf der Grundlage der Prüfberichte des Landes-
rechnungshofs mit dem Ergebnis der Haushaltsführung durch die Lan-
desregierung.
3. Auch in der Schweiz wirken die jeweiligen Parlamente offenbar durch
Wahl maßgeblich an der Bestellung der Mitglieder der Rechnungsprü-
fungsbehörden mit. Allerdings hat der Ausschuss für Haushaltskontrolle
des Landtags Nordrhein-Westfalen den Eindruck gewonnen, dass die
innere Organisation der schweizerischen Rechnungsprüfungsbehörden
weniger hierarchisch, flexibler und bezogen auf die Qualifikation breiter
aufgestellt sind. So soll es beispielsweise möglich sein, in einem Jahres-
programm Querschnitts- und Schwerpunktprüfungen durchzuführen,
und zwar fachgebietsübergreifend durch Gruppen, denen auch Perso-
nen angehörten, die ihre Qualifikation außerhalb der öffentlichen Ver-
waltung erworben haben (z.B. Wirtschaftsprüfer). Darüber hinaus sollen
eingeführte Instrumente der Selbstreflexion und der aufgabenkritischen
Betrachtung des eingesetzten Personals und der in Anspruch genom-
menen Finanzressourcen bestehen.
In Nordrhein-Westfalen seien eine aufgabenkritische Selbstreflexion im
Landesrechnungshof nach Ansicht des Ausschusses für Haushaltskon-
trolle aufgrund der persönlichen Unabhängigkeit der Rechnungshofmit-
glieder bisher nur rudimentär entwickelt und eine „teamorientierte
Schwerpunktfestsetzung“ kaum geübte Praxis.
4. Nach Darstellung des Ausschusses für Haushaltskontrolle soll die
Schweizer Regierung (der Bundesrat) im Schweizer Finanzministerium
(dem Eidgenössischen Finanzdepartement) – erweitert mit Ansprech-
partnern in allen anderen Ministerien – ein umfangreiches Risikoma-
nagement eingeführt haben. Dieses Risikomanagement korrespondiere
strukturell mit der Gliederung der Rechnungsprüfung, agiere aber prä-
ventiv.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 7
…
II. Bitte um rechtliche Prüfung
Vor diesem Hintergrund hat der Ausschuss für Haushaltskontrolle den Par-
lamentarischen Beratungs- und Gutachterdienst des Landtags Nordrhein-
Westfalen um eine rechtliche Prüfung gebeten. Der Parlamentarische Be-
ratungs- und Gutachterdienst hat sich seinerseits an den unterzeichneten
Auftragnehmer gewandt und mit diesem einvernehmlich die Rechtsfragen
unter Buchstabe A formuliert.
III. Wiederkehr des Themas
Bei seinen Untersuchungen ist der unterzeichnete Auftragnehmer auf die
Veröffentlichung seines ehemaligen Fakultätskollegen Prof. Dr. Klaus
Grupp „Zum Verhältnis von Landtag und Landesrechnungshof in Nordrhein-
Westfalen“ gestoßen.1 Dort vermerkt Klaus Grupp in der ersten (Stern-
chen-)Fußnote:
Geringfügig veränderte und mit Anmerkungen versehene Fassung eines Vortrags, den der Verfasser [scil. Klaus Grupp] am 17.3.1992 vor dem Aus-schuss für Haushaltskontrolle des Landtags Nordrhein-Westfalen gehalten hat.
Dies lässt darauf schließen, dass die Fragen des vorliegenden Rechtsgut-
achtens zum Teil bereits vor rund 30 Jahren aufgeworfen wurden und dass
ihnen vielleicht permanente Relevanz zukommt.
1 NWVBl 1992, 265 ff. (Kursivdruck auch im Zitat des Originals).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 8
…
C. Rechtliche Würdigung
Zu Frage Nr. 1
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass der zuständige Aus-schuss des Landtags Nordrhein-Westfalen Prüfaufträge an den Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen erteilt?
Die Erteilung von Prüfaufträgen des zuständigen Landtagsausschusses an
den Landesrechnungshof ist rechtlich zulässig, wenn eine dafür erforderli-
che Rechtsgrundlage besteht (Rechtszustand nach geltendem Recht – de
lege lata). Soweit eine solche Rechtsgrundlage nicht besteht, ist zu unter-
suchen, ob eine solche eingeführt werden dürfte (Zulässigkeit einer mögli-
chen Rechtsänderung – de lege ferenda).
I. Zulässigkeit von Prüfaufträgen nach geltendem Recht (de lege lata)
Im Rahmen des geltenden Rechts ist zunächst zu klären, ob der zuständige
Ausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen für die Erteilung von Prüf-
aufträgen gegenüber dem Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen über-
haupt einer besonderen Rechtsgrundlage bedarf. Dies wäre nicht erforder-
lich, wenn der Landesrechnungshof dem Landtag rechtlich, insbesondere
organisationsrechtlich zuzurechnen wäre, wenn der Landesrechnungshof
also bereits aufgrund seiner derzeitigen Rechtsstellung dem Landtag auf
Weisung zuzuarbeiten verpflichtet wäre.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 9
…
1. Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
Grundlegende Aussagen zur Rechtsstellung des Landesrechnungshofs,
auch in seinem Rechtsverhältnis zum Landtag, finden sich in der Verfas-
sung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesverfassung – LV).2
a) Aufgaben des Landtags, insbesondere in Bezug auf den Landeshaushalt
Nach Art. 30 Abs. 1 Satz 2 LV obliegt dem Landtag namentlich die Kontrolle
des Handelns der Landesregierung. Auch hierzu bildet er nach Art. 30
Abs. 4 Satz 1 LV Ausschüsse. Diese Vorschriften lauten wie folgt:
Artikel 303
(1) 1Der Landtag besteht aus den vom Volke gewählten Abgeordneten. 2Zu seinen Aufgaben gehören die Wahl des/der Ministerpräsidenten/in, die Ver-abschiedung der Gesetze und die Kontrolle des Handelns der Landesregie-rung; er bildet ein öffentliches Forum für die politische Willensbildung. […]
(4) 1Der Landtag bildet Ausschüsse, insbesondere zur Vorbereitung seiner Beschlüsse. 2Die Zusammensetzung der Ausschüsse sowie die Regelung des Vorsitzes in den Ausschüssen ist im Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen vorzunehmen. 3Jeder Abgeordnete hat das Recht auf Mitwirkung in einem Ausschuss. […]
Insbesondere steht dem Landtag gleichsam stellvertretend4 für das Landes-
volk das (parlamentarische) Budgetrecht zu, indem er einerseits – vor Be-
ginn des jeweiligen Haushaltsjahres – den Haushaltsplan und die darin ver-
anschlagten Einnahmen und Ausgaben (einschließlich Verpflichtungser-
mächtigungen) durch das Haushaltsgesetz feststellt und andererseits –
nach Abschluss des jeweiligen Haushaltsjahres – über die Entlastung der
Landesregierung beschließt.5 Zu diesem Zweck hat der Finanzminister dem
Landtag Rechnung zu legen.6 Die zugrunde liegenden Verfassungsvor-
schriften lauten wie folgt:
2 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 28.6.1950 (GV. NW. S. 127, GS. NW. S. 3),
zuletzt geändert durch das Gesetz v. 30.6.2020 (GV. NRW. S. 644) – Kurztitel und Abkürzung nicht amtlich.
3 Art. 30 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 4 angefügt durch Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes v. 25.10.2016 (GV. NRW. S. 859) mit Wirkung vom 5.11.2016.
4 Vgl. Art. 2 und 30 Abs. 1 LV. 5 VerfGH NRW, NVwZ 2012, 631 (634); Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z.
LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 86 Rn. 1. 6 Vgl. § 80 LHO (Fn. 10).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 10
…
Artikel 817
(1) Der Landtag sorgt durch Bewilligung der erforderlichen laufenden Mittel für die Deckung des Landesbedarfs.
(2) 1Alle Einnahmen und Ausgaben des Landes sind in den Haushaltsplan einzustellen; […]. […]
(3) 1Der Haushaltsplan wird für ein oder mehrere Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, vor Beginn des ersten Haushaltsjahres durch das Haus-haltsgesetz festgestellt. […]
Artikel 868
(1) 1Der Finanzminister hat dem Landtag über alle Einnahmen und Ausga-ben im Laufe des nächsten Haushaltsjahres zur Entlastung der Landesre-gierung Rechnung zu legen. 2Der Haushaltsrechnung sind Übersichten über das Vermögen und die Schulden des Landes beizufügen. […]
Prüfstein und Grundlage der Entlastung durch den Landtag ist die Haus-
haltsrechnung,9 deren Inhalt einfachgesetzlich durch § 81 LHO10 vorgege-
ben wird.11 Nach Art. 86 Abs. 1 Satz 2 LHO sind der Haushaltsrechnung
zudem Übersichten über das Vermögen und die Schulden des Landes bei-
zufügen.12
b) Rechtsstellung und Aufgaben des Landesrechnungshofs
aa) Prüfungsaufgaben
In systematisch engem Zusammenhang mit der Haushaltsentlastung durch
den Landtag nach Art. 86 Abs. 1 LV steht Absatz 2 der Vorschrift:
(2) 1Der Landesrechnungshof prüft die Rechnung sowie die Ordnungsmä-ßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. 2Er faßt das Ergebnis seiner Prüfung jährlich in einem Bericht für den Landtag zu-sammen, den er auch der Landesregierung zuleitet.
7 In der Fassung des Gesetzes 14.12.1971 (GV. NW. S. 393); in Kraft getreten am 1.1.1972. 8 Siehe Fn. 7. 9 Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 86 Rn. 4. 10 Landeshaushaltsordnung (LHO) i.d.F. der Bek. v. 26.4.1999 (GV. NRW. S. 158), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1030). 11 Zur Haushaltsrechnung zählen auch der kassenmäßige Abschluss und die Finanzrechnung
nach § 82 Nr. 1 und 2 LHO sowie der Haushaltsabschluss gemäß § 83 LHO, vgl. Kußmaul/Mey-ering, in: Gröpl, Komm. z. BHO/LHO, 2. Aufl. 2019, § 82 Rn. 1.
12 Eine Vermögensbuchführung ist damit nach nordrhein-westfälischem Verfassungsrecht nicht erforderlich, s. Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 86 Rn. 5, was von § 35 Satz 1 Fall 2 HGrG (Fn. 28) zugelassen und in § 86 LHO einfach-gesetzlich aufgegriffen wird.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 11
…
Diese Vorschrift bringt Landtag und Landesrechnungshof in ein funktionales
Näheverhältnis,13 wonach dem Landesrechnungshof im Rahmen der jährli-
chen Haushaltsprüfung die verfassungsunmittelbare Pflicht zur Berichter-
stattung an den Landtag über die Prüfung der Rechnung sowie der Ord-
nungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung erwächst.14 Gleichwohl lässt sich aus Art. 86 LV keine organisatori-
sche oder gar hierarchische Verknüpfung von Landtag und Landesrech-
nungshof ablesen. Insbesondere ist der Landesrechnungshof trotz seiner
„Annäherung“ an das Parlament, die durch die Haushaltsreform des Jahres
1971 bewusst vorgenommenen wurde (Art. 86 Abs. 2 Satz 2 LV u.a.15),
nach allgemeiner Meinung kein „Hilfsorgan“ des Parlaments.16
bb) Sachliche Unabhängigkeit
Die bereits dem Art. 86 Abs. 2 LV zu entnehmende Selbständigkeit des
Landesrechnungshofs wird von Art. 87 LV bestätigt und verdeutlicht:
Artikel 8717
(1) 1Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unter-worfene oberste Landesbehörde. 2Seine Mitglieder genießen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit.
(2) Der Präsident, der Vizepräsident und die anderen Mitglieder des Lan-desrechnungshofes werden vom Landtag ohne Aussprache gewählt und sind von der Landesregierung zu ernennen.
(3) Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.
Durch die Formulierung „nur dem Gesetz unterworfen[e …]“ bringt Art. 87
Abs. 1 Satz 1 LV die sachliche Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs
zum Ausdruck. Daraus folgt in erster Linie, dass die Institution Landesrech-
13 Hufeld, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch-
land, Bd. 3, 3. Aufl. 2005, § 56 Rn. 30 f. 14 Einfachgesetzlich konkretisiert in § 97 LHO. 15 Siehe Fn. 7. 16 Wittrock, ZParl 1982, 209 (216); Zavelberg, 275 Jahre staatliche Rechnungsprüfung in Deutsch-
land, in: ders. (Hrsg.), Die Kontrolle der Staatsfinanzen, 1989, S. 43 (64); differenzierend: Hu-feld, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 3. Aufl. 2005, § 56 Rn. 1 ff.; Grupp, NWVBl 1992, 265 (267); Wieland, DVBl 1995, 894 (904); Rogge, Staatliche Finanzkontrolle freier Wohlfahrtspflege, 2001, S. 61. – Zur geschichtli-chen Entwicklung: Brodersen, Rechnungsprüfung für das Parlament in der konstitutionellen Mo-narchie, 1977, insb. S. 172 ff., 184 ff.; Grupp, Die Stellung der Rechnungshöfe in der Bundes-republik Deutschland, 1972, S. 14ff., 42 ff.
17 Siehe Fn. 7.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 12
…
nungshof vor Weisungen und Einwirkungen von außen, namentlich von an-
deren obersten Landesorganen (Landtag, Landesregierung, Verfassungs-
gerichtshof), geschützt ist.18 Des Weiteren wird aus der sachlichen Unab-
hängigkeit abgeleitet, dass auch eine mittelbare Beeinflussung der Prü-
fungstätigkeit des Landesrechnungshofs unzulässig ist, etwa durch eine
Verpflichtung zur Offenlegung interner Willensbildungsprozesse.19 Vor die-
sem Hintergrund ist es im vorliegenden Untersuchungsrahmen ohne aus-
schlaggebende Relevanz, ob dem Landesrechnungshof neben seiner Stel-
lung als oberster Landesbehörde die Eigenschaft eines Verfassungsorgans
beigemessen wird.20
cc) Persönliche Unabhängigkeit der Rechnungshofmitglieder
Ergänzt wird die sachliche Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs als
Institution durch die persönliche Unabhängigkeit seiner Mitglieder, wenn
diesen durch Art. 87 Abs. 1 Satz 2 LV der Schutz der richterlichen Unab-
hängigkeit garantiert wird. Damit verweist diese Vorschrift auf Art. 97 Abs. 2
GG, sie beschränkt sich allerdings auf die Finanzkontrollfunktion.21 Ausfluss
dieser persönlichen Unabhängigkeit ist unter anderem, dass Weisungen in-
nerhalb des Landesrechnungshofs nicht erlaubt sind.22
dd) Weisungsfreiheit und „Parlamentsfreiheit“
Die Weisungsfreiheit des Landesrechnungshofs, die sich bereits aus seiner
sachlichen Unabhängigkeit und der persönlichen Unabhängigkeit seiner
Mitglieder ergibt, wird durch die Anordnung seiner Selbständigkeit als
18 So Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 5;
Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 87 Rn. 7. 19 Eine Akteneinsicht, die sich hierauf bezieht, ist nicht statthaft, vgl. Kamp, in: Heusch/Schönen-
broicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 6. 20 Dagegen: OVG NRW, Urt. v. 9.5.1978, XII A 687/76, NJW 1980, 137 f.; Bertrams, NWVBl 1999,
1 (2); Grupp, Die Stellung der Rechnungshöfe in der Bundesrepublik Deutschland, 1972, S. 93 ff.; ders., NWVBl 1992, 265 (266); vgl. auch Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 87 Rn. 8.
21 Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 12 mit Verweis auf Stern, in: Böning/v. Mutius (Hrsg.), Finanzkontrolle im repräsentativ-demokrati-schen System, 1990, S. 9 (33).
22 Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 11.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 13
…
oberste Landesbehörde verstärkt. Hierzu schreibt Manuel Kamp im Stan-
dardkommentar zur Landesverfassung Nordrhein-Westfalen:23
Die Verfassung bezeichnet den Landesrechnungshof ausdrücklich als selbstständige Landesbehörde. Das bedeutet dessen organisatorische Un-abhängigkeit; er ist ministerialfrei, d.h. nicht an ein Ressort angebunden, auch in dienstrechtlicher und budgetärer Hinsicht. […]
Aus der Ministerialfreiheit folgt auch eine Parlamentsfreiheit. Zum einen be-steht keine durch einen Minister vermittelte parlamentarische Verantwortlich-keit des Landesrechnungshofs. Zum anderen gibt es keine unmittelbare Ver-antwortlichkeit gegenüber dem Landtag.
Der Landesrechnungshof ist eine oberste Landesbehörde, ist also auf der gleichen Organisationsebene mit der Landesregierung, dem Ministerpräsi-denten und den Ressorts. […]
Damit folgt die Weisungsfreiheit des Landesrechnungshofs speziell gegen-
über Aufträgen des Landtags auch aus der „Parlamentsfreiheit“ des Lan-
desrechnungshofs. Er ist kein Organ, Organteil oder Unterorgan des Land-
tags.24 Vielmehr qualifiziert ihn die Landesverfassung als „oberste Landes-
behörde“ und rechnet ihn damit der vollziehenden Gewalt (Exekutive) zu.25
Allerdings soll Art. 77 LV nicht gelten;26 damit kommt weder der Landesre-
gierung noch einem Landesminister die Befugnis zu, die „Einrichtung“ des
Landesrechnungshofs „im Einzelnen“ durch Erlass o.Ä. zu bestimmen. Vor-
rang genießt vielmehr Art. 87 Abs. 3 LV, wonach der Landtag „das Nähere“
zum Landesrechnungshof durch Gesetz zu regeln hat, dabei allerdings an
die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 87 Abs. 1 und 2 LV gebun-
den ist.27
23 Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 2 ff.
(Hervorhebungen im Original), mit Verweis zur Parlamentsfreiheit auf Kleinrahm, in: Loschel-der/Salzwedel, Verfassungs- und Verwaltungsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, 1964, S. 49 (91).
24 Organteile des Landtags sind insb. der Landtagspräsident, der Ältestenrat, die Ausschüsse und die Fraktionen, vgl. Thesling, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 30 Rn. 26 ff.; Heusch, ebd., Art. 75 Rn. 26 mit Verweis auf § 43 VerfGHG NRW. Vgl. zum Bundesrecht (Art. 93 Abs. 1 Nr. 1 GG, § 63 BVerfGG) Walter, in: Walter/Grünewald (Hrsg.), BeckOK BVerfGG, 9. Edition, Stand 1.7.2020, § 63 Rn. 15, jeweils m.w.N.
25 Siehe zur insoweit vergleichbaren Rechtsstellung des Bundesrechnungshofs Di Fabio, in: Isen-see/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 27 Rn. 33.
26 Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 4; Grawert, Komm. z. Verf NRW, Anm. z. Art. 87.
27 Körkemeyer, DÖV 1996, 160 (161 ff.). Siehe dazu auch unten sub C zu Frage Nr. 3 II.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 14
…
ee) Zwischenergebnis
Aufgrund der verfassungsrechtlich garantierten und geschützten Unabhän-
gigkeit des Landesrechnungshofs sind Prüfaufträge namentlich des Land-
tags oder seiner Ausschüsse jedenfalls ohne spezifisch parlamentsgesetz-
liche Rechtsgrundlage keinesfalls zulässig.
2. Einfaches Landesrecht
Mit Blick auf den Regelungsauftrag des Art. 87 Abs. 3 LV ist zu untersu-
chen, ob und inwieweit Prüfaufträge des Landtags oder seines zuständigen
Ausschusses auf geltendes Recht gestützt werden können.
a) Landesrechnungshofgesetz
Von Relevanz ist zunächst das Gesetz über den Landesrechnungshof
Nordrhein-Westfalen (Landesrechnungshofgesetz – LRHG):28
§ 1. Stellung und Sitz
(1) 1Der Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen ist eine selbständige oberste Landesbehörde und als unabhängiges Organ der Finanzkontrolle nur dem Gesetz unterworfen. 2Im Rahmen seiner gesetzlichen Aufgaben un-terstützt er insbesondere den Landtag bei seinen Entscheidungen. […]
§ 2. Zusammensetzung und Organisation
(1) Der Landesrechnungshof besteht aus der Präsidentin oder dem Präsi-denten, einer Vizepräsidentin oder einem Vizepräsidenten und den anderen zu Mitgliedern ernannten Beamtinnen und Beamten.
(2) 1Der Landesrechnungshof gliedert sich in Prüfungsabteilungen und Prüfungsgebiete. 2Für die Verwaltung besteht eine Präsidialabteilung.
(3) Die Prüfungsabteilungen bestehen aus der Präsidentin oder dem Prä-sidenten, der Vizepräsidentin oder dem Vizepräsidenten und den Abteilungs-leiterinnen oder Abteilungsleitern als Vorsitzende oder Vorsitzender und min-destens zwei weiteren Mitgliedern.
(4) 1Der Landesrechnungshof wird mit der erforderlichen Anzahl von Prü-fungsbeamtinnen und -beamten und sonstigen Bediensteten ausgestattet. 2Die zuständigen Landesbehörden stellen dem Landesrechnungshof auf Er-suchen geeignete Bedienstete zur Verfügung.
§ 5. Unabhängigkeit der Mitglieder
(1) 1Die Präsidentin oder der Präsident, die Vizepräsidentin oder der Vize-präsident und die anderen Mitglieder des Landesrechnungshofs sind unab-hängige, nur dem Gesetz unterworfene Beamtinnen oder Beamte auf Le-
28 Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung der staatlichen Finanzkontrolle vom 9.6.1994 (GV. NW.
S. 428), zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes v. 8.12. 2015 (GV. NRW. S. 812) – Kurztitel nicht amtlich.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 15
…
benszeit. 2Sie genießen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit. 3Die Vor-schriften für Richterinnen und Richter auf Lebenszeit über die Dienstaufsicht, Versetzung in ein anderes Amt, Versetzung in den Ruhestand, Entlassung, Amtsenthebung, vorläufige Untersagung der Amtsgeschäfte, Abordnung, Al-tersgrenze und das Disziplinarverfahren gelten entsprechend. […]
§ 10. Geschäftsverteilung und Arbeitsplanung
(1) 1Vor Beginn des Geschäftsjahres werden für seine Dauer die Geschäfte des Landesrechnungshofs, soweit sie nicht durch Gesetz der Präsidentin oder dem Präsidenten zugewiesen sind, auf die Abteilungen und Prüfungs-gebiete verteilt und die Zusammensetzung der Abteilungen bestimmt. 2Über die Verteilung der Geschäfte einschließlich der Vertretungsregelung und die Zusammensetzung der Abteilungen entscheidet das um die beiden dem Dienstalter, bei gleichem Dienstalter der Geburt nach ältesten Mitglieder er-weiterte Große Kollegium.
(2) Die Regelungen nach Absatz 1 können im Laufe des Geschäftsjahres nur geändert werden, wenn dies wegen Überlastung, Wechsels oder dau-ernder Verhinderung einzelner Mitglieder erforderlich wird.
(3) Über die Arbeitsplanung und ihre Änderung im Laufe des Geschäfts-jahres beschließt das jeweilige Kleine Kollegium. […]
§ 13. Geschäftsordnung
(1) 1Einzelheiten zur Organisation und zum Verfahren des Landesrech-nungshofs werden in der Geschäftsordnung geregelt, die von allen Mitglie-dern beschlossen wird. 2Sie bestimmt das Nähere zur Vertretung nach § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 3, § 8 Abs. 2 und § 10 Abs. 1. 3Sie kann Regelungen über das Verfahren der Entscheidungsgremien treffen.
(2) Alle Mitglieder können ferner Einzelheiten über das Verfahren und die Grundsätze der Arbeitsplanung, der Prüfung, der Beratung und der Bericht-erstattung regeln.
(3) 1In den Fällen der Absätze 1 und 2 erfolgt die Entscheidung durch Mehr-heitsbeschluß. 2Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag.
(4) Die Geschäftsordnung ist dem Landtag und der Landesregierung mit-zuteilen.
Die hier wiedergegebenen Vorschriften des Landesrechnungshofgesetzes
konkretisieren im Wesentlichen die Vorgaben der Landesverfassung, ins-
besondere die sachliche Unabhängigkeit der Institution Rechnungshof (§ 1
LRHG) sowie die persönliche Unabhängigkeit von dessen Mitgliedern (§ 5
LHRG).29 Daraus ergeben sich die Vorschriften über die Geschäftsvertei-
lung (§ 10 LRHG) und die Geschäftsordnung (§ 13 LRHG).30 Befugnisse
29 Siehe hierzu oben sub C zu Frage 1 I 1 b. Zu beachten ist, dass nicht alle Bediensteten des
Landesrechnungshofs auch Mitglieder i.S.v. § 5 LRHG sind. Dies ergibt sich u.a. aus § 2 Abs. 1 LRHG einerseits und § 2 Abs. 4 LRHG andererseits.
30 Zu verfassungsrechtlichen Fragen der Organisation des Landesrechnungshofs NRW Körkemeyer, DÖV 1996, 160 ff.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 16
…
des Landtags oder eines seiner Ausschüsse gegenüber dem Landesrech-
nungshof werden im Landesrechnungshofgesetz nicht begründet.
b) Landeshaushaltsordnung
aa) Konkretisierung der Landesverfassung
Neben dem Landesrechnungshofgesetz ist die nordrhein-westfälische Lan-
deshaushaltsordnung (LHO)31 zu würdigen, insbesondere deren Teil V über
die Rechnungsprüfung. Die Vorschriften lauten auszugsweise wie folgt:
§ 88. Aufgaben des Landesrechnungshofs
(1) 1Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes ein-schließlich seiner Sondervermögen und Betriebe wird von dem Landesrech-nungshof nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen geprüft. 2Der Lan-desrechnungshof kann die Prüfung durch ihm nachgeordnete Staatliche Rechnungsprüfungsämter wahrnehmen lassen.
(2) 1Der Landesrechnungshof kann auf Grund von Prüfungserfahrungen den Landtag, die Landesregierung und einzelne Ministerien beraten. 2Soweit der Landesrechnungshof den Landtag berät, unterrichtet er gleichzeitig die Landesregierung. 3Die laufende Beratung des Landtags, seiner Ausschüsse und einzelner Mitglieder bleibt hiervon unberührt. […]
§ 89. Prüfung […]
(2) Der Landesrechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung be-schränken und Rechnungen ungeprüft lassen. […]
§ 94. Zeit und Art der Prüfung
(1) Der Landesrechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und lässt erforderliche örtliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen. […]
§ 96. Prüfungsergebnis
(1) 1Der Landesrechnungshof teilt das Prüfungsergebnis unverzüglich den zuständigen Stellen zur Äußerung innerhalb einer von ihm zu bestimmenden Frist mit. 2Er hat es auch anderen Stellen mitzuteilen, soweit er dies aus be-sonderen Gründen, insbesondere zur Durchsetzung eines Schadenersatz-anspruchs, für erforderlich hält. 3Von einer Mitteilung kann er absehen, wenn es sich um unerhebliche Mängel handelt oder Weiterungen oder Kosten zu erwarten sind, die in keinem angemessenen Verhältnis zu der Bedeutung der Angelegenheit stehen würden.
(2) Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung teilt der Landesrechnungshof dem Finanzministerium mit.
31 Bekanntmachung der Neufassung v. 26.4.1999 (GV. NW. S. 158), zuletzt geändert durch Ge-
setz v. 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1030).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 17
…
bb) Prüfung durch den Landesrechnungshof
§ 88 Abs. 1 LHO schreibt die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsfüh-
rung des Landes als zentrale Aufgabe des Landesrechnungshofs fest. Prü-
fen bedeutet, einen Sachverhalt festzustellen, in seinen finanzwirksamen
Faktoren mit Blick auf die jeweiligen Soll-Anforderungen (Prüfungsmaß-
stäbe) nachzuvollziehen, zu bewerten und, soweit erforderlich, daran an-
knüpfend Empfehlungen auszusprechen, die eine künftig verbesserte
Haushalts- und Wirtschaftsführung im Hinblick auf Ordnungsmäßigkeit und
Wirtschaftlichkeit zum Ziel haben.32 Aus § 94 Abs. 1 LHO ergibt sich, dass
der Landesrechnungshof grundsätzlich nach eigenem Ermessen über seine
Prüfungstätigkeit bestimmt.
Nicht entnehmen lässt sich diesen Vorschriften die Befugnis des Landtags
oder seiner Ausschüsse, dem Landesrechnungshof Aufträge zu erteilen,
bestimmte Stellen, Fragen oder Problemkomplexe zu prüfen. Vor diesem
Hintergrund wären entsprechende Prüfaufträge rechtswidrig.
cc) Beratung des Landtags
Indes ließe sich womöglich daran denken, dass ein Prüfauftrag durch den
Landtag oder einen seiner Ausschüsse im Rahmen einer Beratung des
Landtags durch den Landesrechnungshof erteilt werden darf. Denn Prüfung
und Beratung durch den Landesrechnungshof lassen sich, wie richtig be-
merkt worden ist, nicht immer trennscharf voneinander abgrenzen.33
(1) Unselbständige Beratung
Eine sog. unselbständige Beratung findet zum Abschluss einer konkreten
Prüfung durch den Landesrechnungshof statt. Sie ist dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen den konkreten Prüfungsfeststellungen des Landesrech-
nungshofs einerseits und seinen Empfehlungen, Vorschlägen und Hinwei-
sen andererseits ein unmittelbarer sachlicher Zusammenhang besteht. Ad-
32 So Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 88 BHO Rn. 8. 33 Engels, Die Beratungsaufgabe der Rechnungshöfe, in: Wallmann u.a. (Hrsg.), Moderne Finanz-
kontrolle und öffentlichen Rechnungslegung, 2013, S. 141 (149), a.A. BVerfG, Beschl. v. 7.9.2010, 2 BvF 1/09, BVerfGE 127, 165 (209, 215 f.).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 18
…
ressat dieser unselbständigen Beratung ist die geprüfte Behörde oder sons-
tige Stelle selbst; als Rechtsgrundlage dient § 88 Abs. 1 i.V.m. § 96 Abs. 1
LHO.34
Zwar ist der Landesrechnungshof überdies nach § 96 Abs. 2 LHO verpflich-
tet, Prüfungsergebnisse von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller
Bedeutung dem Finanzministerium mitzuteilen. Eine Befugnis für Prüfauf-
träge zugunsten des Landtags an den Landesrechnungshof lässt sich dar-
aus aber nicht ableiten.
(2) Selbständige Beratung
§ 88 Abs. 2 Satz 1 LHO sieht vor, dass der Landesrechnungshof auf Grund
von Prüfungserfahrungen den Landtag, die Landesregierung und einzelne
Ministerien beraten kann. In der Praxis scheint eine Beratung – jedenfalls
auf Bundesebene zwischen Bundesrechnungshof und Bundestag – auch
gegenüber einzelnen Ausschüssen zu erfolgen.35 Bei der durch § 88 Abs. 2
Satz 1 LHO umschriebenen Tätigkeit handelt es sich um die selbständige
Beratung durch den Landesrechnungshof, d.h. die Beratung außerhalb kon-
kreter Prüfungsvorgänge im Sinne von § 88 Abs. 1 LHO.36 Eine solche selb-
ständige Beratung ist kraft Verfassungsrechts nicht vorgegeben, auch nicht
von Art. 86 Abs. 2 Satz 1 LV. Vielmehr stellt diese Art von Beratung eine
eigenständige, von der traditionellen Prüfungstätigkeit zu unterscheidende
Aufgabe des Landesrechnungshofs dar, die der Gesetzgeber kraft seiner
Regelungskompetenz gemäß Art. 87 Abs. 3 LV begründen durfte. Die selb-
ständige Beratung ergibt sich häufig aus einem entsprechenden Wunsch
aus dem parlamentarischen Bereich und soll dem Vernehmen nach in jün-
gerer Zeit erheblich an Bedeutung gewonnen haben.37
34 Zum Verfahren beim Bundesrechnungshof Störring, Die Beratungsfunktion des Bundesrech-
nungshofs und seines Präsidenten, S. 182. 35 Vgl. Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 88 BHO Rn. 25. 36 Vgl. hierzu und zum Folgenden Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand:
1.6.2020), § 88 BHO Rn. 16 f. mit Verweis auf BT-Drs. V/3040, S. 66; Nebel, in: Piduch, Bun-deshaushaltsrecht, § 88 BHO Rn. 5 (Stand der Bearb.: Feb. 2018); Engels, Die Beratungsauf-gabe der Rechnungshöfe, in: Wallmann u.a. (Hrsg.), Moderne Finanzkontrolle und öffentlichen Rechnungslegung, 2013, S. 141 (151).
37 Vgl. Mähring, in: Heuer/Scheller, ebd. (Fn. 36), § 88 BHO Rn. 18 mit Verweis auf Eibelshäuser (Hrsg.), Finanzpolitik und Finanzkontrolle – Partner für Veränderung, 2002; Korthals, Beiträge der Rechnungshöfe zur Verwaltungsreform, DÖV 2000, S. 855 ff. Zum Verfahren beim Bundes-rechnungshof siehe Störring, Die Beratungsfunktion des Bundesrechnungshofs und seines Prä-
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 19
…
Allerdings bindet die Formulierung „auf Grund von Prüfungserfahrungen“ in
§ 88 Abs. 2 Satz 1 LHO die selbständige Beratung des Landesrechnungs-
hofs an dessen Prüfungstätigkeit zurück. In den Gesetzgebungsmaterialien
zu den entsprechenden Vorschriften auf Bundesebene findet sich dazu Fol-
gendes:
Sie [die Bestimmung] bezweckt, die vom Rechnungshof aufgrund von Prü-fungserfahrungen gesammelten Erkenntnisse für die Lösung von Fragen mit allgemeiner oder grundsätzlicher Bedeutung nutzbar zu machen. Eine Bera-tung zu Bewirtschaftungsfragen in Einzelfällen, bei denen erfahrungsgemäß das Absicherungsbedürfnis einzelner Ressorts im Vordergrund steht, sollte hierbei ausgeschlossen sein.38
Und:
Eine Beratung außerhalb konkreter Prüfungsvorgänge „aufgrund von Prü-fungserfahrungen“ kann sich ihrem Wesen nach nur auf wichtige Angelegen-heiten beziehen. Deshalb kommen für eine solche Beratung ausschließlich die gesetzgebenden Körperschaften, die Bundesregierung und einzelne Bundesminister, nicht aber nachgeordnete Behörden, in Betracht.39
Das Schrifttum zum Bundesrecht meint hierzu:
Auch die selbstständige Beratung nach § 88 Abs. 2 BHO muss einen auf dem Prüfungsgeschäft des BRH [Bundesrechnungshofs, Anm. d. Verf.] ba-sierenden Inhaltskern aufweisen. Vorschläge und Überlegungen, die ebenso in der Verwaltung selbst begründet werden könnten, fallen deshalb nicht in den Bereich des § 88 Abs. 2 BHO. Keine bessere Sachkompetenz wird der BRH bei der Auslegung von Rechtsvorschriften im Allgemeinen besitzen. Eine Beratung kommt hier jedoch dann in Frage, wenn Prüfungserkennt-nisse aus ihrer Anwendung, dem Verwaltungsvollzug der Vorschriften für die Auslegung von Bedeutung sind. Gleiches gilt, wenn aus Sicht des BRH seine Prüfungsfeststellungen zur Anwendung bestimmter Rechtsvorschriften dafür sprechen, die Vorschriften nicht nur durch Auslegung sondern – wo dies nicht möglich ist und nicht mehr ausreicht – durch Rechtsänderungen den Erfordernissen anzupassen.40
Abgesehen davon wird durchgehend das Ermessen betont, das § 88 Abs. 2
Satz 1 LHO und die vergleichbare Vorschrift auf Bundesebene dem Rech-
nungshof einräumen.41 Dies bedeutet, dass der Rechnungshof weder durch
sidenten, S. 183 f. Vgl. für den Bundesrechnungshof Engels, Die Beratungsaufgabe der Rech-nungshöfe, in: Wallmann u.a. (Hrsg.), Moderne Finanzkontrolle und öffentlichen Rechnungsle-gung, 2013, S. 141 (147, 153).
38 BT-Drs. V/3040, S. 56 zu § 42 Abs. 5 HGrG (Nachw. in Fn. 43). 39 BT-Drs. V/3040, S. 66 zu § 88 Abs. 2 BHO (Nachw. in Fn. 44). 40 Vgl. Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 88 BHO Rn. 20. 41 Vgl. Mähring, ebd. (Fn. 40), § 88 BHO Rn. 18, 23 und 24 (zur Entscheidungszuständigkeit des
jeweiligen Kollegiums nach §§ 7 und 8 LRHG); Hufeld, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. 3, 3. Aufl. 2005, § 56 Rn. 40; Blasius, DÖV 1993, 642 (645); Schwarz, in: Gröpl (Hrsg.), Komm. z. BHO/LHO, 2. Aufl. 2019, § 88 Rn. 7
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 20
…
das Landtagsplenum noch durch einen Landtagsausschuss mit einem Be-
ratungsauftrag befasst werden darf, dass er also nicht verpflichtet ist, einem
entsprechenden Auftrag nachzukommen. Dem steht nicht entgegen, dass
sich der Landesrechnungshof in der Praxis gerade mit Blick auf § 1 Abs. 1
Satz 2 LRHG einer entsprechenden Bitte in aller Regel nicht verschließen
wird, da sich die Rechnungshöfe nach Aussage des Fachschrifttums als
Partner und Berater der parlamentarischen Gremien verstehen.42
dd) „Laufende Beratung des Landtags“
Eine besondere Eigenart in Nordrhein-Westfalen genießt § 88 Abs. 2 Satz 3
LHO: Danach bleibt „die laufende Beratung des Landtags, seiner Aus-
schüsse und einzelner Mitglieder […] hiervon [scil. von der Beratung nach
§ 8 Abs. 2 Satz 1 und 2 LHO] unberührt“. Sinn und Zweck dieser Norm so-
wie auch ihre Rechtsfolgen erschließen sich nicht ohne weiteres. Es stellen
sich vor allem folgende Fragen:
Worin besteht der Unterschied zwischen einer Beratung im Sinne von
§ 88 Abs. 2 Satz 1 und 2 LHO einerseits und einer laufenden Beratung
nach § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO?
Was bedeutet „bleibt […] unberührt“? Welche Rechtsfolge ergibt sich da-
raus?
(1) Gesetzesentwicklung
Interessanterweise findet sich eine dem § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO entspre-
chende Vorschrift weder im Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)43 noch in
der Bundeshaushaltsordnung (BHO).44 Auch im ursprünglichen Gesetzent-
wurf der nordrhein-westfälischen Landesregierung für eine Landeshaus-
haltsordnung vom 30. März 1971 war dieser Satz noch nicht enthalten.45 Zu
§ 88 Abs. 2 LHO-E ist in der Landtags-Drucksache zu lesen:
m.w.N.; Nebel, in: Piduch, Bundeshaushaltsrecht, § 88 BHO Rn. 5 (Stand der Bearb.: Feb. 2018); Dittrich, Komm. z. BHO, § 88 Rn. 13 (Stand der Bearb.: Jan. 2019).
42 Vgl. Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 88 BHO Rn. 18, 21.
43 Vom 19.8.1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes v. 14.8.2017 (BGBl. I S. 3122). Siehe hierzu näher unten sub C zu Frage Nr. 1 II 2.
44 Vom 19.8.1969 (BGBl. I S. 1284), zuletzt geändert durch Art. 212 der Verordnung v. 19.6.2020 (BGBl. I S. 1328).
45 LT-Drs. 7/618, insb. S. 117.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 21
…
[…] Der Landesrechnungshof kann insoweit auf eigene Initiative oder auf Anforderung tätig werden. Anstelle der bisherigen Regelung des § 101 RHO[46], nach der dem Präsidenten des Landesrechnungshofs unter den dort genannten Voraussetzungen eine Verpflichtung zur gutachtlicher Äußerung oblag, ist in Satz 1 die Beratung als Kann-Aufgabe ausgestaltet. Damit stellt die Bestimmung klar, daß der Landesrechnungshof beratend nur tätig zu werden braucht, soweit sich dies mit der verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit seiner Mitglieder (Artikel 87 LV) vereinbaren läßt. Eine Be-ratung außerhalb konkreter Prüfungsvorgänge „aufgrund von „Prüfungser-fahrungen“ kann sich ihrem Wesen nach nur auf wichtige Angelegenheiten beziehen. […]47
Im Laufe der Beratungen des Gesetzentwurfs im Landtag NRW wurde § 88
Abs. 2 Satz 3 LHO jedoch in der 3. Sitzung der Arbeitsgruppe des Haus-
halts- und Finanzausschusses und des Rechnungsprüfungsausschusses
am 17. September 1971 vom Abgeordneten Trabalski (SPD) vorgeschla-
gen.48 Eine Begründung ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich. Der Abge-
ordnete Dr. van Aerssen (CDU) stellte hierzu die Frage, ob es sinnvoll sei,
hier gewisse essentielle Verpflichtungen des Landesrechnungshofs einzu-
bauen, wie z.B. die Beteiligung an der Ausschussarbeit oder dass Einzel-
beratung stattfinden könne, was bereits ohne gesetzliche Grundlage ge-
handhabt werde. Direktor Sauer vom Landesrechnungshof hielt eine beson-
dere gesetzliche Regelung nicht für erforderlich, weil das bisherige Verfah-
ren seit Jahrzehnten praktiziert werde und immer funktioniert habe. Das In-
teresse liege beim Landtag. Wenn der Landtag nicht interessiert sei, nutze
dem Landesrechnungshof das Recht nichts, vor dem Landtag und vor den
Ausschüssen zu erscheinen. Am Ende war die Arbeitsgruppe jedoch mit der
Anfügung des vorgeschlagenen Satzes 3 einverstanden.49
In der folgenden 4. Sitzung der Arbeitsgruppe vom 7. Oktober 1971 antwor-
tete Direktor Sauer vom Landesrechnungshof auf die Frage des Abgeord-
neten Dr. van Aerssen (CDU), dass „Sonderprüfaufträge des Landtags an
46 Reichshaushaltsordnung v. 31.12.1922 (RGBl. 1923 II S. 17), die nach Art. 123 GG in den Län-
dern bis zum Inkrafttreten der Landeshaushaltsordnungen als Landesrecht fortgalt. § 101 RHO lautete: „Der Rechnungshof hat sich auf Ansuchen der Reichsminister oder des Reichstags über Fragen gutachtlich zu äußern, deren Beantwortung für die Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Behörden von Bedeutung ist.“ Vgl. auch Dommach, Der Reichsrechnungshof während der Amtszeit seines Präsidenten Saemisch (1922 bis 1938), in: Zavelberg (Hrsg.), Die Kontrolle der Staatsfinanzen, 1989, S. 72 ff.
47 LT-Drs. 7/618 S. 178. 48 LT NRW, Ausschussprotokoll (APr) 7/420, S. 13. 49 LT NRW, Ausschussprotokoll (APr) 7/420, S. 13.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 22
…
den Landesrechnungshof nicht in dem Gesetzentwurf [scil. zur Landes-
haushaltsordnung] geregelt seien. Er [scil. Direktor Sauer] habe es aber
noch nie erlebt, daß der Rechnungshof diesbezüglichen Wünschen des
Landtags nicht unverzüglich nachgekommen wäre.“50
Dessen ungeachtet wurde auf der Gemeinsamen Sitzung des Haushalts-
und Finanzausschusses sowie des Rechnungsprüfungsausschusses am
20. Oktober 1971 beschlossen, dem § 88 Abs. 2 LHO-E den Satz 3 anzu-
fügen (wiederum ohne Begründung).51 Entsprechend wurde die Landes-
haushaltsordnung in der 35. Sitzung des Landtags NRW am 2. Dezember
1971 abschließend beschlossen,52 ausgefertigt und verkündet.53 Sie trat am
1.1.1972 in Kraft.54 Durch die nachfolgenden Änderungsgesetze zur Lan-
deshaushaltsordnung wurde § 88 Abs. 2 Satz 3 nicht berührt.55
50 LT NRW, Ausschussprotokoll (APr) 7/455, S. 9. 51 LT NRW, Ausschussprotokoll (APr) 7/491/492, S. 22. Vgl. auch den Bericht des Haushalts- und
Finanzausschusses zur 2. Lesung des Gesetzentwurfs vom 10.11.1971, LT-Drs. 7/1189, S. 11. 52 LT NRW, Plenarprotokoll 7/35. 53 GV. NW. v. 20.12.1971, S. 397. 54 Vgl. § 117 Abs. 1 LHO. 55 Vgl. Art. 8 des Rechtsbereinigungsgesetzes 1987 für das Land Nordrhein-Westfalen v.
6.10.1987 (GV. NW. S. 342);
Art. 1 des (ersten) Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung v. 18.12.1987 (GV. NW. S. 490);
Art. I des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung v. 2.7.1992 (GV. NW. S. 279);
Art. 2 des Gesetzes zur Neuordnung der staatlichen Finanzkontrolle v. 19.6.1994 (GV. NW. S. 428);
Art. II des Gesetzes v. 20.12.1994 (GV. NW. 1995 S. 28);
Art. I des Dritten Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung vom 23.3.1999 (GV. NRW. S. 67) und Neubekanntmachung aufgrund von Art. II dieses Gesetzes;
Art. 78 des Gesetzes v. 25.9.2001 (GV. NRW. S. 708),
Art. 7 des Gesetzes v. 2.7.2002 (GV. NRW. S. 284);
Art. 4 des Gesetzes v. 21.12.2006 (GV. NRW. S. 631);
Art. 6 des Gesetzes v. 30.10.2007 (GV. NRW. S. 443);
Art. 1 des Gesetzes v. 17.12.2009 (GV. NRW. S. 950);
Art. 2 des Gesetzes v. 4.12.2012 (GV. NRW. S. 636);
Art. 2 des Gesetzes v. 17.12.2015 (GV. NRW. S. 938);
Art. 16 des Gesetzes v. 14.6.2016 (GV. NRW. S. 310);
Art. 1 des Vierten Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung v. 7.4.2017 (GV. NRW. S. 442);
Art. 3 des Gesetzes v. 17.10.2017 (GV. NRW. S. 825);
Art. 1 des Gesetzes v. 23.1.2018 (GV. NRW. S. 94);
Art. 1 des Gesetzes v. 18.12.2018 (GV. NRW. S. 803);
Art. 1 des Fünften Gesetzes zur Änderung der Landeshaushaltsordnung v. 19.12.2019 (GV. NRW. S. 1030).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 23
…
(2) Auslegung
Eine systematische Auslegung von § 88 Abs. 2 LHO legt nahe, dass es ei-
nen Unterschied zwischen der „Beratung“ des Landtags durch den Landes-
rechnungshof „aufgrund von Prüfungserfahrungen“ einerseits und der „lau-
fenden Beratung des Landtags und seiner Ausschüsse durch einzelne Mit-
glieder des Landesrechnungshofs andererseits geben muss.
Zum Textvergleich:
§ 88 Abs. 2 Satz 1 LHO: § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO:
Der Landesrechnungshof kann auf Grund von Prüfungserfahrun-gen den Landtag, die Landesre-gierung und einzelne Ministerien beraten.
Die laufende Beratung des Landtags, seiner Ausschüsse und einzelner Mitglieder bleibt hiervon unberührt.
Eine Analyse von § 88 Abs. 2 Satz 1 LHO zeigt, dass die damit umschrie-
bene selbständige Beratung zwar auf die Beratung außerhalb konkreter
Prüfungsvorgänge im Sinne von § 88 Abs. 1 LHO abzielt. Allerdings müs-
sen nach dem ausdrücklichen Wortlaut der Vorschrift auch der selbständi-
gen Beratung „Prüfungserfahrungen“ zugrunde liegen. Zudem beschränkt
das Schrifttum die selbständige Beratung auf wichtige Angelegenheiten,
wodurch eine Beratung zu Bewirtschaftungsfragen in Einzelfällen ausge-
schlossen wird. Auch darf in diesem Rahmen nach Überzeugung des
Schrifttum keine Beratung bei der Auslegung von Rechtsvorschriften im All-
gemeinen erfolgen, sondern nur, wenn Prüfungserkenntnisse aus der An-
wendung bestimmter Normen durch die Verwaltung von Bedeutung sind
oder ein Änderungsbedarf besteht.56
Wendet sich der Blick auf die laufende Beratung nach § 88 Abs. 2 Satz 3
LHO, so ist diese Aufgabe ebenso von der Prüfungstätigkeit des Landes-
rechnungshofs nach § 88 Abs. 1 LHO abzugrenzen: Das bedeutet, dass
sich auch die laufende Beratung auf die Beratung außerhalb konkreter Prü-
fungsvorgänge beziehen muss, um eine Abgrenzung zu § 88 Abs. 1 LHO
56 Nachw. oben sub C zu Frage Nr. 1 I 2 b cc in Fn. 35 ff.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 24
…
zu erzielen. Daraus folgt, dass § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO dem Landesrech-
nungshof nicht die Befugnis einräumt, im Rahmen einer laufenden Beratung
qua Auftrag des Landtags oder eines seiner Ausschüsse eine Prüfung mit
allfälligen Eingriffen in die Sphäre anderer Behörden, Stellen oder Dritter
vorzunehmen. So verstandene Prüfaufträge des Landtags oder eines sei-
ner Ausschüsse scheiden damit von vornherein aus.
Abgesehen davon liegt es nahe, der Vorschrift des § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO
eine von Satz 1 abweichende Funktion beizumessen: Eine laufende Bera-
tung wird Einzelfragen betreffen, denen keine herausgehobene Bedeutung
zukommt, die also keine Grundsatzfragen oder generellen Probleme der
Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes betreffen.57 Umfasst sein
werden hingegen informelle Stellungnahmen im „kleinen Dienstverkehr“,
der keine für den Landesrechnungshof verbindliche Meinungsbildung in
dessen Kollegialorganen zugrunde liegen muss. Umso wichtiger erscheint,
dass gerade bei der laufenden Beratung die Grenze zwischen Finanzkon-
trolle und „Mitverwaltung“ durch den Landesrechnungshof eingehalten
wird.58
Kein eindeutiges Ergebnis liefert der Wortlaut von § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO
zu der Frage, ob der Landesrechnungshof zur laufenden Beratung verpflich-
tet ist oder ob er – wie bei § 88 Abs. 2 Satz 1 LHO – nur dazu berechtigt
sein soll. Legt man die Stellungnahmen der Arbeitsgruppe von 1971 zu-
grunde, deutet vieles darauf hin, dass sich der Landesrechnungshof zu die-
ser Tätigkeit im Rahmen einer Art „Amtshilfe“ im weiteren Sinne angehalten
sah, ohne dass dies bis dahin auf einer gesetzlichen Grundlage basierte.
Insoweit könnte es sich bei § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO um die Kodifizierung
von damals bestehendem Gewohnheitsrecht gehandelt haben. Damit aber
dürfte dem Landesrechnungshof auch unter der heutigen Geltung der Norm
kein Ermessensspielraum zur Ablehnung der laufenden Beratung zustehen.
57 So schon Giesen/Fricke, Das Haushaltsrecht des Landes Nordrhein-Westfalen, 1972, § 88 LHO
Rn. 8. 58 Vgl. Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 88 BHO Rn. 22;
siehe dazu auch die Nachw. in Fn. 95 und 96.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 25
…
Grenzen ergeben sich allerdings aus der Bedeutung und dem Umfang der
Angelegenheit: Wichtige, umfangreiche und arbeitsaufwendigere Angele-
genheiten dürfen der laufenden Beratung nicht unterliegen. Zudem wird der
Landesrechnungshof im Rahmen der laufenden Beratung ebenso wenig
wie bei § 88 Abs. 2 Satz 1 LHO um Auskunft bei der abstrakten Auslegung
von Rechtsvorschriften ersucht werden dürfen; insoweit verbleibt es beim
Ablehnungsermessen, das dem Landesrechnungshof nach § 88 Abs. 2
Satz 1 LHO zusteht.
Diese Erkenntnisse zur laufenden Beratung haben Rückwirkungen auf die
Frage, ob und inwieweit dem Landesrechnungshof seitens des Landtags
oder eines seiner Ausschüsse Prüfaufträge erteilt werden dürfen: Ein Prüf-
auftrag wird im Rahmen der laufenden Beratung als zulässig zu erachten
sein, soweit er sich auf kleinere, nicht besonders arbeitsaufwendige Fragen
der Aufstellung und Bewirtschaftung des Haushaltsplans sowie der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung bezieht und
keine eigens anzuberaumende Prüfung bei einer Behörde, Stelle oder ei-
nem Dritten erfordert. Größere und arbeitsintensive Prüfaufträge insbeson-
dere mit Außenwirkung gegenüber Dritten, die – fälschlicherweise – als lau-
fende Beratung tituliert werden, dürfen vom Landesrechnungshof hingegen
abgelehnt werden.
ee) Jahresbericht; Unterrichtung bei besonderer Bedeutung
Abzugrenzen von spezifischen Prüfaufträgen wie auch von der Beratung ist
die Tätigkeit des Landesrechnungshofs nach den §§ 97, 99 und 114 Abs. 2
und 3 LHO:
§ 97. Jahresbericht über das Ergebnis der Prüfung
(1) Der Landesrechnungshof fasst das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die Entlastung der Landesregierung wegen der Haushaltsrechnung von Bedeutung sein kann, jährlich in einem Bericht für den Landtag zusammen, den er auch der Landesregierung zuleitet. […]
§ 99 Angelegenheiten von besonderer Bedeutung.
Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Landesrech-nungshof den Landtag und gleichzeitig die Landesregierung jederzeit unter-richten. […]
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 26
…
§ 114. Entlastung […]
(2) 1Der Landtag beschließt aufgrund der Haushaltsrechnung und des Jah-resberichtes über das Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes über die Entlastung der Landesregierung. 2Er stellt hierbei die wesentlichen Sachverhalte fest und beschließt über einzuleitende Maßnahmen.
(3) Der Landtag kann den Landesrechnungshof zur weiteren Aufklärung einzelner Sachverhalte auffordern.
Die jährliche Berichterstattung des Landesrechnungshofs zur Rechnungs-
prüfung nach § 97 LHO an den Landtag bildet im Rahmen des Haushalts-
kreislaufs eine wichtige, wenn nicht – mit Rücksicht auf § 114 Abs. 2 Satz 1
LHO – die zentrale Grundlage für dessen Entscheidung über die Entlastung
der Landesregierung nach Art. 86 Abs. 1 Satz 1 LV. Seinen Jahresbericht
liefert der Landesrechnungshof unaufgefordert, d.h. ohne dass ein geson-
derter Prüfauftrag zugrunde läge. Zwar kann der Landtag den Landesrech-
nungshof nach § 114 Abs. 3 LHO zur weiteren Aufklärung einzelner Sach-
verhalte auffordern. Solche Aufklärungsersuchen sind jedoch an die jährli-
che Rechnungsprüfung des Landesrechnungshofs und seinen Jahresbe-
richt nach Art. 86 Abs. 2 LV und § 97 LHO gekoppelt; selbständige Prüfauf-
träge dürfen auf dieser Rechtsgrundlage nicht vergeben werden.59
Unabhängig von der Rechnungsprüfung und dem Jahresbericht berechtigt
§ 99 LHO den Landesrechnungshof, den Landtag (nicht aber nur einzelne
seiner Ausschüsse) und die Landesregierung jederzeit zu informieren,
wenn nach Ansicht des Landesrechnungshofs eine Angelegenheit von be-
sonderer Bedeutung vorliegt, sei es mit Blick auf das finanzielle Gewicht
oder grundsätzliche Erwägungen in rechtlicher oder wirtschaftlicher Hin-
sicht.60 Eine solche Unterrichtung erfolgt auf Initiative des Landesrech-
nungshofs; ein Prüfauftrag des Landtags oder eines seiner Ausschüsse ist
daher ausgeschlossen.
59 Vgl. Demir, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 114 BHO Rn. 7 60 Vgl. Elbert, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 99 BHO Rn. 7; zur
Abgrenzung zwischen § 88 Abs. 2 und § 99 BHO ebd., Rn. 11.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 27
…
3. Geschäftsordnung des Landtags Nordrhein-Westfalen
Wenn es um die Frage der Zulässigkeit von Prüfaufträgen des Landtags
oder eines seiner Ausschüsse geht, ist ein Blick auf die Geschäftsordnung
des Landtags zu werfen und zu untersuchen, ob sich dort entsprechende
Befugnisse finden lassen. In Nordrhein-Westfalen bestimmt Art. 38 Abs. 1
Satz 2 LV, dass sich der Landtag eine Geschäftsordnung gibt.61 Diesem
Verfassungsauftrag kommt der Landtag in aller Regel zu Beginn der jewei-
ligen Wahlperiode (Art. 34, 36 LV) durch Beschluss der Geschäftsordnung
des Landtags Nordrhein-Westfalen (GOLT)62 nach.
a) Parlamentarisches Binnenrecht
Der Geschäftsgang in den Volksvertretungen wird in Deutschland traditio-
nell nicht durch Gesetz geregelt, sondern durch Geschäftsordnung auf-
grund eines Beschlusses des jeweiligen Parlaments.63 Geschäftsordnungs-
recht ist mithin das allein für das Parlament geltende, „abstrakt-individuelle
Binnenrecht“; mangels Gesetzeskraft kommt Geschäftsordnungen keine
Außenwirkung zu.64 Eine parlamentarische Geschäftsordnung begründet
intraorganschaftliches Recht für das Parlament und ist daher in erster Linie
für alle Abgeordneten sowie für die Organteile des Parlaments verbindlich.
Dritte werden davon nur betroffen, soweit in der Geschäftsordnung das
Hausrecht und die Polizeigewalt des Parlamentspräsidenten, die ihrerseits
verfassungsrechtlich vorgegeben sind,65 ausgeformt werden.
Aufgrund dieser Funktion und dieses Rechtscharakters ist es ausgeschlos-
sen, dass in einer Geschäftsordnung Rechte oder Pflichten für andere Or-
gane oder gar andere Rechtsträger begründet oder beschränkt werden.66
Damit ist die Geschäftsordnung von vornherein ungeeignet dafür, dem
61 Hierzu Thesling, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 38
Rn. 2 ff. 62 Vom 18.12.2019 (GV. NRW. 2020 S. 40), zuletzt geändert am 12.2.2020 (GV. NRW. S. 158)
mit Wirkung vom 14.3.2020 – Abkürzung nicht amtlich. 63 Vgl. allg. Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, Rn. 89 ff. m.w.N. 64 Austermann/Waldhoff, Parlamentsrecht, 2020, Rn. 98. 65 So für Nordrhein-Westfalen in Art. 39 Abs. 2 Satz 3 LV. 66 Hierzu und zum Folgenden Thesling, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW,
2. Aufl. 2020, Art. 38 Rn. 4 ff. m.w.N.; VerfGH NRW, Urt. v. 4.10.1993, VerfGH 15/92, NVwZ 1994, 678 (ebd.).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 28
…
Landtag oder einem seiner Ausschüsse Befugnisse gegenüber dem Lan-
desrechnungshof einzuräumen.
b) Organisation und Verfahren der parlamentarischen Ausschüsse
Sehr wohl aber ist die Geschäftsordnung maßgeblich für die Einsetzung der
parlamentarischen Ausschüsse und für das von ihnen zu beachtende Ver-
fahren. Die einschlägigen Vorschriften der Geschäftsordnung des Landtags
Nordrhein-Westfalen lauten auszugsweise:
§ 48. Einsetzung
(1) 1Zur Vorbereitung seiner Beschlüsse setzt der Landtag Ausschüsse für die Dauer der Wahlperiode ein. 2Er kann hierzu für bestimmte Aufgaben auch Sonderausschüsse einsetzen. 3Die Anzahl der Ausschüsse einschließlich der Sonderausschüsse soll 21 nicht übersteigen.
(2) Die Ausschüsse können zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse mit Zustim-mung des Landtags Unterausschüsse einsetzen. […]
§ 51. Aufgaben der Ausschüsse
(1) Die Ausschüsse behandeln Angelegenheiten, die ihnen durch Be-schluss des Landtags oder durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten über-wiesen worden sind oder die im Zusammenhang mit überwiesenen Gegen-ständen stehen.
(2) 1Andere Fragen aus ihrem Geschäftsbereich können die Ausschüsse beraten und dem Landtag hierzu Empfehlungen vorlegen. 2Empfehlungen sind Gesetzentwürfe, Anträge und Entschließungsanträge. 3Eigene Ent-schließungen können Ausschüsse nur in den Angelegenheiten fassen, die ihnen vom Landtag zur abschließenden förmlichen Entscheidung überwie-sen worden sind.
(3) 1Über die ihm überwiesenen Beratungsgegenstände hat der Ausschuss innerhalb von zehn Sitzungswochen nach Überweisung dem Landtag einen Abschlussbericht oder, falls eine abschließende Beratung nicht möglich war, unter Angabe der Hinderungsgründe einen Zwischenbericht vorzulegen. 2Der Landtag kann bei der Überweisung von Beratungsgegenständen an die Ausschüsse die Berichtsfrist anderweitig festsetzen. 3Kann ein Auftrag von einem Ausschuss nicht abgeschlossen werden, so gibt er ihn an den Landtag zurück. […]
§ 57. Anhörung
(1) 1Jeder Ausschuss kann im Rahmen seines Geschäftsbereichs be-schließen, Sachverständige oder andere Personen, insbesondere Vertrete-rinnen bzw. Vertreter betroffener Interessen anzuhören. […]
(2) 1Im Beschluss sollen der Gegenstand der Anhörung und die anzuhö-renden Personen bzw. die Modalitäten ihrer Benennung bezeichnet sein. 2Die Frist zwischen dem Beschluss und der Durchführung der Anhörung soll in der Regel nicht weniger als vier Wochen betragen; eine davon abwei-chende Frist kann der Ausschuss mit Mehrheit beschließen. 3Den Auskunfts-personen können die wesentlichen Fragen vorher schriftlich mitgeteilt wer-den. […]
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 29
…
(4) 1Auf Antrag eines Viertels der Mitglieder des Ausschusses, einer Frak-tion oder einer im Ausschuss vertretenen Gruppe findet eine Anhörung nach Absatz 1 statt. […]
(5) 1Beschließt der Ausschuss eine Begrenzung der Anzahl der anzuhö-renden Personen, kann von der Minderheit nur der ihrem Stärkeverhältnis im Ausschuss entsprechende Anteil an der Gesamtzahl der anzuhörenden Aus-kunftspersonen benannt werden. 2Jede Fraktion und jede im Ausschuss ver-tretene Gruppe hat jedoch das Recht, mindestens eine Auskunftsperson zu benennen.
(6) Eine erneute Anhörung oder eine Anhörung weiterer Sachverständiger zu demselben Beratungspunkt ist nur zulässig, wenn zwei Drittel der Mitglie-der des Ausschusses dies beschließen.
(7) 1Erwachsen aus der Durchführung einer Anhörung Kosten, so ist vorab die Zustimmung der Präsidentin bzw. des Präsidenten einzuholen. 2Bei Mei-nungsverschiedenheiten mit dem Ausschuss entscheidet das Präsidium. […]
§ 63. Anwendbarkeit der Bestimmungen der Geschäftsordnung 1Für das Verfahren der Ausschüsse und der Enquetekommissionen gelten
die Verfahrensregelungen der Geschäftsordnung für die Plenarsitzungen sinngemäß. 2Der Ältestenrat kann über die Geschäftsordnung hinaus Richt-linien für die Grundzüge der Arbeit in den Ausschüssen beschließen.
c) Ausschluss einer Überschreitung des Binnenrechts durch Umgehung
Zu beachten ist, dass die Rechtsstellung, namentlich die Unabhängigkeit
des Landesrechnungshofs aus Art. 87 Abs. 1 LV, nicht dadurch umgangen
werden dürfte, dass der Vorsitzende eines Landtagsausschusses eine An-
hörung im Sinne von § 57 GOLT anberaumt, zu der der Präsident oder an-
dere Bedienstete des Landesrechnungshofs geladen und in diesem Rah-
men mit Prüfungen beauftragt werden. Zwar steht es dem Präsidenten und
– mit dessen Einverständnis – anderen Mitgliedern des Landesrechnungs-
hofs frei, der Einladung zu öffentlichen Anhörungen nachzukommen und
auch im Übrigen Stellungnahmen zu Fragen eines Ausschusses abzuge-
ben. Eine Verpflichtung zu allgemeinen oder bestimmten Prüfungen von
Sachverhalten ist davon indessen bereits dem Wortlaut des § 57 GOLT
nach nicht umfasst.
4. Ergebnis
a) Die Rechtsstellung des Landesrechnungshofs als selbständige, nur
dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde schließt Weisungen
an ihn insbesondere seitens des Landtags oder von dessen zuständi-
gen Ausschüssen aus.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 30
…
b) Nach dem geltenden § 88 Abs. 2 LHO darf der Landesrechnungshof
den Landtag und dessen zuständige Ausschüsse beraten. Nicht in Be-
tracht kommt dabei allerdings – in Abgrenzung zur genuinen Prüfungs-
tätigkeit des Landesrechnungshofs nach § 88 Abs. 1 LHO – eine Prü-
fung konkreter Sachverhalte in oder bei Behörden, sonstigen Stellen
oder Dritten.
c) Die Beratungsaufgabe des Landesrechnungshofs nach § 88 Abs. 2
LHO unterteilt sich in die selbständige Beratung nach Satz 1 und die
laufende Beratung nach Satz 3 der Vorschrift.
d) Die laufende Beratung nach § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO erstreckt sich auf
kleinere, nicht besonders arbeitsaufwendige Fragen der Aufstellung und
Bewirtschaftung des Haushaltsplans sowie der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung. Hierzu ist der Landesrech-
nungshof verpflichtet; insoweit sind „(Prüf-)Aufträge“ des Landtags und
seines zuständigen Ausschusses zulässig.
e) Größere und arbeitsintensivere Ersuchen seitens des Landtags oder
seines zuständigen Ausschusses, die den Rahmen der laufenden Be-
ratung überschreiten, dürfen vom Landesrechnungshof gemäß § 88
Abs. 2 Satz 1 LHO abgelehnt werden, soweit hierfür nachvollziehbare
Gründe bestehen.
II. Zulässigkeit von Prüfaufträgen aufgrund von Rechtsände-rungen (de lege ferenda)
Vor dem Hintergrund der bislang untersuchten Rechtsvorschriften erhebt
sich die Frage,
ob und inwieweit namentlich der seit dem Inkrafttreten der Landeshaus-
haltsordnung am 1. Januar 1972 dort enthaltene § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO
eine bundesrechts- und verfassungskonforme Rechtsvorschrift darstellt
sowie
ob und inwieweit der Landesgesetzgeber durch Rechtsänderung darüber
hinausgehende Befugnisse des Landtags oder seiner Ausschüsse zur
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 31
…
Erteilung von Prüfaufträgen an den Landesrechnungshof begründen
dürfte.
1. Kompetenz
Gemäß Art. 87 Abs. 3 LV hat das Land die Kompetenz, „das Nähere“ zu
seinem Landesrechnungshof durch Gesetz zu regeln. Dies umfasst nicht
nur den Erlass der Landeshaushaltsordnung und des Landesrechnungshof-
gesetzes, sondern auch die Änderung dieser Gesetze. Zuständig für deren
Verabschiedung ist nach Art. 3 Abs. 1 Fall 2, Art. 30 Abs. 1 Satz 2 Fall 2 LV
in erster Linie der Landtag.
2. Vorgaben
Bei seiner Gesetzgebung hat das Land und haben namentlich seine Ver-
fassungsorgane Landesregierung und Landtag vorrangiges Recht zu be-
achten.
a) Unionsrecht
Mangels entsprechender Kompetenzen enthält das Recht der Europäi-
schen Union für die Rechnungsprüfung der Haushalte der Mitgliedstaaten
durch mitgliedstaatliche Rechnungsprüfungsbehörden (Rechnungshöfe)
keine spezifischen Vorschriften.67
b) Bundesrecht
aa) Kompetenz zur Haushaltsgrundsatzgesetzgebung
Das Land Nordrhein-Westfalen steht – ebenso wie die anderen deutschen
Länder – nicht für sich allein, sondern ist als Gliedstaat in die Bundesrepub-
lik Deutschland integriert (Art. 1 Abs. 1 Satz 1 LV, Art. 20 Abs. 1, Art. 28
GG68). Als Bundesverfassung verteilt und begrenzt das Grundgesetz die
Kompetenzen des Bundes und der Länder (Art. 30, 70 ff., 83 ff., 92 ff.,
67 Zur Kontrolle durch den Europäischen Rechnungshof siehe etwa Kempny, Verwaltungskon-
trolle, 2017, S. 75 f., 161 f., 193 ff., 224 ff., 245 f. – Die Vorschrift des Art. 325 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) zum Schutz der finanziellen Interessen der Union gegen Betrügereien und ähnliche rechtswidrige Handlungen bleibt außerhalb der hier angestellten Untersuchungen.
68 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23.5.1949 (BGBl. I S. 1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 15.11.2019 (BGBl. I S. 1546).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 32
…
104a ff. GG). In ihrer Haushaltswirtschaft sind Bund und Länder nach
Art. 109 Abs. 1 GG selbständig und voneinander unabhängig; garantiert
wird damit – im Grundsatz – die Kompetenz zu eigenständiger und unab-
hängiger Haushaltswirtschaft.69 Allerdings begründet Art. 109 Abs. 2 bis 5
GG Einschränkungen der Haushaltsautonomie. Namentlich Art. 109 Abs. 4
GG gewährt dem Bund durch eine – neben den Art. 71 und 73 GG beste-
hende – besondere Gesetzgebungskompetenz das Recht, mit Zustimmung
des Bundesrates gemeinsam geltende Grundsätze für das Haushaltsrecht
aufzustellen. In diesem Rahmen darf der Bund auch Grundsätze für die Auf-
gaben und Befugnisse der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder vor-
geben.70
Von dieser Grundsatzgesetzgebungskompetenz hat der Bund weitreichend
Gebrauch gemacht, namentlich durch das Haushaltsgrundsätzegesetz
(HGrG).71 Da sich die Bindungswirkungen des Haushaltsgrundsätzegeset-
zes nach dessen § 1 auf die Gesetzgeber von Bund und Ländern be-
schränkt, mussten seine Vorgaben durch Bundes- und Landesrecht in der
Bundeshaushaltsordnung und den Haushaltsordnungen der Länder umge-
setzt werden.72 Darüber hinausgehende Rechte und Pflichten kann das
Haushaltsgrundsätzegesetz nach seinem § 49 nur durch Vorschriften sei-
nes Teils II (§§ 49a bis 57 HGrG) begründen.
bb) Gesetzgebungsaufträge im Sinne von § 1 HGrG
In seinem Teil I (§§ 1 bis 48) enthält des Haushaltsgrundsätzegesetz zu den
Rechnungshöfen insbesondere folgende Vorschriften:
§ 42. Aufgaben des Rechnungshofes
(1) Die gesamte Haushalts- und Wirtschaftsführung des Bundes und der Länder einschließlich ihrer Sondervermögen und Betriebe wird von Rech-nungshöfen geprüft.
69 Kube, in: Maunz/Dürig, Komm. z. GG, Art. 109 Rn. 43 (Stand der Bearb.: Mai 2011); G. Kirchhof,
in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Komm. z. GG, 14. Aufl. 2018, Art. 109 Rn. 10. 70 Vgl. Heun, in: Dreier, Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2018, Art. 109 Rn. 58; Siekmann, in:
Sachs, Grundgesetz, Kommentar, 8. Aufl. 2018, Art. 109 Rn. 91. 71 Langtitel: Gesetz über die Grundsätze des Haushaltsrechts des Bundes und der Länder (HGrG)
v. 19.8.1969 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes v. 14.8.2017 (BGBl. I S. 3122)
72 Vgl. BVerwG, Urt. v. 19.12.1996, 3 C 1/96, NVwZ 1998, 950 (951).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 33
…
(2) Der Rechnungshof prüft insbesondere
1. die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungen zur Leistung von Ausga-ben,
2. Maßnahmen, die sich finanziell auswirken können,
3. das Vermögen und die Schulden.
(3) Der Rechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung beschrän-ken und Rechnungen ungeprüft lassen.
(4) Die Durchführung der Prüfung von geheimzuhaltenden Angelegenhei-ten kann gesetzlich besonders geregelt werden.
(5) 1Auf Grund von Prüfungserfahrungen kann der Rechnungshof beraten. 2Das Nähere wird durch Gesetz geregelt. […]
Diese Vorschrift hat das Land Nordrhein-Westfalen in den §§ 88, 89 und
10a Abs. 3 LHO sowie in § 9 LRHG umgesetzt. Insbesondere die selbstän-
dige Beratungstätigkeit des Landesrechnungshofs wurde aufgrund von § 42
Abs. 5 HGrG in § 88 Abs. 2 LHO geregelt.73
Des Weiteren bestimmt das Haushaltsgrundsätzegesetz:
§ 46. Ergebnis der Prüfung
(1) Der Rechnungshof faßt das Ergebnis seiner Prüfung, soweit es für die Entlastung der Regierung von Bedeutung sein kann, jährlich in einem Bericht für die gesetzgebenden Körperschaften zusammen.
(2) In den Bericht können Feststellungen auch über spätere oder frühere Haushaltsjahre aufgenommen werden.
(3) Über Angelegenheiten von besonderer Bedeutung kann der Rech-nungshof die gesetzgebenden Körperschaften und die Regierung jederzeit unterrichten.
§ 47. Entlastung, Rechnung des Rechnungshofes
(1) Die gesetzgebenden Körperschaften beschließen auf Grund der Rech-nung und des jährlichen Berichts des Rechnungshofes über die Entlastung der Regierung.
(2) Die Rechnung des Rechnungshofes wird von den gesetzgebenden Kör-perschaften geprüft, die auch die Entlastung erteilen. […]
Dieser Vorschrift entsprechen die §§ 97, 99 und 114 LHO.74
cc) Einheitlich und unmittelbar geltende Vorschriften
Aus Teil II des Haushaltsgrundsätzegesetzes verdient die folgende Bestim-
mung Erwähnung:
73 Siehe hierzu oben sub C zu Frage Nr. 1 I 2 b cc. 74 Siehe hierzu oben sub C zu Frage Nr. 1 I 3 b bb und ee.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 34
…
§ 56. Rechte der Rechnungsprüfungsbehörde, gegenseitige Unterrich-tung
(1) Erlassen oder erläutern die obersten Behörden einer Gebietskörper-schaft allgemeine Vorschriften, welche die Bewirtschaftung der Haushalts-mittel einer anderen Gebietskörperschaft betreffen oder sich auf deren Ein-nahmen oder Ausgaben auswirken, so ist die Rechnungsprüfungsbehörde der anderen Gebietskörperschaft unverzüglich zu unterrichten.
(2) Bevor Stellen außerhalb einer Gebietskörperschaft, die Teile des Haus-haltsplans der Gebietskörperschaft ausführen, Verwaltungsvorschriften zur Durchführung der für die Gebietskörperschaft geltenden Haushaltsordnung oder eines entsprechenden Gesetzes erlassen, ist die Rechnungsprüfungs-behörde der Gebietskörperschaft zu hören.
(3) Sind für Prüfungen oder Erhebungen mehrere Rechnungshöfe zustän-dig, so unterrichten sie sich gegenseitig über Arbeitsplanung und Prüfungs-ergebnisse.
Aus dem Wortlaut wird bereits ersichtlich, dass diese Vorschrift nur Unter-
richtungspflichten und Anhörungsrechte, aber keine Befugnisse für die Par-
lamente oder deren Untergliederungen zu Prüfaufträgen an die „Rech-
nungsprüfungsbehörde“ (Rechnungshof) bereitstellt.
dd) Bundesrechtlich garantierte Rechtsstellung der Landesrechnungshöfe
Das Haushaltsgrundsätzegesetz erwähnt die Unabhängigkeit der Rech-
nungshöfe der Länder nicht ausdrücklich. Insbesondere den §§ 42 bis 47
HGrG ist jedoch zu entnehmen, dass dieses Gesetz von einer besonderen
Stellung der Rechnungshöfe der Länder ausgeht. Denn der Haushalts-
grundsätzegesetzgeber des Jahres 1969 fand in Bund und Ländern bereits
Rechnungshöfe vor, die – jeweils verfassungsrechtlich garantiert – weitge-
hende Unabhängigkeit genossen. Wenn der Bundesgesetzgeber daran et-
was hätte ändern wollen, wäre zu erwarten gewesen, dass er dies im Haus-
haltsgrundsätzegesetz geregelt hätte.
Zudem sind die Bestimmungen des Haushaltsgrundsätzegesetzes im zeit-
geschichtlichen Kontext der Verfassungsänderungs- und Haushaltsord-
nungsgesetzgebung der Jahre 1969 ff. zu sehen.75 Diese Reformen auf
Bundes- und Landesebene fanden die besondere Stellung der Rechnungs-
höfe vor und schrieben sie fest. So lautete die ursprüngliche, bis zum
75 Zur Entwicklung im 19. Jh. Friauf, Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Parla-
ment und Regierung, 1968, S. 131 ff.; Grupp, NWVBl 1992, 265 (265 f.).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 35
…
14. Mai 1969 geltende Fassung von Art. 114 Abs. 2 Satz 1 GG für den Bun-
desrechnungshof:76
(2) 1Die Rechnung wird durch einen Rechnungshof, dessen Mitglieder rich-terlicher Unabhängigkeit besitzen, geprüft. […]
Vor diesem Hintergrund wären landesrechtliche Vorschriften, die die sach-
liche Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs oder die persönliche Un-
abhängigkeit seiner Mitglieder substantiell einschränkten, mit Bundesrecht,
insbesondere mit dem Haushaltsgrundsätzegesetz, unvereinbar.
c) Landesrecht
Bei der Gesetzgebung sind Landesregierung und Landtag nicht nur an Bun-
desrecht, sondern auch an die Landesverfassung gebunden. Bereits deren
bis zum 31. Dezember 1971 geltende Erstfassung77 betonte in Art. 87 a.F.:
Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unterwor-fene oberste Landesbehörde. Seine Mitglieder genießen den Schutz der richterlichen Unabhängigkeit. Das Nähere wird durch Gesetz geregelt.78
Die seit dem 1. Januar 1972 geltende neue Fassung von Art. 87 Abs. 1
weicht davon nicht wesentlich ab:
(1) 1Der Landesrechnungshof ist eine selbständige, nur dem Gesetz unter-worfene oberste Landesbehörde. 2Seine Mitglieder genießen den Schutz richterlicher Unabhängigkeit. […]
Konsequenz dieser Verfassungsbestimmung ist, dass durch landesgesetz-
liche Vorschriften weder die Selbständigkeit noch die (sachliche) Unabhän-
gigkeit noch die Behördeneigenschaft des Landesrechnungshofs noch die
persönliche Unabhängigkeit der Mitglieder des Landesrechnungshofs be-
einträchtigt werden dürfen. Daraus folgt die bereits weiter oben dargelegte
Regierungs-, Ministerial- und Parlamentsfreiheit des Landesrechnungs-
hofs.79
76 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland v. 23.5.1949 (BGBl. I S. 1), Art. 114 geändert
durch das 20. Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes v. 12.5.1969 (BGBl. I S. 357). 77 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen v. 6.6.1950 (GV. NW. S. 127). 78 Zu den historischen Hintergründen Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002,
Art. 87 Rn. 2 f. 79 Siehe oben sub C zu Frage Nr. 1 I 1 b m.w.N.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 36
…
3. Rechtsvergleich: Haushaltsordnungen des Bundes und der anderen Bundesländer
Interessant ist, dass die Haushaltsordnungen der Länder Baden-Württem-
berg, Bayern, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersach-
sen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und
Thüringen den jeweiligen Landesparlamenten die Befugnis einräumen, die
dortigen Rechnungshöfe mit Gutachten zu beauftragen.80 Die übliche For-
mulierung lautet:
Der Rechnungshof hat sich auf Ersuchen des Landtags oder der Landesre-gierung gutachtlich über Fragen zu äußern, die für die Haushalts- und Wirt-schaftsführung des Landes von Bedeutung sind.
Nur in drei der genannten Länder, nämlich in Niedersachsen, Sachsen und
Sachsen-Anhalt, wird der zuständige Landtagsausschuss unmittelbar dazu
berechtigt, dem jeweiligen Rechnungshof Gutachtensaufträge zu erteilen.81
Darüber hinaus erweitern die Haushaltsordnungen der Länder Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Befugnis der jewei-
ligen Volksvertretung explizit auf die Erteilung von Prüfaufträgen:82
Durch Beschluss des Landtags kann der Landesrechnungshof ersucht wer-den, eine vom Landtag bestimmt bezeichnete Angelegenheit von besonde-rer Bedeutung zu prüfen und hierüber zu berichten.
Hamburg räumt seinem Rechnungshof indessen in diesem Zusammenhang
das Recht ein, das Ersuchen zu verweigern.83
Die Haushaltsordnungen der fünf verbleibenden Länder (Berlin, Branden-
burg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland) gleichen hingegen dem § 88
80 Siehe § 88 der jeweiligen Haushaltsordnungen von Baden-Württemberg (§ 88 Abs. 3 LHO BW),
Bayern (Art. 88 Abs. 3 BayHO), Hamburg (§ 81 Abs. 3 HmbLHO), Hessen (§ 88 Abs. 3 Hess-LHO), Mecklenburg-Vorpommern (§ 88 Abs. 4 und 5 LHO M-V), Niedersachsen (§ 88 Abs. 3 NdsLHO), Rheinland-Pfalz (§ 88 Abs. 3 LHO RhPf), Sachsen (§ 88 Abs. 3 SächsHO), Sachsen-Anhalt (§ 88 Abs. 3 LHO LSA), Schleswig-Holstein (§ 88 Abs. 4 und 5 SchlH LHO) und Thürin-gen (§ 88 Abs. 3 ThürLHO). Vgl. hierzu und zum Folgenden Mähring, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 88 BHO Rn. 27. Vgl. auch Störring, Die Beratungsfunk-tion des Bundesrechnungshofs und seines Präsidenten, S. 185 f.
81 Siehe § 88 Abs. 3 NdsLHO, § 88 Abs. 3 SächsHO und § 88 Abs. 3 LHO LSA. 82 Nachw. siehe oben sub Fn. 80. 83 § 81 Abs. 3 Satz 4 LHO v. 17.12.2013 (HmbGVBl. S. 503), zuletzt geändert am 27.11.2019
(HmbGVBl. S. 408, 409).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 37
…
der Haushaltsordnung des Bundes (Bundeshaushaltsordnung),84 indem sie
nur eine freiwillige Beratung durch den jeweiligen Rechnungshof vorsehen.
4. Empfehlung der Konferenz der deutschen Landesparlamente aus dem Jahr 1971
Von interpretatorischer Bedeutung sein kann in diesem Zusammenhang
eine bereits weit in die Vergangenheit zurückreichende „Empfehlung der
Konferenz der deutschen Länderparlamente[85] zur Neuordnung des Lan-
deshaushaltsrechts und zur Neugestaltung des Verhältnisses von Parla-
ment und Landesrechnungshof“ vom Februar 1971.86 In ihr empfahlen die
Landtagspräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen,
Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein der Präsidentenkonferenz zur Vor-
bereitung der Landeshaushaltsordnungen unter anderem:
2. […] Darüber hinaus sollte dem Landesparlament landesgesetzlich die Be-fugnis eingeräumt werden, vom Rechnungshof Prüfungsberichte über An-gelegenheiten von besonderer Bedeutung zu verlangen. Ein solches Recht des Parlaments zur Erteilung von Sonderprüfungsaufträgen steht zu der bundesrechtlichen Rahmenregelung [scil. insb. des § 42 und des § 46 HGrG] des Rechnungshofs bzw. seiner Mitglieder nicht in Wider-spruch. […]
5. Entsprechend § 52 Abs. 4 Haushaltsgrundsätzegesetz sollte die Befugnis des Landesrechnungshofs zur Beratung des Landesparlaments und der Landesregierung in die Landeshaushaltsordnungen übernommen wer-den. Dabei sollte auch eine gesetzliche Verpflichtung des Landesrech-nungshofs begründet werden, das Landesparlament und die Landesre-gierung auf deren Ersuchen zu beraten.
6. Die Vertreter des Rechnungshofs sollten berechtigt und auf Verlangen des zuständigen Ausschusses verpflichtet sein, an den Beratungen der Parlamentsausschüsse über Prüfungsberichte und Gutachten des Rech-nungshofs sowie an den Ausschußberatungen über den Staatshaushalts-plan teilzunehmen. […]
84 Nachw. sub Fn. 44. – Zu Einzelheiten von § 88 Abs. 2 BHO siehe Störring, Die Beratungsfunk-
tion des Bundesrechnungshofs und seines Präsidenten, 2013, S. 175 ff. 85 Gemeint ist wohl: „Parlamente der Länder“ oder „Landesparlamente“, da es den Singular „Län-
derparlament“ nicht gibt und bei zusammengesetzten Hauptwörtern nur das Grundwort in den Plural gesetzt wird.
86 Vorschläge der Kommission der Landtagspräsidenten von Baden-Württemberg, Bayern, Nie-dersachsen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein für die Präsidentenkonferenz am 4.2.1971 in Saarbrücken, LT NRW, Vorlage 7/259 v. 22.4.1971, S. 6 f. (Hervorhebungen nur hier).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 38
…
In ihren Empfehlungen führten die Landtagspräsidenten bedauerlicher-
weise nicht näher aus, warum sie gegen die Einfügung entsprechender Be-
ratungs- und Prüfungsverpflichtungen der Landesrechnungshöfe keine
rechtlichen Bedenken hatten.
5. Bewertung
Angesichts der dargetanen Verfassungs- und Rechtslage sowie der Emp-
fehlungen der Landtagspräsidenten aus dem Jahre 1971 stellt sich die ent-
scheidende Frage, ob und inwieweit die Einführung von Befugnisgrundla-
gen für Prüfaufträge des Landtags oder des zuständigen Landtagsaus-
schusses von Verfassungs wegen unbedenklich sind.
a) Vorschriften in anderen Bundesländern
Aus der Tatsache, dass den Rechnungshöfen anderer Länder aufgrund des
dortigen Landesrechts zum Teil Prüfaufträge erteilt werden dürfen, folgt
nicht, dass dies im Land Nordrhein-Westfalen ebenfalls zulässig ist. Denn
nach dem föderativen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland sind die
Länder im Rahmen der grundgesetzlichen Ordnung, d.h. vor allem unter
Berücksichtigung der sog. Homogenitätsklausel des Art. 28 Abs. 1 GG so-
wie kompetenzgemäß erlassenen Bundesrechts, berechtigt, eigenes Recht
zu setzen.87 Dies gilt mit Rücksicht auf Art. 109 Abs. 1 GG insbesondere für
die Haushaltswirtschaft, zu der das Haushaltsrecht und in diesem Zusam-
menhang auch Regelungen über das Verhältnis zwischen dem Landespar-
lament und dem Landesrechnungshof gehören.
Allerdings ist die maßgebliche Vorschrift des § 42 Abs. 5 HGrG wohl so zu
verstehen, dass Bund und Länder ihrem jeweiligen Rechnungshof bei der
Regelung der Beratung Ermessen einzuräumen haben. Ähnliches gilt nach
§ 42 Abs. 3 HGrG bei der gesetzlichen Ausgestaltung der Prüfungsaufga-
ben des jeweiligen Rechnungshofs. Angesichts dessen begegnen starre
87 Die Grundrechte des Grundgesetzes, die nach Art. 1 Abs. 3 GG auch die Länder unmittelbar
binden, erlangen im innerstaatlichen Rechtsverhältnis zwischen dem Landtag und dem Landes-rechnungshof keine Bedeutung.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 39
…
landesrechtliche Beratungs- oder gar Prüfverpflichtungen des jeweiligen
Landesrechnungshofs bundesrechtlichen Bedenken.88
Abgesehen davon könnten sich die haushaltsrechtlichen Vorschriften der-
jenigen Länder, die eine Beratungs- und Prüfungspflicht des jeweiligen Lan-
desrechnungshofs vorschreiben, bei einer Überprüfung als landesverfas-
sungswidrig erweisen.89
b) Verfassungslage in Nordrhein-Westfalen
Entscheidend ist damit die Verfassungslage im Land Nordrhein-Westfalen,
deren maßgebliche Vorschriften in den Art. 86, 87 LV bereits weiter oben
vorgestellt wurden.90 Konkret mit Blick auf die Zulässigkeit von Prüfaufträ-
gen ergibt sich folgendes Panorama:
aa) Beratungen des Verfassungsausschusses
Im Verfassungsausschuss zur Erarbeitung der Landesverfassung in den
Jahren 1947 ff. wurde dem Vorschlag, in der Landesverfassung festzu-
schreiben, dass der Landesrechnungshof ein Organ des Landtags sei und
dessen Prüfaufträge erfüllen müsse,91 mehrheitlich widersprochen. Allen-
falls werde der Landesrechnungshof „im Interesse des Landtags“ tätig; or-
ganisatorisch oder gar rechtlich zuzurechnen sei er diesem jedoch nicht.92
bb) Schrifttum zur Landesverfassung: „Parlamentsfreiheit“ und Weisungsfrei-heit
In den Kommentaren zur nordrhein-westfälischen Landesverfassung wird
aus Art. 87 Abs. 1 LV und der daraus zu entnehmenden „Parlamentsfrei-
heit“ nicht nur gefolgert, dass es keine parlamentarische Verantwortung des
Landesrechnungshofs gegenüber dem Landtag geben dürfe, und zwar we-
der direkt noch indirekt (etwa vermittelt über den Ministerpräsidenten oder
einen Landesminister). Darüber hinaus folge aus der sachlichen Unabhän-
88 So Grupp, NWVBl 1992, 265 (270). 89 Für eine Verfassungswidrigkeit Grupp, NWVBl 1992, 265 (269). 90 Sub I 1. 91 So der damalige Abgeordnete Josef Rick (CDU). 92 Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 87 Rn. 3 m.w.N.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 40
…
gigkeit des Landesrechnungshofs als Institution der Schutz gegen Weisun-
gen und Einwirkungen, insbesondere durch andere oberste Landesor-
gane.93 Betont wird zudem, dass, wenn der Gesetzgeber dem Landesrech-
nungshof im Rahmen von Art. 87 Abs. 3 LV Beratungsaufgaben zuweise,
darauf zu achten sei, dass dadurch nicht die primäre Funktion des kritischen
Prüfers beeinträchtigt wird.94
cc) Schrifttum zum Bundesrecht
Die Literatur zur Stellung des Bundesrechnungshofs ist ebenfalls skeptisch,
was eine Pflicht zur Beratung oder sogar Prüfaufträge anbelangt. Vorge-
bracht wird, dass jede Beratungstätigkeit geeignet sei, bei einer möglicher-
weise nachfolgenden Prüfung zumindest die Besorgnis der Befangenheit
zu begründen.95 Zudem bestehe die Gefahr, dass die Trennungslinie zwi-
schen kontrollierendem und handelndem Organ verwischt werde. Im Ergeb-
nis müsse der Rechnungshof bei jeder Beratungstätigkeit seine Funktion
als fachliche und nicht politische Kontrollinstanz beachten.96
Dem wird von anderer Seite entgegengehalten, dass sich die institutionelle
Garantie der Unabhängigkeit des Rechnungshofs nicht auf Beratungsauf-
gaben beziehe, sondern nur auf die überkommene und traditionelle Prü-
fungstätigkeit. Die Unabhängigkeit des Rechnungshofs werde erst beein-
trächtigt, wenn Beratungs- und Begutachtungsaufträge die Prüfungstätig-
keit des Rechnungshofs behindere.97 Auch aus dieser Ansicht ist allerdings
nicht abzuleiten, dass Prüfaufträge im engeren Sinne, die eine Prüfungstä-
tigkeit bei anderen Behörden, Stellen oder Dritten mit sich bringen, beden-
kenlos zulässig wären.
93 Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87 Rn. 3
und 5; Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 87 Rn. 7. 94 Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 86 Rn. 22 mit Verweis auf Blasius,
NWVBl 1997, 367 ff. 95 Kube, in: Maunz/Dürig, Komm. z. GG, Art. 114 Rn. 122 m.w.N. (Stand der Bearb.: März 2019). 96 Vgl. zum Bundesrecht Schwarz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, Komm. z. Grundgesetz, 7. Aufl.
2018, Art. 114 Rn. 98; ders., in: Gröpl, Komm. z. BHO/LHO, 2. Aufl. 2019, § 88 Rn. 7. 97 Vgl. Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), BeckOK GG, 43. Ed. 15.5.2020, Art. 114 Rn. 36 und
36.1.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 41
…
6. Ergebnis
a) In der Diskussion zwischen Prüfungs- und Beratungsermessen sowie
Beratungsverpflichtung des Landesrechnungshofs dürfte mit der genuin
nordrhein-westfälischen Fassung des § 88 Abs. 2 LHO ein sowohl bun-
desrechts- als auch landesverfassungskonformer Kompromiss gefun-
den sein.
b) Insbesondere die Differenzierung zwischen der selbständigen Beratung
aufgrund von Prüfungserfahrungen in größeren Angelegenheiten nach
pflichtgemäßem Ermessen des Landesrechnungshofs gemäß Satz 1
und der verpflichtenden laufenden Beratung in kleineren Fragen nach
Satz 3 der Vorschrift kann für die Praxis handhabbar gestaltet werden.98
c) Aufträge des Landtags oder eines seiner Ausschüsse zur Prüfung eines
konkreten Sachverhalts bei einer Behörde, sonstigen Stelle oder bei ei-
nem Dritten werden von der Beratungstätigkeit des Landesrechnungs-
hofs nach § 88 Abs. 2 LHO nicht umfasst. Über das Ob, Wie und Wann
solcher Prüfungen bestimmt der Landesrechnungshof nach seinem
pflichtgemäßen Ermessen (§ 89 Abs. 2, § 94 Abs. 1 LHO).
d) Nur zwei deutsche Länder – Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein – räumen ihren Parlamenten in Angelegenheiten von besonde-
rer Bedeutung die Befugnis zur Erteilung von Prüfaufträgen an den je-
weiligen Landesrechnungshof ein. Der Übernahme einer entsprechen-
den Vorschrift in nordrhein-westfälisches Landesrecht stünden landes-
verfassungsrechtliche Bedenken entgegen.
98 A.A. Grupp, NWVBl 1992, 265 (269), der eine Beratungsverpflichtung auch bei der laufenden
Beratung für verfassungswidrig hält.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 42
…
Zu Frage Nr. 2
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass sich der zuständige Ausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen während des laufenden Haushaltsjahres mit Fragen der Ausführung des Haushaltsplans befasst?
I. Zulässigkeit nach geltendem Recht (de lege lata)
1. Zustimmungsvorbehalte bei der Ausführung des Haushaltsplans im engeren Sinne
Bereits das geltende Haushaltsrecht sieht in Einzelbestimmungen vor, dass
sich der Landtag während des laufenden Haushaltsjahres mit Fragen der
Ausführung des Haushaltsplans („Haushaltsvollzug“) befasst. Regelungs-
technisch erreicht wird dies häufig durch die Statuierung eines Einwilli-
gungsvorbehalts.99 Die relevanten Vorschriften lauten (Hervorhebungen nur
hier):
§ 17. Einzelveranschlagung, Erläuterungen, Planstellen […]
(6) 1Andere Stellen als Planstellen sind in den Erläuterungen auszuweisen. 2Im Haushaltsgesetz oder im Haushaltsplan kann bestimmt werden, dass die in den Erläuterungen bei den einzelnen Besoldungs-, Vergütungs- und Lohn-gruppen ausgewiesenen Stellen nach Satz 1 verbindlich sind und die Einrich-tung von weiteren Stellen der Einwilligung des Landtags bedarf. […]
§ 22. Sperrvermerk 1Ausgaben, die aus besonderen Gründen zunächst noch nicht geleistet oder
zu deren Lasten noch keine Verpflichtungen eingegangen werden sollen, so-wie Planstellen oder Stellen, die zunächst nicht besetzt werden sollen, sind im Haushaltsgesetz oder im Haushaltsplan als gesperrt zu bezeichnen. 2Entspre-chendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen. 3In Ausnahmefällen kann durch Sperrvermerk bestimmt werden, dass die Leistung von Ausgaben, die Besetzung von Planstellen oder Stellen oder die Inanspruchnahme von Ver-pflichtungsermächtigungen der Einwilligung des Landtags bedarf. […]
§ 36. Aufhebung der Sperre 1Nur mit Einwilligung des Finanzministeriums dürfen Ausgaben, die durch
Gesetz oder im Haushaltsplan als gesperrt bezeichnet sind, geleistet, Ver-pflichtungen zur Leistung solcher Ausgaben eingegangen sowie im Haushalts-
99 Die Einwilligung wird in § 34 Abs. 4 Satz 1 LHO als vorherige Zustimmung legaldefiniert.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 43
…
gesetz oder im Haushaltsplan gesperrte Planstellen oder Stellen besetzt wer-den. 2In den Fällen des § 22 Satz 3 hat das Finanzministerium die Einwilligung des Landtags einzuholen. […]
§ 42. Konjunkturpolitisch bedingte Maßnahmen
(1) Die Landesregierung beschließt die erforderlichen Maßnahmen nach § 6 Abs. 1 und 2 und § 7 Abs. 2 in Verbindung mit § 14 des Gesetzes zur Förde-rung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft.
(2) 1Das Finanzministerium ist ermächtigt, für Ausgaben nach Absatz 1 über die für Kreditaufnahmen im Haushaltsgesetz festgesetzten Höchstbeträge hin-aus weitere Kreditmittel, gegebenenfalls mit Hilfe von Geldmarktpapieren, auf-zunehmen. 2Der Höchstbetrag wird durch das Haushaltsgesetz bestimmt. 3§ 18 Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.
(3) 1Die Ausgaben dürfen nur mit Zustimmung des Landtags geleistet wer-den. 2Die Zustimmung des Landtags gilt als erteilt, wenn er sie nicht binnen vier Wochen nach Eingang der Vorlage der Landesregierung verweigert hat. 3Die Ausgaben sind wie über- und außerplanmäßige Ausgaben zu behandeln. […]
2. Beteiligungsvorbehalte im Übrigen
Auch in anderen Fallgruppen, die typischerweise besondere Bedeutung für
das Landesvermögen erlangen können, fordert das Haushaltsrecht eine
Beteiligung, zumeist eine Einwilligung des Landtags.
§ 63. Erwerb und Veräußerung von Vermögensgegenständen […]
(3) 1Vermögensgegenstände dürfen nur zu ihrem vollen Wert veräußert wer-den. 2Ausnahmen können im Haushaltsgesetz oder im Haushaltsplan zuge-lassen werden. 3Das Finanzministerium kann in besonderen Fällen oder bei Gegenständen von geringem Wert weitere Ausnahmen zulassen. 4Die Fälle von besonderer Bedeutung sind dem Landtag mitzuteilen. 5Dies gilt nicht für die Veräußerung von Gegenständen, die aus Zuwendungen unter den Voraus-setzungen des § 44 angeschafft sind.
§ 64. Grundstücke […]
(2) 1Haben Grundstücke erheblichen Wert oder besondere Bedeutung und ist ihre Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwilligung des Landtags veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme hiervon geboten ist. 2Ist die Einwilligung nicht einge-holt worden, so ist der Landtag alsbald von der Veräußerung zu unterrichten. […]
§ 65. Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen […]
(7) 1Haben Anteile an Unternehmen besondere Bedeutung und ist deren Veräußerung im Haushaltsplan nicht vorgesehen, so dürfen sie nur mit Einwil-ligung des Landtags veräußert werden, soweit nicht aus zwingenden Gründen eine Ausnahme geboten ist. 2Ist die Einwilligung nicht eingeholt worden, so ist der Landtag alsbald von der Veräußerung zu unterrichten. […]
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 44
…
3. Beschlussfassungskompetenz des zuständigen Ausschusses
Die vorgenannten Vorschriften adressieren durchweg den Landtag als
oberstes Verfassungsorgan. Danach müsste eine entsprechende Beratung
und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung des Landtagsplenums statt-
finden (Art. 42, 44 LV, § 64 GOLT100). In der Praxis des Bundes und der
Länder ist es allerdings nicht unüblich, dass im Rahmen dieser Beteili-
gungsvorbehalte der zuständige Ausschuss des Parlaments (je nach Be-
zeichnung Haushaltsausschuss, Finanzausschuss o.Ä.) beratend und so-
gar beschließend tätig wird.101 Für diese Kompetenz der Ausschüsse beruft
sich die Parlamentspraxis, soweit sie das überhaupt hinterfragt, offenbar
auf Gewohnheitsrecht.102 Unter staatsorganisationsrechtlichen und rechts-
staatlichen Gesichtspunkten wäre freilich eine Klarstellung im Wortlaut der
jeweiligen Haushaltsordnung zu empfehlen, entweder in den jeweiligen Ein-
zelvorschriften oder – was systematisch vorzugswürdig erschiene – „vor die
Klammer gezogen“ in Form einer Generalklausel.103
II. Zulässigkeit aufgrund von Rechtsänderungen (de lege lata)
Soweit eine Beteiligung des Landtags nicht bereits spezialgesetzlich vorge-
geben ist, sind die Spielräume auszuloten, innerhalb deren das einfache
Recht, insbesondere die Landeshaushaltsordnung oder das Landesrech-
nungshofgesetz, geändert werden dürfte, um eine Befassung des Landtags
oder des zuständigen Landtagsausschusses mit Fragen der Ausführung
des Haushaltsplans zu ermöglichen.
1. Haushaltskreislauf mit Kompetenzen und Funktionen
Bedenken gegen eine generelle oder jedenfalls zu weitgehende Befassung
des Landtags oder eines seiner Ausschüsse bei der Ausführung des Haus-
haltsplans ergeben sich aus der haushaltsverfassungsrechtsspezifischen
100 Nachw. sub Fn. 62. 101 Vgl. z.B. Mayer, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 36 BHO
Rn. 49; Mähring, ebd., § 64 BHO Rn. 4; Rossi, in: Gröpl (Hrsg.), Komm. z. BHO/LHO, 2. Aufl. 2019, § 36 Rn. 9, § 64 Rn. 11.
102 Vgl. Mayer, ebd. (Fn. 101), § 36 BHO Rn. 4: „langjährig geübte Staatspraxis“. 103 Etwa: „Soweit nach diesem Gesetz eine Beteiligung, insbesondere eine Zustimmung oder Ein-
willigung des Landtags erforderlich ist, kann diese durch den zuständigen Landtagsausschuss erfolgen.“
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 45
…
Gewaltenteilung. Denn im sich jährlich wiederholenden Haushaltskreislauf
wechseln die Zuständigkeiten und Funktionen der einzelnen Staatsgewal-
ten einander ab:104
Die Aufstellung der Entwürfe von Haushaltsplan und Haushaltsgesetz
obliegt der Exekutive (mittelbewirtschaftende Stellen, Finanzministe-
rium). Die Regierung entscheidet darüber abschließend durch Be-
schluss, aufgrund dessen die Entwürfe ins Parlament eingebracht wer-
den.
Die Beratung und vor allem die Verabschiedung der Entwürfe von Haus-
haltsplan und Haushaltsgesetz stellt eines der zentralen demokratischen
Rechte des Parlaments dar (parlamentarisches Budgetrecht). In den tra-
ditionsbehafteten Worten des Haushaltsrechts wird der Haushaltsplan
durch das Haushaltsgesetz festgestellt.
Demgegenüber obliegt die Ausführung des Haushaltsplans („Haushalts-
vollzug“) der Exekutive, d.h. dem Finanzministerium und den zuständi-
gen mittelbewirtschaftenden Stellen (Titelverwaltern). Hierzu gehören
auch die Buchführung, das Kassenwesen sowie die jährliche Rech-
nungslegung.
Für die nachgängige Rechnungsprüfung als Teil der Finanzkontrolle ist
der Rechnungshof zuständig, er berichtet hierüber dem Parlament, das
auf dieser Grundlage über die Entlastung der Regierung entscheidet.
Diese traditionellen Phasen des Haushaltskreislaufes prägen grosso modo
die Gliederung der Haushaltsordnungen des Bundes und der Länder (vgl.
§§ 11 ff., §§ 34 ff., §§ 88 ff. LHO).105 Auch die Verfassungen von Bund und
Ländern bauen auf dieser Grundstruktur auf.
104 Siehe hierzu und zum Folgenden nur Gröpl, Haushaltsrecht und Reform, 2001, S. 112 m.w.N.;
vgl. bereits Neumark, Der Reichshaushaltsplan, 1929, S. 560; Stern, Das Staatsrecht der Bun-desrepublik Deutschland, Bd. II, 1980, § 49 IV 1; historisch: Schwarz, Formelle Finanzverwal-tung in Preußen und im Reich, 1907, S. 31 ff., 91 ff.
105 Vgl. Gröpl, in: ders. (Hrsg.), Komm. z. BHO/LHO, Einl. Rn. 28 ff.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 46
…
2. Gewaltenteilung als tragendes Verfassungsprinzip
Unterfangen wird diese bereichsspezifische Kompetenzzuordnung durch
die allgemeinen Lehren zur horizontalen Gewaltenteilung, die bereits aus
ihren überkommenen Begrifflichkeiten deutlich werden: Die Legislative („ge-
setzgebende Gewalt“) hat vorrangig die Funktion der Gesetzgebung, die
Exekutive („vollziehende Gewalt“) hingegen die Funktion der Ausführung
der Gesetze („Gesetzesvollzug“), die Judikative („rechtsprechende Gewalt“)
die Funktion der Rechtskontrolle der Exekutive. Dieses Verteilungsschema
gehört zu den Grundstrukturen des Grundgesetzes als demokratisch-
rechtsstaatlicher Verfassung (Art. 1 Abs. 3, Art. 20 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3
GG), das insofern auch die Landesverfassungen prädestiniert (Art. 28
Abs. 1 GG).106 Auch die Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen ba-
siert auf diesem Konzept, das namentlich in ihrem Art. 3 ebenso deutlich
wie prominent herausgestellt wird („tragendes Konstitutionsprinzip“).107
3. Gewaltenverschränkung: Bedingungen und Grenzen
Freilich kennen und konstituieren das Grundgesetz und die Verfassungen
der Länder auch Verschränkungen der gesetzgebenden und vollziehenden
Gewalt, ohne dabei auf Unterscheidbarkeit und Ordnung zu verzichten.108
Die deutschen Verfassungen trennen und verbinden zugleich; Verschrän-
kungen sollen mehr Effektivität und Kontrolle ermöglichen, aber auch zur
Konfliktvermeidung durch Beteiligung beitragen. Im Haushaltsverfassungs-
recht verschränken sich die Gewalten im Haushaltskreislauf in einem aus-
tarierten System der „Staatsleitung zur gesamten Hand“,109 ohne dass
dadurch die Zuordnung von Zuständigkeiten und Verantwortung verloren
geht.
106 Aus der Fülle der rechtswissenschaftlichen Literatur siehe nur Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof
(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 27 Rn. 1 ff.; Badura, Staatsrecht, 6. Aufl. 2015, D 47 ff.; Gröpl, Staatsrecht I, 11. Aufl. 2019, Rn. 864 ff.
107 Heusch, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 3 Rn. 1 ff.; Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 3 Rn. 1 ff.
108 Vgl. hierzu und zum Folgenden: Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staats-rechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 27 Rn. 31 ff.
109 Heun, Staatshaushalt und Staatsleitung, 1989, S. 517 ff.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 47
…
Aus diesem Aperçu folgt zugleich, dass Gewaltenverschränkungen als Mo-
difikationen oder gar Durchbrechungen der Gewaltenteilung in aller Regel
einer verfassungsrechtlichen Grundlage bedürfen.
Im Haushaltsverfassungsrecht wird die Kompetenz der Exekutive zur Aus-
führung des Haushaltsplans nicht eigens herausgestellt. Freilich beruhen
die Regelungen der Art. 81 ff. LV auf dem oben110 beschriebenen Haus-
haltskreislauf, der zugleich ein bereichsspezifisches Gewaltenteilungs-
schema konstituiert, wenn der
Landtag zur Feststellung des Haushaltsplans berufen ist (Art. 81 LV),
der Landesregierung das Nothaushaltsrecht zugesprochen wird (Art. 82
LV),
die Kreditaufnahme an eine gesetzliche Ermächtigung gebunden wird
(Art. 83 LV),
dem Finanzminister – bei der Ausführung des Haushalts – ein Notbewil-
ligungsrecht eingeräumt wird (Art. 85 LV) sowie
die Rechnungsprüfung und Entlastung eigens garantiert werden (Art. 86,
87 LV).
Grundsätzliche Durchbrechungen dieser besonderen Art der Gewaltentei-
lung sind von Verfassungs wegen nicht vorgesehen und damit auch nicht
rechtfertigungsfähig. Dies ergibt sich bereits aus der Überlegung, dass der
Landtag, wenn er nach Art. 86 Abs. 1 LV zur Haushaltskontrolle und zur
Entlastung der Landesregierung berufen ist, nicht zugleich für die Ausfüh-
rung des Haushaltsplans verantwortlich sein darf. Anderenfalls fielen der
Kontrolleur und der Kontrollierte jedenfalls partiell zusammen, was dem
Prinzip der Gewaltenteilung widerspräche.111
110 Sub II 1. 111 Vgl. bereits Roedig, Zur Problematik der Mitwirkung des Bundesrechnungshofs bei der Planung
und Durchführung von Verwaltungsaufgaben, 1966, S. 150 f.; Sigg, Die Stellung der Rech-nungshöfe im politischen System der Bundesrepublik Deutschland, 1983, S. 34 ff.; Grupp, NWVBl 1992, 265 (268 f.) m.w.N.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 48
…
4. Insbesondere zu Einflussmöglichkeiten der Legislative auf den Haus-haltsvollzug
Wenn die Ausführung des vom Parlament gesetzlich festgestellten Haus-
haltsplans der vollziehenden Gewalt obliegt und die Verfassung hiervon
keine Ausnahmen begründet, gestaltet sich die Beteiligung eines Aus-
schusses des Landtags als Teil des Parlaments und damit der Legislative
als nur in engen Grenzen zulässig und überdies als besonders rechtferti-
gungsbedürftig. Bei der Ausbringung von Haushaltssperren im Sinne von
§ 22 LHO wird dies im Fachschrifttum zum Bundesrecht diskutiert:
Grundsätzlich ist der Bundeshaushaltsplan so aufzustellen und vom Parla-ment zu verabschieden, dass er von den einzelplanführenden Stellen in ei-gener Zuständigkeit ausgeführt werden kann. Dies folgt aus dem Grundsatz der Gewaltenteilung (Art. 20 Abs. 2 GG) sowie einfachgesetzlich aus § 3 Abs. 1 BHO, nach dem der Haushaltsplan die Verwaltung ermächtigt, Aus-gaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.112
Und weiter:
Soll bereits die gesperrte Veranschlagung von Haushaltsmitteln der Ausnah-mefall sein, bildet die qualifizierte Sperre [scil. der Einwilligungsvorbehalt zu-gunsten des Parlaments] nach der normativen Vorgabe in § 22 Satz 2 BHO hierzu noch einmal die Ausnahme in der Ausnahme. Begründet wird der ge-steigerte Ausnahmecharakter qualifizierter Sperren mit „übergeordneten ver-fassungsrechtlichen Erwägungen“, da der Bundestag auf diese Weise in den grundsätzlich der Exekutive als „Hausgut“ vorbehaltenen Haushaltsvollzug eingreifen kann. Solange qualifizierte Sperren aber in einem überschauba-ren Umfang bleiben, werden sie wegen der für das Parlament bei den Haus-haltsberatungen noch nicht abschließend bewertbaren Etatreife der von ihnen umfassten Haushaltsmittel als vertretbar angesehen.113
Diese Überlegungen lassen sich angesichts der Bedeutung der Gewalten-
teilung auch im Haushaltsrecht verallgemeinern: Die Mitwirkung des Parla-
ments oder seiner Ausschüsse in Fragen des Haushaltsvollzugs bedarf
erstens einer spezialgesetzlichen Regelung, die sich jedenfalls auf ein-
zelne Fallgruppen beschränkt, und
zweitens einer besonderen verfassungsrechtlichen Rechtfertigung.
112 Mayer, in: Heuer/Scheller, Komm. z. Haushaltsrecht (Stand: 1.6.2020), § 22 BHO Rn. 19 m.w.N. 113 Mayer, ebd. (Rn. 112), § 22 BHO Rn. 27 mit Verweis auf Gröpl, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.),
Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 174. EL September 2015, Art. 110 GG Rn. 111.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 49
…
Das bedeutet: Wollte der Landtag – sei es in der Landeshaushaltsordnung,
sei es in anderen Gesetzen – neue Vorschriften verabschieden, die seine
Beteiligung oder die eines seiner Ausschüsse bei der Ausführung des Haus-
haltsplans ermöglichten, bedürfte jede dieser Vorschriften einer besonde-
ren verfassungsrechtlichen Rechtfertigung und müsste aufs Ganze gese-
hen die Ausnahme bleiben. Besondere Rechtfertigungsgründe für eine Mit-
wirkung des Parlaments oder seiner Untergliederungen beim Haushaltsvoll-
zug in größerem Umfang sind aber nicht ersichtlich. In Betracht kämen dafür
im Grunde nur eine herausragende finanzielle Bedeutung einzelner Bewirt-
schaftungsmaßnahmen oder andere exzeptionelle Auswirkungen von Ein-
zelmaßnahmen auf den Gesamthaushalt oder das Vermögen des Landes.
III. Ergebnis
a) Eine Befassung des zuständigen Ausschusses des Landtags mit Fra-
gen der Ausführung des Haushaltsplans während des Haushaltsjahres
ist mit Rücksicht auf das verfassungsrechtliche Strukturprinzip der Ge-
waltenteilung nur zulässig aufgrund einer spezialgesetzlichen Rege-
lung. Für diese Regelung muss ein besonderer Rechtfertigungsgrund
von verfassungsrechtlichem Gewicht streiten. Insgesamt muss die Be-
teiligung des zuständigen Landtagsausschusses an der Ausführung des
Haushalts die Ausnahme bleiben.
b) Bei einer Gesamtschau dürften die Beteiligungsvorschriften nach ge-
genwärtiger Rechtslage diesen Ausnahmecharakter wahren.
c) Gesetzliche Ausweitungen der Einflussmöglichkeiten des Landtags
oder von dessen zuständigem Ausschuss auf den Haushaltsvollzug
würden grundsätzlich Bedenken aufwerfen. Sie wären allenfalls in ver-
fassungsrechtlich begründeten Ausnahmekonstellationen zulässig.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 50
…
Zu Frage Nr. 3
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dem Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen Vorgaben für die Art und Weise seiner Aufgabenerfüllung zu machen?
Um die Frage der Zulässigkeit von Vorgaben für die Art und Weise der Auf-
gabenerfüllung des Landesrechnungshofs beantworten zu können, muss
hinsichtlich der Rechtsgrundlage differenziert werden. In Betracht kommen
Vorgaben in Form von Anordnungen im Einzelfall oder für bestimmte
Gruppen von Einzelfällen (Weisungen) sowie
Vorgaben abstrakt-genereller Art aufgrund gesetzlicher Regelung.
I. Vorgaben in Form von Weisungen
1. Weisungen in einem hierarchischen Organisationsverhältnis
Anordnungen für den Einzelfall oder für bestimmte Gruppen von Einzelfäl-
len (Weisungen) sind zulässig in einem hierarchischen Organisationsver-
hältnis, wenn also eine nachgeordnete Behörde im Weisungsstrang gegen-
über einer vorgesetzten Behörde steht.114 Im Landesrecht kommt dies
durch den Begriff der „Leitung“ zum Ausdruck, wenn § 5 Abs. 1 Satz 1 des
nordrhein-westfälischen Landesorganisationsgesetzes (LOG)115 bestimmt,
dass die Landesregierung und im Rahmen ihres Geschäftsbereichs der Mi-
nisterpräsident und die Landesministerien die Landesverwaltung leiten und
beaufsichtigen. Nach § 11 LOG unterstehen die nachgeordneten Landes-
behörden der Dienstaufsicht und der Fachaufsicht. Gemäß § 13 Abs. 3
LOG können die Fachaufsichtsbehörden in Ausübung der Fachaufsicht ins-
besondere Weisungen erteilen.
114 Schmitz, in: Stelkens/Bonk/Sachs, Komm. z. Verwaltungsverfahrensgesetz, 9. Aufl. 2018, § 4
Rn. 34; Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Aufl. 2017, § 22 Rn. 30; vgl. auch Schönenbroicher/Rossbach, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 54 Rn. 21.
115 Gesetz über die Organisation der Landesverwaltung (Landesorganisationsgesetz – LOG NRW) v. 10.7.1962 (GV. NW. S. 421), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes v. 1.10.2013 (GV. NRW. S. 566).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 51
…
2. Weisungen außerhalb eines hierarchischen Organisationsverhältnis-ses
a) Allgemeines
Außerhalb eines hierarchischen Organisationsverhältnisses sind Weisun-
gen nur aufgrund besonderer verfassungsrechtlicher Grundlage zulässig,
etwa im Rahmen der Landesverwaltung im Bundesauftrag nach Art. 85
Abs. 3 und Art. 108 Abs. 3 Satz 2 GG, im überregionalen Katastrophenfall
gemäß Art. 35 Abs. 3 GG, im Fall des inneren Notstandes nach Art. 91
Abs. 2 GG oder im Rahmen des Bundeszwangs (Bundesexekution) gemäß
Art. 37 Abs. 2 GG.
b) Insbesondere Stellung des Landesrechnungshofs
Als selbständige, nur dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde
steht der Landesrechnungshof wegen Art. 87 Abs. 1 Satz 1 LV116 in keiner-
lei hierarchischem Weisungsverhältnis gegenüber einer vorgesetzten Be-
hörde oder einem vorgesetzten Organ. Neben dieser sachlichen Unabhän-
gigkeit genießen die Mitglieder des Landesrechnungshofs nach Art. 87
Abs. 1 Satz 2 LV persönliche Unabhängigkeit in Form richterlicher Unab-
hängigkeit. Aus diesen beiden Gründen wären Vorgaben an den Landes-
rechnungshof für die Art und Weise seiner Aufgabenerfüllung in Form von
Weisungen ausnahmslos unzulässig. Dies gilt auch für Weisungen durch
den Landtag und durch seine Ausschüsse.
Die sachliche Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs und die persönli-
che Unabhängigkeit seiner Mitglieder dürfen nicht dadurch umgangen wer-
den, dass der Landesgesetzgeber, gestützt auf den Regelungsauftrag des
Art. 87 Abs. 3 LV,117 dem Landtag, seinen Ausschüssen oder anderen Be-
hörden oder Stellen durch Landesgesetz die Befugnis zu Weisungen ge-
genüber dem Landesrechnungshof einräumt. Gesetzliche Regelungen
nach Art. 87 Abs. 3 LV sind nur dann verfassungsgemäß, wenn sie sich im
Rahmen der Landesverfassung, namentlich der Vorgaben des Art. 86
116 Siehe hierzu und zum Folgenden bereits näher oben sub C zu Frage Nr. 1 I 1 b. 117 Hierzu sogleich näher sub II.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 52
…
Abs. 2 sowie des Art. 87 Abs. 1 und 2 LV, halten.118 Der Regelungsauftrag
des Art. 87 Abs. 3 LV ermächtigt den Landesgesetzgeber zu „Ausführungs-
bestimmungen“, um die Aufgaben und Befugnisse des Landesrechnungs-
hofs auszugestalten,119 nicht indessen zur Konterkarierung der verfas-
sungsrechtlichen Grundentscheidungen in Art. 86 Abs. 2 sowie in Art. 87
Abs. 1 und LV.
II. Vorgaben in Form von Gesetzen
Die zweite Möglichkeit, dem Landesrechnungshof Vorgaben für die Art und
Weise seiner Aufgabenerfüllung zu machen, bestünde in Gesetzen, d.h. in
abstrakt-generellen Vorschriften zur Konkretisierung der Aufgaben und Be-
fugnisse des Landesrechnungshofs. Hierfür enthält Art. 87 Abs. 3 LV sogar
einen Auftrag an den Landesgesetzgeber, wenn er vorschreibt, dass „das
Nähere […] durch Gesetz geregelt“ wird. Dem ist der nordrhein-westfälische
Landesgesetzgeber vor allem durch zwei Gesetze nachgekommen: durch
das Landesrechnungshofgesetz120 sowie durch die Landeshaushaltsord-
nung,121 dort insbesondere in den §§ 88 bis 104 LHO.
1. Landeshaushaltsordnung
Eine Analyse vor allem der einschlägigen Vorschriften der Landeshaus-
haltsordnung zeigt, dass die Art und Weise der Aufgabenerfüllung durch
den Landesrechnungshof dort in der Tat geregelt wird, namentlich in § 89
Abs. 2 LHO:
Der Landesrechnungshof kann nach seinem Ermessen die Prüfung be-schränken und Rechnungen ungeprüft lassen.
oder § 94 LHO:
(1) Der Landesrechnungshof bestimmt Zeit und Art der Prüfung und lässt erforderliche örtliche Erhebungen durch Beauftragte vornehmen.
(2) Der Landesrechnungshof kann Sachverständige hinzuziehen.
118 Vgl. Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 87 Rn. 13. 119 Vgl. Kamp, in: Heusch/Schönenbroicher (Hrsg.), Komm. z. LV NRW, 2. Aufl. 2020, Art. 87
Rn. 21 und Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 87 Rn. 13. 120 Nachw. in Fn. 28. 121 Nachw. in Fn. 31.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 53
…
Weitere Bestimmungen zur Art und Weise der Aufgabenerfüllung enthalten
etwa § 96 LHO (Prüfungsergebnis), § 97 LHO (Jahresbericht und Ergebnis
der Prüfung) oder § 99 LHO (Angelegenheiten von besonderer Bedeutung).
2. Landesrechnungshofgesetz
Zudem enthält das Landesrechnungshofgesetz verschiedene Vorschriften
für die Art und Weise der Aufgabenerfüllung durch den Landesrechnungs-
hof, insbesondere in § 10 (Geschäftsverteilung und Arbeitsplanung), § 11
(Befangenheit), § 12 (Verschwiegenheit), § 13 (Geschäftsordnung), aber
auch die Bestimmungen zum Präsidenten und Vizepräsidenten des Lan-
desrechnungshofs (§ 6) sowie zu den Entscheidungen (§ 7) und zu den Ent-
scheidungszuständigkeiten (§ 8).
3. Maßstäbe
a) Landesverfassung
Beim Erlass dieser Vorschriften ist der Landesgesetzgeber zum einen an
die Landesverfassung gebunden, neben den Maßgaben zur allgemeinen
und besonderen Gewaltenteilung122 namentlich an die Vorgaben für die
sachliche Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs, für die persönliche
Unabhängigkeit seiner Mitglieder (Art. 87 Abs. 1 LV) sowie für die zentrale
Aufgabe des Landesrechnungshofs, die Prüfung der Rechnung sowie der
Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Haushalts- und Wirtschafts-
führung (Art. 86 Abs. 2 LV). Regelungen in Landesgesetzen, die diesen
Grundentscheidungen zuwiderliefen, wären verfassungswidrig und grund-
sätzlich nichtig.
b) Bundesrecht
Überdies ist der Landesgesetzgeber mit Blick auf Art. 109 Abs. 4 Fall 1 GG
an gültige bundesrechtliche Vorgaben gebunden. In diesem Rahmen sind
vor allem die Bestimmungen von Teil I des Haushaltsgrundsätzegesetzes
122 Zur Stellung des (Bundes-)Rechnungshofs im gewaltenteilenden System des Grundgesetzes
Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutsch-land, Bd. II, 3. Aufl. 2004, § 27 Rn. 33.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 54
…
in Erinnerung zu rufen.123 Als Leitlinien für die Aufgabenerfüllung des Lan-
desrechnungshofs zu nennen sind vor allem die §§ 42 bis 47 HGrG.
c) Verfassungsmäßigkeit und Regelungskonzept
Mangels anderer Anhaltspunkte ist davon auszugehen, dass die zitierten
Vorschriften des Haushaltsgrundsätzegesetzes sowie der Landeshaus-
haltsordnung und des Landesrechnungshofgesetzes verfassungsgemäß
und gültig sind.124 Geprägt sind sie von Respekt für die Unabhängigkeit des
Rechnungshofs sowie dementsprechend von zurückhaltenden Vorgaben
für die Art und Weise der Aufgabenerfüllung. Als Leitprinzip lässt sich fest-
stellen, dass dem Rechnungshof bei seiner Tätigkeit bedeutende Ermes-
sensspielräume zugestanden werden (§ 42 Abs. 3 HGrG sowie § 89 Abs. 2,
§ 94 LHO), die er freilich pflichtgemäß auszufüllen hat. Konkrete Vorgaben
für die Art und Weise seiner Aufgabenerfüllung wären damit unvereinbar.
III. Ergebnis
Vorgaben für die Art und Weise der Aufgabenerfüllung des Landesrech-
nungshofs
a) in Form von Weisungen sind unzulässig,
b) in Form gesetzlicher Regelungen müssen die bundesrechtlichen Maß-
stäbe des Haushaltsgrundsätzegesetzes sowie die landesverfassungs-
rechtlichen Wertungen in Art. 86 Abs. 2 und Art. 87 Abs. 1 und 2 LV be-
achten. Mit Rücksicht auf die verfassungsrechtlich garantierte Rechts-
stellung des Landesrechnungshofs und die Gewaltenteilung als tragen-
des Verfassungsprinzip dürfte der Landesgesetzgeber hier nur mit äu-
ßerster Vorsicht agieren, wenn sich dies durch verfassungsrechtliche
Belange rechtfertigen ließe, die von mindestens gleichrangigem Ge-
wicht wie die Unabhängigkeit des Landesrechnungshofs wären.
123 Näher dazu oben sub C zu Frage Nr. 1 II 2 b aa. 124 Zu Bedenken gegen das Landesrechnungshofgesetz siehe Körkemeyer, DÖV 1996, 160 ff., die
allerdings – soweit ersichtlich – nicht weiter vertieft, anderweit aufgegriffen oder gar rechtspre-chungsrelevant wurden.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 55
…
Zu Frage Nr. 4
Inwieweit ist es rechtlich zulässig, in den Landesministerien ein Risikomanagementsystem einzuführen?
Die Einführung eines Risikomanagementsystems in den Ministerien des
Landes Nordrhein-Westfalen ist rechtlich zulässig, wenn sie weder Bundes-
recht noch Landesverfassungsrecht widerspricht.
I. Begriff des Risikomanagementsystems
Der Begriff des Risikomanagementsystems fand im Bereich des Steuer-
rechts und der Finanzverwaltung durch das Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens vom 18. Juli 2016125 Eingang in die Abgabenord-
nung (AO), und zwar in deren § 88 Abs. 5:
1Die Finanzbehörden können zur Beurteilung der Notwendigkeit weiterer Er-mittlungen und Prüfungen für eine gleichmäßige und gesetzmäßige Festset-zung von Steuern und Steuervergütungen sowie Anrechnung von Steuerab-zugsbeträgen und Vorauszahlungen automationsgestützte Systeme einset-zen (Risikomanagementsysteme). 2Dabei soll auch der Grundsatz der Wirt-schaftlichkeit der Verwaltung berücksichtigt werden. 3Das Risikomanage-mentsystem muss mindestens folgende Anforderungen erfüllen:
1. die Gewährleistung, dass durch Zufallsauswahl eine hinreichende Anzahl von Fällen zur umfassenden Prüfung durch Amtsträger ausgewählt wird,
2. die Prüfung der als prüfungsbedürftig ausgesteuerten Sachverhalte durch Amtsträger,
3. die Gewährleistung, dass Amtsträger Fälle für eine umfassende Prüfung auswählen können,
4. die regelmäßige Überprüfung der Risikomanagementsysteme auf ihre Zielerfüllung.
4Einzelheiten der Risikomanagementsysteme dürfen nicht veröffentlicht wer-den, soweit dies die Gleichmäßigkeit und Gesetzmäßigkeit der Besteuerung gefährden könnte. 5Auf dem Gebiet der von den Landesfinanzbehörden im Auftrag des Bundes verwalteten Steuern legen die obersten Finanzbehörden
125 Art. 1 Nr. 12 des Gesetzes vom 18.7.2016 (BGBl. I S. 1679). Hierzu etwa Fischer, Die Veran-
kerung des Risikomanagementsystems (RMS) durch das Gesetz zur Modernisierung des Be-steuerungsverfahrens (StModernG), jurisPR-SteuerR 40/16 Anm. 1; Marx, Der Einsatz von Ri-sikomanagementsystemen nach § 88 Abs. 5 AO als Kernelement der Modernisierung des Be-steuerungsverfahrens, Ubg 2016, 358 ff.; Ortmann-Babel/Franke, Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens, DB 2016, 1521 ff.; Zaumseil, Die Modernisierung des Besteue-rungsverfahrens, NJW 2016, 2769 ff. – Zur Vorläufervorschrift Rätke, in: Klein, Komm. z. AO, 13. Aufl. 2016, § 88 Rn. 70.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 56
…
der Länder die Einzelheiten der Risikomanagementsysteme zur Gewährleis-tung eines bundeseinheitlichen Vollzugs der Steuergesetze im Einverneh-men mit dem Bundesministerium der Finanzen fest.
Generell wird unter einem Risikomanagementsystem ein automationsge-
stütztes Gesamtgebilde verstanden, das die Notwendigkeit weiterer Hand-
lungsschritte, insbesondere von Ermittlungen und Prüfungen, anhand von
Risikopotenzialen, d.h. Gefährdungswahrscheinlichkeiten, beurteilt.126
Nach der Begründung des Entwurfs zum Gesetz zur Modernisierung des
Besteuerungsverfahrens besteht ein Risikomanagement aus der systema-
tischen Erfassung und Bewertung von Risikopotenzialen sowie der Steue-
rung von Reaktionen in Abhängigkeit von den festgestellten Risikopotenzi-
alen.127 Ziel des Risikomanagements könne es allerdings nicht sein, jedes
abstrakt denkbare Risiko auszuschalten. Im Verwaltungsbereich verfolgt Ri-
sikomanagement – abstrahiert vom Besteuerungsverfahren – also vielmehr
das Ziel, konkrete Gefahren für einen defizitären Gesetzesvollzug zu ver-
hindern und damit präventiv zu wirken, namentlich die individuelle Fallbear-
beitung durch Amtsträger aufgrund einer risikoorientierten Steuerung der
Bearbeitung zu optimieren, die Bearbeitungsqualität durch Standardisie-
rung der Arbeitsabläufe bei umfassender Automationsunterstützung nach-
haltig zu verbessern und qualitativ hochwertige Rechtsanwendung gleich-
mäßig zu gestalten. Risikomanagement hilft dabei, mit den vorhandenen
Ressourcen das bestmögliche Ergebnis im Spannungsverhältnis zwischen
gesetz- und gleichmäßiger Verwaltung einerseits und zeitnahem und wirt-
schaftlichem Verwaltungshandeln andererseits zu erreichen. § 88 Abs. 5
Satz 3 AO definiert hierfür bereichsspezifisch gesetzliche Mindestanforde-
rungen. Eine bloße automationsgestützte Plausibilitätsprüfung soll demge-
genüber noch kein Risikomanagementsystem darstellen.
126 Rätke, in: Klein, Komm. z. AO, 15. Aufl. 2020, § 88 Rn. 95. 127 Vgl. hierzu und zum Folgenden BT-Drs. 18/7457, S. 69 f.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 57
…
II. Kompetenz zur Einführung auf Landesebene
1. Leitungskompetenz von Landesregierung, Ministerpräsidenten und Landesministerien – Gesetzesvorbehalt
a) Einführung aufgrund untergesetzlicher Bestimmung
Nach Art. 30 GG sind die Erfüllung der staatlichen Aufgaben und Ausübung
der staatlichen Befugnisse grundsätzlich Sache der Länder, soweit das
Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt. Damit ist prinzipiell
jedes Land in seinem Staats- und Verwaltungsbereich für die Entscheidung
über die Einführung von Risikomanagementsystemen sowie für deren Ein-
satz zuständig. Landesverfassungsrechtlich ergibt sich die grundsätzliche
Berechtigung aus Art. 3 Abs. 2 Fall 1 i.V.m. Art. 51, 55 und 77 LV, einfach-
gesetzlich aus § 5 Abs. 1 Satz 1 sowie § 11 i.V.m. § 13 LOG.128 Diese Zu-
ständigkeit umfasst auch die Landesministerien. Grundlage für die Einfüh-
rung könnte ein innerministerieller Erlass oder eine andere Verwaltungsvor-
schrift129 sein.
b) Einführung aufgrund eines Landesgesetzes – Vorbehalt des Gesetzes
Soweit ein Risikomanagementsystem die Anwendung eines Gesetzes oder
ein anderes („gesetzesfreies“) Verwaltungshandeln gegenüber dem Einzel-
nen betrifft und in dessen Rechte (Art. 4 LV u.a.m.) eingreifen kann oder
sonst grundlegende Bedeutung für die Landesverwaltung hat, ist nach dem
allgemeinen Vorbehalt des Gesetzes eine Regelung in einem formellen
Landesgesetz erforderlich (Art. 3 Abs. 1, Art. 65 ff. LV).130 Dies wird in aller
Regel der Fall sein, wenn sich ein Risikomanagementsystem auf das Ob
und Wie von Sachverhaltsermittlungen und verbindlichen Entscheidungen
zugunsten oder zulasten des Einzelnen auswirken kann, typischerweise in
einem Verwaltungsverfahren. Eine gesetzliche Regelung eines Risikoma-
128 Hierzu oben sub C zu Frage 3 I 1 m.w.N. 129 Die Terminologie für verwaltungsinterne Anordnungen schwankt; als Oberbegriff hat sich dog-
matische der Begriff Verwaltungsvorschrift(en) durchgesetzt, vgl. Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Aufl. 2017, § 24 Rn. 1.
130 Zur zugrundeliegenden Wesentlichkeitstheorie siehe nur Jarass, in: Jarass/Pieroth, Komm. z. GG, 15. Aufl. 2018, Art. 20 Rn. 71 mit Verweis auf BVerfG, Urt. v. 5.11.2014, 1 BvF 3/11, BVer-fGE 137, 350 (363 f. Rn. 33) und weit. Nachw.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 58
…
nagementsystems wird des Weiteren erforderlich sein, wenn das Risikoma-
nagementsystem grundlegende Dispositionen des Landes beeinflusst, etwa
im Bereich des Landeshaushalts, des Landesvermögens und der Landes-
schulden oder – im laufenden Jahr besonders aktuell – der Gesundheits-
vorsorge.
2. Vorbehalt der Bundeskompetenz
Unzulässig ist die Einführung eines Risikomanagementsystems durch au-
tonome Entscheidung des Landes in Bereichen, die aufgrund einer Bundes-
kompetenz bundesrechtlich geregelt sind. Die überwiegende Zahl der Bun-
desgesetze wird nach Art. 83 Halbs. 1 GG von den Ländern in sog. Landes-
eigenverwaltung ausgeführt; in diesem Fall verbleibt den Ländern mit Blick
auf Art. 84 Abs. 1 Satz 1 GG die Kompetenz, das Verwaltungsverfahren zu
regeln. Insoweit Gleiches gilt für die Landesverwaltung im Bundesauftrag
nach Art. 85 Abs. 1 Satz 1 GG, solange Bundesgesetze nichts anderes vor-
sehen.131 Vor diesem Hintergrund stieße die Einführung von Risikomana-
gementsystemen in Landesministerien auch bei der Ausführung von Bun-
desgesetzen durch die Länder auf keine Bedenken.
Grenzlinien verlaufen jedoch dort, wo die Bundesregierung nach Maßgabe
von Art. 84 Abs. 2, Art. 85 Abs. 2 Satz 1 oder Art. 108 Abs. 7 GG allge-
meine Verwaltungsvorschriften erlassen hat, die einem Risikomanagement-
system entgegenstehen. Weitere Beschränkungen ergeben sich, wenn und
soweit der Bund das Verwaltungsverfahren bei der Landeseigenverwaltung
oder bei der Landesverwaltung im Bundesauftrag durch Bundesrecht nor-
miert hat. So richtet sich vor allem das bereits erwähnte Risikomanage-
mentsystem in der Finanzverwaltung (Steuerverwaltung) der Länder wegen
der Bundeskompetenz aus Art. 108 Abs. 5 Satz 2 GG132 nach § 88 Abs. 5
AO und den darauf beruhenden Verwaltungsvorschriften des Bundes
131 Trotz der Tatsache, dass das Verwaltungsverfahren in der Vorschrift nicht eigens erwähnt wird,
vgl. Henneke, in: Schmidt-Bleibtreu/Klein/Hofmann/Henneke, Komm. z. GG, 14. Aufl. 2018, Art. 85 Rn. 7 m.w.N.; Gröpl, in: Gröpl/Windthorst/v. Coelln, Studienkomm. z. GG., 4. Aufl. 2020, Art. 85 Rn. 4. Der Unterschied zwischen Art. 84 und Art. 85 GG liegt darin, dass bundesgesetz-liche Verfahrensvorschriften im Rahmen der Auftragsverwaltung keiner Zustimmung des Bun-desrats bedürfen, siehe BVerfG, Beschl. v. 4.5.2010, 2 BvL 8, 9/07, BVerfGE 126, 77 (100 ff.).
132 Zum verbleibenden Spielraum für die Länder siehe Schwarz, in: Maunz/Dürig, Komm. z. GG, Art. 108 Rn. 61 (Stand der Bearb.: März 2019).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 59
…
(Art. 108 Abs. 7 GG). Raum für landesautonome Risikomanagementsys-
teme besteht insoweit nicht mehr.
III. Materielle Maßstäbe
Abgesehen von kompetenziellen Fragen gebieten rechtsstaatliche Anforde-
rungen aus Art. 20 Abs. 2 und 3, Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG sowie aus Art. 3
LV133 gewisse Standards, an denen ein Risikomanagementsystem vor sei-
ner Einführung zu messen ist und die es im Rahmen seiner Anwendung
erfüllen muss.134
1. Gleichmäßigkeit der Ausführung der Gesetze
Ein Risikomanagementsystem darf nicht dazu führen, dass die Gleichmä-
ßigkeit bei der Ausführung der Gesetze beeinträchtigt wird.135 Das Gebot
des Gleichmaßes ergibt sich aus dem allgemeinen Gleichheitssatz des
Art. 3 Abs. 1 GG, der nach Art. 4 Abs. 1 LV auch Bestandteil der Landes-
verfassung ist. Wenn alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind, dann hat
der Staat auf die Gleichbehandlung seiner Bürger bei Leistungen und Las-
ten Bedacht zu nehmen. Diese Maxime verpflichtet insbesondere die Lan-
desministerien als oberste leitende Behörden der Landesverwaltung (§§ 3
und 5 LOG). Ein Risikomanagementsystem darf dieses Gleichbehand-
lungsgebot nicht vernachlässigen, etwa indem es nach statistischer Zufalls-
auswahl Vollzugsdefizite verursacht oder zulässt.
Problematisch ist in diesem Zusammenhang die Vernachlässigung des Un-
tersuchungsgrundsatzes (§ 24 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
– VwVfG136) bei der Einführung ausschließlich automationsgestützter Ver-
133 Zum Rechtsstaatsprinzip als ungeschriebener Grundsatz des nordrhein-westfälischen Verfas-
sungs VerfGH NRW, OVGE 16, 315 (318 f.), zit. bei Tettinger, in: Löwer/Tettinger, Komm. z. Verf NRW, 2002, Art. 1 Rn. 42.
134 Vgl. hierzu das Risikomanagementsystem nach § 88 Abs. 5 AO und die Kommentierungen von Rätke, in: Klein, Komm. z. AO, 15. Aufl. 2020, § 88 Rn. 92 m.w.N.
135 Grundlegend zur Gleichmäßigkeit bei der Ausführung der Steuergesetze BVerfG, Urt. v. 27.6.1991, 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 239 (268 ff.).
136 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen i.d.F. der Bek. v. 12.11.1999 (GV. NRW. S. 602), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes v. 17.5.2018 (GV. NRW. S. 244).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 60
…
waltungsverfahren. Hier muss der Einsatz von Risikomanagementsyste-
men für einen hinreichenden Ausgleich sorgen, indem an die Stelle des
Grundsatzes der Einzelfallprüfung eine automationsgestützte Risikobeurtei-
lung tritt. In der Regel kann § 88 Abs. 5 AO als Orientierungsmaßstab für
andere Bereiche der öffentlichen Verwaltung dienen. So muss ein Risiko-
managementsystem die personelle Prüfung der ausgesteuerten Fälle und
eine personelle Fallauswahl ermöglichen.137 Bei einer Installation von Risi-
komanagementsystemen ausschließlich in Landesministerien verlieren
diese Anforderungen an Bedeutung, soweit diese obersten Landesbehör-
den nicht mit der Ausführung von Gesetzen gegenüber dem Einzelnen be-
traut sind.
2. Grundsätze der Bestimmtheit und der Rechtssicherheit
Zu den Kernelementen moderner Rechtsstaatlichkeit gehört das Gebot der
hinreichenden Bestimmtheit von Hoheitsakten, insbesondere von Gesetzen
und anderen Rechtsvorschriften.138 Der Gewaltunterworfene muss sich
über das Ausmaß seiner Ansprüche und Belastungen klar werden und da-
rauf vertrauen können. Hat ein Risikomanagementsystem demnach unmit-
telbare Auswirkungen auf die Ausführung von Gesetzen gegenüber dem
Einzelnen, sind seine Voraussetzungen und Wirkungsweisen gesetzlich
hinreichend zu umschreiben. Dies bezieht sich auch auf die Verwaltung in
den Landesministerien, soweit diese Ansprechpartner für den Einzelnen
sind oder ihm sonst unmittelbar gegenübertreten. Auch in Landesministe-
rien dürfen Risikomanagementsysteme nicht dazu beitragen, dass die
Rechtssicherheit als weiteres einschlägiges Element des Rechtsstaats be-
einträchtigt wird.139
Diese rechtsstaatlichen Kriterien treten zurück, soweit insbesondere Lan-
desministerien nicht in den Gesetzesvollzug gegenüber dem Einzelnen ein-
gebunden und stattdessen mit Leitungsaufgaben der Personalsteuerung
137 Hierzu Braun Binder, NVwZ 2016, 960 (961 f.). 138 Vgl. nur Jarass, in: Jarass/Pieroth, Komm. z. GG, 15. Aufl. 2018, Art. 20 Rn. 82 m.w.N. 139 Hierzu statt vieler Jarass, in: Jarass/Pieroth, Komm. z. GG, 15. Aufl. 2018, Art. 20 Rn. 94 ff.
m.w.N.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 61
…
und -verwaltung, der Verwaltung von Liegenschaften (Immobilien), des öf-
fentlichen Hochbaus und der Haushaltsüberwachung befasst sind. Zwar gilt
das Rechtsstaatsprinzip auch auf diesen Feldern uneingeschränkt. Die zu-
rücktretende Relevanz subjektiver Rechte ermöglicht allerdings einen wei-
tergehenden Einsatz von Risikomanagementsystemen.
3. Verpflichtungen des objektiven Rechts
Die geringere Einbindung von Landesministerien in die Ausführung von Ge-
setzen und die damit einhergehende reduzierte Relevanz subjektiver
Rechte ändert nichts an der uneingeschränkten Verpflichtung von Landes-
ministerien an das objektive Recht. Von Bedeutung ist hier die allgemeine
Verpflichtung zur Förderung des Gemeinwohls,140 zur Erhaltung der Hand-
lungsfähigkeit des Staates (Landes),141 konkret zur Gewährleistung des
parlamentarischen Budgetrechts durch künftige Parlamente.142 Risikoma-
nagementsysteme in Landesministerien dürfen diese zentralen Belange
des objektiven Rechts nicht beeinträchtigen; sie sollen vielmehr darauf ge-
richtet sein, sie zu gewährleisten, jedenfalls aber zu fördern. Diese Argu-
mente sprechen etwa dafür, im Bereich des staatlichen Schuldenmanage-
ments, vor allem wenn Finanzrisiken durch Derivate u.dgl. abgesichert wer-
den sollen, Risikomanagementsysteme einzusetzen.
Dessen ungeachtet wäre es mit der demokratischen Verantwortlichkeit der
Regierung, der Minister und namentlich des Ministerpräsidenten gemäß
Art. 55 und 61 LV gegenüber dem Parlament und letztlich gegenüber dem
Landesvolk nicht vereinbar, wenn Risikomanagementsysteme dazu miss-
braucht werden könnten, die Entscheidungskompetenzen der zuständigen
Amtsträger zu ersetzen oder zu verschleiern. Ein Risikomanagementsys-
tem darf gerade auf Ministerialebene niemals als Argument vorgebracht
werden, um persönliche Zurechenbarkeit zu ersetzen.
140 Vgl. nur BVerfG, Urt. v. 7.11.2017, 2 BvE 2/11, BVerfGE 147, 50 (152 ff. Rn. 266, 271, 275);
Gröpl, Staatsrecht I, 11. Aufl. 2019, Rn. 529 f. 141 Vgl. etwa BVerfG, Beschl. v. 25.9.1992, 2 BvL 5/91 u.a., BVerfGE 87, 153 (179). 142 Vgl. BVerfG, Urt. v. 7.9.2011, 2 BvR 987/10 u.a., BVerfGE 129, 124 (177, 179 f.).
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 62
…
IV. Ergebnis
a) Die Einführung und Anwendung eines Risikomanagementsystems in
Landesministerien ist aufgrund der allgemeinen Leitungskompetenz der
Landesregierung, des Ministerpräsidenten und der Landesminister
grundsätzlich zulässig.
b) Soweit ein Risikomanagementsystem in Rechte des Einzelnen eingrei-
fen kann oder sonst grundlegende Bedeutung für die Landesverwaltung
hat, ist nach dem allgemeinen Vorbehalt des Gesetzes eine hinreichend
bestimmte Regelung in einem formellen Landesgesetz erforderlich.
c) Vorrangiges Bundesrecht, insbesondere bei der Ausführung der Bun-
desgesetze in Landeseigenverwaltung und Landesverwaltung im Bun-
desauftrag, ist zu beachten und kann der landesautonomen Einführung
eines Risikomanagementsystems entgegenstehen.
d) Bei der Einführung und Anwendung eines Risikomanagementsystems
sind insbesondere die rechtsstaatlichen Anforderungen an die Be-
stimmtheit und der Rechtssicherheit zu beachten. Außerdem darf ein
Risikomanagementsystem der Verpflichtung des Landes auf das Ge-
meinwohl und auf die Gewährleistung seiner fortdauernden Handlungs-
fähigkeit nicht zuwiderlaufen, sondern soll diese Belange fördern.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 63
…
Ergebnisse – Zusammenfassung –
1. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass der zuständige Ausschuss des Landtags Nordrhein-Westfalen Prüfaufträge an den Landes-rechnungshof Nordrhein-Westfalen erteilt?
a) Die Rechtsstellung des Landesrechnungshofs als selbständige, nur
dem Gesetz unterworfene oberste Landesbehörde schließt Weisungen
an ihn insbesondere seitens des Landtags oder von dessen zuständi-
gen Ausschüssen aus.
b) Nach dem geltenden § 88 Abs. 2 LHO darf der Landesrechnungshof
den Landtag und dessen zuständige Ausschüsse beraten. Nicht in Be-
tracht kommt dabei allerdings – in Abgrenzung zur genuinen Prüfungs-
tätigkeit des Landesrechnungshofs nach § 88 Abs. 1 LHO – eine Prü-
fung konkreter Sachverhalte in oder bei Behörden, sonstigen Stellen
oder Dritten.
c) Die Beratungsaufgabe des Landesrechnungshofs nach § 88 Abs. 2
LHO unterteilt sich in die selbständige Beratung nach Satz 1 und die
laufende Beratung nach Satz 3 der Vorschrift.
d) Die laufende Beratung nach § 88 Abs. 2 Satz 3 LHO erstreckt sich auf
kleinere, nicht besonders arbeitsaufwendige Fragen der Aufstellung und
Bewirtschaftung des Haushaltsplans sowie der Wirtschaftlichkeit und
Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung. Hierzu ist der Landesrech-
nungshof verpflichtet; insoweit sind „(Prüf-)Aufträge“ des Landtags und
seines zuständigen Ausschusses zulässig.
e) Größere und arbeitsintensivere Ersuchen seitens des Landtags oder
seines zuständigen Ausschusses, die den Rahmen der laufenden Be-
ratung überschreiten, dürfen vom Landesrechnungshof gemäß § 88
Abs. 2 Satz 1 LHO abgelehnt werden, soweit hierfür nachvollziehbare
Gründe bestehen.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 64
…
f) Mit dieser Differenzierung dürfte in der Diskussion zwischen Prüfungs-
und Beratungsermessen sowie Beratungsverpflichtung des Landes-
rechnungshofs ein sowohl bundesrechts- als auch landesverfassungs-
konformer Kompromiss gefunden sein, der auch für die Praxis handhab-
bar ist.
g) Nur zwei deutsche Länder – Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-
Holstein – räumen ihren Parlamenten in Angelegenheiten von besonde-
rer Bedeutung die Befugnis zur Erteilung von Prüfaufträgen an den je-
weiligen Landesrechnungshof ein. Der Übernahme einer entsprechen-
den Vorschrift in nordrhein-westfälisches Landesrecht stünden landes-
verfassungsrechtliche Bedenken entgegen.
2. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dass sich der zuständige Aus-schuss des Landtags Nordrhein-Westfalen während des laufenden Haushaltsjahres mit Fragen der Ausführung des Haushaltsplans befasst?
a) Eine Befassung des zuständigen Ausschusses des Landtags mit Fra-
gen der Ausführung des Haushaltsplans während des Haushaltsjahres
ist mit Rücksicht auf das verfassungsrechtliche Strukturprinzip der Ge-
waltenteilung nur zulässig aufgrund einer spezialgesetzlichen Rege-
lung. Für diese Regelung muss ein besonderer Rechtfertigungsgrund
von verfassungsrechtlichem Gewicht streiten. Insgesamt muss die Be-
teiligung des zuständigen Landtagsausschusses an der Ausführung des
Haushalts die Ausnahme bleiben.
b) Bei einer Gesamtschau dürften die Beteiligungsvorschriften nach ge-
genwärtiger Rechtslage diesen Ausnahmecharakter wahren.
c) Gesetzliche Ausweitungen der Einflussmöglichkeiten des Landtags
oder von dessen zuständigem Ausschuss auf den Haushaltsvollzug
würden grundsätzlich Bedenken aufwerfen. Sie wären allenfalls in ver-
fassungsrechtlich begründeten Ausnahmekonstellationen zulässig.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 65
…
3. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, dem Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen Vorgaben für die Art und Weise seiner Aufga-benerfüllung zu machen?
Vorgaben für die Art und Weise der Aufgabenerfüllung des Landesrech-
nungshofs
a) in Form von Weisungen sind unzulässig,
b) in Form gesetzlicher Regelungen müssen die bundesrechtlichen Maß-
stäbe des Haushaltsgrundsätzegesetzes sowie die landesverfassungs-
rechtlichen Wertungen in Art. 86 Abs. 2 und Art. 87 Abs. 1 und 2 LV be-
achten. Mit Rücksicht auf die verfassungsrechtlich garantierte Rechts-
stellung des Landesrechnungshofs und die Gewaltenteilung als tragen-
des Verfassungsprinzip darf der Landesgesetzgeber hier nur mit äu-
ßerster Vorsicht agieren.
4. Inwieweit ist es rechtlich zulässig, in den Landesministerien ein Risikomanagementsystem einzuführen?
a) Die Einführung und Anwendung eines Risikomanagementsystems in
Landesministerien ist aufgrund der allgemeinen Leitungskompetenz der
Landesregierung, des Ministerpräsidenten und der Landesminister
grundsätzlich zulässig.
b) Soweit ein Risikomanagementsystem in Rechte des Einzelnen eingrei-
fen kann oder sonst grundlegende Bedeutung für die Landesverwaltung
hat, ist nach dem allgemeinen Vorbehalt des Gesetzes eine hinreichend
bestimmte Regelung in einem formellen Landesgesetz erforderlich.
c) Vorrangiges Bundesrecht insbesondere bei der Ausführung der Bun-
desgesetze in Landeseigenverwaltung und Landesverwaltung im Bun-
desauftrag ist zu beachten und kann der landesautonomen Einführung
eines Risikomanagementsystems entgegenstehen.
d) Bei der Einführung und Anwendung eines Risikomanagementsystems
sind insbesondere die rechtsstaatlichen Anforderungen an die Be-
stimmtheit und der Rechtssicherheit zu beachten. Außerdem darf ein
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 66
…
Risikomanagementsystem der Verpflichtung des Landes auf das Ge-
meinwohl und auf die Gewährleistung seiner fortdauernden Handlungs-
fähigkeit nicht zuwiderlaufen, sondern soll diese Belange fördern.
gez. Gröpl
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 67
…
Anhang: Schrifttum
Austermann, Philipp/Waldhoff, Christian, Parlamentsrecht, 2020.
Bertrams, Michael, 50 Jahre Landesrechnungshof Nordrhein-Westfalen, NWVBl 1999, 1 ff.
Blasius, Hans, Der Rechnungshof: Kontrolleur und Informant, DÖV 1993, 642 ff. — Die Aufgaben der Rechnungshöfe im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und
Beratung, NWVBl 1997, 367 ff.
Blasius, Hans, Die Aufgaben der Rechnungshöfe im Spannungsfeld zwischen Kontrolle und Beratung, NWVBl 1997, 367 ff.
Braun Binder, Nadja, Vollautomatisierte Verwaltungsverfahren im allgemeinen Verwaltungsverfahrensrecht?, NVwZ 2016, 960 ff.
Böning, Wolfgang/Mutius, Albert v. (Hrsg.), Finanzkontrolle im repräsentativ-de-mokratischen System, 1990, zit. nach Bearbeiter.
Dittrich, Norbert, Bundeshaushaltsordnung, Kommentar, Werkstand: 1.1.2019.
Dommach, Hermann, Der Reichsrechnungshof während der Amtszeit seines Präsidenten Saemisch (1922 bis 1938), in: Zavelberg, Heinz Günter (Hrsg.), Die Kontrolle der Staatsfinanzen, 1989, S. 72 ff.
Dreier, Horst (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 3. Aufl. 2018, zit. nach Bearbei-ter.
Engels, Dieter, Die Beratungsaufgabe der Rechnungshöfe, in: Wallmann, Wal-ter/Nowak, Karsten/Mühlhausen, Peter/Steingässer, Karl-Heinz (Hrsg.), Mo-derne Finanzkontrolle und öffentlichen Rechnungslegung, 2013, S. 141 ff.
Epping, Volker/Hillgruber, Christian (Hrsg.), Beck’scher Online-Kommentar (BeckOK) Grundgesetz, 43. Edition Stand 15.5.2020, zit. nach Bearbeiter.
Friauf, Karl Heinrich, Der Staatshaushaltsplan im Spannungsfeld zwischen Par-lament und Regierung, 1968.
Giesen, Hans Adolf/Fricke, Ebenhard, Das Haushaltsrecht des Landes Nord-rhein-Westfalen, 1972.
Grawert, Rolf, Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kommentar, 1998.
Gröpl, Christoph (Hrsg.), Bundeshaushaltsordnung/Landeshaushaltsordnungen, Staatliches Haushaltsrecht, Kommentar, 2. Aufl. 2019, zit. nach Bearbeiter.
— Kommentierung von Art. 110, in: Kahl, Wolfgang/Waldhoff, Christian/Walter, Christian (Hrsg.), Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 174. EL September 2015.
— Staatsrecht I, 11. Aufl. 2019.
Grupp, Klaus, Die Stellung der Rechnungshöfe in der Bundesrepublik Deutsch-land, 1972;
— Zum Verhältnis von Landtag und Landesrechnungshof in Nordrhein-Westfa-len, NWVBl 1992, 265 ff.
Heun, Werner, Staatshaushalt und Staatsleitung, 1989.
Heusch, Andreas/Schönenbroicher, Klaus, Die Verfassung Nordrhein-Westfalen (in diesem Rechtsgutachten: Komm. z. LV NRW), 2. Aufl. 2020, zit. nach Be-arbeiter.
Isensee, Josef/Kirchhof, Paul (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundes-republik Deutschland, 3. Aufl., zit. nach Bearbeiter, jeweils mit Angabe von Band und Erscheinungsjahr.
Jarass, Hans D./Pieroth, Bodo, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutsch-land, Kommentar, 15. Aufl. 2018, zit. nach Bearbeiter.
Kempny, Simon, Verwaltungskontrolle, 2017.
Gröpl, Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Haushaltskontrollverfahren in NRW 68
Klein, Franz, Abgabenordnung, Kommentar, 13. Aufl. 2016, 15. Aufl. 2020, zit. nach Bearbeiter.
Körkemeyer, Stephan, Das neue Gesetz über den Landesrechnungshof Nord-rhein-Westfalen, DÖV 1996, 160 ff.
Löwer, Wolfgang/Tettinger, Peter J., Kommentar zur Verfassung des Landes Nordrhein-Westfalen, 2002, zit. nach Bearbeiter.
Mangoldt, Hermann v. (Begr.)/Klein, Friedrich/Starck, Christian (Fortf.)/Huber, Peter M./Voßkuhle, Andreas (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 7. Aufl. 2018, zit. nach Bearbeiter
Maunz, Theodor/Dürig, Günter (Begr.), Grundgesetz, Loseblattkommentar, Werkstand: Februar 2020, zit. nach Bearbeiter.
Maurer, Hartmut/Waldhoff, Christian, Allgemeines Verwaltungsrecht, 19. Aufl. 2017.
Miß, Holger, Die Unabhängigkeit von Bundesrechnungshof und Abschlußprüfern vor dem Hintergrund paralleler Prüfung und Beratung, 2006.
Neumark, Fritz, Der Reichshaushaltsplan, 1929.
Piduch, Erwin A., fortgeführt von Heller, Karl-Heinz u.a., Bundeshaushaltsrecht, Kommentar, 2. Aufl. Werkstand: Feb. 2018, zit. nach Bearbeiter.
Roedig, Guido, Zur Problematik der Mitwirkung des Bundesrechnungshofs bei der Planung und Durchführung von Verwaltungsaufgaben, Diss. jur. Köln, 1966.
Rogge, Philipp Laurenz, Staatliche Finanzkontrolle freier Wohlfahrtspflege, 2001.
Sachs, Michael (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 8. Aufl. 2018, zit. nach Bear-beiter.
Schmidt-Bleibtreu, Bruno/Klein, Franz/Hofmann, Hans/Henneke, Hans-Günter, Kommentar zur Grundgesetz, 14. Aufl. 2018, zit. nach Bearbeiter.
Schwarz, Otto, Formelle Finanzverwaltung in Preußen und im Reich, 1907.
Sigg, Wolfgang, Die Stellung der Rechnungshöfe im politischen System der Bun-desrepublik Deutschland, 1983.
Stern, Klaus, Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. II, 1980.
Störring, Jens Michael, Die Beratungsfunktion des Bundesrechnungshofes und seines Präsidenten, 2013.
Störring, Jens Michael, Die Beratungsfunktion des Bundesrechnungshofes und seines Präsidenten, 2013.
Vialon, Friedrich Karl, Streitfragen der öffentlichen Finanzkontrolle, FinArch Bd. 22 n.F., 1962/63, 1 ff.
Wallmann, Walter/Nowak, Karsten/Mühlhausen, Peter/Steingässer, Karl-Heinz (Hrsg.), Moderne Finanzkontrolle und öffentliche Rechnungslegung, Denk-schrift Manfred Eibelshäuser, 2013, zit. nach Bearbeiter.
Wieland, Joachim, Rechnungshofkontrolle im demokratischen Rechtsstaat, DVBl 1995, 894 ff.
Wittrock, Karl, Möglichkeiten und Grenzen der Finanzkontrolle. Das Verhältnis des Bundesrechnungshofes zum Bundestag, ZParl 1982, 209 ff.
Zavelberg, Heinz Günter, 275 Jahre staatliche Rechnungsprüfung in Deutsch-land, in: ders. (Hrsg.), Die Kontrolle der Staatsfinanzen – Geschichte und Gegenwart – 1714–1989, Festschrift zur 275. Wiederkehr der Errichtung der Preußischen General-Rechen-Kammer, 1989, S. 43 ff.