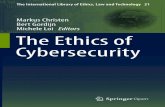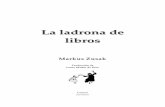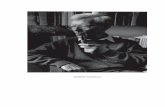Oliver FRIES, Die Gertrudskirche. Ergebnisse einer Bauforschung. In: Bettina Marchart u. Markus...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Oliver FRIES, Die Gertrudskirche. Ergebnisse einer Bauforschung. In: Bettina Marchart u. Markus...
K A P I T E LDIE GERTRUDSKIRCHE
ERGEBNISSE EINER BAUFORSCHUNG
von Oliver Fries
12.3
Zum Forschungsstand 475
Zusammenfassung der Baugeschichte 477
Der Karner 496
Fazit 500
Typologisch gesehen stellt das Areal mit der Gertrudskirche, dem Karner, dem um-gebenden Friedhof und der mit wehrhaften Elementen ausgestatteten Kirchhofmauer – direkt am hochmittelalterlichen Torweg der Burg gelegen – einen Art Vorburgbereich dar.1 Bedeutende Teile der Kirchhofmauer gehören aufgrund des charakteristischen, der Einzellage verpflichteten Bruchsteinmauerwerks der romanischen Stilepoche an und stellen als Fortsetzung des Berings der Hochburg eine eigene Umwehrung des Kirch-hofareals dar (Abb. 3). Nach Karl Kafka handelt es sich bei den ruinösen Gebäudeteilen im Westen der Kirchhofmauer, mit dem Einbau der rezenten Toilettanlage, um den ehe-maligen Pfarrhof.2 Vom Ort her erreicht man die Gertrudskirche unter anderem über einen Kalvarienberg, der beim östlichen Tor der Kirchhofmauer endet. Von hier führt eine ehemals gedeckte Verbindungstreppe zur Hochburg, die in den Jahren 2011/2013 restauriert bzw. wiederhergestellt wurde.
Zum ForschungsstandAnlässlich der Arbeiten zur Österreichischen Kunsttopographie „Die Denkmale des politischen Bezirks Horn“, die 1911 vorgelegt wurde, erhielt die Gertrudskirche erst-mals eine ausführliche Würdigung in Bezug auf ihre Bau- und Ausstattungsgeschichte. Hier heißt es zur mittelalterlichen Baugeschichte: Ursprünglich spätromanische Anlage
1) Im übertragenen Sinn ist die Situation von Gars mit dem ausgedehnten Kirchenbereich vergleichbar mit der Anlage von Stiefern. Vgl. Gerhard Reichhalter, Die Burg von Stiefern in Niederösterreich. Burgenbau und Herrschaftsräume der Herren von Stiefern-Gaaden-Arnstein. In: Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 20 (Wien 2004) S. 179-189. Zur Problematik von Kirchen in Burgbereich bzw. der Burg-Kirchen-Anlagen vgl. zuletzt Gabor Tarcsay, Burgkirche, Burg-Kirchen-Anlage, umwehrte Kirche – die Friedhofsmauer als Indiz für…? In: Michaela Zorko, Friedersbach. Eine Waldviertler Landpfarre und ihre Bauten. Mit Beiträgen von Friedel Moll, Gabor Tarcsay u. Ralf Wittig = Zwettler Zeitzeichen 15 (Zwettl 2013) S. 16-21.2) Karl Kafka, Gars-Thunau, Pfarrkirche St. Gertrude von Nivelles. In: Wehrkirchen Niederösterreichs I (Wien 1969) S. 60ff.
Die eigentliche und ursprüngliche Pfarrkirche von Gars am Kamp ist jener zu Ehren der hl. Gertrude geweihte Kirchenbau (Fig. 1), der sich auf einer abgesetzten Terrasse südlich der Burg Gars erhebt (Abb. 1, 2).
Das weitläufige Areal der sogenannten Gertrudskirche wird im Süden von einer bis zu 12 m hohen Futtermauer mit stark geböschten Strebepfeilern umgürtet, deren Fortsätze im Westen und Osten an den äußeren Bering der Hochburg anschließen.
475
GERTRUDSKIRCHE
474
K APITEL 12.3
Fig. 1: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude und Karner, Baualterplan. | © Entwurf und Ausführung: Oliver Fries
Abb. 1: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Ansicht von Süden mit Karner. | © Oliver Fries
gebäuden bzw. zu Bauten in der nahen Region aufzuzeigen.5 In diesem Zusammenhang wurde von ihm auch die Gertrudskirche bearbeitet, er lieferte somit zumindest für Gars einen Beitrag zur Beziehung der einzelnen Bauteile der Pfarrkirche zueinander.
Wilhelm Zotti widmete der Gertrudskirche in seinem 1986 erschienenen Band zur kirchlichen Kunst in Niederösterreich nördlich der Donau einen mehrseitigen Beitrag zur Bau- und Ausstattungsgeschichte.6 Zuletzt beschäftigte sich Ilse Schopf im Jahr 2000 mit der Baugeschichte der Gertrudskirche.7 Sie bemühte sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit vor allem um die Klärung der mittelalterlichen Baugeschichte.8
Zusammenfassung der BaugeschichteIm Rahmen der Vorarbeiten zum vorliegenden Heimatbuch ergab sich auch die Mög-lichkeit, die Baugeschichte der Gertrudskirche nochmals mit den Methoden der histo-rischen Bauforschung zu durchleuchten. Vor allem die spätmittelalterlichen Bauphasen werden noch Grundlage für zukünftige Diskussionen sein. Die Nachteile, die sich bei der bauhistorischen Erforschung von verputzten Baukörpern ergeben, sind allgemein bekannt. So liegen Mauerstrukturen und Baufugen verborgen – die Baugeschichte lässt sich nur indirekt erschließen oder Zusammenhänge bleiben überhaupt unerkannt.9
Der romanische Gründungs-bau – um/vor 1130Das Langhaus, eine dreischiffige Staffelhalle, integriert im Westen die baulichen Reste des Grün-dungsbaus, mit einem Turm in Form eines Giebel- bzw. Dachrei-ters (Abb. 4). Die Fülle an hoch-mittelalterlichen Baubefunden lässt den romanischen Ursprungs-bau – zumindest im Westen – sehr gut rekonstruieren.
5) Gerhard Seebach, Stift Altenburg, Studien zur Baukunst der Benediktiner im Mittelalter, Diss. Universität Wien (Wien 1986) I/1 203ff., II/2 142 ff. und I/1 Fig. 43a.6) Wilhelm Zotti, Kirchliche Kunst in Niederösterreich. Diözese St. Pölten. Bd. 2. Pfarr- und Filialkirchen nördlich der Donau (St. Pölten/Wien 1986) S. 91-95.7) Ilse Schopf, Die Gertrudskirche von Gars/Thunau. Bauhistorische Untersuchnung, Dipl. Universität Wien (Wien 2000) bzw. Ilse Schopf, St. Gertrude, die mittelalterliche Pfarrkirche von Gars/Thunau. In: Das Waldviertel 51/4 (2002) S. 377-397.8) Bei einer nicht unbeachtlichen Anzahl an Baufugen, die sie in ihrer Diplomarbeit beschreibt, handelt es sich lediglich um Setzungsfugen!9) Vgl. Ronald Woldron u. Markus Jeitler, Schloss Ulrichskirchen – eine Baugeschichte. In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich 66-68, 2000-2002 (St. Pölten 2006) S. 387-433, hier S. 387.
um die Mitte des XIII. Jhs.; die Westfassaade enthielt vielfache Details von diesem Baue, bei dem der derbe Turm, wie sich aus seinen gegen O. gerichteten Fenstern ergibt, mit einem viel größeren Teil freistand als jetzt und das flachgedeckte Langhaus weit überrag-te. Auch das derbe, eingewölbte, dreischiffige Langhaus zeigt Reminiszenzen an die ur-sprüngliche Anlage, der um die Mitte des XIV. Jhs. oder wenig später der von Nebenchören begleitete Mittelchor zugefügt wurde.3 Dies führte zur lange vertretenen Meinung, dass der „Westturm“ an drei Seiten freistand und erst im Zuge von Um- und Ausbauten in das Langhaus integriert wurde.4
Derzeit sind keinerlei Urkunden bekannt, die direkt auf eine Bautätigkeit im Mittelalter Bezug nehmen. Daher ist vor allem die historische Bauforschung gefordert, neue Er-kenntnisse ans Licht zu bringen. Gerhard Seebach war es, der 1986 im Rahmen seiner Arbeit über die mittelalterliche Anlage von Stift Altenburg versuchte, unter anderem über den Vergleich von Steinmetzzeichen eine Beziehung unter den einzelnen Kloster-
3) Max Dvořák (Red.), Österreichische Kunsttopographie 5, Die Denkmale des politischen Bezirks Horn, hrsg. von der k.k. Zentral-Kommission für kunst- und historische Denkmale (Wien 1911) S. 528-547.4) Vgl. Rudolf Pühringer, Denkmäler der früh- und hochromanischen Baukunst. In: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. 70 (Wien 1931) S. 55; Adalbert Klaar, Kirchenbaukarte. In: Romanische Kunst in Österreich, Ausstellungskatalog (Krems 1964) S. 274; Hans Heppenheimer, Gars am Kamp, St. Gertrud (St. Pölten 1975) S. 3; Karl Kubes, Glasmalerei aus der Gertrudskirche in Gars. In: Die Kuenringer. Das Werden des Landes. Ausstellungskatalog zur Niederösterreichischen Landesausstellung in Stift Zwettl vom 16. Mai bis 26. Oktober 1981 (Wien 1981) S. 405; Rudolf Koch, Die Entwicklung der romanischen Westturmanlage in Österreich. In: Das Münster, Zeitschrift für christliche Kunst- und Kunstwissenschaft 42 (München/Zürich 1989) S. 104; Wilhelm Zotti, Kirchliche Kunst in Niederösterreich, Diözese St. Pölten, Bd. 2, Pfarr- und Filialkirchen nördlich der Donau (St. Pölten/Wien 1986) S. 91f.; Franz Eppel, Das Waldviertel, seine Kunstwerke, historische Lebens- und Siedlungsformen (Salzburg 91989) S. 220; Dehio-Handbuch, Die Kunstdenkmäler Österreichs: Niederösterreich nördlich der Donau (Wien 1990) S. 1172.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
476 477
Abb. 2: Wenzel Czerwenka, Alte Kirche von Gars am Kamp, 1879. Die Ansicht zeigt eine rundbo-gige Werksteinrahmung des romanischen Hauptportals. | © NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 30.407
Abb. 3: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, östlicher Abschnitt der Kirchhofmauer mit roma-nischen Mauerstrukturen. | © Oliver Fries
Abb. 4: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, An-sicht der Westfassade. | © Oliver Fries
Im Erdgeschoß des Turms findet sich das ursprüngliche Westportal, dessen Laibungen durch Orthostaten gebildet werden (Abb. 5). Dieses Portal wurde noch im Hochmit-telalter – der Mauertechnik zufolge in der ersten Hälfte bzw. um die Mitte des 13. Jahr-hunderts – zu einem Trichterfenster abgemauert. Das Kreuzgratgewölbe dieser kleinen Torhalle gehört zum Gründungsbau und setzt über Ecklisenen an. Gegen Osten, zum Kirchenschiff hin, öffnete sich der Erdgeschoßraum mittels eines weiten Rundbogens aus sorgfältig behauenen Werksteinen, der zu einem kleinen Durchgang abgemauert wurde (Abb. 6).10 Das erste Obergeschoß öffnete sich gegen Norden, Süden und gegen das Kirchenschiff im Osten durch mit Werksteinen gefasste weite Rundbögen (Abb. 7). Die Rundbögen setzen über gekehlte Kämpfer an, die sowohl im Inneren des Turms als auch im Kirchenraum zu beobachten sind (Abb. 8, 9). Die Kämpfer indizieren für den Gründungsbau eine über seine ursprüngliche Breite reichende Westempore, die sich gegen den Sakralraum durch weite Rundbögen öffnete (Abb. 10). Der Turm war so-mit Teil einer komplexen Emporenanlage und trat dachreiterartig in Erscheinung. Eine vergleichbare Situation mit dreigliedriger Westempore findet sich in der Propsteikirche von Zwettl, die trotz barocker Veränderung zum romanischen Originalbestand des Ge-bäudekomplexes gehört.11
10) Die Fugen zwischen den einzelnen Werksteinen des Rundbogens weisen eine Gestaltung mittels Kellenstrich auf. Die von Schopf geäußerte Annahme, dass das gegenwärtige Kreuzgratgewölbe anlässlich der Vermauerung des Westportals und des Rundbogens im Osten eingestellt wurde, ist nicht haltbar. Auch finden sich keine Baufugen in der Nord- und Südmauer, die eine Rundbogenöffnung hier indizieren würde. Vgl. Schopf, Studien (wie Anm. 7) S. 26 bzw. Schopf, St. Gertrud (wie Anm. 7) S. 381.11) Vgl. Thomas Kühtreiber, Studien zur Baugeschichte des Gebäudekomplexes auf dem Zwettler Probsteiberg. Die Ergebnisse der Bauuntersuchung 1998. In: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich 69-71, 2003-2005 (St. Pölten 2007) S. 309-385, bes.
Der Zugang zur Empore erfolgte – ähnlich wie in Zwettl – über einen Hocheingang in der Westfassade (vgl. Abb. 4).12 Ursprünglich schloss die Empore im ersten Ober-geschoß des Turms mit einer flachen Balkendecke ab, von der sich die Köpfe der ab-geschlagenen Balken noch im Mauerwerk des Turms befinden. Diese liegen jedoch derart ungünstig, dass sie derzeit nicht für eine dendrochronologische Untersuchung in Frage kommen.13 Diese Geschoßdecke wurde für den Einbau eines Gewölbes in ca. 6 m über dem heutigen Niveau des Raumes entfernt.
S. 330-366.12) Dieser Hocheingang war wohl über eine hölzerne Freitreppe zu erreichen.13) Die in situ befindlichen Reste der originalen Balken werden von der gegenwärtigen freitragenden Geschoßdecke verstellt, sodass eine Probenentnahme nur unter besonderem Aufwand und unter teilweisem Abbau der Decke möglich wäre.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
478 479
Westturm
vermauerterRundbogen
Abb. 7: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, Obergeschoßkammer, Blick gegen den vermauerten Rundbogen in der Ostmauer, mit Altarmensa.Abb. 8: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, Obergeschoßkammer, romanische Kämpferzone. | © Oliver Fries
Abb. 5: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, Erdgeschoßkammer, Blick gegen das vermauerte Westportal des Gründungsbaus. Der Sturz der Innenlaibung wird von einer nur rund 10 cm starken Steinplatte gebildet.Abb. 6: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, Erdgeschoßkammer, Blick gegen den vermauerten Rundbogen zum Mittelschiff. | © Oliver Fries
Abb. 9: Gars am Kamp, Pfarr-kirche hl. Gertrude, Westem-pore, Blick gegen die roma-nische Kämpferzone an der Nordost-Ecke des Westturms.
Abb. 10: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Mittelschiff, Blick gegen des Westturm. Die strichlierten Linien skizzieren die roma-nische Westempore mit ihren Bogenstellungen. | © Oliver Fries
Die Abdrücke der Gewölbe sind an den Wänden noch gut ablesbar (Abb. 11). Zusätzlich zeichnet eine geglättete Putz-fläche mit „Quadermalerei“ den Verlauf des Gewölbes nach. In diesem Bereich sitzt in einer nachträglich ausgebroche-nen Nische eine monolitische Lochfigur mit Fünfpass. Die Laibung des Fensters wird durch Strahlenmalerei akzentu-iert (Abb. 12). Zusätzlich wurde der ehemals gewölbte Raum durch ein ebenfalls nachträglich in die Westwand gebroche-nes Rundbogenfenster mit Doppeltrichterlaibung belichtet. Der Einbau des Gewölbes und das Einbrechen der Fenster erfolgten im Zuge einer spätromanischen/frühgotischen Bauphase. Zu dieser Bauphase gehört auch die Altarmensa in der Nordost-Ecke des Raumes. Möglicherweise diente der Raum im ersten Obergeschoß als Privatkapelle bzw. als Archiv- und Bergeraum (Abb. 13). Das dritte Obergeschoß des Turms bildet mit seiner Bifore gegen Westen das ehem.
Läutgeschoß. Idente Biforen bzw. Schallfenster in der Nord-, Süd- und Ostmauer wur-den in einer jüngeren Bauphase, wohl im Zuge des Hochziehens der Hochschiffwände um/nach 1411 (Abb. 14) vermauert. Die Breite des Gründungsbaus entsprach, ähnlich wie in der Propsteikirche in Zwettl, der dreifachen Breite des Turmes.14
14) Der von Henriette Liebhart-Ulm geäußerte Vorschlag, die Breite des ursprünglichen Langhauses wäre mit dem Verlauf der Mittelschiffwände gleichzusetzen, erscheint dem Verfasser als nicht schlüssig. Vgl. Henriette Liebhart-Ulm, Babenberger Pfarrarchitektur im Einflussbereich der Diözese Passau, Dipl. Universität Wien (Wien 1999) S. 73ff.
Der Grundriss des hochmittelalterlichen Kirchenbaus zählt zum Typus einer einfachen Saalkirche mit eingezogenem Chorquadrat und halbrunder Apsis (Abb. 15) – ähnlich der Propsteikirche in Zwettl bzw. die Pfarrkirche von Altweitra (pB Gmünd).15 Einen ähnlichen Grundriss besitzen mehrere Sakralbauten im Waldviertel, so die Primärbau-ten von Horn St. Stephan16, Röhrenbach (pB Horn)17, Weikertschlag (pB Waidhofen/Thaya)18, Niklasberg (pB Waidhofen/Thaya)19, Schiltern (pB Krems-Land)20 und Frie-dersbach (pB Zwettl)21.
DatierungFür eine etwaige dendrochronologische Beprobung kommen vor allem die in situ be-findlichen Balkenköpfe von zwei primären Geschoßdecken in Frage, die jedoch von
15) Kühtreiber, Probsteiberg (wie Anm. 11) S. 336.
16) Die im aufgehenden Mauerwerk erhaltenen baulichen Reste gehören zum Gründungsbau Mitte des 11. Jahrhunderts – Datierung nach Gerhard Seebach, Zeitspezifische Strukturen des mittelalterlichen Mauerwerks. In: Burgen und Ruinen = Denkmalpflege in Niederösterreich 12 (St. Pölten 1993) S. 19-23, hier S. 20. Anlässlich einer Innenrenovierung erfolgte eine archäologische Untersuchung durch Gustav Melzer. Vgl. Fundberichte aus Österreich 22 (1983) S. 19-27.17) Der Primärbau datiert um 1100 bzw. vor 1256. Die Frage, ob eine Apsis als Ostabschluss bestand, könnte hier nur durch etwaige archäologische Untersuchungen geklärt werden. Vgl. Oliver Fries, Die mittelalterliche Baugeschichte der Pfarrkirchen Röhrenbach und Strögen, unpubl. Forschungsbericht (Krems 20102) S. 10-14.18) Beide Bauten datieren in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts. Vgl. Oliver Fries, Neue Erkenntnisse zur mittelalterlichen Baugeschichte der Pfarrkirchen von Weikertschlag und Niklasberg. In: Geraser Hefte 63 (2009) S. 15-25, hier S. 17-19.19) Fries, Baugeschichte (wie Anm. 18) S. 22-24.20) Auch im Fall von Schiltern konnte nicht im Konkreten geklärt werden, ob eine Apsis als Ostabschluss bestand. Der Primärbau datiert vorsichtig um 1200/1260. Vgl. Oliver Fries, Historische Bauforschung in Kohärenz von Geistes- und Naturwissenschaften. Die bauhistorische Untersuchung der Pfarrkirche hl. Pankrazius in Schiltern (pB Krems), Jänner 2011 bis April 2012. In: Das Waldviertel 62/2 (2013) S. 155-177.21) Der Primärbau (Anlage I) konnte anhand eines Rüstholzes um 1169 (d) datiert werden. Vgl. Zorko, Friedersbach (wie Anm. 1) S. 26.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
480 481
V.l.n.r.: Abb. 14: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, romanisches Läuthaus, Blick gegen die Ostmauer mit vermauerter Bifore. Abb. 15: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, hypothetische Rekonstruktion der ersten Bau-phase (um/vor 1130). | © Oliver Fries
Abb. 11: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, zweites Obergeschoß, Fensternische mit Lochfigur. Abb. 12: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, zweites Obergeschoß, Detailansicht der Fensternische mit Strahlenmalerei. | © Oliver Fries
Abb. 13: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, Obergeschoß-kammer, Altarmensa in der Nordost-Ecke. | © Oliver Fries
den gegenwärtigen Geschoßdecken – einer teilweise freitragenden Konstruktion – gänzlich verdeckt werden und ohne invasiven Eingriff nicht zugänglich sind. Das im Turmmauerwerk vorhandene Buchen- und Eichenholz der im Mauerwerk verbliebe-nen Gerüststangen eignet sich aufgrund der wenigen Jahrringe und des schlechten Er-haltungszustandes des Holzes nicht für eine dendrochronologische Untersuchung. So müssen der stilistische Vergleich der bauplastischen Ausstattung, die Beurteilung der Mauertechnik sowie historische Überlegungen zur Datierung des Gründungsbaus ins Treffen geführt werden.
Ein wesentliches Datierungskriterium stellt neben den Architekturdetails vor allem die Struktur des Mauerwerks dar. Die Beurteilung der Mauertechnik erscheint hier als problematisch, da nur das Primärmauerwerk im Turminneren frei-liegt und nicht unbedingt der Versatztechnik der Außenseite entsprechen muss. Die Mauertechnik charakterisiert sich durch das hammerrechte, der Einzellage verpflichtete Bruchsteinmauerwerk mit flächigem Pietra-Rasa-Verputz. Partiell fin-den sich opus-spicatum-artige Einschübe. Der feinsandige, hellweiße Mörtel besitzt eine hohe Festigkeit – überschüssiger Fugenmörtel wurde mit dem Rücken der Kelle dellig verstrichen. Ein durchgehend geritztes Fugennetz findet sich nicht. Zumeist sind die Lagerfugen durch ins Ondulieren geratene Ritzungen gestaltet (Abb. 16).
Eine Betonung der Stoßfugen durch Kellenritzungen finden sich kaum. Eine derartig inkonsequente Oberflächengestaltung ist für die ursprüngliche Fassade nicht vorstell-bar, weshalb das sichtbare Mauerwerk kaum repräsentativ für den hochmittelalter-lichen Primärbau sein kann. Trotzdem soll hier ein Vergleich des Mauerwerks und seines Versatzes angestellt werden. Vergleichbare Mauerstrukturen findet sich in den oberen Bereichen der romanischen Latrinenanlage von Stift Zwettl, die nach 1137 bzw. vor 1156 datiert (Abb. 17).22 Auch das Mauerwerk des 1135 dendrodatierten Pri-märbaus der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt in Raabs an der Thaya zeigt Analogien (Abb. 18).23 Derart vergleichbares Mauerwerk findet sich nicht auf Burg Gars, auch die
22) Mario Schwarz, Zwettl (NÖ.), Zisterzienserabtei, Kapitelsaal, Kat. Nr. 49. In: Hermann Fillitz (Hg.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich: Früh- und Hochmittelalter (München 1998) S. 258-260.23) Oliver Fries, Robert Kuttig u. Christiane Wolfgang, „Castrum quod dicitur Schala“ – Von der hochmittelalterlichen Burg zum modernen Ausstellungszentrum. In: Peter Aichinger-Rosenberger (Bearb.), Die Schallaburg. Geschichte, Archäologie, Bauforschung (Weitra 2011) S. 177-284, hier S. 222, Anm. 141.
romanischen Mauerstrukturen der Kirchhofmauer können nicht zum Vergleich her-angezogen werden. Das primär im Mauerwerk befindliche romanische Biforenfenster ist die einzige architektonische Detailform, die für einen breiten stilistischen Vergleich herangezogen werden kann (Abb. 19). Die schlanke Mittelsäule besitzt ein einfaches Würfelkapitell mit Halsring und halbrunde glatte Schildflächen (Abb. 20). Die attische Basis mit Schaftring verfügt über kräftige Eckknollen (Abb. 21). Das Heranziehen der Säulenbasis als Datierungshilfe ist im Fall von Gars, entgegen anderer Forschungsmei-
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
482 483
Abb. 16: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Detail der Oberflächen-gestaltung mit pietra rasa-artigem Verputz. | © Oliver Fries
Oben v.l.n.r.: Abb. 17: Stift Zwettl, Nordmauer der Latrinenanlage, Burchsteinmauerwerk mit pietra rasa-artiger Oberflächengestaltung (nach 1137/vor 1156). Abb. 19: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, romanisches Läuthaus, Bifore in der Westmauer.Unten v.l.n.r.: Abb. 18: Raabs an der Thaya, Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt auf dem Berge, Ansicht der Südmauer des Primärbaus, Bruchsteinmauerwerk mit pietra rasa-artiger Oberflä-chengestaltung (1135 d). Abb. 20: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Kapitell der romanischen Bifore. Abb. 21: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Basis der romanischen Bifore. | © Oliver Fries
nung, wenig zielführend.24 Hingegen lässt sich das Kapitell besonders mit einem Ka-pitell einer freigelegten Bifore am Stiftshospiz St. Gertrude in Klosterneuburg – eine Gründung Markgraf Leopolds III. um 1125 – vergleichen.25 Wie „langlebig“ solche einfachen Formen sind, beweisen die ähnlich gestalteten Kapitelle der 1174 geweih-ten Krypta von Gurk (pB St. Veit/Glan).26 Aber auch das Kapitell der originalen Bi-fore in der Ostfassade des nach Patrick Schicht um 1200 errichteten Saalbaus auf Burg Hardegg (pB Hollabrunn) zeigt beinahe eine idente Gestaltung.27
Die Pfarre Gars geht aus einer Eigenkirche der österreichischen Markgrafen hervor. Sie gehörte zu den 13 Eigenpfarren, auf die Leopold III. gegenüber dem Passauer Bischof Reginmar 1135 verzichtete – dies ist auch gleichzeitige die Erstnennung und liefert somit einen terminus ante quem für die Errichtung des Gründungsbaus der Kirche.28 In Anbetracht der genannten Vergleichsbeispiele sowie der historischen Zusammen-hänge, vor allem von Gars zu Klosterneuburg, wird eine Datierung „um bzw. vor 1130“ vorgeschlagen.
Spätromanische Bautätigkeit – um 1230/1260Neben den bereits erwähnten spätromanischen Fenstereinbrüchen im ersten Oberge-schoß des Turmes findet sich in der Westfassade auch ein Radfenster (Abb. 22). Ana-logien zeigt etwa ein Radfenster der spätromanischen Westempore des Stephansdomes in Wien, das um 1230/1240 datiert.29
Falls sich jenes von Gars in situ befindet, dann könnte dieses gleichfalls wie die übri-gen spätromanischen bzw. frühgotischen Lochfiguren zur Belichtung der Westempore gedient haben (Abb. 23, 24, 25). Die Beurteilung des Langhauses erweist sich aufgrund
24) Rudolf Pühringer maß den Eckknollen von romanischen Basen als Datierungshilfe großen Wert bei. Aufgrund des gesetzmäßigen Stilwandels sah er eine kontinuierliche Entwicklung. Vgl. Rudolf Pühringer, Denkmäler der früh- und hochromanischen Baukunst. In: Denkschriften der Akademie der Wissenschaften in Wien, Bd. 70 (Wien 1931) S. 18f.25) Vgl. Kurt Bleicher, Das ehemalige Stiftshospiz bei St. Gertrud in Klosterneuburg (Leopoldstraße 31). In: Denkmalpflege in Niederösterreich 22 (St. Pölten 1999) S. 42f.26) 1174 erfolgt die Weihe der Krypta, anlässlich der Übertragung der Gebeine Hemmas von Gurk dorthin. Vgl. Robert Koch, Gurk (Ktn.), Pfarr- und ehemalige Domkirche Mariae Himmelfahrt, Kat. Nr. 41. In: Fillitz, Geschichte bildende Kunst (wie Anm. 22) S. 249-252.27) Patrick Schicht, Die Burg Hardegg, Entstehung – Gestalt – Geschichte der bedeutendsten Grafenburg Niederösterreichs (Retz 2008) S. 109-120, vgl. die Abb. auf S. 116.28) BUB 1, Nr. 674 bzw. BUB 4, Nr. 674. Vgl. Heide Dienst, Niederösterreichische Pfarren im Spannungsfeld zwischen Bischof und Markgraf nach dem Ende des Investiturstreites. In: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 34 (Wien 1981) S. 1-44, hier 2ff., 19ff. Original: StiA Klosterneuburg, AUR 1135. 29) Vgl. Johann J. Böker, Der Wiener Stephansdom. Architektur als Sinnbild für das Haus Österreich (Salzburg/Wien/München 2007) S. 30-44 bzw. Günther Buchinger, Markus Jeitler, Paul Mitchell u. Doris Schön, Die Bautätigkeit von St. Stephan bis in das 13. Jahrhundert. Analyse der Forschungsgeschichte und Neuinterpretation unter dem Blickwinkel rezenter Methodik, In: Nikolaus Hofer (Hg.), Archäologie und Bauforschung im Wiener Stephansdom. Quellen zur Baugeschichte des Domes bis zum Ende des 13. Jahrhunderts (Wien 2013) S. 315-401, hier S. 374.
mehrerer Faktoren als durchaus problematisch, vor allem da relevante bauhistorische Aufschlüsse wie Baufugen gänzlich unter deckenden Putzschichten liegen. Die sicht-baren Befunde im Dachraum beziehen sich auf eine dendrochronologisch datierte Aufzonung der Langhauswände um/nach 1411.30 Gerhard Seebach konnte durch die Aufnahme von Steinmetzzeichen aufzeigen, dass das frühgotische Nord- und Süd-portal sowie die lanzettartigen Spitzbogenfenster zur selben Bauphase gehören wie die Errichtung der Staffelchoranlage um 1290/1320. Ilse Schopf vermerkte in ihrer
30) Das Mauerwerk dieser Aufzonung stößt über einer vertikalen Baufuge gegen den frühgotischen Chorbau.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
484 485
Oben v.l.n.r.: Abb. 22: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westfassade, spätromanisches/frühgotisches Radfenster. Abb. 23: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westfassade, spätromanische/frühgotische Lochmaske, ausgebrochenes Radfenster (?).Unten v.l.n.r.: Abb. 24: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westfassade, spätromanische/frühgotische Lochmaske. Abb. 25: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westfassade, spätromanisches/frühgotisches Passfenster. | © Oliver Fries
Arbeit, dass die gequaderte Nordwest-Ecke des Nordchors ca. 1,25 m tiefer zieht als die Traufe des nördlichen Seitenschiffs. Schopf wies erstmals darauf hin, dass der Südchor auf einer älteren Langhausaußenmauer aufsitzt.31 Laut ihr war bis zur Renovierung in den Jahren 1972 bis 1975 eine horizontale Zäsur an der Langhausnordmauer erkennbar, welche sie als ehemaligen Traufenho-rizont interpretierte.32 Eben diese Traufe schnei-det jedoch die (heute weitgehend vermauerten) Lanzettfenster, sodass Schopf zu der Ansicht kam, dass zumindest die Langhausaußenmauern einem spätromanischen Langhausneubau angehören.33 Während das spätromanische Radfenster für eine Zeitstellung noch vor 1250 steht, so sprechen die frühgotischen Detailformen des Langhauses, wie die Mittelschiffarkaden und die Lochfiguren bzw. Passfenster in der Westfassade.
Historischer KontextFür etwaige spätromanische bzw. frühgotische Bautätigkeit ist der zwischen 1246 und 1271 genannte Magister Gerhard als Pfarrer von Gars von großem Interesse, dessen Titulatur ihn als Absolvent höherer Studien ausweist. Er war auch Pfarrherr von Wien, Kaplan des Apostolischen Stuhls sowie Domherr von Passau.34 Unter Magister Gerhard werden die Pfarren Gars und Eggenburg das erste Mal in einer Hand vereinigt erwähnt. Er war auch ein Vertrauter König Ottokars II. und stand unter dessen Schutz.35 Ihm folgte Magister Heinrich, der Notar und späterer Protonotar König Ottokars II. war und den Beinamen Italicus trug.36 1283 gewährte Bischof Gottfried von Passau den Be-suchern der Pfarrkirche von Gars einen Ablass von vierzig Tagen.37 Magister Heinrich behielt die Pfarre bis spätestens 1307.38
31) Der entsprechende Befund ist im Dachraum der Süd- bzw. Johanneskapelle sichtbar. Vgl. Schopf, Studien (wie Anm. 7) S. 40-42.32) Schopf, Studien (wie Anm. 7) S. 40f.33) Im Zuge der aktuellen Bauanalyse konnte der Verfasser die These Schopfs weder bestätigen noch widerlegen.34) Vgl. Alois Plesser, Das religiöse Leben im Zeitenwandel, Kirchen und Klöster. In: Franz Lukas u. Friedrich Moldaschl (Hg.), Heimatbuch des Bezirks Horn (Horn 1933) S. 338-375, hier S. 342.35) Vgl. Alois Plesser, Beiträge zur Geschichte der Pfarre Gars am Kamp. In: Geschichtliche Beilagen zum St. Pöltner Diözesanblatt 8 (St. Pölten 1907) S. 445-682, hier S. 446ff.36) Plesser, Beiträge (wie Anm. 35) S. 457.37) Plesser, Beiträge (wie Anm. 35) S. 459. Laut Plesser soll sich zum Zeitpunkt seiner Arbeiten eine Abschrift von 1535 im Stadtarchiv (sic!) Eggenburg befunden haben. 38) Vgl. Plesser, Beiträge (wie Anm. 35) S. 453.
InterpretationDie ältesten Wandmalereien im Langhaus wer-den von Elga Lanc um die Mitte des 14. Jahrhun-derts datiert und ergeben so einen terminus ante quem für die Errichtung der Langhausmauern.39 Ohne Zweifel nimmt die nüchterne Gestaltung des Langhauses Bezug auf die Bettelordensarchi-tektur der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. So seien z.B. das nach 1244 bzw. vor 1263 errichtete Langhaus der Dominikanerkirche in Krems an der Donau40 oder das nach 1251 bzw. vor 1297 errichtete Langhaus der Dominikanerkirche in Friesach (pB St. Veit/Glan) genannt.41 Zum Zeit-punkt der Untersuchung lag im Sockelbereich ei-
nes Pfeilers der südlichen Mittelschiffwand Mauerwerk frei, das m.V. eine Errichtung in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts nahelegt. Die plattig bis blockigen Bruchsteine sind lagig versetzt und zu niedrigen Kompartimenten zusammengefasst, die wiederum auf die Höhe der Laibungssteine abgeglichen sind (Abb. 26). Der um 1290/1320 errich-tete Staffelchor reagiert mit seinen bauzeitlichen Triumphbögen bereits auf ein drei-schiffiges Langhaus, bei dem es sich nach der Auffassung des Verfassers um das gegen-wärtige Langhaus handelt. Dieses erhält gleichzeitig mit einer geringfügigen Aufzonung im Zuge des Chorbaus die frühgotischen Lanzettfenster und Portale in der Nord- und Südmauer. In Bezug auf die historische Situation und die wenigen, jedoch aussagekräf-tigen Befunde wird eine Datierung um 1230/1260 vorgeschlagen.
Die frühgotische Staffelchoranlage – um 1290/1310Den imposantesten Bauteil der Gertrudskirche bildet unbestritten der dreischiffige Staffelchor. Der jeweils von einem einjochigen Seiten- bzw. Nebenchor flankierte zwei-jochige Hauptchor wurde in einer Bauphase errichtet und lässt keinerlei bauliche Zwi-schenstufen (Bauetappen) bzw. Planwechsel erkennen (Abb. 27). Zu den Seitenchören kommuniziert der Hauptchor über einfache Spitzbogenportale im westlichsten Joch. Ohne Zweifel steht der Hauptchor ganz in der Tradition zeitgenössischer Langchö-re, die nicht nur bei Ordensgemeinschaften, sondern auch bei Pfarrkirchen unter der Leitung von „einflussreichen“ Pfarrherren bereits in den beiden Jahrzehnten vor 1300
39) Vgl. Elga Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien in Niederösterreich = Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien Österreichs 2 (Wien 1983) S. 326ff.40) Barbara Schedl, Krems/D. (NÖ.), Ehemalige Dominikaerkirche Hll. Peter und Paul (Kat.-Nr. 20). In: Günter Brucher (Hg.), Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 2, Gotik (München/New York/London 2000) S. 221-222.41) Barbara Schedl, Friesach (Ktn.), Dominikanerkirche Hl. Nikolaus (Kat.-Nr. 16). In: Brucher, Geschichte der bildenden Kunst (wie Anm. 40) S. 218-219.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
486 487
Abb. 26: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Langhaus, Arkadenpfei-ler mit freiliegendem Mauerwerk.© Oliver Fries
Abb. 27: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Ansicht der Staffelchoranlage von Süden. © Oliver Fries
auftreten können.42 Die stilistische Einordnung des Garser Staffelchors wurde bereits von einigen Kunsthistoriker/innen unternommen, wobei neben dem überregionalen Vergleich vor allem versucht wurde, den regionalen Bezug ins Treffen zu führen.43
Dem Verfasser ist bewusst, dass eine stilkritische Auseinandersetzung den hier zur Verfügung stehenden Rahmen bei weitem sprengen würde und so soll der Versuch unternommen werden, einige „stilistische“ Schlaglichter hervorzuheben.
Regionalen Einfluss übte maßgeblich der Langchor der Kremser Dominikanerkirche (vor 1300 vollendet).44 Was die Konzeption der Staffelchoranlage von Gars betrifft, so wurde für den ostösterreichischen Raum stets die Vorbildwirkung des 1304 begonnenen, jedoch um 1340 vollendeten Albertinischen Chors des Stephansdoms in Wien bemüht.45
Regional weist der dreischiffige Staffelchor der Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt von Raabs an der Thaya (pb Waidhofen/Thaya) Analogien auf, dem aufgrund stilistischer Überlegungen und bauhistorischer Befunde eine Bauzeit um 1290/1320 zugeschrieben wird.46 Bereits Gerhard Seebach bemerkte, dass die bauplastische Ausstattung des Gar-ser Staffelchors wie Gewölbedienste, Rippen, Kapitelle, Schlusssteine u. dgl. die gleiche Formensprache sprechen wie zeitgleiche Bauten in Stift Altenburg. Er erkannte auch eine Anzahl von übereinstimmenden Steinmetzzeichen.47
So zeigen neben der Abtkapelle vor allem die frühgotischen Bauteile der ab 1308 er-richteten Veitskapelle in Altenburg in der bauplastischen Ausstattung Analogien zum
42) So wird in der Literatur die von Papst Urban IV. im Jahr 1262 gestiftete Kirche von Troyes, St. Urbain (FR), mit Staffelchoranlage als Vorbild auf die ottokarische Architektur in Böhmen und Österreich bemüht, die sich unter der Herrschaft der Habsburger fortsetzt. Vgl. Mario Schwarz, Die Entwicklung der Baukunst zwischen 1250 und 1300. In: Brucher, Geschichte (wie Anm. 40) S. 195-201, hier S. 196-197.43) Neben dem Albertinischen Chor des Wiener Stephandomes wurde der Staffelchor von Gars immer wieder mit den vermeintlich einheitlichen Staffelchoranlagen von Zellerndorf und Sitzendorf (beide pB Hollabrunn) verglichen. Vgl. Hanna Egger, Gerhard Egger, Gregor Schweighofer u. Gerhard Seebach, Stift Altenburg und seine Kunstschätze (St. Pölten/Wien 1981) S. 50f. Beide Vergleichsbeispiele scheiden nun aufgrund ihrer differenzierten Baugenese völlig aus. Vgl. Peter Aichinger-Rosenberger u. Ronald Woldron, Die Pfarrkirche von Zellerndorf: Ergebnisse einer Bauforschung. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Bd. 55 (Wien 2001) S. 31-42. Peter Aichinger-Rosenberger (Hg.), Daheim in Sitzendorf. Heimatbuch der Marktgemeinde Sitzendorf an der Schmida (Sitzendorf 2006) S. 615-628.44) Zur Datierung des Kremser Langchores vgl. Barbara Schedl, Eine neue zeitliche Einordnung des Chores der ehemaligen Dominikanerkirche Hll. Peter und Paul in Krems an der Donau. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 52/2 (1998) S. 387-392.45) Laut der Auffassung Bökers wurde unter Herzog Rudolf IV. (reg. 1358-1365) der ursprüngliche Staffelchor von St. Stephan zum heutigen Hallenchor umgebaut. Vgl. Böker, Stephansdom (wie Anm. 29) S. 44-53 u. S. 54ff.46) Die auf einem unvollendeten (?) Chorbau zurückgreifende Staffelchoranlage wurde aufgrund retardierender Stilelemente im Südchor über eine längere Bauzeit hinweg errichtet. Vgl. Peter Aichinger-Rosenberger u. Oliver Fries, Pfarrkirche Raabs (Maria Himmelfahrt auf dem Berge) [Kat.Nr. 2]. In: Peter Aichinger-Rosenberger u.a. (Hg.), Bekanntes und Unbekanntes rund um Raabs. Archäologie einer Landschaft (Raabs an der Thaya 2009) S. 22-26, bes. S. 24-25.47) Seebach, Altenburg (wie Anm. 5) Fig. 43a.
Garser Chor.48 Auch wenn die Veitskapelle selbst eine Stiftung des Hadmar von Sonn-berg ist49, so besteht durch mehrere potente Stiftungen der Burggrafen von Gars eine enge Beziehung zu Altenburg. Die Garser Burggrafen gelten in der Haustradition des
Klosters sogar als „zweite Stifter“.50
Während im Hauptchor Dienstbündel die Längs-wände emporsteigen und ohne Kapitellzone zu den Kreuzrippengewölben überleiten, besitzen die Seitenchöre halbrunde Gewölbedienste mit polygonalen Kelchkapitellen, die über Deckplat-ten mit gepflockten Rippenanläufen zu den Ge-wölberippen mit Birnstabprofil überleiten (Abb. 28). Der Rippenquerschnitt im Hauptchor setzt sich aus einer Hohlkehle zusammen, über das ein Dreiecksprofil ansetzt.51
Aufgrund von identen Steinmetzzeichen ist an-zunehmen, dass die lanzettartigen Spitzbogenfenster sowie das Nord- und Südportal des Langhauses zu einer Bauphase mit Errichtung des Staffelchores gehören (Abb. 29). Vergleichbare Portale, die sich aus einem Rundstab und einem Birnstab zusammen-setzen, finden sich in der Göttweigerhofkapelle in Stein, deren malerische Ausstattung von Elga Lanc mit 1305/1310 datiert wird52, oder in der Passauerhofkapelle (Ursula-kapelle) von Krems und Oberstockstall – beide um 1300.53 Sowohl die Gestaltung der beiden Sitznischen im Hauptchor als auch deren originale malerische Gestaltung lässt sich mit den Nischen im Hauptraum der Göttweigerhofkapelle vergleichen.54
Das Fenstermaßwerk des Hauptchors setzt sich aus sechs bzw. drei gestapelten Drei-pässen zusammen. Die Ostfenster der Seitenchöre weisen die gleiche Figuration auf als die zweibahnigen Fenster des Hauptchors. Die seitlichen Fenster der Nebenchöre weisen
48) Vgl. zur gotischen Veitskapelle zuletzt Doris Schön, Martin Krenn u. Johannes M. Tuzar, Archäologische Untersuchungen. Geschichte ans Licht gebracht. In: Albert Groiss u. Werner Telesko (Hg.), Benediktinerstift Altenburg. Mittelalterliches Kloster und Barocker Kosmos (Wien 2008) S. 34-51, bes. S. 41-42.49) Hanna Egger, Kurz gefasste Geschichte der Benediktinerabtei Altenburg vor dem Barockumbau (1144-1648). In: Horst Adler (Red.), Fundort Kloster. Archäologie im Klösterreich. Katalog zur Ausstellung im Stift Altenburg vom 1. Mai bis 1. November 2000 = Fundberichte aus Österreich, Materialhefte A 8 (Wien 2000) S. 48-57, hier S. 50.50) Vgl. zuletzt Albert Groiss, Streiflichter zur Geschichte der Benediktinerabtei Altenburg. In: Groiss u. Telesko, Altenburg (wie Anm. 48) S. 8-33, hier S. 12.51) Ab den 1280er/1290er-Jahren können Birnstab- als auch Dreiecksprofile gleichzeitig auftreten.52) Elga Lanc, Die mittelalterlichen Wandmalereien in Wien und Niederösterreich = Corpus der mittelalterlichen Wandmalereien Österreichs 1 (Wien 1983) S. 293-308.53) Dehio-Handbuch (wie Anm. 4) S. 559 bzw. S. 836.54) Lanc, Wandmalereien (wie Anm. 52) S. 293ff.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
488 489
Abb. 28: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Südchor, Detailansicht Chorpolygon. | © Oliver Fries
moderne und reichere Maßwerkformen auf, deren Profile gekehlt und stark gegratet sind (Abb. 30). Idente Motive finden sich im Ostflügel des mittelalterlichen Kreuzganges von Altenburg, der in die Zeit um 1320/1350 datiert. Vor allem die Abmessung dieser scheinbar jüngeren Fenster korrespondiert nicht mit jenen der Ostfenster. Offensicht-lich wurden diese Fenster inklusive Maßwerk erst in einer jüngeren Bauphase eingefügt und ersetzten bauzeitlich schmale Lanzettfenster. Diese Annahme wird besonders durch ein einfaches Lanzettfenster im Südchor unterstützt. Demnach dürften nur die Ostfenster mit zweibahnigen Maßwerkfenster ausgestattet gewesen sein, hingegen die restlichen Fenster einfache schlitzförmige Lanzettfen-ster besessen haben, die in einer jüngeren Bauphase des 14. Jahrhunderts ersetzt wurden.
Die bauplastische Ausstattung des Staffelchors der Gertrudskirche verweist auf das stilistische Repertoire der Jahrzehnte um 1300 (Abb. 31). Historisch kommen somit die frühen Burggrafen von Gars bzw. Magister Heinrich als Bauherr bzw. Stifter in Betracht – die Einflussnahme durch den Landesfürsten beim Bau ist jedoch auch in die Überlegungen miteinzubeziehen. Für die Errichtung des Staffelchors wird eine Datie-rung um 1290/1310 vorgeschlagen. Zuletzt sei noch auf ein bauplastisches Detail, die figürlichen Traufsteine des Staffelchores, eingegangen. Am Hauptchor im Norden und Süden sowie am südlichen Nebenchor finden sich teilplastische Köpfe an der Kehlung der konsolenartig vortretenden Traufsteine (Abb. 32, 33, 34). Während der nördliche Traufstein des Hauptchors einen Mann darstellt, zeigt der südliche den einer Frau. Der
Traufstein des nördlichen Nebenchors ist einfach gestaltet, jener des südlichen zeigt einen Kopf in der Gestalt eines Bären (?).
Aufzonung des Langhauses um 1411Im wahrsten Sinne des Wortes überragend ist die verhältnismäßig überproportionierte Innenhöhe des Langhauses (Abb. 35). Im Mittelschiff zeichnet sich bei Steiflicht ca. 2 m
GERTRUDSKIRCHE
490 491
K APITEL 12.3
Oben v.l.n.r.: Abb. 31: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Südchor, Schlussstein.Abb. 32: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Hauptchor, nördliche Kopfkonsole, Darstellung eines Mannes. Oben v.l.n.r.: Abb. 33: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Hauptchor, südliche Kopfkonsole, Darstellung einer Frau. Abb. 34: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Hauptchor, südliche Kopfkonsole, Darstellung eines Bärenkopfes (?). Abb. 35: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Langhaus, Blick gegen Osten. © Oliver Fries
Abb. 29: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, frühgotisches Nordportal des Langhauses. | © Oliver Fries
Abb. 30: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Maßwerkfigurationen bzw. Fensterformen des Staffelchors. S/S1, S/O, H/SO, H/O, H/NO, N/O gehören zur bauzeitlichen Ausstattung (um 1290/1320), die restlichen Fenster wurden im fortgeschrittenen 14. Jahrhundert eingefügt.© Oliver Fries nach Gerhard Seebach (1989)
über den Scheiteln der Arkaden eine horizontale Zäsur im Putz ab, die möglicherweise die Lage einer ursprüng-lich flachen Balkendecke nachzeichnet. Die gegenwärtige Spitztonne im Mittelschiff wurde erst 1831 eingezogen.
In der nördlichen Mittelschiffwand befindet sich heute ein vermauertes Portal, das eine Verbindung zwischen nördlichen Seitenschiffdachraum und Mittelschiffdach-raum ermöglichte. Die Rahmung der Öffnung aus Holz sitzt ohne erkennbare Baufuge in situ im Mauerwerk (Abb. 36).55 Von drei Balkenresten eines dazugehörigen ehem. hölzernen Podestes konnte dendrochronologisch das Fälldatum mit Winterhalbjahr 1410/1411 bestimmt werden.56 In der Regel sind ein bis max. drei Jahre dem Fälldatum hinzuzurechnen, um das Baudatum zu erhal-ten.57 Demnach erfolgte um 1411 eine Aufzonung der Mittelschiffwände, wodurch eine mit dem Staffelchor einheitliche Trauflinie geschaffen wurde. Das bedeutete
aber für den romanischen Turm, dass er völlig vom neuen Westgiebel „verschluckt“ wurde. Da ein völlig eingehaustes, nur im Westen offenes Läuthaus als relativ un-wahrscheinlich erscheint, ist wohl ein hölzerner Aufbau mit Glockenstube wahr-scheinlicher.58
Die Johanneskapelle – um 1470/1530Zu den letzten baulichen Veränderungen, die in die Gotik datieren, zählt die im Süden des Langhauses angestellte über ein hohes Sockelgeschoß errichtete Kapelle. Zum südli-chen Seitenschiff öffnet sich der gedrungene Kapellenraum über zwei abgefasste Spitz-bogenarkaden. Abgeschlossen wird der Kapellenraum von einem Netzrippengewölbe, die Kapelle wird von einem Halbwalmdach überspannt (Abb. 37, 38). Die Gewände der Spitzbogenfenster sowie das außen umlaufende Kaffgesimse zeigen verstäbte Profile – ein typisches Charakteristikum der Spätgotik (Abb. 39:). Im Dachraum der Kapelle ist sichtbar, dass im Zuge ihrer Errichtung die Außenmauer des südlichen Seitenschiffes abgebrochen werden mussten. Die Mauerplombe bzw. die seitlichen Baufugen sind auf-
55) Auf Höhe der Portalschwelle zeichnet sich im Mauerwerk eine horizontale Baufuge ab, die das spätromanische/frühgotische Mauerwerk von der spätgotischen Aufzonung separiert. Das ältere Mauerwerk korrespondiert im Osten mit blockhaften Läufersteinen, die hier eine Ecksituation indizieren.56) Die dendrochronologische Beprobung und Datierung erfolgte 2000 durch MMag. Ronald Woldron. Mittelkurve der drei Proben (137 Jahrringe), GLK 69/TvBP 6,3/TvH 7,0.57) Vgl. Kurt Nicolussi u. Thomas Pichler, Altes Holz in feuchten Mauern – Zur Frage der zeitlichen Kongruenz von Fälldaten und Baudaten in Tirol. In: Anja Diekamp (Hg.), Naturwissenschaften & Denkmalpflege (Innsbruck 2007) S. 91-103.58) Möglicherweise bestand auch am Übergang von Chor zum Langhaus ein kleiner dachreiterartiger Glockenturm.
grund der unterschiedlichen Mörtelfarbe und -zuschläge sowie dem stark ausgezwickel-ten Bruchsteinmauerwerk gut vom älteren Mauerwerk des Langhauses zu unterscheiden.
DatierungWer und zu welchem Zweck die Kapelle errichten ließ, ist derzeit unbekannt. 1395 be-gründet Hans II. von Maissau als Burggraf von Gars und Inhaber der landesfürstlichen Herrschaft Gars ein Benefizium am St. Johannes-Altar in der Gertrudskirche.59 Der Zeitpunkt der Stiftung kann aufgrund stilistischer Kiriterien nicht mit dem Bau der Kapelle identifiziert werden. Offensichtlich befand sich der Altar vorerst im Inneren des Langhauses. Sebastian Helfried Herr von und zu Wopping und Kharpffhaimb stif-teten 1663 eine Messe in der Peterskapelle der Gertrudskirche.
Er ließ in der Gruft der Kapelle ein Begräbnis bzw. eine Familiengruft einrichten, in der er 1666 auch beigesetzt wurde.60 Offensichtlich ist diese Peterskapelle mit der Johan-
59) DASP, Pfarrarchiv Gars, Abschrift Pfarrakten 5. Vgl. Plesser, Beiträge (wie Anm. 35) S. 580.60) DASP, Pfarrarchiv Gars, Konsistorialakten.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
492 493
Abb. 37: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Einblick in die Südkapelle, gegen Westen.
Abb. 38: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Südkapelle, Detail, Konsole der Gewölbedienste.© Oliver Fries
Abb. 39: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Südkapelle, Detailansicht der Südfassade.© Oliver Fries
Abb. 36: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Dachraum des südlichen Seitenschiffe, vermauerter Türrahmen in der nördlichen Hochschiffwand (Mittelschiff). © Oliver Fries
neskapelle zu identifizieren, da sich die Gruftplatte des Sebastian Helfried im Boden unmittelbar vor dem heutigen Johannes-Nepumuk-Altar befindet. Aufgrund der Rip-penfiguration und des doppelt gekehlten Rippenprofils sowie des stilistischen Gesam-trepertoires der bauplastischen Ausstattung der Johanneskapelle wird eine Datierung um 1470/1530 vorgeschlagen – aufgrund der konservativen Detailformen ist eine Voll-endung bereits vor der Jahrhundertwende vorstellbar, jedoch nicht zwingend möglich.
Neuzeitliche Bautätigkeit und Turmerhöhung 1697/1698Im Verlauf des Dreißigjährigen Krieges kam es am 29. April 1620 zu einem Gefecht zwi-schen den im Ort liegenden Mansfeld’schen Truppen und der kaiserlichen Reiterei. In dessen Folge wurde die Gertrudskirche geplündert, wobei ein Schaden von 1.000 fl. ent-stand.61 1681 kommt es zu umfangreichen Instandsetzungsarbeiten an der Kirchhofmau-er, die massive Strebepfeiler erhält, die Renovierung des Karners wurde in Angriff ge-nommen und es wird der Kalvarienberg mit Breitpfeilerstationen eingerichtet. Am Ende des Kreuzwegs wurde der massive Breitpfeilerbau mit Kreuzigungsgruppe errichtet.62 In den Jahren 1697/1698 kommt es zu einer Erhöhung des romanischen Westturms (Abb. 40). Der neu errichtete Turm erhielt den gegenwärtigen Abschluss mit steinerner Kuppel und Eckobelisken. Entsprechende Eintragungen finden sich in den Kirchen-rechnungen und Bauakten dieser Zeit.63 Zusätzlich finden sich im Bereich des roma-nischen Mauerwerks des Turms zwei eingemeißelte Inschriften, die mit 1698 datieren. Überdies befinden sich zwei Weiheinschriften im Westen und Osten an der Innenseite des steinernen Turms (Abb. 41, 42):
(westliche Kuppelhälfte) 1698SVB
R IOANNES SEBASTIANO ERNST
DE WEISMAIN LIBEROFRANCONE
DECANO ET PAROCHOAC NVNC CONSISTORIALI
PASAVIENSIEX TRVCTA
(östliche Kuppelhälfte)16 IG 98
WDERZEIT OBERKIRCH
VATTER.
Offensichtlich war 1797 die Schleifung der Kirche geplant, denn nach Beschwerden der umliegenden Gemeinden erhielt der Pfarrer, Freiherr von Rauber, den Befehl vom
61) Vgl. Plesser, Beiträge (wie Anm. 35) S. 526f.62) DASP, Pfarrarchiv Gars, Kirchenrechnungen 1, Bauakten I.63) DASP, Pfarrarchiv Gars, Kirchenrechnungen 1.
495
GERTRUDSKIRCHE
494
K APITEL 12.3
Abb. 40: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Detailansicht Läuthaus und Kuppel. © Oliver Fries
Abb. 42: Gars am Kamp, Pfarrkirche Hl. Gertrude, Inschrift an der Innenseite der Osthälfte der Sandsteinkuppel. © Oliver Fries
Abb. 41: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Inschrift an der Innenseite der Westhälfte der Sandsteinkuppel. | © Oliver Fries
Kreisamt Krems, mit den Abbrucharbeiten an der Kirche bis zur Abhaltung einer Kommission zu warten.64 Im Folgejahr lehnte eine bischöfliche Visitation den Abbruch der Kirche ab und dem Pfarrer wurde aufgetragen, die bereits abmontierten Glocken wieder in die Gertrudskirche zu transferieren. Freiherr von Rauber hatte bereits begon-nen, Grabsteine aus der Kirche zu schaffen, daraufhin wurde er dazu verpflichtet, die Fehlstellen im Boden wieder pflastern zu lassen.65
In einem Inventar von 1807 wird vermerkt, dass die Kirche in einem guten Zustand sei, jedoch der „Decke“ der Einsturz drohe.66 Bei der einsturzgefährdeten Decke handelte es sich offensichtlich um jene des Mittelschiffs, da 1831 ein neues Gewölbe aus Ziegeln eingezogen wurde. Im Licitationsprotokoll vom September 1830 heißt es: In der oberen Kirche zu Gars ist ein Teil neu einzuwölben, derselbe gottisch [sic!] heerzustellen, dann die ganze Kirche zu verputzen und zu weißnen.67 Unter dem „Conservator“ der k.k. Cen-tral Kommission, Oberbaurat Karl Rosner, erfolgte 1880 eine umfangreiche Renovie-rung, die erst 1886 abgeschlossen war. Bei diesen Arbeiten wurden weite Bereiche der heute freiliegenden Wandmalereien aufgedeckt. Weitere Freilegungsarbeiten erfolgten 1905 bzw. 1906.68
Die letzten umfassenden Renovierungsarbeiten fanden von 1972 bis 1975 in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt statt. Im Verlauf dieser Ar-beiten wurde die barocke Sakristei im Winkel von Haupt- und Nordchor abgebrochen.
Der KarnerSüdöstlich der Gertrudskirche liegt der Karner, eine Rotunde mit im Osten anschließenden Apsis (Abb. 43).69
Zum Karner in Gars selbst existieren so gut wie keine historischen Nachrichten, selbst über das ur-sprüngliche Patrozinium der offensichtlich primär im Obergeschoß eingerichteten Kapelle ist nichts
64) DASP, Pfarrarchiv Gars, Pfarrakten 5, Kirchenrechnungen 3.65) DASP, Pfarrarchiv Gars, Pfarrakten 5, Kirchenrechnungen 3; Bauakten I.66) DASP, Pfarrarchiv Gars, Inventare, fol. 61.67) DASP, Pfarrarchiv Gars, Pfarrakten 5, Bauakten I.68) DASP, Pfarrarchiv Gars, Kirchenrechnungen 6; Bauakten I.69) Als Karner bezeichnet man zumeist ein zweigeschoßiges Beinhaus zur Aufbewahrung der im Untergeschoß sekundärbestatteten Gebeine (Ossuarium) des umliegenden Friedhofs. Im Obergeschoß ist in der Regel ein Kapellenraum eingerichtet.
bekannt. 1681 wir im Karner als letzte Station des Kalvarienbergs ein Heiliges Grab eingerichtet.70
Wie aus einer Beschreibung Franz X. Schweickhardts aus dem Jahr 1840 ersichtlich, war der Karner bereits „ohne Dach“.71 Dies wird auch durch eine Anzahl an zeitgenössi-schen Abbildungen bestätigt, die ihn im ruinösen Zustand und ohne Dach darstellen.72 Einer um 1810 datierten Darstellung Franz Jaschkes zufolge besaß der Karner noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts einen Zwiebelhelm (Abb. 44).73 Es ist durchaus vorstellbar, dass der Karner den Maßnahmen der josephinischen Reformen zum Opfer gefallen ist, die mitunter noch ihre Auswirkungen bis in die 1810er Jahre zeigten.74
Seit 1876 ist im Karner die Begräbnisstätte der Familie Croy untergebracht, er wur-de im selben Jahr von Architekt Ludwig Wächtler (1842-1916, ein Schüler Friedrich Schmidts) in seine heutige Gestalt gebracht (Abb. 45).75 Zu seinen bedeutendsten Werken zählt der historisierende Umbau von Schloss Grafenegg – gemeinsam mit
70) DASP, Pfarrarchiv Gars, Kirchenrechnungen 1, Bauakten I.71) Franz Schweickhardt Ritter von Sickingen, Darstellung des Erzherzogthums Oesterreich unter der Ens, Viertel Ober-Manhardsberg, Bd. 4 (Wien 1840) S. 181-190;72) Vgl. NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.647 (1814/1824 Anton Köpp von Felsenthal), Nr. 1.682 (1871 Emil Hütter), Nr. 30.407 u. 30.408 (1878 bzw. 1877, Wenzel Czerwenka).73) Vgl. NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.674.74) Das Benefizium des Karners von Raabs und Weikertschlag wurde unter den Reformen Kaiser Josephs II. aufgelassen. Der Karner von Raabs wurde in der Folge zur Gänze geschleift.75) Dvořák (Red.), Kunsttopographie (wie Anm. 3) S. 544. Eine Fotografie von Amand Helm aus 1882 zeigt den Karner bereits in seiner heutigen Gestalt. Vgl. NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.678.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
496 497
V.l.n.r.: Abb. 44: Detail aus der Ansicht von Franz Jaschke, Das Schloß Gars am Kampflusse, ca. 1810. | © NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.674
Abb. 45: Gars am Kamp, Wappen der Grafen von Croy am Abgang zum Untergeschoß des Karners. | © Oliver Fries
Abb. 43: Gars am Kamp, Ansicht des Karners von Norden. | © Oliver Fries
Hugo Ernst in den Jahren nach 1870.76 Im Auftrag der Familie Croy erfolgten durch Wächtler auch zeitgenössische Um- und Ausbauten an Schloss Buchberg am Kamp.77 Franz Eppel bezeichnet 1963 die historistische Umgestaltung des Karners als „ge-schmacklose modernistische Renovierung“, die den Baukörper gänzlich entstelle.78 Der Karner durchlief unter Wächtler eine umfassende Umgestaltung, der auch die zin-nenbewehrte doppelläufige Freitreppe und das spitze Kegeldach angehören. Sowohl die ungegliederte Rieselputzfassade als auch die gotisierenden Spitzbogenfenster mit breiten Putzfaschen gehören zu dieser Bauphase. Über dem Abgang zur Gruft im Un-tergeschoß prangt das Wappen der Grafen Croy. Das ungewölbte Obergeschoß ist zum Dachstuhl hin offen. Der abschließende Zackenfries könnte eine Anspielung auf regio-nale gotische Vorbilder sein, wie es die abschließenden gotischen Zackenzinnen der Karner von Pulkau, Zellerndorf, Friedersbach und jener im Kloster Pernegg darstellen.
Da weder Mauerstrukturen noch sonstige architektonische Details des Primärbaus freiliegen, sind besonders die vorhin genannten historischen Darstellungen aus dem Zeitraum zwischen 1824 und 1878 von großem Interesse (Abb. 46). Alle zeigen ein-heitlich eine Gliederung der Apsis durch Lisenen- bzw. Halbrundsäulen und abschlie-ßenden Rundbogenfries.
76) Siehe eine Werksliste von Wächtler in Ludwig Wächtler, Werkverzeichnis der Umbauten und Neubauten. In: Ludwig Wächtler (Hg.), Festschrift anlässlich des 125jährigen Bestandes der Pensions-Gesellschaft bildender Künstler in Wien (Wien 1913) 57.77) Wächtler zeichnet sich auch für die historisierende Renovierung von Schloss Ottenstein (1867-1878) verantwortlich. Vgl. Ludwig Wächtler, Über die Restauration des Schlosses Ottenstein. In: Wochenschrift des Österreichischen Ingenieurs und Architektenvereines 1877 (Wien 1877) S. 307ff.78) Eppl, Waldviertel (wie Anm. 4) S. 230.
Am detailreichsten ist die mit 1871 datierte Bleistiftzeichnung von Emil Hütter, die eine Zeitstellung in die romanische Stilepoche rechtfertigt (Abb. 47).79 Es handelt sich also nicht wie zuletzt von Zotti angenommen um einen frühgotischen Baukörper.80 Interessant ist, ob diese Gliederung der Apsis noch hinter einer allfällig möglichen Doublierung mittels einer Ziegelvorsatzschale erhalten blieb oder im Zuge der Umge-staltung durch Wächtler abgeschlagen wurde.
In relativer Nähe zu Gars findet sich beispielsweise an der Apsis der in die erste Hälfte des 12. Jahrhunderts datierten Pfarrkirche hl. Michael von Kühnring ein vergleichbarer romanischer Gliederungsapparat.81
So ist vor allem auf die Erkenntnisse restauratorischer und bauhistorischer Untersu-chungen im Vorfeld von zukünftigen Renovierungen des besonders in seiner Sockel-zone in Mitleidenschaft gezogenen Karners zu hoffen.
79) NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.682.80) Zotti, Kirchliche Kunst (wie Anm. 6) S. 95.81) Gerhard Reichhalter, Die Burg von Kühnring. In: Burghard Gaspar, Johannes M. Tuzar u. Leopold Winkelhofer (Hg.), Kühnring. Festschrift mit Beiträgen zur Vergangenheit und Gegenwart anlässlich der Feiern im Jahr 2006 (Kühnring 2006) S. 53-70. Falko Daim, Karin Kühtreiber u. Thomas Kühtreiber (Hg.), Burgen Waldviertel – Wachau – Mährisches Thayatal (Wien 2009) S. 89ff.
GERTRUDSKIRCHEK APITEL 12.3
498 499
v.l.n.r.: Abb. 46: Detail aus der Abbildung von Anton Köpp von Felsenthal.© NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.647
Abb. 47: Darstellung des Karners von Emil Hütter, 1871. | © NÖLB, Top.-Smlg. Inv.-Nr. 1.682
Abb. 48 Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Ansicht gegen Süden. | © Oliver Fries
FazitDie Ergebnisse der bauhistorischen Untersuchung erlauben eine Neubewertung der Baugeschichte und damit verbunden eine Revidierung des bisherigen Forschungsstan-des. So handelt es sich beim Westturm nicht um einen ehemals an drei Seiten freiste-henden Baukörper, sondern dieser war voll in den hochmittelalterlichen Gründungs-bau integriert und trat – ähnlich wie bei der von den Kuenringern gegründeten Prop-steikirche von Zwettl – als Giebel-bzw. Glockenreiter in Erscheinung. Da zum jetzigen Zeitpunkt noch kein originales Bauholz aus dem Turm für eine dendrochronologische Untersuchung geborgen werden konnte, müssen weiterhin historische Überlegungen und der stilistische Vergleich der bauplastischen Details am Turm für eine Datierung um/vor 1130 ins Treffen geführt werden.
Einen Rückschluss auf den Grundrisstypus des Primärbaus erlaubt neben den Baube-funden am aufgehenden Mauerwerk auch der Vergleich zu anderen Sakralbauten aus dem Einflussgebiet der Kuenringer – allen voran der Zwettler Propsteikirche aus der
„Die Neuzeit brachte keine tiefgreifenden Baueingriffe ...“
zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts – welche die Rekonstruktion einer Chorquadrats-kirche mit anschließender Apsis im Osten und einer dreigliedrigen Herrschaftsempore im Westen vermuten lassen.
Im Zuge einer spätromanischen/frühgotischen Bautätigkeit um 1240/1280 kommt es zum Neubau eines dreischiffigen Staffellanghauses, dessen Mittelschiff sich mittels ge-drungener Spitzbogenarkaden zu den Seitenschiffen öffnet.
In der Folge kommt es unter der Herrschaft der letzten Burggrafen aus der Sippe der Kuenringer bzw. dem einflussreichen Pfarrherren Magister Heinrich um 1290/1320 zur Errichtung der imposanten, dreischiffigen Staffelchoranlage, welcher aufgrund sei-ner mittelalterlichen Glasgemälde von Seiten der Kunst-geschichte besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.82 Dendrochronologisch erfassbar wurde eine Erhöhung bzw. Aufzonung der Mittel- bzw. Hochschiffwände, wo-durch Chor und Langhaus in einer Trauflinie vereint wurden. An das südliche Seitenschiff wurde der stilisti-schen Einordnung der bauplastischen Details zufolge um 1470/1530 die Johanneskapelle angestellt.
Die Neuzeit brachte keine tiefgreifenden Baueingriffe, einzig die Erhöhung des West-turmes um ein Glockengeschoß 1697/1698 prägt bis heute das Erscheinungsbild der Kirche. So präsentiert sich die Gertrudskirche bis heute in einem beinahe vollständig mittelalterlichen Erscheinungsbild. Welche Umstände am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert vorherrschten, verdeutlicht die Tatsache, dass wohl als Folge der josephi-nischen Reformen und aufgrund der Existenz der Marktkirche hl. Martin die Ger-trudskirche „überflüssig“ geworden war und 1797 die Schleifung drohte, die jedoch im Folgejahr abgewehrt werden konnte. Nur 23 Jahre später erlangte der ehrwürdige Sakralbau an Bedeutung zurück, da man im Zuge einer Renovierung bedacht war, das Mittelschiff mit einer Spitztonne im gotischen Stil neu zu wölben.
82) Eva Frodl-Kraft, Die Mittelalterlichen Glasgemälde in Niederösterreich, Gars-Thunau-Pfarrkirche St. Gertrud. In: Corpus Vitrearum Medii Aevi, Österreich, Bd. II, Niederösterreich 1. Teil (Wien/Köln/Graz 1972) S. 55-71.
501
GERTRUDSKIRCHE
500
K APITEL 12.3
Abb. 49: Gars am Kamp, Pfarrkirche hl. Gertrude, Westturm, Obergeschoßkammer, Detail des spätgotischen Türblatts mit Kreuzigungsdarstellung. | © Oliver Fries