Oliver FRIES u. Ronald WOLDRON, Kollmitz – Eine Burg des Mittelalters im 17. und 18. Jahrhundert....
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Oliver FRIES u. Ronald WOLDRON, Kollmitz – Eine Burg des Mittelalters im 17. und 18. Jahrhundert....
209
Oliver FRIES, Ronald WOLDRON
Kollmitz – Eine Burg des Mittelalters im 17. und 18. Jahrhundert
Ausgewählte Ergebnisse der Bauforschungen von Mai 2011 bis Oktober 2012[1]
Kollmitz – st�edov�ký hrad ze 17. a 18. stoletíVýb�r výsledk� stavebního pr�zkumu od kv�tna 2011 do�íjna 2012
Resumé
V roce 2012 byl proveden rozsáhlý stavební pr�zkum z�íceniny Kollmitz, jehož cílem bylo, objasnit komplexní stavební genezi tohoto objektu. Dendrochronolický pr�zkum, který byl sou�ás� stavebního pr�zkumu, byl proveden na historickém d�evním materiále in situ a p�inesl nejen významné údaje o go� cké stavební fázi, ale p�edevším i poznatky o doposud neznámé výstavb� z doby kolem roku 1640. Hlavn� pomíjivé majitelské pom�ry od po�átku 17. stole� ukazují jasn�, že do té doby již do zámecké dimenze rozestav�ný hrad doslova o�ividn� po�al ztrácet na atrak� vit�. Pro majitele tedy stályve st�edu zájmu již pouze s budo-vou spojené panství s jehop�íjmy a privilegii.
Potom když co byl v roce 1611 Kollmitz pro da�ové dluhy konfis-kován císa�em Rudolfem II., kon�í panství rodiny Ho irchen, které tato rodina m�la od roku 1411. Kollmitz byl odd�len od Drösiedlu, který zustal nadále v majetku rodiny Ho irchen. 1616 se p�j�uje teh-dy v zástavu na 37.349 odhadované panství Georgovi Schü� ovi, který tež kv�li vysokému zadlužení musel panství v roce 1637 prodat.
1 Der an dieser Stelle publizierte Beitrag stellt eine umfangreiche Zusammenfas-sung des von Oliver Fries am 26. April 2013 auf Schloß Vranov (CZ) im Zuge des Kolloquiums „Grenzen.Geschichte.Menschen“ gehaltenen Vortrags dar.
210
Hans Schubhardt, císa�ský rada a Schö� elmeister, koupil v roce 1637 panství. Objekt Kollmitz, mu byl v roce 1639 císa�em Ferdinand III. p�j�en v zástavu. 1642 bylo panství za splátku ve výši 2.600 pro-hlášeno za volné. Kollmitz je v roce 1663 uveden na seznamu úto�iš Viertel ober dem Manhartsberg pro p�ípad tehdy hrozících tureckých invazí. Na vršku ve výši cca. 600 m byl instalován oh�ový signál (Kreid-feuer), který mél slovžit, jako �lének k dolnorakouskému varovnímu systému.
_____________________
Im Au� rag des Vereins zur Erhaltung der Burgruine Kollmitz und mit � nanzieller Unterstützung durch das Bundesdenkmalamt, Landes-konservatorat für Niederösterreich wurden von Mai 2011 bis Au-gust 2012 umfangreiche Bauforschungen an der Burgruine Kollmitz (pB Waidhofen an der Thaya) (Abb. 1) durchgeführt.[2]Diese ha� en die Klärung der komplexen Baugenese zur Aufgabe. Die Bauanalyse und Auswertung erfolgte durch die Bauforscher Oliver Fries (Krems an der Donau) und Ronald Woldron (Wien). Im Vor-feld der Untersuchungen wurde die Herrscha� sgeschichte durch den Historiker Erich Kerschbaumer (Raabs an der Thaya) aufgear-beitet, dem besonders unser Dank gebührt. Die im Zuge der Baufor-schungen durchgeführten dendrochronologischen Untersuchungen an den im Baubestand in situ be� ndlichen historischen Bauhölzern er-brachten nicht nur bedeutende Daten für die go� schen Bauphasen,
2 An dieser Stelle sei Frau Margit Auer, der Obfrau des Vereins zur Erhaltung der Burgruine Kollmitz und der zuständigen Referen� n des Bundesdenkmalamtes, Frau Mag. Petra Weiss für ihre Unterstützung herzlich gedankt. Je ein Exem-plar der gedruckten „Vollversion“ des umfangreichen Bauforschungsberichts be� ndet sich im Archiv des Vereins zur Erhaltung der Burgruine Kollmitz und am Bundesdenkmalamt, Landeskonservatorat für Niederösterreich bzw. als Download unter h� p://academia.edu/2632749/Bauforschungsbericht_Burg-ruine_Kollmitz_pB_Waidhofen_an_der_Thaya_NO_ (letzter Aufruf: 14. Juli 2013).
211
Abb. 1 Lu� bild der Burgruine Kollmitz, aufgenommen am 17. März 2013 durch Oliver Fries. Links, die sogenannte Böhmische Mauer, die den Bergsporn an sei-ner engsten Stelle abriegelt. Rechts, die imposanten Reste des Burg-Schlosses am Ende des Sporns. Unten, die Ortscha� Kollmitzgraben, die terrassenar� g die Anhö-hen bis zur Vorburg besetzt.
sondern auch die Erkenntnis über einen bisher unbekannten Ausbau der Burg in der Zeit um 1640.[3] Besonders die wechselvolle Besitz-geschichte zeigt deutlich, dass die bereits schlossar� g ausgebaute Burganlage im fortgeschri� enen 17. Jahrhundert zusehends an A� rak-� vität verlor. Nur mehr die an das Bauwerk geknüp� e Herrscha� mit ihren Einkün� en und Rechten schien für deren Besitzer von Interes-se zu sein.
3 Dendrochronologische Untersuchung durch MMag. Ronald WOLDRON, Ins� -tut für Holzforschung, Universität für Bodenkultur Wien, am 30. August 2005. Insgesamt wurden 24 Proben genommen, von denen 15 da� ert werden konn-ten.
212
Zusammenfassung der Baugeschichte
Die ältesten Mauerteile der Burgruine sind im felsigen Gelände un-mi� elbar südöstlich des Bergfrieds situiert. Sie verweisen auf einen architektonisch anspruchslosen Kleinadelssitz aus den Jahrzehnten vor der Erstnennung von 1287.[4] Die noch erhaltenen, in späteren Bauphasen überprägten Mauerreste nehmen eine Fläche von rund 10 x 20 m ein. Gegen Nordwesten ist eine schwache Schildmauer ausgebildet, die ehemals die anderen Außenmauern der Burg um zumindest eineinhalb Geschoße überragte.
Dies lässt sich besonders gut an der Westmauer der Altburg able-sen. Sie zeigt im Anschluss an die Schildmauer vermauerte zinnen-ar� ge Strukturen, die darauf schließen lassen, dass sie ursprüng-lich nur eingeschossig ausgeführt war. Es ist daher für die Anfänge des Herrscha� ssitzes an eine Kombina� on von Holz- und Steinbe-bauung zu denken, wie sie auch für die nahe gelegene Burg Gros-sau (pB Waidhofen an der Thaya) rekonstruiert werden kann.[5] Für die hölzernen Bauteile bedeutete die Schildmauer im Bedrohungs-fall einen wich� gen Schutz. Das Bruchsteinmauerwerk der Altburg zeigt teilweise noch lagige Tendenzen, wobei die Sorglosigkeit des Steinversatzes nicht unbedingt nur zeitspezi� sch zu werten ist. Sie kann zudem mit dem geringen Anspruch des bescheidenen Adelssit-zes begründet werden. Ein in der Schildmauer be� ndliches Rüstholz besaß zu wenig Jahrringe für eine sichere dendrochronologische Da-� erung. Die Errichtung der Altburg ist daher derzeit nur anhand der Mauertechnik zeitlich einzuordnen; diese legt eine Errichtung um 1260/1290 nahe. Der Ausbau der kleinen Burg zu einem großen, re-präsenta� ven Adelssitz fand in den Jahren um 1321 (d) sta� .[6] Die-ses genaue Baudatum verdanken wir der dendrochronologischen
4 S� A Zwe� l AUR 1287 IV 20. 5 Freundliche mündliche Mi� eilung der Grabungsleiterin Dr. Sabine Felgen-
hauer-Schmied. Die ergrabenen Mauerreste der Burg zeigen spätromanische Mauertechnik.
6 Vgl. Anm. 3.
213
Abb. 2 Baualterskizze auf Basis eines Vermessungsplans der Europäischen Bur-gendatenbank (EBIDAT), Oliver Fries und Ronald Woldron 2012:Die kleine Altburg des 13. Jahrhunderts (rot) wurde um 1320/1340 zu einem reprä-senta� ven Herrscha� ssitz ausgebaut (dunkelblau). Um 1378 (d) erfolgte die Errich-tung eines „Wohnturms“ (viole� ). Auch der Torturm könnte noch dem ausgehen-den 14. Jahrhundert angehören (hellblau). Auf spätgo� sche Bautä� gkeit des 15. Jahrhunderts geht unter anderem die große Vorburg zurück (grün). Die Ausbauten des 16. und 17. Jahrhunderts sind gelb zusammengefasst.
214
Beprobung von Wehrganghölzern des go� schen Bergfrieds. Als Bau-herr des Bergfrieds lässt sich damit Heinrich von Wallsee-Drosen-dorf fassen. Der Bergfried wurde burgsei� g an die ältere Schildmau-er des Kleinadelssitzes angefügt. Mit seiner durch die exponierte Felslage betonten, beachtlichen Höhe von rund 25 m belegt er den hohen Anspruch und sozialen Status der Herren von Wallsee-Dro-sendorf. An baulichen Details sind unter anderem das gefaste Werk-steingewände des rundbogigen Hocheingangs und die nachträglich vermauerten, go� schen Zinnen zu nennen. Das Erscheinungsbild des Bergfrieds prägte ehemals der unterhalb der Zinnen umlau-fende, hölzerne Außenwehrgang, dessen Balken noch zahlreich im Mauerwerk sitzen. Der gleichen großen go� schen Bauphase wie der Bergfried sind die an ihn anschließende Schildmauer, der südlich an die Altburg des 13. Jahrhunderts angefügte, große Wohnbau und die Reste einer weitläu� gen Ringmauer mit weiteren randständigen Gebäuden zuzuweisen. Wie bei großen Bauunternehmungen üblich, lassen sich mehrere Bauetappen unterscheiden. Die polygonal ge-führte Schildmauer, die den Burgbereich gegen das überhöhende Gelände sichern sollte, steht über eine Baufuge an den Bergfried an. Nicht mehr erhalten ist der zugehörige Torbereich, der bereits um 1380/1410 durch einen neuen Torturm ersetzt wurde. Die heu� gen Außenmauern der Kernburg gehen zumindest an der Basis noch teil-weise auf die Zeit um 1320/1340 zurück. Wie geringe Mauerreste belegen, besaß der südliche Bereich der Kernburg bereits früh eine randständige Bebauung. Er lag deutlich � efer als der große, saalar-� ge Wohnbau, der an die Südseite der go� sch ausgebauten Altburg des 13. Jahrhunderts angestellt wurde. Von diesem wohl repräsen-ta� vsten go� schen Wohnbau der Burg ist vor allem das nachträg-lich eingewölbte Untergeschoß erhalten. Ein von Süden vom Burg-hof aus in dieses Untergeschoß führendes Rundbogenportal wurde bereits im 14. Jahrhundert durch Neubebauung verstellt.
215
Ab 1371 befand sich die Herrscha� im Besitz der Herren von Tyr-na.[7] Unter ihnen wurde der Herrscha� ssitz architektonisch weiter ausgestaltet. Hervorzuheben ist der südlich des go� schen Wohn-baus situierte „Wohnturm“, der nachträglich in den go� schen Bur-ghof eingefügt wurde. Für zwei seiner originalen Bauhölzer konn-te dendrochronologisch das Fälldatum Winterhalbjahr 1378/1379 (d) belegt werden.[8] An baulichen Details sind das weite Rundbo-genportal des Untergeschoßes sowie Portal und Fenster des ers-ten Obergeschoßes hervorzuheben. Da das Miteinbeziehen älte-rer Mauerzüge sta� sch nachteilig war, wurde in das Untergeschoß ein starker Pfeiler eingefügt. Trotzdem musste der „Wohnturm“ im 17. Jahrhundert in großen Teilen erneuert werden. Möglicherweise ist auch die Errichtung des Torturms der Kernburg mit den Herren von Tyrna in Verbindung zu bringen. Dieser besitzt eine Tor- sowie eine Gehtürö� nung mit einfachen, später veränderten Werkstein-gewänden. Seine Mauerstrukturen s� mmen weitgehend mit de-nen des dendrochronologisch da� erten „Wohnturms“ überein. Er könnte daher gleichfalls noch im ausgehenden 14. Jahrhundert er-richtet worden sein, wobei eine etwas spätere Bauzeit nach 1411 – dem Besitzantri� der Herren von Ho� irchen – nicht ausgeschlossen werden kann. In die Zeit der Herren von Tyrna fällt zudem vielleicht auch die erste Erhöhung der Schildmauer.
1411 gelangte die Herrscha� an die Herren von Ho� irchen.[9] Ih-nen ist der großar� ge spätgo� sche Ausbau des 15. Jahrhunderts zu verdanken, der den Herrscha� ssitz gegen die damals rasant fort-schreitende Verbreitung und technische Weiterentwicklung von Feuerwa� en sichern sollte. Hervorzuheben ist die Anlage der spät-go� schen Vorburg, die neben den wehrtechnischen Aspekten auch wirtscha� liche Funk� onen erfüllen konnte. Dank dendrochronologi-scher Daten lässt sich ein entwickelter Baufortschri� bereits für die Zeit um bzw. nach 1450 unter dem Bauherrn Hans I. von Ho� irchen
7 TOPOGRAPHIE 1903, 305.8 Vgl. Anm. 3.9 ZAK 1895, 259 bzw. LICHNOVSKY 1839, 909, Nr. LXXXIV und 1218, Nr. CXIII.
216
nachweisen.[10] Nach Ausweis der baulichen Befunde begannen die Bauarbeiten mit der Errichtung des Hungerturms und der anschlie-ßenden westlichen Befes� gungsmauer. Mit dieser ersten Bauetap-pe wurde das zukün� ige Areal der Vorburg bereits de� niert. Ein im Vorraum des Hungerturms verbautes Bre� endet mit dem Jahrring von 1453 (d).[11] Planwechsel wie das Vermauern von bereits aus-geführten Schießfenstern des Hungerturms oder das nachträgliche Ausbrechen einer Poterne in der westlichen Befes� gungsmauer zei-gen einen komplexen Baufortschri� bzw. eine längere Bauzeit an.Gleiches gilt für das nachträgliche Ansetzen der Halbrondelle an der West- und Südseite. Der rondellar� ge äußere Torturm, der mit einer Zugbrücke ausgesta� et war und ein mit Wappenresten versehenes Spitzbogentor besitzt, verzahnt gleichfalls erst mit dem Mauerwerk der zweiten Bauetappe. Auch in seinem Fall legt ein Balkenrest eine Bauzeit bald nach 1450 nahe. Erst zuletzt wurden Hungerturm und Schildmauer der Kernburg mit einer Befes� gungsmauer, in die eine weitere Poterne integriert wurde, verbunden. Die Innenbebauung stand erst am Ende der spätgo� schen Bautä� gkeit im Bereich der Vorburg. Nördlich des Torwegs erfolgte erhöht die Errichtung eines kastenar� gen Wirtscha� s- und Speicherbaus, der mit einer Schmal-seite an die westliche Befes� gungsmauer angestellt wurde. Sein Obergeschoß war durch einen spitzbogigen Hocheingang erschlos-sen und herrscha� lich-repräsenta� v in Szene gesetzt. Ein weiterer langgestreckter Wirtscha� sbau entstand an der südlichen Befes� -gungsmauer, die teilweise der Innenbebauung weichen musste.
Dem gleichen bedeutenden Bauherrn – Hans I. von Ho� irchen – ist auch die Errichtung der rund 350 m nordwestlich der Burg situierten „Böhmischen Mauer“ zuzuschreiben. Sie verdient als eine im spät-go� schen Burgenbau des Herzogtums Österreich einzigar� ge Vor-befes� gung besondere Beachtung. Es handelt sich um eine rund 120 m lange Sperrmauer mit zinnenbekröntem Wehrgang, in die drei � ankierende Schalentürme eingebunden sind. Der mi ge Scha-
10 Vgl. Anm. 311 Vgl. Anm. 3.
217
lenturm besitzt als Torturm ein spitzbogiges Werksteingewände mit Vorrichtungen einer Zugbrücke. Wie bei der spätgo� schen Vorburg sind die Bauarbeiten anhand der bautechnischen Details bereits um 1450/1470 anzusetzen. Mit der Errichtung der Vorburg dür� en die ersten baulichen Veränderungen des go� schen Torturms der Kern-burg einhergehen. Das einfache Torgewände wurde nachträglich mit einer zeitgemäßen Fase versehen. Bedeutende bauliche Eingrif-fe erfolgten zudem in den Jahrzehnten um 1500. Das Obergeschoß des Turms erhielt west- und südsei� g zwei Flacherker, deren ho-her repräsenta� ver Anspruch heute nur noch den aufwändig pro-� lierten Kragsteinen zu entnehmen ist. Vermutlich erfolgte bereits damals die Abmauerung der Tordurchfahrt. Sie wurde durch eine südlich des Torturms errichtete Brückenkonstruk� on ersetzt. Wei-tere Detailbefunde zeigen, dass unter anderem auch die go� schen Wohnbauten der Kernburg in der späten Go� k s� lis� sch und funk� -onal adap� ert wurden. Den Zeitgenossen des beginnenden 16. Jahr-hunderts präsen� erte sich Kollmitz als repräsenta� ver und außer-gewöhnlich stark befes� gter Herrscha� ssitz.
Für die Jahre um 1590 kann eine weitere große Ausbauphase des Herrscha� ssitzes belegt werden. Inves� ert wurde dabei auch in die Wehrha� igkeit. Der Bauherr Wolfgang II. von Ho� irchen ließ unter anderem nach 1587 (d) den Wehrgangbereich der westlichen Be-fes� gungsmauer der Vorburg erneuern. Im Bereich der Kernburg sind zahlreiche Mauerreste der gleichen Bauphase erhalten, doch fällt heute vor allem der aufwändige Umbau des go� schen Wohn-baus auf. Er wurde im Sinne der Renaissance mit großen rechtecki-gen Fensterö� nungen und mit stuckierten Gewölben ausgesta� et. Seine feldsei� ge Außenmauer erhielt als Zitat der zeitgenössischen Festungsarchitektur eine gemauerte Böschung mit rundem Kordon-gesims. Ein dendrochronologisch beprobtes Ankerholz des Wohn-baus da� ert die Bauarbeiten in die Jahre um 1590 (d).
218
Im 17. Jahrhundert mussten im Bereich der südlichen Kernburg schwere Bauschäden repariert werden. Hervorzuheben ist der auf-wändige Neubau jener hohen Außenmauer, die den südlichsten Teil der Kernburg gegen Norden schützt. Sie lässt teilweise wiederver-wendetes Baumaterial der Renaissance erkennen. Ein zur Stabilisie-rung der Mauer eingefügter Eichenbalken endet – ohne Splint – mit dem Jahrring von 1628 (d).[12] Als Bauherr kann daher Hans Schub-hardt angenommen werden, der die Herrscha� 1637 erwarb und ab 1642 als freies Eigen besaß.[13] Der Wiederau au der Außenmauer war Teil eines umfassenden Bauprogramms, das unter anderem die weitgehende Erneuerung der Bebauung an der Südseite der Kern-burg beinhaltete und zu einer deutlichen Verkleinerung der Ho� ä-chen führte. Kennzeichnend für diese Bauphase ist die Gestaltung der Fassaden mit aufgemalten roten, gequaderten Kanten und Kor-donbändern; die vorgeritzten und gemalten Rahmungen der Archi-tekturö� nungen waren gleichfalls rot gefasst.
Im Jahr 1693 erwarb das Kloster Pernegg die Herrscha� .[14] Wie beachtliche Reste barocker Stuckdekora� onen belegen, folgte auf diesen Kauf zunächst die hochwer� ge Neugestaltung von Innen-räumen. Das Interesse am kostspieligen Erhalt des ausgedehnten Herrscha� ssitzes ging aber bald verloren. Der 1703 abgebrannte obere Turm wurde bis zum Verkauf der Herrscha� 1708 nicht re-pariert. Dieser Verkauf bedeutete das Ende der baulichen Inves� -� onen und die Burg geriet in Verfall. Köpp von Felsenthal zeichne-te Kollmitz 1814 bereits als dachlose Ruine, mit starken Bäumen auf den Mauerkronen (Abb. 3).
12 Vgl. Anm. 3. Ankerholz aus der Nordmauer des Wohnturms, Probe rkoqp13m, Holzart: Eiche, ohne Waldkante.
13 TOPOGRAPHIE 1903, 314.14 S� A Geras, Bestand Pernegg, Akten Kollmitz. Im Kau rief vom 10.8.1693 tri�
als Käufer Propst Franz Schöllingen für das S� � Pernegg auf.
219
Abb. 3 Köpp von Felsenthal, Ansicht der Burgruine Kollmitz, um 1814. NÖLB Top.-Smlg., St. Pölten, Inv.Nr: 3.432. Vgl. Andraschek-Holzer 2010, 38.
Die historische Situation im 17. und 18. Jahrhundert
Da die Herrscha� Kollmitz 1611 von Kaiser Rudolf II. wegen Steuer-schulden eingezogen wurde, endete die seit 1411 währende Herr-scha� der Familie Ho� irchen auf Kollmitz.[15] Kollmitz wurde von Drösiedl getrennt, das weiterhin im Besitz der Ho� irchen verblieb. 1616 wurde Georg Schü� mit der auf 37.349 � geschätzten Herr-scha� belehnt,[16] musste diese jedoch 1637 aufgrund von Schul-den verkaufen.[17] Hans Schubhardt, kaiserlicher Rat, erwarb 1637 die Herrscha� Kollmitz und wurde 1639 von Kaiser Ferdinand III. damit belehnt. 1642 wurde die Herrscha� gegen die Zahlung von 2.600 � zum freien Eigen erklärt. 1663 wird Kollmitz im Verzeichnis der Fluchtorte des Viertels ob dem Manhartsberg für den Fall dro-
15 REINGRABNER 2011, 363.16 TOPOGRAPHIE 1903, 314.17 S� A Geras, Bestand Pernegg, Akten Kollmitz A83/620/K430.
220
hender Türkeneinfälle genannt.[18] Auf dem ca. 600 m hohen Gipfel des Kollmitzbergs war ein Kreidfeuer installiert, welches als Glied ei-ner niederösterreichweiten Alarmierungske� e dienen sollte.Schubhardts Ehe mit Anna Elisabeth von Po� enstein blieb kinderlos, so adop� erte er am 5.12.1656 seinen Ne� en Hans Caspar Schub-hardt und setzte ihn zu seinem Erben ein.[19]
1675 erwarb Mar� n Eusebius Schä� el durch Heirat mit der Witwe Schubhardt die Herrscha� Kollmitz.[20] Der von Zeitgenossen als übel-berüch� gter Mensch bezeichnete Schä� el wurde in den frühen 1680er-Jahren wegen vorsätzlicher Krida inha� iert.[21] Eine unda� erte Eingabe seiner Frau Helena Constan� a bei den nie-derösterreichischen Landständen liegt im S� � sarchiv Geras auf. Sie versucht darin, das […] alte Herkommen des Landgerichts […] auf Kollmitz mit dem Vorhandensein einer Kammer für die peinliche Be-fragung im sogenannten Hungerturm der Vorburg zu legi� mieren.[22] Da sie jedoch keine schri� lichen Beweise vorlegen konnte, wur-den die Landgerichtsgrenzen neu gezogen. Wohl als symbolischer Akt wurde die neue Grenze zwischen dem Landgericht Raabs und Drosendorf [...] in bemelten Schloss mi� en durch die Tafelstuben […] gezogen.[23]
Der Erbe Carl Ferdinand Schubhardt verkau� e die Herrscha� 1693 an Propst Franz Schöllingen vom S� � Geras.[24] Dieser ließ das ge-samte Burg-Schloss Kollmitz großzügig renovieren und erweiterte die dem hl. Bartholomäus geweihte Schlosskapelle.
18 NEWALD 1883, 263.19 S� A Geras, Bestand Pernegg, Akten Kollmitz, No� zen des Archivars Johannes
MIKES.20 S� A Geras, Bestand Pernegg, Akten Kollmitz, Karton A81/620/K024.21 Vgl. KOUDELKA 1901, 132.22 S� A Geras, Bestand Pernegg, Akten Kollmitz, Buch 62-2, Handbuch 1673.23 S� A Geras, Bestand Pernegg, Akten Kollmitz, Karton A83/620/K210.
(Unda� erte Kopie aus dem Schlossarchiv Drosendorf.)24 Vgl. Anm 14.
221
In einem Herrscha� sanschlag von 1708 wurde Kollmitz jedoch be-reits von Kheller an bis an den Thachstuhl an villen Ohrten zer-schrickht beschrieben.[25] Propst Schöllingen dür� e wenige Jahre zuvor kaum noch Inves� � onen getä� gt haben, denn als 1703 nach einem Blitzschlag der Hungerturm ausbrannte, wurde das Dach in den fünf Jahren bis zum Verkauf nicht mehr repariert.[26]
Am 23. Dezember 1708 erwarb Franz Anton Edler von Quarient und Raall die Herrscha� Kollmitz und vereinigte diese mit der Herrscha� Raabs.[27] Er bewohnte das Burg-Schloss nicht mehr selbst und in der Folge kam es zum Verfall der Gebäude. Um 1760 bewohnte nur mehr der herrscha� liche Revierjäger mit seiner Familie den äuße-ren Torturm.[28]
Die bauhistorischen Befunde
Den dendrochronologischen Daten zufolge ist Hans Schubhardt für eine Reihe von umfangreichen Um- und Ausbauten verantwortlich. Kennzeichnend für diese Bauphase ist die Gestaltung der Fassaden mit aufgemalten roten, gequaderten Kanten und Kordonbändern; die vorgeritzten und gemalten Rahmungen der Architekturö� nun-gen waren gleichfalls rot gefasst. Da sich Reste dieser roten Fassa-dengliederung auch am Torturm und Wohnbau der Kernburg sowie am südlichen Wirtscha� strakt der Vorburg erhalten haben, darf von einer vollständigen baulichen Erneuerung des Herrscha� ssitzes aus-gegangen werden. Das architektonische Ergebnis der Bemühungen von Hans Schubhardt ist durch den Kupfers� ch von Vischer (1672) überliefert. Allerdings befanden sich die Baulichkeiten damals be-reits wieder in schlechtem Zustand (Abb. 4).
25 Vgl. KOUDELKA 1901, 136.26 KOUDELKA 1903, 134 � .27 Wie Anm. 19.28 KOUDELKA 1903, 136 f.
222
Abb. 4 Georg M. Vischer, Ansicht Kollmitz von Südosten, um 1672.Darstellung von Collmiz in Topographia archiducatus Austriae inferioris modernae / heervorgebracht im Jahr 1672 [...] Durch [...] Georg Ma� haei Vischer. NÖLB Top.-Slg., St. Pölten, Inv.Nr.: 3.431
Anhand von zwei Beispielen sollen die Befunde der Bautä� gkeit des 17. Jahrhunderts dargestellt werden.
Wohnturm:Beim Wohnturm handelt es sich um einen rund 8 x 10 m großen, ehemals viergeschoßigen Bauteil, der südostlich an den go� schen Wohnbau der Kernburg ansteht. Die Errichtung des Wohnturms konnte dendrochronologisch genau da� ert werden. Zwei original erhaltene Bauhölzer wurden im Winterhalbjahr 1378/1379 (d) ge-fällt.[29] Damit ist der Bauteil den Herren von Tyrna zuzuweisen, die die Herrscha� ab 1371 inneha� en. Der Wohnturm wurde in den damaligen Hofraum zwischen dem go� schen Wohnbau und einem an der östlichen Ringmauer der Kernburg stehenden Wirtscha� s-bau(?) eingefügt. Während der Wohnturm im Westen über Baufu-gen an den Wohnbau ansteht, sitzt er im Osten auf der ehemaligen
29 Vgl. Anm. 3.
223
Hofmauer des Wirtscha� sbaus auf. Den sta� schen Nachteilen die-ser Vorgangsweise wirkten die Bauleute mit einem mäch� gen, in das Untergeschoß eingefügten Pfeiler entgegen. Das heute großteils verschü� ete Untergeschoß besitzt hofsei� g ein weites Rundbogen-portal und ein kleines Rechteckfenster. Das erste Obergeschoß war über einen rundbogigen Hocheingang erschlossen, an dem sich ei-nige primäre Bauhölzer erhalten haben. Gleiches gilt für das östlich benachbarte Rechteckfenster. Der Nordteil des Wohnturms wurde in der ersten Häl� e des 17. Jahrhunderts gänzlich erneuert. Auf die-se Bauphase gehen unter anderem der Innenputz und die Fenster-ö� nungen des zweiten und dri� en Obergeschoßes zurück; hervor-zuheben ist zudem die au� ällige, rote Putzgestaltung der Fassaden (gequaderte Kordon- und Eckbänder) (Abb. 5).
Ein in der neuen Nordmauer des Wohnturms versetzter Eichenbal-ken wurde in den Jahrzehnten nach 1628 (d) gefällt. Als Bauherr
Abb. 5 Rekonstruk� on der Fassadengestaltung um die Mi� e des 17. Jahrhunderts auf Basis der vorherrschenden Befundsitua� on.
224
lässt sich damit Hans Schubhardt bes� mmen, der die Herrscha� ab 1642 als freies Eigen besaß. Er ließ mit großem � nanziellen Aufwand nicht nur den Wohnturm, sondern die gesamte Burg grundlegend
ausbauen. Nach 1693 – dem Jahr des Ankaufs der Herrscha� durch das Kloster Pernegg – erfolgte eine zeitgemäße Neuaussta� ung der beiden im Turm untergebrachten Wohnräume. Erhalten haben sich Reste von Stuckpro� len, für die der ältere Verputz aufgespitzt wur-de.
Kapelle:Zwischen dem go� schen Wohnbau und dem spätgo� schen Küchen-trakt be� ndet sich ein kleiner Anbau, der den vorderen, großen Hof der Kernburg vom hinteren, kleineren Hof trennt. Das erste Oberge-schoß des Anbaus wird aufgrund der barocken Stuckdekora� on tra-di� onell als Kapelle interpre� ert. Grundsätzlich lässt sich der An-bau in seiner heu� gen Form der Bautä� gkeit des Hans Schubhardt
Abb. 6 Segmentbogennische im Bereich der Burgkapelle mit Resten einer baro-cken Stuckrahmung. Kreuz, Bla� girlande, Muschel, naturalis� sche Zweige und Vo-luten aus bereits rela� v zarten, krau� gen Akanthusranken (Zustand: Jänner 2012).
225
– ab 1642 – zuweisen. Entsprechend ist die auf den kleinen Hof ge-hende Fassade mit roten, gequaderten Kordon- und Kantenbändern ausgesta� et. Für die Mi� e des 17. Jahrhunderts gibt es keinen bau-lichen Hinweis, dass der Raum als Kapelle genutzt worden wäre. Die barocke Stuckdekora� on des ersten Obergeschoßes gehört erst ei-ner jüngeren Bauphase an. S� lis� sch darf sie mit dem Erwerb der Herrscha� durch das Kloster Pernegg im Jahr 1693 in Verbindung gebracht werden. Dieser Befund unterstützt den Inhalt einer histo-rischen Quelle, dass der Propst Franz Schöllingen das ganze Schloss reparieren ließ, mehrere Gemächer hinzufügte und die dem hl. Bartholomäus geweihte Schlosskapelle erweiterte (Abb. 6 und 7).
Abb. 7 Barocke Stuckrahmung im südlichen Anraum zur Burgkapelle, vor der 2009 erfolgten Restaurierung durch Mag.a Beate Sipek.
226
Abb. 8 Typgleiches Stuckdekor um eine Rundbogennische an der Nordmauer der Klosterkirche Pernegg, aus der Zeit von Propst Schöllingen.
S� lis� sch und mo� visch lässt sich der Stuck etwa mit der Decke der Kaiserkapelle in der Kartause Mauerbach und den Stuckaussta� un-gen unter Propst Schöllingen im nahe gelegenen Kloster Pernegg (Abb. 8) und dem Pfarrhof von Harth vergleichen, die vermutlich in den späten 1690er Jahren entstanden.[30] Vor allem aber an den Trakten südlich und östlich des kleinen Hofes der Kernburg zeigt sich deutlich die massive Bautä� gkeit unter Hans Schubhardt. Hier wurden die bestehenden Bauteile durch Aufzo-nungen erhöht bzw. aufgrund von massiven Bauschäden völlig neu errichtet (Abb. 9).
30 HUBER 1999, 27f.
227
Abb. 9 Die großen Fensterö� nungen der Zeit ab 1642 sitzen in älteren, kleineren Fensterö� nungen der Renaissance; die Wölbungen der älteren Fenster können an-hand der Bogenansätze abgelesen werden (1). Die vergrößerten Fensterö� nungen durchbrechen die ehemalige Geschoßteilung, auf die Abdrücke der Geschoßbalken und ein Mauerrücksprung verweisen (2). Zudem wurde die Mauer entlang einer – durch Pfeile markierten – Baufuge erhöht (3). Die Befunde bestä� gen, dass Hans Schubhardt die zeitgemäße Vereinheitlichung der Fassaden seines Herrscha� ssit-zes mit beachtlichem Eifer verfolgte.
Zusammenfassung und Resümee
Nach kurzem und raschem Besitzerwechsel erwirbt Hans Schub-hardt 1637 die Herrscha� Kollmitz. Wenig später, im Jahr 1642 löst Schubhardt um 2.600 � Kollmitz aus der Pfandherrscha� und besitzt die Burg und die Herrscha� als freies Eigen. Den dendrochronologi-schen Daten zufolge kommt es in der Folge zu umfangreichen bau-lichen Maßnahmen auf Kollmitz. Hat man bereits unter den späten Ho� irchen auf Kollmitz einen renaissancezeitlich geprägten Bur-genbau zu erwarten, so erhält Kollmitz spätestens unter Schubhardt seinen schlossar� gen Charakter, der durch die Darstellung Vischers eindrucksvoll dokumen� ert ist. Ohne die dendrochronologische Da-
228
� erung von Ankerhölzern, im Bereich des mehrfach adap� erten go-� schen Wohnturms, wäre es durchaus möglich gewesen, die noch sehr der Renaissance verp� ichteten, einfachen Fassadengliederun-gen einer späten Ausbauphase unter den letzten Ho� irchen zuzu-weisen. Auch hat die penible Auswertung der vorhandenen Schri� -quellen dabei geholfen, den verantwortlichen Bauherren aus� ndig zu machen. Sowohl die bauhistorischen Befunde als auch der Quel-lenbefund, in Kombina� on mit den dendrochronologischen Ergeb-nissen, dokumen� eren eindrucksvoll einen bisher unbekannten frühbarocken Ausbau der Burg.
Die Maßnahmen unter Propst Schöllingen, die sich im Grunde nur auf eine Adap� erung der Räumlichkeiten beschränkten, lassen ihre eigentlichen Inten� onen nicht erkennen. Von Erich Kerschbaumer wurde die Vermutung geäußert, dass man kurze Zeit bestrebt war, ein „adeliges S� � “ auf Kollmitz einzurichten.
Unter den späteren Besitzern wird deutlich, dass Kollmitz trotz des Verlustes seines Sitzcharakters nicht als „ö� entlicher Steinbruch“ in Verwendung stand. Schon alleine die Tatsache, dass der herrscha� -liche Revierjäger mit seiner Familie den äußeren Torturm bewohnte, muss in diesem Fall als herrscha� licher Akt verstanden werden [31] Frühe Fotogra� en zeigen, dass Kollmitz weitestgehend als Ruine sich selbst überlassen wurde – schon alleine die intakte Befes� -gungsmauer der Vorburg indiziert, dass die Burg mit einem herr-scha� lichen Bann belegt war. Möglicherweise knüp� e sich direkt an das „Haus“ das Recht der Herrscha� . Diese Vermutung bedür-fe aber noch einer gründlichen Klärung und muss daher weiterhin Hypothese bleiben.
31 Eine ähnliche Situa� on � ndet sich auf der Schallaburg (pB Melk) wieder, wo die Torbauten die Namen „Jägerstöckl“ und „Försterstöckl“ tragen.
229
LITERATUR:
ANDRASCHEK-HOLZER 2010: Ralph Andraschek-Holzer, Amand Helm. Niederös-terreich zwischen Malerei und Fotogra� e. Weitra o.J. [2010], 38 (Kat.-Nr. 42).
HUBER 1999: Astrid Huber, Die Stuckaussta� ungen der Kartause Mauerbach. In: Österreichische Zeitschri� für Kunst und Denkmalp� ege, He� 2,3,4/1999, 27 f.
KOUDELKA 1901: August Koudelka, Sommerfrische Raabs an der Thaya und Um-gebung (Raabs 1901).
LICHNOVSKY 1839: Eduard Maria Lichnovsky, Geschichte des Hauses Habsburg, Bd. V (Wien 1839).
NEWALD 1883: Johann Newald, Die Fluchtörter und Kreudenfeuer in Niederös-terreich zur Zeit der drohenden Türkeninvasion. In: Blä� er des Vereins für Lan-deskunde N.F. 17 (Wien 1883), 263.
REINGRABNER 2011: Gustav Reingrabner, Grundherrscha� und Reforma� on am Beispiel Kollmitz-Drösiedl. In: Das Waldviertel, He� 4/2011, 345-373.
TOPOGRAPHIE 1903: Topographie von Niederösterreich, hrsg. Verein für Landes-kunde von Niederösterreich, Band 5 (Wien 1903).
ZAK 1895: Alfons Zak, Eibenstein und Primersdorf. Zwei Schlösser und Orte an der Thaja. In: Blä� er des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich, N.F. 29 (Wien 1895), 173-462.
QUELLEN:
S� A Zwe� l S� � sarchiv Zwe� l
S� A Geras S� � sarchiv Geras
NÖLB Niederösterreichische Landesbibliothek





























![Paláce hradu v Hazlově. [Res: Bauanfänge der Burg in Hazlov]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63226e04078ed8e56c0a685c/palace-hradu-v-hazlove-res-bauanfaenge-der-burg-in-hazlov.jpg)


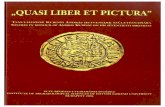
![Burgküchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Königreich Ungarn [Társszerző: Feld István]. In: Küche – Kochen – Ernährung. Hrsg.: Ulrich Klein – Michaela Jansen](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632751d1030a927336036a88/burgkuechen-des-mittelalters-und-der-fruehen-neuzeit-im-koenigreich-ungarn-tarsszerzo.jpg)

![Flucht aus der Burg. Überlegungen zur Spannung zwischen institutionellem Raum und kommunikativer Offenheit in den Minnereden [gemeinsam mit Jacob Klingner]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/634253483ba7d9573e0f625f/flucht-aus-der-burg-ueberlegungen-zur-spannung-zwischen-institutionellem-raum-und.jpg)






