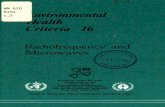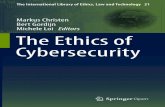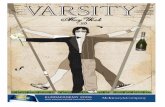# 620 "DIE PARABEL VOM GEFUNDENEN DIRHEM IN DER FRUNHEN ANATOLISCHEN VERSEPIK : BY MARKUS ...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of # 620 "DIE PARABEL VOM GEFUNDENEN DIRHEM IN DER FRUNHEN ANATOLISCHEN VERSEPIK : BY MARKUS ...
DIE PARABEL VOM GEFUNDENEN DIRHEM IN DERFRUNHEN ANATOLISCHEN VERSEPIK
Marlcus Kiiltbach
Es ist das Verdienst der Perser, nach der fslamisierung undRezeption arabischer Kultureinfliisse die von den Arabern ent-wickelten poetischen F ormen weiterentwickelt und um das Genreder Versepik bereichert zu haben. Die anatolischen Tiirken habenihrerseits diese Dichtungsgattung von den Persern iibernommenund in Ubersetzungen, Bearbeitungen und eigenen Sch<ipfungenweitergefi.ihrt.
Man kann diese Versepen, die man wegen ihrer paarweise reimen-den Halbverse,rnatnuwl nennt, nach ihrem Inhalt vereinfaehend inzwei groBe Gruppen unterteilen :
a) das rornantische Epos, das einen Stoff der arabischen oderpersischen Sage behandelt (2. B. Laila und Magnln, Sosrou undSlr-rn etc.), oft auch mehrere Verserzlhlungen, eingebettet in eineRahmenhandlung, zu einem Zyklus verbind"et (2. B. Haft peykar vonNizdmi etc.);
b) das religids-didaktische Epos, das entweder ein bestimmtesThema im allegorischen Kleid vorfiihrt, oder einzelne Betrachtung-€o, Parabeln ect., die bestimmte religiiise oder ethische Prin-zipien und Ansichten illustrieren, of! thematisch gruppiert, vereinigtz. B. Maulana Galaladd-in BEmis Matnawi-yi ma'natni)
fn den Werken dieser zweiten Gruppe finden wir immer wiederStiicke, die einem traditionellen, weitverbreiteten Themen- undMotivschatz angehciren. Leider fehlt bis jetzt eine systematische
MARICUS KOHBACH
Sichtung und Klassifikation dieser stiindig wiederkehrendenGrundmotive - zweifellos eine Sisyphusarbeit in Anbetracht deri.iberreichen Fiille religicis-didaktischer Matnawls in persischerund tiirkischer Sprache -, doch wiirde ein solches Hilfsmittel diekomparatistische Forschung in diesem Bereich wesentlich fcirdernund erleichtern').
In der vorliegenden Arbeit soll ein solches Motiv, das uns indrei wichtigen Werken der anatolischen Verspik des 13. und 14.
Jahrhunderts begegnet, nd,ner untersucht werden.
Es handelt sich um die Parabel vom gefundenen oder ge-schenkten Dirhem : mehrere Reisende, die untenvegs zusam-mentreffen, aber einand.er nicht verstehen, finden einen Dirhembzur. erhalten ihn geschenkt. Miide und erschcipft von ihrer Wan-derung, md,chte ein jeder von ihnen damit in der n[chsten StadtTrauben kaufen. Da aber keiner die Sprache der and.eren versteht,kommt es trotz des gleichen Wunsches zum Streit, der erst durch dasFingreifen- eines weisen, sprachenkundigen Mannes geschlichtetwerden kann. An diese Parabel schlieBt eine religiiise Betrachtungan iiber das menschliche Streben, das oft auf das gleiche Ziel - inletzter Konsequenz GoLt - gerichtet ist, aber infolge der menschli-chen Unzuliinglichkeit zu Gegensatz und Entzweiung fiihrt.
Neben dieser religirisen Tiefendimension d.er Parabel bietet der?iuBere Rahmen - das gegenseitige Nichtverstehen der einzelnenReisegeflhrten - dem Dichter die Mciglichkeit, Vertreter ver-schiedener ihm bekannter Volksgruppen redend einzufiihren undseine Sprachkenntnisse ztt zeigen. Nicht zufii.llig stammen diehier zusammengestellten Versionen aus dem anatolischen Raum des
13. und fri.ihen 14. Jahrhund"erts, einem Bereich mit hcichst kom-plexer ethnischer und kultureller Situation.
1 Einen wesentlichen Beitrag zur Sichtung und Klassifizierung von Mo-tiven in der persischen Epik bildet das Werk'von Hellmut R'ttter' Das Meerder Seele. Mensch, Welt und Gott in den Geschichten des Fariduddin 'A16r,Leiden, 1955. Ritter analysiert nicht nur die poetischen Stilmittel und religids-rnoralischen Grundgedanken, sondern auch die Erzlihlmotive im Werk diesesDichters.
DIE PARABEL VOM GEF'UNDENEN DIRHEM
Die erste Fassung unseres Motiv stammt von Mauland Galdladdin
R[mi (1207-1273), aus seinem Hauptwerk Matnnwi-yd ma'nawL
Dort sind es vier Md.nner, ein ,Perser, ein Araber, ein Grieche und
ein Tiirke. Die Wechselred.en der vier lauten') :
car kas-ra dad mardi Yek deramdn yeki goft in be-angrlrl dahamdn yeki digar 'arab bod goft 16
man 'enab b*aharn na angiir eY da$a
dn yeki torki bod o goft in beni.im
man nemib-aham 'enab b-aham iiziimdn yeki rlmi begoft in qil-ratark kon b*ahim estafil-ra
Ein Mann schenkte vier Leuten einen Dirhem./ Der eine sagte:<<Den will ich fiir d,ngur ausgebenlr>
Der andere war ein Araber und sagte : <Nein,/ ich will 'inab, keineangur,d.u Schurke!>
Der dritte war ein Tiirke und sagte: <Diesler Dirhem] ist mein,/ich will ke{ne'i,nub, ich will itaiim!>>
Der vierte, ein Grieche, sagte : <<LaB dieses Gerede,/ wir wollen
6tarpj,(r !;Mit Ausnahme der arabischen Negation la und. des tiirkischen
Genetivs vom,Personalpronomen der 1. Person Sg. beniim beschr[nktsich Rtmi auf die Wiedergabe des Wortes fiir Trauben in den vierSprachen, pers. d,ngfir, arab. 'inab, tirk. iniim und griech' estd-
lil ( 6raV0,Ar ). Rumi waren diese Sprachen vertraut und geliiufig, er
lebte in Konya, der Residenzstadt der Rumseldschukensultane,
wo die Ttirken die fiihrende schicht bildeten, er sebst war ira-nischer Herkunft und sprach Persisch als Muttersprache, Arabisch
war die sprache muslimischer Theologie und wissenschaft, seine
zweite Frau Kera ( K0pc ) Hat[n'. griechischer Herkunft.
2 Die zitierte Stelle findet sich im Matnawi-gi'3861 ff.
3 Ndheres iiber Kera $ltiin bei SAMS AL-DINal-'erifin, Tahsin YAZ-ICI ed', 2 Bde., Ankara, 1959-1961
(s. Index).
n1,a'ne'wl, 2. Buch, V.
AL-AFLAKI, Man6$ib(T'IK, III, 3), passim
502 MARKUS KOHBACH
Eine weitere Version dieser Parabel findet sich im MatnawiKi,tdb al:i,Yrde des anatolischen Dichters N69irin, das 699 H./ 1299'
1300 vollendet wurde. Bei Na$iri sind es nur zwei Wanderer, einAraber und ein Tiirke, die.gemeinsam nach Aleppo unterwegs sind.Ihr Gespriich lautetu. :
dn 'arab gofti wagadnd dirhamdgrin 'an6 gurlrun wagad[n6] marhamdin yakun waglun lana sfiqu l-t{alabastari min dalika s-sfiqi l-'inabtork goftd gun geleb lutf eYlediaqge wirdi aglarrnr toyladr.gtn l.{alebe warawuz i5it sdziimaqge wirtib alawuz andan iiziim
Jener Araber sagte : <Wir haben einen Dirhem gefunden,/ da
[uns] eine wunde quiilte, haben [wir] ein Heilmittel gefunden.
Wenn wir den Markt von Aleppo erreichen,/ kaufe ich von jenem
Markt Trauben>>.
Der.jliirke sagte : <<Da uns Gott Gnade erwies,/ gab er Geld und
s?ittigte seine Hunrigen.
Slenn wir Aleppo erreichen, hijre mein Wott,/ geben wir das GeId
[her] und kaufen dort Trauben>.
4 uber Ndsiri vgl. KILISLI MU,ALT.IM RIF'AT IBILGEI, Sulten Veled
ile mu,dsrr iki Ttirk sa,iri, in: Tiirk Yurdu 5.25.7927.64-88' und Franz
TAESCHNER, Der anatolische Dichter Ndsiri (um 1300) und sein x'utuvvet-neme, Leipzig, Ig44 (Abhandlungen fi.ir die Kunde des Morgenlandes, XXIX, 1)'
besonders pp. 81-98 (zurn Ki,tab al,:isrdq).In beiden Publikationen werden die
tiirkischen Textproben aus dem Werk des Dichters mitgeteilt'5 Das Kitab al:israq ist in fiinfzig 'israqat unterteilt, die Parabel vom
gefundenen Dirhem bildet den Inhalt des 25. 'iiraq. Das Werk ist in zwei Hand-
schriften i.iberliefert, beide in Istanbul, Kiipriilii 159? und Veliyiiddin 1630' vgl.
TAESCHNER, op. cit., p. 81. Wiihrend die verse, dlie die Rede des Tiirkenenthalten, bereits publiziert voriiegen, war es notwendig, fiir die Rede des Ara-bers die Haridschriften heranzuziehen. Ich folge in der Fassung des Textes der
iilteren Hs. I(dpriilii 1597 aus dem Jahr 840 H./1436-37. Herr Dr. Klaus Kreiser,
universitiit Miinchen, war 'wtihrend seines Aufenthalts am Deutschen
Archiiologischen Institut in Istanbul so liebenswiirdig, die EIs. fiir mich einzu-
sehen, woftir ihm an dieser Stelle besonders herzlich gedankt sei.
DIE PARABEL VOM GEX''UNDENEN DIRHEM
Na$iri bringt im Gegens alz zu R[mi ein regelrechtes Gesprtich
der Reisegef?ihrten in ihren Sprachen' Wiihrend die tiirkischen
verse zwar einfach, aber grammatikalisch und metrisch korrekt
gebaut sind., sind d.ie arabischen etwas ungelenk -
konstruiert'
Iie persische Konjunktion tAn im zweiten Halbvers der Rede des
Arabers ist entweder vom persisch schreibenden Autor eingefiigt
oder ein zeichen fiir einen stark iranisierten arabischen Dialekt'
der dem Autor geliiufig war.
Nagirl war Tiirke, nach eigener Aussage verfaBte er sein Kitab
al-'i,hraq in Tokat und zwar in Persisch, der gehobenen Hof-und
Literatursprache seiner Zeit. Die - wenigstens elementare_- Kenntnis
des Arahischen war fiir einen Literaten dieses Kulturraumes
sebstverstiind.Iich.
Die dritte und ausfiihrliehste Abwandlung des Motivs vom ge-
fundenen Dirham liegt im Garlbname des 'Agrq Paga vor, vollendet
7g0:H./l3S0.WiebeiRumisindesauchhiervierPersonen,einAraber, ein Perser, ein Tirrke und statt des Griechen ein Armeni-
er, ihre Reden sind aber - wie bei N69iri - zu vollen Sdtzen erweiterto. :
dil ayruq illa dilek bir idibir igit kim her biri ne d6rdi
lLk af$z 6tdi dilince ol 'arabqdla Yd aghdbuna h6tLr l-'inabpdrsi eYdiir be-in ang[r f*arimb*o5 beham bendaste 6n-ra bworimtiirkmen eydiir iiziim aluj yiyeliimbu ugaq kelecileri qoYalum
6 Eine Ubersicht iiber die zahlreichen Manuskripte des Garibndme in
italienischen Bibliotheken gibt der ausgezeichnete Aufsatz von Elttore Rossl'Studi su manoscritti del Gir-ibname di 'Asrq Pasa nelle biblioteche d'Italia' in:
Rivista degli stutti orientali 24.7-4.7949.708-119. Dort wird auf p' 113 die vorlie-
gende Geschichte mit Textvarianten auf Grund der in Italien befindlichen Ma-
nusxripteundderPariserHandschriftMs'turcSlSmitgeteilt'ZtrrrweiterenVergteich habe ich die Wiener Handschrift Mxt. 452, O.N.B., Wien, fol. 320r,
hera'ngezogen. Das Gariby&me ist in zehn bab ^) je zehn dastan untetteilt' die
Parabel vom gefundenen Dirhem bildet den zehnten ila,$an des ersten bab'
504 . MARKUS KoHBACH
ermeni eydiir yes xalol k'owzemt"e xalol darnus yes ... xowzemT.
[Ihre] Sprache war verschieden, aber der Wunsch eins./ Hdre wasein jeder'von ihnen sagte!
Zuerct begann der Araber in seiner Sprache,/ er sagte : <<Oh, meineGefdhrten, gebt Ttauben her!>>
Der Perser sagte : <Damit wollen wir Trauben kaufen,/ wir wollenuns froh zusammensetzen und sie essen!>>
Der Tiirkmene sagte : <<Kauft Trauben, wir wollen sie essen,/ diesekindishen Reden wollen wir lassen!>>
Der Armenier sagte : <<fch mcichte Trauben,,/ wenn du keine Traubenkaufst, suche ich nach ...>
? M. F uad KOPRULU erwiihnt diesen armenischen Vers in seinem Auf-$atz: Ttirk edebiyatr'mn Ermeni edebiyatr iizerindeki te'sirleri, in: EdebiyatAragtrrmalan, Ankara, 1966, pp. 254-255, Anm. 23 (der Aufsatz erschien bereitsin der Edebiyat tr'aktiltesi Mecmuasr 2.!.7338/L922.1-30), wo er feststellt, daB
sich im ersten Halbvers lediglich die Wdrter aa'trol k'owzem - ieh mdchte Trau-ben - eindeutig erkliiren lassen. Auch ROSSI, op. cit,, p. a74, sagt, daB
blo8 das Wort xolol, - Trauben - auBer Zweifel steht, wiihrend die iibrigen Wtjr-ter durch Abschreibefehler so entstellt seien, daB erst eine mdglichst umfas-sende Kollation der handschriftlichen Varianten die Grundlage fiir eine befrie-digende Erkliirung liefern k6nnte.
Das erste armenische Wort, das in den Handschriften als GYB, CS, CyS,GYZY, YS iiberliefert wird, ist aller Wahrscheinlichkeit nach das Personalprono-men der 1. Pers. Sg. es (altarmen, ies). Es wtire denkbar, daB der i-Vorschlagdialektal zu g/c wird. Die Wcirter nal,ol, k'owzezr stehen au8er Zweifel. Imzweiten Halbvers ist die Wortgruppe t'e ualol Q&rnus eindeutig, das Verbumim zweiten Satzteil, das in verschiedenen Varianten iiberliefert ist, am ehestenals *owzem - ich suche, ich schaue nach etc, zu interpretieren. Das Schltissel-wort des zweiten Halbverses muB vorderhand unerkliirt bleiben. Die Hs. Vat.Turco 148 bringt im zweiten Halbvers einen vijllif anderen Text (s, ROSSI,op. cit., p. 113, Anm, ?) | iST'KI 'NzD 'WR yYS H'EG PRYM. ohne besondereManipulation liiBt sich dieser Halbvers lesen als: astak ind,z dousr Aes salol,perem - Gib mir das Geld! Ich bringe Trauben.. Ich darf an dieser Stelle den verehrten PP. Paul und Simon von derMechitaristenkongregation Wien, Herrn Dr. Kevork Bardakjian, Universityl-,ibrary, Harvard University, Cambridge, Mass., und Herrn Dr. Ralf-Peter Rit-ter, Osterreichische Akademie der 'Wissenschaften, Iranische Kommission, fiiri,hre freundliche Hilfe bei der Lesung und Interpretation des armenischen Ver-ses sehr herzlich danken.
DIE PARABEL VOM GEF'''UNDENEN D]RHEM 505
Agrq Paga, d.er bereits in Tiirkisch schreibt' bringt in den
worten des Arabers neben dem verbum q6ld, 111ltt eine kurze, auf-
fordernde Phrase. In der Rede des,Persers fii.ilt die Form benXaste<
be-nesasteauf,dasPPPinVerbindungmitdemPrlfixbe.,wodurchdas Partizip dem hortativen Hauptverb im satz beigeordnet wird'
Die Lesung und Interpretation der Aussage des Armeniers wirfteinige Probieme aut; wir miissen davon ausgehen' daB das in Ana-
tolien gesprochene westarmenisch des friihen 14. Jahrhunderts nach
aem CenOr mit den unzureichenden Md'glichkeiten der arabischen
schrift fixiert und von Kopisten weiter entstellt wurde. Trotzdem
liiBt sich mit Ausnahme des schliisselwortes im zweiten Halbvers
der Satz einigermaBen befriedigend. deuten. vielleicht wird hier
einmal eine Kollation der wesentichen Handschriften fiir eine kriti-
sche Edition eine brauchbare Lesung liefern, die eine passende In-
terpretation zulii.Bt'.
Diese drei Fassungen eines gbngigen Themas zeigen uns die
Entwicklungderversepit<inAnatolienvomPersischenzumTiir.kischen, das sich aUmatrlctr als Verwaltungs - und Litepatursprache
durchzusetzen und zu entwickebr beginnntn' Sie reflektieren sehr
anschaulich d.ie ethnolinguistische und kulturelle Situation dieses
Gebietes im 13. und 14. Jahrhundert, eine situation, die trotz der
Dominanz des tiirkischen Elements in der weiteren historischen und
kulturellen Entwicklung bis zum Beginn unseres Jahrhunderts fort-
8 Das fragliche wort ist in den schreibungen 'LK, aLuK,'LRK' aLLaRKi'
iiberliefert. Die von den Mechitaristenpatres vorgeschlagene Lesung arok'
-Branntwein.scheidetaus,obwohlsieimKontextSinnergebenwiirde,dadieses Wort von arab. 'ara'q hetstammt und wohl kaum in so verstiimmelter
Formwiedergegebenwordenware'AuchdieLesungetrok-Etdbeere-istprob-lematisch,daeineWiedergabealsAel'ek/gitrekodersogatgi't'ekzuerwartenwiire(dastiirkischeWortfi.irErdbeeregl,teksolTeinarmenischesLehnwortsein von altarmen. i'elak) '
9 Bereits im 13. Jahrhundert existierte in Anatolien, zwat noch im Schat-
tendesPersischen,eineKunstliteraturintiirkischersprache(z.B.Dehhenl'$eyyed Hamza). Der ErlaB des KaramanoSlu Mehmed Beg nach der Einnahme
**vu" :f277, im amtlichen verkehr nur mehr das Tiirkische zu verwenden, hat
sicher auch seine Auswirkungen auf die Literatur in ti.irkischer Sprache gehabt'
In den Werken von Sullan Veled, Y[nus Emre und 'Agrq Paga erweist sich das
Tiirkischeinaltertiimlicher,verhiiltnismiiBigreinerFormdengestelltenlite-rarischen Anforderungen bereits durchaus gewachsen'
MARKUS KoHBACH
bestand. Daher bot d.ieses Motiv den Autoren, d.ie diesen verhd,ltnis-sen entstammten, die willkommene Mriglichkeit, ihre sprachkenntnis-se zu zeigen. Zwar finden wir in den Werken d.er drei hier behan-delten Dichter vieifach kiirzere oder lii,ngere Einschiibe in anderenSprachen, die - speziell die tiirkischen verse bei tlraulana GalaladdinR[mi als friihe anatolischtiirkische sprachdenkmli.rer - bereits ge-sammelt und publiziert vorliegen, doch kommt es besonders bei un-serem vorliegenden Motiv, dem letztlich der Gedanke der babyloni-schen sprachen verwirrung zugrundelie gt, zu einer reizvollen ver-bindung der verschiedenen in Kleinasien gesprochenen sprachen.Das Grundmuster der Parabel ist bei allen drei herangezogenenAutoren gleieh, die Ausfi.ihrung variiert in der Anzahl der personenund ihrer Nationalitdt, im umfang der einzernen sprachproben undbei Na$iri durch die Einfiihrung von Aleppo als Reiseziel, wod.urchder Erziihlung konkretes Lokalkolorit gegeben wird.
Die religitise Ausdeutung der Parabel differiert bei den ein-zelnen Dichtern, die alle vereinfachend der Mystik zuzuzd,hlen sind,in besonderen Auancen des sufistischen Gedankengutes, eine einge-hende Analyse der Standpunkte tiberschreitet den Rahmen unserervergleichenden literarischen Betrachtung und ist Gegenstand reli-gions - und geistesgeschichtlicher Interpretation.