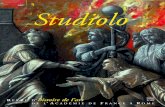Neuvermessungen der Gewaltgeschichte. Über den \"langen Ersten Weltkrieg\" (1900–1930), in:...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
4 -
download
0
Transcript of Neuvermessungen der Gewaltgeschichte. Über den \"langen Ersten Weltkrieg\" (1900–1930), in:...
Mittelweg 36 1–2/2015 225
Nr. 1 April / Mai 2015 Hamburger Institut für Sozialforschung
Beilage zum Mittelweg 36
Christoph Nübel Neuvermessungen der Gewaltgeschichte Über den »langen Ersten Weltkrieg« (1900–1930)
Gewalt, wohin man schaut: Im 21. Jahrhundert scheinen sich, so wird mit Blick auf die Krisenherde der Gegenwart argumentiert, deutliche Parallelen zu den ersten Dekaden des 20. Jahrhunderts aufzutun. Letztere gelten in der Geschichtsschreibung als eine Epoche, die ein bislang nicht gekanntes Aus-maß an Leid und Unterdrückung kennzeichnet. Die Gewaltgeschichte Eu-ropas – die freilich nicht auf den Kontinent selbst beschränkt bleiben kann, da Gewalt einer seiner bevorzugten Exportartikel war – hat in den letzten Jahren erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Drei neuere Entwick-lungen werden in der jüngeren Forschung sichtbar. Sie hat sich erstens von ihrer Fokussierung auf den Holocaust als »the defining event of the twen-tieth century«1 gelöst und fragt inzwischen allgemeiner nach der Bedeu-tung von Gewaltereignissen, ohne deren Relevanz allein aus einem Zusam-menhang mit der NS-Vernichtungspolitik abzuleiten. Gleichwohl werden diesbezügliche Debatten immer wieder geführt, zumeist auf nur dünner empirischer Basis. Zweitens widmet sich die Forschung nun zunehmend Akten und Dynamiken der Gewalt, die sie als Formen sozialer Praxis be-greift, anstatt nur nach ihren Ursachen und Folgen zu fragen, womit die ei-gentlichen Gewaltpraktiken unberücksichtigt bleiben würden. Gewalt ist drittens sogar zu einem historiografischen Narrativ geworden.2
1 Mark Mazower, »Violence and the State in the Twentieth Century«, in: American Historical Review 107 (2002), S. 1158–1178, hier S. 1159. – Ich danke Christina Müller und Andreas Weiß für ihre hilfreichen Anmerkungen sowie den Studentinnen und Studenten der Humboldt-Universität zu Berlin, die während eines Seminars zahlreiche Aspekte dieses Aufsatzes mit mir diskutiert haben.
2 Gewalt strukturiert Jörn Leonhards Gesamtdarstellung und ist die neue Klammer für Benjamin Ziemanns Einzelstudien zum Ersten Weltkrieg. Vgl. Jörn Leonhard, Die Büchse der Pandora. Geschichte des Ersten Weltkriegs, München 2014; Benjamin Ziemann, Gewalt im Ersten Weltkrieg. Töten – Überleben – Verweigern, Essen 2013.
Literatur
226 Mittelweg 36 1–2/2015
Die neuere Gewaltgeschichte erhebt den Anspruch, Gewalt nicht mehr nur in ihren Repräsentationen, sondern auch in ihren konkreten physisch- materiellen Auswirkungen auf Individuen und Gesellschaften zu analysieren. Sie will akteurszentriert vorgehen und den Entstehungsbedingungen verlet-zender Praktiken und ihren Folgen nachspüren, indem sie auf neuere An-sätze aus Disziplinen wie der Soziologie zurückgreift. Randall Collins geht in seiner Mikroanalyse der Gewalt im Krieg und auf der Straße davon aus, dass Gewalt kein Sonderfall, sondern eine alltäglich verfügbare Ressource ist. Der Wert seines Modells liegt vor allem darin, dass es Emotionen wie Angst einbezieht und auf die Dynamiken verweist, die einem Gewaltaus-bruch vorgelagert sind.3
Das ambitionierte gewaltgeschichtliche Forschungsprogramm wird nicht immer umgesetzt. Der Gewaltbegriff ist zwar in Mode gekommen, fungiert aber zuweilen nur als neues Label für altbekannte Themen. Ganz zu Recht wurde deshalb seine Omnipräsenz kritisiert,4 da viele Werke ähn-lich wie manche Forschungen zum Raum oder zu Diskursen diese Vokabel nur im Titel tragen, ohne das Konzept tatsächlich zum Gegenstand der Ana-lyse zu machen. Dessen ungeachtet hat sich die Gewalt in vielen Fällen als nützlicher Leitfaden für die Erforschung und erzählerische Darstellung his-torischer Ereignisse erwiesen. Hervorzuheben ist, dass zahlreiche Gewalt-geschichten tatsächlich der immer wieder zu vernehmenden Forderung Folge leisten, vergleichend zu arbeiten, Transfers zu berücksichtigen und globale Zusammenhänge in den Blick zu nehmen.
Dieser Beitrag stellt neuere Publikationen zur Gewaltgeschichte Euro-pas im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts vor, um die zentralen Forschungs-fragen und -kontroversen zu identifizieren und sie zu neuen, übergreifenden Deutungsansätzen zu verdichten. Als analytische Klammer dient der »lange Erste Weltkrieg«, der auf eine Forschungsagenda verweist, die globale Transfers und Kontinuitäten der Gewalt in einer Epoche herausarbeitet. Ihr chronologischer Rahmen wird ungefähr von den Jahren 1900 und 1930 mar-kiert. Der »lange Erste Weltkrieg« löst sich also von den Fluchtpunkten wie 1914, 1918 oder 1945, die das konkurrierende Konzept des »zweiten Dreißigjährigen Krieges« beherrschen. Anhänger des letzteren neigen dazu,
3 Zu diskutieren wäre, wie sich die aus gegenwartsbezogenen Daten gewonnenen Befunde historisieren lassen (Randall Collins, Dynamik der Gewalt. Eine mikrosozio-logische Theorie, übers. von Richard Barth und Gennaro Ghirardelli, Hamburg 2011). Allgemein zur neueren Gewaltforschung vgl. Jan C. Behrends, »Gewalt und Staatlich-keit im 20. Jahrhundert: Einige Tendenzen zeithistorischer Forschung«, in: Neue Politische Literatur 58 (2013), 1, S. 39–58. Programmatisch dazu Jörg Baberowski, »Gewalt verstehen«, in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 5 (2008), 1, S. 5–17.
4 Valentin Groebner, »Schock, Abscheu, schickes Thema: Die Kulturwissen-schaften und die Gewalt«, in: Zeitschrift für Ideengeschichte 1 (2007), S. 70–83, hier S. 71 f.
Mittelweg 36 1–2/2015 227
den Ersten Weltkrieg nur als Vorläufer des Zweiten zu sehen und mit einer fragwürdigen Periodisierung wichtige Linien abzuschneiden.5 Die hier vor-geschlagene Agenda dagegen problematisiert Lern- und Austauschprozesse in ihren zeitgenössischen Kontexten und bezieht sie auf das Großereignis Erster Weltkrieg. Denn die Gewaltgeschichte Europas beginnt nicht erst 1912 oder 1914, sondern hat ihre Vorläufer in den Kolonialkriegen, und der »lange Erste Weltkrieg« endete nicht 1917 oder 1918, sondern die durch den Krieg zusätzlich angefachten Gewaltpraktiken und -repräsentationen exis-tierten fort.6 Es geht indes nicht darum, Gewaltereignissen nur dann eine Forschungsrelevanz beizumessen, wenn sie sich in den Kontext des Ersten Weltkrieges stellen lassen. Vielmehr sollen die Voraussetzungen und Folgen der Gewalt zwischen 1900 und 1930 präziser als bisher bestimmt werden. Damit ermöglicht es die Agenda, Strukturen von langer Dauer zu identi-fizieren und sie gegen situative Momente zu gewichten. Der Staatenkrieg 1914 bis 1918 steht deshalb nicht mehr allein im Zentrum – gerade die Betei-ligung nichtstaatlicher Akteure drückte den Konflikten, die sich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts inner- und außerhalb Europas ereigneten, ih-ren Stempel auf. Es wird deutlich, dass die Staatsgewalt in dieser Zeit nicht mehr unangefochten war und die Gewalt von der Entstehung, Neuerfin-dung oder Abwesenheit von Staaten geprägt wurde.
Die Annäherung an die Gewaltgeschichte Europas in der Zeit des »lan-gen Ersten Weltkrieges« erfolgt in drei Schritten. Zunächst ist zu zei-gen, dass der Erste Weltkrieg nur sehr selektiv mit Mitteln der Gewalt-forschung in den Blick genommen wird. Gewalt wird vor allem abseits der Frontlinien untersucht, was auf eine fortbestehende Trennung zwischen Militärgeschichte und Gewaltgeschichte hindeutet. Anschließend wird die Chronologie des »langen Ersten Weltkrieges« diskutiert. Die vorliegenden Befunde und Desiderate lassen es notwendig erscheinen, das erste Drittel des 20. Jahrhunderts neu zu unterteilen sowie die Kolonialkriege und Nach-kriege stärker in die europäische Gewaltgeschichte einzubeziehen. Schließ-lich werden räumliche Ansätze der Gewaltgeschichte vorgestellt, anhand derer sich Gewaltdynamiken und -legitimationen analysieren lassen. Ihr Potenzial ist aber bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
5 Jörg Echternkamp, »1914–1945: Ein zweiter Dreißigjähriger Krieg? Vom Nutzen und Nachteil eines Deutungsmodells der Zeitgeschichte«, in: Sven-Oliver Müller / Cornelius Torp (Hg.), Das Deutsche Kaiserreich in der Kontroverse, Göttingen 2009, S. 265–280.
6 Zur zeitlichen Neuvermessung des 20. Jahrhunderts vgl. Anselm Doering-Manteuffel, »Die deutsche Geschichte in den Zeitbögen des 20. Jahrhunderts«, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 62 (2014), S. 321–348.
228 Mittelweg 36 1–2/2015
Der Erste Weltkrieg als Kristallisationspunkt der GewaltIn der Weltkriegsforschung dominierten lange politik- und sozialgeschicht-liche Fragen ohne Bezug zur Gewaltthematik. Auch die Alltags- und Men-talitätsgeschichte verzichtete zunächst auf eine Gewaltanalyse, bis immer mehr Stimmen dafür plädierten, das Töten und Verletzen als zentralen Akt des Krieges zu diskutieren. Mittlerweile versteht die Wissenschaft den Ers-ten Weltkrieg als »Laboratorium der Gewalt«.7 Aus der Vielzahl der neuen Schwerpunktsetzungen werden im Folgenden zwei Bereiche näher beleuch-tet: Gewalt an der Front und Gewalt gegen Zivilisten.
Das Töten an der Front wird im Gegensatz zu Themen wie Kriegsdeu-tungen oder Besatzung immer noch als ein Randphänomen behandelt. Ei-nige Darstellungen geben nur knappe Hinweise auf das Grauen an der Front und illustrieren es mit Todesziffern, die miteinander geradezu im Wettbe-werb zu stehen scheinen. Die Betonung hoher Opferzahlen dient einer »Dämonisierung des Kriegsschreckens« und soll darüber hinaus die Rele-vanz der Arbeit des Historikers unterstreichen, der sich offenbar mit ent-scheidenden Wegmarken des Ersten Weltkrieges beschäftigt. Dass er damit vor allem die nationale Erinnerungskultur bestätigt und Geschichtspoliti-kern Munition liefert, steht auf einem anderen Blatt.8 Tatsächlich sind die Aspekte der Kampf- und Durchhaltebereitschaft für den Zweiten Weltkrieg wesentlich besser untersucht als für den Ersten, auch wenn es an Versuchen der Verallgemeinerung nicht gefehlt hat.9 Eine ähnlich ausführliche De-batte, die entweder die Ideologie oder die Sozialstruktur für das Tötungs-handeln verantwortlich macht, wurde aber noch nicht geführt.10 Statt-dessen sind eine ganze Reihe von Faktoren benannt worden, die hier nur angedeutet werden können.11 Für die Kampfbereitschaft war sicherlich das institutionelle Korsett entscheidend, in dem die Soldaten agierten. Inwie-weit Taktiken wie das Stoßtruppverfahren oder die Tiefenverteidigung das
7 Zur Gewaltforschung zu 1914 bis 1918 vgl. Ziemann, Gewalt, S. 7–17, Zitat 15. 8 Für die Genozidforschung siehe die kritische Position von Christian Gerlach, Extrem
gewalttätige Gesellschaften. Massengewalt im 20. Jahrhundert, München 2011, S. 341–354; das Zitat findet sich bei Ziemann, Gewalt, S. 26. Deutlich zu hoch gegriffene Zahlen, etwa für Verdun, liefert Herfried Münkler, Der große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918, Berlin 2014, S. 417. Vgl. auch Christoph Jahr / Stefan Kaufmann, »Den Krieg führen: Organisation, Technik, Gewalt«, in: Niels Werber / Stefan Kaufmann / Lars Koch (Hg.), Erster Weltkrieg. Kulturwissenschaftliches Handbuch, Stuttgart/Weimar 2014, S. 164–231.
9 Der Referenzrahmen ist ein Analyseinstrument, das das Handeln von Soldaten konfliktüber-greifend erklären soll (Sönke Neitzel / Harald Welzer, Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben, Frankfurt am Main 2011). Bereits der Titel des Werkes, das sich beinahe ausschließlich mit den Jahren 1939 bis 1945 beschäftigt, deutet die Breite des Ansatzes an.
10 Siehe die Diskussion in Ben Shepherd, »The Clean Wehrmacht, the War of Extermina-tion, and Beyond«, in: Historical Journal 52 (2009), S. 455–473.
11 Alan Kramer, Dynamic of Destruction. Culture and Mass Killing in the First World War, Oxford 2007, S. 237–244; Ziemann, Gewalt, S. 24–90.
Mittelweg 36 1–2/2015 229
Tötungshandeln und die Selbstwahrnehmung der Soldaten beeinflussten, ist bislang nur in Ansätzen bekannt. Gerade an der Westfront dürfte der Wunsch eine Rolle gespielt haben, endlich einmal das Ausharren im Graben zu unterbrechen und nicht mehr passives Opfer der Artillerie, sondern ak-tiver Kriegsteilnehmer zu sein.12 Für alle Fronten galt jedoch, dass es im Ge-fecht selbst zu einer Enthemmung und Gewalteskalation kam, die danach rasch abklang.13
Die Befunde verdeutlichen, dass der militärische Apparat auf eine effi-ziente Produktion von Tötungsgewalt ausgerichtet war. Als solchen sollte ihn auch die Forschung verstehen, weshalb eine moderne Gewaltgeschichte neben den vielzitierten Egodokumenten verstärkt Militärakten heranziehen muss. Diese zeigen, dass sich die militärischen Entscheidungsträger, sobald die Soldaten lokale Waffenstillstände vereinbarten, bemühten, durch eska-lierende Befehle den Austausch von Feindseligkeiten wieder anzustacheln. Der begrenzte Handlungsspielraum einfacher Soldaten im Krieg wird da-durch offenkundig. Möglicherweise war die Freiheit, sich für oder gegen Gewaltausübung zu entscheiden, in staatlichen Institutionen kleiner als in irregulären Formationen wie Banden oder paramilitärischen Verbänden. Umgekehrt ist zu fragen, unter welchen Umständen sich Befehle, die Ge-waltakte gegen Zivilisten unterbinden sollten, gegen situative Faktoren wie die Franktireurfurcht durchsetzen konnten.
Individuelle Handlungsspielräume werden insbesondere im Umgang der Soldaten mit Kriegsgefangenen sichtbar, über den noch immer zu wenig bekannt ist. Lange wurde die These vertreten, an der Front sei das Erschie-ßen von Gefangenen gang und gäbe gewesen.14 Mittlerweile liegen empi-risch besser fundierte Analysen vor, die allerdings zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Während einige Historiker davon ausgehen, dass Erschießungen die Ausnahme bildeten,15 sehen andere darin eine verbrei-tete Praxis.16 Festzuhalten bleibt, dass nicht immer institutionelle Zwänge,
12 Von einer »Todessehnsucht« spricht Münkler, Der große Krieg, S. 468, sowie ganz ähnlich Niall Ferguson, Der falsche Krieg. Der Erste Weltkrieg und das 20. Jahrhun-dert, München 2002, S. 331. Während Ferguson jedoch den Soldaten einen mystischen »Todestrieb« und Freude am Töten unterstellt, steht Münklers Interpretation der überzeugenden These Geyers nahe, die Soldaten seien zur »Selbstzerstörung« bereit gewesen (Michael Geyer, »Vom massenhaften Tötungshandeln, oder: Wie die Deut-schen das Krieg-Machen lernten«, in: Peter Gleichmann / Thomas Kühne [Hg.], Massenhaftes Töten. Kriege und Genozide im 20. Jahrhundert, Essen 2004, S. 105–142, hier S. 121).
13 Thomas Weber, Hitlers erster Krieg. Der Gefreite Hitler im Weltkrieg – Mythos und Wahrheit, Berlin 2011, S. 162 f.; Ziemann, Gewalt, S. 76–78.
14 So etwa Ferguson, Der falsche Krieg, S. 356. 15 Kramer, Dynamic of Destruction, S. 64; Ziemann, Gewalt, S. 71–78. 16 Brian Feltman, »Tolerance As a Crime? The British Treatment of German Prisoners
of War on the Western Front, 1914–1918«, in: War in History 17 (2010), 4, S. 435–458; Alexander Watson, Enduring the Great War. Combat, Morale and Collapse in the German and British Armies, 1914–1918, Cambridge 2009, S. 71 f.
230 Mittelweg 36 1–2/2015
sondern durchaus auch situative Bedingungen, Emotionen und die Soziali-sation entschieden, ob Soldaten den Abzug betätigten oder nicht. Auch in dieser Hinsicht ist die Forschung zum Zweiten Weltkrieg bereits erheblich weiter fortgeschritten, natürlich auch deshalb, weil das Interesse groß ist, individuelles Handeln in den Gewaltexzessen von Vernichtungskrieg und Holocaust zu erklären.
Mehr Aufmerksamkeit hat die Gewalt gegen Nichtkombattanten erfah-ren. Der Erste Weltkrieg gilt hier gemeinhin als Wasserscheide, und das nicht, weil Zivilisten nun in großem Maßstab zu Kriegsopfern wurden (nachdem ihr Schutz kurz zuvor rechtlich verankert worden war), sondern weil die um 1900 als großer zivilisatorischer Schritt gefeierte Trennung von Kombattanten und Zivilisten im Krieg schlagartig erodierte. Der Erste Welt-krieg entfesselte eine Gewalt von zuvor ungekanntem Ausmaß, weil es sich um einen zur Entgrenzung neigenden »Kulturkrieg« langer Dauer handelte, in dem nicht nur um militärisch-politische Ziele im engeren Sinne, sondern um Werte und Lebensweisen gerungen wurde. Seine extensiven Ziele konn-ten mit effizienten Organisationen und elaborierten technischen Mitteln verfolgt werden.17 Die Gewalt gegen Zivilisten nahm vielfältige Gestalt an: Durch die britische Seeblockade litt die Bevölkerung der Mittelmächte Hunger; im Seekrieg gingen Zivilisten mit Handels- oder Passagierschiffen unter. Die Bevölkerung wurde indes auch direkt unter Feuer genommen, etwa bei Luftangriffen oder während des Beschusses des englischen Küs-tenstädtchens Scarborough durch die deutsche Marine 1914. Besonders häufig kam es indes im Zuge von Besatzungsherrschaft zur Gewalt gegen Zi-vilisten. John Horne und Alan Kramer zufolge waren friendly fire, Desinfor-mation und der Mythos der Franktireurs entscheidende Faktoren für das Ausmaß der Gewalt deutscher Soldaten in Belgien und Frankreich 1914. Die deutschen Offiziere hätten auf angebliche Attacken der Zivilbevölkerung mit äußerst harschen Befehlen reagiert, die die Grenzen des Völkerrechts klar überschritten, indem sie Kollektivstrafen ohne Anhörung anordneten.18 Dieses Thema wurde im Anschluss an die Pionierarbeit Hornes und Kra-mers häufig aufgegriffen und scheint daher geeignet, um exemplarisch An-sätze und Forschungsbeiträge der jüngst erschienenen Gesamtdarstellun-gen zum Ersten Weltkrieg zu prüfen. Wie also gewichten sie die Gewalt, die sich im Kontext von Kampfhandlungen gegen die Bevölkerung richtete?
Mit einer eigenen empirischen Forschungsleistung kann die innovative und erzählerisch meisterhaft angelegte Studie Ring of Steel von Alexander Watson aufwarten. Sie beschränkt sich nicht auf deutsche Kriegsgräuel, son-
17 Das ist das Kernargument in Kramer, Dynamic of Destruction. Vgl. dazu Sönke Neitzel, »Der historische Ort des Ersten Weltkrieges in der Gewaltgeschichte des 20. Jahrhun-derts«, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 64 (2014), 16/17, S. 17–23.
18 John Horne / Alan Kramer, Deutsche Kriegsgreuel 1914. Die umstrittene Wahrheit, Hamburg 2004.
Mittelweg 36 1–2/2015 231
dern bezieht die Deportation von Elsässern durch französische Behörden ebenso ein wie die sogenannten »Russengräuel« in Ostpreußen. Während Horne und Kramer vorsichtig formulieren, dass »systematische Gewalt-taten gegen Zivilisten kein Hauptbestandteil des Verhaltens der russischen Soldaten waren«, kann Watson zeigen, dass es zu weitaus mehr Vorfällen kam als bislang bekannt. So starben in Ostpreußen nicht lediglich 101, son-dern 1 491 Zivilisten. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz waren es 6 427. Mit aller Vorsicht, die bei der Erhebung und Gewichtung solcher Zahlen walten muss, verweist Watson zu Recht darauf, dass die Gewalt in West und Ost relativ zur Bevölkerungsdichte ein vergleichbares Ausmaß hatte.19 Ost-preußen machte den Deutschen klar, was Krieg auf eigenem Boden bedeu-tete. Die unmittelbaren sowie die medialen Gewalterfahrungen bildeten einen Resonanzboden, der den mobilisierenden Effekt des Sieges von Tan-nenberg verstärkte.
Diesen Punkt betont auch Jörn Leonhard, der die Gewalt in Ostpreußen – wie es dem bisherigen Stand der Forschung entspricht – nur äußerst knapp erwähnt,20 dafür aber für den Westen eine konzentrierte und überzeugende Darstellung der Gewaltursachen liefert. Ob indes der Antikatholizismus für die Gewalt in Belgien und Frankreich verantwortlich zu machen ist, wird mittlerweile mit dem Argument angezweifelt, dass die dort eingesetzten Verbände zum Teil selbst aus Katholiken bestanden hätten.21 Gewalt ist ei-nes der strukturierenden Motive in Leonhards Buch. Die mehrfach gebro-chene Darstellung spiegelt die Komplexität des Weltkrieges, indem sie sich einer Meistererzählung verweigert. Die Ereignisse von 1914 sind nur ein Beispiel von vielen, das die Eigendynamiken und -logiken der Gewalt auf der Meso- und Makroebene aufzeigt. Leonhard konstatiert, dass die hohen Opferzahlen eine »Gewaltschwelle« markierten, die den Akteuren kein Zurück erlaubte, sondern sie vielmehr dazu zwang, alle Mittel einzusetzen, um zu siegen. Das brachte sie auch dazu, zur Gewalt gegen Zivilisten zu greifen: Der Krieg schuf einen »Raum der Gewaltermöglichung«, was Fol-gen für das gesamte 20. Jahrhundert hatte.22
Darin stimmt Leonhard mit der erfreulich schlanken Überblicksdarstel-lung von Oliver Janz überein, die den Ereignissen in Belgien und Frankreich relativ viel Aufmerksamkeit widmet. Nach Janz wurden die Massaker vor allem durch die Furcht vor Franktireurs ausgelöst. Sie habe »bis hinauf zu
19 Ebd., S. 127 f. sowie 121; ebenso Ziemann, Gewalt, S. 60. Zur Neubewertung Alexander Watson, Ring of Steel. Germany and Austria-Hungary at War, 1914–1918, London 2014, S. 171. In der Tat wurden im belgischen Dinant wie im deutschen Abschwangen 10 Prozent der Bevölkerung während der Besatzung getötet (eine falsche Relation liefert Oliver Janz, 14. Der große Krieg, Frankfurt am Main 2013, S. 77). Gleichwohl erschöpft sich die Gewalterfahrung nicht in der Zahl der Opfer.
20 Leonhard, Die Büchse, S. 191 f.; ebenso Janz, 14, S. 80; Watson, Ring of Steel, S. 180. 21 Leonhard, Die Büchse, S. 170–174. Zum Antikatholizismus Weber, Hitlers erster Krieg, S. 56 f. 22 Leonhard, Die Büchse, S. 255 und 257. Zu den Folgen der Gewalt ebd., S. 998–1001.
232 Mittelweg 36 1–2/2015
den höchsten Kommandoebenen« gereicht, die daraufhin befohlen hät-ten, strukturierte Vergeltungsmaßnahmen durchzuführen. Indes wird nicht ganz klar, ob diese Aktionen »völlig unbegründet« waren oder ob es doch »sehr wenige erwiesene Fälle« tatsächlicher Übergriffe der Zivilbevölke-rung auf die Invasoren gab.23 An dieser Stelle bleiben notgedrungen auch die übrigen Gesamtdarstellungen vage.24 Möglicherweise unterschieden sich die Städte von den peripheren ländlichen Regionen Europas, in denen staatliche Behörden weniger Zugriff auf die Landesbewohner hatten, wes-halb sich eine lokale Gewaltkultur etablieren konnte.
Herfried Münklers Darstellung legt den Akzent erkennbar auf politische und operative Zusammenhänge; sie ist daher nicht als Gewaltgeschichte 1914 bis 1918 zu lesen. Das zeigt sich in den knappen Teilen des Buches, die die »Leiden der […] Zivilbevölkerung« zumeist aus der Makroperspek-tive beschreiben. Münkler geht davon aus, dass auch Ostpreußen »von den Furien des Krieges erheblich in Mitleidenschaft gezogen« wurde, sagt aber nichts über vergleichbare Ursachen der Gewalt in Ost und West. Wegen der dünnen empirischen Basis – Münkler verwendet literarische Berichte oder oral histories der 1990er-Jahre – erfährt man wenig über die Dispositionen der Soldaten. Die Gewalt scheint vor allem situativ bedingt. Die Frage nach einem planvollen gewaltsamen Vorgehen der deutschen militärischen Entscheidungsträger in Belgien wird ausweichend mit »[m]öglicherweise« beantwortet.25 Dagegen ist Münklers Vermutung, die Uniformen der belgi-schen Garde civique könnten die Franktireurfurcht noch angeheizt haben, von anderen Forschern empirisch untermauert worden.26
Obgleich die Synthesen unterschiedliche Schwerpunkte setzen, dienen die Ereignisse in Belgien und Frankreich überall als paradigmatisches Bei-spiel für Gewalt gegen Zivilisten. Watsons bemerkenswerte Befunde zu Ostpreußen bilden die Ausnahme, dürften aber – auch wegen der notorisch problematischen Quellenlage – ebenso kontrovers aufgenommen werden wie vor einigen Jahren die Studie von Horne und Kramer. Gleichwohl wer-den diese Ergebnisse die Forschungen beleben, denn sie bieten neuen Stoff für die Diskussion darüber, ob die Formen und die Intensität der Gewalt-ausübung einer problematischen Situation oder der spezifischen national- militärischen Kultur einer Armee zuzurechnen sind. Hierin liegt eines der größten Forschungsdesiderate, das mit einem transnationalen Ansatz beho-ben werden sollte. Die in einigen Untersuchungen geäußerte Vermutung, die »Kriegsgräuel« resultierten aus einer besonderen Gewaltdisposition der deutschen Armee und seien damit singulär, wird durch Gewaltakte in
23 Janz, 14, S. 76. Vgl. auch ebd., S. 122. 24 Watson, Ring of Steel, S. 172; Leonhard, Die Büchse, S. 170. 25 Münkler, Der große Krieg, S. 157 und 123. 26 Ebd., S. 119; Weber, Hitlers erster Krieg, S. 55; Ziemann, Gewalt, S. 57. Von einer geringen
Bedeutung dieses Faktors sprechen Horne/Kramer, Deutsche Kriegsgreuel, S. 197.
Mittelweg 36 1–2/2015 233
Ostpreußen und anderswo nachhaltig in Frage gestellt.27 Der Befund, dass die Gewalt zuweilen abrupt endete und dass einige Orte betroffen waren, andere hingegen nicht, spricht dafür, die jeweiligen Gewaltkontexte stärker zu berücksichtigen.28 Neigte das Militär zum Einsatz entgrenzter Gewalt auch gegen Zivilisten, sofern eine bestimmte Konstellation auf einem Kriegs-schauplatz eintrat, oder war eine schon im Frieden angelegte Militärkultur dafür verantwortlich? Diese Frage ist bereits im Kontext der Kolonialkriege aufgegriffen worden, die möglicherweise als ein brutales Präludium der Er-eignisse in Europa zu lesen sind.
Grenzüberschreitungen I: Kolonialkriege Gewalt überschreitet Grenzen, nicht nur sozial, sondern auch zeitlich und räumlich. Isabel Hull hat eine der ersten Arbeiten vorgelegt, die diesem Umstand Rechnung tragen, und hat die Gewaltlogiken innerhalb des deut-schen Militärs in europäischen Konflikten und Kolonialkriegen seit 1870 untersucht. Ihre Studie ist wegen des Arguments, die deutsche Armee hätte eine von anderen westlichen Streitkräften abweichende, besonders brutale Militärkultur entwickelt, mit Recht kritisiert worden.29 Gleichwohl bleibt sie ein bedeutender Beitrag zur Gewaltgeschichte, weil sie die Ursachen des Gewalthandelns der bewaffneten Macht in der longue durée thematisiert und dabei vor allem die Frage aufgreift, ob die militärischen Entscheidungsträ-ger ihre Lehren aus den Gewaltpraktiken der Kolonialkriege gezogen und diese während des Ersten Weltkrieges auf Europa transferiert haben. Damit hat Hull ihren Teil zu einer Debatte beigetragen, die bis heute um die Frage kreist, inwieweit der Kampf in den Kolonien Spuren in der deutschen Ge-waltgeschichte hinterlassen hat. Die Autorin betont, hier seien Praktiken wie Deportationen, die Unterbringung in Lagern oder der Kampf gegen Zivilis-ten eingeübt worden, die auf die totale Vernichtung des Gegners zielten.
Hull beobachtet dieses Verhalten allein bei den deutschen Truppen und greift damit zu kurz. Mittlerweile werden die Ursachen für gewaltsames Ver-halten differenzierter herausgearbeitet. Vergleichende Untersuchungen be-tonen, ähnliche Praktiken hätten zum Herrschaftsrepertoire aller Kolonial-mächte gehört. Der berühmte »Vernichtungsbefehl« Lothar von Trothas in Deutsch-Südwestafrika sei kein Einzelfall gewesen, denn auf Kuba und
27 Isabel Hull, Absolute Destruction. Military Culture and the Practices of War in Imperial Germany, Oxford 2007; sowie implizit bei Horne/Kramer, Deutsche Kriegsgreuel, S. 619 f. Eine fundierte Kritik bietet Weber, Hitlers erster Krieg, S. 57–60.
28 Die Ereignisse im verschont gebliebenen Allenstein und im stark betroffenen Abschwangen beschreibt Watson, Ring of Steel, S. 162–170 und 174 f.
29 Hull, Absolute Destruction. Eine kritische Würdigung dieser Arbeit findet sich bei Susanne Kuß, Deutsches Militär auf kolonialen Kriegsschauplätzen. Eskalation von Gewalt zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Berlin 2010, S. 29–31.
234 Mittelweg 36 1–2/2015
den Philippinen hätten spanische und amerikanische Befehlshaber ähnlich fatale Anweisungen gegeben.30 Im Boxerkrieg 1900/1901 unternahmen nur die Amerikaner keine gewaltsamen Strafexpeditionen, Deutsche, Italiener und Briten hingegen schon. Auch hier zeigt sich, dass die internationalen Koalitionstruppen aus einem gemeinsamen Repertoire der Gewaltprakti-ken schöpften, wenngleich sich offenbar die deutschen Truppen besonders hervortaten.31 Für die Lager, die jetzt in den Mittelpunkt der Forschung ge-rückt sind, war in Deutsch-Ostafrika 1907 nicht einmal ein Etat vorgesehen. Sie wurden dennoch errichtet und dementsprechend prekär ausgestattet. Gleichwohl kann man nicht pauschal von einer genuin deutschen Vernich-tungsabsicht ausgehen. Im Haushalt von Deutsch-Südwestafrika waren für die dortigen Lager immerhin 1,5 Millionen Reichsmark eingestellt. Ökono-mische und sicherheitspolitische Motive dominierten, doch die Behörden verfolgten kein genozidales Grundkonzept, wie manche Historiker mei-nen.32 Zukünftige Forschungen könnten Motive und Formen der Lager-herrschaft stärker international vergleichend analysieren und dabei die kon-troverse Debatte aufnehmen, ob die Lager erst um 1900 erfunden wurden und damit ein Phänomen der Moderne darstellen – oder ob sie in längere Kontinuitäten einzuordnen sind.33 Zugleich wäre zu klären, inwieweit die Idee der Lager, deren Möglichkeiten in den Kolonien im großen Maßstab getestet wurden, als Antwort auf soziale und militärische Probleme ihren Weg nach Europa zurück fand. Die Vermutung, dass Lager nicht allein der gewaltsamen Segregation, sondern auch der Inklusion – der Lagerinsassen, aber mehr noch der Zuschauer außen – dienten, liefert weiteren Stoff zum Nachdenken.34
30 Donald Bloxham et al., »Europe in the World: Systems and Cultures of Violence«, in: ders. / Robert Gerwarth (Hg.), Political Violence in Twentieth-Century Europe, Cambridge 2011 , S. 11–39, hier S. 14 f.; Robert Gerwarth / Stephan Malinowski, »Der Holocaust als ›kolonialer Genozid‹? Europäische Kolonialgewalt und nationalsozialistischer Vernich-tungskrieg«, in: Geschichte und Gesellschaft 33 (2007), S. 439–466, hier S. 446–449.
31 Kuß, Deutsches Militär, S. 77; Dierk Walter, Organisierte Gewalt in der europäischen Expansion. Gestalt und Logik des Imperialkrieges, Hamburg 2014, S. 253.
32 Siehe die widerstreitenden Beiträge von Jonas Kreienbaum (»›Wir sind keine Sklaven-halter‹: Zur Rolle der Zwangsarbeit in den Konzentrationslagern in Deutsch- Südwestafrika [1904 bis 1908]«, S. 68–83) und Jürgen Zimmerer (»Lager und Genozid: Die Konzent-rationslager in Südwestafrika zwischen Windhuk und Auschwitz«, S. 54–67) in: Christoph Jahr / Jens Thiel (Hg.), Lager vor Auschwitz. Gewalt und Integration im 20. Jahrhundert, Berlin 2013; sowie Claudia Siebrecht, »Formen von Unfreiheit und Extreme der Gewalt. Die Konzentrationslager in Deutsch-Südwestafrika, 1904–1908«, in: Bettina Greiner / Alan Kramer (Hg.), Die Welt der Lager. Zur »Erfolgsgeschichte« einer Institution, Ham-burg 2013, S. 87–109. Die Etats sind vermerkt bei Kuß, Deutsches Militär, S. 267.
33 Andreas Gestrich, »Konzentrationslager: Voraussetzungen und Vorläufer vor der Moderne«, und Andreas Stucki, »Streitpunkt Lager: Zwangsumsiedlung an der imperialen Peripherie«, in Greiner/Kramer (Hg.), Die Welt der Lager, S. 43–61 bzw. S. 62–86.
34 Christoph Jahr / Jens Thiel, »Prolegomena zu einer Geschichte der Lager. Eine Einführung«, in: dies. (Hg.), Lager vor Auschwitz, S. 7–19.
Mittelweg 36 1–2/2015 235
Gegen eine unmittelbare Übertragung der Gewaltpraktiken und damit gegen eine direkte Kontinuität vom Kolonialkrieg zum europäischen Krieg von 1914 sprechen die zahlreichen Besonderheiten, welche die Konflikte außerhalb Europas prägten und sich auf das Handeln der kolonialen Ak-teure auswirkten. Vor allem fünf Aspekte werden von der Forschung her-vorgehoben:35 Erstens waren die Europäer materiell und technisch schlecht für die logistischen Herausforderungen eines Krieges in fernen Ländern gerüstet. Nur selten war die für die Beherrschung großer Räume notwen-dige Anzahl an Soldaten vorhanden. Vielfach fehlte es an Nachschub, die medizinische Versorgung musste erst auf die Bedingungen vor Ort ein-gestellt werden. Diese Mängel führten zweitens dazu, dass sich ein Frust- und Aggressionspotenzial unter den Soldaten aufbaute. Mit Racheaktionen sühnten sie Attacken der Einheimischen auf die Europäer, wie sie etwa in China oder Deutsch-Südwestafrika vorgekommen waren. Die fremde Um-gebung und der Eindruck der taktischen Unterlegenheit schufen eine in hohem Maße unberechenbare und beängstigende Situation, in der Gewalt als bestes Mittel erschien, um die Handlungshoheit und Selbstsicherheit wiederzuerlangen.36 Die Unwägbarkeiten wurden drittens durch den frem-den Raum verstärkt, in dem ein Gegner bekämpft werden musste, der mit der Umgebung bestens vertraut war und – so sahen es manche Beobach-ter – sprichwörtlich mit dem Gelände verschmolz, sodass er unsichtbar zu werden schien. Mit einem Angriff aus dem Hinterhalt war jederzeit zu
35 Eine Typologie dieser neuzeitlichen Kriege liegt jetzt vor mit Walter, Organisierte Gewalt; vgl. zu den im Folgenden erläuterten Faktoren insbesondere S. 25–118. Den Spezifika kolonialer Kriege und ihren gewaltfördernden Dimensionen trägt Kuß mit dem Konzept des »Kriegsschauplatzes« Rechnung (Kuß, Deutsches Militär, S. 32–37 und 127–310).
36 Matthias Häußler / Trutz von Trotha, »Brutalisierung ›von unten‹: Kleiner Krieg, Entgren-zung der Gewalt und Genozid im kolonialen Deutsch-Südwestafrika«, in: Mittelweg 36 21 (2012), 3, S. 57–89; Kuß, Deutsches Militär, S. 69; Walter, Organisierte Gewalt, S. 178.
Kolonialgeschichte ist auch die Geschichte der Aneignung neuer Gewaltpraktiken. Wilhelminische Soldaten machen sich mit der chinesischen Variante des Prangers, der sogenannten Nackenfessel, vertraut.
© D
euts
ches
His
tori
sche
s Mus
eum
, Ber
lin
236 Mittelweg 36 1–2/2015
rechnen.37 Viertens führten auch soziale Faktoren zu einer Eskalation der Gewalt. In den Kolonien agierten Europäer, die in der Heimat am Rande der Gesellschaft gestanden hatten (etwa weil sie Straftäter waren) und ihr Engagement an der Peripherie als besondere Chance begriffen. Die indi-gene Bevölkerung wiederum war oftmals in Clans organisiert, und es fehlte an staatlichen Strukturen, die Übereinkünfte im europäischen Stil wie einen geordneten Friedensschluss für ein klar bezeichnetes Gebiet ermöglicht hätten. Zugleich bevorzugte sie die Strategie des kleinen Krieges, die die Auswirkungen der bisher genannten Faktoren verstärkte, worauf die Kolo-nialtruppen wiederum mit Gewaltaktionen reagierten. Die Rekrutierung einheimischer und schwer zu kontrollierender Hilfstruppen bewirkte eine zusätzliche Eskalation, denn ihnen wurde zuweilen ihre Kriegsbeute als ein-ziger Lohn zugesprochen.38 Fünftens schließlich sind kulturelle und ideolo-gische Faktoren zu nennen. Ihr endemischer Rassismus und Imperialismus verlieh den Europäern ein Überlegenheitsgefühl, das die Überzeugung be-inhaltete, der in jeder Hinsicht minderwertige Gegner verstehe nur die Sprache der Gewalt. Dieser Wahrnehmungsfilter legitimierte Gewalthand-lungen, die gegen Europäer niemals als statthaft angesehen worden wären.39
In der Forschung besteht Konsens darüber, dass der Export der europä-ischen Kriegskunst in die Kolonien scheiterte, weil es in den Kolonien an den Voraussetzungen dafür fehlte, sie umzusetzen. Tatsächlich bestimmte nicht eine Seite allein, wie gekämpft wurde. Vielmehr lernten die Kriegspar-teien voneinander und handelten so die Gefechtsform gewaltsam miteinan-der aus, ein Phänomen, das zu Recht als »transkulturelle Kriegführung« bezeichnet wird.40 Sie konnte im Zusammenwirken mit den oben geschil-derten Faktoren zu einer Zuspitzung der Gewalt führen. Gleichwohl wollten die Heerführer der Imperialmächte ihre offensichtliche Schwäche haupt-sächlich durch die Herbeiführung von Entscheidungsschlachten und einen eindeutigen Sieg kompensieren – mit allen Konsequenzen für die indigene Bevölkerung.41
37 Kuß, Deutsches Militär, S. 232–268; Tanja Bührer, Die Kaiserliche Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika. Koloniale Sicherheitspolitik und transkulturelle Kriegführung 1885 bis 1918, München 2011, S. 236; Häußler/Trotha, »Brutalisierung«, S. 75–79.
38 Bührer, Die Kaiserliche Schutztruppe, S. 211 f. und 271 f.; Kuß, Deutsches Militär, vor allem S. 90–93.
39 Dierk Walter, »Kein Pardon: Zum Problem der Kapitulation im Imperialkrieg«, in: Mittelweg 36 21 (2012), 3, S. 90–111, hier S. 102 f. Hull ist kritisch, was die Bedeutung dieser Faktoren für die unmittelbare Gewaltpraxis angeht, und sieht darin vor allem nachträgliche Legitimationsstrategien (Hull, Absolute Destruction, S. 330).
40 Siehe Bührer, Die Kaiserliche Schutztruppe, vor allem S. 269–275. Gleichwohl ist fraglich, inwieweit das Schlagwort von der »Afrikanisierung der Gewalt« (ebd., S. 275) zweckmäßig ist. Es impliziert, dass es in ganz Afrika eine einheitliche und nur dort zu beobachtende Gewaltkultur gegeben habe, obgleich ähnliche Formen der Kriegführung in verschiedenen imperialen Peripherien und staatsfernen Räumen sichtbar werden.
41 Es gibt allerdings Hinweise darauf, dass die deutsche Militärführung nach dem Krieg gegen die Herero und Nama von diesen Prinzipien abrückte (Kuß, Deutsches Militär, S. 384).
Mittelweg 36 1–2/2015 237
Während man also von einem letztlich gescheiterten Transfer der Krieg-führungstechniken von Europa in die Kolonien ausgehen kann, ist weitaus weniger klar, welche Folgen die koloniale und imperiale Gewalt in Europa selbst hatte. Gab es Rückwirkungen von der Peripherie ins Zentrum?42 Das ist Thema einer vehement geführten Debatte, die um die Auswirkungen ko-lonialer Gewaltpraktiken auf den NS-Vernichtungskrieg kreist. Eine Seite nimmt an, dass die Deutschen in den Kolonien eine Neigung zur extremen Gewalt bewiesen hätten, die schließlich im Holocaust ihre logische Konse-quenz gefunden habe.43 Gegen diese Auffassung ist mittlerweile eine ganze Reihe von guten Argumenten angeführt worden. Kritisiert wurde, dass oft-mals von einem deutschen kolonialen Sonderweg die Rede sei, ohne dass diese Behauptung in vergleichenden Studien erhärtet worden sei. Die These, dass die Nationalsozialisten auf koloniale Praktiken des Kaiserreiches re-kurrierten, um ihre Vernichtungspolitik auszugestalten oder zu rechtferti-gen, würden nur spärliche Hinweise stützen. Zudem gebe es für personelle und ideelle Kontinuitäten im langen Zeitraum zwischen 1904 und 1941 kaum Belege.44 Diese Befunde legen nahe, dass sich Einflüsse der kolonia-len Träume der Kaiserzeit auf die nationalsozialistische Ostpolitik nur schwer nachweisen lassen. Offenbar müssen wir akzeptieren, dass jede Zeit eigene Mittel fand, um ihre gewaltsamen Vorstellungen zu legitimieren.
Interessanterweise ist die aus vielen Gründen näherliegende Frage nach Transfers in den Ersten Weltkrieg hinein bislang selten gestellt worden. Es ist völlig unklar, ob das Kaiserreich aus den Kolonialkriegen Lehren zog und ob personelle oder institutionelle Kontinuitäten zwischen Kolonialtruppen und europäischen Heeren bestanden, die eine Gewaltentgrenzung bewirk-ten. In allen Imperien kursierten natürlich Berichte und Analysen der Kolo-nialkriege. Gleichwohl – und das bestätigt eindrucksvoll die Annahme, die Zeitgenossen hätten zwischen Europa und seinen Kolonien keinen Bezug gesehen – scheint zumindest die deutsche Armee nur ganz am Rande daran gedacht zu haben, die gewonnenen Erkenntnisse in einem europäischen Krieg anzuwenden. Über die Pfadfinderbewegung sickerten diese allerdings
42 Zu diesem Desiderat vgl. Walter, Organisierte Gewalt, S. 242 f. 43 Benjamin Madley, »From Africa to Auschwitz: How German South West Africa Included
Ideas and Methods Adopted and Developed by the Nazis in Eastern Europe«, in: European History Quarterly 33 (2005), S. 429–464; Jürgen Zimmerer, Von Windhuk nach Auschwitz. Beiträge zum Verhältnis von Kolonialismus und Holocaust, Münster 2007.
44 Der beste Forschungsbericht zur Frage ist Gerwarth/Malinowski, Der Holocaust. Zur not-wendigen Differenzierung siehe Boris Barth, Genozid. Völkermord im 20. Jahrhundert. Geschichte, Theorien, Kontroversen, München 2006; Bührer, Die Kaiserliche Schutztruppe, S. 27 f.; Birthe Kundrus, »Kontinuitäten, Parallelen, Rezeptionen: Überlegungen zur ›Kolonialisierung‹ des Nationalsozialismus«, in: WerkstattGeschichte 43 (2006), S. 45–62; Kuß, Deutsches Militär, S. 20–31; Andreas Weiß, »Colonialism and Violence: Alleged Trans-fers and Political Instrumentalisation«, in: Jörg Feuchter / Friedhelm Hoffmann / Bee Yun (Hg.), Cultural Transfers in Dispute. Representations in Asia, Europe and the Arab World since the Middle Ages, Frankfurt am Main / New York 2009, S. 193–211, hier S. 202–209.
238 Mittelweg 36 1–2/2015
in die militarisierte Jugendkultur ein.45 Insgesamt ist viel zu wenig über einen möglichen bellizistischen Erfahrungstransfer von den Kolonien nach Europa bekannt. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass die Weltkriegs-forschung allzu oft erst 1914 ansetzt und die lange Kette der vorangegange-nen Gewalteskalationen nicht berücksichtigt. Zu denken ist dabei an die Kolonien, aber natürlich auch an die Balkankriege.46 Zusätzlich dürfte die bisherige Fokussierung der Forschung auf Europa selbst einschränkende Effekte haben, die sich unter dem Einfluss der Global- und Transferge-schichte jetzt aufzulösen beginnen.47 Für die Relevanz der Gewaltpraktiken an der Peripherie im Hinblick auf den Ersten Weltkrieg sprechen zwei Gründe. Erstens gelangten Gewaltakteure aus den Kolonien oder imperia-len Grenzräumen an die Fronten des europäischen Staatenkrieges, nämlich die Europäer, die in den Kolonialkriegen Dienst getan hatten. Daneben wurden indigene Kontingente eingesetzt. Auf Seiten der Franzosen standen während des Krieges 438 000 Kolonialsoldaten im Feld, die in Europa und dem Nahen Osten kämpften.48 Der Umstand, dass deutsche Frontsoldaten die angebliche Brutalität der Afrikaner, Inder, Kanadier und Australier be-klagten, verweist darauf, dass zumindest die Zeitgenossen von unterschied-lichen Gewaltkulturen ausgingen, die an der Westfront aufeinandertrafen.49 Zweitens sah man sich im Kriegsverlauf mit ähnlichen Problemen wie in den Kolonialkriegen konfrontiert. Dazu zählten die Notwendigkeit, eine große Anzahl von Menschen in Lagern unterzubringen, irreguläre Formen der Kriegführung oder auch die Konfrontation mit einer fremden und als lebens-feindlich empfundenen Umgebung. Gleichwohl unterschieden die Zeitge-nossen klar zwischen Europa und den Kolonien und unterwarfen ihre For-men der Kriegführung anderen Regeln, als sie an der Peripherie galten. Auch das Denken in kolonialen Mustern war im Reich weniger verbreitet, als man heute zuweilen annimmt. So ist etwa zweifelhaft, ob die Besatzungspolitik der Mittelmächte in Osteuropa nach 1914 als kolonial bezeichnet werden kann. Zwar beutete man in Polen die Ressourcen des Landes aus, allerdings unter ausdrücklicher Anerkennung und Berücksichtigung der polnischen Bevöl-kerung, die in der Ausrufung der polnischen Monarchie 1916 gipfelte. In den außereuropäischen Kolonien wäre eine solche Politik undenkbar gewesen.50
45 So der vorläufige Befund in Kuß, Deutsches Militär, S. 393 f. und 403–411. Zum Lernen vgl. ebd., S. 379–394; Bührer, Die Kaiserliche Schutztruppe, S. 277–313. Vgl. Martin H. Geyer, »Grenzüberschreitungen: Vom Belagerungszustand zum Ausnahmezustand«, in: Werber/Kaufmann/Koch (Hg.), Erster Weltkrieg, S. 341–384, hier S. 364.
46 Kramer, Dynamic of Destruction, S. 135. 47 Siehe das von Malte Rolf herausgegebene Themenheft »Imperiale Biographien«,
Geschichte und Gesellschaft 40 (2014), 1. 48 Janz, 14, S. 171. 49 Heike Liebau et al. (Hg.), The World in World Wars. Experiences, Perceptions and
Perspectives from Africa and Asia, Leiden/Boston 2010. 50 Jesse Kauffman, »Schools, State-Building, and National Conflict in German-Occupied
Poland, 1915–1918«, in Jennifer D. Keene / Michael S. Neiberg (Hg.), Finding Common
Mittelweg 36 1–2/2015 239
Eine Übertragung der Gewalt nach Europa geschah sicherlich weniger in unmittelbarer Form als durch die Adaption eines bestehenden Ideen- und Handlungsrepertoires der Gewalt, die aber den europäischen Verhältnissen Rechnung trug. Obschon die weitreichenden Befunde der diskutierten Ar-beiten nicht darauf reduziert werden dürfen, dass die koloniale Epoche als bloße Vorkriegszeit zu betrachten wäre, liegt es doch nahe, in Zukunft ver-stärkt nach Transfers und Kontinuitäten der Gewalt bis in den Ersten Welt-krieg hinein zu fragen.
Grenzüberschreitungen II: Nachkriege Zum aktuellen Trend, vereinfachende Zäsuren zu hinterfragen, gehört auch, dass der Erste Weltkrieg nicht mehr ausschließlich vom August 1914 bis in den November 1918 hinein untersucht wird, sondern auch die folgenden Jahre Berücksichtigung finden. Mit dem »Greater War« ist nicht (mehr) der Zweite Weltkrieg gemeint. Es ist der Erste Weltkrieg, der als eine beson-dere Verdichtung vielfältiger Konflikte gilt, da sich von 1911/12 bis in die 1920er-Jahre hinein um ihn herum in Europa ein ganzes Geflecht weiterer gewaltsamer Auseinandersetzungen entsponnen hat,51 die den »Ausnahme-zustand« zeitweise zur Normalität werden ließen.52 Diese neue Chronolo-gie ergibt sich aus transnationalen,53 europäischen oder gar globalen For-schungsansätzen und fügt sich in Versuche ein, die erste Hälfte des 20. Jahr-hunderts neu zu vermessen, indem von einem europäischen Bürgerkrieg oder dem Zeitalter der Weltkriege gesprochen wird.54 Zumindest für Ost-europa nimmt man an, dass die lange und konfliktreiche Nachkriegszeit mit
Ground. New Directions in First World War Studies, Leiden/Boston 2011, S. 113–138; und Stephan Lehnstaedt, »Fluctuation Between ›Utilisation‹ and Exploitation: Occupied East Central Europe During the First World War«, in: Jochen Böhler / Włodzimierz Borodziej / Joachim von Puttkamer (Hg.), Legacies of Violence. Eastern Europe’s First World War, München 2014, S. 89–112. Dagegen Philipp Ther, »Deutsche Geschichte als imperiale Geschichte: Polen, slawophone Minderheiten und das Kaiserreich als kontinentales Empire«, in: Sebastian Conrad / Jürgen Osterhammel (Hg.), Das Kaiserreich transnational. Deutschland in der Welt 1871–1914, Göttingen 2004, S. 129–148.
51 Siehe dazu die von Robert Gerwarth herausgegebene Reihe »The Greater War« bei Oxford University Press sowie ders. / John Horne (Hg.), Krieg im Frieden. Paramilitärische Gewalt in Europa nach dem Ersten Weltkrieg, übers. von Ulrike Bischoff, Göttingen 2013. Die meisten dieser Publikationen lassen die Nachkriegszeit 1923 mit dem Vertrag von Lausanne enden.
52 Geyer, »Grenzüberschreitungen«. 53 Die Erforschung von Paramilitärs und von Veteranenverbänden profitiert erheblich
von diesem Ansatz; siehe Julia Eichenberg, »›Suspicious Pacifists‹: The Dilemma of Polish Veterans Fighting War During the 1920s and 1930s«, in: Keene/Neiberg (Hg.), Finding Common Ground, S. 293–312.
54 Siehe Jörg Echternkamp (Hg.), Kriegsenden, Nachkriegsordnungen, Folgekonflikte. Wege aus dem Krieg im 19. und 20. Jahrhundert, Freiburg 2012; Enzo Traverso, 1914–1945. La guerre civile européenne, Paris 2009.
240 Mittelweg 36 1–2/2015
dem Ende des Zarenreiches 1917 begann und ihre Fortsetzung im Zusam-menbruch der deutschen, österreichisch-ungarischen und osmanischen Imperien fand. Zahlreiche Faktoren erhöhten das Gewaltpotenzial in den »shatter zones«:55 Der Zusammenbruch der staatlichen Ordnung ermög-lichte es neuen Akteuren, ihr eigenes, auf Gewaltökonomien fußendes Re-gime zu errichten.56 Bereits bestehende soziale Konflikte wurden durch den Krieg angeheizt oder durch neue Konfliktlinien überlagert;57 der Nationa-lismus verschärfte das Minderheitenproblem und legitimierte Gewalt gegen andere.58 Umstritten ist der Einfluss eines weiteren Faktors, der Ideologie. Einige Historiker kommen zu dem Schluss, Ideologien hätten das Gewalt-handeln dieser Zeit nicht beeinflusst. Sie sagen: »Ideen töten nicht«, und führen die Gewalt hauptsächlich auf soziale Dynamiken zurück.59 Andere sind hingegen überzeugt, dass die Gewalteskalation nicht ohne Ideologien zu erklären ist.60 Tatsächlich lässt sich feststellen, dass sich seit 1917 der Charakter der Kriegführung an der Ostfront infolge des Auftauchens bol-schewistischer Kampfverbände veränderte, sodass auch die Zeitgenossen dem Kampf nun eine neue Qualität beimaßen.61 Innenpolitisch wurde die Revolutionsangst zu einem Kampfinstrument; ideologische Versatzstücke hielten paramilitärische Verbände zusammen. Die Furcht vor einem kommu-nistischen Umsturz legitimierte ein brutales Vorgehen von regulären und
55 Diese vielzitierte Formel fand Donald Bloxham, The Final Solution. A Genocide, Oxford 2009, S. 81.
56 Diese Faktoren werden diskutiert in: Julia Eichenberg / John Paul Newman, »Introduc-tion: Aftershocks. Violence in Dissolving Empires After the First World War«, in: Contemporary European History 19 (2010), 3, S. 183–194; Omer Bartov / Eric D. Weitz (Hg.), Shatterzone of Empires. Coexistence and Violence in the German, Habsburg, Russian, and Ottoman Borderlands, Bloomington 2013; Dirk Schumann, »Europa, der Erste Weltkrieg und die Nachkriegszeit: Eine Kontinuität der Gewalt?«, in: Journal of Modern European History 1 (2003), S. 24–43, hier S. 32 f.
57 Den Einfluss dieser Krisen auf Genozide untersucht Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften, S. 355 f.
58 Norman Naimark, Flammender Hass. Ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert, München 2004. Galizien beispielsweise war eine »Krisenregion« zwischen den Imperien. Nach 1914 transformierten sich politische Konflikte in Kriegsgewalt (siehe Agnieszka Kudełka, »Das galizische ›Pulverfass‹ und der Beginn des Ersten Weltkriegs: Eine Krisenregion zwischen Österreich-Ungarn und Russland«, in: Jürgen Angelow / Johannes Großmann [Hg.], Wandel, Umbruch, Absturz. Perspektiven auf das Jahr 1914, Stuttgart 2014).
59 Jörg Baberowski, Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt, München 2012, S. 362. Ähnlich Hull, Absolute Destruction, S. 329–332; Felix Schnell, Räume des Schreckens. Gewalträume und Gruppenmilitanz in der Ukraine, 1905–1933, Hamburg 2012, S. 551; Timothy Snyder, Bloodlands. Europa zwischen Hitler und Stalin, München 2011.
60 Eichenberg/Newman, »Introduction«, S. 184. 61 Wilhelm Deist, »Auf dem Weg zur ideologisierten Kriegführung: Deutschland
1918–1945«, in: ders., Militär, Staat und Gesellschaft. Studien zur preußisch-deutschen Militärgeschichte, München 1991; Wolfram Dornik / Peter Lieb, »Die militärischen Operationen«, in: Wolfram Dornik et al. (Hg.), Die Ukraine zwischen Selbst-bestimmung und Fremdherrschaft, Graz 2011, S. 203–248; Schumann, Europa, S. 34 f.
Mittelweg 36 1–2/2015 241
irregulären Verbänden auf der Straße.62 Allerdings waren die einzelnen Ge-waltakteure zweifellos sehr unterschiedlich stark politisiert. Der Einfluss von Ideologien oder sozialen Strukturen bleibt in der Forschung also um-stritten, man sollte ihn aber immer wieder im Einzelnen bestimmen, ohne dem einen oder anderen Faktor ein zu großes Gewicht einzuräumen.
Die Folgewirkungen des Ersten Weltkrieges werden zuweilen mit dem Begriff »aftershocks« bezeichnet, der die umstürzende Kraft des Krieges und seine schwerwiegenden Folgen beschreibt. Dieses Narrativ macht den »langen Ersten Weltkrieg« tatsächlich zur Urkatastrophe, die neue Ent-wicklungen in Gang setzte, und lässt ihn weniger als einen Katalysator er-scheinen, der Vorkriegskonflikte lediglich verschärfte.63 Ein großer Teil der neueren Studien zur Gewaltgeschichte der Nachkriegszeit konzentriert sich auf Ost- und Südosteuropa. Hier spitzten sich zuerst jene Konflikte zu, die später auf andere Teile des Kontinents ausstrahlten oder sich dort unab-hängig davon entwickelten.64 In diesem Zusammenhang hat die Forschung, die sich lange allein auf Westeuropa beschränkte, den größten Nachhol-bedarf.
Trat bis zum 19. Jahrhundert Gewalt in Form von Subsistenzprotesten und politischen Unruhen noch vor allem in ländlichen Regionen auf, ver-dichteten sich die Auseinandersetzungen um die Nachkriegsordnung (mit wichtigen Ausnahmen) in den Städten. Während der Januarkämpfe 1919 in Berlin etwa schrieb Harry Graf Kessler in sein Tagebuch: »Nie seit den Tagen der Französischen Revolution hat so viel bei Straßenkämpfen in einer Stadt für die Menschheit auf dem Spiel gestanden.«65 Dasselbe ließe sich für Moskau, München, Rom und St. Petersburg sagen. Gleichwohl ist die ländliche Gesellschaft auch für die städtische Gewalt bedeutsam, denn das gigantische Wachstum der Städte ging auf Zuwanderung aus ländlichen Räumen zurück. Das Dorf kam in die Stadt und brachte zumindest in der Sowjetunion seine ländliche Gewaltkultur mit. Die Industrialisierung zog also zusammen mit Modernisierungsbestrebungen vielfältige soziale Ver-
62 Gerwarth/Horne, »Bolschewismus als Fantasie. Revolutionsangst und konterrevolutionäre Gewalt 1917 bis 1923«, und Gerwarth, »Im ›Spinnennetz‹. Gegenrevolutionäre Gewalt in den besiegten Staaten Mitteleuropas«, in: dies. (Hg.), Krieg im Frieden, S. 94–107 und 108–133; Klaus Weinhauer, »Protest, kollektive Gewalt und Polizei in Hamburg zwischen Versammlungsdemokratie und staatlicher Sicherheit ca. 1890–1933«, in: Friedrich Lenger (Hg.), Kollektive Gewalt in der Stadt. Europa 1890–1939, München 2013, S. 69–102.
63 Eichenberg/Newman, »Introduction«, S. 185. 64 Gerwarth/Horne, »Bolschewismus«, S. 15. 65 Zitat nach Wolfgang Hardtwig, »Gewalt in der Stadt 1917–1933: Erfahrung – Emotion –
Deutung«, in: Lenger (Hg.), Kollektive Gewalt, S. 1–24, hier S. 9; vgl. Gerwarth, »Rechte Gewaltgemeinschaften und die Stadt nach dem Ersten Weltkrieg: Berlin, Wien und Budapest im Schatten von Kriegsniederlage und Revolution«, im selben Band, S. 103–122. Siehe auch Alexander Otto-Morris, »›Only united can we escape certain ruin‹: Rural Protest at the Close of the Weimar Republic‹, in: Rural History 20 (2009), 2, S. 187–208.
242 Mittelweg 36 1–2/2015
werfungen in Stadt und Land nach sich, die Gewaltdispositionen hervorru-fen konnten.66
Führte die Kriegsgewalt in Europa also zu einem Anstieg der Gewalt nach 1917/18? Diese Frage berührt die alte Diskussion, ob die Gewalt im Verlauf der Geschichte abgenommen oder eher zugenommen hat.67 Für die Nachkriegszeit liefert George Mosse mit seinem Buch Gefallen für das Vater-land einen Denkanstoß, indem er die Nachkriegsgewalt nicht mit dem Zu-sammenbruch staatlicher Strukturen und sozialen Konflikten erklärt. Viel-mehr geht er davon aus, dass die Gewalterfahrung im Krieg selbst zu einer »Brutalisierung« der Soldaten führte, die auch in der Nachkriegszeit wirk-sam blieb.68 Einige Historiker vertreten die ähnlich gelagerte These, der Krieg in Osteuropa habe »Gewaltmenschen« geschaffen, die dann ihre Er-fahrungen in die entstehenden Gesellschaftsmodelle eingebracht hätten.69 Die These ist aber natürlich vor allem im Hinblick auf Deutschland relevant, weil sie sich in den Fememorden oder Straßenschlachten der Weimarer
66 Baberowski, Verbrannte Erde, S. 36–39. Jane Burbank geht dagegen davon aus, dass die russischen Landbewohner durchaus zum differenzierten staatsbürgerlichen Handeln fähig waren ( Jane Burbank, Russian Peasants Go to Court. Legal Culture in the Country-side, 1905–1917, Bloomington 2004). Die Folgen der Industrialisierung für Gewalt erläutert Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften, S. 366–371.
67 Kritisch dazu Wolfgang Knöbl, »Überlegungen zum Phänomen kollektiver Gewalt in europäischen Großstädten während des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts«, in: Lenger (Hg.), Kollektive Gewalt, S. 187–202, hier S. 187–194; Benjamin Ziemann, »Eine ›neue Geschichte der Menschheit‹? Anmerkungen zu Steven Pinkers evolutiver Deutung der Gewalt«, in: Mittelweg 36 21 (2010), 3, S. 45–56.
68 George L. Mosse, Gefallen für das Vaterland. Nationales Heldentum und namenloses Sterben, übers. von Udo Rennert, Stuttgart 1993, S. 195. Differenzierend dazu Gerwarth/Horne, »Bolschewismus«, S. 9–11.
69 Baberowski, Verbrannte Erde, S. 44. Auch Gerwarth spricht von durch den Krieg »verrohte[n]« Soldaten, lehnt jedoch zugleich Mosses These ab (Gerwarth, »Im ›Spinnennetz‹«, S. 109 und 131). Resümierend und differenzierend dazu Eichenberg/Newman, »Introduction«, S. 188.
Wer hätte gedacht, dass Zeitungspapier als Barrikade taugt?Straßenkampf in Berlin 1919.
© p
ictu
re a
llian
ce /
ZB
Mittelweg 36 1–2/2015 243
Republik eindrucksvoll zu bestätigen scheint. Hitler selbst hat behauptet, der Krieg habe ihn gelehrt, dass zu leben kämpfen heiße.70 Gleichwohl ha-ben viele Geschichtswissenschaftler Mosses These widersprochen. Die An-nahme einer Brutalisierung aller Kriegsteilnehmer sei abwegig, zumal sich viele von ihnen rasch in die Zivilgesellschaft integriert und sich sogar pazi-fistischen Verbänden angeschlossen hätten. Entscheidend für das Gewalt-niveau in einer Gesellschaft waren wohl nicht die Gewalterfahrungen an der Front – die machten schließlich auch französische und britische Soldaten, ohne dass sich hier langfristig parastaatliche Gewaltakteure hätten etablie-ren können. Vielmehr war neben den bereits genannten Faktoren die Frage bedeutsam, ob es einen auf Frieden, Mäßigung und Verständigung zielen-den Konsens in der politischen Kultur einer Gesellschaft gab. In Deutsch-land und Italien existierte ein solcher im Gegensatz zu Frankreich oder Großbritannien nicht, während die Situation in neu entstandenen National-staaten wie Polen wegen der soziopolitischen Verschiebungen noch weit-aus komplexer war.71 Zudem scheinen der Kriegsausgang für den jeweiligen Staat und der Ablauf der Demobilmachung eine Rolle gespielt zu haben, weil diese Grundkoordinaten für die Erfahrungen in der Kriegsfolgengesell-schaft lieferten.72 Dirk Schumann hat in diesem Zusammenhang die anre-gende Beobachtung gemacht, dass das Gewaltniveau innerhalb Europas mit Theodor Schieders Modell der Entstehung von Nationalstaaten überein-stimmte, was zusätzlich für eine genaue Einzelfallanalyse der politischen Kultur und gegen Pauschalisierungen spricht.73
Die europäischen Gewaltakteure verbündeten sich beispielsweise unter Warlords, als Paramilitärs, kriminelle Banden oder als reguläre Militär- und Polizeitruppen. Wie ihr Organisationsgrad unterschied sich auch ihre Ziel-richtung, denn sie konnten nicht nur gegen oder für einen bestehenden Staat kämpfen, sondern sogar am Aufbau eines eigenen Staates arbeiten. Das staatliche Gewaltmonopol war nun umstritten; es musste neu erkämpft und legitimiert werden.74 Nur bei wenigen Veteranen lässt sich indes von
70 Weber, Hitlers erster Krieg, S. 72. 71 Schumann, Europa; Ziemann, Gewalt, S. 158 f.; Emilio Gentile, »Paramilitärische Gewalt
in Italien. Das Grundprinzip des Faschismus und die Ursprünge des Totalitarismus« (S. 150–177, hier S. 152 f.), und John Horne, »Verteidigung des Sieges: Paramilitärische Politik in Frankreich von 1918 bis 1926: Ein Gegenbeispiel« (S. 320–343), beide in: Gerwarth/Horne (Hg.), Krieg im Frieden. Zu Polen siehe Julia Eichenberg, »Consent, Coercion and Endurance in Eastern Europe: Poland and the Fluidity of War Experien-ces«, in: Böhler / Borodziej / von Puttkamer (Hg.), Legacies of Violence, S. 235–258.
72 So sieht Gerwarth in der »Nachkriegserfahrung« ein entscheidendes Momentum für die »Verrohung der politischen Kultur« in Mitteleuropa (Gerwarth, »Im ›Spinnennetz‹«, S. 109). Auch Webers Befunde legen nahe, dass diese Zeit Hitlers Einstellung zur politischen Gewalt stärker geprägt hat als die Kriegsjahre (Weber, Hitlers erster Krieg, S. 72 und 317).
73 Schumann, Europa, S. 31. 74 Zur Gewaltsemantik von staatlichen und oppositionellen Gruppen vgl. Heinz-Gerhard
Haupt, Gewalt und Politik im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts, Göttingen 2012, S. 35–90, insbes. S. 38 f.
244 Mittelweg 36 1–2/2015
einem enthemmten Gewaltverhalten sprechen. Man könnte sie in Anleh-nung an Collins’ Diktum von den »violent few«, die im Gegensatz zur friedlichen breiten Masse tatsächlich Gewalt ausüben, als die »brutal few« bezeichnen.75 Häufiger jedoch zeichneten sich jene durch eine hohe Gewalt-bereitschaft aus, die den Krieg nicht mitgemacht hatten und einem kämpfe-rischen Ideal nacheiferten.76
Was bleibt also von Mosses Argument? Er selbst spricht von einer Brutalisierung der Gewaltpraktiken und Gewaltrepräsentationen in der Zwischenkriegszeit. Während diese These im Kontext der Gewaltpraktiken zurückgewiesen worden ist, erhöhte der Krieg zweifellos die Präsenz von Gewaltdiskursen. Entscheidend für deren Erfolg war, ob sie als legitim ange-sehen wurden. Das geschah (mit Ausnahme einiger osteuropäischer Staaten) vor allem während der Übergangs- und Nachkriegszeit 1917 bis 1923 und dann wieder in der Krise um 1930.77 Wahlplakate identifizierten Feinde, wo eigentlich von politischen Gegnern die Rede hätte sein sollen. Die politi-sche Sprache Europas war von Kampfmetaphern getränkt, der Rekurs auf den verlustreichen Krieg selbstverständlich geworden. In Deutschland bei-spielsweise galt die Westfront als Todeszone, in der die Soldaten für die Na-tion gelitten und gekämpft hatten. Gewalt war tief in die Darstellungen von Soldaten und Kriegslandschaften eingeschrieben, die wiederum wichtiger Bestandteil der Auseinandersetzung um das Erbe des Krieges wurden, das auch mit Raumbildern verhandelt wurde.78 Die Erschütterungen des »lan-gen Ersten Weltkrieges« haben also in der politischen Kultur deutliche Spu-ren hinterlassen, darin ist Mosse zuzustimmen. Sie schufen Repräsentatio-nen, auf die Paramilitärs und Faschisten in der Krise um 1930 zurückgreifen konnten.
Raum und GewaltEuropa war kein einheitlicher »Kontinent der Gewalt« ( James Sheehan), sondern in zahlreiche Räume unterteilt, in denen die Gewalt ganz unter-schiedliche Formen annahm und bisweilen sogar eine gewisse Berechti-gung zu besitzen schien. So empfand das etwa der Kriegsberichterstatter Adolf Köster 1917: »Krieg auf dem Balkan – Krieg in Frankreich. […] Da
75 In der deutschen Ausgabe als »Minderheit der Gewalttätigen« bezeichnet (Collins, Dynamik der Gewalt, S. 558).
76 Sven Reichardt, Faschistische Kampfbünde. Gewalt und Gemeinschaft im italienischen Squadrismus und in der deutschen SA, Köln/Weimar/Wien 2009.
77 Ziemann, Gewalt, S. 163. Zum Stellenwert und zur Funktion von Gewalt in der politischen Sprache vgl. Haupt, Gewalt und Politik.
78 Christoph Nübel, Durchhalten und Überleben an der Westfront. Raum und Körper im Ersten Weltkrieg, Paderborn 2014, S. 369–375; allgemein Dirk Schumann, Politische Gewalt in der Weimarer Republik. Kampf um die Straße und Furcht vor dem Bürgerkrieg, Essen 2001.
Mittelweg 36 1–2/2015 245
unten«, auf dem Balkan, da »paßt der Krieg noch sozusagen in die Land-schaft – der Komitadschis, der Dorfkämpfe, der ewigen Aufstände.« Für Frankreich mit seiner »hochentwickelten Stadtkultur« dagegen gelte das nicht. »[A]nders als in Nisch und Monastir blickt einen hier der Krieg aus allen Dingen an – gedrückter, schmerzlicher.«79 Offenbar galt der Balkan den Zeitgenossen als traditioneller Raum der Gewalt, wohingegen sie in Frankreich als fremd empfunden wurde. Während die Frage, wie Gewalt-räume wahrgenommen werden, nach wie vor zu beantworten bleibt, rückt die Forschung verstärkt das Konzept des Raumes in den Mittelpunkt, um Gewaltdynamiken zu analysieren. Räume werden nicht mehr nur als Teile der Erdoberfläche begriffen, sondern als strukturale Gebilde, die im alltäg-lichen Handeln erst geformt werden. Diese Dynamik lässt nach dem Entste-hen und der Veränderung räumlicher Ordnungsmuster fragen.80
Timothy Snyder hat mit Bloodlands eine dichte Erzählung von der Ge-walt im Osten Europas vorgelegt. Sie wird allerdings unter anderem wegen ihres unreflektierten räumlichen Ansatzes kritisiert. Für Snyder sind die Bloodlands der »Ort, wo alle Opfer starben«. Die Karten im Buch präsentie-ren einen Raum, der sich von Posen bis hinter Kursk erstreckt. Folgt man Snyder, so veränderten sich hier zwischen 1914 und 1941 allenfalls die Län-dergrenzen, nicht aber die Ausdehnung der Bloodlands, deren Konstruk-tionsbedingungen im Buch auch gar nicht erklärt werden. So definiert Sny-der alles, was hier passiert, als das reinste Grauen. Um das Töten im Krieg geht es ihm bezeichnenderweise aber nicht, sondern allein um das »Mas-senmordregister« der Diktatoren Hitler und Stalin, die ihre Herrschaft auf Gewalt gegen Zivilisten stützten – obwohl es mehr als zweifelhaft ist, dass sich Kriegsgewalt und Gewalt in asymmetrischen Machtverhältnissen sau-ber voneinander trennen lassen.81 Auf diese Weise kann das Raumkonzept nicht zur Erklärung des großen Mordens beitragen, das sich in Osteuropa ereignete, sondern verschleiert eher die Vielzahl der Ursachen, welche die Gewalt vorantrieben und das genannte Gebiet, das ist Snyders narrativer
79 Adolf Köster, Wandernde Erde. Kriegsberichte aus dem Westen, München 1917, S. 7. Zur Raumwahrnehmung im Ersten Weltkrieg siehe Nübel, Durchhalten und Überleben. Die Verbindung von materiellen und vorgestellten Räumen analysiert J. Carter Wood, »Locating Violence: The Spatial Production and Construction of Physical Aggression«, in: Katherine D. Watson (Hg.), Assaulting the Past. Violence and Civilization in Historical Context, Newcastle 2007, S. 20–37.
80 Zu dieser Forschungsagenda vgl. Christoph Nübel, »Raum in der Militärgeschichte und Gewaltgeschichte: Probleme, Ergebnisse und neue Felder der Forschung«, in: Militärgeschichtliche Zeitschrift 73 (2014), 2 [im Erscheinen].
81 Snyder, Bloodlands, S. 9, 12. Kritisch dazu Jürgen Zarusky, »Timothy Snyders ›Blood-lands‹: Kritische Anmerkungen zur Konstruktion einer Geschichtslandschaft«, in: Viertel-jahrshefte für Zeitgeschichte 60 (2012), S. 1–31. Zur Dynamisierung der Gewalt an der Ost-front im Zweiten Weltkrieg siehe Shepherd, The Clean Wehrmacht. Auch Gerlach, der sich für eine Gewaltanalyse unterhalb der staatlichen Ebene ausspricht, untersucht nur die »Gewalt gegen Nichtkombattanten« (Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften, S. 7).
246 Mittelweg 36 1–2/2015
Fluchtpunkt, zur Grabstätte von 14 Millionen Ermordeten machten. Damit hat der Autor dem Trend, den Raum zum Gegenstand einer historiografi-schen Erzählung zu machen, zu sehr nachgegeben.
Obschon wir es hier mit einem historiografischen Raumkonstrukt zu tun haben, das ersonnen wurde, um Gewalt untersuchen zu können, wird zu-nehmend der Zusammenhang von historischen Raumstrukturen und Gewalt-formen in den Blick genommen.82 Das von Jörg Baberowski entwickelte Konzept der Gewalträume fragt, wann und wodurch Gewalt ermöglicht wird. Ihm geht es allerdings nicht um eine Verortung der Gewalt im physischen Raum, sondern um die sozialen Bedingungen und Potenziale von Gewalt. In Gewalträumen ist das »Verhalten von Menschen vor allem eine Antwort auf die Präsenz der Gewalt«, denn sie sind »Ermöglichungs- und Ermäch-tigungsräume, in denen Regeln sozialer Kommunikation, die im Frieden gelten, suspendiert sind«.83 Vor allem die osteuropäische Geschichte wird mit diesem Instrumentarium untersucht. In den »shatter zones« scheint die Gewalt ein ideales Habitat gefunden zu haben. Dafür war ausschlagge-bend, dass hier bis Ende der 1920er-Jahre nur schwache staatliche Struktu-ren bestanden.84 Die Erschütterungen des Ersten Weltkrieges wirkten als Katalysator einer Gewaltkultur, indem sie neue Vergesellschaftungsformen, nämlich räuberische Kleingruppen und Milizen, hervorbrachten. Das waren enthemmte, konkurrierende Gewaltakteure, die die Zivilbevölkerung terro-risierten und sie zwangen, zum Zwecke des Selbstschutzes am Gewaltspiel teilzunehmen. Die Regierungen entstehender, sich neu erfindender oder schon wieder zerfallender Staaten wie die Ukraine legitimierten irreguläre Gewaltakteure, um sich ihrerseits im Machtkampf durchsetzen zu können, befeuerten damit allerdings die Gewaltdynamiken weiter.85 Nach dem Ende des Bürgerkrieges 1921 sowie dem Sieg der Roten über die Weißen und die Milizen wurde Gewalt zu einem Mittel der Territorialisierung staatlicher Herrschaft, die zwar vor dem Stalinismus auf dem Lande kaum sichtbar ge-wesen war, sich nun aber blutig etablierte. Die sowjetische Herrschaft be-ruhte auf Gewalt, welche als Mittel der Kommunikation sowie der Durch-setzung von Macht fungierte und damit neue Gewalträume schuf. Dies
82 Zur Unterscheidung vgl. Christoph Nübel, »Der Raum zwischen Materialität und Konstrukt: Raumkonzepte der deutschen Geschichtswissenschaften seit dem 19. Jahr-hundert«, in: Historische Mitteilungen 27 (2015) [im Erscheinen].
83 Jörg Baberowski, »Einleitung: Ermöglichungsräume exzessiver Gewalt«, in: ders. / Gabriele Metzler (Hg.), Gewalträume. Soziale Ordnungen im Ausnahmezustand, Frankfurt am Main / New York 2012, S. 7–28, hier S. 25.
84 Baberowski, Verbrannte Erde, S. 33–43; Schnell, Räume des Schreckens, S. 30–59, 541 f. Gerlach verweist dagegen auch auf staatliche Gewaltakteure (Gerlach, Extrem gewalttätige Gesellschaften, S. 375 f.).
85 Mikroskopisch nachgezeichnet wird dies von Schnell, Räume des Schreckens, bei dem sich auch das akteursbezogene Konzept der »Gruppenmilitanz« findet.
Mittelweg 36 1–2/2015 247
geschah etwa, als Staat und Partei gewaltsam in den lokalen Raum eindran-gen, um die bäuerliche Gesellschaft zu brechen.86
Die enge Verbindung von Territorialität und Gewalt prägte aber auch die Herrschaft anderer europäischer Mächte bereits im 19. Jahrhundert. Sie sahen sich selbst als zivilisierende Kräfte, die sich außereuropäische Länder unterwarfen und damit neue Raumordnungen schufen. Diese Raumordnun-gen waren Ausdruck imperialistischer Ideen, die sich in der Herrschaftspra-xis niedergeschlagen hatten. Solche Akte der Landnahme wurden mit dem Topos des »leeren Raumes« begründet, den es zu füllen galt.87 Das brachte Gewalt mit sich, denn die beanspruchten Räume waren selten tatsächlich leer, sondern wurden von Menschen bewohnt, die man als Verfügungs-masse imperialer Machtprojektionen ansah.
Wie sich Raumbilder (mental maps) auf konkrete Gewaltpraktiken aus-wirkten, ist im Kontext von Nationalismus und imperialer Expansion gezeigt worden, die beide im »langen Ersten Weltkrieg« besonders virulent waren. Im Gefolge der äußerst blutigen Balkankriege entstand die Idee, internatio-nale Spannungen durch einen vertraglich geregelten Bevölkerungsaustausch beizulegen. Bunte Landkarten und Bevölkerungsstatistiken wurden zu Waf-fen in den Kriegsfolgekonflikten, mit denen man Territorien gegen die An-sprüche der Gegenpartei verteidigte. Dem politischen Ringen am grünen Tisch in London, Versailles, Neuilly oder Lausanne folgten blutige Gefechte und gewaltsame Deportationen vor Ort, die sich durch nationale, soziale und religiöse Spannungen verschärften. Etwa 2,8 Millionen Menschen muss-ten während des »langen Ersten Weltkrieges« ihre Heimat verlassen.88 In Ostmitteleuropa, auf dem Balkan und in Kleinasien hoffte man, Konflikte mit einer Welle ethnischer Säuberungen zu lösen. Der Massenmord an den Armeniern 1915 ist ein besonders radikales Beispiel. Aber auch die Politik der »épuration« in Elsass-Lothringen 1918 gehört in diesen Ideenkreis, was deut-lich macht, dass Gewalt gegen Zivilisten auch in Demokratien opportun war.
Schluss: Gewaltgeschichte heuteDieser Forschungsüberblick verbindet die Ergebnisse einiger jüngerer Bei-träge zu einer Gewaltgeschichte des »langen Ersten Weltkrieges«. Die viel-fältigen Gewaltformen und -ereignisse der Jahre 1900 bis 1930 belegen, dass
86 Baberowski, Verbrannte Erde. 87 Ulrike Jureit, Das Ordnen von Räumen. Territorium und Lebensraum im 19. und
20. Jahrhundert, Hamburg 2012. 88 Ther analysiert die Gewaltpraktiken in der Balkanregion (Philipp Ther, »Pre-negotiated
Violence: Ethnic Cleansing in the ›Long‹ First World War«, in: Böhler / Borodziej / von Puttkamer [Hg.], Legacies of Violence, S. 259–284) und liefert auch die zitierten Zahlen, während Jureit den Schwerpunkt auf die Verhandlungsprozesse im Gefolge von Versailles legt ( Jureit, Das Ordnen von Räumen, S. 179–235).
248 Mittelweg 36 1–2/2015
Gewalt eine oft genutzte Handlungsoption war. Ein großer Teil der Studien konzentriert sich darauf, die Ursachen der Gewalt zu erklären, und betrach-tet sie als einen sozialen Modus, Bedingungen der Inklusion und Exklusion zu verhandeln. Neben den oben identifizierten Desideraten und umstritte-nen Fragen soll abschließend auf zwei Grundprobleme hingewiesen werden, die die Forschung nach wie vor beschäftigen und von deren Reflexion wich-tige Impulse zu erwarten sind.
(1) Während sich die Militärgeschichte vor allem als Geschichte der staatlich organisierten Tötungsgewalt begreift, konzentriert sich die Ge-waltgeschichte oftmals auf alltägliche oder staatsferne Konflikte. Anstatt weiterhin getrennt zu forschen, sollten beide Subdisziplinen vereint schla-gen: Das Gewaltraumkonzept beispielsweise ist auch für die Analyse des Krieges sinnvoll, weil dieser ebenfalls Eigendynamiken unterliegt, die bei der Interaktion ganz unterschiedlicher Akteure vor Ort entstehen. Die Mi-litärgeschichte könnte davon profitieren, die Entschlüsse der Befehlshaber stärker mit Gewaltpraktiken vor Ort zu verknüpfen oder neben den Voraus-setzungen und Folgen der Gewalt eine dichte Beschreibung der Gewaltakte vorzunehmen. Umgekehrt sollte die Gewaltgeschichte auch den Handlun-gen des Militärs im Krieg Aufmerksamkeit schenken. Als »Akt der Gewalt« (Clausewitz) gehört der Krieg schließlich mit in ihren Forschungsbereich.
(2) Die Gewaltforschung integriert teilweise körper- und geschlechter-geschichtliche Fragen, erschöpft sich jedoch zu oft in der Analyse scheinbar rationaler Prozesse, ohne die Emotionen zu berücksichtigen. Angst und Euphorie können jedoch auf Akteure (ent-)hemmend wirken, wie Collins eindrücklich gezeigt hat.89 Gewaltrepräsentationen wiederum sind emotio-nal codiert, weil sie immer im Rahmen von Gefühlsregistern interpretiert werden. Diese Deutungs- und Handlungsmuster schlagen bestimmte Reak-tionen auf Gewaltdarstellungen vor. Emotionen sind keine historischen Konstanten, sondern verändern sich stetig. Ihre Omnipräsenz und vor allem ihre Historizität legen es nahe, ihnen einen festen Platz in der Gewaltge-schichte einzuräumen. Nicht zuletzt kann der Blick auf Gefühle helfen, die Verarbeitung von Gewalterfahrungen zu erforschen und zu ergründen, wie sich das individuelle Selbstverständnis der Beteiligten zwischen dauerhaf-ten Verletzungen und Überlebensstolz formte. Denn es sind oftmals die Be-richte der Überlebenden, auf die sich die Gewaltgeschichte bezieht.
Christoph Nübel, Historiker, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Europäische Geschichte des 19. Jahrhunderts der Humboldt-Universität zu Berlin. [email protected]
89 Collins, Dynamik der Gewalt, S. 35 und passim.




























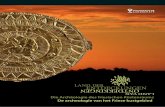







![Gewalt im Militär. Die Rote Armee im Zweiten Weltkrieg [Violence in the Military. The Red Army in World War II]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d3447665120b3330c3b4a/gewalt-im-militaer-die-rote-armee-im-zweiten-weltkrieg-violence-in-the-military.jpg)

![»Wollen Sie wirklich Armee und Bevölkerung ohne Hosen lassen […]?!« Die Mobilisierung für den Zweiten Weltkrieg in der usbekischen Sowjetrepublik (»Do you really want to leave](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631d34ab665120b3330c3b7c/wollen-sie-wirklich-armee-und-bevoelkerung-ohne-hosen-lassen-die-mobilisierung.jpg)