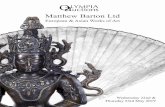Kontinuität und Wandel. Beobachtungen am Zeustempel von Olympia
Transcript of Kontinuität und Wandel. Beobachtungen am Zeustempel von Olympia
FORSCHUNGSCLUSTER 4
Heiligtümer: Gestalt und Ritual, Kontinuität und Veränderung
Sanktuar und Ritual Heilige Plätze im archäologischen Befund
Herausgegeben von
Iris Gerlach und Dietrich Raue
VIII, 416 Seiten mit 352 Abbildungen und 2 Tabellen
Titelvignette: S. irwāh. , Άlmaqah-Tempel. Rekonstruktionszeichnung des Vorhofs. Blickrichtung nach Nordwesten. Am nordwestlichen Ende des Vorhofs erstrecken sich weitere Sakralbauten. Zeichnung: DAI, Orient-Abteilung (M. Kinzel)
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Iris Gerlach / Dietrich Raue (Hrsg.)Sanktuar und Ritual ; Heilige Plätze im archäologischen Befund. Rahden/Westf.: Leidorf 2013
(Menschen – Kulturen – Traditionen ; ForschungsCluster 4 ; Bd. 10)ISBN 978-3-86757-390-0
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier
Alle Rechte vorbehalten© 2013
Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel
Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.Tel: +49/ (0) 57 71/95 10-74Fax: +49/(0) 57 71/95 10-75
E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de
ISBN 978-3-86757-390-0ISSN 2193-5300
Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, BLUERAY, Internet oder einemanderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlagentwurf und Standard-Layout: Catrin Gerlach und Jörg Denkinger, Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale BerlinRedaktion: Anja Ludwig, Berlin
http://www.dainst.org
Satz, Layout und Bildnachbearbeitung: stm | media GmbH, Köthen/Anhalt
Druck und Produktion: IMPRESS Druckerei Halbritter KG, Halle/Saale
1 G. Treu, Löwenköpfe von der Traufrinne des Zeustempels, Olympia II (Berlin 1892) 22 – 27; F. Willemsen, Die Löwenkopf-Wasserspeier vom Dach des Zeustempels, OF 4 (Berlin 1959).
2 W. B. Dinsmoor, An Archaeological Earthquake at Olympia, AJA 45, 1941, 399 – 427.
3 So stammt keine einzige der insgesamt 20 Säulentrommeln mit Wolfslöchern, die Dinsmoor a. O. (Anm. 2) 414 f. heranzog, um eine Reparatur der Ostseite zu belegen, von dort.
4 P. Grunauer, Zur Ostansicht des Zeustempels, 10. OlBer (Berlin 1981) 275 – 280; A. Mallwitz, Neue Forschungen in Olympia. Theater und Hestiaheiligtum in der Altis, Gymnasium 88, 1981, 108 – 110.
5 J. Younger – P. Rehak, Technical Observations on the Sculptures from the Temple of Zeus at Olympia, Hesperia 78, 2009, 41 – 105, legten jüngst Überlegungen zur Reparaturgeschichte des Zeus-Tempels dar. Wenn Younger, ebenda 43, meint, bisher wäre meist nicht versucht worden, die Geschichte des Baus und seiner Skulp-turen zu verstehen, dürfte ihm vermutlich der überwiegende Teil der deutschsprachigen Arbeiten der letzten 80 Jahre nicht bekannt gewesen sein.
6 A. Mallwitz, Ergebnisse und Folgerungen, 11. OlBer (Berlin 1999) 224 – 229.
Kontinuität und WandelBeobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia
Arnd Hennemeyer
Der Zeus-Tempel war von seiner Errichtung, die allgemein ab etwa 470 v. Chr. angesetzt wird, bis zu seiner Aufgabe über 850 Jahre in Betrieb. Diese zeitliche Dimension des Bauwerks gründlicher zu erschließen, ist ein Schwerpunkt der derzei-tigen Arbeiten im Rahmen der monographischen Vorlage des Zeus-Tempels von Olympia, in die der folgende Beitrag einen Einblick gibt. Die Ruine soll dabei mit den Methoden und aus Sicht der Bauforschung unter den beiden Aspekten Kontinuität und Wandel betrachtet werden. Der Begriff Kon-
tinuität steht für die Tatsache, dass der Bau über diesen lan-gen Zeitraum laufend instand gehalten und repariert werden musste. Diese Arbeiten stellten, das muss man sich bewusst machen, keineswegs nur kleinere Instandhaltungsmaßnah-men dar, sondern durchaus große Bauvorhaben bei denen nach Beschädigungen ganze Bereiche des Tempels wieder hergestellt werden mussten. Als komplementäre Ergänzung werden zwei Einbauten vorgestellt, die vielleicht besonders deutlich Aspekte des Wandels am Zeus-Tempel zeigen.
Kontinuität – Zur Reparaturgeschichte des Zeus-Tempels
Unter den Löwenkopfwasserspeiern vom Dachrand wa-ren bereits während der Ausgrabung des 19. Jh. zahlreiche Ersatzstücke aufgefallen, die Georg Treu und später Franz Willemsen umfassend in einer eigenen Monographie nach stilistischen Merkmalen Reparaturen vom 4. Jh. v. bis zum 3. Jh. n. Chr. zuweisen konnten1. Insgesamt haben sich auf diese Weise Reste von etwa 150 Stücken erhalten, während am Dachrand ursprünglich nur 98 erforderlich waren. Dass die Beschädigungen und Reparaturen aber auch am Bauwerk selbst viel weitreichender waren, als man anfangs angenom-men hatte, machte William Bell Dinsmoor mit seinem Aufsatz »An Archeological Earthquake« offensichtlich2. Dieser Auf-satz stellte seither, wenn auch bei der Zuweisung von Bau-gliedern an bestimmte Stellen am Bauwerk wie bei der Da-tierung etliche Irrtümer enthalten sind3, gewissermaßen den Leitfaden für die folgenden Forschungen am Zeus-Tempel dar. Während der Bearbeitung durch Peter Grunauer zeich-nete sich ab, dass die östliche Frontseite im 4. Jh. v. Chr. zu erheblichen Teilen abgebaut und wieder neu errichtet wur-
de4. Der gesamte Umfang an Reparaturen wird hingegen erst jetzt durch die umfassende Inventarisierung und Katalogisie-rung aller Bauglieder und Fragmente kenntlich5. Hinzu kom-men neue Beobachtungen an den in situ erhaltenen Teilen der Ruine. Die einzelnen Bauglieder, die für Wiederherstellun-gen des Baus gefertigt worden sind, lassen sich aber mangels fest datierbarer Charakteristika in der Regel weit schwieriger als die Löwenkopfwasserspeier unterschiedlichen Phasen zuweisen. Eine vollständige Klärung der verwirrend zahlrei-chen einzelnen Reparaturbeobachtungen wird daher sowie wegen der Komplexität der Reparaturgeschichte wohl kaum mehr möglich sein. Die folgende Übersicht gibt so immer noch nur einen vorläufigen Stand der Arbeiten wider – eine erhebliche Anzahl von Bauteilen vor allem der Westseite ist noch nicht untersucht – und muss in Teilen hypothetisch bleiben. Doch lassen sich inzwischen auch für den gesamten Bau mindestens vier große Reparaturphasen unterscheiden, die erste noch im 5. Jh. v. Chr., die letzte bereits in der Spät-antike.
Reparatur I (mittleres 5. Jh. v. Chr.)
Die Hinweise auf einen erheblichen Eingriff im mittleren 5. Jh. v. Chr., wohl nach einer Beschädigung des Tempels noch kurz vor oder unmittelbar nach seiner Fertigstellung, haben sich verdichtet: Die so genannte Steinzeilenschicht – südlich des Geländes der Hestia-Halle gelegen – enthielt bekannt-
lich zwei Fragmente eines bereits versetzten Antenkapitells des Zeus-Tempels sowie zwei Fragmente von Kalypteren des Tempeldaches6. Die Buleuterionvorhalle, in dessen Fun-dament ein Geisonblock des Tempels verbaut ist, wird nun sowohl stilistisch als auch stratigraphisch ebenfalls etwa in
Arnd Hennemeyer20
7 A. Heiden, Die Tondächer von Olympia, OF 24 (Berlin 1995) 118 f.; K. Herrmann, Anmerkungen zur ionischen Architektur in der Pelo-ponnes, in: E.-L. Schwandner (Hrsg.), Säule und Gebälk. Zu Struktur und Wandlungsprozeß griechisch-römischer Architektur, DiskAB 6 (Mainz am Rhein 1996) 127 f.; H. Kyrieleis – K. Herrmann, Bericht über die Arbeiten in Olympia in den Jahren 1982 – 1999, 12. OlBer (Berlin 2003) 28. 31. 46 – 48.
8 A. Hennemeyer, Neue Forschungsergebnisse zur Cella des Zeus-tempels von Olympia, in: Koldewey-Gesellschaft (Hrsg.), Bericht über die 43. Tagung für Ausgrabungswissenschaft und Baufor-
schung vom 19.–23. Mai 2004 in Dresden (Stuttgart 2006) 103 – 111. 9 Grunauer a. O. (Anm. 4); Mallwitz a. O. (Anm. 4). 10 Grunauer a. O. (Anm. 4) 277 – 279. 11 Mallwitz a. O. (Anm. 4) 109. 12 W. Koenigs, Die Echohalle, OF 14 (Berlin 1984) 16. 97. 98 Taf. 32. 81. 13 W. Dörpfeld, Der Zeustempel, Olympia II (Berlin 1892) 22. 14 A. Mallwitz, Olympia und seine Bauten (München 1972) 246. 15 Xen. hell. 7, 4, 21 – 32; Mallwitz a. O. (Anm. 4) 113. 16 A. Mallwitz, Zu zwei Ereignissen im 4. Jh. v. Chr., 11. OlBer (Berlin
1999) 246.
diese Zeit datiert7. Vor allem aber zwingen Beobachtungen in der Cella zu dem Schluss, dass dort umfassende Arbeiten ausgeführt werden mussten8: Die Stylobatplatten der Cel-lasäulenreihen wurden offensichtlich ein zweites Mal verlegt. Dabei nahm man gegenüber der ursprünglichen Planung deutliche Änderungen vor: Man verringerte die Jochweite und dementsprechend die Plattenformate des Stylobats, an-scheinend um Wandpfeiler als Abschluss der Säulenreihen einzufügen. Des Weiteren verbreiterte man das Mittelschiff um zwölf Zentimeter. Man könnte daher vermuten, dass es
sich um eine Planänderung im Baufortschritt handelte. Indes zeugen noch Stemmlöcher von der Verlegung des Stylobats mit der ursprünglichen Fugenaufteilung. Eine deutlich we-niger sorgfältige Ausführungsqualität, wie sie am ursprüngli-chen Bau sonst nirgends zu beobachten ist, belegt, dass es sich um eine spätere Maßnahme handelt. Andererseits muss sie noch vor oder gleichzeitig mit der Aufstellung der Zeus-Statue des Pheidias ausgeführt worden sein. An der Entwick-lung der Löwenkopfwasserspeier ist eine der ursprünglichen Errichtung zeitlich so nahe Reparatur stilistisch nicht greifbar.
Reparatur II (4. Jh. v. Chr.)
Bereits von Grunauer, Alfred Mallwitz und Klaus Herrmann wurde erkannt, dass am Tempel wohl im 2. Viertel des 4. Jh. v. Chr. umfassende Reparaturen durchgeführt wurden9. Südlich vor der Hestia-Halle wurde gegen 360 v. Chr. eine Schicht (IV b) angeschüttet, die zahlreiche abgeschlagene Fragmente des Zeus-Tempels enthielt. Im Fundament der Hestia-Halle ist die Halstrommel einer Frontsäule verbaut10; Mallwitz vermutet sogar, dass die Hestia-Halle zur Gänze aus beschädigtem und umgearbeitetem Material des Zeus-Tem-pels errichtet worden ist11. Des Weiteren sind im Fundament der Echohalle mehrere Fragmente von Säulentrommeln so-wie eine Triglyphe des Zeus-Tempels verbaut12. In der wohl gleichzeitigen Wasserleitung zwischen Echohalle und Hestia-Bau sind mehrere Triglyphen einer Naosfront des Tempels wiederverwendet13, die aus mehreren Gründen wahrschein-lich vom Pronaos stammen. Schließlich verläuft unter dem Westtrakt des Leonidaions das Fundament wohl einer Halle, die nach Mallwitz kurz zuvor begonnen, dann aber wieder aufgegeben worden war14. Hierin sind mehrere umgearbei-tete Bauteile des Tempels verbaut, vor allem Geisonblöcke, aber auch ein Teil eines Architravs und weitere nicht sicher identifizierbare.
Einen genaueren Datierungsanhalt gibt indes ein merk-würdiger stratigraphischer Befund: Man stieß auf drei schräg verlaufende Gräben, die vom Bereich der Hestia-Halle nach
Westen führten. Mallwitz interpretierte sie überzeugend als jene Verteidigungsstellung, die die Arkader eilig angelegt hatten, als die Eleier während der Olympiade 364 v. Chr. ver-suchten, die Altis zurückzuerobern15. Da sich die Gräben aber an der Hestia-Halle orientierten, muss diese bereits gestan-den sein. »Nur mangels anderer Anhaltspunkte« vermutet Mallwitz weiter16, dasjenige Beben, das 373 v. Chr. die Stadt Helike im Meer versinken ließ, mag auch den Zeus-Tempel beschädigt haben. Das wäre möglich, scheint aber aus meh-reren Gründen problematisch: Es irritiert zum einen, dass sich keine anderen beschädigten Bauten zwingend mit diesem Beben in Verbindung bringen lassen. Des Weiteren ist bei dem für den Bau der Hestia-Halle angesetzten Zeitraum nicht ausreichend berücksichtigt, dass einer Umarbeitung der Bau-glieder der Abbau der beschädigten Partien vorangegangen sein muss, wenn nicht sogar vorrangig die Reparatur des Tempels in Angriff genommen wurde. Schließlich erscheint fraglich, ob das Bauprojekt unter der arkadischen Besetzung ab dem Jahr 366 v. Chr. nahtlos weitergeführt wurde. Aus diesen Gründen müsste die Beschädigung früher angenom-men werden. In der ›Formenschicht‹ südlich der Pheidias-Werkstatt fanden sich zahlreiche Stücke mehrerer Dächer. Achim Heiden bringt diese um 390 v. Chr. datierte Schicht daher mit Aufräumarbeiten nach einem Erdbeben in Verbin-dung, vielleicht nach jenem, das 402 v. Chr. Elis erschüttert
Abb. 1 Vergleich der Kapitellformen. a. Zeus-Tempel Olympia, ursprüngliches Kapitell der Langseite 470/460 v. Chr. – b. Zeus-Tempel Olympia, Ersatz-kapitell der Ostseite ~360 v. Chr. – c. Tegea, Tempel der Alea Athena, Kapitell der Ringhalle ~370 – 350 v. Chr.
Kontinuität und Wandel – Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia 21
17 Xen. hell. 3, 2, 24; Heiden a. O. (Anm. 7) 165.18 Koenigs a. O. (Anm. 12) 7.19 F. Krauss, Die Säulen des Zeustempels von Olympia, in: E. Boehrin-
ger – W. Hoffmann (Hrsg.), Robert Boehringer. Eine Freundesgabe (Tübingen 1957) 365 – 387; A. Hennemeyer, Zur Lichtwirkung am Zeustempel von Olympia, in: U. Wulf-Rheidt – P. Schneider (Hrsg.), Licht-Konzepte in der vormodernen Architektur, DiskAB 10 (Regens-burg 2010) 101 – 110.
20 I. Trianti, Neue Beobachtungen an den Skulpturen des Zeustempels von Olympia, in: H. Kyrieleis (Hrsg.), Olympia 1875 – 2000. 125 Jahre deutsche Ausgrabungen. Internationales Symposion, Berlin 9.–11. November 2000 (Mainz 2002) 281 – 300.
21 Willemsen a. O. (Anm. 1) 81 f. – Vgl. W. Dittenberger – K. Purgold, Die Inschriften von Olympia, Olympia V (Berlin 1896) 697 – 700.
22 Treu a. O. (Anm. 1) 26; G. Treu, Die Bildwerke von Olympia in Stein und Thon, Olympia III (Berlin 1897) 94 f.
23 P. Grunauer, Der Zeustempel in Olympia – Neue Aspekte, BJB 171, 1971, 119 Abb. 2.
haben soll17. Die Arbeiten am Tempel haben sich wohl bis in die zweite Jahrhunderthälfte erstreckt. Darauf weist die oben erwähnte Triglyphe im Fundament der im 3. Viertel des 4. Jh. v. Chr. begonnenen Echohalle, die, wie sich jetzt aufgrund der Abmessungen zeigen ließ, für diese zweite Reparaturpha-se gefertigt, dann aber verworfen worden ist.
Vom Problem der genauen Datierung abgesehen wurde jedenfalls, wie sich an den verstürzten Bauteilen ablesen lässt, die gesamte Ostfassade des Tempels abgebaut und von den untersten Säulentrommeln an neu errichtet – zum größten Teil aus neu gebrochenem Baumaterial, das sich von den frü-her verwendeten Muschelkalkvarianten klar unterscheidet, da die Muscheln vollständig zersetzt sind und sich nur ihre Hohlformen im Stein abzeichnen. Dass dieselbe charakteris-tische Muschelkalkvariante auch an der Südhalle sowie für die später bei der Fertigstellung der Echohalle wiederver-wendeten Bauteile einer ›zerlegten Halle‹18, einer sonst unbe-kannten Hallenarchitektur des 4. Jhs. v. Chr., verwendet wur-den, stützt die zeitliche Verbindung der Reparatur mit den in den Fundamenten verwendeten Baugliedern. Zum anderen lassen sich die Detailformen, die gegenüber den ursprüngli-chen Bauteilen subtil geändert sind, mit einer Datierung ins 4. Jh. v. Chr. gut in Einklang bringen. So sind die Kapitelle vor allem im Bereich der Kannelurenden verändert, und die Kanneluren haben im Querschnitt nicht mehr die Form eines
Kreissegments, sondern eines Korbbogens (Abb. 1. 2)19. Bei dieser Wiederherstellung mussten natürlich die Giebelskulp-turen entfernt und abschließend wieder versetzt werden, womit sich zahlreiche technische Beobachtungen an diesen erklären lassen20.
Reparatur III (etwa 2. Hälfte des 1. Jhs. v. Chr.?)
Die bei weitem umfassendste Erneuerung der Sima, die mit den drei Ersatzfiguren für den Westgiebel in Verbindung ge-bracht wird, setzte Willemsen in die Zeit des Agrippa: »Nur ein Mal vereinigen sich literarische und monumentale Zeug-nisse, um von einer Beschädigung des Zeus-Tempels und Notlage des gesamten Heiligtums Kenntnis zu geben, die ins erste vorchristliche Jahrhundert gehören«21. Folgende Aspek-te flossen hierbei zusammen: Nach Eusebius wurde die Zeus-Statue 56 v. Chr. vom Blitz getroffen. Flavius Josephus gibt an, Herodes I. von Judäa habe als Agonothet an den Spielen teilgenommen, und seine Stiftungen hätten sich auf die ge-samte Ausstattung des Heiligtums erstreckt. Seit 36 v. Chr. werden ausgewechselte marmorne Dachziegel des Tempels zur Aufzeichnung von Beamtenlisten zweitverwendet. Es gibt ein Inschriftenfragment, das Agrippa nennt, mit großen eingelassenen Bronzebuchstaben auf einem rot geäderten Marmor, wie er auch für den nachträglichen Plattenboden aus Buntmarmor im Pronaos und dem östlichen Pteron ver-wendet worden ist. Schließlich bestehe, so bereits Treu22, eine starke stilistische Ähnlichkeit zwischen den Löwenköp-fen dieser Reparaturphase und den drei Ersatzfiguren im Westgiebel.
So bestechend diese Zusammenstellung ist, bestehen doch mehrere Angriffspunkte: Die Inschriftenfragmente wa-ren zwar nördlich und nordöstlich des Zeus-Tempels ver-streut, doch teils in erheblichem Abstand. Agrippa ist zudem kein seltener Name, zumal sich nicht ausschließen lässt, dass es sich um einen Beinamen handelt. Die Verbindung mit der Erneuerung der Sima ist aber nur durch zeitliche Nähe herge-stellt. Des Weiteren ist die stilistische Datierung der Ersatzfi-guren keineswegs frei von Zweifeln. Auch wenn sie seit län-gerem überwiegend ins 2. oder 1. Jh. v. Chr. datiert werden, reichen einzelne Vorschläge bis ins 4. Jh. v. Chr. zurück.
Von diesen Problemen abgesehen: Lassen sich mit der Erneuerung am Dachrand oder den Ersatzfiguren wiederum Reparaturmaßnahmen am Gesamtbau in Verbindung brin-gen? Grunauer belegte anhand der Tatsache, dass auf der Westseite der nördliche Eckarchitrav zu lang gefertigt ist, dass mit der Fertigung der darüber angeordneten Ersatzfi-guren wohl eine größere Reparatur an der architektonischen Struktur einhergegangen sein müsse23. Tatsächlich besitzen alle Architrave der Westseite einschließlich der anschließen-den Eckjoche auf den Langseiten sogar einen etwas anderen Steinschnitt. Auch die Triglyphen und Metopen unterschei-
Abb. 2 Olympia, Zeus-Tempel. Kanneluren der Ostseite. Vermessung mit Kreisschablonen
Arnd Hennemeyer22
24 W. Dörpfeld, Alt-Olympia. Untersuchungen und Ausgrabungen zur Geschichte des ältesten Heiligtums von Olympia und der älte-ren griechischen Kunst (Berlin 1935) 258 f. Abb. 68; Dinsmoor a. O. (Anm. 2) 409.
25 F. Krauss, Beobachtungen am Zeustempel von Olympia, in: Neue Ausgrabungen im Nahen Osten, Mittelmeerraum und in Deutsch-land. Bericht über die Tagung der Koldewey-Gesellschaft in Regens-
burg vom 23. bis 27. April 1957 (o. O., o. J.) 10 Seiten ohne Seiten-zahl, nahm noch abweichend an, der eine Typ von Wolfslöchern gehe auf die ursprüngliche Erbauung des Tempels zurück.
26 Willemsen a. O. (Anm. 1) 74 – 90. 124.27 P. Grunauer, Der Westgiebel des Zeustempels zu Olympia, JdI 89,
1974, 25 f. mit Abb. 23. 24 und Anm. 62.
den sich in technischen Merkmalen von denen der Langsei-ten. Einige Stücke der Südseite nahe dem westlichen Ende zeigen sowohl die ursprünglichen Hebelöcher (für einschieb-bare Hebebossen) als auch Wolfslöcher, wie sie an der West-seite beobachtet wurden, sowie zweimalige Verklammerung. Diese Beobachtungen lassen nur einen Schluss zu: Auch der Westgiebel einschließlich des Gebälks muss einmal ab- und neu aufgebaut worden sein. Das betraf anscheinend auch die Kapitelle, nicht aber die unteren Abschnitte der Säulen.
Die Detailunterschiede weisen in ihrer Gesamtheit darauf hin, dass die Westseitenreparatur zumindest organisatorisch von der Neuerrichtung der Ostseite getrennt werden muss. Der große zeitliche Abstand ist indes keineswegs zwingend. Der Zusammenhang mit den Ersatzfiguren ist zwar plausibel, jedoch nicht zu beweisen. Die Datierung dieser Reparatur-phase muss bislang weiter lediglich an den zahlreichen Er-satz von Löwenkopfwasserspeiern und an die Datierung der Ersatzfiguren angehängt werden.
Weitere Reparaturmaßnahmen
Daneben gibt es weitere Reparaturmaßnahmen, die sich bis-lang aber keiner bestimmten Phase zuweisen lassen. Schon Wilhelm Dörpfeld beobachtete, dass auf den Sichtseiten von Gebälkbauteilen der Westecken Löcher für große Π-Klammern eingeschlagen sind, und erklärte dies mit einer Sicherungs-maßnahme24. Inzwischen wurden weitere Bauteile mit solchen Klammerlöchern identifiziert, sowohl der westlichen Ecken als auch der Nordostecke, vor allem aber auch auf mehre-ren Wandquadern der Cellamauern (Abb. 3). Es handelt sich nicht mehr nur um eine auf einen kleinen Problempunkt be-schränkte Maßnahme. Auf den Außenseiten der Cellawände wurden anscheinend systematisch Hunderte von Klammern gesetzt, um dem Bau größere Stabilität zu geben, wofür er-hebliche Mengen Eisen und Blei benötigt wurden. Auch bei den Bauteilen der Gebälkecken des Pronaos muss es sich um Reparaturstücke handeln. Angesichts zweier unterschiedlicher Wolfslochtypen, die beide an Bauteilen des ursprünglichen Bauwerks nicht beobachtet wurden, müssten sie sogar zwei-mal in deutlichem zeitlichem Abstand versetzt worden sein25.
Reparatur IV (spätantik)
Die letzten Reparaturen schließlich lassen sich wieder als eine eigene Phase fassen. Willemsen datiert die letzte Erneue-rungsphase an den Wasserspeiern um 300 und bringt sie mit Diokletians Maßnahmen zur Wiederherstellung ›Alter Wer-te‹ in Verbindung26. Wenn zu dieser Zeit der Dachrand ein letztes Mal umfassend repariert wurde, also im Großen und Ganzen noch bestand und wiederhergestellt worden war, stellt sich jedoch ein Problem: Die letzte Reparaturphase am Gesamtbau hat nämlich, wie sich anhand der Bauglieder er-schließen lässt, den Dachrand zumindest auf der Nordseite nicht mehr erreicht; denn da eine beträchtliche Anzahl von Säulentrommeln aus Architravblöcken als autophagem Spo-lienmaterial des Tempels umgearbeitet wurde, hätte man für diese Stücke logischerweise Ersatz schaffen müssen. Entspre-chend roh gearbeitete Ersatzstücke aus dem Gebälk sollten leicht zu erkennen sein. Jedoch lassen sich, vielleicht mit Aus-nahme der Südostecke des Frieses, keine finden. Im Norden liegen die wenigen erhaltenen Gebälkstücke fast ausschließ-
lich vor einem einzigen Joch. Zudem handelt es sich anschei-nend um Stücke des ursprünglichen Baus. Man muss daher annehmen, dass die Peristasis des Tempels zu großen Teilen gar kein Gebälk mehr besaß, sondern trotz umfassender Re-paraturversuche schließlich den Anblick einer Ruine gebo-ten hatte. Es sei denn, man nähme an, das gesamte Gebälk wäre in Holz ersetzt, darauf aber wieder eine marmorne Sima versetzt worden. Das scheint wenig plausibel. Nach dieser Überlegung muss die letzte große Reparatur später als die letzte Erneuerung an den Wasserspeiern sein und demnach im 4. oder gar erst Anfang des 5. Jhs. angenommen werden. Jedenfalls wurden die Arbeiten plötzlich abgebrochen und nicht mehr aufgenommen: Für eine Säule der Südseite sind bereits mehrere Architravblöcke auf das Format von Säu-lentrommeln geteilt, deren Lagerflächen aber noch nicht geebnet worden (Abb. 4). Auf der Westseite sind auf der Oberseite eines Kapitellechinus, wie schon von Grunauer ge-zeigt27, Taenia, Regula und Guttae aus der Erstverwendung
Abb. 3 Olympia, Zeus-Tempel. Wandquader der Naosmauer mit Klam-merlöchern auf der Sichtseite
Kontinuität und Wandel – Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia 23
28 Kedrenos 1, 564.29 C. Mango – M. Vickers – E. D. Francis, The Palace of Lausus at Cons-
tantinople and Its Collection of Ancient Statues, Journal of the His-tory of Collections 4/1, 1992, 95; S. Guberti Bassett: »Excellent Offe-rings«. The Lausos Collection in Constantinople, ArtB 82, 2000, 1, 11.
30 Scholion zu Lukian, Rhet. praec. 6 (H. Rabe [Hrsg.], Scholia in Lucia-num [1906, Neudruck Stuttgart 1971] 175 – 177).
31 U. Buchert, Denkmalpflege im antiken Griechenland. Maßnahmen zur Bewahrung historischer Bausubstanz (Frankfurt 2000) 150.
32 Vgl. D. Steuernagel, Erscheinung und Funktionen griechischer Tem-pel in der Zeit römischer Herrschaft, in: J. Rüpke (Hrsg.), Antike Re-ligionsgeschichte in räumlicher Perspektive. Abschlußbericht zum Schwerpunktprogramm 1080 der Deutschen Forschungsgemein-schaft »Römische Reichsreligion und Provinzialreligion« (Tübingen 2007) 157 – 161.
als Architrav noch nicht abgearbeitet worden. Das heißt aber, dass das Stück ebenfalls nicht mehr versetzt worden ist. Auf der Westseite und vor der Südwestecke liegen weitere Bau-teile, nämlich Architrave und Metopen, die man bereits be-gonnen hatte, in Säulentrommeln umzuarbeiten. Der Stand der Arbeiten scheint wie eingefroren. Ein solch abrupter Abbruch lässt sich wohl kaum allein mit dem Versiegen der Finanzierungsquellen erklären – hier hätte man wohl doch
weniger Stücke nur halb angefangen und lieber einiges noch zu einem gewissen Abschluss gebracht. Sondern man muss vielmehr annehmen, dass die Arbeiten plötzlich obsolet ge-worden waren, sei es durch Verbot des Kults durch Theodo-sius I. in den 390er Jahren, sei es durch die Entfernung der Zeus-Statue, die, wie uns Kedrenos überliefert28, in Konstan-tinopel im Palast des Lausos aufgestellt wurde – wohl gegen 420, als dieser die höchsten Staatsämter innehatte29, oder sei es durch die Zerstörung des Baus wohl durch Brand in der Zeit Theodosius II., wie durch ein Scholion überliefert wird30 und heftige Abplatzungen der Oberflächen in der Cella na-helegen.
Dass in größerer Zahl Gebälkbauteile zu Säulentrommeln umgearbeitet wurden, entsprechender Ersatz aber nicht vorhanden ist, verrät aber auch den Zustand des Tempels in der Spätzeit des Heiligtums. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als die Reparatur abgebrochen worden war, standen von der Peristasis auf den Langseiten nur noch die Säulen, wäh-rend das Gebälk weitgehend fehlte. Entweder der Tempel war schwer zerstört, und man versuchte als erstes die Säulen wieder aufzustellen, wobei man auch auf vermutlich bereits heruntergefallene Gebälkstücke zurückgriff. Oder aber die vollständige Wiederherstellung des Baus war gar nicht mehr beabsichtigt, so dass die Gebälkteile zur Verwendung als au-tophage Spolien frei geworden waren. Nicht die überdeckte Ringhalle, sondern nur noch der Kranz der Säulen wäre in Stand gehalten bzw. gesetzt worden.
Reparaturen als Kontinuität
Trotz des nie endenden, umfassenden Reparaturbedarfs errichtete man auch bei erheblichen Zerstörungen keinen Neubau – ohnehin nicht für den gesamten Bau, wobei sich das Problem gestellt hätte, dass man die Zeus-Statue hätte ab- und neu aufbauen müssen. Doch wurde auch die Peri-stasis, die den Anblick des Tempels bestimmt, nie in neuen Formen errichtet. Das ist durchaus bemerkenswert, bedenkt man, welchen Umfang die Reparaturen teilweise hatten. Eine konkrete, überschlägige Berechnung soll den Reparaturauf-wand verdeutlichen: Eine Säule des Tempels – über 10 ½ m hoch und am Säulenfuß mit einem Durchmesser von gut 2,20 m – besteht aus etwa 40 m³ Stein, eine Säule beispiels-weise der Echohalle hingegen aus nur 2,0 – 2,5 m³. Die in der 1. Hälfte des 4. Jhs. v. Chr. neu errichtete Ostseite des Tem-pels enthielt also fast die 2 ½-fache Materialmenge der 98 m langen Front der Echohalle. Bei all diesen Reparaturmaßnah-men wurden beschädigte Teile des Baus, von wenigen Aus-nahmen abgesehen, immer wieder, soweit man vermochte, nach den längst altertümlich gewordenen Proportionen und Bauformen des Strengen Stils wiederhergestellt31. Diese be-wusste Anpassung an den Bestand setzt selbstverständlich eine intensive Auseinandersetzung mit diesem voraus. Der
Tempel wurde also nicht nur in seiner Funktion als Umhau-sung der Zeus-Statue und Haupttempel von Olympia ge-schätzt, sondern auch die Architektur des Baus in ihrem über-kommenen Aussehen. Wie sich nur vermuten lässt, dürften gerade das Alter des Baus oder sogar der Bau als Zeugnis der Geschichte einen wesentlichen Anteil an der Wertschätzung gehabt haben. Gerade auf Pheidias und seine Zeit hat man sich in besonderem Maße bezogen. Schon im Hellenismus orientierte man sich an seinen Götterstatuen32, und Hadrian ließ im fertig gestellten Olympieion in Athen die Kopie der Zeus-Statue von Olympia aufstellen. Die Ausführlichkeit, mit der sich Pausanias der Darstellung Olympias wie des Zeus-Tempels und insbesondere seiner Bauskulptur widmet – jede der über den Fronten von Pronaos und Opisthodom ange-ordneten Heraklesmetopen wird der Reihe nach besprochen, die Figuren des Ostgiebels werden einzeln behandelt, die Gestaltung und Ausstattung der Cella beschrieben –, all dies weist auf die Bedeutung, die dem Bau beigemessen wur-de, und welch Identität stiftende Wirkung er gehabt haben dürfte. Olympia diente sogar über das Ende des Kults hinaus, wie auch andere Orte von Festspielen, der lokalen und regi-onalen Bevölkerung weiter als Festort und Kommunikations-
Abb. 4 Olympia, Zeus-Tempel. Begonnene Umarbeitung eines Architrav-blockes in Säulentrommeln
Arnd Hennemeyer24
33 A. Gutsfeld – J. Hahn – S. Lehmann, Christlicher Staat und panhel-lenische Heiligtümer. Zum Wandel überregionaler paganer Kultstät-ten im spätantiken Griechenland, in: Rüpke a. O. (Anm. 32) 228 – 237.
34 P. Amandry, La Ruine du temple d’Apollon à Delphes, in: Acadé-mie Royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique (Hrsg.), Bulletin de la classe des lettres et des sciences morales et politiques (Serie 5) 75 (Brüssel 1989) 26 – 47.
35 A. Ohnesorg, Artemis-Tempel, Ephesos, Türkei, in: W. Nerdinger (Hrsg.), Geschichte der Rekonstruktion – Rekonstruktion der Ge-schichte (München 2010) 189 f.
36 Buchert a. O. (Anm. 31) 99 – 117.37 Hennemeyer a. O. (Anm. 8) 108 – 111.38 F. Forbat, Der Fußboden im Innern des Zeus-Tempels, in: Dörpfeld
a. O. (Anm. 24) 226 – 247.39 Erstmals Krauss a. O. (Anm. 19) und Krauss a. O. (Anm. 25).
zentrum33. So verwundert es nicht, dass man gerade in der Spätantike noch einmal Wiederherstellungsmaßnahmen am Zeus-Tempel von Olympia oder am Apollon-Tempel von Del-phi34 ausführte und sich so auf jene Zeit berief, als man ein herausragendes Zentrum im Netz der Antiken Welt war.
Die Überlegung, man könne bei den verschiedenen Wie-derherstellungen am Zeus-Tempel auch die Bauformen dem Bestand in der Absicht nachgeahmt haben, sich auf den ursprünglichen Bau zu berufen und an die eigene Vergan-genheit zu erinnern, wäre daher verlockend. Doch ist eher anzunehmen, dass man schlicht die ästhetische Einheit des Baus wie auch seiner Bauskulptur wahren wollte. Schließlich besteht das Konzept des Peripteraltempels gerade in seiner Allansichtigkeit, was durch den Wiederaufbau eines Teilbe-reichs in anderen Formen empfindlich gestört worden wäre. In diesem Zusammenhang muss man sich bewusst machen, dass der Entwurf des Tempels die Einheit des Baus durch subtilste Mittel unterstreicht, beispielsweise durch die Kurva-
tur aller horizontalen Linien oder die Entasis der Säulen. Diese Bautradition wurde bis weit in die römische Kaiserzeit fortge-führt. So wird verständlich, dass bei Wiederherstellungen von Teilen des Baus als wichtiger erachtet werden musste, dieses Entwurfskonzept durch formgetreues Kopieren zu wahren, als der allgemeinen Formentwicklung zu entsprechen. Bau-te man Tempel indes nach einer völligen Zerstörung neu auf, folgte man, soweit sich überblicken lässt, durchaus der gleichzeitigen allgemeinen Formentwicklung – wobei lokale Eigenheiten (gewissermaßen als Erkennungszeichen) durch-aus aufgegriffen werden konnten, wie z. B. die mit Figuren verzierten Säulentrommeln (columnae caelatae) am Artemi-sion von Ephesos35. Als man in Delphi den Apollon-Tempel nach 369 v. Chr. wieder errichtete, hielt man so zwar den Grundriss des spätarchaischen Vorgängerbaus weitgehend bei, im Aufriss stehen die Proportionen und alle Architektur-formen aber ganz in der damaligen allgemeinen Forment-wicklung36.
Wandel – Zu Änderungen am Zeus-Tempel
Eine deutliche Änderung gegenüber dem ursprünglichen Bau wurde am Zeus-Tempel, wie oben angesprochen, be-merkenswerterweise allein bei der frühesten Wiederherstel-lung vorgenommen, indem in der Cella die Jochweiten der Säulenreihen etwas verkürzt und Wandpfeiler eingefügt wur-den, wie sie anscheinend zu eben dieser Zeit im tektonischen Gerüst unerlässlich wurden37. Als man im Anschluss die Zeus-Statue aufstellte, wurde in einer zweiten Maßnahme der Bo-den in der Cella grundlegend umgebaut38. Dabei wurde der Bereich vor der Statue als flaches Becken vertieft und mit schwarzen sog. eleusinischen Platten gepflastert sowie mit einem weißen Marmorrand umgeben. Seit die goldelfenbei-
nerne Zeus-Statue des Pheidias errichtet war, später zu den sieben Weltwundern gezählt, scheint auch das Aussehen des Baus als unveränderlich angesehen worden zu sein, in gewis-ser Weise als ›sakrosankt‹. Bauformen des Tempels wurden von da an nur noch im Detail geändert und dabei so unauf-fällig, dass sie nach der Grabung 70 Jahre lang nicht bemerkt worden waren39. Freilich erfuhr der Tempel andererseits Änderungen schon durch die fortlaufende Aufstellung von Weihgeschenken und Kaiserstatuen sowie durch Einbauten. Von diesen sollen zwei, an denen sich Aspekte des Wandels am Zeus-Tempel fassen lassen, wie eingangs angekündigt, mit ihren Befunden im Folgenden vorgestellt werden.
Vorhang?
Vor der Schwelle verläuft über die gesamte Länge von etwa 5 m ein schmaler Streifen einer betonharten Masse, die als ›Guss-Stein‹ bezeichnet sei. Auf den ersten Blick scheint der Befund klar: Es wurde eine Stufe vorgelegt, da die Schwel-le in die Cella unbequem hoch war. Doch eröffnet sich bei genauer Betrachtung des Befundes eine andere Deutung. Der ›Guss-Stein‹ ist an beiden Enden in schwalbenschwanz-förmige Ausnehmungen auf dem Überstand der Toicho-batschicht eingegossen (Abb. 5 b). Offensichtlich sollte er kraftschlüssig angeschlossen werden und auch Zugkräfte aufnehmen können. Auf beiden Schmalseiten des ›Guss-Steines‹ ist mittig in der genannten Ausnehmung und vor-ne noch etwas um die Ecke eine Bettung um etwa 10 cm vertieft. Längs zeigen Dübellöcher nahe der Vorderkante, dass hierauf weitere Bauteile angeordnet werden müssen.
Bei der Breite der Bettung von 17 cm vorne und 23 cm auf den Schmalseiten kommt dabei sowohl Holz als auch Werk-stein in Frage. Demnach kann es sich bei dem Aufbau nicht um eine massive Stufe, sondern es muss sich vielmehr um eine kastenförmige Einfassung handeln, die der eigentlichen Türschwelle vorgelegt war. Für den Kasten ergäbe sich im Innern ein Querschnitt von mindestens 35 cm Breite und, wenn er mit der Schwelle oben bündig war, etwa 50 cm Höhe (Abb. 5 a). Wie ist diese Maßnahme zu datieren? Direk-te Vergleiche sind m. E. nicht bekannt. Die scheinbare Ähn-lichkeit des Materials mit opus caementicium könnte dazu verleiten, hierin eine römische Umbaumaßnahme zu vermu-ten. Doch würde das wohl in die Irre führen, denn der ›Guss-Stein‹ ist viel feinkörniger als opus caementicium, für das zu-dem eine Außenschale erforderlich wäre.
Kontinuität und Wandel – Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia 25
40 Pausanias 5, 12, 4. Weiter gehende Fragen der Datierung und Zu-weisung sollen der monographischen Publikation des Tempels vor-behalten bleiben.
Wozu mag der Kasten gedient haben? In mehreren römi-schen Theaterbauten wurden Vorrichtungen zum Versenken von Vorhängen gefunden, deren Kästen allerdings ungleich tiefer reichten. In diesem Zusammenhang ist an den Pur-purvorhang zu denken, den nach Pausanias Antiochos in den Zeus-Tempel weihte40. Dieser Vorhang sei nicht hoch-gezogen worden wie am Artemis-Tempel von Ephesos, son-dern an Seilen nach unten in oder auf den Boden abgelas-sen. Der Text besagt nicht, wo im Tempel sich der Vorhang befand. Allein die Anordnung der Textstelle könnte einen Hinweis geben. Sie folgt unmittelbar der Beschreibung der Zeus-Statue, was auf eine räumliche Nähe schließen lassen könnte. Dementsprechend wurde bisher in der Regel ange-nommen, der Vorhang habe hinter der Statue gehangen. Doch steht die Textstelle andererseits der Aufzählung von Weihgeschenken in der Cella und im Pronaos voran, zu der sie vielleicht schon zu zählen ist. Vor der Statue befand sich das leicht vertiefte Becken mit Platten aus schwarzem, so ge-nanntem eleusinischem Kalkstein. Das Plattenpflaster selbst ist nicht erhalten, doch die Lage darunter, ohne dass irgend-
welche Spuren einer Vorrichtung zum Ablassen des Vor-hangs zu finden wären. Ebenso wenig finden sich im Bereich hinter der Zeus-Statue, wo der Vorhang meist rekonstruiert wurde, irgendwelche Spuren auf eine solche Vorrichtung. Wenn der Vorhang nicht nur einfach auf den Boden abgelas-sen wurde, hätte also ein Kasten zum Einrollen des Vorhangs in die Basis der Zeus-Statue selbst eingebaut sein müssen. Trifft die Identifizierung vor der Cellatüre indes zu, verhäng-te der Purpurvorhang im ausgebreiteten Zustand diese und verschloss sie, da der Vorhang unten ja nicht frei hing! Wur-de der Vorhang nur gezeigt, wenn die Cellatür geschlossen war? Diente der Vorhang einer effektvollen Inszenierung, um beim Herablassen die Zeus-Statue von oben nach unten all-mählich erscheinen und unter dem zusehends stärker durch die Türöffnung einfallenden Licht aufscheinen zu lassen, ge-wissermaßen als Epiphaniezauber? Man könnte in der Maß-nahme dann eine zeitgemäße Modernisierung des Kults im Hellenismus sehen, was sich vielleicht sogar mit der Herkunft des Weihgeschenks aus dem Seleukidenreich in Verbindung bringen ließe.
Abb. 5 Olympia, Zeus-Tempel. ›Guss-Stein‹ vor dem Fundament der Türwand (M. 1 : 20). a. Schnitt, maßstäbliche Skizze. – b. Aufsicht des nördlichen Endes
0 50 100 cm
Arnd Hennemeyer26
41 Pausanias 5, 10, 10. 42 Dörpfeld a. O. (Anm. 13) 16.
Einbau der Treppen
Die letzte Beobachtung betrifft die Treppen. Pausanias Text verpflichtet41, der gewundene Aufgänge ins Dach nennt, re-konstruierte die ›Alte Grabung‹ am östlichen Ende der beiden Seitenschiffe Wendeltreppen aus Holzkonstruktionen, wofür in beiden Seitenschiffen liegende Steine mit Bettungen als Beleg herangezogen wurden42. Doch genauer betrachtet handelt es sich bei den Bettungen nicht um auf allen vier Sei-ten umrandete Einlassungen, wie sie bei senkrechten Pfosten als Tragkonstruktion für die angenommenen Wendeltreppen zu erwarten wären, sondern um auf einer Seite nicht be-grenzte Ausnehmungen. Auch dienen die Blöcke nicht nur als Auflager – die östlich angefügten Steine gleicher Höhe und Länge wären dabei überflüssig –, sondern haben auch passende Abmessungen für eine Antrittsstufe. Das zeigt, dass nicht Wendeltreppen, sondern einläufige Treppen re-konstruiert werden müssen, die von Osten betreten wurden und auf die Galerien führten (Abb. 6). Die Bettungen dien-ten den Treppenwangen, was den länglichen Querschnitt erklärt, während man für Pfosten quadratische Querschnitte erwarten müsste. Wo haben sich dann aber die von Pausa-nias erwähnten Wendeltreppen befunden? Sie müssen, wie es übrigens dem genauen Wortlaut des Texts sogar besser entspricht, erst von den Galerien weiter nach oben geführt haben. Mehrere Merkmale zeichnen die Treppenauflager-steine deutlich als nachträglichen Einbau aus: Sie bestehen aus einem gelblichen Sandstein, der sonst am Zeus-Tempel nicht vorkommt und in Olympia vor allem in der Kaiserzeit ab dem 2. Jh. n. Chr. verwendet wurde. Zudem handelt es sich um Spolien, wie Klammer- und Dübellöcher einer Erst-verwendung belegen. Da sich in den Seitenschiffen keinerlei Hinweise auf frühere Treppen zu den Emporen finden, muss man annehmen, dass auch die Galerien selbst erst zusam-men mit den Treppen eingebaut wurden. Dies begrenzt den Datierungsspielraum nach hinten, da ja bereits Pausanias die Galerien nennt.
Wie ist der Einbau der Treppen und damit, wie wir gese-hen haben, wohl auch der Galerien zu deuten? Die Cella wur-de im 2. Jh. n. Chr. für Besucher hergerichtet. Während zuvor das mit schwarzen Kalksteinplatten gepflasterte Becken eine Distanz zur Zeus-Statue sicherstellte, kommt man nun nicht nur nah an die Zeus-Statue heran, sondern kann sich ihr so-gar in der Höhe nähern. Als Vergleich für diese Thematisie-rung effektvoller Zugänglichkeit sei beispielsweise an den Clou der im Innern der Traianssäule hinaufführenden Treppe erinnert. Es befremdet, dass man nun wahrscheinlich sogar einen Blick auf die Rückseite der Zeus-Statue werfen konnte.
Die Maßnahme steht auf diese Weise dafür, dass an die Seite der kultischen Bedeutung zusehends eine museale Bedeu-tung der Statue, des Tempels wie des gesamten Heiligtums getreten war.
Abbildungsnachweis
Abb. 1: a. Krauss a. O. (Anm. 19) 365 – 387 Abb. II b. – b. Verf. – c. Aus-schnitt aus Ch. Dugas – J. Berchmans – M. Clemmensen, Le Sanctu-aire d’Aléa Athéna à Tégée au IVe siècle (Paris 1924) Taf. 21 (Zeich-nung M. Clemmensen). – Abb. 2 – 6: Verf.
Anschrift des Autors
Dr. Arnd HennemeyerInstitut für Denkmalpflege und BauforschungWolfgang-Pauli-Strasse 27HIT H 438093 Zürich Hö[email protected]
Abb. 6 Olympia, Zeus-Tempel. Treppenanfänger im südlichen Seiten-schiff der Cella mit Rekonstruktionsvorschlag, Skizze
Inhaltsverzeichnis
Hans-Joachim GehrkeEinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Wolf-Dietrich NiemeierForschungsfeld 1: Kontinuität und Wandel an Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Volkmar von GraeveDas Aphrodite-Heiligtum von Milet und seine Weihegaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Arnd Hennemeyer Kontinuität und Wandel. Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Helmut KyrieleisMythos und Politik. Zur Deutung des plastischen Bildschmucks des Zeus-Tempels von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Wolf-Dietrich Niemeier Kultkontinuität von der Bronzezeit bis zur römischen Kaiserzeit im Orakel-Heiligtum des Apollon von Abai (Kalapodi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Nils HellnerKalapodi. Neue Kriterien einer Typologie der dorischen Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Anja SlawischDidyma. Untersuchungen zur sakralen Topographie und baulichen Entwicklung des Kernheiligtums vom 8.–4. Jh. v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Stefan LehmannForschungsfeld 2: Ende und Nachleben von Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Christoph B. Konrad – Dorothée SackDie Wiederverwendung von Baugliedern in der Pilgerkirche (Basilika A) und in der Großen Moschee von Resafa-Sergiupolis/Rus.āfat Hišām . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Andreas Effland»Bis auf den heutigen Tag begab sich kein Mensch mehr auf den Hügel von Abydos um zu opfern« – Zum Ende der Kulthandlungen in Umm el-Qaʿāb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Dietrich RaueHeliopolis – eine Hierapolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Stephan Lehmann – Andreas GutsfeldSpolien und Spoliarisation im spätantiken Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Nils Hellner – Nicole Alexanian – Claudia Bührig – Ute Rummel – Detlev Wannagat – Mike SchnelleForschungsfeld 3: Gestalteter Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Christina LeypoldDie Statuenbasen im Zeus-Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Stefan M. MaulDas Haus des Götterkönigs. Überlegungen zur Konzeption überregionaler Heiligtümer im Alten Orient . . . . . . . . . . . . . 125
Ute RummelDer Himmel auf Erden. Heiligtümer im Alten Ägypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Claudia BührigDas Theater-Tempel-Areal von Gadara. Konzeption und Wandel des gestalteten Raumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
VI Inhaltsverzeichnis
Nicole AlexanianDie Gestaltung der Pyramidenanlagen des Snofru in Dahšur/Ägypten. Einführende Bemerkungen zum Grabungsplatz von Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Rüdiger GogräfeIsriye (It-rīah)-Seriana. Bemerkungen zur Raumfunktion eines severischen Tempels in Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Sophie HelasPunische Heiligtümer in Selinunt. Architektonische Gestaltung und religiöse Rituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Margarete van EssGestaltung religiöser Architektur in Babylonien. Das Beispiel des Eanna-Heiligtums in Uruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Iris Gerlach – Mike SchnelleSabäische Sakralarchitektur in Südarabien (Jemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Ute RummelDer Tempel im Grab. Die Doppelgrabanlage der Hohenpriester Ramsesnacht und Amenophis (K93.11/K93.12) in Drāʿ Abū el-Nagā/Theben-West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Klaus SchmidtDie Gestaltung des sakralen Raums im Frühneolithikum Obermesopotamiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Iris Gerlach – Gunvor Lindström - Dietrich RaueForschungsfeld 4: Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Ulrich DemmerText, Drama und performativer Diskurs. Ethnologische Ritualtheorien der Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Thomas Schattner – Gabriel ZuchtriegelMiniaturisierte Weihgaben: Probleme der Interpretation. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Jan Breder, Julia Budka, Frauke Donner, Ute Effland, Piet Kopp, Gunvor Lindström, Oliver Pilz, Dietrich Raue und Michael Wörrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Gunvor Lindström – Oliver PilzVotivspektren. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Ute Effland, Andreas Effland, Heide Frielinghaus, Iris Gerlach, Piet Kopp, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
Martin Bentz – Helga BumkeMahlzeiten in rituellen Kontexten. Basierend auf den Projektdarstellungen von Martin Bentz, Helga Bumke, Ute Effland, Iris Gerlach, Achim Heiden, Ivonne Kaiser, Norbert Nebes, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . 275
Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen Heiligtum von Milet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen (SH III A) bis früheisenzeitlichen (SG) Heiligtum von Kalapodi . . . . . . . . . . . 295
Gunvor LindströmBaktrien – Votive und Votivpraxis in den hellenistischen und kuschanzeitlichen Heiligtümern (3. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Piet KoppVotive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie . . . . . . . . . . . . . . . . 307
Ute EfflandDas Grab des Gottes Osiris in Umm el-Qa āʿb/Abydos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Nicole AlexanianSpektrum und Veränderung der Funde aus den Tempeln des Snofru in Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Inhaltsverzeichnis VII
Helga BumkeDer archaische Heiligtumsbefund vom ›Taxiarchishügel‹ in Didyma und sein Zeugniswert für die Rekonstruktion ›ritueller Mahlzeiten‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Oliver Pilz – Michael KrummeDas Heiligtum von Kako Plaï auf dem Anavlochos (Kreta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Martin BentzAttisch rotfigurige Keramik aus Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Susanne BocherAspekte früher Ritualpraxis anhand des geometrischen Votivspektrums im Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Heide FrielinghausBeobachtungen zum Votivspektrum Olympias in archaischer und nacharchaischer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
Joachim HeidenDas Artemis-Heiligtum in Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Svend HansenBronzezeitliche Deponierungen in Europa nördlich der Alpen. Weihgaben ohne Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Gabriel ZuchtriegelEisenzeitliche und archaische Funde aus dem ›Santuario Orientale‹ von Gabii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Thomas SchattnerDie Romanisierung einheimischer Heiligtümer im Westen der Iberischen Halbinsel unter besonderer Berücksichtigung von Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393