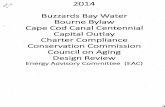Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke. Beobachtungen zum Cod. Hieros. slav....
Transcript of Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke. Beobachtungen zum Cod. Hieros. slav....
JERUSALEM UND DIE SLAVISCHE LITURGISCHE EUCHOLOGIE FÜR KRANKE
Beobachtungen zum Cod. Hieros. slav. 12 (14. Jh.)
Tinatin Chronz (Bonn)
Neben den griechischen Originalen sowie den georgischen, syrischen und arabischen Übersetzungen gehören auch slavische liturgische Handschriften zu den wichtigen Zeugen der spätbyzantinischen Liturgie Jerusalems und Pa-lästinas. Elena Velkovska hat vor wenigen Jahren als erste auf eine zuvor kaum beachtete slavische Handschrift hingewiesen, die in diesem Zusam-menhang besondere Aufmerksamkeit beanspruchen darf, zumal sie in Jerusa-lem selbst aufbewahrt wird.1
Es handelt sich dabei um den Codex Hierosol. slav. 12. Die älteste Be-schreibung dieser Papierhandschrift verdanken wir N. Krasnosel’cev (1888), der sie in das 16.-17. Jh. datierte und als Euchologion, требник (Rituale / Agende) bezeichnete.2 Aufgrund der vorhandenen Wasserzeichen setzt Kli-mentina Ivanova (Sofia) aber die Entstehungszeit nunmehr in die ersten Jahr-zehnte des 14. Jh.3 Elena Velkovska bezeichnet das Buch wegen der darin aufgezeichneten monastischen Riten als „Schematologion“, d. h. Buch für die Einkleidung von Mönchen, und stellt fest, dass manche der acht verschie-denen Hände, die an dieser Handschrift mitgewirkt haben, jenen ähneln, die auch im Tetraevangelion Moskau GIM Uvarov 55 (480)4, „della Laura di S. Saba a Gerusalemme“, auftreten.5
Dass unser slavisches Teileuchologion Hieros. slav. 12 heute in Jerusalem liegt, bedeutet natürlich nicht unbedingt, dass es vor Ort oder in der Nach-barschaft entstanden sein muss. Ein sprechendes Beispiel für die Unsicher-heit von Lokalisierungen auf der Basis von Verwahrungs- oder Erwerbungs-
1 Velkovska, Elena: „Il rito della Teofania in uno schematologion slavo del XIV secolo“. In: Nuovi paralleli greci dell’Eucologio slavo del Sinai. (= Università di Roma „La Sapienza“. Seminario del Dipartimento di studi Slavi e dell’Europa Centro-orientale, Filologia slava - 1). Rom 1996, pp. 31-45. 2 Krasnosel’cev, Nikolaj: „Славянские рукописи Патриаршей библиотеки в Иеру-салиме“. In: Православный собеседник. Bd. 12. Kazan’ 1888, pp. 1–32, hier: 15. 3 Nach Velkovska E., op. cit., p. 31, Anm. 4. Klimentina Ivanova bereitet derzeit einen neuen Katalog der slavischen Handschriften der Jerusalemer Patriarchalbiblio-thek vor. 4 Beschreibung in: Archimandrit Leonid (Hg.): Систематическое описание славя-но-российских рукописей собрания Графа А. С. Уварова. Bd. 1. Moskau 1893, pp. 25-27. 5 Velkovska E., op. cit., p. 32.
Tinatin Chronz
122
orten ist gerade der soeben erwähnte Codex der Uvarov-Sammlung in Moskau: Geschrieben in einer bulgarischen Ustav-Schrift des 13.-14. Jh., enthält das Tetraevangelion einen Zusatz mit Apostolos-Lesungen und Ma-karismen für alle Wochentage, geschrieben im Jahr 1399 von einem Ana-gnosten (Lektor) Georgios, wie er selbst in Griechisch auf Folio 234v ver-merkte.6 Zwei weitere Vermerke schmücken den Codex: ein griechischer auf der Verso-Seite des letzten Folios „im Jahre 1401“ und eine russische Notiz ganz vorne: „Erworben in Palästina in der Laura des hl. Sabas am 16. April 1835“. Aufgeklebt ist eine Karte mit dem Wappen des russischen Staatsman-nes und Gelehrten A. S. Norov (1795-1869), der bekanntlich 1834-1836 eine Bildungsreise ins Heilige Land unternommen hat.7 Damit ist die vormalige Aufbewahrung des Codex in der Sabas-Laura für das 19. Jh. erwiesen. Ande-rerseits erwägt der Archimandrit Leonid in seinem Katalog der Uvarov-Sammlung, der genannte Anagnostes Georgios könne ein des Griechischen mächtiger Slave der Sabas-Laura gewesen sein, wie man aus den Überschrif-ten der Apostolos-Lesungen ersehe, denn sie seien in griechischer Art („гре-ческого пошиба“) geschrieben. Die im Codex notierte Jahresangabe 1401 lasse erkennen, dass dieses Tetraevangelion im Gefolge der Eroberung des Bulgarischen Reiches durch die Türken in die Sabas-Laura gebracht und wahrscheinlich erst dort um die Tages-Apostoloi ergänzt worden sei.8
Die Handschrift Hierosol. slav. 12 enthält heute 127 Folia. Der Schluss fehlt, in der Mitte ist eine Lücke. Neben einem ersten hagiographischen Teil (Wunder des Erzengels Michael zu Chonai) enthält der Codex eine Reihe liturgischer Ordnungen:
1. ein Schematologion mit den Feiern zur Einkleidung mit dem Kleinen und dem Großen Schema (Mönchshabit),
2. Begräbnisfeier für einen verstorbenen Mönch, 3. acht – nicht nur sieben9 – Orationen aus der Feier von Ölweihe und
Krankensalbung10,
6 Archimandrit Leonid, op. cit., pp. 25-27. 7 Norov, Abraham S.: Путешествие по Святой Земле в 1835 году. Moskau 2008; Путешествие по Египту и Нубии в 1834-1835 гг. Sankt Petersburg 1840. 8 Archimandrit Leonid, op. cit., p. 27. 9 Krasnosel’cev (p. 15) verzeichnet insgesamt nur sieben Gebete. 10 Das christliche Krankenöl (auch Krankensalbung, Gebetsöl, Euchelaion, gr. eujcevlaion, sl. таинство елеосвящения) ist ein Sakrament, dessen Feier traditionell aus der Weihe von (Pflanzen-) Öl durch priesterliches Gebet und seiner nachfolgen-den Anwendung besteht, häufig in der Form einer Salbung des Kranken, teilweise auch anderer Personen und Sachen. Von der östlichen Tradition unterscheidet sich die westliche Praxis dadurch, dass im Westen die Priester gewöhnlich für die Salbung vom Bischof vorgeheiligtes Öl verwenden, es also nicht bei der Krankensalbung durch ein spezielles Ölgebet heiligen. Die gottesdienstliche Ordnung der Feier in den orthodoxen Kirchen findet man heute im Kleinen Euchologion (entspricht dem abend-
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 123
4. Anabathmoi (Stufengesänge) in den acht Tönen, 5. Ordnung der Großen Wasserweihe an Epiphanie. Mehrere dieser liturgischen Inhalte sind bereits von E. Velkovska unter-
sucht worden. In ihrem beachtlichen Beitrag für das Slavische Seminar der Römischen Universität „La Sapienza“ hat sie festgestellt (p. 45), dass (a) die im Hieros. slav. 12 versammelten Gottesdienstordnungen keine homogene Tradition verkörpern, (b) sich eine liturgiegeschichtlich keineswegs unge-wöhnliche Kontamination von Konstantinopler und vorderorientalischen Ele-menten feststellen läßt, wobei (c) der Ritus der Wasserweihe an Theophanie Besonderheiten aufweist, die zwischen Süditalien und Palästina verbreitet waren, und dabei (d) einige Einzelheiten auf Abkunft aus derselben Tradition hinweisen, die ihren Niederschlag auch im slavischen Euchologium Sinaiti-cum (Sinait. slav. 37 + slav. 1/N) gefunden hat. Zur Zeit der Anfertigung des Hieros. slav. 12 ist die Jerusalemer Liturgie jedenfalls bereits weitgehend by-zantinisiert und übt zugleich erneut ihren Einfluss auf die Liturgie der 1261 von den Lateinern zurückeroberten Kaiserstadt aus. Dieses Phänomen be-zeichnet Robert Taft treffend als „neu-sabaitische Synthese” und unterschei-det diese von der älteren studitischen, die ihrerseits eine Verbindung von palästinischen Elementen mit konstantinopolitanischen Gewohnheiten dar-stellt.11
Die Orationen des Hierosolymitanus für Ölweihe und Krankensalbung haben bislang keine besondere Aufmerksamkeit erfahren. Daher sollen sie in dieser Miszelle erstmals vorgestellt und zumindest vorläufig liturgiege-schichtlich eingeordnet werden.
In einem ersten Schritt werden die slavischen Gebete mit ihren Initia aufgeführt und zugleich die ermittelten griechischen Modellformulare, derer sich der oder die slavische(n) Übersetzer bedienten, benannt12:
1. bejna!ålne nepr™m™nne : st+¥i st+¥xß : i"e edinorodnago si sn+a poslavß : ic™l™øwa vså strtS^i d‚+ß i t™lesß na‚ixß ... (f. 104r)
[Anarce, ajdiavdoce, a{gie aJgivwn, oJ to;n monogenh sou UiJo;n ejxaposteivla" ijwvmenon pasan novson kai; pasan malakivan twn yucwn kai; twn swmavtwn hJmwn... (TR 143-145)
2. blago¨v™tlive g+i : edine ml+ostive i !l+vkolüb!e : kaø så ø jlobaxß na‚ixß: v™d¥i æko prile"itß m¥sl´ !l+v™ku na jlaa † ünosti ego ne
ländischen Rituale bzw. der Agende), einem liturgischen Buch, das u. a. die Feier der nichteucharistischen Sakramente regelt. 11 Taft, Robert: The Byzantine Rite. A Short History. Collegeville, Minnesota 1992, p. 79. Aktualisierte russische Ausgabe: Византийский церковный обряд. Краткий очерк. Sankt Petersburg 22005. 12 Für die Möglichkeit, Photos der Folia 104r bis 113r einzusehen, danke ich verbind-lich Frau Elena Velkovska. Die griechischen Texte werden zitiert nach Trempelas, Panagiotes N.: Mikro;n Eujcologion. Bd. 1. Athen 1950. Nachdruck 1998. (weiter: TR)
Tinatin Chronz
124
xtåi sßmrßti gr™‚niku æko "e øbratiti så i "ivu b¥ti emu ... (f. 104r-105v)
Eujdiavllakte Kuvrie, oJ movno" ejlehvmwn kai; filavnqrwpo", oJ metanown ejpi; tai`" kakivai" hJmwn, oJ eijdwv", o{ti e[gkeitai hJ diavnoia tou ajnqrwvpou ejpi; ta; ponhra; ejk neovthto" aujtou, oJ mh; qevlwn to;n qavnaton tou aJmartwlou, wJ" to; ejpistrevyei kai; zh/n aujtovn ... (TR 149-151)
3. vlkDo g+i vsedrß"itelü : st+¥i cr+ü slav™ : nakajuø i ne ¨mrßwv™å : potvrß"daøi nijßpadaøwøå: i vßjßstavl™øi nijßvrß"en¥xß : i"e t™lesn¥ø skrßbi ispravl™ø !lv+komß ... (f. 105v-106r)
Devspota Kuvrie oJ Qeov", oJ Pantokravtwr, a{gie Basileu, oJ paideuvwn kai; mh; qanatwn, oJ uJposthrivzwn tou;" katapivptonta" kai; ajnorqwn tou;" katerragmevnou": oJ ta;" swmatika;" qlivyei" diorqouvmeno" twn ajnqrwvpwn ... (TR 153-154)
4. blag¥ !l+v™kolüb!e : bl+gosrßde i mnogomltS^ive g+i : i"e vßs™kß nedøgß i vs™kø bol™jn¿ ic™l™ø : ic™li raba tvoego sego : i vßjvDigni ego † odra bol™jni (106r-106v) !Agaqe; kai; filavnqrwpe, eu[splagcne kai; poluevlee Kuvrie, oJ pasan
novson kai; pasan malakivan ijwvmeno", i[asai kai; to;n doulon sou tovnde, ejxevgeiron aujto;n ajpo; klivnh" oJduvnh" aujtou ... (TR 155-156)
5. gi+ b"+e na‚ß : nakajaø i paky ic™l™ø: vßjvDi"øi † jemlå uboga : i † gnoiwa vßjnosåi niwa : i"e sir¥mß øc+ß i vdov¥mß sødii : vlßnuøwîm så pristaniwe ... (f. 106v- 108v)
Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ paideuvwn kai; pavlin ijwmeno": oJ ejgeivrwn ajpo; gh" ptwco;n kai; ajpo; kopriva" ajnuywn pevnhta: oJ twn ojrfanwn path;r kai; twn ceimazomevnwn limh;n ... (TR 158-160)
6. bl+godarim tå gDi b+e naÍ : bl+g¥ vra!ü d‚+am´ i t™lom´ na‚im´ i"e bol™jni na‚ø nebol™jno nosåi : ego"e æjvoå v´si ijc™l™xom´ : past¥rü dobr´ i i"e na v´j¥skanie øv!åte pri‚ed´ ... (f. 108v-110v)
Eujcaristoumevn soi, Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ ajgaqo;" kai; filavnqrwpo" kai; ijatro;" twn yucwn kai; swmavtwn hJmwn: oJ ta;" novsou" hJmwn ajpovnw" bastavzwn: ou| tw/` mwvlwpi pavnte" ijavqhmen: oJ poimh;n oJ kalov", oJ eij" ajnazhvthsin ejlqw;n tou planhqevnto" probavtou ... (TR 162-164)
7. vlDko gDi b"+e naÍ^ : vra!ü d‚+am i t™lom´ na‚im´ : i"e l™tn¥å strasti uvra!üåi : isc™l™å vs™k´ nedøg´ i v´s™kø bol™jn´ v´ lüdex´ ... (f. 110v-112r)
Devspota, Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, ijatre; yucwn kai; swmavtwn, oJ ta; crovnia pavqh qerapeuvwn, oJ ijwvmeno" pasan novson kai; pasan malakivan ejn tw/ law/` ... (TR 166-168)
8. bl+goåtrobn¥ mnogomltS^ive giD : ne xotå smrS^ti gr™‚nago æko v´jvratiT I så i "ivu b¥ti emu : ne v´jlagaå moå røkø gr™‚nøå na glavø pri‚ed‚omu ti v´ gr™s™x´ i prOsåwu † tebe nami ståvlenie : nø tvoå røkø dr´"avnøå i silnøø e"e v´ st+™m´ eûG^li sem´ ... (f. 112r-113r)
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 125
Eu[splagcne, poluevlee Kuvrie, oJ Qeo;" hJmwn, oJ mh; qe;lwn to;n qavnaton tou aJmartwlou wJ" to; ejpistrevyai kai; zh/n aujtovn: ouj tivqhmi ejmh;n cei`ra aJmartwlo;n ejpi; th;n kefalh;n tou proselqovnto" soi ejn aJmartivai" kai; aijtoumevnou para; sou di j hJmwn a[fesin aJmartiwn ... (TR 169-171)
Bei Betrachtung des Inhalts dieser Orationen ergibt sich: Das erste Gebet, das ein Priester über dem Haupt des Kranken zu rezitie-
ren hat (molitvø gleT popß naD glavoø), ist ein Weihegebet für Krankenöl. Denn mit ihm wird Gott um die Herabsendung des Heiligen Geistes zur Hei-ligung des Öles gebeten, auf dass es demjenigen, der damit gesalbt wird, zur Erlösung von Sünden, zur Heiligung des Körpers und des Geistes und zur Erbschaft der himmlischen Herrschaft gereiche.
Die weiteren sechs Gebete (Nr. 2-7) sind Krankengebete, in denen um die Heilung des Leibes und der Seele sowie um die Reinigung und Befreiung von den absichtlichen und unabsichtlichen Vergehen des Sünders und Knech-tes Gottes gebetet wird.
Das letzte Gebet (Nr. 8) schließlich ist ein Vergebungsgebet für den Kranken und wurde in der Regel unter Auflegung des Evangeliars auf das Haupt des Kranken gesprochen. Darin wird ausdrücklich um die Auflegung der „mächtigen und starken Hand“ Gottes (vgl. Apg. 4, 30) gebeten, „die in diesem heiligen Evangelium“ (ist), „das die Konzelebranten und das Presby-terium auf diesem Haupt halten“. Durchtränkt sind die Gebete mit Anspie-lungen auf Passagen des AT und NT, auf die Ereignisse der Heilsgeschichte und nicht zuletzt auf den die Krankensalbung legitimierenden Jakobos-Brief (5, 14f.).
Die Zahl der Orationen deutet darauf hin, dass das vorliegende Gebetsgut offenbar bereits für eine Feier der Ölweihe und Krankensalbung mit sieben konzelebrierenden Priestern bestimmt war.13 Während die liturgischen Quel-len des ersten Jahrtausends nur eine einfache Form der Weihe des Öles und /
13 Die einzige umfassende Monographie über die Geschichte der byzantinischen Feier der Ölweihe und Krankensalbung ist noch immer das Werk des russischen Liturgie-wissenschaftlers und Priestermönchs Benedikt (Alentov): К истории православного богослужения. Историко-литургическое и археологическое исследование о чине таинства елеосвящения. С четырьмя приложениями древнеславянских редак-ций чина елеосвящения. Sergiev-Posad 1917 (Nachdruck: Kiev 2004), im Westen nur bekannt geworden durch das Referat von Rouët de Journel, Marie Joseph: „Le rite de l’Extrême-Onction dans l’Église gréco-russe“. In: Revue de l’Orient Chrétien 3e sér. 1 (1918/1919), pp. 40-72. Auf Alentov stützen sich weiterhin Remorov, Ioann: „The Byzantine Office of the Sacrament of Unction“. Referat of the V International Theological Conference of the Russian Orthodox Church „Orthodox Teaching on the Sacraments of the Church“. Moscow, 13-16 November 2007; ders. / Tkachenko, Ale-xander A.: Art. „Елеосвящение“ in: Православная энциклопедия XVIII (2008), pp. 325-337; Pruteanu, Petru: „Slujba Sfântului Masli: istorie si actualitate“. In: www. teologie.net/biblioteca/studii/ierom_petru/PP_Maslu.pdf (17 Seiten).
Tinatin Chronz
126
oder des Wassers für Kranke, in der Regel durch ein einziges Gebet, bezeu-gen, verzeichnen die griechischen Handschriften um die Jahrtausendwende verschiedene Ausgestaltungen des Krankensakramentes, die charakterisiert sind durch die Mitwirkung einer Siebenzahl von Priestern. Zu den ältesten Zeugen dieser Übung zählen das Porfirij-Uspenskij-Euchologion Petropol. gr. 226 (10. Jh.)14 und das Strategios-Euchologion Paris. Coislin. gr. 213 v. J. 1027,15 eine hochfeierliche Gestalt der Ölweihe, an der sieben konzelebrie-rende Priester beteiligt sind.
Im Laufe der Zeit wachsen Zahl und Umfang der priesterlichen Gebete, der Fürbitten, der biblischen Lesungen sowie der Gesänge, umfangreicher wird das Zeremoniell. Zur Feier der Ölweihe tritt ein spezieller Gottesdienst für den Kranken hinzu, der der Heiligung des Krankenöls entweder unmittel-bar oder bereits am Vorabend vorausgeht. Die Ölweihe selbst findet inner-halb einer Eucharistiefeier statt, so z. B. nach dem georgischen Euchologion des Athoniten Giorgi, erhalten in der Sinai-Handschrift des 12.-13. Jh. Sinait. iber.O. 73.
Griechische und georgische Euchologia zeigen ab dem 13. Jh., die slavi-schen ab dem 14. Jh. das Schema und die Grundelemente für die Feier der Ölweihe und Krankensalbung, die sich nach zwischenzeitlich vielfältigen Ausgestaltungen und Entwicklungsstufen von der Göttlichen Liturgie und dem Stundengebet gelöst hatte und schließlich zu einem siebengliedrigen Gottesdienst gewachsen war, wie er bis heute in Gebrauch ist.16
Den Gottesdienst des Heiligen Öles mit sieben konzelebrierenden Pries-tern im Zustand des 13.-14. Jh. kann man grob in drei Teile gliedern:
I. ein Bittgottesdienst für den Kranken II. die Ölweihe, dabei sieben Apostolos- und Evangelion-Lesungen, Frie-
densektenie und sieben Gebete, von jedem der Priester einzeln vorzutragen, III. Vergebungsgebet für den Kranken, begleitet von der Auflegung des
Evangelions und der Rechten der Priester auf sein Haupt, und anschließende Salbung.
Anhand dieses Schemas kann man feststellen, dass die Orationen Nr. 1-7 des Euchologions Hierosol. slav. 12 aus dem zweiten Teil des siebenglied-rigen Formulars stammen und der Reihe nach jeweils von einem der
14 Jacob, André: „L’euchologe de Porphyre Uspenski Cod. Leningr. gr. 226 (Xe siècle)“. In: Le Muséon 78 (1965), pp. 173-214, zur Herkunft: p. 176. Besprechung des Ordos bei Benedikt (Alentov), op. cit., pp. 172-177. 15 Dmitrievskij, Aleksej A.: (Hg.), Описание литургическихъ рукописей, хранящих-ся въ библıотекахъ православного востока. Bd. 2 Eujcolovgia. Kiev 1901 (weiter: Dmitrievskij II), pp. 1017-1020; Maj, J. M.: Coislin 213. Eucologio della Grande Chiesa. Manoscritto greco della Biblioteca Nazionale di Parigi (ff. 101-211). Excerp-ta ex Dissertatione ad Doctoratum. Rom 1995, pp. 21-23. 16 Vgl. Phountoules, Ioannes: !Akolouqiva tou Eujcelaivou (Keimevna leitourgikh" 15), Thessalonike 1978, p. 10.
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 127
Konzelebranten im Anschluss an die ihm zufallenden Perikopen gebetet wur-den. Die Oration Nr. 8 hingegen wurde, wie ihr Inhalt deutlich zeigt, bei der Auflegung des Evangeliars als Vergebungsgebet für den Kranken gespro-chen.
Es bleibt nunmehr die Frage zu beantworten, in welchen liturgischen Traditionsstrang der in Jerusalem entdeckte slavische Zeuge einzuordnen ist. Denn die orthodoxe gottesdienstliche Landschaft ist zu seiner Zeit alles ande-re als einheitlich. Aus historischen Gründen weist sie nicht zuletzt regionale Unterschiede (nach altkirchlichen Patriarchaten) auf sowie soziologische Dif-ferenzierungen (Liturgie in Säkularkirchen, in Klöstern, für Kaiser und Hof sowie andere Personen von Stand). Diese Unterschiede bleiben zu bedenken, auch wenn zur Zeit der Entstehung des Hierosol. slav. 12 eine allgemeine Tendenz zur Angleichung an die Übungen der Hauptstadt zu beobachten ist und sich der monastische Einfluss bereits generell bemerkbar gemacht hat.
Für eine befriedigende Lösung der gestellten Aufgabe ist zweierlei von entscheidender Bedeutung: (1) der im untersuchten Zeugen vorhandene Bestand an Orationen, d. h. die von den für die Redaktion des von ihm reprä-sentierten Ordos verantwortlichen Liturgikern getroffene Auswahl aus einem zu ihrer Zeit größeren Repertoire an Gebetstexten, sowie (2) die Reihenfolge, in der insbesondere gleichartige und daher prinzipiell austauschbare Formu-lare bei Verschriftlichung der vor Ort gepflegten Consuetudines angeordnet und als Ordo tradiert wurden.
Um den Liturgievergleich im Sinne Anton Baumstarks durchführen zu können, werden im folgenden sowohl (a) griechische als auch (b) slavische Ordines der Ölweihe und Krankensalbung herangezogen, die eine Feier des Heiligen Öles mit einer siebengliedrigen Ordnung vertreten.
a) Vergleich mit den griechischen Handschriften
Die Betrachtung der griechischen liturgischen Quellen zeigt, dass in ihrem Verbreitungsgebiet zu etwa der gleichen Zeit verschiedene Modelle der Feier des Euchelaions im Gebrauch waren. Als Beispiele werden hier folgende Handschriften berücksichtigt:
1. das in Palästina benutzte „Auxentios-Euchologion“ Codex Sinait. gr. 973 + St. Petersburg, GPB gr. 418 v. J. 1152/1153,17 enthaltend liturgische Ordnungen verschiedener Traditionen, wobei es bei der Feier der Ölweihe und Krankensalbung wegen des verordneten Aufwandes um eine hochfeierli-
17 Beschreibung und Teiledition in: Dmitrievskij II, pp. 101-109; aktuelle Literatur zum Codex in: Specimina Sinaitica. Die datiertem griechischen Handschriften des Katharinen-Klosters auf dem Berge Sinai. 9. bis 12. Jh. Von Harlfinger, Dieter / Reinsch, Dieter R. / Sonderkamp, Joseph A. M.. In Zusammenarbeit mit Giancarlo Prato. Berlin 1983, pp. 48f.
Tinatin Chronz
128
che konstantinopolitanische Ausgestaltung handelt, die ursprünglich ver-mutlich in hochstehenden Kreisen, etwa von Kaiser und Adel, bevorzugt wurde18,
2. das „Archimedes-Euchologion“ v. J. 1229, eine Palimpsest-Hand-schrift, vormals in der Bibliothek des Konstantinopler Metochions des Jeru-salemer Patriarchats, 1998 von einem Ungenannten für mehr als 2 Mio. $ bei Christie’s in New York ersteigert und derzeit im Walters Art Museum in Baltimore (Ma) aufbewahrt. Während der kostbare untere palimspestierte Text u. a. Werke des Archimedes enthält, bietet der obere Text dieselben li-turgischen Ordnungen wie das „Auxentios-Euchologion“. Beide Handschrif-ten bezeugen somit, dass eine Konstantinopler Feier des Euchelaions im 12. und 13. Jh. in Palästina bekannt war19,
3. ein weiterer Zeuge aus dem 13. Jh.: Sinait. gr. 96020, dessen Feier der Ölweihe ein entwickeltes Modell der konstantinopolitanischen Ordnung dar-stellt, ebenfalls bezeugt im georgischen Euchologion des Athoniten Giorgi (†1065), dem Codex Sin. geo. O. 73 aus dem 12. Jh.21
4. das „Taktikon“ (Euchologion) des Johannes VI. Kantakuzenos (ca. 1295-1383), der sich nach seiner Abdankung als Kaiser 1354 als Mönch Joasaph Christodoulos in das Kloster des hl. Georgios twn Maggavnwn in Konstantinopel zurückzog: Codex Nr. 261 (279) der Synodal-Sammlung des Staatlichen Historischen Museums in Moskau (GIM), ehemals des Moskauer Patriarchats22. Vermutlich war dieses Manuskript bereits während seiner Herrschaftszeit (1347-1354) im Gebrauch, denn in der Handschrift wird er nur mit Titel und Namen als Kaiser erwähnt: auf Folio 3r und am Ende der
18 Arranz, Miguel: „Les sacrements de l’ancien Euchologe constantinopolitain (2)“. In: Orientalia Christiana Periodica 49 (1983), pp. 42-90, hier: p. 50 Anm. 20, vermutet „une église séculière desservie par des moines“ als Bestimmungsort des Codex. 19 Detaillierte Inhaltsangabe des Euchologions in: Parenti, Stefano: A Oriente e Occi-dente di Constantinopoli. Vatikanstadt 2010, pp. 129-145. Näheres zu diesem Palim-psest bei: Netz, Refiel / Noel, William: The Archimedes Codex. London 2007 und http://www.archimedespalimpsest.org/palimpsest_making1.html. 20 Beschreibung und Teiledition in: Dmitrievskij II, pp. 197-202. 21 Beschreibung in: Metreveli, Elene et al. (Hg.): ქართულ ხელნაწერთა აღწერი-ლობა, სინური კოლექცია (Beschreibung der georgischen Codices, Sinai-Samm-lung). Bd. 3. Tbilisi 1987, pp. 94-107; Cagareli, Аlexander A.: Сведения о памятни-ках грузинской письменности, Bd. 2, Sankt Petersburg 1889, p. 70. Džavachishvili, Ivane (Hg.): სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. (Beschreibung der georgischen Codices des Berges Sinai). Tbilisi 1947, p. 112. 22 Beschreibung in: Archimandrit Vladimir (Hg.): Систематическое описание ру-кописей Московской Синодальной (патриаршей) библиотеки. Bd. 1: Рукописи греческие. Moskau 1894, pp. 361-368. Edition der Feier der Ölweihe in: Dmitriev-skij, Aleksej: Богослужение в русской церкви в XVI веке. Kazan’ 1884, pp. 107-118.
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 129
Euchelaion-Ordnung (Folio 100r) heißt es: !Iwavnnou tou eujsebestavtou basilevw" kai; aujtokravtoro" JRwmaivwn tou Kantakouzhnou taktiko;n su;n Qew/` aJgivw/23; in den Krankengebeten24 wird durchgängig für to;n doulon sou, to;n paneusebevstaton kai; filovcriston basileva hJmwn !Iwavnnhn gebetet.25
5. zwei weitere Codices der Moskauer Synodal-Sammlung, die um 1654 auf dem Athos von A. Suchanov erworben wurden26: Nr. 262 (280) des 15. Jh. aus dem Kloster Esphigmenu27 und 263 (281) v. J. 1470 aus dem Kloster Vatopedi.28
6. schließlich ein weiterer Vertreter der liturgischen Tradition nach der Wiederherstellung des orthodoxen Gottesdienstes in der Hagia Sophia 1261, Arranz29 zufolge charakterisiert durch wachsende Aufnahme von orientali-schen und monastischen Elementen, näherhin der jüngere Teil des Codex Athen. gr. 662, 13./14. Jh. (hier zitiert als Athen. gr. 662-II).30
23 Archimandrit Vladimir (Hg.): Систематическое описание рукописей Москов-ской Синодальной (патриаршей) библиотеки. Bd. 1: Рукописи греческие. Mos-kau 1894, p. 361. 24 Da unsere Untersuchungen sich auf die Ausgabe durch Dmitrievskij stützen, in der die gewöhnlichen Orationen und Fürbittreihen nur mit ihren Initia verzeichnet sind, können wir annehmen, dass auch in der Friedenslitanei der Ordnung in der Fürbitte JUpe;r tw`n eujsebestavtwn ... ebenfalls des Kaisers namentlich gedacht wurde. Leider aber fehlen bislang eine wissenschaftliche Ausgabe und eingehende Untersuchung dieses bedeutenden Zeugnisses lebendiger kaiserlicher Liturgie Konstantinopels. 25 Dmitrievskij, Aleksej: Богослужение ..., pp. 111, 112 u. a., vermutet sogar, dass es sich hier um ein Autograph des Kaisers Johannes handele (p. 110 Anm. 2). 26 Fonkič, Boris L.: Греческие рукописи и документы в России в ХIV-начале ХVІІІ в. Moskau 2003, pp. 131. 135. 27 Beschreibung in: Archimandrit Vladimir (Hg.): Систематическое описание ..., wie Anm. 22, pp. 368-377. 28 Beschreibung in: Archimandrit Vladimir (Hg.): Систематическое описание ..., wie Anm. 22, pp. 377-380. Edition der Feier des Euchelaions nach den beiden Codices: Dmitrievskij, Aleksej: Богослужение ..., pp. 119-135. 29 Arranz, Miguel: „Le preghiere degli infermi nella tradizione bizantina. I sacramenti della restaurazione dell’antico Euchologio costantinopolitano II-5“. In: Orientalia Christiana Periodica 62 (1996), pp. 295-351, hier: p. 297. 30 Im Codex Athen. gr. 662 unterscheidet Arranz (p. 297) zwei Teile: die Haupthand-schrift (12. Jh.) mit der postikonoklastischen konstantinopolitanischen Tradition und ergänzende Blätter (13.-14. Jh.), die an verschiedenen Stellen in den Codex eingefügt worden sind, die u.a. auch die Feier der Krankensalbung enthalten. Edition in: Trem-pelas, Panagiotes: Mikro;n Eujcologion. Bd. 1. Athen 1950. Nachdruck 1998, pp. 120-174 (sehr unübersichtlich). Ausführliche Beschreibung in: Arranz, Miguel: „Les Sacrements de l’ancien Euchologe constantinopolitain (1)“, in: Orientalia Christiana Periodica 48 (1982), pp. 284-335, hier: pp. 316-321. Der Öffentlichkeit noch unzu-gänglich ist die bei M. Arranz (PIO, Rom) gefertigte Doktorarbeit über das Eucholo-gion Athen. gr. 662 von Kalaitzides, Panagiotes: To; uJp jariqm. 662 ceirovgrafo – eujcolovgio th" jEqnikh" Biblioqhvkh" th" ÔEllavdo", 2004.
Tinatin Chronz
130
Mit diesen Zeugen scheint der ganze Bogen zwischen dem Athos und Palästina abgedeckt.
Zum Vergleich werden im Folgenden die sieben Orationen der Lesungen nach den angeführten Handschriften in Synopse vorgestellt.
Der Sin. gr. 973 und der Archimedes-Codex bieten eine außergewöhnli-che, ganz aus dem Rahmen fallende Feier der Ölweihe.31 Statt der sieben Ge-bete nach den sieben Apostolos- und Evangelion-Lesungen sind hier zwei Reihen von sieben Orationen verzeichnet, (a) beim siebenmaligen Anzünden und (b) später beim Löschen der sieben Dochte. Daher werden diese beiden Orationen-Reihen vorab und außerhalb des nachfolgenden Schemas aufge-führt:
(a) Beim Anzünden eines Dochtes: 1. Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ kaqhvmeno" ejpi; twn ceroubi;m ... 2. Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ ejn tw/ ejlevei kai; toi`" oijktirmoi`" ... 3. [Ekpemyon, Kuvrie, th;n piovthta tou ejlevou sou ... 4. AiJtouvmeqav se, Kuvrie oJ Qeov", o{pw" prostavxh/" to; e[leov" sou... 5. ÔO polu;" ejn ejlevei kai; plouvsio" ejn ajgaqovthti ... 6. Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, wie 2. 7. !Agaqe; kai; poluevlee kai; polueuvsplagcne kai; dhmiourge; ...
(b) beim Löschen eines Dochtes: 1. Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ ejn tw/ ejlevei kai; toi`" oijktirmoi`" ... 2. Pavter a{gie, ijatre; yucwn kai; swmavtwn ... 3. Kuvrie Pantokravtwr, a{gie basileu, oJ Qeov", oJ paideuvwn kai; ... 4. Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ pavntwn Despovth" kai; twn o{lwn poihthv", oJ
twn ajsqenouvntwn ijatro;" ... 5. ÔO ijatro;" twn yucwn kai; twn swmavtwn hJmwn, oJ ajnalabw;n eij" ta;"
ajsqeneiva" tou laou ... 6. ÔO Qeo;" hJmwn, oJ Qeo;" tou swvzein, poiwn e[leo" eij" ciliavda" kai;
muriavda" toi`" ajgapwsiv se .... 7. Pavter a{gie, ijatre; yucwn kai; swmavtwn ...
Der leichteren Übersichtlichkeit halber werden in der folgenden Synopse die Initia der slavischen Gebete durch ihre griechischen Pendants vertreten. Es werden folgende Abkürzungen verwendet: = das slavische Gebet ist Grie-chisch vorhanden, KG – Krankengebet, ÖG – Ölgebet, VG – Vergebungs-gebet bei Auflegung des Evangeliars.
31 Vgl. Denysenko, Nicholas E.: The Blessing of Waters on the Feast of Theophany in the Byzantine Rite: Historical Formation and Theological Implications. Washington, D.C. 2008 (Diss. masch.), p. 66: „Sinai 973 can be characterized as a repository of different practices converging in one document, truly reflecting the tensions particular to a liturgy in transition.“
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 131
Sinait. gr.
960, 13. Jh. Synod. gr. 279
14. Jh. Kantakouzenos-
Codex
Hierosol. slav.12
Synod. gr. 280, 281,
15. Jh.
Athen. gr. 662-II,
13.-14. Jh.
1. Kuvrie, ejn tw/ ejlevei
2. JO plouvsio" ejn ejlevei
3. Aijtouvmeqav sou, Kuvrie
(ÖG)
Kuvrie, oJ ejn tw/ ejlevei (ÖG)
Lacuna Kuvrie, oJ ejn tw/ ejlevei (ÖG)
Kuvrie, oJ ejn tw/ ejlevei
(ÖG)
ÔO qeo;" oJ mevga" kai; qaumasto;"
(1. KG)
Gevnoito, Kuvrie, to; e[laion
touto (1. KG)
jAnarce, ajdiavdoce (1. KG)
= (1. KG)
= (prokeimevnh
eujchv)
Gevnoito, Kuvrie, to;
e[laion (2. KG)
JO Qeo;" oJ mevga" kai; qaumasto;"
(2. KG)
Eujdiavllakte Kuvrie
(2. KG)
= (2. KG)
= (1. KG)
ÔO qeo;" oJ mevga" kai; u{yisto" (3. KG)
Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ movno"
oijktivrmwn (3. KG)
Devspota Kuvrie Pan-tokravtwr (3. KG)
= (3. KG)
= (2. KG)
ÔO qeo;" oJ mevga", oJ polu;" ejn
ejlevei (4. KG)
Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ
kaqhvmeno" ejpi; twn Ceroubi;m
(4. KG)
!Agaqe; kai; filavnqrwpe
(4. KG)
= (4. KG)
= (3. KG)
Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ
kaqhvmeno" ejpi; twn
Ceroubi;m (5. KG)
jEpikalouvmeqav se, Devspota
(5. KG)
Kuvrie oJ Qeo;" hJmwn, oJ paideuvwn
(5. KG)
= (5. KG)
= (4. KG)
Devspota, Kuvrie oJ qeo;" hJmwn (6. KG)
JO Qeo;" oJ mev-ga" kai; qau-
mastov" (6. KG)
Eujcaristoumevn soi, Kuvrie (6.
KG)
= (6. KG)
= (5. KG)
ÔO qeo;" oJ dunato;" kai;
ejlehvmwn (7. KG)
O Qeo;" oJ paideuvwn (7.
KG)
Devspota Kuvrie oJ
Qeo;" hJmwn, ijatre;
(7. KG)
= (7. KG)
= (6. KG)
Tinatin Chronz
132
ÔO Qeo;" oJ Swth;r hJmwn
(7. KG wie VG Teil 2)
Eu[splagc-ne, poluevlee Kuvrie ... ÔO
Qeo;" oJ Swth;r hJmwn
... (VG)
= (VG) = (VG)
Gebet zur Salbung:
Pavter a{gie, ijatre; twn
yucwn
Pavter a{gie, ijatre;
Pavter a{gie, ijatre;
Der vorstehende Vergleich lässt erkennen, dass die slavische Handschrift
in Jerusalem exakt einer griechischen Tradition entspricht, die ab dem 14. Jh. in den Athos-Codices bezeugt ist, und zwar sowohl in der Auswahl der Gebetsformulare als auch in der Abfolge ihrer Rezitation (Athen. gr. 2014 [TR 120-174, Sigle Z]; Mosqu. Synodal. 280, 281). Weiterhin ergibt sich, dass unser slavischer Vertreter nicht jenem Modell entspricht, das in den gesellschaftlich führenden Kreisen Konstantinopels seine ursprüngliche Heimat zu haben scheint (Sinait. gr. 973 par. und Mosqu. Synod. 279).
b) Vergleich mit den slavischen Handschriften
Abgesehen vom sog. Euchologium Sinaiticum (11. Jh.), das eine reiche Sam-mlung von ca. 50 Orationen für Kranke und die Weihe des Krankenöles, jedoch keinen Ordo der Feier enthält,32 setzen slavische Euchologion-Hand-schriften erst im 13. Jh. ein. Zu den ältesten gehört der serbische Codex Nr. 3-I-65 aus der Sammlung von Radoslav Grujich im Museum der Serbischen Orthodoxen Kirche in Belgrad, datiert ins Ende des 13. Jh.33 Er vertritt eine 32 Edition: Frček, Jean: „Euchologium Sinaiticum. Text slave avec sources grecques et traduction française“. In: Patrologia Orientalis 24, 5 (1933), pp. 611-802; 25, 3 (1939), pp. 487-617, hier: pp. 708-759. Eine nützliche Übersicht der vorhandenen Literatur zum Codex bietet die jüngst erschienene Arbeit von Penkova, Prinka: Речник-индекс на Синайския Евхологий. Sofia 2008, pp. 5-8. 33 Beschreibung der Handschrift und Edition der Feier der Ölweihe in: Simić, P.: „Требник српске редакције XIII века“. In: Djurić, V. (Hg.): Зборник историје књижевности. Оделење језика и књижевности 10. Стара српска књижевност. Beograd 1976, pp. 53-87.
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 133
besondere Form der Feier der ebenfalls von sieben Priestern vollzogenen Öl-weihe und Krankensalbung, die bislang nur aus vier slavischen Codices bekannt ist und Jerusalemer Ursprung beansprucht. Wendet man Benedikt Alentovs textgeschichtliche Einteilung des in slavischer Sprache überliefer-ten Materials an, bildet die genannte Gruppe von Handschriften die „erste südslavische Redaktion“ der Feier des Heiligen Öles und ist zu unterscheiden von einer etwa gleichzeitig entstandenen „zweiten südslavischen Redaktion“, repräsentiert u. a. durch die Codices Moskau GIM Chludov 118, 14. Jh., und Synodal. 373, 15. Jh.34
Auch bei den russisch-kirchenslavischen Handschriften unterscheidet Alentov zwei Redaktionen: die erste, deren Entstehung er an das Ende des 13. Jh. setzt, vertreten z. B. durch die Handschrift der Sophiensammlung von RNB in Sankt Petersburg Nr. 1055, 14. Jh., der Pogodin-Sammlung Nr. 75, 15.-16. Jh.,35 und eine zweite, nach Metropolit Kyprian von Moskau († 1406) benannte „Kyprian-Redaktion“, die im 15.-16. Jh. die ältere russische Redak-tion verdrängt. Dieser „Kyprian-Redaktion“ gehören die meisten erhaltenen Codices an.36 Die beiden von Alentov unterschiedenen russischen Redaktio-nen sind freilich einander sehr ähnlich: die Varianten betreffen vor allem den Anfangs- und den Schluss-Teil der Euchelaion-Feier, z. B. im hymnographi-schen Material und im Zeremoniell. Die priesterliche Euchologie hingegen bleibt in den beiden Redaktionen konstant bis auf den einen Unterschied, dass in der jüngeren Redaktion nach dem siebenten Krankengebet (KG) eine weitere Oration rezitiert wird und erst danach das übliche Vergebungsgebet (VG).
Im folgenden Schema werden die Orationen des slavischen Codex Hierosol. slav. 12 mit Handschriften der beiden südslavischen und russischen Redaktionen verglichen. Da, wie gesagt, die 1. und 2. russischen Redaktionen im Hinblick auf die Gebetsliteratur fast vollkommen übereinstimmen, werden sie in einer Spalte zusammengefasst. Zur Veranschaulichung der Verbindung mit der griechischen Situation werden in der letzten Spalte auch die Oratio-nen des Codex Athen. gr. 662-II berücksichtigt, wobei das griechische Initi-um der Übersichtlichkeit halber durch sein slavisches Pendant vertreten ist. (KG = Krankengebet, ÖG = Ölgebet, VG = Vergebungsgebet bei Auflegung des Evangeliars.)
34 Benedikt (Alentov), К истории православного богослужения ..., pp. 342-346. 35 Benedikt (Alentov), op. cit., p. 366. 36 Benedikt (Alentov), op. cit., p. 378f.
Tinatin Chronz
134
„Jerusalemer
Ordo” Hier. Slav. 12 2. südsl.
Redaktion russische Redak-tionen
Athen. gr. 662-II
be+ imêè vlastì åpuqati grêxý (1. KG)
bejna!ålne nepr™m™nne st+¥i st+¥xß (1. KG)
= (1. KG) = ( 2. ÖG) = (2. ÖG)
bg+atýi vì mlS^ti i mnogýi vì bl©gostýni (2. KG)
blago¨v™tlive g+i edine ml+ostive (2. KG)
= (2. KG) = (1. KG) = (1. KG)
molimì te gi+ be+ äko da poslewi milostì (3. KG)
vlkDo g+i vsedrß"itelü (3. KG)
= (3. KG) = (2. KG) = (2. KG)
be+ silìnýi i mlS^tive (4. KG)
blag¥ !l+v™kolüb!e (4. KG)
= (4. KG) = (3. KG) = (3. KG)
be+ silì posêti brata (5. KG)
gi+ b"+e na‚ß nakajaø i paky (5. KG)
= (5. KG) = (4. KG) = (4. KG)
mnogomlS^tive mlS^rde g©i nevi-dime (6. KG)
bl+godarim tå gDi b+e naÍ (6. KG)
= (6. KG) = (5. KG) = (5. KG)
gi+ be+ nawì i<e plìtìskýmì tvoimì priwìstvièmì (7. KG)
vlDko gDi b"+e naÍ^ vra!ü d‚+am (7. KG)
= (7. KG) = (6. KG) = (6. KG)
b+atýi mlS^tìü
(7. KG)
b+e sp+sitelü
b+e sp+sitelü (7. KG)
= (VG) bl+goåtrobn¥ mnogomltS^ive giD ... b+e sp+sitelü ... (VG)
= (VG) = (VG) = (VG)
Der synoptische Vergleich zeigt deutlich, dass die Orationen des
Hierosol. slav. 12 ganz der Auswahl und Reihenfolge von Alentovs „zweiter südslavischer Redaktion“ entsprechen. Auch verglichen mit den russischen
Jerusalem und die slavische liturgische Euchologie für Kranke 135
Redaktionen, die ihrerseits mit dem Codex Athen. gr. 662 parallel gehen, weist unser Codex kaum Eigentümlichkeiten auf. Demgegenüber ist der beträchtliche Unterschied zu jenem Ordo, der sich in seinen Überschriften selbst ausdrücklich auf die Kirche von Jerusalem zurückführt, alles andere als zu übersehen.37 Da sich für ihn bisher kein Zeuge in griechischer Sprache gefunden hat, erweist sich auch mit diesem Fall, dass die slavische Überliefe-rung bei der liturgiegeschichtlichen Erforschung des Jerusalemer Gottes-dienstes und seiner Ausstrahlung in die Oikumene nicht vernachlässigt werden darf.
37 Näheres bei: Chronz, Tinatin: „Die Feier des heiligen Öles nach Jerusalemer Ordnung“ mit dem Text des slavischen Codex Hilferding 21 (13.-14. Jh) der Russischen Nationalbibliothek in Sankt-Petersburg. Einführung, Edition, Kommentar. (= JThF Bd. 18). Münster 2011.


































![oknh Jh- fnid jked`”.k dksGh] iksyhl fujh{kd] rRdk](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632705476d480576770d11f9/oknh-jh-fnid-jkedk-dksgh-iksyhl-fujhkd-rrdk.jpg)