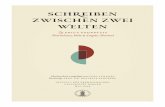I. Balzer, Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soci
Transcript of I. Balzer, Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soci
Nord-Süd, Ost-WestKontakte während der Eisenzeit in Europa
Akten der Internationalen Tagungen der AG Eisenzeit
in Hamburg und Sopron 2002
Herausgegeben von
ERZSÉBET JEREM, MARTIN SCHÖNFELDER und GÜNTHER WIELAND
BUDAPEST 2010
Der Druck des vorliegenden Bandes erfolgte mit Unterstützungdes Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Wien
und des Nationalen Kulturfonds in Ungarn, Budapest
Umschlagbild:
Hallstattzeitliches Wagengefäß aus Fertõendréd(Kom. Sopron, Ungarn)
Gestaltung:Michael Ober, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz
Redaktion:ERZSÉBET JEREM
ISBN 978-963-8046-57-4HU ISSN 1215-9239
Alle Rechte vorbehalten
© Stiftung Archaeolingua
Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, Internet odereinem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung von Archaeolingua reproduziert
oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
2010
ARCHAEOLINGUA ALAPÍTVÁNYH-1250 Budapest, Úri utca 49
Textverarbeitung durch die AutorenLektorierung und sprachliche Redaktion: Wolfgang Meid, Sarah Scheffler, Martin Schönfelder
Konvertierung und Herstellung der Druckvorlage: Rita Kovács
Druck: Akaprint Kft
D e r B r e i s a c h e r M ü n s t e r b e r g
z w i s c h e n M o n t L a s s o i s u n d M o s t n a S o è i
INES BALZER
Einführung
Der Münsterberg von Breisach (Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Deutschland) liegt in einerEntfernung von ungefähr 20 km westlich von Freiburg und östlich von Colmar direkt am Rhein. Deraus Olivintephrit-Tuffbreccien aufgebaute und mit Löß überdeckte Berg überragt die Rheinebene um37 m (Abb. 1). Sein etwa 530 x 200 m großes Plateau ist mindestens seit dem späten Endneolithikumfast kontinuierlich bis heute, jedoch unterschiedlich intensiv besiedelt worden.
Wolfgang Kimmig rechnete bereits 1969 den Münsterberg aufgrund seiner herausragenden topo-graphischen Lage zu den „frühkeltischen Adelssitzen“, obwohl damals Importfunde wie attische Kera-mik und reich ausgestattete Gräber in unmittelbarer Nähe noch fehlten. Inzwischen hat sich der For-schungsstand entschieden verbessert. Vor allem seit den Grabungen ab 1972 sind Keramikfunde ausSüd- und Ostfrankreich, Slowenien und Böhmen bekannt (BENDER et al. 1993, 79 ff.). Aus den bishergrößten Grabungsflächen 1980–1986 stammen außerdem zehn Fragmente attischer Gefäße(WEHGARTNER 1995; BALZER 2002, 300 ff.). Dank der Luftbildarchäologie konnten in den letztenbeiden Jahrzehnten außerdem im Umland des Münsterberges weitere Großgrabhügel mit reich ausge-statteten späthallstatt- und frühlatènezeitlichen Bestattungen dokumentiert werden (DEHN 1999, 2000).
Die Großgrabungen 1980–1986 auf dem Breisacher Münsterberg wurden unter der Leitung vonProf. Dr. Manfred K. H. Eggert (Universität Tübingen) in dem von der Deutschen Forschungsgemein-schaft geförderten Projekt „Chronologisch-chorologische Analyse des späthallstatt- und frühlatène-zeitlichen ,Fürstensitzes‘ auf dem Münsterberg von Breisach (Grabungen 1980–1986)“ aufgearbeitet(BALZER 2004a). In diesem Projekt sollten – neben der Bearbeitung und Vorlage der Grabungen –auch die Fremdfunde verifiziert werden. Dies geschah in erster Linie durch makroskopische Ver-gleiche mit den Originalen bzw. den mutmaßlichen Vorbildern. Dazu kamen stichprobenartig Dünn-schliffanalysen.
Die folgenden Ausführungen basieren auf den Ergebnissen von insgesamt 136 Dünnschliff-untersuchungen an Keramikfragmenten. Getreu dem Tagungsmotto „Ost-West-Beziehungen wäh-rend der Eisenzeit in Europa“ sind hier diejenigen ausgewählt worden, die Aufschlüsse über dieBeziehungen des Münsterberges nach Osten und nach Westen bringen können. Dafür wurden dreiKategorien von Keramikfunden ausgesucht, die im Breisacher Fundgut auffallen oder fremd er-scheinen. Es handelt sich zum einen um die handaufgebaute sogenannte Vixien-Keramik, zumzweiten um ein ebenfalls handaufgebautes „slowenisches Dolium“ und schließlich um die frühesteDrehscheibenkeramik nördlich der Alpen.
Insgesamt liegen 102 Dünnschliffe aus Breisach vor1, dazu kommen 34 weitere, zum Teil 2001und 2002 neu angefertigte Schliffe von acht späthallstatt- und frühlatènezeitlichen Fundorten inBaden-Württemberg und Ostfrankreich2. Die meisten Dünnschliffe der Breisacher Keramik analy-
1 Davon stammen 23 Analysen aus den Untersuchungen von B. RÖDER (1995, 255). Weitere fünf wurden für einenVergleich mit Scheibenware aus der späthallstattzeitlichen Talsiedlung Wolfgantzen (Dép. Haut-Rhin, F) ange-fertigt (KUHNLE et al. 1998, 164 f.). Für die Übergabe der Analysebögen sei allen herzlich gedankt.
2 Es handelt sich um die Fundorte Heuneburg (Gde. Herbertingen-Hundersingen, D), Kirchheim-Osterholz (Gde.Kirchheim am Ries, D), Spaichingen (Lkr. Tuttlingen, D), Hausen-Lochenstein (Lkr. Balingen, D), Mont Lassois(Dép. Côte-d’Or, F), Wolfgantzen (Dép. Haut-Rhin, F), Merxheim (Dép. Haut-Rhin, F) und Pfulgriesheim (Dép.Bas-Rhin, F).
sierte der Freiburger Geologe Hansjosef Maus, der bereits späthallstatt- und frühlatènezeitlicheKeramik aus dem Breisgau (RÖDER 1995) und dem Elsaß (KUHNLE et al. 1998, bes. 164 f.) untersuchthatte (siehe auch BÜCKER et al. 2001). Er erstellte außerdem Vergleichsschliffe aus dem Materialpotentieller Tonentnahmestätten und führte Brennversuche durch. Nach seinem unerwarteten Tod2001 übernahm Dipl.-Min. Ute Mann aus dem Institut für Mineralogie der Universität Tübingen dieAnalysen von Keramik meist anderer Fundorte3.
Die Dünnschliffe wurden mineralogisch-petrographisch untersucht: Unter dem Polarisations-mikroskop wurde die Matrix analysiert und Magerungskomponenten über einer Korngröße von
28 Ines Balzer
Abb. 1. Luftbild des Breisacher Münsterberges mit Blickrichtung von Nordosten nach Südwesten
(O. Braasch/Landesdenkmalamt Baden-Württemberg).
3 U. Mann (Tübingen) möchte ich an dieser Stelle auch für die Durchsicht des Manuskriptes danken.
0,15 mm in Art und Anzahl genauso wie insgesamt die Korngröße, -form und Korngrößenverteilungerfasst4. An dieser Stelle beschränke ich mich auf die Vorstellung von Magerungsart und Anzahl(ausführlich: BALZER 2004a).
Der Breisacher Münsterberg und Ostfrankreich: die Vixien-Keramik
Bereits 1939 kamen in Breisach zwei pastos bemalte, mit geometrischen Mustern verzierteKeramikfragmente zum Vorschein (BENDER et al. 1993, Taf. 31B,8–9; PAPE 1993, 107), derenParallelen in Ostfrankreich, besonders beim Mont Lassois (Dép. Côte-d’Or, F), liegen und deshalbauch als „Vixien“ bezeichnet werden (BENDER et al. 1993, 81). Weitere Funde folgten (BENDER et al.
1993, 81 f. mit Taf. 43,9 und Taf. 51C,1–2). Auch aus den Grabungen 1980–1986 sind insgesamt 13kleinfragmentierte Scherben bekannt (Abb. 2.b). Ludwig Pauli sah die Keramik eher im Umfeld vonBragny-sur-Saône (Dép. Saône-et-Loire, F) und bezeichnete sie als Keramik „à la Barbotine“(BENDER et al. 1993, 81 f.), was sich aber letztendlich nicht durchsetzte (siehe auch FISCHER 1996,277). Aus rein formaler Sicht ist die Frage nach der Herkunft allerdings schwer zu beantworten, da derForschungsstand zur Vixien-Keramik als ungenügend bezeichnet werden muß. Das Formen-, Farben-und Verzierungsspektrum ist bisher immer noch nur aus der ausschnittshaft publizierten, unstrati-fizierten Keramik aus Altgrabungen des Mont Lassois zu erschließen (JOFFROY 1960, Taf. 43–51,53–63), von anderen Fundplätzen wie Bragny-sur-Saône (FEUGÈRE – GUILLOT 1986, bes. 175Fig. 15) sind die Keramikfunde nur ansatzweise publiziert.
Wie eine unmittelbare Gegenüberstellung aufzeigte, scheint es sich makroskopisch betrachtet beider Vixien-Keramik von Breisach und vom Mont Lassois um dieselbe „Handschrift“ zu handeln(Abb. 2) – nur die Farbe des Grundtones differiert geringfügig. So weisen die Vixien-Scherben desMont Lassois eher einen rotbraunen Grundton auf, während diejenigen aus Breisach eine Tendenzzum Hellbraun zeigen.
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi 29
Abb. 2. Vixien-Keramik
mit Dünnschliffen.
a. Mont Lassois;
b. Breisacher Münsterberg.
4 Zur Methode: DELL’MOUR 1989; allgemein: BARCLAY 2001. Zur geologischen Ausgangssituation in Breisach undim Breisgau: RÖDER 1995, bes. 78 ff. und 138. Meistens werden chemisch-mineralogische Analysen durchgeführt(z. B. KILKA 1986; MAGETTI – GALETTI 1987; weitere Literaturhinweise unter http://www.unifr.ch/geoscience/mineralogie/archpapers.html), die nicht mit den hier vorgestellten mineralogischen Untersuchungen direkt ver-gleichbar sind.
Von zwei Breisacher Vixien-Scherben wurden von Hansjosef Maus Dünnschliffanalysen ange-fertigt (Abb. 2.b), eine weitere von Ute Mann untersucht. Die Scherben weisen einen mittleren bishohen Quarzanteil und jeweils abgestufte Anteile von Kalifeldspäten und Plagioklasen auf. EinDünnschliff zeigte außerdem eine geringe Menge von Kristallinem und einen mäßigen Anteil anGoethitkonkretionen (Abb. 3), ein anderer beinhaltete zudem noch äußerst geringe Anteile anGlimmer, Pyroxen, Augit, Vulkanit und Schamotte. Die Matrix eines Gefäßes stammt nach Maus ausdem Löß, die des anderen aus dem Bereich der Rheinaue. Im Vergleich mit anderen Dünnschliffenvon Breisacher Keramik fällt diese Zusammensetzung nicht aus dem Rahmen.
Für einen direkten Vergleich wurden die Schliffe zweier Vixien-Gefäße vom Mont Lassoisanalysiert (Abb. 2.a)5. Der Quarzgehalt ist hier sehr hoch. Von den Breisacher Komponentenunterscheiden sie sich außerdem deutlich durch einen sehr hohen Anteil an Calcit, Schamotte undrötlichen Konkretionen (Ton- oder Glasfragmente) und einem niedrigen Anteil an Vulkaniten,Hämatiten und Glasfragmenten (von Vulkaniten?) (Abb. 3)6.
Der Breisacher Münsterberg und das Südostalpengebiet:das leistenverzierte Dolium
1972 wurden auf dem Breisacher Münsterberg in zwei Ha D3-zeitlichen Gruben leistenverzierteFragmente eines handaufgebauten Großgefäßes, darunter auch das Stück eines wohl nachgedrehtenRandes, angetroffen (BENDER et al. 1993, 213 und 222 mit Taf. 11,6). Wie Pauli bereits überzeugend
30 Ines Balzer
Vixien-Keramik:
Breisach (schwarz) und Mont Lassois (grau)
0 1 2 3 4
Quarz
Kalifeldspat
Plagioklas
Calcit
Kristallin
Vulkanit
Goethitkonkr.
Hämatit
Schamotte
Glasfragm.
rötl. Konkretion
Ko
mp
on
en
ten
art
Komponentenanzahl:
1 = 1–5/100 mm²; 2 = 6–20/100 mm²; 3 = 21–50/100 mm²; 4 > 51/100 mm².
Abb. 3. Vixien-Keramik. Vereinfachte Darstellung der Dünnschliffanalysen
aus Breisach (Br86/8939-1) und dem Mont Lassois (88.8808.1).
5 Die Scherben stellte dankenswerterweise J.-L. Coudrot (Musée du Châtillonnais, Châtillon-sur-Seine) zur Ver-fügung.
6 In Abb. 3 ist wegen der besseren Übersichtlichkeit jeweils nur eine Probe von beiden Fundorten abgebildet. Zuanderen Analysen von Keramik des Mont Lassois siehe auch RAMSEYER 1999 mit weiteren Literaturhinweisen.
belegen konnte, finden diese Gefäße ihre beste Entsprechung in Exemplaren des Gräberfeldes vonMost na Soèi in Westslowenien, auch wenn der zylindrische Halsbereich des Breisacher Gefäßesetwas aus dem Rahmen fällt (BENDER et al. 1993, 85 ff.). In einer Grube der Breisacher Grabungen1980–1983, die in etwa 20 m bzw. 25 m Entfernung zu den Fundorten von 1972 liegt, fand sich einweiteres 43 x 38 cm großes Wandstück, das sehr wahrscheinlich zum selben Gefäß gehört (BALZER
2001, 13 Abb. 5). Insgesamt lassen sich die Fragmente zu einem mindestens 0,70 m hohen Gefäßrekonstruieren (Abb. 4).
Bei einem Besuch der Museen in Triest, Ljubljana, Tolmin und Wien und einem dort erfolgtendirekten Vergleich7 unter anderem mit den Originalgefäßen aus dem Gräberfeld von Most na Soèiwurde schnell klar, daß die „Handschrift“ des Breisacher Dolium mit der der slowenischen Keramikübereinstimmt. Dies betrifft sowohl die rötlich-hellbraune Oberflächenfarbe, die unter den sonstreduzierend gebrannten Keramikgefäßen auf dem Breisacher Münsterberg sehr auffällig ist, als auchdie Gestaltung der Leisten auf dem Gefäßkörper. Kleinere Unterschiede sind erst auf den zweitenBlick zu erkennen: Die Oberfläche beispielsweise der Dolien aus Most na Soèi ist sehr porös, der Tonscheint insgesamt nicht gut aufgearbeitet und wirkt schlierig. Dagegen weist das Dolium aus Breisacheine glatte Oberfläche und einen gut gearbeiteten, hart gebrannten Ton auf (Abb. 4 links)8.
Von dem Breisacher Dolium wurden zwei Dünnschliffe angefertigt. Als Vergleich konnten dreiSchliffe von neu entdeckten und von Verf. als Dolien bestimmten Fragmente aus Kirchheim-Osterholz (Gem. Kirchheim am Ries, Baden-Württemberg) (KRAUSE 2002, 503 Abb. 18) herange-
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi 31
Abb. 4. „Slowenisches“ Dolium vom Breisacher Münsterberg.
Links: Außen- und Innenseite einer Wandscherbe von Fundplatz 3 (Grabung 1972).
Rechts: Wandscherbe von Fundplatz 28 (Grabungen 1980–1983) und
Randscherbe von Fundplatz 3 (Grabung 1972) in einer Rekonstruktion.
7 Für die Möglichkeit zur Begutachtung der Keramik möchte ich A. Kern (Wien), M. Mlinar (Tolmin) und P. Turk(Ljubljana) herzlich danken.
8 Es sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich betont, daß es sich bei den „slowenischen Dolien“ um Grob-keramik handelt. Sie sind weder mit den feinkeramischen Este-Situlen noch mit den scheibengedrehten „Dolien-fragmenten“ aus Châtillon-sur-Glâne (Kt. Fribourg, CH) vergleichbar. Dagegen: LÜSCHER 1998, 169 ff.
zogen werden (Abb. 5)9. Eine Dünnschliffserie aus Slowenien oder Nordostitalien zum direktenVergleich steht allerdings noch aus.
Die zwei Schliffe des Breisacher Großgefäßes zeigen einen höheren bis hohen Quarzanteil und inleichter Abstufung Anteile an Kalifeldspäten und Plagioklasen. Dazu kommen höhere Anteile anKristallinem und Vulkaniten. Demgegenüber sind die Anteile an Glimmer, Pyroxen, Hämatit undSchamotte außerordentlich gering. In einem Schliff war außerdem ein Amphibol zu erkennen. EinKalkanteil, wie er sich teilweise makroskopisch bei den Dolien aus Most na Soèi feststellen läßt, istnicht vorhanden.
Zwei Schliffe der Dolien aus Kirchheim-Osterholz – einer davon ist graphisch in Abb. 5
dargestellt – zeigen einen erhöhten Quarz- und einen niedrigen Plagioklasanteil. Untergeordnet sindVulkanite, Schamotte und Glasfragmente. Hämatit und Hohlraumformen haben einen sehr hohenAnteil10. Diese Gefäße stehen mit ihrer sehr porösen Oberfläche auch makroskopisch denslowenischen Gefäßen näher als dem Breisacher Dolium. Bei einem dritten Schliff können insgesamtähnliche Komponenten beobachtet werden, es fehlen jedoch hier die Hohlräume.
Eine zweite Bestimmung der Dolien-Dünnschliffe führte Klaus Peter Burgath (Hannover) zurKontrolle durch11. Demnach kann das Breisacher Dolium sehr gut im südlichen Oberrheingebiethergestellt worden sein. Mit den Dolien aus Kirchheim-Osterholz gibt es keine Übereinstimmungen.In einem Schliff von Osterholz konnte die Magerungsart als „zerkleinerte Schlacken aus Erzver-hüttung (wahrscheinlich Kupfererz)“ präzisiert werden.
32 Ines Balzer
"Slowenische" Dolien:
Breisach (schwarz) und Kirchheim-Osterholz (grau)
0 1 2 3 4
Quarz
Kalifeldspat
Plagioklas
Pyroxen
Kristallin
Vulkanit
Hämatit
Schamotte
Hohlraum
Glasfragm.
Ko
mp
on
en
ten
art
Komponentenanzahl:
1 = 1–5/100 mm²; 2 = 6–20/100 mm²; 3 = 21–50/100 mm²; 4 > 51/100 mm².
Abb. 5. „Slowenisches“ Dolium: Vereinfachte Darstellung der Dünnschliffanalysen aus Breisach (72/23a)
und Kirchheim-Osterholz (Oster 184.2).
9 Für die Bereitstellung der Scherben ist R. Krause (Esslingen) sehr zu danken.10 Die Drehscheibenkeramik aus Kirchheim-Osterholz weist im übrigen einen ähnlich hohen Hämatitwert auf.11 K. P. Burgath (Hannover) möchte ich für sein spontanes Angebot zur unabhängigen Kontrollbestimmung meinen
herzlichen Dank aussprechen.
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und der Heuneburg:die Drehscheibenkeramik
Haben Vixien-Keramik und das „slowenische Dolium“ nur einen unwesentlichen prozentualen Anteilan den Keramikfunden aus Breisach überhaupt, sieht das bei der frühesten Drehscheibenkeramikanders aus: In fast jeder späthallstattzeitlichen (Ha D3) Befundverfüllung findet sich dünnwandigeschmalgeriefte Scheibenware. Wurde sie in Breisach und Umgebung hergestellt oder ist sie importiertworden, womöglich sogar von der Heuneburg?
Vergleicht man die früheste Ha D3-zeitliche Drehscheibenkeramik beispielsweise der Heuneburg,des Breisacher Münsterberges und des Mont Lassois nur anhand von Abbildungen (z. B. HOPERT
1996), scheinen einige Formen ähnlich, wenn nicht sogar eines einzigen Ursprunges. In einer direktenGegenüberstellung sind jedoch im einzelnen teilweise makroskopische Unterschiede wie ver-schiedenartige Oberflächenbehandlung, Glimmerzusatz oder Kalkanteile feststellbar.
Für eine Gegenüberstellung mit Breisacher Scheibenware wurde für diesen Beitrag jeweils einDünnschliff vom Mont Lassois und der Heuneburg ausgewählt (Abb. 6 und 7)12. Der aus Breisachausgesuchte Dünnschliff zeigt einen mittelhohen Quarzwert. Neben geringeren Anteilen an Kalifeld-späten und Plagioklasen gibt es einen niedrigen Kalksteinanteil, was bei der späthallstattzeitlichenDrehscheibenkeramik des Breisgaus gelegentlich vorkommt, aber interessanterweise nicht mehr beiScheibenware der Frühlatènezeit (BALZER 2004a; siehe auch RÖDER 1995, 93).
Der Dünnschliff der Keramik vom Mont Lassois weist ähnliche Komponenten und Häufigkeitenwie die Vixien-Scherben (siehe oben) auf, der hohe Calcitanteil ist hier auffällig.
Der analysierte Schliff einer Scherbe der Heuneburg zeigt einen hohen Quarzanteil. WeitereKomponenten sind Kalifeldspäte und Plagioklase, Glimmer, Calcit, Hämatit und Schamotte inniedriger Anzahl. Charakteristisch scheint der sehr hohe Vulkanitanteil13 zu sein. Weitere, hier nicht
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi 33
Abb. 6. Links: Späthallstattzeitliche Drehscheibenkeramik vom Mont Lassois (a) und aus Breisach (b).
Rechts: Mineralogisch analysierte Scheibenware (siehe dazu Abb. 7). a. Breisach (BENDER et al. 1993,
Taf. 2,7); b. Heuneburg (HOPERT 1996a, Taf. 10,53); c. Mont Lassois (BALZER 2004a).
12 Die Drehscheibenkeramik der Heuneburg stellte freundlicherweise H. Reim (Tübingen) auf Vermittlung von S.Hagmann (Hundersingen) zur Verfügung.
13 Vermutlich handelt es sich um Vulkanit, da die Matrix der Komponente sehr glasig erscheint.
näher behandelte Schliffe der Heuneburg bestätigen die Komponentenarten, nur die Menge anSchamotte und Glimmer differiert jeweils.
Wie auch die hier nicht angeführten Analysen von Scheibenware anderer Fundorte aufzeigen(dazu: BALZER 2004a), dürfte in den meisten Fällen der Herstellungsort identisch mit dem jeweiligenFundort sein.
Bewertung
Die meisten in Breisach aufgefundenen Gefäße dürften auch auf oder in der Nähe des BreisacherMünsterberges hergestellt worden sein, wie dies die mineralogisch-petrographischen Analysen ausBreisach und weiterer Fundorte nahe legen. Dies scheint sowohl für die handaufgebauten „Fremd-funde“ als auch für die früheste Drehscheibenkeramik zu gelten.
Die schmalgeriefte Scheibenware kommt im Gegensatz zur Vixien-Keramik und dem leisten-verziertem Großgefäß überaus häufig in den späthallstattzeitlichen (Ha D3) Befundverfüllungen aufdem Münsterberg vor. Dass frühe Drehscheibenkeramik lokal produziert und nicht nur von einemeinzigen „Fürstensitz“ aus exportiert wurde, ist keine neue Feststellung. Zu entsprechenden Er-gebnissen gelangte RAMSEYER 1999 für den Mont Lassois und Châtillon-sur-Glâne aufgrund derAnalysen von KILKA 1986. Untersuchungen und Vergleiche von Keramik aus Châtillon-sur-Glânemit der Heuneburg (MAGETTI – GALETTI 1987, mit weiteren Literaturhinweisen) und mit der
34 Ines Balzer
Frühe Drehscheibenkeramik:
Breisach (schwarz), Mont Lassois (grau) und Heuneburg (weiß)
0 1 2 3 4
Quarz
Kalifeldspat
Plagioklas
Glimmer
Pyroxen
Calcit
Kristallin
Vulkanit
Kalkstein
Goethitkonkr.
Hämatit
Schamotte
Glasfragm.
rötl. Konkretion
Ko
mp
on
en
ten
art
Komponentenanzahl:
1 = 1–5/100 mm²; 2 = 620/100 mm²; 3 = 21-50/100 mm²; 4 > 51/100 mm².
Abb. 7. Späthallstattzeitliche Drehscheibenkeramik. Vereinfachte Darstellung der Dünnschliffanalysen
von Scheibenware aus Breisach (19), vom Mont Lassois (89.302.1) und der Heuneburg (X129).
Baarburg (Kt. Zug, CH) sowie dem Üetliberg (Kt. Zürich, CH) (BÉARAT – BAUER 1994) zeigtenähnliche Resultate14. Dennoch ist es bemerkenswert, daß die früheste Drehscheibenkeramik nördlichder Alpen zuerst ein recht einheitliches Formenspektrum aufweist (HOPERT 1996), das erst späterinnerhalb der Siedlungen mit eigenständigen Formen und Verzierungen, soweit dies das auf derScheibe nur begrenzt herzustellende Spektrum überhaupt zuläßt, einen individuellen Charaktererhält.
Über den Ursprung der nordalpinen Drehscheibenkeramik wurde bisher erstaunlich wenigspekuliert. Wolfgang Dehn leitete die frühkeltische Drehscheibenkeramik von der südfranzösischen„poterie grise“ ab (DEHN 1963, 379 ff.), Amei Lang bevorzugte eine Herkunft aus Nord- bzw.Mittelitalien (LANG 1974, 26 ff.). Dabei ist allerdings zu bedenken, daß die Scheibentechnik an sichgar nicht besonders fremd gewesen sein dürfte. Eine mit der Hand anzutreibende Tournette ist bereitsmindestens in der Urnenfelderzeit als Hilfsmittel bei der Keramikherstellung verwendet worden. DasDrehen als erleichternde Technik beispielsweise bei der Herstellung von Bernsteinperlen oder derspäthallstattzeitlichen Sapropelitarmringe wurde seit dem Neolithikum angewendet (FEUGÈRE –GEROLD 2004). Dazu können als weitere Anregung besonders die attischen und provenzalischen, aufder schnellen Scheibe gedrehten Gefäße, die sich seit der zweiten Hälfte des 6. Jhs. v. Chr. vereinzeltin Orten nördlich der Alpen finden (PAPE 2000, 102 ff.), gedient haben. Vergleicht man dazu Formenund Verzierung der südfranzösischen „ceramique grise“ mit den mehrfach gerieften scheibenge-drehten Gefäßen Ostfrankreichs wie vom Mont Lassois15, ist eine Ausbreitung von Technik undmöglicherweise auch bestimmter Formen von dort aus nach Süddeutschland und in die Schweiz sehrgut vorstellbar. Multiplikator der Technik könnten dabei beispielsweise auch Wanderhandwerker ge-wesen sein16. Andere Beispiele weisen auf in der Fremde angelernte Handwerker, die in ihre Heimatzurückkehrten, um dort ihrem Beruf nachzugehen (vgl. auch ROMSAUER – PIETA 1992, 219).
Schwierig ist auch die Bewertung der handaufgebauten Fremdfunde. Angesichts der auf min-destens 1,2 Tonnen geschätzten Keramik der Hallstatt- und Frühlatènezeit aus allen bisherigenGrabungen und Aufsammlungen vom Breisacher Münsterberg haben die 18 Fragmente von Vixien-Keramik und die sehr wahrscheinlich von einem einzigen Gefäß stammenden Dolienscherbenallerdings nur einen äußerst geringen Anteil an der Gesamtkeramikmenge.
Die Ähnlichkeit mit den postulierten Vorbildern ist bemerkenswert, auch wenn es makroskopischim direkten Vergleich geringfügige Unterschiede geben kann. Weil Form oder Bemalungstechnik,also die „Handschrift“ des Töpfers, zu ähnlich erscheinen, ist eine Imitation – also die Nachahmungetwa eines Vixien-Gefäßes – weniger wahrscheinlich. Auch würde man dann in diesem Falle eher mitder Imitation beispielsweise einer attischen Schale, wie die nachgeahmte Kylix aus Pilsen-Roudnáaufzeigt (BAŠTA et al. 1989), rechnen, als mit Grobkeramik wie dem hier vorgestellten leisten-verzierten Großgefäß.
Worum handelt es sich dann, wenn nicht um Imitationen oder Importe? Da die Herstellunghandaufgebauter Keramik nach ethnologischen Analogien überwiegend in Frauenhand lag (KNOPF
2002, bes. 182 ff.), könnte hier die Einheirat von ortsfremden Frauen, die ihren Töpferstil nachBreisach mitgebracht und weiterhin angewendet haben, eine Rolle spielen. Allerdings scheint diesinsgesamt eher unwahrscheinlich, da sich bei ethnologisch beobachteten Gruppen die einheiratendenFrauen in der Regel dem im Dorf üblichen Töpferstil anpassen (DAVID – DAVID-HENNIG 1971, 295;
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi 35
14 Leider wurden die beprobten Keramikgefäße meist nicht abgebildet, so daß unmöglich zu entscheiden ist, ob essich bei den analysierten Gefäßen um eine „Fremdform“ innerhalb des Fundgutes handelt. Dies ist besondersbedauerlich bei den Keramikanalysen von Le Pègue und dem Mont Lassois, die teilweise aus angeblich denselbenTonlagerstätten stammen sollen (KILKA 1986).
15 Graumonochrome Keramik: ARCELIN-PRADELLE 1984 (Formenspektrum); PAPE 2000, 115 Abb. 19 (Ver-breitungskarte). Nordalpine frühe Scheibenware: HOPERT 1996 (Formenspektrum); BALZER 2004a (Ver-breitungskarte).
16 Allgemein zu Wanderhandwerkern: PAULI 1978, 442 ff. Wandertöpfer in der Antike: SCHEIBLER 1995, bes. 78und 121. Ethnologisches Beispiel: VOSSEN 1990, 287 ff. Siehe außerdem Beitrag Karl in diesem Band.
VOSSEN 1990, 159; KNOPF 2002 z. B. 201). Entscheidend für die Annahme oder Ablehnung fremderKeramikstile oder Techniken dürfte insbesondere die vorhandene oder fehlende Nachfrage sein(siehe dazu auch KNOPF 2002, bes. 242 ff).
Wurde in Breisach ein individuelles Schicksal erfaßt? Diese Frage drängt sich zumindest bei demleistenverzierten Großgefäß auf. Denn diese Dolien sind in hoher Anzahl bisher nur an einem einzigenFundort, dem westslowenischen Gräberfeld in Most na Soèi, beobachtet worden (TERÞAN et al. 1984;1985). Nur wenige Dolienfragmente oder komplette Dolien in geringen Mengen kennt man dagegenbeispielsweise aus Stièna (GABROVEC 1994, 178 Taf. 19,3), Libna (GUŠTIN 1976, 136 Taf. 88,1)sowie einem Grab von Magdalenska Gora (GABROVEC et al. 1970, 31 Abb. 11,24). Aus Österreichsind einige Fragmente aus dem Gräberfeld von Frög (Kärnten) bekannt, weitere stammen ausNordostitalien (CASINI – FRONTINI 1988, 270 ff.)17. Die Mehrzahl dieser Großgefäße wurde demnachals Grabgefäß verwendet. Als Transportgefäß für weite Strecken, noch dazu über die Alpen,erscheinen sie zudem sehr unpraktisch. Es besteht also auch die Möglichkeit, daß es in Breisach einePerson gab, die sich nach der Sitte des Heimatortes bestatten lassen wollte und deshalb vor ihrem Todnoch das passende Grabgefäß herstellte18. Wie dann aber die neuentdeckten Dolienfragmente aus derSiedlung Kirchheim-Osterholz in das Bild passen, ist noch nicht zu beantworten.
Bei allen drei hier vorgestellten Keramikgruppen sind Fernkontakte offenkundig. Da diese anihrem Fundort Breisach auch hergestellt worden sind, entfällt eine Deutung als Handelsgut, Beuteoder Geschenk (dazu LANG 2002 mit weiterer Literatur). Was bleibt, um Fernkontakte zu begründen,ist der Aspekt Mobilität. Hier ist, wie oben aufgezeigt, zwischen Privatpersonen, die es beispielsweiseaufgrund von Abenteuerlust, Auswanderung oder Heirat in die Ferne verschlägt, oder Gewerbebetreibenden Personen, die gezielt weite Strecken zurücklegen, wie Wanderhandwerker, zu unter-scheiden.
Aber auch auf den ersten Blick abwegige Erklärungsmöglichkeiten müssen in Betracht gezogenwerden. So erörterten Nicholas David und Hilke David-Hennig am Beispiel der Ful in Nordkamerun:„In Bé fehlten lange Zeit Töpfer, und ihre Abwesenheit führte dazu, dass Tonwaren aus umliegendenOrtschaften gekauft und Besucher angehalten wurden, gelegentlich Gefäße zu fertigen […]“ (DAVID
– DAVID-HENNIG 1971, 312; Hervorhebung durch I. B.).
Literaturverzeichnis
ARCELIN-PRADELLE, C. 1984La céramique grise monochrome en Provence. Rev. Arch. Narbonnaise Suppl. 10. Paris.
BALZER, I. 2001Neues vom Breisacher Münsterberg in frühkeltischer Zeit. Arch. Nachr. Baden 64, 9–14.
BALZER, I. 2002Neue Untersuchungen zu Breisach: Zum Forschungsprojekt „Chronologisch-chorologischeAnalyse des späthallstatt- und frühlatènezeitlichen ,Fürstensitzes‘ auf dem Münsterberg vonBreisach (Grabungen 1980–1986)“. In: LANG – SALAÈ 2002, 298–303.
BALZER, I. 2004aChronologisch-chorologische Untersuchung des späthallstatt- und frühlatènezeitlichen
„Fürstensitzes“ auf dem Münsterberg von Breisach (Grabungen 1980–1986). DissertationTübingen.
36 Ines Balzer
17 Diese Hinweise verdanke ich G. Tomedi (Innsbruck) und R. Krause (Esslingen).18 Auch zwei vermutlich in Norditalien hergestellte Sanguisugafibeln aus den Grabungen 1984–86 von Breisach,
leider mit Lesefundcharakter, geben Hinweise auf Fernkontakte bzw. die Mobilität einzelner Personen aus demsüdöstlichen Alpenraum.
BALZER, I. 2004bBeobachtungen zur frühen Drehscheibenkeramik aus Breisach (Kr. Breisgau-Hochschwarzwald,Baden-Württemberg, D). In: FEUGÈRE – GEROLD 2004, 91–100.
BARCLAY, K. 2001Scientific analysis of archaeological ceramics. A handbook of resources. Oxford.
BAŠTA, J. – BAŠTOVÁ, D. – BOUZEK, J. 1989Die Nachahmung einer attisch-rotfigurigen Kylix aus Pilsen-Roudná. Germania 67, 463–476.
BÉARAT, H. – BAUER, I. 1994Früheisenzeitliche Keramik von Baarburg ZG und Üetliberg ZH. Eine mineralogisch-petro-graphische und chemische Untersuchung zur Frage der Herstellungsorte scheibengedrehterKeramik in der ausgehenden Hallstattzeit. Germania 72, 67–93.
BENDER, H. – PAULI, L. – STORK, I. 1993Der Münsterberg in Breisach II: Hallstatt- und Frühlatènezeit. Veröff. Komm. Arch. Er-forschung Spätröm. Raetien Bayer. Akad. Wiss., Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 40.München.
BÜCKER, CH. – GOLDENBERG, G. – JENISCH, B. 2001In memoriam Dr. Hansjosef Maus (1936–2001). Arch. Nachr. Baden 65, 43 f.
CASINI, ST. – FRONTINI, P. 1988La ceramica grossolana. In: R. de Marinis (Hrsg.), Gli Etruschi a nord del Po. Vol. 1. 266–280.Udine.
DAVID, N. – DAVID-HENNIG, H. 1971Zur Herstellung und Lebensdauer von Keramik. Untersuchungen an den sozialen, kulturellen undökonomischen Strukturen am Beispiel der Ful aus der Sicht des Prähistorikers. Bayer.
Vorgeschbl. 36, 289–317.
DEHN, R. 1999Hügel 6 des Grabhügelfeldes im Gewann „Nachtwaid-Ried“, Ihringen/Gündlingen, Kr. Breisgau-Hochschwarzwald. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1999, 57–59.
DEHN, R. 2000Frühe Kelten im Breisgau. Der Fürstensitz auf dem Münsterberg in Breisach. Denkmalpfl.
Baden-Württemberg 2000, 210–212.
DEHN, W. 1963Frühe Drehscheibenkeramik nördlich der Alpen. Alt-Thüringen 6, 1962/63, 372–382.
DELL’MOUR, R. W. 1989Keramikanalyse mit dem Polarisationsmikroskop. Methodik – Interpretation – Beispiele. Arch.
Austriaca 73, 17–34.
FEUGÈRE, M. – GEROLD, J.-C. 2004 (Hrsg.)Le tournage, des origines à l’an Mil. Actes du Colloque de Niederbronn, octobre 2003.
Monographies instrumentum 27. Montagnac.
FEUGÈRE, M. – GUILLOT, A. 1986Fouilles de Bragny I. Les petits objets dans leur contexte du Hallstatt final. Rev. Arch. Est et
Centre-Est 37, 159–221.
FISCHER, F. 1996Rezension zu: H. Bender – L. Pauli – I. Stork, Der Münsterberg in Breisach II (München 1993).Germania 74, 275–279.
GABROVEC, S. – FREY, O.-H. – FOLTINY, S. 1970Erster Vorbericht über die Ausgrabungen im Ringwall von Stièna. Germania 48, 12–33.
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi 37
GABROVEC, S. 1994Stièna I. Siedlungsausgrabungen. Kat. in Monogr. 2, Narodni Muzej 28. Ljubljana.
GUŠTIN, M. 1976Libna. Veröffentl. Posavski muz. Breþice 3. Breþice.
HOPERT, S. 1996Frühe scheibengedrehte Keramik aus Südwestdeutschland und der Schweiz. Arch. Schweiz 19,18–27.
JOFFROY, R. 1960L’oppidum de Vix et la civilisation hallstattienne finale dans l’Est de la France. Paris.
KILKA, T. 1986Châtillon-sur-Glâne – Mont Lassois – Le Pègue : Etude comparative des céramiques sur la based’analyses pétrographiques, minéralogiques et chimiques. Chronique Arch. 1986, 116–127.
KIMMIG, W. 1969Zum Problem späthallstattzeitlicher Adelssitze. In: K.-H. Otto – J. Herrmann (Hrsg.), Siedlung,
Burg und Stadt: Studien zu ihren Anfängen. Festschrift Paul Grimm. 95–113. Deutsche Akad.Wiss. Berlin, Schr. Sektion Vor- u. Frühgesch. 25. Berlin.
KNOPF, TH. 2002Kontinuität und Diskontinuität in der Archäologie. Quellenkritisch-vergleichende Studien.
Tübinger Schr. Ur- u. Frühgesch. Arch. 6. Münster.
KRAUSE, R. 2002Ein frühkeltischer Fürstensitz auf dem Ipf am Nördlinger Ries. Antike Welt 33, 493–508.
KUHNLE, G. – TESNIER-HERMETEY, C. – PLOUIN, S. – THURNHEER, CH. – MAISE, CH.1998
L’Habitat Hallstattien D2/D3 de Wolfgantzen (Haut-Rhin): une occupation de plaine face àBreisach. Rev. Arch. Est et Centre-Est 49, 135–181.
LANG, A. 1974Die geriefte Drehscheibenkeramik der Heuneburg 1950–1970 und verwandte Gruppen.
Heuneburgstud. III. Röm.-Germ. Forsch. 34. Mainz.
LANG, A. 2002Fernkontakte – Voraussetzungen, Interpretationen und Auswirkungen für die Eisenzeit. In: LANG
– SALAÈ 2002, 11–19.
LANG, A. – SALAÈ, V. 2002 (Hrsg.)Fernkontakte in der Eisenzeit/Dálkové kontakty v dobê þelezné. Konferenz Liblice 2000. Prag.
LÜSCHER, G. 1998Die Importkeramik. In: B. Dietrich-Weibel – G. Lüscher – T. Kilka (Hrsg.), Posieux –Châtillon-sur-Glâne: Keramik. Freiburger Arch. 12, 119–210. Fribourg.
MAGETTI, M. – GALETTI, G. 1987Hallstattzeitliche Keramik von Châtillon-sur-Glâne und der Heuneburg: ein naturwissenschaft-licher Vergleich. Arch. Fribourgeoise, Chronique Arch. 1984 (1987), 96–105.
PAPE, J. 1993Keramik vom Breisacher Münsterberg – Zeugnis weitreichender Verbindungen. In: Zeitspuren.Arch. Nachr. Baden 50, 106 f.
PAPE, J. 2000Die attische Keramik der Heuneburg und der keramische Südimport in der Zone nördlich derAlpen während der Hallstattzeit. In: W. Kimmig (Hrsg.), Importe und mediterrane Einflüsse aufder Heuneburg. Heuneburgstudien XI. Röm.-Germ. Forsch. 59, 71–175. Mainz.
38 Ines Balzer
PAULI, L. 1978Der Dürrnberg bei Hallein III. Auswertung der Grabfunde. Veröff. Komm. Arch. ErforschungSpätröm. Raetien Bayer. Akad. Wiss., Münchner Beitr. Vor- u. Frühgesch. 18. München.
RAMSEYER, D. 1999Les céramiques de Vix et Châtillon-sur-Glâne. Productions locales ou importations. In: B.Chaume – J.-P. Mohen – P. Périn (Hrsg.), Archéologie des Celtes. Mélanges à la mémoire de René
Joffroy. 307–314. Protohist. Européenne 3. Montagnac.
RÖDER, B. 1995Frühlatènekeramik aus dem Breisgau – ethnoarchäologisch und naturwissenschaftlich analysiert.
Materialh. Arch. Baden-Württemberg 30. Stuttgart.
ROMSAUER, P. – PIETA, K. 1992Bedeutender Fund aus der späten Hallstattzeit in Hubina. Slov. Arch. 40/2, 213–222.
SCHEIBLER, I. 1995Griechische Töpferkunst. Herstellung, Handel und Gebrauch der antiken Tongefäße.2 München .
TERÞAN, B. – SCHIAVI, F. L. – TRAMPUÞ-OREL, N. 1984Most na Soèi (S. Lucia) II. Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Tafelband. Kat. in Monogr. 23/2Ljubljana.
TERÞAN, B. – SCHIAVI, F. L. – TRAMPUÞ-OREL, N. 1985Most na Soèi (S. Lucia) II. Die Ausgrabungen von J. Szombathy. Text. Kat. in Monogr. 23/1Ljubljana.
VOSSEN, R. 1990Reisen zu Marokkos Töpfern. Forschungsreisen 1980 und 1987. Wegweiser zur Völkerkunde 36.Hamburg.
WEHGARTNER, I. 1995Keramik vom Münsterberg in Breisach. In: Luxusgeschirr keltischer Fürsten. Griechische Keramiknördlich der Alpen. Ausstellungskatalog des Mainfränkischen Museums Würzburg. Mainfränk.
H. 93, 136–137. Würzburg.
Der Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi 39
I n h a l t
Vorwort .................................................................................................................................................. 7
KATALIN ALMÁSSYSome new data on the Scythian-Celtic relationship ......................................................................... 9
INES BALZERDer Breisacher Münsterberg zwischen Mont Lassois und Most na Soèi ....................................... 27
CLARISSA BELARDELLIZur Bedeutung von Ost-West-Beziehungen zwischen Griechenland und Italienwährend der Urbanisierung der Apenninhalbinsel am Anfang der frühen Eisenzeit .................... 41
JOCHEN BRANDTDie Latènisierung der Jastorfkultur.Kulturkontakt als Folge germanischer Raum-Zeit-Konzeptionen ................................................ 51
JÁNOS GÖMÖRIEin Grab der Osthallstattkultur mit Kultwagen aus Fertõendréd (Kom. Sopron, Ungarn) ........... 61
FRANZISKA HEIMANNKontakte in der Späthallstattzeit.Soziale und chorologische Untersuchungen zu Paukenfibelnund deren Auswirkung auf die chronologische Bewertung der Späthallstattzeit .......................... 75
RAIMUND KARLLern’ ‘was G’scheit’s im fremden Land, Bub! ............................................................................... 87
JUTTA KNEISELDie Gesichtsurnen und ihre Verbindungen nach Nord-, Mittel- und Südeuropa.Untersuchungen zur Bilderwelt der pommerschen Kultur .......................................................... 107
THOMAS KNOPFAmphorenimport im Oppidum Heidengraben.Chronologische und kulturhistorische Aspekte ........................................................................... 127
JULIA KATHARINA KOCHFrüheisenzeitliche Reitergräber zwischen Ost- und Westhallstattkreis ...................................... 139
ANGELA KREUZ – JULIAN WIETHOLDArchäobotanische Ergebnisse der eisen- und kaiserzeitlichen Siedlung Mardorf 23,Lkr. Marburg-Biedenkopf. Hinweise auf kulturelle Beziehungen nach Süden und Norden ...... 151
PIOTR £UCZKIEWICZDie spätlatènezeitlichen Trinkhornbeschläge.Zeugnisse germanischer Einflüsse im keltischen Gebiet? ........................................................... 165
J. VINCENT S. MEGAW – M. RUTH MEGAWEast and West in Early Celtic Art. The First Stages Once More Reviewed ................................. 183
CAROLA METZNER-NEBELSICKPhänomene und Ursachen kulturellen Wandels durch östliche Beziehungenam Beginn der Eisenzeit in Europa ............................................................................................... 207
SVEN OSTRITZBeziehungen zwischen dem nordischen Kreis und der Mittelgebirgszonewährend der späten Hallstattzeit – untersucht anhand der Wendelringe ..................................... 225
PETER C. RAMSLVerbindende Randzonen des Karpatenbeckens in der Frühlatènezeit ........................................ 241
MARTIN SCHÖNFELDERDie Wagen von Dejbjerg. Import, Umwandlung und Anregung ................................................. 257
JENS SCHULZE-FORSTEROst-West-Beziehungen am Mittel- und Niederrhein in der mittleren und späten Latènezeit ..... 269
THOMAS STÖLLNERKontakt, Mobilität und Kulturwandel im Frühlatènekreis –das Beispiel Frühlatènegürtelhaken ............................................................................................. 277
ROBERTO TARPINIFrühe Formen figuraler Kunst nördlich und südlich der Alpen ................................................... 321
PETER TREBSCHEUntersuchungen zu Reichweite und Bedeutung von Kontakten in der Spätlatènezeitanhand der Feinkammstrich-Keramik ......................................................................................... 333
Anschriften der Verfasser .................................................................................................................. 349