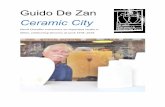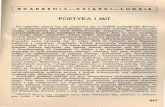guido graf gespräche mit - HilDok
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of guido graf gespräche mit - HilDok
theoriender
literatur
guido graf
theorie und praxis 1theorie und praxis gespräche mit
Wir schreiben, lesen, erzählen, sprechen,experimentieren, forschen und lehren. Wirbewegen uns durch literarischeProduktionsräume, erproben Techniken undFormen. Wir beobachten dieGegenwartsliteratur, ihre Entstehung,Vermittlung und Rezeption. Wir erschließenKontexte der Jetztzeit. In dieserSchriftenreihe buchstabieren wir Methoden,Poetiken, Werkprozesse und Inszenierungendes literarischen Schreibens durch.Regelmäßig erscheinen neue Bände, diesich essayistisch, literarisch oder auchwissenschaftlich mit den für dasLiteraturinstitut Hildesheim zentralenFragen auseinandersetzen.
armen avanessianmarcel beyer
ulrich blumenbachjan drees
anke hennigannette pehntsimon roloffsylvia sasse
ulf stolterfohtjacob teichanja utler
senthuran varatharajahuljana wolf
guidograf
theoriender literatur
Guido Graf
Theorien der LiteraturGespräche mit
Armen Avanessian, Marcel Beyer,Ulrich Blumenbach, Jan Drees,Anke Hennig, Annette Pehnt,Simon Roloff, Sylvia Sasse,
Jacob Teich, Anja Utler,Senthuran Varatharajah,
Uljana Wolf
DasWerk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwer-tung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts-gesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Überset-zungen,Mikroverfilmungen und die Einspeicherungund Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Pu-blikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detail-lierte bibliografische Daten sind im Internet über http://
dnb.d-nb.de abrufbar.
Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
Satz und Layout: Guido GrafUmschlaggestaltung: Antje Schroeder,Walsrode
Herstellung: buch.one. Offsetdruckerei Karl GrammlichGmbH, 72124 PliezhausenPrinted in Germany
© Universitätsverlag Hildesheim, Hildesheim 2021
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 978−3−96424−051−4
ISSN (Print): 2750−4077
ISSN (Online): 2750−4085
Dieses Werk steht auch als elektronische Publikation imInternet kostenfrei zur Verfügung: https://doi.org/
10.18442/193
Dieses Werk ist mit der Creative-Commons-Nutzungslizenz »Namensnennung – Nicht kommerziell
– Keine Bearbeitung 4.0 International« versehen.Weitere Informationen finden sich unter: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
legalcode.de
für Antje
6 7
Inhalt
Theorien der Literatur 9Guido Graf
Wie denkt Literatur? 17Gespräch mit Simon Roloff
Kann man Literatur rauchen? 33Gespräch mit Sylvia Sasse
Spekulative Poetik 53Gespräch mit Anke Hennig und Armen Avanessian
Do this Book or Die 67Gespräch mit Senthuran Varatharajah
falten flächen friktionen 95Im Gespräch mit Annette Pehnt
Dirty Bird Translation 111Im Gespräch mit Uljana Wolf
Wasimmerwitz 125Gespräch mit Ulrich Blumenbach
kommen sehen 141Gespräch mit Anja Utler
Am Rand der Sätze 155Im Gespräch mit Ulf Stolterfoht
Kritik in der Literatur 179Gespräch mit Jan Drees
Im Park 195Gespräch mit Jacob Teich
superfette SPRACHINSTALLATION. Thomas Kling 207Gespräch mit Marcel Beyer
8 9
Theorien der LiteraturGuido Graf
Der Titel ist irreführend. Es handelt sich um einen Etikettenschwin-del. Eine Strategie, die ich mir bei Didier Eribon ausgeliehen habe,dessen Buch Theorien der Literatur von 2015 mit Système du genre etverdicts sexuels untertitelt ist, Literatur also daraufhin betrachtet,wie sie mit Geschlechtlichkeit verfährt, wie sie Rollen codiert undvon geschlechtsspezifischen Sprachregistern codiert wird, wie siesich dieser Mechanismen entzieht, sie aushebelt und unterläuft, seitsie einfach weiß, dass es sich um Programmierungen und Codes han-delt. Einen Unterschied, den Eribon macht, kann man in dem einenBuchstaben finden,der imTitel den Plural markiert.Von Theorien derLiteratur in der Mehrzahl zu reden, betont das Potential von literari-schen Texten, als theoretische Botenstoffe zu fungieren, ohne dabeigleich immer auf einen schlüssigen Zusammenhang angewiesen zusein, der etwa über den Rahmen einer Erzählung hinausweist. In derLiteratur, die, wenn sie gelingt, immer mehr ist als die Summe ihrereinzelnen Teile,werden Vorstellungen von derWelt ausgedrückt, Ide-en finden Verbreitung in Form von Geschichten und Bildern. Dassdavon auch die Bildung von Geschlecht und Identität betroffen ist,sollte eigentlich eine banale Einsicht sein. Doch in Literaturwissen-schaft und ästhetischer Theorie sind da dicke Bretter zu bohren.Wie nun nicht nur das Denken der Sexualität in Erscheinung tritt,unter Bedingungen, die wir Literatur nennen, ergäbe eine gute undgroße Sammlung von entsprechenden Theorien, die in literarischerTextpraxis zeigen, wie sie zum ordnenden Prinzip einer poetischenLogikwerden.Dabei geht es z.B.weniger darum, etwa Figurenrede alsTheorie zu lesen. Denn Romane etwa inszenieren Figuren, die glau-ben, vor den Augen der anderen zu verbergen, was sie sind, währendalle anderen mit dem Wissen spielen, das sie Handlungsmacht überdiese Figuren besitzen.
»Er lässt sich keine Gelegenheit entgehen, dem Leser eine Theo-rie zu skizzieren, die zwar nicht als eine solche thematisiert wird,die zwar aus losen Fragmenten zu bestehen scheint, aus zusam-menhanglosen Bemerkungen,die über die Seiten hinweg inmehr
10 11
oder weniger sentenzieller, mehr oder weniger weihevollerWeiseheruntergebetet werden, die zwar eine spontane Theorie ist, eineProtoTheorie, deren Elemente mehr oder weniger kodifiziert,mehr oder weniger ernsthaft sind, und die eher einer langen, ob-sessiven und manchmal widersprüchlichen Plauderei gleicht alseiner gründlichen Reflexion, jedoch nichtsdestoweniger einenvon einem Homosexuellen gehaltenen Diskurs über die Homo-sexualität darstellt, der ganz und gar nicht dem entspricht, wasvom heterosexuellen Erzähler über jenen gesagt wird.«
Eribon bezieht sich hier auf Marcel Proust. Außer mit Proust befasster sich vor allem mit Jean Genet. Das muss für seine Theorien der Li-teratur reichen. Das literarische Wissen, das Eribon hier eigentlichbeobachtet, erzählt viel vom normativen Charakter des Geschlechts,von Wirkungen und Machtverteilungen, aber eben in Bezug auf Ho-mosexualität. Zweifellos legitim und überzeugend funktioniert die-ses Gender Reading, doch steht es letztlich auf zu schmaler Basis, umtatsächlich von Theorien der Literatur reden zu können. Eribon siehtdas durchaus selbst:
»Wir sehen also, dass das literarischeWerk dazu neigt, seine The-orie der Sexualität schon aufzulösen,während es sie noch errich-tet, sie schon zu dekonstruieren,während es sie noch konstruiert,oder genauer, dass ein theoretischer – oder pseudotheoretischer– Diskurs mit universellem Anspruch auf den Widerstand einesanderen theoretischen – oder pseudotheoretischen – Diskurses(oder mehrerer) trifft, die ihn in Frage stellen, ihn umgehen, insLeere laufen lassen, kurz gesagt: ihn zurückweisen, um anderevorzubringen. Zumindest könnte man das glauben, wenn manbei näherer Betrachtung nicht auch sähe, dass der beherrschte –von den Beherrschten selbst gehaltene – Diskurs in vielerlei Hin-sicht die Neigung hat, die „Schuldigen« wieder der Norm, derNormalität einzugliedern, um ihnen ein Entkommen aus jenerTheorie zu ermöglichen, die sie mit Verbissenheit zu pathologi-sieren, zu partikularisieren oder zu entnormalisieren versucht.“
Das könnte auch damit zusammenhängen, dass die Literatur keineTendenz hat, dieWelt theoretisch zu erfassen, Normalitäten zu erfin-den, sondern mit ihrer Eigendynamik eher Notwendigkeiten schafft,anders auf die Welt zu schauen, Kontexte herzustellen und ihr mittheoretischer Reflexion zu begegnen.Einen blinden Fleck schafft sichEribon aber vor allem dadurch, dass er,was die literarischen Texte be-trifft, allein von männlicher Homosexualität ausgeht und dann auchnoch von großen Schriftstellern. Dass er damit unbefragt einen klas-sischen Topos geschlechtsspezifischer Literaturgeschichtsschreibungübernimmt, kommt Eribon nicht in den Sinn.Weibliche Texte finden
imwichtigsten Kapitel des schmalen Buches Eingang in den Diskurs.Es sind Theoretikerinnen wie Simone de Beauvoir und Judith Butler,auf die sich Eribon bezieht, wenn er nach Konsequenzen sucht ausder Diagnose, dass im theoretischen Wissen literarischer Texte einegehörige Sprengkraft liegt für die Fiktionen der Geschlechtlichkeit,mit denen unser alltägliches Leben strukturiert wird. Da kommt Eri-bon schließlich auch wieder auf das Thema, das er in seinem so er-folgreichen Buch Rückkehr nach Reims verfolgt hat: die Suche nacheinemWiderstand gegen gesellschaftliche und damit auch individu-elle Machtsysteme, der in der komplizenhaften, symbolischen Naturliterarischen Schaffens wiederzufinden ist.Theorien werden auch in dem vorliegenden Buch, das Gespräche mitAutor:innen, Wissenschaftler:innen, und Buchmacher:innen um-fasst, nicht im Sinne einer intellektualistischen Konzeptualisierungverstanden. Es geht weder darum, Literaturtheorien aufzustellenoder sie vorzustellen, noch zu behaupten, Schriftsteller seien Soziolo-gen oder Philosophen, die akademisches Wissen produzieren wollen.Der Plural erlaubt ganz verschiedene Auffassungen von Autor:innenoder innerhalb eines komplexenWerkes zuzulassen und zu kontextu-alisieren. Wirklichkeits- und Textwahrnehmungen spielen dabeiebenso eine Rolle wie existentiellen Einblicke in die diskursive litera-rische Praxis und Produktion. Innerhalb solcher Praxis können Theo-rien nicht nur stattfinden, sondern auch miteinander kollidieren.Die Gespräche sollen zur Objektivierung der Diskurse beitragen. Diein der literarischen Textpraxis geschriebenen und damit prozessier-ten Theorien ähneln den Saiten eines Musikinstruments, die zwarvoneinander getrennt sind, aber alle an derselben Melodie beteiligtsind. Diesen Theorien liegt eine fundamentale Instabilität zugrunde,die nicht nur widersprüchlich durch die Pluralität der Schreib- undDenkweisen wirkt, sondern auch implizit wie explizit die Autoritätmachtvoller Gesten über Schreiben und Lesen untergräbt. Damitwerden diese Theorien der Literatur, also diejenigen, die der Literaturangehören, auch der Pluralität von Identitäten und der Multidimen-sionalität der sozialen Welt gerecht. Das schreibende Selbst weicht,ganz der prozessualen Logik Roland Barthes’ folgend, dem Momentdes Schreibens als dem Ort für Widerstand und Dissens gegenüberder Vorstellung, der theoretische Akt könne Standards literarischerPraxis konsolidieren. Vielmehr zeigen die Gespräche in diesem Band,wie solche literarische Praxis immer auch Wissenspraxis bedeutetund Erkenntnisformen herstellt.Theorien der Literatur in der hier praktizierten Mehrzahl richten ihrInteresse weniger auf das ‘Was’ der Literatur, sondern auf das ‘Wie’.Hier über Literatur zu sprechen, heißt Produktions- und Denkweisen
Theorien der Literatur Theorien der Literatur
12 13
der Literatur in einem Zusammenhang zu sehen. Diese Perspektivenmischen Theorien und Methoden und wissen einigermaßen, was siemischen, aber nicht, was dabei herauskommt. Deshalb bestand dasInteresse der Gespräche zunächst darin, die Praktiken kennenzuler-nen, sie als mögliche Methoden zu identifizieren und sich ihre An-wendung vorstellen zu können. Epistemologisch ist damit noch nichtviel geleistet. Intention war aber auch nicht, Theoriebildung für neusynthetisierte Methoden zu betreiben.Vielmehr geht es nach wie vordarum, methodische und theoretische Gewissheiten, so sie nochexistieren, in Frage zu stellen.Das Vorgehen kann sich in Form von Appropriationen, Adaptionenoder Amalgamierungen realisieren. In jedem Fall aber wird theoreti-sches Wissen als Konvention sichtbar, die in einem spezifischen his-torischen, sozialen und materialen Kontext relative Gültigkeit bean-spruchen kann, zugleich aber deutlichmacht, dass es notwendigwer-den könnte, sich dieser Konvention zu entledigen. Das weist daraufhin, dass Methoden und Praktiken des literarischen Feldes nach denmoralischen Überhöhungsperspektiven und nach den unterwerfen-den Wahrheitsentfaltungen vergangener Epochen immer gerade soviel Wissen produzieren, wie für die nächste Lektüre notwendig ist.Wir trainieren also immer im Resonanzraum solcher Latenz, dieihren Gegenstand kontaminiert. Der Modus der Latenz ist ebensohistorisch definiert und in hermeneutischen Traditionen verhaftetwie dekodierende oder dem Ethos derWahrheit sich verpflichtet füh-lende Lektüren. Das Unverfügbare der Bedeutung wurde (und wird)als Transzendenz, höhere Ordnung und sinngebende Struktur ent-worfen. Insofern das Heilige und Unantastbare in der Annahme einerWirklichkeit gründet, der eine Dimension des Unverfügbaren zuge-schrieben wird und die zugleich ein spezifisches Spektrum der Refle-xion, des Handelns und der Überformungmit dem Ziel der Initiation,der Widmung oder des Heilens ermöglichen soll, neigt es stets auchzu einer Struktur von Latenz.Wir erkennen darin ein grundlegendesPrinzip kultureller Formationen und textueller Verfahren: In den Er-scheinungen von Kultur und Bedeutung verdecken sich die Verfahrenihrer Produktion und sind doch latent zu lesen. Kulturelle Phänome-ne wie etwa Texte haben demnach eine Tiefenstruktur.Texte sind wahr in ihrer möglichen Unwahrheit und wir arbeiten,wenn wir schreiben und lesen, mit grobem und auch feinem Werk-zeug, indemwir Schneisen schlagen, Spuren sichern und auchwiederverwischen und uns literarischer Praxis als derMöglichkeitsform vonLiteratur versichern.Wo sich etwas offenbart, muss etwas verborgensein, auch wenn das Verborgene nicht verfügbar ist. Von Trassierungspricht etwa Anselm Haverkamp und der Ausdruck zeugt noch von
der traditionellen Gewalttätigkeit der hermeneutischenWut des Ver-stehens, gleichwohl er in seiner depersonalisierten Verwendung aufdie Prozessualität dieser interpretatorischen Paradoxie verweist. AlsProzessualität möchte ich beschreiben,was sich in derMischung die-ser Gespräche wie auch in der Diskursivität des Wissens zeigen lässt,in der uns literarische Praxis und ihre Theorien verfügbar werden.Wir lernen und bemühen uns mehr um Ausdifferenzierung und Er-weiterung denn umAusschließung und Dominanz. Denn wir erlebendie Literatur als ein ihrWissen verkörperndes Denken und Schreiben.Wir denken in der Literatur,mit der Literatur und durch die Literatur.Wir beobachten sie als Geste, als Handlung und als Ding, das einePraxis hergestellt hat. Was Werk genannt wurde, zeigt sich als Kon-stellation. In dieser szenischen Streuung stellt sie ein Medium dar,indem sich die Praktiken »dieser Trassierung, Spurensicherung undVerwischung« (Haverkamp) entfalten.Es geht, wie gesagt, nicht um eine Theorie, sondern um Pluralität.Darüber hinaus kann die Literatur in den Theorien der Literatur alsProdukt der Theorien verstanden werden, als ihr Ausdruck. Es sindaber auch Theorien, die der Literatur gehören, die Theorien der Lite-ratur in der Theorie, Literatur als Theorie, Literatur, die sich ihrerselbst bewußt ist, ihrer eigenen Mechaniken, Bedingungen et cetera,die sie ausstellt, in Szene setzt und somit immer auch ihre Theoriebeinhaltet. Das »begriffslose Denken« (Daniel Falb) der Literatur,ihre innere Reflexivität als theoretische wie literarische Praxis ver-standen lenkt den Fokus auf Peripherien und Überkreuzungen, in de-nen in denen die autorschaftliche Subjektkonstitution zugunsten ei-ner größeren Durchlässigkeit und zugunsten ihrer Minorisierungund Multiplikation aufgelöst wird. Werden, klein werden, viele wer-den: Das sind die Bewegungen gegen Formen der Dominanz, als eineIch-Behauptung, die zugleich Selbst-Dekonstruktion betreibt. DieGleichzeitigkeit und die Konjunktion »und«, die das Verbindendeund das Trennende in eins denken, entscheiden, dass die Theorieohne Praxis nicht zu haben ist und die Praxis nicht ohne Theorie.Dasist wegweisend für Theorien der Literatur, die sich auch als eine sozi-ale Poetik verstehen.
Dass diese Gespräche, als Vorlesungspodcast im ersten Pandemie-winter 2020/2021 und nachzuhören unter theorenderliteratur.de,möglich waren, verdanke ich Armen Avanessian, Ulrich Blumenbach,Jan Drees, Anke Hennig, Annette Pehnt, Simon Roloff, Sylvia Sasse,Ulf Stolterfoht, Jacob Teich, Anja Utler, Senthuran Varatharajah undUljanaWolf.
Theorien der Literatur Theorien der Literatur
14 1514 15
Theorien der Literatur Theorien der Literatur
Anmerkungen
Didier Eribon: Theorien der Literatur.Wien: Passagen,2019.
Dieter Mersch: »Ästhetisches Denken: Kunst alsTheoria«, in: Dieter Mersch, Sylvia Sasse, SandroZanetti (Hg.), Ästhetische Theorie. Berlin: Diaphanes,2019, S. 241−259.
16 1716 17
Wie denkt Literatur?Gespräch mit Simon Roloff
Um Suchbewegungen, um das Wegrutschen und um Unordnung, umdisorder geht es in diesen Theorien der Literatur, auch in diesem Ge-spräch, das ich mit Simon Roloff geführt habe. Simon Roloff war Juni-orprofessor am Literaturinstitut Hildesheim und ist jetzt Fellow ander Leuphana in Lüneburg. Simon Roloff ist Autor, Literatur- und Me-dienwissenschaftler. Er studierte an der Humboldt-Universität inBerlin sowie am Literaturinstitut Leipzig. Als Stipendiat des Gradu-ierten-Kollegs Mediale Historiographien promovierte er über RobertWalser. Im Zentrum seiner Arbeit stehen Fragen einer Kulturtech-niktheorie der Literatur, der politischen Literatur sowie des literari-schen Forschens. In Vorbereitung ist auch sein Buch Kunst-Bemü-hung. Wie ich ein kreatives Subjekt wurde. Aktuell verfolgt er einForschungsprojekt: Der simulierter Autor. Literatur als Datenverar-beitung. Darüber und was Literatur als Denken und als Forschungsein könnte, haben wir gesprochen.
Guido GrafSimon,was trinkst Du gerne?Simon RoloffIch hab mir einen Kaffee und einenWein hingestellt. Erst den Kaffee,damit wir am Anfang noch einigermaßen klar sprechen können. UnddenWein dann für den Rest,wenn es dann privat wird.Guido Graf:Ich habe eine Tasse mit Zitronenverbene.Simon RoloffAuch bestimmt anregend, denke ich.Guido GrafDu bist aktuell Fellow an der Leuphana in Lüneburg.Simon Roloff:Richtig.
18 19
hier entsteht Literatur und die hat ein bestimmten Kontext, der ge-nealogisch erforschbar ist. Es wird immer auf Herkünfte gesehen.Und da ist man dann schnell bei Nietzsche, der der Urheber des ge-nealogischen Denkens der Postmoderne ist.Guido GrafIch habe vor ein paar Jahren versucht, diesen Begriff der Schreib-Sze-ne auch auf den Begriff der Leseszene auszudehnen, und es hat sichdann getroffen, dass sich einige Leute aus dieser Forschung, die Mar-tin Stingelin, Sandro Zanetti, Davide Giuriato vor allem mitverant-worten, auch mit der digitalen Schreib-Szene beschäftigt haben. UndDu hast jetzt in Lüneburg ein Forschungsprojekt annonciert: der si-mulierte Autor. Heißt das, dass das,was da so kurz als Abriss zu lesenist, geradezu idealtypisch diese digitale Schreib-Szene ist?Simon RoloffIch kann zumindest andeuten, was mir bisher als sinnfällig erschie-nen ist. Es geht darum, Schreib-Szenenforschung auf Momente desDeep Learnings und der künstlichen Intelligenz anzuwenden. Es gibteinen ersten Roman, der tatsächlich von einer künstlichen Intelli-genz in dem Sinne verantwortet wurde, dass die Maschine im Copy-right mit genannt wird. Das Projekt ging auf einen amerikanischenMedienkünstler zurück, der in Zusammenarbeit mit Google Beat-Prosa und zwar konkret Jack Kerouacs On the Road in einer Art Re-Enactment mit KI nachgeschrieben hat – oder eigentlich nachgefah-ren ist –, indem er einen Computer in ein Auto gepackt hat,mit einerKamera oben auf dem Dach. Es gab auch Mikrofone, die die Gesprä-che der Insassen in dem Auto aufgezeichnet haben. Aus diesem Roh-material hat die KI dann einen Text entstehen lassen. Es wurde ver-sucht, Kerouacs Stil zu reproduzieren. Wie gut das funktioniert hat,ist eine andere Frage, aber das Experiment bestand auch eher darin,Literatur in ihrer Entstehung zu simulieren. Der Autor, der Mensch,der da programmiert, ist natürlich noch vorhanden.Der ist auchmit-gefahren. Aber der Text selbst ist dann aus Trainingsdaten entstan-den,mit denen die KI zuvor gefüttert wurde. Es lassen sich also Über-legungen zurAutorschaft und auch zu den rechtlichen Fragen anstel-len, die bei Autorschaft mit im Spiel sind.DerAutor,wiewir ihn heutekennen, ist eine juristische Konstruktion von 1800.Man wollte Autorsein, die eigene Literatur vermarkten, weil sich das zuvor gängigeMäzenatensystem aufgebraucht hatte. Das war aber nur möglich,weil es die juristische Form des Urhebers gab.Mit den Möglichkeitenvon künstlicher Intelligenz, eigene Texte zu verfassen, stellt sich nundie Frage: Was wird aus diesem Autorschaftskonzept? Mir scheintzum Beispiel, diese Szene, die ich skizziert habe,wäre ein Moment, indem sich neue Fragen der Urheberschaft von literarischen Texten
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
18 19
Guido Graf:Du wirst dort damit vorgestellt, dass Du Dich mit Fragen einer Kul-turtechniktheorie der Literatur beschäftigst. Kannst Du kurz erklä-ren,was man sich darunter eigentlich vorstellen kann?Simon RoloffDas berührt tatsächlich Literaturtheorie im weitesten Sinne. Wer»Kulturtechniktheorie der Literatur« gesagt hat, beschäftigt sichgrob gesagt mit so etwas wie Operationsketten, die Literatur hervor-bringen. Das kann im Sinne einer Hildesheimer Schreibprozessfor-schung sein. Das kann aber auch noch viel grundsätzlicher werden,indem man fragt, wie Literatur sich z.B. zu nicht-literarischen Auf-schreibesystemen verhält. Das war schon in meiner Dissertation derFall: Da habe ich mich über Robert Walsers Aufschreibepraktikenschlau gemacht, während er Literatur verfasst hat, und habe danneine Beziehung hergestellt zu Aufschreibepraktiken, die in Arbeitslo-sen-Institutionen seiner Zeit vollzogen wurden. Da ging es vor allemum das Aufschreiben des Lebens, im Fall Walsers als autobiografischeLiteratur, aber auch in der Erhebung von biopolitischen Daten dieserInstitutionen. Kulturtechniktheorie heißt grundsätzlich nur, dass esum eine besondere Art geht, auf Praktiken zu schauen und Literatureben nicht als einen hermetisches System,was einfach aus sich selbstheraus entsteht, zu begreifen, sondern es in einem kulturellen Kon-text zu verorten, der aber sehr technisch, vor allem auchmateriell ge-dacht ist.Guido GrafDas steht in einer Tradition, die an den Satz von Nietzsche anknüpft:»Das Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken«.Die Materiali-tät des Schreibens wird also einbezogen. Das, was Du jetzt in Bezugauf Robert Walser dargestellt hast, wäre eine Erweiterung auf allemöglichen anderen Faktoren, die sich noch dazu gesellen.Simon RoloffDas Schreibzeug selbst ist sehr wichtig. Kulturtechnik hat immer et-was mit konkreten Dingen und Techniken zu tun, aber es wird in die-sen theoretischen Rahmen auch darauf hingewiesen, dass Technikniemals alleine gilt, sondern z.B. in der Herkunft von literarischenSchreibverfahren aus den institutionellen Augschreibeverfahren ih-rer Zeit in ihrer genealogischen Herkunft zu erforschen wäre. WasMartin Stingelin mit der Schreib-Szene, einem Begriff, den RüdigerCampe geprägt hat, vor einigen Jahren thematisiert hat, würde auchauch darunter fallen. Auch wenn da nicht immer von Kulturtechnikdie Rede ist, kann man die Schreib-Szene kulturtechnisch adressie-ren. Und das heißt tatsächlich, historisch vorzugehen und zu sagen,
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
20 21
Gedanken, wie Du Nietzsche gerade zitiert hast. Er hat mit seinerSchreibmaschine damals schon gewusst, dass sich derText sofort ver-ändert, sobald man ein neues Schreibzeug hat. Das in verstärkterForm der Fall, wenn die Schreibmaschine nicht nur tippt, sondernauch tatsächlich kreiert und also viel stärker Einfluss auf den Textnimmt, als es damals der Fall gewesen ist.Guido GrafWir können jetzt die Brücke schlagen von dem Begriff der Autor-schaft, die ja oft in der Wissenschaft, in der Kritik sowieso und auchim alltäglichen Sprachgebrauch vor allem subjektbezogen verstan-denwird,hin zu einerAuffassung,die eher von einer Funktion sprichtund zwar in dem Sinne, dass Autorschaft eine Funktion darstellt sowie Sprache auch. Autorschaft wäre dann eine Funktion in einemHandlungszusammenhang, den man als als Klammer auch Literaturnennen kann.Was ich in dieser Vorlesung verfolge, ist eigentlich, die-sen Titel Theorien der Literatur mit zwei Akzenten zu versehen. Daseine ist der Plural. Es geht nicht um eine Theorie, sondern wir neh-men immer eine Pluralität an. Darüber hinaus möchte ich diese Ge-netivkonstruktion Theorien der Literatur auch als einen GenitivusSubjectivus verstehen. Die Theorien also, die der Literatur gehören,die Theorien der Literatur in der Theorie, Literatur als Theorie, Litera-tur, die sich ihrer selbst bewußt ist, ihrer eigenenMechaniken,Bedin-gungen et cetera, die sie ausstellt, in Szene setzt und somit immerauch ihre Theorie beinhaltet.Simon RoloffDas ist interessant, weil es ja darum geht: Welche Form von Wissenhat Literatur eigentlich? Das ist, wie Du sagst, immer auch ein Wis-sen, das immer die Literatur selbst betrifft, ihre eigene Herstellungoder ihre eigene Verfasstheit, ihr eigenen Grenzen vielleicht auch. Inder Schreibszenen-Forschung würde man annehmen, dass es dieMöglichkeit einer Selbstverständigung über den eigenen Entste-hungskontext in Literatur gibt.Aber ich würde sagen, dass es darüberhinausgeht. Literatur kann nicht nur über sich selbst nachdenken. Ichhabemich immer schon gerne damit befasst,welche Verknüpfung ei-gentlich zwischen Literatur und dem außerliterarischen Wissen be-steht, etwa zuwissenschaftlichen Diskursen.Wie verhalten sich diesebeidenMöglichkeiten der Beschreibung vonWelt zueinander? Es gibtAnsätze der sogenannten Poetologien des Wissens, die versucht ha-ben, innerhalb von historischen Untersuchungen auch Literatur ineinemWissensrahmen, zum Beispiel der Ökonomie oder der Biologiezu verorten. Nicht zu verwechseln ist das mit der Darstellung vonWissen in Literatur.
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
20 21
stellen. Im Fall des On-the-Road-Experiments, wäre meine Vermu-tung, dass die Urheberschaft zunächst mal bei Google liegt, weil de-nen eben die Technik gehört, auch die Deep-Learning-Software. Dasamerikanische Urheberschaftsrecht hat zum Beispiel überhaupt kei-ne Probleme damit, die Schöpfungshöhe für nichtmenschliche Perso-nen anzunehmen. Außerdem ist es auch sehr gut möglich, dass aufUnternehmen zu übertragen. Softwareunternehmen haben ein Co-pyright auf den Text, der als Code produziert wurde und sofern auchauf das, was die Software dann selbst als neue Codes produziert. Dassind die Fragen, die mich interessieren: Mit was für einem neuen Au-torschaftsbild haben wir es unter der Maßgabe zu tun, dass es sichimmer auch um schreibtechnische und auch juristische Fragen han-delt? Seit den 1960er Jahren tauchen Autorschaftsdiskurse auf, dieman historisch als Vorläufer dessen ansehen könnte, was wir heutehier präsent haben, auch als eine neue Herausforderung auch an denAutorschaftsbegriff der Germanistik.Guido GrafHeinrich Bosse hat 1981 das Buch Autorschaft ist Werkherrschaft ver-öffentlicht, eineAuseinandersetzungmit demBegriff des Autors oderder Autorin, der in einem juristischen Verständnis auch in der Litera-tur niederschlägt. Wenn man so kurz und prägnant konstatiert, wieDu es gesagt hast, dass Autorschaft heute zuallererst ein juristischerBegriff ist, könnte man dann genauso pointiert den Kurzschluss zie-hen, literaturwissenschaftlich, literaturtheoretisch über Autorschaftnachzudenken, ist damit hinfällig?Simon RoloffIch glaube nur, dass es an der Zeit wäre für Literaturwissenschaft,über etwas wie verteilte Autorschaft nachzudenken. Zum Beispielwerden Kollaborationspraktikenmit K.I.wichtiger in Zukunftwerdenund dafür gibt es ja auch Vorläufer – und das ist noch eine andereSpur, die ich vielleicht verfolgen würde, in konzeptueller Literaturoder im generischen Schreiben. Da kann man nicht von einer künst-lichen Intelligenz sprechen, aber dawird natürlich sehr starkmit Ver-fahren, Konzepten und Algorithmen gearbeitet, die tendenziell dieUrheberschaft des Textes wegrücken von dem einen Menschen, derda sitzt und eine göttliche Eingebung hat. Ich bin kein Literaturtheo-retiker, der das soweit tragenmöchte, aber zumindest,wennman dasgenealogisch aufzieht, gibt es guten Grund, den Autorschaftsbegriff,auf den die Germanistik seit 200 Jahren aufbaut, zumindest in Zwei-fel zu ziehen und sich bei bestimmten Texten nochmal zu vergewis-sern, ob nicht das ganze System des Schreibens, auch die Materialitätdes Schreibens, mit einbezogen werden sollte, sobald man über dieUrheberschaft von Texten spricht. Schreibzeug schreibt mit an den
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
22 23
Guido GrafAlso etwa: Daniel Kehlmann erzählt von Humboldt und Gauß.Simon RoloffJa, genau. Richard Powers ist ein anderes Beispiel, der sich sehr ele-gant und mit einem tatsächlich unglaublichenWissen innerhalb vonLiteratur als Physiker inszeniert. Zu fragen wäre darüber hinaus, wieLiteraturWissen in ihrer Form oder vielleicht auch in ihrem Produk-tionsprozess verhandelt. Hier finde ich auch den Text von DieterMersch interessant,wo es um die Theoria als Denken der Kunst geht.Was ist, fragt er, wirklich ein Wissen, das es innerhalb der Kunst gibtund das nur innerhalb der Kunst verhandelt werden kann. Seine Vor-sicht gegenüber der Artistic Research in einer heute sehr gängigenForm ist ja die, dass man versucht Kunst oder ästhetische Formen aufpositiv vorhandenes, gesellschaftstheoretisches oder naturwissen-schaftliches Wissen herunterzubrechen. Dann stellt sich ja die Frage:Wozu braucht man das eigentlich?Wennman das genauso gut inner-halb von einem Experiment oder innerhalb einer sozialwissenschaft-lichen Dissertation verhandeln kann, wieso braucht man dann nochein künstlerisches Arbeiten dazu? Wenn es das ist, was dort festge-stellt oder dargestellt wird, wenn man es rein diskursiv reduzierenkann auf das,was abgebildet wird. Bei Mersch wird in der Kunst eineForm von Konjunktionalität hervorgekehrt, also eine Form von Mon-tage, die erst mal unlogische und nicht vollkommen transparenteVerbindungen herstellen kann. Ich hatte etwas Probleme, das auf Li-teratur anzuwenden. Aber bestimmte Formen von Literatur kannman natürlich auch über die Kunsttheorie adressieren, zum Beispielkonzeptuelles Schreiben oder auch Lyrik.Gerade die Gegenwartslyrikist sehr von der Gegenwartskunst her informiert und lässt sich inso-fern auchmit der Kunsttheorie ganz gut adressieren.Abermir schien,dass doch einige genuin literarische Praktiken undMöglichkeiten beiMersch gar nicht vorkommen können, also zum Beispiel das Erzählenals eine Praxis, die für die Literatur wichtiger ist als in den Künsten.Oder auch in den Möglichkeiten, bestimmte Formen von Subjektivi-tät in ihrer eigenen Verfertigung abzubilden, also Subjektivität alsMeta-Prozess des Verfassens einer Ich-Perspektive zu adressieren.Wennman da in die Feinheiten reingeht, ergeben sichMöglichkeiten,literarisches Forschen oder eine Formvon Literaturtheorie, die ein ei-genesWissen herstellt, genauer abzubilden.Guido GrafIch würde gern noch mal zu Richard Powers kommen und zu seinemfrühen Roman The Gold Bug Variations. Der scheint mir ein gutesBeispiel zu sein für das, was Du eben beschrieben hast, für dieses in-nerliterarische Wissen oder das, was die Praxis der Literatur als Wis-
sen fundiert, das eine gewisse Kongruenz mit einem außerliterari-schen, diskursivenWissen eingehen kann.Goldbug Variations ist 1991erschienen. Dieser Titel – The Goldbug Variations – weist eigentlichschon auf etwas hin, was Powers immer wieder macht, also eine Par-allelstruktur aufzubauen, die hier schon im Titel gegeben ist.The Bugverweist auf Poe und dann spielen die Goldberg-Variationen vonBach eine gewichtige Rolle. Powers erzählt in diesem Roman, auch ineiner Parallelaktion, wie sie so typisch ist für seine Bücher, eine Ge-schichte, die in den frühen fünfziger Jahren des 20. Jahrhundertsspielt und dann in der Gegenwart, hier also in den späten 80er Jahrendes 20. Jahrhunderts. In dieser Fünfzigerjahre-Episode geht es um ei-nen jungen Mikrobiologen, der versucht, das menschliche Genom zuentschlüsseln. Er ist in eine Kollegin verliebt, die verheiratet ist. Siehat zum Geburtstag die erste Einspielung der Goldberg-Variationendurch Glenn Gould geschenkt. Er hört das viele Male beschäftigt sichdamit und kommt dann darauf , dass in diesen Buchstabenkombina-tionen, die in Bachs Fugen-Struktur wirksam sind, der Schlüssel fürdie Genom-Entschlüsselung zu finden wäre. Die Liebe bleibt unglü-cklich und man hat danach nie wiederwas von diesemMenschen ge-hört. In der Gegenwartserzählebene gibt es wieder ein junges Paar.Die haben von diesemMenschen gehört und forschen ihm nach. Dassind diese beiden Geschichten. Das spannende jetzt aber ist, dass derganze Roman gebaut ist wie die Goldberg-Variationen selbst auch:Arie, Fuge und Variation. Das geht so weit, dass Powers die Länge derKapitel genau berechnet hat, wie lang sie in Relation zu der Kompo-sition Bachs sein müssen. Was etwa eine Übersetzung ins Deutschegehörige Schwierigkeiten verursacht,weil sie auch mathematisch ar-beitenmuss,um auf das auf in der anderen Sprachewieder herzustel-len. Hier wird die theoria im Roman maßgeblich durch die Form unddie Sprache gebildet.Simon RoloffDas heißt, es gibt so etwas wie ein Abbildungsverhältnis zwischenForm und dem in der Literatur verhandeltenWissen. Ist es eineAbbil-dungsverhältnis oder ein Repräsentationsverhältnis? Bei Mersch fin-de ich sympathisch, dass es eigentlich um eine Form von Überschussgeht, also auch um etwas, was eigentlich gar nicht benannt werdenkann. Ein nicht-propositionales Wissen, was sich auch nicht als Wis-sen in dem Sinne,wie wir es als Wissen zu adressieren gewohnt sind,enthüllen würde, wenn wir darüber sprechen. Das ist vielleicht auchder dunkle und mystische Teil dieses Textes. Oder es gibt eine sofortsich anschließende Frage: Was wäre es denn dann genau? Ist es dannüberhaupt noch Wissen? Oder ist es nicht etwas ganz anderes? Aberzumindest scheint mir bei ihm, dass er nicht von einem Abbildungs-
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
24 25
verhältnis zwischen dem Wissen und der Form ausgeht. Sondern esist etwas, was der Form dessen, was als Wissen zumindest vorder-gründig aufgeführt wird, funktioniert. Das wäre fürmich ein Ansatz-punkt bei Mersch, den ich auch interessant finde. Ich habe von AnnaLoewenhaupt Tsing Der Pilz am Ende der Welt gelesen. Eine Anthro-pologin, schon etwas älter, hat ein Buch geschrieben über denMatsutake-Pilz, der das Erste war, was nach dem Atombombenab-wurf in Hiroshima dort gewachsen ist. Sie erzählt eine Theorie desglobalen Kapitalismus anhand dieses einen kleinen Gewächses, daseine Delikatesse in Japan ist, und der Wirtschaftskreisläufe, die dadran hängen. Entscheidend ist aber eigentlich – und das ist derGrund,weshalb sie für Fragen nach demWissen der Literatur interes-sant ist –, dass sie eine sehr unwissenschaftliche Form für ihr Buchgewählt hat, wie das manche Anthropologen immer wieder gernemachen.Diese Versuche gibt es schon seit den seit den 1960er Jahren,weil sich ein bestimmtes Wissen auch nur begrenzt benennen lässtinnerhalb eines wissenschaftlichen Diskurses. Loewenhaupt Tsingversucht, Narrative, die immer nur Fortschrittsnarrative werden, auf-zubrechen durch die Art ihres Schreibens. Das geschieht in Minia-turessays, die sich immer auch der letztgültigen Herstellung eines ar-gumentativen Zusammenhangs verweigern. Das ist ein ganz ent-scheidendes Moment dieses Buches, für mich zumindest, gewesen,wo man zumindest sagen könnte: hier tritt das Schreiben in einenprekären Zusammenhang mit dem in ihm verhandelten Wissen.Wenn man dieses Buch auch als ein literarisches Buch begreift, was,glaube ich, möglich ist, dann tritt Literatur hier zum Wissen in einsich gegenseitig aufhebendes oder auch hinterfragendes Verhältnis.Daswäre eineMöglichkeit, dieses Verhältnis nicht als Abbildungsver-hältnis zu begreifen. Das sind die Formen des Prekären, des Unsiche-ren oder des Fragenden und Suchenden. Ein Wissen also, das ebennicht sagt: so ist es, sondern eher sagt, so könnte es sein. Es bewegtund verortet sich auch in einem bestimmten Möglichkeitssinn und-raum. Da erscheint mir Literatur ihre Stärken zu haben, in Vieldeu-tigkeiten und ja, vielleicht auch riskanten Versuchen der Herstellungeines Zusammenhangs.Guido GrafDas Buch ist ein Beispiel dafür,worauf Mersch von Anfang an seinenAkzent legt. Und dieses konjunktionelle Denken, also Verbindungenund Montagen herzustellen macht Loewenhaupt Tsing permanent.Sie erzählt in der Ich-Form, verbindet Recherchen kreuz und quermiteinander, beschreibt und erzählt aber auch. Dabei handelt es sichimmer um ein montiertes Erzählen, das wiederum auch mit dem Pilzselbst korrespondiert,mit der Verbreitung dieses Pilzes und auch mit
den Praktiken, die sie etwa für die Wälder von Oregon imWesten derUSA beschreibt, wo diese Pilze sich auch verbreitet haben. Auf einerdeskriptiven Ebene korrespondiert das mit der Art undWeise,wie siedavon erzählt. Verbindend und trennend ist auch der Akzent, denMersch setzt, um zu verdeutlichen, was eigentlich eine Konjunktionist, was der Unterschied ist zwischen einem »sowohl als auch« odereinem »und« oder einem »oder«. Tsing setzt etwas zusammen undzeigt zugleich, wie sie es zusammensetzt. Dadurch wird wiederumdas Ruinöse des Kapitalismus, von dem sie erzählt, erst deutlich.Wo-her kommt eigentlich diese Tradition der Unterscheidung von Litera-tur oder literarischer Praxis undWissen oderWissenschaft?Simon RoloffDafür gibt es natürlich wissenschaftshistorische Gründe. Es gibt dieTrennung zwischen verschiedenen Wissenschaftsformen, den Hu-manities und den Naturwissenschaften, die sich im 19. Jahrhundertvollzogen hat. Es werden Zuständigkeiten geklärt, bestimmte Wis-sensformen bevorzugt oder als objektiv beschrieben. Und natürlichwerden damit auch Machtpositionen zwischen den Wissenschafteneingezogen, Zuständigkeiten zwischen Kunst und Wissenschaft wer-den neu verteilt.Teil der Problematik der artistic research scheint mirzu sein, der Kunst aufzubürden, ein sehr positivistisch gedachtesWissen auch noch einholen zu müssen und dafür zuständig zu sein.Das scheint mir nicht nur eine Überforderung der meisten Künst-ler:innen und auch ihrer Werke zu sein. Es wäre absurd, gerade hierein Zurückgehen hinter die ursprünglichen Teilungen vorzunehmen.Das ist nicht der Weg. Es müsste eher darum gehen, verschiedeneWissensformen in ihrer Besonderheit so zu legitimieren, dass esnicht nur das eine objektive naturwissenschaftlicheWissen gibt, son-dern auch, wie schon länger in der Anthropologie und der Ethnogra-phie von einem Wissen zu sprechen, wenn es um eine eigene Formvon Philosophie geht, eine eigene Art zu denken. Bei Hubert Fichtegibt es diese Ansätze schon in den 1960er Jahren. Da wird zum Bei-spiel die afrikanische Psychiatrie, die natürlich kein Psychiater in Eu-ropa als solche zur Kenntnis genommen hat, als eine genuine Wis-sensform beschrieben. Nicht, dass europäische Literatur und afrika-nisches Denken jemals dasselbe gewesen wären, aber es könnte fürein literarisches Forschen darum gehen, Spezifizitäten von Wissens-formen auszuzeichnen und hier erst mal keine Hierarchisierung vor-zunehmen.Wenn es überhaupt um so etwas wie Revision geht, dannWissensformen, die außerhalb von Objektivität und naturwissen-schaftlichem Wissen sind, auch außerhalb der Geisteswissenschaf-ten,wirklich als Wissensformen zu begreifen.
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
26 27
Guido GrafMersch sagt es in seinemText nicht explizit, aber es geht doch darum,die literarische Praxis in ihr Recht treten zu lassen. Ihm ist nicht dieFrage wichtig, was Kunst oder Literatur wissen? Es muss vielmehrheißen: Wie weiß Literatur? Es kommt auf die Verfahren an, auf diePraxis, auf die Medialität der Literatur. Damit wären wir wieder beimAusgangspunkt Deines Forschungsprojektes, wenn man sich idealeBedingungen einer solchen literarischen Praxis anschaut und dann,wie sie sich realisiert. Gegenüber einem Diskurs, gegenüber Thesenund Argumenten wird eine ästhetische Erkenntnis initiiert, ein Den-ken, das in der Praxis verkörpert und gezeigt wird.Simon RoloffIch bin in meinem Buch davon weggekommen, Kapitel über vierzigSeiten mit einer Stimme durcherzählen zu wollen. Also habe ich ver-sucht, kleinere Abschnitte daraus zu machen, Theorie mit Beschrei-bung gegenzuschneiden, dann auch kleinere generische Gedichteeinzustreuen, um in dem Moment auch eine Art Vielstimmigkeitmeiner selbst zu erzeugen. Ich wollte auch gar nicht das einzige In-terpretationszentrum dessen sein, sondern wollte Möglichkeiten fin-den,mich auch zu verlassen oder zu dezentrieren in bestimmtenMo-menten. Und da scheinen mir diese unendlichen Möglichkeiten, dieLiteratur hat, um Subjektivität herzustellen und in ihrer Herstellungvor allem auch zu reflektieren, für einen wissenschaftlichen Diskursbereichernd zu sein. Nicht in dem Sinne, dass sie reduziert werdenmuss auf eine sozialwissenschaftlichen Untersuchung, sondern dasssie auch das wissenschaftlich denkende, das interpretierende Subjektdezentrieren kann. Sie vermag eine zweite oder dritte oder vierteStimme an die Hand zu geben,mit der noch anderes verhandelt wer-den kann, weiter gesprochen werden kann, wo eigentlich schon dersozialtheoretische oder der kulturtheoretische Diskurs verstummenmüsste, weil er hier nicht mehr sprechen kann. Das wäre eine Mög-lichkeit, wo mir literarisches Schreiben eine Rolle zu haben scheintfür Forschung, für das forschende Subjekt als Hilfestellung und nichtso sehr als eine vollständige Transformation, die stattfinden muss,sondern eigentlich eher als etwas,was hinzukommt.Guido GrafDie Probe, die man eigentlich immer machen kann, um herauszufin-den, inwiefern es sich um Literatur handelt oder um Diskurs, z.B. umirgendeinen verkappten Essay oder dergleichen – es gibt ja in allenmöglichen Feldern den Versuch, Sachverhalte in Form einer Erzäh-lung, in einem Roman zu erzählen wie einen Managementberater alsHeldengeschichte – zielt auf einen Überschuss: Entweder die Summeder einzelnen Teile ist mehr als die einzelnen Teile oder nicht.
Simon RoloffRichtig. In dieser Konjunktion, wie Mersch das nennt — oder mankann das auch literarische Montage nennen —, ist man im literari-schen Diskurs. Entsteht darin eigentlich nochmal etwas, was viel-leicht nicht benennbar ist, in einem wissenschaftlichen Diskurs? Istda vielleicht etwas aufgehoben,was nicht möglich ist oderwas unge-sagt bleibt in diesen Diskursen? Mit diesen Management-Ratgebernhabe ich ein konzeptuelles Gedicht gemacht. Ich habe das Sprachma-terial von Improvisationsratgebern genommen und alle Sätze mit«müssen» herausgefiltert und dann der Länge nach geordnet. Wasdabei herauskam, war – ohne dass ich es wollte – tatsächlich dannschon ein Mehr als das, was ich selbst hereingegeben hatte. Ich hatteschon die Idee, keine Imperative zu setzen, sondern wollte sehen,wieimperativ ist das eigentlich gedacht, in welchem Befehlston ist esdann doch gehalten, diese scheinbare Freiheit der Improvisation?Aberwas dabei herauskommt, ist z.B., dass der Schlusssatz dieses Tex-tes ein wahnsinniger Zeitdruck ist, in dem alles stattfindet, in demalles stattfindenmuss.Da ist etwas,was nicht unbedingt gesagt wird,aber was immermitschwingt in diesen Ratgebern.Warum aber über-haupt improvisieren? Warum soll Management improvisieren? Dashat damit zu tun, dass die Produktionslinien enger werden und etwain Software-Produktion bestimmte Sachen sehr unter Zeitdruckstattfinden. Genau das ist im Gedicht durch das Filtern dieser Sätzegut herausgekommen. Hier entsteht etwas, was man nicht generellbenennen kann, wenn man es nur diskursiv untersucht, sondern esentsteht tatsächlich durch die Form, in derman mit der Sprache um-geht.Guido GrafEs kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, auf den Mersch hinweist,dass nämlich die Literatur, die literarische Praxis immer auch aufsich selber verweisen, und der Aggregatzustand von Literatur auchReflexivität wäre, so dass in einer literarischen Praxis immer dieserModus der Selbstreflexivität immanent ist.Simon RoloffJa, das sagt er für die Kunst.Wennman sich Poetik ansieht, ist das seitRoman Jakobson das,was Literatur ausmacht. Das ist die Selbstrefle-xivität des literarischen Zeichens, das Opakwerden eines Zeichens,das Sich-selbst-thematisieren als Zeichen, vielleicht auch eine Laut-lichkeit, die in den Vordergrund tritt, während sie in der normalensprachlichen Botschaft ja eigentlich eher rausgehalten werden muss,weil die Botschaft ankommen soll. Wenn ich einen Satz von Dir zumir sende,möchte ich natürlich nicht, dass Du nur über meine Spra-che nachdenkst. Der Inhalt sollte ankommen. Sobald ich einen lite-
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
28 29
rarischen Satz versuche an Lesende zu geben,würde bei Jacobson erstmal im Vordergrund stehen, dass hier Sprache überhaupt passiert alsetwas, was zwischen zwei Kommunikationspartner tritt. Das ist dieIdee. Und ich glaube, dass genau diese Eigenschaft von Literatur einMoment ist, in demman sagen könnte, dass hier genau dieses genuinliterarische Wissen entsteht oder literarisches Wissen adressierbarwird, das mit Sprache als Material zu tun hat.Wennman nun ins Feldgeht und bestimmte Sachen erforscht, als Anthropologin etwa, istSprache überall da.Man hat es in den eigenen Notizbüchern,man hatsie in Interviews, in irgendwelchen Ratgebern, die man noch zusätz-lich liest, während man im Feld ist, und sobald diese Sprache einemferntritt und sobald man sich sie wirklich auch als Sprache anschaut,findetman auch andereMöglichkeiten des Umgangs damit. Es ist wieeine Störung oder ein Irritationsmoment, wenn man merkt, hier sollmir zwarwas erzählt werden, aber ich achte nur auf die Sätze, auf das,wie hier erzählt wird oder wie etwas gesagt wird. Hier hat Literaturdie Möglichkeit, Feinheiten auch des Ausdrucks und der Subjektivi-tät, die durch Sprache und Kommunikation geschaffen werden, her-auszuarbeiten. Das passiert,wennman versucht, Sprache als Sprachewahrzunehmen und sie nicht nur als eine propositionale Angelegen-heit zu verstehen, die möglichst klar eine Botschaft übermitteln soll,sondern sie auch in ihrer Mehrdeutigkeit wahrzunehmen, mit ihr zuspielen und dann aus diesem Spiel heraus neue Erkenntnisse zu ge-nerieren, die propositional sein können, die aber nur durch die Lite-ratur und durch die literarische Praxis entstanden sind.Guido GrafInsofern vermittelt literarische Praxis Unsicherheitskompetenz.Simon RoloffJa, soweit das eine Kompetenz sein kann. Ich fand auch immer denSatz von Alexander Kluge sehr schön, dass es um die massenhafteProduktion von Unterscheidungsvermögen geht. Voraussetzung da-für ist zunächst einmal ein Überforderungsvermögen. Ein Vermögen,sich überblicksarmen Situationen auszusetzen. Dann würde es nichtum Kompetenzen oder Resilienzförderungen durch Lesen oder so et-was Schreckliches gehen, sondern um Literatur als Medium einer er-kenntnisfördernden Verzweiflung. Man steht im literarischen Den-ken immer wieder vor unauflösbaren Situationen oder hat es in derSprache der Literaturmit Mehrdeutigkeiten zu tun. Sich dem auszu-setzen, sich damit zu konfrontieren, kann eine eigene Form des Wis-sens darstellen.
Guido GrafIch habe diesen schönen Satz von Bachtin aus Probleme der Poetik Do-stojewskis aufgeschrieben: «Der Autor konzipiert den Helden alsWort. Deshalb ist dasWort des Autors über den Helden einWort überein anderesWort. Es ist an demHelden als einemWort orientiert unddeshalb dialogisch an ihn gerichtet.Der ganze Roman ist so angelegt,dass der Autor nicht über, sondern mit dem Helden spricht.» Wirmüssten die Leser:in jetzt eigentlich auch nochmit ins Spiel bringen.Simon RoloffJa, da könnte es jetzt weitergehen.
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
Anmerkungen
Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs.München : Hanser, 1971.
Heinrich Bosse: Autorschaft ist Werkherrschaft. Überdie Entstehung des Urheberrechts aus dem Geist derGoethezeit. Paderborn: Schöningh 1981.
Rüdiger Campe: «Die Schreibszene. Schreiben.» In:Hans Ulrich Gumbrecht, K. Ludwig Pfeiffer (Hg.):Paradoxien, Dissonanzen, Zusammenbrüche.Situationen offener Epistemologie. Frankfurt a.M.:Suhrkamp 1991, S. 759−772.
Hubert Fichte: Psyche. Die Geschichte derEmpfindlichkeit. Frankfurt a.M: S. Fischer: 1990.
Roman Jakobson: Poetik. Ausgewählte Aufsätze1921−1971.Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2016.
Alexander Kluge: Die Kunst, Unterschiede zu machen.Frankfurt a.M.:Suhrkamp 2016.
30 3130 31
Wie denkt Literatur? Wie denkt Literatur?
Anna Loewenhaupt Tsing: Der Pilz am Ende derWelt :über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus. Berlin :Matthes & Seitz Berlin, 2020
Dieter Mersch: »Ästhetisches Denken und Theoria«. In:Dieter Mersch, Sylvia Sasse,Sandro Zanetti (Hg.),Ästhetische Theorie. Zürich: Diaphanes, S. 241−260.
Richard Powers: The Gold Bug Variations. NewYork:Morrow 1991.
Simon Roloff: Der Stellenlose. Robert Walsers Poetikdes Sozialstaats.München: Fink 2016.
Davide Giuriato, Martin Stingelin, Sandro Zanetti (Hg.):»Mir ekelt vor diesem tintenklecksenden Säkulum«.Schreibszenen im Zeitalter der Manuskripte.München: Fink 2004.
32 33
Kann man Literatur rauchen?Gespräch mit Sylvia Sasse
Kann man Literatur rauchen? Diese und andere Fragen versucht dasGespräch mit Sylvia Sasse zu beantworten. Sylvia Sasse studierte Sla-wistik und Germanistik an der Universität Konstanz und der Univer-sität Sankt Petersburg. 1990 wurde sie in Konstanz mit einer Arbeitzur Sprachphilosophie der Moskauer Konzeptuellen Literatur promo-viert. Sie war unter anderem in Berlin und Berkeley tätig, habilitiertesich 2005 an der FU Berlin und wurde 2009 auf den Lehrstuhl für Sla-wische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich berufen. Sieist Herausgeberin der Online-Magazine Geschichte der Gegenwartund Nowinki. 1975 wurden in der damaligen ČSSR die Mitglieder derRockband Plastic People of the Universewegen obszöner Texte ange-klagt und verurteilt. In Folge dieser Vorgänge hatten sich bislang Per-sönlichkeiten wie der Dramatiker Václav Havel der reformkommu-nistische Politiker Jiří Hašek oder der Philosoph Jan Patočka zusam-mengetan, um das Bürgerrechts-Manifest Charta 77 ins Leben zu ru-fen. Im selben Jahr 1975 erschien auch die tschechische Übersetzungvon Rabelais und seineWelt des russischen Literaturtheoretikers Mi-chail Bachtin. Das Buch spielte eine Rolle im Prozess. Der damaligeStrafverteidiger der Band brachte die Anklage mit der konsequentenAnwendung der von Bachtin herausgearbeiteten Funktion einerLachkultur in arge Bedrängnis. Die Angst vor dem Lachen, sei es dasLachen der Theorie, war beträchtlich. Im Gelächter werden alle ver-meintlichenWahrheiten hintertrieben. Unser Gespräch dreht sich umMichail Bachtin, von dem Sylvia Sasse diverse Schriften übersetztund über den sie vielfach publiziert hat. Wir sprechen darüber, wieBachtin Theorie als Performanz des Schreibens versteht, wie man inTexten mit anderen spricht und über Literatur als künstlerische Er-kenntnis. Zunächst aber geht es um die minimalen Verschiebungen,die Parodien leisten, nicht zuletzt dann,wenn die Parodie der Theoriegilt.
Sylvia SasseWir denken ja immer noch über ein Projekt nach, das wir schon vorein paar Jahren über Theorieparodie geplant haben.Also nicht in dem
32 33
34 35
Sinne, dass Comedians irgendetwas über Theorien sagen , sondern li-terarisch parodistische Verfahren, die Theorie simulieren oder Theo-rien nachahmen. Es gibt da ganz witzige Arbeiten, weil Parodie oderNachahmung auch immer bedeutet, dass man es schon wissen muss.Wenn man ein Simulacrum macht, muss man über das Simulacrummehrwissen als derjenige, der das Original verbrochen hat. Das findeich eine interessante Auseinandersetzung: die Fähigkeit zu erwerben,etwas tatsächlich zu kopieren und dann an einer bestimmten Stellezu verfremden oder zu verändern, um zu zeigen, wie es funktioniertoder wie es eben nicht funktioniert. Ich bin mal gespannt,was wir daso zusammenfinden werden. Zur Theorieparodie gibt es in Russlandviel Material, aber ich hoffe auch woanders.Guido GrafMeinst Du das in dem Sinne, wie etwa Proust Pastiches geschriebenhat?Sylvia SasseJa, vielleicht ein bisschen konzeptueller. Es gibt hier eine starke Ver-bindung zwischen Theorie und Kunst. Zum Teil sind das, seit es Kon-zeptkunst gibt, auch Sachen aus der bildenden Kunst, nicht nur ausder Literatur,weil man sich da auf eine nochmal andere Art undWei-se mit Sprache auseinandersetzt. In Russland gibt es auch in literari-schen Werken Theoretiker, die als Personen vorkommen. Man kannversuchen, Theoriesprache, also z.B. Freuds Sprache oder NietzschesSprache, zu analysieren und dann so weit zu simulieren, dass sie im-plodiert oder dass sie nur noch Verfahren ist und gar kein Inhaltmehr. Das finde ich interessant, weil man dann auf den Akt oder aufdas Formale zu sprechen kommt. Denn so kristallisiert sich immermehr durch die Nachahmung heraus und weniger der Inhalt.Guido GrafAber das geht schon weg von bekannten Parodien wie es sie ja in gro-ßer Zahl etwa zu Heidegger gibt?Sylvia SasseDoch, in diese Richtung kann es auch gehen, und auch um Adorno-Parodien,wie es sie um 1968 gegeben hat. Ein anderes Beispiel ist dieGruppe Spur in Deutschland. Die haben auch ein paar Theorie-Par-odien gemacht. Autorinnen wie Libuše Moníková, die man fast ver-gessen hat und zu Unrecht: Sie hat Wissenschaftssprache in ihre Ro-mane eingefügt, aber eben oft auch parodistisch. Sie hat diese Wis-senschaftssprache überspitzt, Wittgenstein zum Beispiel. Solche Au-torinnen undAutorenwerden ja immer unter einem bestimmten Ge-sichtspunkt gelesen,wo man sich fragt: Wo gehört sie eigentlich hin?Wir haben ein Seminar über Global Slavic Literature gemacht und
schauen uns die unterschiedlichen Generationen derer an, die schonimmer international und auch mehrsprachig geschrieben haben.Und da ist Libuše Moníková ein interessantes Beispiel. DieseWissen-schaftssprache haben wir uns als eine Art von Mehrsprachigkeit an-gesehen, damit man nicht nur Nationalsprachen, die mehrsprachigsein können, betrachtet, sondern überhaupt das Ziehen unterschied-licher Sprachregister.Guido GrafDamit Parodien möglich sind, sind vermutlich zunächst eine ganzeReihe von Epigonen notwendig. Es braucht also nicht nur einen be-sonders prägnanten Stil bei denen, die nur Theorie geschrieben ha-ben, sondern eine große Zahl von epigonalenVersuchen, die Angriffs-fläche bieten.Sylvia SasseDieses Epigonentum ist auch eine unfreiwillige Parodie. Das könnteman insgesamt unter diesem Aspekt anschauen. Da kann man dieDekonstruktion sehen, die sich oft gar nicht mehr auf Analyseobjektekonzentriert, sondern reine Schreibweise wird. Mir geht es wirklichum avanciert künstlerische Parodien.Nicht um sich lustig zumachenüber jemanden, sondern um Parodie als Minimalverschiebung vonetwas zu betrachten, als das Herstellen von Theorie-Simulakren, inder Kunst oder in der Literatur. Ein Film etwawie z.B. von Želimir Žil-nik, dem jugoslawischen Filmemacher, über das Frühwerk von Marxist auch eine Theorie-Parodie. Die Schriften werden wörtlich genom-men und dann aufgeführt. Aber in der Realität. Das sind so unter-schiedliche Ansätze, die Marx in seinen Texten nicht wiederholen,sondern seine Texte ernst nehmen.Guido GrafIn dem Band Ästhetische Theorie, der im Titel etwas aufgreift,was mirfrüher, als ich Adorno gelesen habe, nie in den Sinn gekommen ist,dass man nämlich ästhetische Theorie nicht als Theorie einer Ästhe-tik begreifen muss, sondern die Theorie selbst ästhetisch wird, – indiesem Band hast Du den Aufsatz geschrieben: «Der theoretischeAkt», der sich mit Michail Bachtin beschäftigt und mit dem, was Dufür die Literatur als künstlerische Erkenntnis der Sprache bezeich-nest.Was verbirgt sich dahinter?Sylvia SasseAls wir an dem Band gearbeitet haben, hat mich vor allen Dingen in-teressiert, wie Theorie gemacht ist, also genau dieser Aspekt des Äs-thetischen der Theorie.Theorie ist immer auch Darstellung oderAuf-führung eines Gedankens. Da ist mir ein Zitat aus Bachtins spätenSchriften in den Sinn gekommen. Er hat so um 1960/70 Notizen ge-
Wie denkt Literatur? Kann man Literatur rauchen?
36 37
schrieben, die ihm helfen sollten, sich sein Frühwerk nochmal in Er-innerung zu rufen. Da schreibt er – und das ist eigentlich nur eineRandnotiz –, dass Literatur nicht einfach die Verwendung von Spra-che sei, sondern ihre künstlerische Erkenntnis.Das fand ich eine sehrmoderne, also zeitgenössische Überlegung und auch eine, die manvielleicht nicht so unbedingt mit Bachtin in Verbindung gebrachthat, weil man ihn als denjenigen kennt, der die Dialogizitäts-Theorieausgearbeitet hat, aus der sich dann die Intertextualitäts-Theorieentwickelt hat. Man kennt seine Texte zum Karneval und zur Litera-risierung des Karnevals. Ich fand diese Überlegung interessant undsie wurde noch nicht besprochen. Das ist ein Aspekt, wenn man sichsein gesamtes Werk anschaut, den er nicht formuliert und mit demer auch nicht so stark argumentiert hat, aber den man an der Art undWeise, wie er Theorie macht, eigentlich die ganze Zeit erkennt. Er isteiner derjenigen, die Literatur immer schon als Theorie ernst genom-men haben. Das ist, so wie ich das jetzt sage, natürlich übertrieben,weil er sichmit so vielenAutoren ja gar nicht beschäftigt hat, sondernvor allen Dingenmit Dostojewski und Rabelais.Aber die hat er immerschon auch als Texte gelesen, als literarische Texte, die im GrundePhilosophie oder Theorie aufführen und zeigen.Das ist das,was michinteressiert hat. In diesem Zusammenhang gibt es auch den Begriffdes Obraz, der im Russischen so etwas wie Bild bedeutet. Bei Bachtingeht es darum, dass literarische Sprache Sprache darstellt, die Mög-lichkeiten von Sprache und des Umgangs mit Sprache. Diese Mög-lichkeiten sind in der Literatur aus seiner Perspektive viel größer aus-gefaltet als in der Alltagssprache.Guido GrafDu hast darauf hingewiesen, wie bemerkenswert es ist, dass Bachtinneben Dostojewski, Rabelais und Proust kaum irgendetwas anderesrezipiert hat. Hat Bachtin eigentlich Theorie auch wie Literatur rezi-piert oder ist da in seiner Rezeption dann doch grundsätzlich etwasverschieden?Sylvia SasseDas ist eine gute Frage. Er hat sich ja zu unterschiedlichen Zeiten mitunterschiedlicher Theorie beschäftigt. In den frühen zwanziger Jah-ren hat er viel Georg Simmel gelesen. Er hat Kant gelesen, die Neo-Kantianer und mit einem Blick gelesen, der in der Auseinanderset-zung der Philosophie mit Ästhetik etwas vermisst, was er in der Lite-ratur findet. Er hat – und das begann mit Dostojewski Mitte derzwanziger Jahre – versucht zu zeigen, dass Literatur etwas kann odertut,worauf Philosophie oft verzichtet, also auch die Frage,wie sie sichbezieht auf den anderen, wie sie gemacht ist, und wie sie das zeigt,wie sie Sprache aufführt und nicht so tut, als wäre Sprache vorhan-
den und man könne etwas damit sagen.Das heißt, er hat Philosophienicht wie Literatur gelesen. Ganz im Gegenteil. Er hat an ihr etwasvermisst und auch an Theorie etwas vermisst. Er schreibt um 1920 einBuch, das 1986 veröffentlicht worden ist: Zur Philosophie der Hand-lung. Darin versucht er sich an Kant abzuarbeiten und zu sagen: Wirmüssen der Ästhetik und auch der Theorie etwas hinzufügen, wasBachtin Ethik nennt. Er meint damit: Wenn ich etwas sage oderschreibe, tue ich das in einem ganz konkreten Moment, an einemganz konkreten Ort und ich beziehe mich dabei auf ganz konkreteDinge. Das heißt, ich kann mich nicht außerhalb dieses Textes oderder Situation stellen, in der alles stattfindet. Das Ethische ist fürBachtin ein Moment der Erkenntnis des Hier und Jetzt. Er sprichtauch von dem Versuch, aus der Philosophie eine Ereignisphilosophiezu machen. Ereignis heißt im Russischen sobytie, also wörtlich ge-nommen: «mit sein» Das heißt, ich bin immer schon in Relation zuetwas anderem, zu einem anderen Text, zu einer anderen Situationoder zu einer anderen Person. Das ist etwas,wie Bachtin sagt,was diePhilosophie oft verleugnet,wo sie diesen Akt des Schreibens, den Aktdes Machens, das Hier-und-Jetzt-Sein wieder ausradiert. Für die Lite-ratur sei, so Bachtin, das Problem ähnlich, zum Beispiel der auktorialeErzähler, der sich auch außerhalb von allem stellt,was geschrieben istund eine künstliche Position eingeht und so tut, als könne er sich au-ßerhalb der Dinge imaginieren, in denen er sich befindet. Das ist ei-gentlich eine völlig künstliche Situation. Wir können das im Lebennicht. Ich kannmich nicht überDich erheben. Ich sehe immervonDirnur das,was Dumir zeigst. Ich kann nicht in Dein Inneres gucken. Ichkann Deinen Rücken nicht sehen,wenn ich Dich von vorne anschaue.Das heißt,wir haben immer blinde Flecken.Das Problemvon Philoso-phie und Literatur, so Bachtin, ist zunächst, diese blinden Flecken zuüberzeichnen, zu übermalen,weg zu argumentieren und sie nicht zulassen. Dann liest er irgendwann Dostojewski und findet: Der machtdas nicht. Dostojewski entwickelt für ihn in seiner Literatur eine phi-losophische Erkenntnis der Unmöglichkeit, sich über den anderenhinwegzusetzen. Das formuliert Bachtin dann 1929 in seinem BuchZur Poetik Dostojewskis. Bei Dostojewski sprechen die Figuren, sagtBachtin. Die Figuren in Dostojewskis Romanen sprechen miteinan-der und nicht übereinander. Auch der Erzähler steht auf einer hori-zontalen Ebene. Eigentlich ein demokratisches Prinzip, was er alsoschon 1929 anspricht. Der Erzähler steht nicht über den Figuren, son-dern er spricht mit den Figuren. So wünscht er sich auch Philosophieund Theorie, auf dieser horizontalen Ebene im Dialog mit dem ande-ren.
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
38 39
Guido GrafDiese Dostojewski-Lektüre undwas Bachtin damit macht, liefern unsein wunderbares Kriterium dafür, was Literatur ist und vielleichtauch,was gute Literatur ist: eine Literatur, die dieses Mitsein in ihrerForm und in ihrer Performanz transportiert.Sylvia SasseBachtin würde sogar sagen, Dostojewski liefert uns eine philosophi-sche Erkenntnis, dass es unmöglich ist, dass sich der Einzelne überden anderen erhebt und aus philosophischer oder auch literarischerPerspektive mehrweiß als der andere. Das ist für ihn das,was er ethi-sche Perspektive oder ethische Sicht nennt. Er spricht auch noch voneinem anderen Begriff, den er immer wieder verwendet, von einemvidenie, also von einem Sehen. Bachtin sagt auch, dass die Literaturdie Sprache sieht oder die Art und Weise, wie sie zustande kommt.Auch das Denken sieht, weil es, wenn es in diesem dialogischen Ver-hältnis ist, eine eingeschränkte Perspektive ist und keine künstlichePerspektive. Philosophen, auch der Neo-Kantianismus, befinden sichin einer künstlichen Perspektive. Sie erheben sich gewissermaßenüber den anderen, haben schon ein Urteil, präfigurieren oder sehenetwas, was sie imaginieren, aber sagen nicht, dass sie es imaginieren,sondern tun so, als sei es tatsächlich vorhanden. Bei Dostojewski wirddas runtergefahren auf eine horizontale Perspektive, von der Bachtinsagt: Das ist dialogisch. Er meint mit «dialogisch» nicht, dass dasDialoge seien. Dialog kann seinem Verständnis nach auch monolo-gisch sein.Das ist sein Gegenwort. Ihm geht es um die Art undWeise,wie wir uns tatsächlich in der Welt bewegen. Wir fangen etwas auf,sprechen etwas weiter. Das ist die Art und Weise, wie wir in der Weltselber sind. Dostojewski transportiert das in eine literarische Form.Das sei viel realistischer als alles andere,weil das unrealistischste einallwissender Erzähler sei. Den kann es in derWirklichkeit überhauptnicht geben. Realistisches Erzählen bedeutet in Bachtins Dostojew-ski-Lektüre: Ich spreche mit allen anderen, jeder hat eine Stimmeund ich erkenne den anderen nie vollständig. Die Rede ist, das istauch eine andere Formulierung von ihm, nie abgeschlossen. Sie wirdimmer weiter gedacht, weiter gesprochen, in der Zukunft vermutlichverändert. Allles ist im Fluss, in einem Werden. Das sind Formulie-rungen, die er verwendet, schon in den 30er Jahren, die dann, etwa inder poststrukturalistischen Philosophie – also dasWerden bei Deleu-ze oder eben auch das Dialogische bei Kristeva oder auch bei Barthes– wieder vorkommen.Guido GrafWenn man die späten Vorlesungen von Roland Barthes liest, merktman zwar nicht unmittelbar, dass er sich mit Bachtin beschäftigt hat,
und wenn, hat er das über die Vermittlung von Julia Kristeva getan.Aber die Art, wie beispielsweise die Vorbereitung des Romans bei Ro-land Barthes diesen Gedanken vom Schreiben als Prozess zur Ver-wicklung von Theorie und literarischem Schreiben weitertreibt,knüpft da ja unmittelbar an.Sylvia SasseKristeva hat 1967/68 ihre zentralen Bachtin-Aufsätze geschrieben. Siesaß zu dieser Zeit auch im Seminar von Barthes. Es gibt Aufzeichnun-gen von Roland Barthes, in denen er auch das Vokabular, ohne Kriste-va zu erwähnen,verwendet. Er spricht über eine neue Idee von Litera-tur, die intertextuell sein muss, die Beziehungen zwischen den Tex-ten ermittelnmuss und die auch dialogisch sein soll.Das ist noch, be-vor er über den Tod des Autors schreibt. Er spricht von Intertextuali-tät, ist aber selbst überhaupt nicht intertextuell. Darum geht es jaBachtin auch: Das ganze Gerede, das ganzes Sprechen, die Bezüglich-keit untereinander nicht auszuschalten, sondern tatsächlich aufzu-nehmen und den anderen als anderen zu lassen und wahrzunehmen,aber ihn tatsächlich als anderen zu zitieren oder zu verwenden oderanzusprechen.Guido GrafDie Konsequenz wäre das,was immer vorläufig, instabil, unfertig, of-fen bleibt.Sylvia SasseKristeva spricht später von einem Mosaik aus verschiedenen Texten,oder auch von einer écriture/lecture, also von einem permanentenSchreiben-Lesen. Bachtin hat das nicht so gefasst, sondern mehr de-monstriert. Bei ihm wird das, was er theoretisch fasst, auch aufge-führt. Er spricht permanent auch in seinen Texten mit anderen. Dashat man ihm dann später auch zur Last gelegt, dass er dergleichen oftnicht als philologisches Zitat ausweist oder Gesprächsfetzen nichtkenntlich macht. Aber Bachtin selber hat die wenigsten Texte über-haupt selbst publiziert. Die meisten Texte sind herausgegeben wor-den und herausgegebene Texte haben oft nichts mehrmit demAutorzu tun, sondern mit der Art und Weise, wie die Herausgeber etwasherausgeben. Er wurde bezichtigt, Plagiate verübt zu haben. Das istetwas, woran sich dann auch viele Philosophen und Literaturwissen-schaftler aufgehalten haben, fast in einer kriminologischen, intertex-tuellen Gier, ihm nachzuweisen, dass der Gedanke vielleicht schonmal woanders vorgekommen sei. Aber das Verrückte ist ja, dass dasgenau seine offene Theorie ist.Guido GrafDer Vorwurf muss ihmmerkwürdig vorgekommen sein.
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
40 41
Sylvia SasseDen Vorwurf hat er nicht mehr gehört. Das ist ein Rezeptionsphäno-men. Bachtin ist zu seiner Zeit kaum rezipiert worden. Kurz nach derPublikation des Buches von 1929 ist er verhaftet worden, nicht wegendes Buches, sondern weil man ihm die Mitgliedschaft in einer soge-nannten rechten Gruppe vorwarf. Rechts hieß von Stalin aus gedachteher links. Bachtin war kein Revolutionär, eher ein bürgerlicher Ge-lehrter, der die Revolution auch kritisiert hat. Da wurden ganzeGruppen verhaftet, 1927/28 aus der Akademie der Wissenschaftenund auch befreundete Philosophen. Bachtin wurde in die Verban-nung geschickt. Eigentlich sollte er auf die Solowezki, eines derschlimmsten Lager, aber er war damals schon sehr krank. Er hatteeine chronische Konochenmarksentzündung und wurde dann, weilFreunde ihm geholfen haben, verbannt nach Kustanaj. Er saß damehrere Jahre in der Einsamkeit, konnte sich auch nicht intellektuellaustauschen und war darauf angewiesen, dass Leute ihm Bücher ge-schickt haben. In dieser Zeit entwickelte er die Theorie des dialogi-schen Wortes noch stärker als er das 1929 in dem Dostojewski-Buchschon gemacht hat. Das ist ja eine verrückte Situation: Nicht diesenAustausch zu haben, aber die Idee des Dialogischen so sehr in denVordergrund zu stellen. Wichtig ist, dass seine Theorie die Perfor-manz seines Schreibens ist, dass er sein eigenes Schreiben so be-schreibt, wie er auch seine Theorie beschreibt: ein offenes unabge-schlossenes, sich stets im Werden befindendes, dialogisches Schrei-ben.Guido GrafWenn ich Probleme der Poetik Dostoewskijsmit dem Band vergleiche,den Du mit Renate Lachmann zusammen herausgegeben hast –Sprechgattungen -, dann sehe ich große Unterschiede in dem, wie esgeschrieben ist. Wie hat sich die Schreibweise bei Bachtin im Laufeder Zeit verändert?Sylvia SasseBachtin hat sehr unterschiedliche Sachen geschrieben. Sprechgattun-gen, Problema rečevych žanrov, über die Rede-Gattungen, war eineAuftragsarbeit von der Hochschule, an der er damals teilweise gelehrthat.Man kann das schlecht vergleichen.Sprechgattungen ist auch un-fertig.Das ist ein Fragment, das er nie selbst zur Publikation freigege-ben hat. Das hat man im Nachhinein bei ihm gefunden, während erunentwegt am Rabelais-Buch gearbeitet hat. Er wollte das eigentlichals Habilitation einreichen. Das ist in einem unfassbar langwierigenVerfahren entstanden, das er als erwachsener Gelehrter in dem sozi-alistischen Umfeld über sich ergehen lassen musste. Es wurde auchimmerwieder überarbeitet. Er geht er von ganz unterschiedlichen Sa-
chen aus. Ich finde, die stärksten Bücher sind das Dostojewski- unddas Rabelais-Buch, weil er da von der Literatur ausgeht, die Literaturernst nimmt, sein Material liest und es in seiner Philosophiehaftig-keit zeigt, wie die Texte von Rabelais und Dostojewski sowohl Histo-risches, Ästhetisches, als auch philosophisches Wissen ihrer Zeit dar-stellen oder aufführen.Und dieses Sprechakt-Buch ist ein Versuch, aneinzelne linguistischen Forschungen anzuknüpfen. Das, was wir ver-öffentlich konnten, war im Grunde nur das erste und zweite Kapitel.Alles, was er danach in Aussicht stellte, hat er nicht mehr gemacht.Eigentlich funktioniert das wie eine Definition dessen, was er sichunter Sprechgattungen vorstellt.Aber theoretisch ist es auch interes-sant, weil er sagt, Literatur ist wie eine Sprechgattung. Alles was wirmachen, sind Sprechgattungen. Die Art undWeise,wie wir miteinan-der reden, hat damit zu tun, wie wir Dinge präsentieren. In der Gat-tung zeigt sich auch der Inhalt oder erscheint auf eine andere Weise.Das hat Bachtin interessiert. Daraus wollte er eigentlich noch mehrmachen. Mit dem Roman als Sprechgattung hatte er sich ja schonmal beschäftigt und hatte vor, ein Buch über eben diese unterschied-lichen Sprechgattungen zu schreiben.Guido GrafTheoretisch und natürlich aus so einer nachträglichen Perspektivehat es ja offensichtlich keine Beziehung zu zeitgenössischen Autorenin Russland gegeben, also zu Leuten wie Alexander Wwedenski oderDaniil Charms. Eine Auseinandersetzung mit dieser Oberiu-Gruppewäre ja spannend und theoretisch eben auch möglich gewesen.Sylvia SasseBachtin war,was Literatur anbelangt, eher klassisch und konservativ.Die Avantgarde hat ihn überhaupt nicht interessiert.Mit Oberiu hät-te er nichts anfangen können.Guido GrafObwohl die doch vieles auf ihre Art aufgegriffen haben, was Bachtinbeschäftigt hat, oder?Sylvia SasseEs hätte viele Verbindungen gegeben. Die ganzen zerstückelten Kör-per beiOberiuwären gut als Fortsetzung von Rabelais,vielleicht nichtals obszöner, aber als absurde Körper,deren Körperteile getrennt von-einander dann durch die Welt wandern, zu lesen gewesen. AberBachtin hat sich eigentlich kaum mit zeitgenössischer Literatur aus-einandergesetzt. Er hat manchmal ein paar Einträge geschrieben fürLexika oder Zeitungen. Aber er konnte ja kaum publizieren. Er hattekeinen Zugang zu Publikationen als Verbannter und als jemand, dem,als er 1929 verurteilt wurde, das Recht abgesprochen wurde, künftig
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
42 43
in einer der beiden großen Städte, also in Leningrad und in Moskauzu wohnen. Das heißt, er musste sich immer die ganze Zeit irgendwoam Rande aufhalten, im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen hatteer auch wenig Kontakte, nicht nur zur zeitgenössischen Literatur,sondern auch zur zeitgenössischen Semiotik z.B.. Er hat das rezipiert,aber es gab zum Beispiel kaum eine öffentliche Auseinandersetzungzwischen ihm und denjenigen, die aus der formalen Schule kamen. Erhatte schon in den zwanziger Jahren einen Text geschrieben über denFormalismus, den er kritisiert hat.Aber gleichzeitig ist das ja das Ver-rückte in der Sowjetunion gewesen: All diese Begriffe wurden poli-tisch instrumentalisiert und schief rezipiert. Plötzlich wurde Forma-lismus zu einem politischen Generalvorwurf. Auch Bachtins Buchüber Rabelais – da ging es ja um das Lachen des Volkes in der Renais-sance und über die Kannibalisierung der Literatur – hat man dannspäter als formalistischen Machwerk bezeichnet, gerade bei seinemVersuch der Habilitation. Die hat man dann ihm eben auch nicht ge-währt. Man hat immer nur gesagt, ein Doktortitel ist in Ordnung,aber die Habilitation wurde ihm nicht zugesprochen.Man wollte ihnerniedrigen.Das würde angeblich nicht ausreichen. Natürlich konntedie Sowjetunion mit seinen Texten nichts anfangen. Diese Idee desLachens, das Bachtin als subversives Lachen konzipiert hat, war na-türlich überhaupt nicht dieses volksfröhliche Lachen des sozialisti-schen Realismus in den dreißiger Jahren, diese jubilierende Fröhlich-keit. Ganz im Gegenteil. Das Dialogische z.B.wäre eine super marxis-tische Theorie gewesen. Es geht es ja genau darum, das alles auf einerStufe steht. Niemand steht höher als der andere. Aber natürlich istdas genau nicht zu einer marxistischen oder zu einer leninistischenLiteraturtheorie geworden, weil es auch um Vielstimmigkeit gingund nicht um Monologizität, wie Bachtin das andere bezeichnet hat.Damit meinte er im Grunde das ideologische Sprechen.Guido GrafNach langer Zeit, erst 1963 konnte dann erst das Dostojewski-Buchveröffentlicht werden. Danach ist Bachtin auch in Frankreich und inden USA rezipiert worden. Hat er davon eigentlich noch was mitbe-kommen? 1975 ist er ja gestorben.Sylvia SasseEr hat noch ein wenig die Re-Rezeption von Dostojewski mitbekom-men. Da war es dann Roman Jakobson, der ihn auf den internationa-len Slawistik-Kongressen vorgestellt hat. Auch die Rezeption inFrankreich durch Julia Kristeva, die ja sehr wichtig war, hat er wahr-genommen. Ohne Kristeva hätte das einen ganz anderen Verlauf ge-nommen. Das hat er schon noch mitbekommen. Er hat auch die Re-zeption in Poetik und Hermeneutik in Konstanz mitbekommen und
sich da informiert über Rezeptionsästhetik.Aber eben immer nur ausder Ferne. Er konnte da nicht aktiv diskutieren, also das, was ja ei-gentlich seine Idee gewesen wäre: Dieser offene, polyphone, wissen-schaftliche Dialog. Denn für ihn war wichtig, dass die Theorie immerauch ein Wiederschreiben von bereits Vergangenem ist, dass mannicht Theorie aus dem Nichts heraus schöpft, dass man nicht so tunmuss, als wenn man praktisch ein originärer Theoretiker wäre. Theo-rie funktioniert für ihnwie Literatur in diesem Denk-Chronotopos inRaum und Zeit, der immer wieder etwas aufgreift, verwirft, um-schreibt, wieder schreibt, partizipiert, transformiert und so weiter.Das war das, was was für ihn wesentlich war. Ich denke, das ist auchdas,was heute wichtig ist undwas man auch in theoretischen Debat-ten oft nicht sieht. Was bedeutet das überhaupt, dass Theorie dialo-gisch ist? Wie verhalten wir uns zum anderen Theoretiker oder zu ei-nem anderen Text?Wie machen wir unsere Argumente kenntlich, diewir umschreiben? Es geht mir gar nicht um so eine philosophischeGenauigkeit in Richtung Plagiat, sondern um einen tatsächlichenAustausch innerhalb von Theorie.Guido GrafDieter Mersch und Du in Deinem Aufsatz zum theoretischen Aktsprechen von der inneren Reflexivität der Literatur, die man als einenimmanenten Modus von Literatur verstehen könnte. Gleichzeitigwerden, wenn man literarische Werke, Romane, Gedichte, Dramenauf die Weise nochmal liest, diese reflexiven Beziehungen zwischenForm und Inhalt,Material und oder der Aufführung sofort deutlich.Sylvia SasseEs sind sogar zwei verschiedene Arten von innerer Reflexivität.Damitist erst mal dieser Anfangssatz gemeint, den ich vorhin zitiert habe,in dem Bachtin sagt: Literatur verwendet Sprache nicht, sondern Li-teratur ist die künstlerische Erkenntnis. Literatur zeigt,wie man sichauf Sprache beziehen kann und was man mit ihr machen kann. Mankann ohne zu verstehen, was Sprache ist und wie Sprache funktio-niert, keine Literatur schreiben. Das ist bereits eine Reflexion aufSprache und auch insgesamt auf das Sprechgenre Literatur. Diese in-nere Reflexivität ist eine Grundvoraussetzung. Damit meine ich garnicht so sehr das,was Roman Jakobson in den 1910er Jahren schon sowichtig formuliert hat für die Literatur, wenn er betont, dass Litera-tur immer autoreflexiv ist und sich auf sich selbst bezieht, insbeson-dere auf ihre Materialität. Sondern mir scheint für Bachtin wichtig,dass jede Art von Beziehung zum Material, zu einem anderen Wort,zur Realität immer eine Verbindung eingeht. Diese Verbindung wirdjeweils in der Literatur reflektiert. Außerdem hat sie auch noch eineVerbindung zu einer anderen Literatur oder zu einem philosophi-
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
44 45
schen Text.Diese Beziehungsfähigkeit, die uns in einem literarischenText gezeigt wird, finde ich interessant.Wenn ich einen Text etwa aufder Bühne aufführe, ist das auch eine Beziehung, die ich eingehe mitdiesemText.Das ist die Performanz dieses Textes,weil ich ihn in demMoment, wo ich ihm eine Stimme gebe, ihn auf eine bestimmte ArtundWeise lese oder interpretiere.Guido GrafDas ist, was Du meinst, wenn Du sagst, wir sind zugleich innerhalbund außerhalb der Sprache, also die innere und die äußere Reflexivi-tät?Sylvia SasseGenau das ist es. Das ist eine Überlegung, die man mit Bachtin sehrgut machen kann. Bachtin hat gerade in diesem frühen Buch über diePhilosophie der Handlung einen interessanten Begriff geprägt. Erspricht dort von einer »Außerhalb-Befindlichkeit«. Er meint damit,dass wir immer versuchen zu allem Distanz einzunehmen. Distanzist ja in vielen Philosophien des 20.Jahrhunderts ein wesentlicher Be-griff. Bei Benjamin,bei Adorno, gerade in Bezug auf Kritik und sowei-ter kommt er vielfach vor. Bachtin beschreibt Distanz so, dass mansich nicht außerhalb dessen stellen kann, wo man ist. Ich kann danicht raus. Ich bin da immer drin. Ich kann das aber gleichzeitigimaginieren.Das ist eine Imaginationsleistung. Ich kannmir vorstel-len, draußen zu sein, aber ich bin nicht draußen. Ich kann diese Di-stanz nicht einnehmen, weil ich immer auch eine Nähe habe und indem drin bin,wo ich bin. Bachtin sagt, es gibt kein Alibi. Ich kann alsonicht so tun, als wäre ich woanders, wenn ich hier bin. Das sagt er inBezug auf die Philosophie, auf die Theorie, aber auch auf für die Lite-ratur. Vielmehr müssen wir dieses Ereignishafte, dieses Unsichere,das Noch-Nicht-Fertige in den Blick nehmen. Das ist das, was wirbrauchen in der Philosophie und in der Literatur. Das hat etwas zutun damit, dass man sich in Beziehung setzt und nicht, dass man sichaußerhalb stellt. Beziehung heißt, gleichzeitig hier zu sein, aber auchzu wissen, es gibt jemand anderen.Aber dessen Position kann ich mirnur vorstellen. Da bin ich nicht gleich, ich bin nicht im gleichen Mo-ment. Das ist unmöglich.Guido GrafGibt es eine Form von literarischer Rezeption Bachtins? Man könntedas mit Literaturen zusammendenken, die sich deutlich gegen dieIdee von der originären Autorschaft wenden, die also im Sinne vonDeleuze und Guattari eine kleine Literatur versuchen zu bewerkstel-ligen. Ilse Aichinger etwa fällt mir da ein mit ihren Schlechten Wör-tern, die die falschen oder die schwachenWörter, die schwache Archi-
tektur der Prosa zum Ziel nehmen, um sich nicht der Illusion hinzu-geben,man man könnte etwas ganz anders machen, gar von Null an-fangen.Sylvia SasseUnd auch nichts abschließen, sondern damit rechnen, in Zukunft an-ders gelesen oder interpretiert zu werden. Ich glaube, dass das, wasBachtin gedacht hat, ein Denken, ein Vorgehen ist, das wir verstärktfinden, ganz unterschiedlich in der postmodernen Philosophie, diedann nicht mehr unbedingt auf Bachtin zurückgeführt wird. Bei De-leuze das Werden oder auch der glatte Raum. Das ist auch so eineÜberlegung, oder? Das, was zwischen dem Gekerbten und dem Glat-ten erscheint.Das Haptische,dasmanmit diesemGlatten identifizie-ren kann,würde Bachtin das Ethische nennen, also das,wo ich bin,womein Sehsinn eigentlich nicht mehr funktioniert, wo ich auf meinHören angewiesen bin, auf meine anderen Sinne, weil das Sehen im-mer das ist,was mir den Überblick gibt.Aber das funktioniert in demMoment nicht. Da findet man die kleinen Literaturen. Es ist ja nichtnur eine einseitige Beziehung,mit der wir es zu tun haben. Nicht nurTheoretiker:innen lesen Literatur, auch als Theorie, sondern auchAu-tor:innen haben viel gelesen in Bezug auf Theorie der letzten 50, 60Jahre, die sie verarbeiten und zu der sie sich in Beziehung setzen. InRussland kann man das sehr gut beobachten, also gerade in der Un-dergroundkultur der 70er, 80er Jahre bei Autoren wie Sorokin zumBeispiel. Vladimir Sorokin führt Intertextualität auf, bis nur noch si-mulierte Texte da sind. In seinem Roman Der himmelblaue Speck gibtes diesen himmelblauen Speck, der Kopien von russischen Autorenproduziert. Da kommen etwa 80 Prozent Nabokov oder 65 ProzentTolstoi heraus. Es gelingen nie 100 Prozent. Sorokin wiederholt dannimmer fehlerhaft Texte, die es in der russischen Literatur schon gibt.Auch das ist eine Interpretation dessen, was Bachtin gemacht hat.Das wird auf dieseWeise wieder zu Literatur.Die Theorie wird wiederzu einer Literatur und bekommt ein neues, verrücktes, zum Teil auchparodistisches Sujet.Der himmelblaue Speck ist aus den 2000ern, aberSorokin hat damit schon viel früher angefangen.Auch Dimitri Prigowoder Lew Rubinstein, Autoren aus dem Moskauer Konzeptualismus,kannten Bachtin und haben seine Impulse für sich wieder entdeckt,weil es auch immer den kritischen Impetus hatte eines vieldeutigen,polyphonen Sprechens, was sich gegen diese sowjetische langweiligeRede gewannt hat.Guido GrafDie Konzeptualisten, auch Andrei Monastyrski oder Pavel Pepper-stein scheinen mir da gut zu passen.
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
46 47
Sylvia SasseEinerseits kannten die Bachtin und auch das Konzept der Dialogizi-tät, andererseits haben die sich das auch völlig unabhängig vonBachtin selbst überlegt. Für konzeptuelle Kunst oder konzeptuelle Li-teratur gehört ein theoretischer Anspruch ja auch durchaus dazu.Man kann das in den 70er, 80er Jahren in der Sowjetunion sehr schönsehen, dass Kunst auch selbst zur Theorie wird.Das ist der andere As-pekt dermöglichen Beziehung von ästhetischer Theorie, dass Theoriein der Kunst selbst stattfindet.Was ich persönlich am interessantes-ten finde, ist die Gruppe Kollektive Aktionen. Das ist eine Gruppe, die1976 ihre erste Aktion gemacht hat. Sie haben das selber damals nurDing oder Sache genannt und nicht von Happening oder Perfor-mance gesprochen. Sie haben sich mit einer Gruppe von Leuten ge-troffen, haben die dafür heimlich eingeladen mit Einladungskarten,auf denen stand: Wir treffen uns am Samstag an der Elektritschka,also der S-Bahn und fahren raus in denWald und machen da was zu-sammen. Sie haben philosophische Aktionen gemacht, über die Be-ziehung zueinander, über Raum, über Zeit, über die Frage: Wannfängt eigentlich etwas an, was wir tun, wann ist etwas zu Ende? EinedieserAktionen hieß »Die Zeit«.Mehrere Autoren haben danach überdiese Aktion geschrieben. Die sollten im Winter, es lag Schnee, eineSpule, auf die Band gewickelt war, von einem bestimmten Punkt ausim Wald abwickeln. Es war eine 100 Meter lange Schnur und sie gin-gen sternförmig auseinander. Sie haben sich auch gegenseitig nichtgesehen.Wsewolod Nekrassow, einer derMitbegründer desMoskauerKonzeptualismus, schrieb danach, er hätte immer gedacht, währendsie durch denWald gegangen sind: Gehört das jetzt noch dazu? Dannhat er etwas auf einem Baum eingeritzt gesehen und dachte sich: Istdas jetzt ein Zeichen? Ist das ein Hinweis fürmich? Er ist mit der Elek-tritschka nach Hause gefahren, hat sich die Leute angeguckt undüberlegt, ob die noch dazugehören oder extra reingesetzt wordensind. Er hat eine schwarze Limousine gesehen und dachte sich, viel-leicht ist das sogar der KGB, der uns jetzt beobachtet. Erst als er zuHause in der Badewanne saß, dachte er, da ist nichts mehr, da kommtnichts. Der Raum um mich herum ist gar nicht mit Zeichen belastetoder behaftet. Es war eigentlich gar nichts. Es ging nur genau darum,dass ich mir darüber Gedanken mache. Darum ging es in der Regelbei diesen Aktionen. Man hat sich eine Situation überlegt – und daswaren ja in der Regel alles Freunde aus dem Kunstkreis, die daranteilgenommen haben – und hat dann darüber geschrieben und re-flektiert, was eigentlich passiert ist. Es waren eigentlich Meta-Aktio-nen über Aktionskunst, aber gleichzeitig auch philosophische Aktio-nen. Ich lese das als Theoriearbeiten, die sichmit dem Phänomen Zeit
und mit dem Phänomen Raum auseinandersetzen, mit dem Phäno-men derAutorschaft.Wer ist eigentlich derAutor so einerAktion?Wiegebe ich das ab? Was bedeutet es, im Konzept eines anderen zu sein?Führe ich da nur etwas auf und wie kann ich mich emanzipieren? Siehaben auch großartigeWörter dafür erfunden.Wir übersetzen gerade1.000 Seiten von diesen Kollektiven Aktionen, Texte und Aktionen von1976 bis heute. Und es ist schwierig, das zu übersetzen, weil sie aucheine eigene Sprache entwickelt haben.Guido GrafDu hast mal diese schöne Geschichte einer kurzen Sequenz aus Smo-ke von Wayne Wang geschildert, die ich überhaupt nicht mehr in Er-innerung hatte. Der Film ist 1995 herausgekommen und das Dreh-buch dazu stammt von Paul Auster. Ein Schriftsteller,man könnte ihnsich als Alter Ego von Auster in der Geschichte vorstellen, spricht miteinem jungen Schwarzen, den er ein wenig unter seine Fittiche ge-nommen hat.Sylvia SasseJa, vorher aber noch mal kurz zu Bachtin, der ja auch so ein bisschensagenumwoben ist. Es wäre schwierig, über ihn eine Biografie zuschreiben, weil man nicht so viele Informationen über ihn hat, sodass der selber wieder zum literarischen Stoff wird, zu einer Figur,und nicht nur seine Philosophie, sondern erwandert auch in der Lite-ratur herum.Es gibt da noch ein paar andere Beispiele. Ichweiß nicht,wie Du das gesehen hast in dem Film, aber die Sequenz ist wie losge-löst. Eigentlich geht es in Smoke ums Rauchen. Hier sprechen Rashidund Paul miteinander. Paul ist der Intellektuelle und sie unterhaltensich über einen Philosophen. Aber nahezu alles daran ist falsch. Dasmacht es auch so toll. Auster hat vermutlich eine slawistischeBachtin-Biografie gelesen, wo mal kurz angetippt wird, dass es da soein Gerücht gibt, eine Legende um Bachtin. Aber er nimmt das ernstund versetzt das auch nochmal in eine ganz andere Zeit. Das ist einetypische, eine wunderbar falsche Intertextualität. Wir haben 1942,heißt es, und Bachtin sitzt in Leningrad während der Blockade fest.Stimmt natürlich überhaupt nicht. Bachtin war überhaupt nicht inLeningrad während der Blockade. Er war in Kimry, einem Ort beiMoskau. Er durfte gar nicht in Leningrad sein.Und dann heißt eswei-ter: Ich spreche hier von einem der dunkelsten Momente in der Ge-schichte der Menschheit. 500 000 Menschen starben in dieser Stadt.Und da ist Bachtin, er hat sich in seinerWohnung versteckt und rech-net jeden Tag mit seinem Tod. Er hat eine Menge Tabak, aber kein Pa-pier, um sich was zu drehen. Also nimmt er die Seiten eines Manu-skripts, an dem er seit zehn Jahren arbeitet. Es geht um die Theoriedes Romans. Er arbeitet seit zehn Jahren daran und reißt es in Strei-
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
48 49
fen, um seine Zigaretten drehen zu können, sagt Paul. Dann fragt Ra-shid nach. Er kann das nicht glauben, dass jemand die einzige Kopieseines Manuskripts verraucht haben soll. Paul antwortet: Ich meine,was ist wichtiger, wenn man sowieso stirbt? Ein gutes Buch oder et-was zu rauchen? Bachtin pafft und pafft und Stück für Stück verpaffter so sein Buch.Das ist eine großartige Geschichte. In dem Film denktman dann,mal sehen,was sich jetzt daraus entwickelt. Es entwickeltsich aber überhaupt nichts. Paul greift in sein Bücherregal und willnochmal nachschlagen, aber da ist nichts. Er kann die Geschichtenicht nachschlagen und bleibt in diesem Gerüchtemodus.Guido GrafStattdessen holt er eine Tüte aus dem Regal, in der Geld ist.Vielleichthat Paul die Geschichte einfach erzählt, um diese Situation mit derTüte vorzubereiten.Sylvia SasseDie Geschichte führt zu nichts, sie ist einfach gut. Das Manuskriptzur Theorie des Romans ist übrigens verbrannt worden. Bachtin hattedas schon, nimmt man heutzutage an, beim Verlag abgegeben. ImVerlagsgebäude gab es einen Brand. Er hatte noch eine unvollständi-ge Kopie, die in einemKoffer enthaltenwar, den drei Philosophen vonihm bekommen haben und seine ganzen Schriften dann auch späterherausgegeben haben. Die Erzählung ist natürlich toll. Bachtin hatwirklich viel geraucht.Auf denwenigen Fotos von ihm ist ermeistensmit einer Zigarette zu sehen. Er war zwar krank, hat aber viel ge-raucht. So wird er zu einer Figur. Von 1927 gibt es aus der Gruppe derOberiuten, von Konstantin Vaginov, der vor allem Lyriker war, aberauch Romanautor, das Buch Bocksgesang. Darin gibt es einen Philoso-phen, der im Zug sitzt und raucht und nur einen Satz sagt: »DieWeltist aufgegeben, nicht gegeben. Die Wirklichkeit ist eine Aufgabe, kei-ne Gegebenheit.« Diese Sache der Gegebenheit ist die Quintessenzvon Bachtins Philosophie: Die Welt ist nicht fertig, die ist nicht da.Aufgegeben heißt, dass sie sich noch verändern kann. Das ist ein Vo-kabular, das wir völlig vergessen haben, aber diese Gegebenheitensind ein typisches Vokabular vonAnfang der 20er Jahre.Die Neo-Kan-tianer, Quine haben das verwendet, bei Benjamin in seinem Ge-schichts-Aufsatz kommt es zum Beispiel auch vor.Guido GrafDie Studierenden am Literaturinstitut Hildesheim kommen in ersterLinie aus einer Produktionsperspektive zu uns.Mir scheint, dass eineLektüre von Bachtin für diejenigen, die an der Praxis des Schreibensund Lesens, das Geschrieben- und Gelesenwerdens interessiert sind,den theoretischen Akt, von dem Du schreibst, nicht so sehr als eine
subjektive Angelegenheit erleben, sondern als etwas,was dazwischenstattfindet.Sylvia SasseIch meine, dass diese frühen theoretischen Texte, die entstandensind, als man überhaupt anfängt, von Literaturtheorie zu sprechen,also in Russland in den 10er Jahren, Schklowski, Tynjanow, Jakobson,immer auch für Leute sehr interessant sind, die selber schreiben,weilsie sich schonmit der Frage,wie Texte gemacht sind, auseinanderge-setzt haben, damit, wie Texte von sich selbst als gemachte sprechen,sich als gemachte zeigen. Auch die Frage, was es philosophisch be-deutet, von welcher Perspektive aus ich schreibe, ist dafür wichtig.Bachtin hat gesagt: Literatur sieht Sprache. Sie ist ein Bild von Spra-che, weil sie sie sieht. Sie gibt eine Perspektive auf Sprache vor. Undich glaube, es ist hochinteressant, sich zu überlegen, aus welcher Po-sition oder aus welcher Perspektive heraus blicke ich auf Sprache, in-dem ich sie und wie ich sie verwende.Was sage ich denn in dem Mo-ment über Sprache aus?
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
50 51
Kann man Literatur rauchen? Kann man Literatur rauchen?
Anmerkungen
Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs.München: Hanser, 1971.
Michail Bachtin: Literatur und Karneval. ZurRomantheorie und Lachkultur. Frankfurt a.M.:S.Fischer 1990.
Michail M. Bachtin: Rabelais und seineWelt.Volkskultur als Gegenkultur. Berlin: Suhrkamp, 1995.
Michail Bachtin: Autor und Held in der ästhetischenTätigkeit. Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, 2008
Michail Bachtin: Sprechgattungen. Hrsg. von RainerGrübel, Renate Lachmann und Sylvia Sasse. Berlin:Matthes & Seitz Berlin, 2017.
Michail Bachtin: Chronotopos. Frankfurt a.M.:Suhrkamp, 2017.
Günter Hirt und SaschaWonders (Hrsg.), Präprintium.Moskauer Bücher aus dem Samizdat,mit Multimedia-CD, Bremen: Edition Temmen, 1998.
Kollektive Aktionen: Reisen aus der Stadt. Kollektivnyedejstvija: Poezdki za gorod.Ad Marginem: Moskau 1998.(vgl. auch: http://conceptualism.letov.ru/Kollektive-Aktionen-Reisen-aus-der-Stadt.htm)
Sylvia Sasse: »Wörter und Äpfel : Prozesse derHybridisierung bei Michail M. Bachtin und Ivan Vi.Micurin.« In: UweWirth (Hrsg.), Impfen, pfropfen,transplantieren. Berlin : Kulturverlag Kadmos, 2011, S.135−158.
Sylvia Sasse: »Das Lachen ist ein großer Revolutionär«:Michail M. Bachtins Dissertationsverteidigung im Jahr1946. Zürich : Edition Schublade, 2015.
Sylvia Sasse: Michail Bachtin zur Einführung.Hamburg: Junius 2018.
Sylvia Sasse: Subversive Affirmation. Zürich:Diaphanes, 2019.
Sylvia Sasse: »Der theoretische Akt«. In: DieterMersch, Syvia Sasse, Sandro Zanetti (Hg.), ÄsthetischeTheorie. Zürich: Diaphanes, 2019, S. 119−136.
52 53
Spekulative PoetikGespräch mit Anke Hennig und
Armen Avanessian
Eine experimentelle, eine spekulative Form des Machens, also einePoetik, die an Widersprüchen interessiert ist, an Kollaboration, ge-nauer: an kollaborativen Schreiben, an dem Gespräch über Gegensät-ze, über eine fruchtbare Entfremdung der Literatur, aus der wieder-um eine Fülle an Theorien nicht nur der Literatur präpariert werdenkann: Darüber habe ich mit Anke Hennig und Armen Avanessian ge-sprochen. Anke Hennig wurde 1971 in Cottbus geboren, studierte Ro-stock und Germanistik in Berlin und in Moskau. Sie war wissen-schaftliche Mitarbeiterin im Sonderforschungsbereich ÄsthetischeErfahrung, im Zeichen der Entgrenzung der Künste. Dort hat sie mitArmen Avanessian an der FU Berlin gearbeitet. Derzeit ist sie Gast-professorin an der Universität der Künste Berlin. Ihre Forschungs-schwerpunkte sind Theorie und Poetik des russischen Formalismus,Konzeption der Kunstsynthese in der russischen Avantgarde und dertotalitären Ästhetik, sowie die Zeitmedialität des Films. Armen Ava-nessian, geboren 1973 in Wien, studierte Philosophie, politische Wis-senschaften und Literatur in Wien und Paris. Nach seiner Tätigkeitan der FU Berlin und als Lehrbeauftragter am Peter-Szondi-Institutder FU Berlin lehrt er seit 2013 als Gastdozent an verschiedenenKunstakademien in Nürnberg, Wien, Basel, Kopenhagen und auch inKalifornien. Seine Forschungsschwerpunkte sind Ästhetik und Philo-sophie des 19. und 20. Jahrhunderts. Anke Hennig und Armen Avanes-sian haben inzwischen insgesamt vier Bücher zur Spekulativen Poe-tik geschrieben – gemeinsam geschrieben.
Anke HennigFür uns ist poetische Sprache eine Art Vorbild für Begriffsarbeit. ZuBeginn des Projekts Spekulative Poetik haben wir Dialoge mit einerganzen Reihe von gegenwärtigen Autoren und Autorinnen geführt,also mit Monika Rinck, Elke Erb, Ann Cotten, Oswald Egger, Franz Jo-sef Czernin. Das sind alles Autoren, die viel mit der begrifflichen oderkonzeptuellen Dimension der Sprache arbeiten. Wenn man an die
52 53
54 55
Fremdwörter-Sonette von Ann Cotten denkt oder auch an Oswald Eg-gers Die ganze Zeit, das nicht nur ein poetisches und schriftsteller-isches Projekt ist, sondern im Schreiben und mit dem Wissen derSprache, einer poetischen Sprache, eine Philosophie von Zeit entwi-ckelt. Der Wunsch, den Unterschied zwischen poetischer und be-grifflicher Sprache, aber auch theoretischer Sprache zu verschleifen,gehört zu den Intentionen des Projekts Spekulative Poetik.Armen AvanessianIchwürde jetzt halbwidersprechen und nicht von einemVerschleifensprechen, weil das ja impliziert, dass dieser Unterschied existiert. Esgibt sicher einen Unterschied zwischen Fiktion und akademischerDissertation, es gibt einen Unterschied zwischen Literatur und Philo-sophie. Aber der Unterschied ist nicht einer von poetischer Sprache.Sprache ist selbst poetisch.Was unserem Begriff der Poetik,der Poesisinteressiert hat, ein Element vonWirklichkeitskonstitution, von Pro-duktivität, ist etwas,was Sprache an und für sich auszeichnet. In un-serem ersten Buch, das ausschlaggebend dafür war, dass wir so etwaswie eine Spekulative Poetik dann als Plattform entwickelt haben, ver-sucht haben, anders literaturtheoretisch und philosophisch zu arbei-ten, anders mit Literat:innen ins Gespräch zu kommen, auch metho-disch andereWege zu suchen – diese Arbeit über das Tempus Präsenshat uns zu der These gebracht, dass z.B. die Tempora für unser Ver-ständnis von Zeit, für unsere Erfahrung von Zeit, also poetisch für un-ser Erleben von Zeit konstitutiv sind.Das Poetische,was ja nicht iden-tisch ist mit dem Lyrischen oder mit dem Fiktionalen, mit dem Lite-rarischen, ist für mich nicht ein Trennungsmerkmal.Anke HennigWir sind ursprünglich von den Literaturtheorien des russischen For-malismus ausgegangen, die eine Unterscheidung in poetische undpraktische Sprache getroffen hatten. Später ist daraus die poetischeFunktion der Sprache geworden, wie sie bei Jakobson heißt. Und so-wohl für lyrische Sprache als auch für Prosa oder Fiktion ist danachcharakteristisch, dass es sich bei der poetischen Funktion um einSelbstverhältnis der Sprache handelt, also das Sprechen sich auf dieSprache bezieht oder die Sprache auf das Sprechen. Das ist für unsdann auch wesentlich gewesen, weil das etwas wie eine Metaspracheimpliziert und eine Theoriegeleitetheit von Poetik.Guido GrafDas heißt, dem poetischen Moment, dem spekulativ poetischen Mo-ment, von dem Ihr sprecht, geht es darum, immer etwas zu erschaf-fen, also Begriffe, die erschaffen werden, Anschauungen und damiteben Theorie.
Anke HennigWir haben immer versucht zu sagen, dass wir unsere Poetik auf Poe-sie gründen. Das heißt nicht nur auf einer Analyse und Beschreibungpoetischer Form, sondern auf ein Prinzip von Poesie.Armen AvanessianDas Buch über das Präsens, dass die Art undWeise, wie wir lesen, wiewir Texte prozessieren,wie wir Fiktion prozessieren,wie wir Romanelesen, extrem verändert hat, die massive Lektüre von Präsens-Roma-nen also, aber auch das Schreiben eines Buches darüber, haben dazugeführt, dass wir uns nachher gegenseitig davon berichtet haben,wieunser Lesen und unserDenken verändertwurde.Daswar derAuslöserfür ein zweites Buch überMetanoia, d. h. über die Erfahrung, die alleLiteraturwissenschaftler, Philosophen, aber auch Literaten sichermindestens einmal in ihrem Leben gemacht haben, nämlich, dass dieLektüre eines Textes dazu führt, dass sie ihr Leben ändern, also um-kehren, ihren bisherigen Lebensweg verändern, ihre berufliche Aus-richtung, ihr Privatleben. Was auch immer radikal verändert wird,ausgelöst durch die Lektüre von Sprache: Das ist das BuchMetanoia.Anke HennigZu der Frage, wie wir Poesis verstehen, haben wir uns an GiorgioAgamben angelehnt. In sprachlicher Poesis materialisiert sich das,was Giorgio Agamben als Distinktionsmerkmal des Poetischen be-stimmt hat:
»Die zentrale Erfahrung der Poiesis war die Produktion in die An-wesenheit oder Präsenz, d. h. das Faktum, dass etwas vom Nicht-sein ins Sein aus derVerborgenheit ins volle Licht desWerks tritt.DaswesentlicheMerkmal der Poesis bestand darin, dass sie einenModus, der als Entbergung/Aletheia verstandenenWahrheit dar-stellte.«
Dann habenwirweiterverfolgt,wie im Laufe der Geschichte von Poe-tik dieses Wahrheitsmoment immer weiter zurücktrat, wie auch im-mer weiter das zurücktrat, was wir als Schaffen bezeichnen, dass imliterarischen Schreiben oder auch im Sprechen etwas die Grenze vomNichtsein zum Sein überschreitet. Das trat immer weiter zurück undunter »poetisch« wurde am Ende nur noch eine irgendwie speziellgeformte Sprache verstanden. Das schien uns zu reduktiv.Armen AvanessianVielleicht muss man aufpassen, dass das nicht mit Agamben und mitHeidegger als eine Verfallsgeschichte des Entbergungsbegriffs, desWahrheitsbegriff und des Poetikbegriffs geschildert wird. Man kannes auch einfach sehen als eine alternative Lektüre von Poetik, der jaunter der Dominanz der Hegemonie von Ästhetik vorgeworfen wird,
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
56 57
dass sie ahistorisch und normativ ist.Wir wollten dagegen die Poetikstark machen. Schon am Ende vom Präsens-Buch taucht dieses Zitatvon Agamben auf. Da gibt es einen Epilog über experimentelle Poetik– da heißt es noch nicht spekulative Poetik.Was uns als Literaturwis-senschaftler zu der Zeit wirklich frappiert hat, war, dass ein Phäno-men,über daswir geschrieben haben,nämlich der Präsens-Roman, solange von der Literaturtheorie, von der Literaturwissenschaft igno-riert wurde, übersehen wurde von Narratologen, die, selbst wenn sieüber Präsens-Romane schreiben,wie sogar Genet über Claude Simon,darüber als Präteritum-Romane schreiben. So viel wurde nachge-dacht über Literatur, Fiktion und Zeit, von der klassischen Moderneangefangen, dass man endlos Bibliotheken damit füllen kann. Aberdas Phänomen, dass es ein Erzählen in einem neuen Tempus gibt,wurde nicht thematisiert. Das war für uns ein Anlass, Poetik stark zumachen gegen die ästhetische Dominanz innerhalb der Literaturthe-orie, die immer schon von einer Erfahrung von Zeit ausgeht und da-mit dann an literarische Texte herangeht, anstatt primär die gram-matischen und linguistischen Elemente zu analysieren, die über-haupt erst so etwas wie eine Erfahrung von Zeit konstituieren. Dassage ich, weil es ja auch um das Verhältnis von Wissenschaft, Litera-turtheorie und ihrem Gegenstand geht. Unser Interesse, diese Ob-jekt-Subjekt-Trennung aufzulösen, anderemethodische Zugangswei-sen zu finden, kommt auch daher, dass wir die Erfahrung gemachthaben, dass das dieses Phänomen des Präsens-Romans lange garnicht ans Licht gekommen ist,weil die Literaturwissenschaft es unterästhetischen Auspizien nicht sehen konnte. Das Phänomen, um dases geht, wurde nicht gesehen.Wie kann es sein, dass das von 1930 bisbis 2017 eine sehr interessante Entwicklung des Präsens-Romansgibt, die praktisch nicht thematisiert wird? Das ist ein Problem füreineWissenschaft und betrifft massiv das Verhältnis von literarischerProduktion und wissenschaftlicher Produktion.Guido GrafIch habe das, was Du von Agamben zitiert hast, Anke, eigentlich garnicht so sehr als Reduktion verstanden, sondern eher als einen sehrbasalen Schritt, diese production into presence als einMoment,über-haupt erst mal festzustellen, dass da etwas erscheint in der Poesis, inder sprachlichen Poesis, dass da etwas eröffnet wird. Das ist eine an-dere Perspektive, die die zeitliche Ordnung, die nur, wie Armen dasgerade eben beschrieben hat,von dem bloßen Präteritum immer aus-geht, also einer fest verfugten Vergangenheit, das nicht in den Blicknehmen kann.
Anke HennigPoetik ist im Laufe ihrer Geschichte reduziert worden zu einem Satzvon Instrumenten,mit denenman die Form literarischer Kunstwerkebeschreiben kann. In Agambens Zitat ist eine philosophische Dimen-sion zentral, eine Dimension des Schaffens und der Eröffnung einesRaums von Wahrheit. Diese Frage ist ist in späteren Poetiken nichtmehr gestellt worden. Dort ging es eher um Fragen, ob etwas einegute poetische Form ist oder, undweniger um die Frage, ob damit einRaum vonWahrheit eröffnet wird, eineWelt erschlossen, jenseits vonvon reinem Inhaltismus. Präsens. Poetik eines Tempus war das Buch,dass das Projekt Spekulative Poetik eröffnet hat. Dort geht es um dasTempus und man möchte meinen, das wäre ein ein sehr mikrologi-sches Detail, von dem man erst einmal nicht sehen kann, welche Be-deutung es hat. Eine Bedeutung als solche hat es nicht. Es handeltsich nicht um Substantive oder es geht auch nicht darum, dass imTempus bestimmte Bedeutungen gegeben werden. Sondern in Prä-sensromanen ist das Tempus auf eine Art und Weise gestaltet, dasswir die Erfahrung von Fiktion machen können, d.h. anhand des Tem-pusgebrauchs auch immer wissen, ob wir einen pragmatischen Textoder einen fiktionalen Text vor uns haben. Gleichzeitig wird damiteine Erfahrung von zeitlicher Verschiebung ermöglicht. Wir habendas für Romane des 19.Jahrhunderts im Anschluss an Käte Hambur-ger Vergegenwärtigung genannt. Für die Präsensromane, die wir un-tersucht haben, waren wir der Ansicht, dass das Präsens die Erfah-rung einer asynchronen Zeit, also einer asynchronen Gegenwart er-möglicht. Diese Erfahrungen sind relativ weitreichend, haben abernicht wie sonst eine direkte semantische Funktion.Was man an sol-chen poetischen Phänomenen am Ende trotzdem beobachten kann,ist so etwas wie ein Prozess von Bedeutungsbildung. Den kann manauch im Lesen erfahren.Man hat das Gefühl, Bedeutung wahrzuneh-men im Sinne einer literarischen Erfahrung.Armen AvanessianWenn man diesen berühmten Käthe-Hamburger-Satz als Beispielnimmt: »Morgen war Weihnachten«, haben uns ganz stark Deiktikainteressiert und zwar nicht nur die zeitliche Paradoxie, ein Zukunfts-adverb gemeinsam mit dem Imperfekt zu verwenden, also das epi-sche Präteritum, sondern auch räumliche Deiktika, die das Phäno-men der Fokalisierung aufnehmen, also räumliche, zeitliche und per-sonale sprachliche Paradoxa, die typisch sind für literarische und fürfiktionale Texte. Das hat uns geholfen, auch in unserem späterenSchreiben eine Grenze genauer zu verstehen und zu artikulieren,nämlich z.B. zwischen Fiktion oder Literatur und Wissenschaft. Inden 90er Jahren, in der Postmoderne, gab es ja eine typische, klischee-
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
58 59
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
58 59
hafte Zuschreibung: Derrida, das ist ja eigentlich Literatur, weil ernicht auf eine bestimmte Weise argumentiert. Ich denke, wenn mansich die Deiktik ansieht, kann man viel genauer differenzieren undsehen, dass es eine fiktionale Verwendung der Deiktika gibt. Zugleichgibt es eine Verkümmerung des Reichtums der Ausdrucksmöglich-keiten in der akademischen Prosa, weil da immer ein »man« sprichtoder »wir werden jetzt sehen« spricht, um jetzt nur die personalenDeiktika zu nennen. Zugleich gibt es eine eine große Ausdrucksmög-lichkeit, die nicht zugleich zu einer Fiktionalisierung führt. Es gibtein poetisches Moment auch im wissenschaftlichen Schreiben, dasüberhaupt nicht dazu führen muss, dass man z.B. »morgen war«schreibt, dass man also Fiktion produziert. Das ist nur nur ein Bei-spiel, um zu sagen, dass es nicht auf der Ebene der Behauptung bleibtoder als Verschleifung der Grenzen oder ein frivoleskes Spiel mit lite-rarischen, stilistischen Komponenten als Wissenschaftler oder alsAkademiker, sondern dass man in der Recherche, in derAuseinander-setzung, in der literaturtheoretischen Arbeit auf Kategorien, Begriffeund Phänomene stößt, wie z.B. unterschiedliche Gebrauchsformender Deiktika, die helfen können, sich einen Freiraum zu erschreibenund dann etwas flexibler umzugehen mit literarischen Texten, aberauch mit mit Literat:innen. Eine der experimentellen Anordnungenwar eine Serie von Gesprächenmit Literat:innen,um herauszufinden,was Begriffsschöpfung bedeutet.Wir haben da ein gemeinsames Ter-rain, ein gemeinsames Interesse, nämlich das Schaffen von Begriffen,wie es die berühmte Definition von Deleuze und Guattari vormacht:Was macht Philosophie aus? Sie sie erfindet Begriffe, sie schöpft Be-griffe. Das ist eigentlich etwas, was sie mit Dichter:innen teilt. Undwas bedeutet es, wenn wir als Wissenschafter die anderen nicht zumObjekt nehmen oder deren Texte heroisieren, sondern wirklich eingemeinsames Erkenntnisinteresse, das jetzt schon besteht, fruchtbarmachen?Guido GrafAlso in dem Sinne, wie etwa Daniel Falb Dichtung als begriffslosesDenken bezeichnet hat oder Ulf Stolterfoht Wörter, die Begriffe sind,aber eben nicht etwas bezeichnen, als den Gegenstand einer experi-mentellen Haltung begreift, also genau gegen alles, was man unterEigentlichkeit verstehen könnte?Anke HennigWir haben ausgiebig Stolterfohts fachsprachen gelesen. Gerade an-hand der fachsprachen stellt sich dann tatsächlich die Frage:Was sinddie poetischen Fachsprachen? Was unterscheidet wissenschaftlicheund poetische Sprache? Deixis heißt zeigen und die zentralen Deikti-ka sind örtlich, also »hier, dort«; zeitliche Deiktika wären »jetzt,
dann« und als personale Deiktika gibt es »ich, du, sie, er« oder »wir«.Wennman sich die Texte und Formate ansieht, kannman anhand derDeiktika beobachten, dass poetische Sprache einen freieren Umgangmit ihnen hat.Vor allem an Romanen lässt sich sehen, dass da immereine zeitliche Verschiebung stattfindet, was in den linguistischenTheorien »deictic shift« heißt.Wir haben einen Begriff aus dem rus-sischen Formalismus verwendet, der Verschiebung heißt, der späterin die Linguistik eingeht, aber auch eine eigene poetische Geschichteim russischen Futurismus hat. Die Verschiebung wird auf allenSprachebenen durchgespielt und mit der Verschiebung von sprachli-chen Strukturen werden nicht nur Bedeutungseffekte erzielt, son-dern tatsächlich neue Bedeutungen geschaffen. Das kann man an-hand personaler Deiktika in literaturwissenschaftlichen Texten beo-bachten. Ein close reading zur Zeitlichkeit bei Rilke z.B. würde vor-aussetzen, dass die Unterscheidung zwischen dem,was Rilke schreibtund denkt, und dem, was ich als Wissenschaftler über Rilke schreibeund denke, klar voneinander unterschieden bleibt. Personale Deixiserlaubt mir aber, mit diesem Unterschied zu arbeiten und das, wasRilke sagt, gegen das zu vertauschen, was ich sage oder oder umge-kehrt.Armen AvanessianIn unserer Jugend, wo ich zumindest noch umgeben war von lauterAkademikern, war auch unser Adrenalin oder unser Aggressionslevelhöher und wir haben das alles ein bisschen polemischer ausgedrückt.Um es kurz und knackig zu sagen: Uns war immer egal, was Rilkedenkt, eswar uns auchwurscht,was dieses und jenes Gedicht von Ril-ke denkt. Wir haben keine Analyse einzelner Werke gemacht, ge-schweige denn vonAutoren oderAutorinnen.Uns hat z.B. das TempusPräsens interessiert und da haben zwei, drei Sätze eines Autors schongenügt. »Morgen war Weihnachten« genügt eigentlich, um so einegeniale Idee zu entfalten, wie sie Käthe Hamburger hatte, und dabraucht man nicht den ganzen Thomas Mann dazu zu lesen. DieseIdee der Spekulativen Poetik hatte also immer auch ein polemisches,methodisches Moment. Sie ist verbunden mit der Weigerung, dieseDifferenz zwischen dem Ich Rilkes und dem eigenen Forscher-Ich zumachen. In der Konsequenz bedeutet das auch, dass man sichweigertoder sich immer weniger interessiert für dieses Ich, was es denn ei-gentlich zu sagen hätte.Guido GrafIch versuche mal an einem anderen Beispiel zu formulieren, wie ichverstanden habe, was Spekulative Poetik macht. Der SchriftstellerSenthuran Varatharajah hat in seinem ersten Roman Vor der Zunah-me der Zeichen immer wieder ein rhetorisches Mittel eingesetzt,
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
60 61
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
60 61
nämlich das Futur II, und das auf eine ganz charakteristische Art, ineinem scheinbaren Facebook-Chat, den zwei Figuren miteinanderführen, die beide in Asylbewerberheimen aufwachsen und sich unbe-kannterweise über ihre Kindheits- und Jugenderfahrungen austau-schen. Und die Position, aus der vor allem einer von den beidenspricht, ist immer wieder dieses Futur II. Es wird etwas gewesen sein.Die Art und Weise, wie er Zukunft in die Gegenwart zurückholt,scheint mir etwas zu prozessieren, was Ihr in Bezug auf SpekulativePoetik einmal sehr deutlich sagt, dass hier Gegenwart und Zeit rekur-siv überhaupt erst hergestellt werden.Anke HennigDas betrifft die Frage: Wie wird die Zukunft rekursiv Teil der Gegen-wart oder in welchem Ausmaß? Auch in späteren Stadien der Speku-lativen Poetik haben wir uns ja auch mit Phänomenen wie spekulati-vem oder derivativem Kapital, gegenwärtigen Politiken oder auchFragen von Gender befasst und haben zum Beispiel eine Gemeinsam-keit zwischen spekulativem Kapital und einer rekursiven Integratio-nen der Zukunft in die Gegenwart gefunden. Gerade das rekursiveVerhältnis schien uns spezifisch zu sein für das Verhältnis von Gegen-wart und Zukunft. In unserer Poetik des Tempus Präsens, wo nochRomane unser vorrangiges Material waren, hatten wir festgestellt,dass die erzählende Fiktion des 19.Jahrhunderts überwiegend dasPräteritum verwendet und damit in der literarischen Fiktion aber einganz bestimmtes Erlebnis von Zeit ermöglicht, nämlich eine Verge-genwärtigung der Vergangenheit. Ein klassisch erzählter Roman gibtuns nicht das Gefühl, dass etwas vergangen ist, sondern er gibt unsdas Gefühl, dass wir an diesem vergangenen Geschehen teilnehmenund vergegenwärtigt das vergangene Geschehen. Für die Präsens-Ro-mane ist das Verhältnis zur Gegenwart ein anderes. Es erlaubt unsnämlich, uns asynchron zur Gegenwart zu verhalten, uns von der Ge-genwart auch bis zu einem gewissen Grat geradezu zu distanzierenund ermöglicht uns gleichzeitig, asynchrone Vergangenheiten zuempfinden oder zu erfahren, d. h. solche Vergangenheiten, die nie-mals Gegenwart gewesen sind oder niemals eine vergangene Gegen-wart waren. Für das Verhältnis von Gegenwart und Zukunft schienuns vor allen Dingen der Begriff der Rekursion oder die Charakteri-sierung dieses Verhältnisses als rekursiv besonders überzeugend.Guido GrafWennman Rekursivität als ein Instrument begreift, scheint das über-haupt erst diesen Raum zu eröffnen, um so etwas wie Spekulationund Experiment als eine treibende Kraft zu begreifen, als das Instru-ment,was überhaupt erst etwas immerwieder neu machen lässt. DasBeispiel von Infinite Jest von David Foster Wallace kommt mir da be-
sonders deutlich vor: Ein Roman, der damit aufhört, dass er anfängt,und damit eigentlich sich vorantreibt, der über gesamte Strecke im-mer wieder dieses Modell nutzt, um voranzukommen.Anke HennigSolche Rekursion findetman auf allen Ebenen.Bezogen auf die Längeeines ganzen Romans, aber auch auf viele kleinere Einheiten, Sätzebeispielsweise. »Der Satz, den Sie gerade lesen« oder »der Satz, denSie gerade hören« bezieht sich auf sich selbst. Das ist ein typischesBeispiel für ein rekursiven Satz. Was uns wichtig war für das ProjektSpekulative Poetik, war, einen Geist des Experiments für die Litera-turwissenschaften zurückzugewinnen und sich nicht ausschließlichauf Beobachtung zu beschränken oder auf genaue Wiedergabe einesTextes wie in einem close reading, sondern tatsächlich Begriffsarbeitanzuregen, Instrumente zu entwickeln, mit denen literarische Textenicht nur betrachtet werden, sondern mit denen man auch gezieltVeränderungen an ihnen vornimmt. Man stellt Präparate her, an de-nen dann ein Eindruck von sprachlicher Produktivität gewonnenwird. Bezogen auf den Geist des Experiments waren wir auch immerder Ansicht, dass poetische Sprache oder poetisches Sprechen als dasLabor der Sprache zu verstehen ist. Denn Sprache wird ja nicht durchIngenieure geschaffen oder auch nicht von Programmierern bereit-gestellt, sondern Sprache ist das Ergebnis einer alltäglichen Arbeitdes Sprechens, indem all diese Experimente stattfinden und in denendie Sprache sich weiterentwickelt, neue Bereiche vonWirklichkeit er-schließt, neue Erfahrungen ermöglicht. Dieses Moment an der Spra-che, ihren experimentellen Charakter, ihre Laborhaftigkeit hervorzu-heben,war uns wichtig.Armen AvanessianIch versuche ja immer, ein bisschen polemisch zu situieren, in wel-chem Kontext wir das geschrieben haben, also etwa innerhalb einesSonderforschungsbereich zu Fragen der Ästhetik. Wir waren beidezugleich am Peter-Szondi-Institut in Berlin und haben nicht nur eineKrise dieses Instituts, sondern des Fachs selber konstatiert und habenuns die Frage gestellt: Was macht uns überhaupt als Literaturwissen-schaftler aus? Oder:Was bedeutet überhaupt Allgemeine undVerglei-chende Literaturwissenschaft? Und was hat uns zu diesem Fach ge-bracht? Nicht zuletzt hatte das Fach immer eine unglaubliche Offen-heit für andere Methoden, für neue, auch philosophische Strömun-gen.Wir hatten den Eindruck, dass diese Neugier und diese Offenheitimmer weniger stattfindet, vielmehr eine Verengung des Horizonts,die nicht gut ist für das Fach. Außerdem haben wir konstatiert, dassnach fast einem Jahrhundert von immer neuen Theorie-Strömungen,die ist sich zwar möglicherweise wechselseitig bekriegt haben, die
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
62 63
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
62 63
aber alle eine bestimmte Bezugnahme auf den sogenannten lingu-istic turn hatten,die also alle sprachtheoretisch informiertwaren,wirjetzt aber zum ersten Mal im 21. Jahrhundert mit Theorie-Strömun-gen konfrontiert sind, die fast polemisch gegen Sprache und Sprach-theorie auftreten: Neue Materialismen, eine neue spekulative Philo-sophie, die Sprache und Sprachtheorie und auf ihr aufbauende Lite-raturtheorien und Philosophien als relativistisch zurückweisen. Un-ser Punkt war zu sagen, diese Herausforderung müssen wir anneh-men, diesen Fehdehandschuh müssen wir auffangen, aufgreifen undzugleich zeigen, dass es sehr wohl möglich ist –Metanoia hat als Un-tertitel Eine spekulative Ontologie der Sprache, also als anders ver-standener linguistic turn, mit einer anders verstandenen Sprachthe-orie, die sich auf Gustave Guillaume und andere nicht in der in derSaussureschen Tradition denkende Linguisten bezieht -, ein anderesspekulatives Verständnis von Sprache möglich zu machen, um dieWirklichkeit zu denken, die wirklichkeitsverändernde Kapazität vonSprache zu denken. Rekursion, wenn es überhaupt so etwas gibt wieeine Universalie, die in allen Sprachen ist, also sowohl auf der seman-tischen Ebene aber auch noch basaler, ist ja ein Phänomen, das so-wohl der Sprache zu eigen ist, als auch, wenn man Biologen liest, inder rekursiven Funktionsweise von Organisationsformen von Orga-nismen zu finden ist. Bei Neurologen oder Soziologen wird diese Re-kursivität als ein ontologischer Operator beschrieben. Diese Verbin-dung wollten wir in der Folge auch herstellen. Das war eine massiveAntriebskraft der Spekulativen Poetik, diese neuen philosophischenund gegen die Sprache und gegen die Sprachtheorie gerichteten Strö-mungen zu inhalieren oder zu introjizieren und fruchtbar zu ma-chen, auch letztlich für eine Literaturtheorie.Guido GrafDiese Inhalation hat Euch die Möglichkeit gegeben, Prinzipien derSpekulativen Poetik von dem Gegenstand Literatur auszuweiten aufganz andere Gebiete. Wenn Ihr jetzt mit diesen Erfahrungen wiederauf die Literatur als Gegenstand und auf die Literaturwissenschaftals weiteren Gegenstand zurückblickt: Kann man damit weiterarbei-ten? Hat sich da inzwischen was getan? Oder ist dieses experimentel-le Schaffen von Sprachwissen als Literatur immer noch ein großesDesiderat?Armen AvanessianAus biographischen oder aber vielleicht nicht einfach idiosynkrati-schen oder kontingenten Gründen ist es uns, mir noch noch wenigerals Anke, nicht möglich, über literaturtheoretische Fragen zu arbei-ten, d. h. diesen Fragenwirklich systematischweiter zu folgen. In Fra-gen einer Geopoetik z.B., Fragen eines sympoetischen Schreibens
wäre extrem viel Potenzial. Hätte ich die Zeit, würde ich auf dem Ge-biet arbeiten. Aber aus den schon angedeuteten institutionellenGründen kann ich es nicht beantworten,weil ich einfach notgedrun-gen auf einem anderen Feld forsche.Anke HennigEs hat auch nicht nur eine Bewegung auf andere Felder hin gegeben,also Politik, Kapital, Gender. Das ist auch einhergegangen mit einerBewegung von Theorie zu Praxis, in der sowohl Armen als auch ichangefangen haben, in anderen Bereichen zu arbeiten, hauptsächlichim Kunstbetrieb und in der künstlerischen Ausbildung und wenigerin geisteswissenschaftlichen Forschungsverbünden.Armen AvanessianEs gibt sicher immer mehr Interesse für manche dieser materialisti-schen Themen. Der Anthropozän-Diskurs ist angekommen, auch fürpostkoloniale Fragestellungen, die natürlich etwas zu tun haben mitder Hinterfragung von Subjekt-Objekt-Konstellationen usw. Das istangekommen, aber als Interesse, als Forschungsgegenstand auf einerinhaltlichen Ebene, definitiv nicht auf einer spekulativ poetischenEbene. Das muss es auch nicht, aber Literaturwissenschaft oder Lite-raturtheorie sind da nicht Vorreiter, bieten keine Methoden an. Zielsollte sein, anderen Disziplinen einen Anreiz zu geben, etwas für dieeigene Arbeit zu adaptieren.Wer aufgeklärt und neugierig durch dieWelt geht, beschäftigt sich mit anderen Romanen als die Literatur-wissenschaft, arbeitet an einem anderen Kanon.Guido GrafUnser Literaturinstitut heißt offiziell Institut für LiterarischesSchreiben und Literaturwissenschaft. In erster Linie kommen dieStudierenden nach Hildesheim, um zu schreiben,weniger um Litera-turwissenschaft zu betreiben. Diese Praxis-Perspektive steht massivim Vordergrund. Genau an dieser Schnittstelle interessiert mich, in-wiefern eine poetologische Haltung von Experimentalität, die ja viel-leicht noch stärker ins Spiel gebracht werden kann, als eine spekula-tive Praxis stattfinden kann.Anke HennigIn den letzten beiden Büchern zur Spekulativen Poetik von Feminis-mus,Algorithmik, Politik und Kapital hat sich unser Interesse stärkerin die gegenwärtige Praxis entwickelt. Was wir da auch gemacht ha-ben, war zum Beispiel, die Begriffe der Spekulativen Poetik wie Re-kursion, wie Verschiebung, wie Abduktionen – als Operatoren zu be-zeichnen.Das heißt ihren Instrument-Charakter,mit denenman sichWirklichkeitsbereiche nicht nur zur Beschreibung erschließen kann,
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
64 65
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
64 65
sondern tatsächlich zum Handeln. Daher wurde Politik dann auchwichtiger,weil ein Moment von Aktivismus daran beteiligt war.
Spekulative Poetik Spekulative Poetik
Anmerkungen
Armen Avanessian / Anke Hennig: Präsens. Poetik einesTempus. Zürich: Diaphanes, 2012.
Armen Avanessian / Anke Hennig (Hrsg.): DerPräsensroman. Berlin: deGruyter, 2013.
Armen Avanessian,Anke Hennig, Steffen Popp (Hrsg.):Poesie und Begriff. Positionen zeitgenössischerDichtung. Berlin: Diaphanes, 2014.
Armen Avanessian / Anke Hennig: Metanoia.Spekulative Ontologie der Sprache. Berlin: Merve, 2014.
Armen Avanessian / Anke Hennig: I – I. SpekulativePoetik von Feminismus,Algorithmik, Politik undKapital. Berlin: Merve, 2019.
Armen Avanessian / Anke Hennig: ONE + ONE.Spekulative Poetik von Feminismus,Algorithmik,Politik und Kapital. Berlin: Merve, 2019.
Armen Avanessian / Jan Niklas Howe (Hrsg.): Poetik.historische Narrative und aktuelle Positionen. Berlin:Kadmos, 2014.
Gustave Guillaume: Zeit und Verb. Theorie der Aspekte,der Modi und der Tempora. Hrsg. von ArmenAvanessian und Anke Hennig. Zürich: Diaphanes, 2014.
66 6766 67
Do this Book or DieGespräch mit Senthuran Varatharajah
»Die Sprache ist so nahe an ihrem Gegenstand, dass sie körperlich ist.Sie ist so nah an der Zerstörung, die ihr vorausgegangen ist und dieihn allein in den Stand des Sprechens setzte.« Das hat Senthuran Va-ratharajah über die Gedichte von Ocean Vuong geschrieben, und er istauch da ganz nah seiner eigenen Poetik. Senthuran Varatharajahwurde 1984 geboren, studierte Philosophie, evangelische Theologieund Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und London. Sein ersterRoman Vor der Zunahme der Zeichen erschien 2016 bei S. Fischer.2022 erscheint dort auch sein zweiter Roman Rot (Hunger). Senthu-ran Varatharajah lebt in Berlin. Wir haben über Wiederholung undEinsamkeit gesprochen, über das Fremde des Erzählens und über dieLogik des Widerspruchslosigkeit. Wir haben darüber gesprochen, wieaneinander vorbei gesprochen wird, um den Körper von der Spracheabzuziehen, über das vertikale Deutsch und das Übersetzen als Le-bensrealität, über Verzweiflung und How I Met Your Mother, überden Kampf um die Vorstellungskraft, um die begrenzte Vorstellungs-kraft derWeißen.
Guido GrafEines,was mir bei der wiederholten Lektüre von Vor der Zunahme derZeichen aufgefallen ist, sind Wiederholungen, also Wiederholungen,die immer wieder in dem Buch vorkommen. Zunächst hauptsächlichin den Texten, die Valmira schreibt. Sie fängt einen Satz an und setztdann mit den gleichenWorten noch mal neu an.Senthuran VaratharajahDie Wiederholung ist für mich hier beides: Einmal ein kompositori-sches, ein rhythmisches Element,was ich aus der katholischen Litur-gie übernommen habe. Auf der anderen Seite hängt die Wiederho-lung mit dem Gegenstand dieses Textes zusammen, nämlich die Fra-ge nach der Erinnerung. Die Wiederholung wird dann zu einer Artvon Rache der Erinnerung,die sich dann zeigt,weil man sie verdrängthat, in einem Augenblick, in dem man sie dann nicht mehr erwartenhat können. Insofern ist dieseWiederholung das Festsetzen, das Fest-
68 69
stecken in einer bestimmten Erzählung, in einem bestimmten Er-zählmuster, nicht nur in der Erzählung der Eltern, sondern auch inder Erzählung, dieman sich selbst erzählt und dieman für sein Lebenhält.Guido GrafWo setzen diese Wiederholungen an?Senthuran VaratharajahIch glaube, die Wiederholungen setzen immer mitten in der Einsam-keit an und das heißt fürmich natürlich auch, genau im giftigen Herzder Sprache. Ich würde soweit gehen und sagen, dass die Einsamkeitvielleicht meine Urerfahrung war, so stark, dass sie alle Syntax bisheute ordnet. Das heißt für den ersten Roman »Vor der Zunahme derZeichen«, dass das ein Text ist, der nur von dieser Einsamkeit erzählt,der Einsamkeit, der Sprache und der Einsamkeit des Sprechens. Hiersetzen alle Stilmittel an, aber auch das Erzählen.Guido GrafSie haben einmal geschrieben,dass dieWiederholung das schwierigs-te Stilmittel sei.Senthuran VaratharajahDas hat mit meiner theologischen Vorbildung zu tun, weil die Wie-derholung mich hier auch immer wieder erinnert an die Auferste-hung und an die Toten, an die Menschen, die gestorben sind an unse-rer Stelle, im Krieg, und deren Schuld wir weitertragen, genauso wiewir die Verantwortung für sie weitertragen.Wie kann manwiederho-len, wenn man weiß, dass es keine Auferstehung gibt? Und insofernwar das für mich das frevelhafteste Stilmittel, das ich eigentlich be-nutzen kann, nämlich etwas zu schreiben, woran ich nicht glaube.Aber dennoch gibt es diesen Impuls, genau das zu schreiben. Es gibtdiese eine Szene in The Walking Dead in der Hershel, ein Tierarzt, zuRick, dem Protagonisten, sagt: »I can't profess to understand God'splan, but Christ promised the resurrection of the dead. I just thoughthe had something a little different in mind.« Ich glaube, genau dieseErfahrung, nämlich das Zurückkehren, aber auch das Zurückkommenvon all den Dingen, die man verdrängt, vergessen, verschwiegen, ver-leugnet und vielleicht auf diese Art auch sprachlich vernichtet hat,diese Dinge rächen sich zu ihrer Zeit und das ist dann die Wiederho-lung.Guido GrafRick erinnert Hershel ja daran, dass er eigentlich ein Mann des Glau-bens sei. Und darauf antwortet er, dass er nicht sicher sein kann, ober Gottes Plan wirklich verstanden hat.
Senthuran VaratharajahSie stehen auf der Front Porch, nicht wahr? Und schauen auf ein Feldoder auf eine Wiese. Es ist immer etwas schwierig, über Religion undTheologie zu sprechen in einer Zeit, in der wir alle glauben, wir sindsäkular. Und immer,wenn ich in die Verlegenheit komme, darüber zureden, dann fühle ichmich immer etwas anachronistisch oder reakti-onär. Ähnlich geht es einem vielleicht auch, wenn man über ästheti-sche Grunderfahrungen spricht. Wie kann man darüber sprechen,ohne wie ein Esoteriker zu klingen? Wie kann man davon erzählen?Und vor allem: Wem kann man davon erzählen? Für mich ist diegrundsätzliche Poetik meines Schreibens mit dem Christentum sosehr verwandt, dass ich sagen würde, dass das Christentum und dieBibel selbst eine Poetik sind. Ich habe heute an eine Erfahrung ge-dacht,weil ich mit meiner Mutter gesprochen habe über das Zurück-kehren, about returning. Und ich denke immer diesen Satz von mei-nem Freund Fabian Saul, der auch Schriftsteller ist und der sagt: »toreturn – that is the miracle«. Wie können wir zurückkommen? Gibtes eine Rückkehr? Und als wer kommen wir zurück? Oder vielleichtals was? Das ist natürlich auch diese Paradoxie des Zombies, könnteman sagen. Phänotypisch sieht der Zombie aus wie ein Mensch, denwir kennen. Aber es ist nicht dieser Mensch und es ist gleichzeitigdieser Mensch. Yoko Tawada hat 1998 eine Poetikvorlesung gehaltenan der Universität Tübingen. Und in der sagt sie, dass die Gesichterder Kinder der ersten Generation,die an einem anderen Ort, der nichtder Ort der Herkunft der Eltern ist, aufwachsen, verändert wordensind durch die Sprache. Und das korrespondiert sehr stark auch mitmeiner Erfahrung.Wenn ich, wie man sagen könnte, zurückkehre, indas Land meiner Eltern, das Land der sogenannten Herkunft, in dasLand, in das ich geboren worden bin – wenn ich nach Sri Lanka gehe,dann nur beruflich – 2018war ich dort,weil das Goethe-Institut micheingeladen hatte und 2019war ich zweimal dort auf demGalle Litera-ry Festival, und einmal,weil ich in Colombo und in Jaffna an der Uni-versität mit dem Goethe-Institut ein Projekt über Lyrik veranstaltethabe – und jedes Mal, wenn ich in Sri Lanka bin, dann gibt es diesemerkwürdige Irritation. Ich glaube,man könnte sagen, phänotypischsehe ich vielleicht aus wie ein Tamile. Aber wenn ich in Sri Lanka bin,selbst in Jaffna, in Yalpanam,wie die Stadt, in der ich geboren wurde,auf Tamilisch heißt, werde ich immer wieder für einen Amerikanergehalten.Das heißt, die grundsätzliche Erfahrung des Zurückkehrensist vielleicht das Neutestamentarische, dass das Wort Fleisch gewor-den ist. Aber dasWort lebt da nicht unter uns, sondern in uns. Und eshat unseren Körper durchquert und durchkreuzt auf eine Art undWeise, bis wir nicht wiedererkannt werden.
Do this Book or Die Do this Book or Die
70 71
Guido GrafMir scheint, dass dieser Widerspruch in dem Wort Herkunft schonenthalten ist. Es ist ja kein Herkommen, sondern man kehrt zurück.Aber als jemand, der eigentlich gekommen ist und weg ist und nichtwieder ankommen kann.Senthuran VaratharajahKennen Sie dieses schöne kleine Buch von Jean-Luc Nancy, Der Ein-dringling, L' Intrus, Das fremde Herz. Es geht um die Herztransplanta-tion von Nancy. Ein Herz, das zwanzig Jahre jünger ist als seines. Under sagt an einer Stelle gleich im Anfang,wenn man nach der Ankunftnicht angekommen ist, dann ist man immer im Kommen begriffen.Es gibt in dieser Formulierung nicht nur die Grausamkeit tatsächli-cher Erfahrungen, die z.B.mit Flucht oderMigration verbunden sind,sondern natürlich auch immer eine kleine messianische Melodie,nämlich die Frage:Wann kommt undwie kommt derMessiaswieder?Und was passiert dann? Ist das die absolute Vernichtung? Ist das dieabsolute Erneuerung? Und wenn es die Vernichtung und Erneuerungist, von wem? Von was und warum?Guido GrafDas sind Aporien, die man baut, wenn man darüber spricht oderschreibt. Es gibt in diesem schmalen Buch Aporien von Jacques Derri-da den Versuch einer nicht wirklich ausgeführten, etwas zögerlichenEtymologie. Er nimmt es relativ wörtlich und in der deutschen Über-setzung ist es eigentlich nur unzureichendwiedergegeben.Eigentlichmüsste es eben darauf hinauslaufen, dass man sagt, dass »Aporie«heißt, dass man keinWeg macht oder keine Brücke macht.Senthuran VaratharajahIch glaube, dass die Aporie in einer Art natürlich auch der Versuch ist,eine Logik und auch eine Logik des Erzählens zu finden, die jenseitsklassischer harmonischer Gesetze, also auch der Gesetze der Mathe-matik funktioniert. Ich denke oft an diesen Satz von Calrice Lispector,der jetzt auch für meinen neuen Roman sehr entscheidend ist. Siesagt: »Coherence, I don't want it anymore. Coherence is mutilation, Iwant disorder.« Wenn wir nicht an die Kadenz heute mehr glaubenkönnen, dass die Welt in einem Wohlklang aufgeht, wie können wirdenn davon ausgehen, dass wir Kategorien an Texte herantragen,wiez.B. Kohärenz,Widerspruchslosigkeit? Und ich glaube, das Verharrenund das Bleiben imWiderspruch ist nicht nur eine intellektuell redli-chere Verfahrensweise, sondern auch etwas, was sehr stark mit mei-ner eigenen Erfahrung und natürlich auch einer Erfahrung, die mitder Erfahrung von Derrida korrespondiert. Derrida, geboren als alge-rischer Jude, der dann nach Paris kam und immer der Fremde war,
immer in der différance.Das heißt für jemanden,der hier in Deutsch-land lebt, aufgewachsen ist, auf Deutsch schreibt und natürlich ver-sucht, vielleicht eine andere Form des Erzählens zu finden, müssenwir uns gerade in einem Bereich bewegen, der einer anderen Logikgehorcht als der Logik der sogenannten Widerspruchslosigkeit. Undvielleicht, glaube ich, ist das Festhalten an unterschiedlichen Erzäh-lungen, die sich auch widersprechen können, die weit voneinanderentfernt sind und somit eng verzahnt, bis man sie nicht auseinander-halten kann, der Ort, an dem nicht nur Leben, sondern im strengstenSinne auch Literatur stattfinden könnte.Guido GrafIn Vor der Zunahme der Zeichen ist das Gespräch der beiden Protago-nisten eigentlich nur möglich, weil sie sich immer wieder verpassenund zugleich wissen, dass sie sich nicht begegnen dürfen. Sie suchenanfangs noch nach möglicherweise gemeinsamen Bezugspunkten,stellen das aber eigentlich relativ rasch ein.Senthuran VaratharajahMan könnte sagen, das erste Kapitel ist der Versuch einer Berührung,das Suchen nach Berührungspunkten, die aber ausbleiben. Das hatnatürlich auch etwas mit der Konzeption des Romans zu tun.ValmiraSurroi und Senthil Vasuthevan sind sich nie begegnet und sie kenneninsofern auch nicht die Stimme des anderen. Die Schrift bleibtstimmlos. Es ist eigentlich ein stummes Gespräch und das Aneinan-dervorbeisprechen ist gerade auch der Versuch, den Körper abzuzie-hen von der Stimme und auch von der Sprache. Beide kennen sichnicht, Valmira Surroi studiert Kunstgeschichte in Marburg, SenthilVasuthevan ist Doktorand der Philosophie in Berlin und die wenigeZeit, die sie miteinander verbringen, wenn sie zeitgleich online sind,wird aber dennoch dann torpediert davon,dass sie nicht den gleichenRaummiteinander teilen. Das heißt, es gibt eigentlich nur diese klei-ne Berührung,wenn beide online sind. Aber hier findet das wirklicheSprechen eben nach anderenMaßstäben statt.Auch hier gibt es nichtdas konventionelle Gespräch.Und das kam aus dieser Idee, die natür-lich auf der einen Seite eine philosophische Idee ist, aber auf der an-deren Seite eine sehr biografische. Nämlich die Frage: Wie kann manvon diesen Dingen erzählen? Wie kann man davon erzählen, wennz.B. ichmein ganzes Leben lang gehört habe: Ich glaube dir keinWort.Das kann nicht sein. Es geht nicht nur um die deutlichsten Erfahrun-gen von Rassismus, sondern ganz grundsätzlich wird davon erzählt,was passiert, wenn man nicht sich bewegt in der beschränkten Vor-stellungskraft von weißen deutschen Menschen? Was passiert danneigentlich? Ich möchte eine kleine Anekdote erzählen aus dem 1. Se-mester, über die ich in letzter Zeit sehr oft nachgedacht habe und die
Do this Book or Die Do this Book or Die
72 73
erst jetzt, 15 Jahre später, anfängt, mich traurig zu machen. Es warmein erstes Referat im Hörsaal in Marburg, Einführungsveranstal-tung zur Philosophie und Sie können sich vorstellen, dass der Hörsaalvoll war, weil natürlich nicht nur die Studierenden aus dem Philoso-phie-Studium, sondern auch Nebenfach-Studierende, Lehramts-Stu-dierende anwesend waren. Ich habe über den Diskurs über die Un-gleichheit von Rousseau gesprochen. Es war ein vollkommen konven-tionelles Referat. Nach dem Referat hatte sich ein Kommilitone ge-meldet und er war der erste, der sich gemeldet hat, ein weißer Kom-militone. Und er sagte dann: Ich habe keinWort verstanden von dem,was du gesagt hast. Du hast zu viele Fremdwörter benutzt. Kann je-mand anderes das leichter zusammenfassen? Sie sehen, 15 Jahre spä-ter erinnere ich mich an alle drei Sätze und alle drei Sätze sagen sehrviel über die beschränkte Vorstellungskraft von weißen Menschenaus, die darüber bestimmen, wie geschrieben werden kann, wie ge-schrieben werden soll. Die Tatsache, dass ich in diesem Referat si-cherlich nicht mehr Fremdwörter benutzt habe, als ein junger Philo-sophie-Studierender, aber dennoch meine Sprache als eine fremdeSprache verstanden worden ist, glaube ich, sagt sehr viel darüber aus,wie die Wirklichkeit des Sprechens von rassifizierten Menschen indiesem Land aussehen kann, nämlich dass, sobald wir den Mund öff-nen, die sogenannte Muttersprache eine Fremdsprache wird. Und ichhabe erst jetzt begonnen zu glauben,wäre das nicht der Moment derLyrik? Das wir eine Sprache, die wir jeden Tag in den Mund nehmen,die wir jeden Tag hören, dass sie uns als eine Fremde erscheint, weilsie von überall herkommt.Guido GrafSie haben von der Form gesprochen, von der notwendigen Form die-ses Romans oder Ihres Schreibens überhaupt, dass es nicht darum ge-hen kann, irgendwelche geraden Formen zu finden, sondern dass eseher gebrochene, gekrümmte Formen sein müssen, dass es umDurchstreichungen geht, also eine Linie,über die Sie gekommen sind,als Durchstreichungen zu verstehen und in diesem Sinne dann folgtder Satz: Ich bin ein Schriftsteller ohne Sprache.Wird die Sprache daeigentlich selbst zu einer Durchstreichung?Senthuran VaratharajahSie haben die Linien erwähnt und ich muss dann oft an an eine Reihevon Gemälden aus einem Zyklus von Barnett Newman denken. Einamerikanischer Maler, der dem sogenannten Abstrakten Expressio-nismus zugeordnet wird. Und ich habe zum ersten Mal diesen Zyklus2017 gesehen in Washington, in der National Gallery of Art und derZyklus heißt Stations of the Cross und in Klammern Lema Sabachtha-ni. Und es sind 13 Gemälde, wenn ich mich richtig erinnere, und eine
Coda, in der in unterschiedlichen Variationen nur eine vertikale Liniedargestellt wird. Barnett Newman spricht von »The Zip«,was für ihnauch separateness bedeutet.Man könnte auch vielleicht von Einsam-keit sprechen, von Getrenntheit. Und Newman sagt: Wenn jemanddiese Linie sieht,möchte er, dass diese Person nicht nur erinnert wirdan die separateness, an die Getrenntheit und Einsamkeit von BarnettNewman, sondern auch an die eigene. Ich habe Deutsch gelernt an-hand der Bibel, weil mein Vater, während wir im Asylbewerberheimwaren, sehr früh zu den Zeugen Jehovas konvertierte. Das heißt,Deutsch habe ich nicht gelernt in einem sogenannten natürlichenUmfeld, sondern in einem biblischen, in einem theokratischen. Da-mals, als Kind, dachte ich, dass die Bibel auf Deutsch verfasst wordenist. Ich wusste nichts von Übersetzung. Ich wusste vielleicht geradedeshalb nichts von Übersetzung,weil das Übersetzen unsere Lebens-realität war. Nicht nur von einer Sprache in die anderen, sondernauch unsere Körperwurden übersetzt von einemUfer zu einem ande-ren, von einem Kontinent zu einem anderen, von einem Alphabet,von einer Sprache in eine andere. Das Tamilische, das Deutsche unddas Englische. Diese drei Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin,unterscheiden sich, wenn man sie sich als Linien vorstellen mag,grundsätzlich. Das Tamilische und das Englische waren für mich im-mer horizontal verlaufende Sprachen, von Mund zu Ohr und Ohr zuMund,wohingegen das Deutsche fürmich eine vertikale Sprachewar.Sie kam von Gott und nur von Gott.Wenn ich bete, dann ging sie vonmir zu Gott. Ich glaube,das ist vielleicht auch heute einer derGründe,weshalb fürmich das Deutsche,und das ist nur eine biografischeAus-sage, keine Aussage von universeller Bedeutsamkeit, eine Sprache ist,die einen besonderen Grad an Intimität, Intensität und Pietät besitzt.Guido GrafDann kann diese Sprache durch solche Durchstreichungen, Über-schreibungen,Auslöschungen, können diese Vertikalen als Vertikalensichtbar werden?Senthuran VaratharajahIch habe versucht, in Vor der Zunahme der Zeichen die vertikale Liniein die horizontale zu verlegen. Das kann natürlich nur dann funktio-nieren, wenn ich die Gesetzmäßigkeiten, die unser konventionellesVerständnis von Dialog und Gespräch definieren, außer Kraft setze,d.h. es gibt hier keine Rede und Gegenrede, keine Frage und Antwort,sondern dieses Gespräch funktioniert nach anderen Prinzipien.Weil– und das ist auch eine biografische Erfahrung – ich, wenn ich vondiesen Dingen erzählen wollte, ich gemerkt habe, dass die Form dertraditionellen Rede nicht ausreicht. Aber auch das ist für mich einetheologische Frage.Das Erzählen geht eigentlich von diesen Prinzipi-
Do this Book or Die Do this Book or Die
74 75
en aus, nämlich vom Glauben. Glaube ich dir und habe ich Glaube andich? Und ich glaube, dass der Versuch, diese vertikale Linien in dieHorizontale zu verlegen, nur dann funktionieren kann, weil Valmiraund Senthil sich nicht anschauen. Es ist in etwa so,wie bei Jabés, dassdie Kreatur ihre Liebe zum Göttlichen darin bezeugt hat, dass sieGott als unsichtbar, als nicht vorstellbar sich hat vorstellen können.Und das ist für mich auch die äußerste Bedeutung. Dieser Satzkommt in dem Roman zweimal vor: Bis zur äußersten Bedeutungmüssen wir gehen und es wird nicht weit genug gewesen sein.Wennich mir Gott vorstellen kann, dann kann ich mir grundsätzlich allesvorstellen. Das ist dann eine literarische Frage und keine theologi-sche mehr.Guido GrafDie Abwesenheit der Sprache in der Sprache ist dann eigentlich das,was dabei hergestellt wird,wenn die Vertikale in die Horizontale ver-schoben wird.Senthuran VaratharajahSie wissen, dass das Kreuz eben auch diesen Schnittpunkt hat, indemsich Endlichkeit und Unendlichkeit, Diesseits und Jenseits, dasMenschliche und das Göttliche schneiden. Und dass es dann in dergroßen Erzählung des Christentums eben die Ankunft von Christusgewesen ist. Ichweiß nicht, ob das mir im ersten Roman gelungen ist.Wenn ich jetzt zurückdenke, dann habe ich manchmal den Eindruck,ich habe mir das Empfinden nicht erlaubt und der Roman ist an vie-len Stellen für mich bloße Reflexion. Die Reflexion ist natürlich et-was, was ich sehr wertschätze, nicht nur aus der Philosophie kom-mend, sondern auch als ein grundsätzlicher Modus des literarischenDenkens. Ich glaube, Literatur, wie ich sie mir vorstelle und die ichgerne verkörpern und die ich gerne schreibenmöchte, ist jenseits vondem,was wir heute Storytelling nennen, das sich als bloßes Erzählenvon sogenannten Geschichten bewegt, sondern das ist ein Modus derReflexion, das heißt, wie wir mit Formen umgehen, wie wir mit Syn-tax umgehen,wie wir mit Sprache umgehen,wie wir mit Grammatikumgehen, wie wir lesen. All das kann ein kritischer Modus sein, wiewir unser Selbst und Weltverhältnis neu arrangieren. In der Syntaxund in der Grammatik ist festgelegt,wiewir uns dieWirklichkeit vor-stellen,wie dieWirklichkeit geordnet sein soll.Das lyrische Sprechen,das lyrische Schreiben ist gerade der Versuch, hier einzubrechen. Dasheißt aber gleichzeitig, diese Sprache aufzubrechen. Hier haben wirbeides, die Bewegung von oben nach unten, den Einbruch und vonunten nach oben,denAufbruch, also das Sprechen Gottes zumir, aberauch das Gebet, das Sprechen von mir in die Leere, die vielleicht Gottsein kann.
Guido GrafIch sehe diese Art der Reflexion als eine außerordentlich körperlicheTätigkeit an und habe sie auch so gelesen oder lese sie, wenn ich aufandere Texte von Ihnen oder viele der Texte komme, die Sie zitieren,Jabés oderMaurice Blanchot. Diese Texte lese ich als körperliche Tex-te. Es gibt in einem langen Text von Ihnen über Gedichte von OceanVuong den Satz: »So eine Sprache ist so nah an ihrem Gegenstand,dass sie körperlich ist. Sie ist so an der Zerstörung, die ihr vorausge-gangen ist und die ihn allein in den Stand des Sprechens setzte.« Die-sen Zusammenhang finde ich entscheidend, aus der Zerstörung, ausder Auslöschung nicht nur denWiderstand zu brechen, überhaupt zuschreiben, sondern eben dieses Instandsetzen wieder eine doppelteBewegung werden zu lassen.Senthuran VaratharajahDas hat mit zwei Dingen zu tun, nämlich einmal mit der grundsätz-lichen Gefahr, der wir ausgesetzt waren in Sri Lanka, im Bürgerkrieg,aber natürlich auch mit der Reduktion auf bloße Körper und bloßeKörperlichkeit, hier in Deutschland nämlich, dass wir nur das waren,Körper und dunkle Haut.Und damals, in den 90er Jahren, als die NPD,die Republikaner und die DVU sehr stark waren, habe ich immer ge-dacht, wenn auf Demonstrationen gerufen wurde »Haut ab!«, dasswir unsere Haut abziehen sollten. Wir waren reduziert auf die bloßeKörperlichkeit und insofern hat der Körper hier eine ganz andereFunktion. In dem ersten Roman habe ich versucht, über diesen Kör-per zu sprechen, indem dieser Körper nicht in demText erscheint, in-dem er nur Sprach- und Schriftkörper geworden ist. Das ist etwas,was mit der Konzeption des Romans zusammenhängt. Es ist ein Ge-spräch, könnte man sagen, als Nicht-Gespräch, vielleicht der Traumeines Gespräches oder die Idee eines Gesprächs, aber ohne Bilder. Esgibt neben den Namen kein Profilbild und Senthil und Valmira be-schreiben die Bilder. Sie werden in dem Roman nicht abgedruckt.Dashat fürmich sehr starkmit einem der grundsätzlichen Prinzipien desliterarischen Schreibens zu tun, nämlich mit dem Bilderverbot. Ichdarf mir kein Bildnis machen und das Bildnisse von uns gemachtworden sind, von rassifizierten Menschen, das ist die Lebensrealitätin diesem Land, aber leider nicht nur in diesem.Guido GrafKörper und Textkörperwerden dann eins, im Sprechen, im Lesen undsicherlich auch in der Wiederholung des Schreibens. Dieses Aufbre-chen und Einbrechen findet in einer gewissen Konkurrenz statt.
Do this Book or Die Do this Book or Die
76 77
Senthuran VaratharajahAbsolut.Und ich habe 30 Jahre gebraucht, um diesen Zusammenhangnicht vielleicht unbedingt verstehen, aber ihn einordnen zu können.Auf der einen Seite gibt es ja die Reduktion der sogenannten weißendeutschen Mehrheitsgesellschaft. Dieser Körper hat hier nichts zusuchen.Dieser Körper ist ein Fremdkörper.Davon handelt ja auch derText von Nancy,Der Eindringling, über denwir gesprochen haben.DieFrage nach dem Körper, dem Fremdkörper und der Grenze des Kör-pers, aber auch des Körperlichen. Auf der anderen Seite auch die Re-duktion der Eltern als eine Art von Verweigerung, kein Zugeständniszu geben an diese sogenannte Mehrheitsgesellschaft, weil das aufden Verrat der Herkunft hinauslaufenwürde.Was passiert mit diesenKörpern? Wohin mit diesen Körpern? Als ich 2019 im September inJaffna war, in Yalpanam, der Stadt, in der ich geboren wurde, zumin-dest der Erzählung meiner Eltern nach, habe ich dort zum ersten Maldiese seltsame Erfahrung erlebt. Ich habe nämlich grundsätzlich,physisch begriffen: Das ist der Boden, auf dem meine sogenanntenVorfahren gelaufen sind. Das ist das Meer, indem sie geschwommensind, das ist das Meer, das meine Eltern gesehen haben. Ich kanntediese Erfahrung nicht, weil ich immer von dem Übersetzen ausge-gangen bin. Wir sind einfach irgendwo verlassen worden, geworfenworden,und es spielt keine Rolle,wo es ist. Zum erstenMal dachte ichmir, wie verrückt das eigentlich ist, dass meine Vorfahren sich viel-leicht gar nicht vorstellen konnten, dass wir diesen Raum irgend-wann verlassen werden. Dass es Gründe geben könnte, dass wir die-sen Ort nicht mehr als den Ort unserer Herkunft bezeichnen. Ichdachte, die beschränkte Vorstellungskraft ist insofern auch ein Prin-zip, was den Bereich des Ethischen berührt, nicht nur der Ästhetik.Können wir uns etwas vorstellen jenseits unserer eigenen partikula-ren Erfahrungen? Ich hatte große Angst vor dem ersten Roman undich bin ich bin froh, dass in den Rezensionen das kein Thema war.Aber ich kannmich noch sehr genau erinnern anmeine erste Lesung.Meine erste Lesungwar beim Bachmannpreis 2014.Und vielleicht dasnoch als eine kleineVorgeschichte: Ichwollte nicht Schriftstellerwer-den, ich wollte entweder Pfarrer werden oder Professor für Geschich-te der Philosophie.Als ich anmeiner Doktorarbeit saß über das Frem-de in der klassischen deutschen Philosophie, vor allem bei Kant undbei Hegel, ausgehend von Platon und dann aber auch von Freud, habeich gemerkt,wie beschränkt die Sprache der Universität ist. Diese in-stitutionalisierte Sprache. Ich habe das natürlich schon vorher ge-merkt, aber zum ersten Mal habe ich diese physische Enge gespürt.Dann habe ich angefangen, diesen Roman zu schreiben. Ich wurdeeingeladen, beim Bachmannpreis zu lesen. Was ich oft gehört habe
damals war: so spricht niemand, so kann keiner sprechen. Ich erinne-re mich daran, das ist vielleicht eine sehr persönliche Aussage, aberich glaube, über diese persönlichen Dinge müssen wir ab einem ge-wissen Punkt sprechen. Alles andere führt nur dazu, dass wir verlet-zendes Verhalten reproduzieren. Es ist mir sehr unangenehm, dar-über zu reden. Es ist etwas sehr Persönliches, aber ich sage es den-noch: Nach dem Bachmannpreis konnte ich drei Monate lang dasSofa nicht verlassen. Ich war damals Stipendiat im Haus von GünterGrass. Ich hatte das Döblin-Stipendium derAkademie der Künste undich verbrachte jeden Tag damit, auf ProSieben How I met your motheranzuschauen. Und ich habe dabei gelacht. Dann können Sie sich denGradmeinerVerzweiflung vorstellen.Meine damalige Freundin sagtezu mir: Vielleicht musst du es dir so vorstellen: Wenn du Applaus be-kommen würdest, nur Applaus, dann solltest du dich fragen, ob dunicht etwas falsch gemacht hast. Ich wusste, dass wir für unsere Vor-stellungskraft kämpfen müssen. Ich weiß, dass wir unser ganzes Le-ben lang darum kämpfenmüssen, dass die beschränkte Vorstellungs-kraft auf der einen Seite der weißen Menschen und ihrer Institutio-nen und Autoritäten, aber auf der anderen Seite in einer wesentlichschwächeren, aber auch gewaltsameren Form, der Eltern und der so-genannten Community, dass wir in diesem kleinen Raum,der uns ge-währt wird, weder leben noch erzählen können. Ich bin jetzt 36 Jahrealt und erst jetzt weiß ich: Vielleicht spricht niemandwie ich, und ichempfinde das nicht als einen Makel. Ich empfinde nicht Scham, ichempfinde das als ein Geschenk.Guido GrafEs gab seit dem Jahr 2015 in verschiedenen Debatten immer wiederdie Frage, wenn in den ostdeutschen Bundesländern Flüchtlingsun-terkünfte angegriffen wurden, ob die vergessen haben, dass sie auchversucht haben zu fliehen. Oder: Was ist mit den Revanchisten, dienach dem Zweiten Weltkrieg geflohen sind und ihre Fluchtgeschich-ten auch über Generationen weitergetragen haben? Mir scheint, dasses vielleicht genau darum nicht geht, um eine Amnesie, sondern dasses eigentlich eher etwas Skalierbares ist, dass es also nur darum geht,wie manifest diese Brüche in der Sprache sind, in den Körpern, wiesichtbar,wie hörbar. In demMoment,wo ich diese Unterschiede auchhierarchisch, in der Vertikale habe, kann ich damit Macht ausübenund Gewalt ausagieren.Senthuran VaratharajahWir haben über die Wiederholung gesprochen und kamen dann zuThe Walking Dead. Ich glaube, man könnte vielleicht sich vorstellen,dass Symbole und Motive sich verändern über die Zeit.Wenn wir unsdie Geschichte des Zombiefilms anschauen, bei Romero zum Beispiel,
Do this Book or Die Do this Book or Die
78 79
dann werden die Zombies als die Arbeiterklasse vorgestellt, die sichorganisieren kann. Ich glaube, das Motiv des Zombies hat sich überdie Zeit verändert.Wir leben ja in einer Zeit, in der extrem viele Zom-bie-Filme gedreht worden sind und immer noch große Popularitätgenießen.Manchmal denke ich, vielleicht ist der Zombie gerade jetztzu einem Symbol oder zu einem Stellvertreter des geflüchteten Men-schen geworden. Zum ersten Mal habe ich darüber nachgedacht, als2015 in der Süddeutschen Zeitung eine Fotografie abgebildet wordenist, die von einerDrohne aufgenommenwurde.Auch das ist ein inter-essantes Detail, weil die Drohne natürlich aus dem Militär kommt,ein militärisches Medium, das dann späterauch von der Zivilbevölke-rung benutztworden ist.Man konnte die sogenannte Balkanroute se-hen,wie eine Gruppe von Menschen verschmutzt und langsam läuft.Auf einmal war diese Assoziation da. Das sind doch Bilder, die wirkennen. Der Zombie genauso wie der geflüchtete Mensch ist – psy-choanalytisch können wir sagen – die Wiederkehr des Verdrängten,die Wiederkehr dessen, woran man sich nicht erinnern möchte. Dasist einer derGründe,weshalb so vieleMenschen,die vielleicht in ihrerpersönlichen Biografie oder in der Familienbiografie Ähnliches erlebthaben, mit dieser Strenge reagieren. Wir dürfen uns nichts vorma-chen: 2015 haben das ganze Feuilleton, alle Journalist:innen und auchdie weiße Mehrheitsbevölkerung in Deutschland so getan, als sei dasein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik, dass Menschenkommen. Es sind schon immer Menschen in die Bundesrepublik ge-kommen, in die Berliner Republik, nach Westdeutschland, nach Ost-deutschland, in das,was einmal Deutschland vielleicht war, die soge-nannten Hugenotten, die Ruhr-Polen, die sogenannten Heimatver-triebenen, die Spätaussiedler, die sogenannten Asylanten, die soge-nannten Boat People, die sogenannten Vertragsarbeiter:innen und soweiter und so fort. Die Art und Weise, wie darauf reagiert wird, dieseStrenge hat auf der psychoanalytischen Ebene genau damit zu tun,dass man das sieht, dass man sein ganzes Leben lang versucht hat zuverdrängen. Es kommt nicht von ungefähr, glaube ich – und das ver-stehe ich auch jetzt erst langsam -, dass die drei großen Philosophen,mit denen ich mich während meines Studiums beschäftigt habe, Pla-ton,Hegel und Freud,nicht nur die drei großen Philosophen der Erin-nerung sind, der Anamnese, sondern auch die drei großen Philoso-phen der Erotik sind. Das ist für mich aber auch die Beziehung zudem zweiten Roman, den ich gerade schreibe. Der erste Roman, sozumindest habe ich das sortiert in der Erzählung, die ich fürmein Le-ben halte, handelt von der Einsamkeit des Sprechens und der Ein-samkeit der Sprache.Der zweite Romanmuss von der Einsamkeit des
Sprechens, der Einsamkeit der Sprache, aber als Einsamkeit des Kör-pers erzählen können.Guido GrafResultiert aus dieser Einsamkeit des Körpers im Vokabular eine Me-taphorik, die immer auch etwas mit einer Rhetorik der Gewalt zu tunhat?Senthuran VaratharajahFür die grundsätzliche Erfahrung von Einsamkeit und nicht unbe-dingt von Sprachlosigkeit gibt es einen Unterschied: nicht sprechenzu können ist eine Erfahrung, die alle Menschen machen, auf die jeeigeneArt undWeise und aus den je eigenen verschiedenen Gründen.Aber in einer kapitalistisch-neoliberalen Gesellschaft, in derwir erzo-genwerden, Ellenbogen auszupacken, sprichtman nicht darüber.Vondiesen Dingen zu sprechen, ist ein Zeichen von Schwäche. Man zeigtkeine Verletzungen. Man zeigt keine Angst. Man erzählt nicht vonden Dingen, die einemwiderfahren sind.Aber ich habe das immer soerlebt. In der Literatur kann man davon erzählen. Und die Literatur,die mich berührt hat, war immer die Literatur, die nur davon erzählthat. Einer der Texte, der das für mich gebündelt hat, ist von Margue-rite Duras: Hiroshima Mon Amour. Eine der wesentlichen Stellen istdie, in der die weibliche Stimme zu dem Mann sagt: »Verschlingemich, verforme mich bis zur Hässlichkeit. Ich bitte dich darum, war-um nicht du?« Und der Roman fängt nurmit diesem Satz an, als Ein-gangszitat: »Ich bitte dich darum.«Guido GrafDie Einsamkeit des Körpers haben Sie auch in Ihrem Text imMerkurthematisiert. Es geht darum, Einsamkeit zu beenden, aber eine Ein-samkeit, die nicht enden wird. Ich kenne bislang das Exposé Ihresneuen Romans, der 2022 erscheinen wird, und darin heißt es, diesesBeenden von etwas, das nicht enden wird, wird versucht durch Ein-verleibung, durch Entleiben, durch eine Überschreitung der Körper.Senthuran VaratharajahExakt. Das ist sehr stark geprägt nicht mehr von Duras, sondern auchvon Bataille, aber auch von unserer konventionellsten Rede. Wir sa-gen ja solche Dinge wie: Ich habe dich zum Fressen gern. Ich möchtedich aufessen. I wanna eat you out. Das geht in unterschiedlichenSprachen. Im Türkischen sagen wir »yerim seni«. Dieses Motiv derEinverleibung, vom Mund ausgehend, ist etwas, was in vielen Spra-chen repräsentiert ist als eine Form der Erinnerung an unsere Ein-samkeit. Manchmal glaube ich, dass die Sprache die Dinge für unsträgt, die wir nicht ertragen können.Vielleicht ist das Gegenteil wahr,dass nicht unser Unbewusstes strukturiert ist wie Sprache, sondern
Do this Book or Die Do this Book or Die
80 81
unsere Sprache unser Unbewusstes ist. Wenn wir davon ausgehen,dann stimmt das vielleicht, wenn Georges Bataille sagt, »The kiss isthe beginning of cannibalism.« (1: Es gibt in Georges Batailles »L'éro-tisme« einen kurzen Abschnitt über den Kannibalismus, der aller-dings nicht dieses Zitat enthält). Und wenn ich sage I wanna eat youout, wenn ich sage »yerim seni«, wenn ich sage »Ich habe dich zumFressen gern«, dann bin ich ein Kannibale. Dann habe ich genau dasgetan. Mein zweiter Roman handelt von dem sogenannten Kanniba-len von Rotenburg, Armin Meiwes, der 2001 im Internet auf BerndBrandes gestoßen ist, auf dessen Anzeige, in der er sich zum Essen,zumVerspeisen angebotenhat.ArminMeiweswar auf der Suche nachjemanden, den er verspeisen konnte. Aus der absoluten Einsamkeitheraus. Ich möchte diese Geschichte, die ein bundesrepublikanischerSkandalwar,umschreiben,nämlich als eine Liebesgeschichte und dasnicht nur anhand der psychiatrischen und forensischen Gutachten,sondern eben auch mit den Mitteln der Philosophie und der Litera-tur. Das heißt, mit den Mitteln der Eindringlichkeit und des Ernstes,der Sprache und unseres Sprechens. Diese Geschichte wird parallelgeführt zu einer anderen Geschichte, einer Geschichte der Trennung.Das heißt, es gibt zwei Erzählstränge: die Geschichte eines Verlustes,eine autofiktionale Erzählung, und auf der anderen Seite die Ge-schichte eines Findens: Armin Meiwes und Bernd Brandes. Für michheißt es also hier:Wo verläuft diese Grenze? Im ersten Roman ging esum die Grenze des Sprechens, um die Grenze der Sprache, wohlge-merkt nicht um die Grenze des Sagbaren. Jetzt geht es darum, wennes die Grenze des Sprechens gibt und die Grenze der Sprache: in wel-chem Verhältnis stehen diese Grenzen zur Grenze des Körpers undwelche Grenze ist der Körper eigentlich? Ist das: Fleisch, Haut, Haare,Knochen? Oder können wir diese Grenze, diesen Körper, anders ar-rangieren? Dieses andere Arrangieren, das ich von Bacon gelernthabe,von Francis Bacon,demMaler, der Körper anders arrangiert hat,der Körper in ihrer absoluten Deformation dargestellt hat, weil dasihre einzige Formation, ihre einzige Form ist: das ist auch eine Frageder Lyrik.Wie können wir die Sätze anders arrangieren, damit etwas,was vielleicht unsere Erfahrung einmal sein könnte oder gewesensein mag, sich zeigen kann für den Augenblick einer Sekunde? Wennwir uns auf die Geschichte der Schrift und des Schreibens anschauen,dann ist die Geschichte der Schrift und die Geschichte des Schreibensnatürlich auch eine Geschichte der Verletzung. Pergament, nicht ge-gerbte Tierhaut. Wir haben auf die Haut geschrieben und wir habendamit aber auch die Haut verletzt, nicht nur während des Schreibensmit der Feder,mit der Spitze des Skalpells, sondern bereits in der Pro-duktion. Aber wie können wir uns das vorstellen? Manchmal denke
ich an diesen Satz von Hegel: »Der Begriff schlägt dieWunde, die nurder Begriff heilen kann«.Wagner hat das später im Parsifal übernom-men, in dem es dann heißt, auch hier dialektisch: Der Speer schlägtdie Wunde, die nur der Speer heilen kann. Aber wie können wir unseine Sprache vorstellen, die diese notwendigen Verletzungen erzähltund damit in einerArt auch uns erinnert an all das,was uns entwederwiderfahren ist, aber vielleicht auch an all das, was uns hätte wider-fahren sein können? Auf der anderen Seite appelliert sie an eine Spra-che, die eben nicht mehr verletzt. Wie kann das aussehen? Wie kön-nen wir davon erzählen? Manchmal denke ich, weil ich mich gerademit Hölderlin auseinandersetze: Vielleicht könnenwir davon nur sin-gen. Einer der wesentlichen Sätze aus meiner Kindheit ist aus demLied Jesus to a child von George Michael, aus seinem 1996 veröffent-lichten Album Older. Dort heißt es »So the words you could not say,I'll sing them for you«.Und in der Friedensfeier vonHölderlin sehe icheine kleine Parallele, wenn es dort heißt: »Bald sind wir aber Ge-sang«. Manchmal sehe ich auch eine Parallele zu Kendrick Lamar,wenn er singt: »sing about me im dying of thirst«. Vielleicht könnenwir davon nicht erzählen, sondern nur singen und dann sind wir be-reits im Bereich der Liturgie und, glaube ich, auch im Bereich der Ly-rik.Guido GrafIst das auch der Grund, warum der Roman drei Teile haben wird, einTriptychon, dessen mittlerer Teil aus Gedichten besteht?Senthuran VaratharajahSo ist es.Angelehnt an den Satz vonMaurice Blanchot ausDas Unzer-störbare,wo es heißt, Prosa sei die kontinuierliche Linie und Lyrik diegebrochene. Je mehr ich darüber nachdenke, glaube ich, dass ich mitdiesem Roman vielleicht nochmehrmich erinnern kann.Obwohl dererste Roman ein Buch über das Erinnern und die Unmöglichkeit desErinnerns ist, passiert hier gerade das, was im ersten Roman hättevielleicht passieren sollen, dass ich mich erinnere an das gebrocheneDeutsch meiner Eltern. Ist das bereits die gebrochene Linie? Ist dasbereits die grundsätzliche Erfahrung von Lyrik? Kannibalen: Ich habeimmer geglaubt, dieser Roman geht nur von der Frage nach der Kör-perlichkeit und der Erotik aus. Aber die Kannibalen? Der Begriff desKannibalen ist natürlich auch ein rassistischer Begriff gewesen. 1503hat Vespucci, der, wenn ich mich richtig erinnere, die brasilianischeKüste bereist hat, einen Text geschrieben: Mundus Novus, Die neueWelt. Dort erzählt er von den sogenannten Kannibalen. Das wirddann später zu einemMotiv in der sogenannten Kolonial- und Entde-ckerliteratur,was immerwieder bedient wurde,weil die Menschen inEuropa genau das lesen wollten. Das heißt, Vespuccis Werk wurde in
Do this Book or Die Do this Book or Die
82 83
mehrere Sprachen übersetzt und bis heute wird es im Lateinunter-richt verwendet,weil es ein einfaches Latein ist. Das wurde ins Deut-sche übersetzt, ins Französische und ins Niederländische. Der Kanni-bale, das waren wir, die nichtweißen Menschen. Der Kannibale warein Begriff, ein Name, zu demwir geworden sind,weil die beschränk-te Vorstellungskraft von weißenMenschen nicht ausgereicht hat, umsich ein anderes Leben vorzustellen. Wie bei meinem ersten Romanmanchmal gesagt wurde,wie gesagt zum Glück nicht in der Rezepti-on, im Feuilleton. Aber damals auch in Klagenfurt: So spricht nie-mand. Dann wurden wir aus der Vorstellungskraft weißer Menschen,dann wurde dieser Text aus der Vorstellungskraft weißer Menschennicht nur suspendiert. Er wurde nihiliert. Er wurde negiert. Es spieltkeine Rolle.Wir müssen uns vorstellen: Auch heute in unterschiedli-chen literarischen, ästhetischen Erfahrungen gehen wir davon aus,dass unsere partikularen Erfahrungen bestätigt werden müssendurch die Literatur, diewir lesen.Das heißtwir universalisieren unserErleben. Die Frechheit und die Gewalt, die mit diesem Modus, dersich für einen intellektuellen ästhetischen Modus ausgibt, einher-geht, wird kaum verstanden. Es ist auch insofern eine zirkuläre, einetautologische Form des Lesens, weil wir in der Welt nur das sehenwollen, was wir ohnehin schon wissen. Aber Erfahrung ist der Ein-bruch von etwas, was wir nicht kennen. Das ist auch meine grund-sätzliche Leseerfahrung gewesen. Wenn ich ein Werk gelesen habe,das mich getroffen hat bis ins Mark meiner Grammatik hinein, dannkonnte ich danach nicht mehr sprechen. Ich habe mich geschämt,vorher überhaupt diese Dreistigkeit besessen zu haben, gesprochenzu haben,weil ich nichtwusste, dass dieWörter und dasArrangementder Syntax falsch waren. Ein Werk, das nicht das mit uns macht, wasuns nicht an das Ende unseres Alphabets führt, das uns nicht be-schämt in unserem Sprechen und uns aufbürdet, erfordert neue For-men zu finden, neue Formen des Erzählens jenseits der eigenen Vor-stellungskraft sich zu bewegen, ist ein Werk, das korrupt ist, weil esdiese Form des Erzählens und diese Form der Wahrnehmung repro-duziert, die so vielen Menschen das Leben gekostet hat und immernoch kostet.Guido GrafDas sind die Tränen von Caliban, der wieder träumen möchte.Senthuran VaratharajahEs gibt diesen Satz von Meister Eckhart: Nur Gott schmeckt sichselbst. Und ich frage mich: Wie kann das aussehen, einen Roman zuschreiben, einen Text zu schreiben, der in sich, so an und für sich ist,dass er eigentlich niemanden braucht? Keine Menschen, die diesesWerk lesen und vielleicht auch nicht den Menschen, der dieses Werk
geschrieben hat. Ist es möglich, ein solches Werk zu schreiben? EinWerk,das gleichgültig ist gegenüber all den politischen, emotionalen,philosophischen Anforderungen, die wir an ein Werk heute stellen?Ich war sehr glücklich, zu sehen, als 2016 eine Anzahl von Romanenherausgekommen sind von Menschen, die transkontinentale Flucht-und Migrationserfahrung erlebt haben. Ich denke an Rasha Khayat,Shida Bazyars Romane, ich denke an Pierre Jarawan und an meinenRoman, die zeitgleich veröffentlicht worden sind, alle geschriebenvonMenschen,die in Deutschland groß geworden sind.Auf der ande-ren Seite gibt es natürlich eine große Tradition. Wir stehen auf denSchultern von Giganten, deren Namen wir nicht kennen. Wie vielenichtweiße Menschen haben versucht zu erzählen und deren Werkekonnten nicht veröffentlicht werden, weil die beschränkte Vorstel-lungskraft von Lektor:innen nicht ausgereicht hat, sich das vorzu-stellen. Nicht nur sich das vorzustellen, sondern auch diese Literatureinem Publikum zuzumuten.Unswurde nicht geglaubt und niemandhatte Glaube an uns und auch niemand hatte Glaube für uns. Jetztauf einmal zu sehen, wie viele Werke von nichtweißen Autor:innenveröffentlicht werden, die erzählen von all diesen unterschiedlichenDingen. Ich glaube,das ist sehr, sehrwichtig.Nicht nur angesichts derveränderten Diskurse, sondern auch um zu wissen, dass wir in dieserEinsamkeit ganz alleine sind und dass jeder in dieser Einsamkeit ein-geschlossen ist. Es gibt keine Korrespondenz von Erfahrung. Es gibtkeine Ähnlichkeit. Es gibt in dieser Form auch keine Solidarität. Fürmich heißt das aber auch, dass wir – und ich spreche einmal mehrvon diesem fiktiven Kollektiv, von rassifizierten Autor:innen – dasswir nicht so erzählen dürfen,wie immer erzählt worden ist.Wir kön-nen keine klassischen Romane schreiben,wie klassische Romane im-mer geschrieben worden sind.Wir können nicht erzählen,wie in die-sem Land immer erzählt worden ist. 2018 hat Christian Kracht inFrankfurt seine Poetikvorlesung gehalten und er hat von einer Kor-rektur gesprochen, die er in Faserland vorgenommen hat, nämlich,dass der Porsche nicht türkisfarben, sondern maulbeerfarben ist.Diese Unverschämtheit, diese Dummheit, diese Dreistigkeit, mit dersich Menschen abgegeben haben und die sie für Literatur gehaltenhaben, diese saturierte bürgerliche Selbstzufriedenheit: haben wirdas für Literatur gehalten? Ist das die Literatur, die uns berühren soll?Heute haben sich die Diskurse verändert. Heute leben wir in einerWelt, in der es so viele Bilder gibt. Keiner kann es mehr leugnen.Aberauch damals konnte niemand leugnen, was auf dieser Welt und wasin diesem Land passiert.Dennochwar und ist bis heute die Poplitera-tur, diese männlichweiße Literatur, immer noch ein Standard des Er-zählens.Wennwir heute erzählenwollen,müssenwir uns verabschie-
Do this Book or Die Do this Book or Die
84 85
den von all den Prinzipien des Erzählens.Wirmüssen uns verabschie-den von dem Erzählen und der Sprache selbst. Diese Ideologie, einenRoman mit einem starken Satz anzufangen, ist eine Ideologie, die soomnipräsent ist. Ich habe mit meinem Freund Anuk Arudpragasamgesprochen, dessen Roman in deutscher Übersetzung bei Hanser er-schienen ist – Die Geschichte einer kurzen Ehe, und er meinte: »alsich meinen Roman geschrieben habe, habe ich angefangen mit einerAmputationsszene, weil ich wusste, die amerikanischen Lektorinnenhaben nur fünf Minuten Zeit für einen Text und dann muss es einenstarken Anfang geben.Dieser Effekt, eine Literatur, die sich dieses Ef-fektes bedient, ist für mich eine unredliche Literatur. Das ist eine Li-teratur, die Zugeständnisse an ein bereits korrumpiertes Publikummacht, statt das Publikummit einem Einbruch zu verändern. Bei unsimVerlagshaus S. Fischer gibt es diesen Satz von Samuel Fischer, demGründer des Verlages: «Man darf den Menschen nicht geben,was sielesen wollen.Man muss ihnen geben,was sie nicht lesen wollen.« Li-teratur muss eine Zumutung sein. Aber nicht nur, indem was erzähltwird, sondern auch, indem, wie wir erzählen. Ich glaube bis heute –und das war auch der Imperativ für meinen ersten Roman –: DieserRoman darf nicht funktionieren nach den traditionellen Vorstellun-gen,wie ein Roman zu funktionieren hat. Das gilt auch für den zwei-ten Roman.Wirmüssen die Formen aufbrechen.Wirmüssen Spracheaufbrechen.Wir müssenWörter aufbrechen.Wir müssen uns aufbre-chen, unseren Körper und unsere Erinnerung.Wenn wir dann erzäh-len können, ist das vielleicht der Abschied von der Sprache. Das isteine Sprache, die von unten nach oben geht, wo es keinen Gott gibt.Aber eine Einsamkeit von größter Ordnung. Das wäre vielleicht einText, der nur sich selbst schmeckt.Guido Graf2008 hat Shida Bazyar bei uns in Hildesheim angefangen zu studie-ren – ich habe da auch gerade angefangen am Literaturinstitut zu ar-beiten und sie hat in ihrem ersten Semester bei mir im Seminar ge-sessen. Ein paar Jahre später, als sie auch den Master studiert unddann abgeschlossen hat mit demAnfang ihres ersten Romans Nachtsist es leise in Teheran, bin ich eigentlich aus allen Wolken gefallen,weil mir da erst wirklich klar geworden ist, was für Widerstände siedie ganze Zeit während ihres Studiums hat überwindenmüssen.Übereine lange Strecke und unsere, der Lehrenden Sprachlosigkeit hinsteht für mich eigentlich immer noch die Frage im Raum,wie stellenwir das weiterhin an? Wie präfigurieren wir etwa mit unseren Studi-enordnungen bestimmte Schreibweisen oder verhindern sie,wie för-dern wir genau diese ökonomischen Modelle, die Sie eben auch be-schrieben haben, also die ersten Sätze oder die Einstiege, die irgend-
wie catchen sollen, mit diesem Spotify-Prinzip, dass in den erstenpaar Sekunden die Hookline kommen muss und die ganze Komposi-tion sich von Musikstücken eben danach ausrichtet: Wie brechen wirdas?Senthuran VaratharajahMeine Poetik geht von einer christlichen Theologie aus und ich glau-be, die christliche Theologie ist eine Poetik. Im Anfang war das Wortund so weiter. Eine Poetik im strengsten Sinne. Wenn ich jetzt sage,dass wir andere Formen des Erzählens finden müssen, zum Beispielnicht mit starken Sätzen anzufangen, dann ist das fürmich auch sehrstark geprägt von dieser Vorstellung der lateinamerikanischen Be-freiungstheologie. Eine katholische Richtung, die sich verbunden hatmit Psychoanalyse undMarxismus, und die nur einen Grundsatz hat:»Always opting for the poor«, also die absolute Solidarität mit denSchwachen.Dass war auch einer der Gründe,weshalb in meinem ers-ten Roman kein Diskurswort vorgekommen ist. Es fällt mit keiner Sil-be das Wort Rassismus. Das heißt aber nicht, dass diese Erfahrungnicht dennoch im Roman vorkommt. Aber ich finde es auch erstaun-lich,wennman sich vorstellt,wer in diesem Land eigentlich die Mög-lichkeit hat, die Stimme einer Generation zu werden.Wer hat in die-sem Land eigentlich die Möglichkeit, einen Roman zu schreiben vonbundesrepublikanischer Bedeutsamkeit? Das sind nicht wir, das sindnicht die nichtweißen Autor:innen, die jetzt die Möglichkeit haben,bei großen Publikumsverlagen zu veröffentlichen, weil so viele unsvorausgegangen sind, deren Namen wir nicht kennen und die dieseMöglichkeiten nicht hatten. Sie müssen sich vorstellen, was es auchauf einer ganz ökonomischen Ebene bedeutet, wenn Lektor:innen –und das sind ja meistens nurweißeMenschen – darüber sprechen: Esgibt hier einen Roman von einer nicht-weißen Person, und die er-zählt. Und sie erzählt vielleicht nicht von Rassismus,was gerade heu-te natürlich auch gut vermarktbar ist.Umso schlimmer,dass das heu-te ein Trend-Thema geworden ist.Aber manchmal denke ich: ich lebe36 Jahre in diesem Land und ich bin froh, wenn es Hashtags gibt, ichbin froh,wenn es diese Bücher gibt und nicht die gleichen Erzählun-gen. Wenn weiße Menschen nicht daran vorbeikommen, wenn eskein Vorbeikommen gibt und Vorbeigehen an diesen Geschichten.Wirwerden die ganze Zeit auf diese Themen reduziert.Das heißt aberauf der anderen Seite auch, unsere Vorschüsse sind geringer, unserMarketingbudget ist geringer.Wir sind ein Risiko. Aber wenn unsereVorschüsse geringer sind, weil weiße Lektor:innen glauben, dieseWerke können niemals erfolgreich sein – damals, heute hat sich et-was verändert und ich bin ich bin sehr glücklich, das zu sehen –,dannwird sich das natürlich reproduzieren.Wenn die Erwartung geringer
Do this Book or Die Do this Book or Die
86 87
sinkt, dass Marketingbudget, dann bleiben diese Romane immer ineiner Nische. Sie werden niemals zu bundesrepublikanischen Ereig-nissen,niemals zu dieser journalistischen Leerformel: Die Stimme ei-ner Generation. Wenn man sich anschaut, welche Werke das in denletzten fünf Jahren waren, waren das meistens welche von weißenMännern oder von weißen Menschen grundsätzlich. Ich sage Ihnendas mit der Strenge, die angebracht ist: Diese dumme und dümmli-che und an sich selbst dumm gewordene Literatur – ich weiß nicht,mit wieviel Langeweile ich darauf noch reagieren kann. Ich weißnicht, welche Menschen das noch lesen wollen. Das ist unmöglich,sich so zu verschließen vor der ganzen Brutalität derWelt.Wenn Jour-nalistinnen und Journalisten nicht einmal den Unterschied kennenzwischenMilieu, Kohorte und Generation. Und sie glauben,wenn einweißer Autor dreißig Jahre erzählt in seinem saturierten Berliner bil-dungsbürgerlichen Milieu, dass das dann die Geschichte einer Gene-ration sein soll? Die Geschichte einer Kohorte, die Geschichte einesMilieus? Wer erzählt und wie kann heute erzählt werden? Das istauch eine Frage des Journalismus. Die Tatsache, dass sich nach 2015etwas verändert hat – und wir alle wissen, dass es umso schlimmerist, dass der Erfolg von unseren Büchern, von Shidas, von Rashas, vonmeinem Buch nicht alleine der literarische Erfolg ist, weil so vielegute Bücher geschriebenworden sind und niemand hat sich dafür in-teressiert. Das hat auch mit der politischen Situation in Deutschlandzu tun, dass auf einmal Journalist:innen und Leser:innen gedacht ha-ben: Es gibt Ausländer in diesem Land.Wirwollen mal wissen,was siezu erzählen haben.Wir wurden nicht gelesen mit ästhetischen Prin-zipien, sondern mit zoologischen. Nicht mal mit soziologischen, son-dern mit zoologischen. Darum hat sich das bewahrheitet: das Tier-sein, der bloße Körper sein. Sie haben von der Karibik gesprochen.Und tatsächlich gibt es diese etymologische Verbindung zwischenKannibalen und Karibik, ja,was auch auf einem von Kolumbus falschtranskribierten Wort beruht. Wir sind immer nur das: die Be-schränktheit weißer Vorstellungskraft. Ich glaube, jetzt verändertsich etwas. Aber wissen Sie, mein erster Roman handelt nicht vonRassismus.Mein erster Roman handelt nur von Sprache und Tod undvon der Einsamkeit des Erzählens. Das heißt, die sogenannte Mutter-sprache für Valmira, aber auch für Senthil: das Albanische wie auchdas Tamilische, im Kosovo wie auch in Sri Lanka waren mit dem Todbesetzt. Tamil wie Albanisch zu sprechen in der Öffentlichkeit hatden Tod bedeutet. In Sri Lanka konnteman vergewaltigt werden,mankonnte mit Macheten klein gehackt werden, in Bussen lebendig ver-brannt werden. Die sogenannte Muttersprache war mit dem Tod be-setzt. Der Tod war, so sagen wir in der Philosophie, die Bedingung der
Möglichkeit und derWirklichkeit, aber auch des Deutschen, dass wirnach Deutschland gekommen sind. Das heißt, ohne den Tod hättenwir niemals Deutsch gelernt. Ich habemich im ersten Roman gefragt:Ist Sprache identisch mit der Präsenz des Todes? Spricht der Toddurch uns, aus uns? Sind wir Stellvertreter der Menschen, die an un-serer statt gestorben sind? Ich habe jetzt in den letzten vier Jahrenüber 400 Veranstaltungen und Lesungen, Podien, Diskussionen undso weiter gemacht. Nicht nur in Deutschland, in Österreich und derSchweiz, in Singapur, in den USA, in Frankreich, im Kosovo, in Norwe-gen, in Spanien usw. und ich denke mir: Ja, natürlich. Ich würde amliebsten nicht darüber sprechen. Ich möchte nicht dieses pornografi-sche Element der Mehrheitsgesellschaft geben, aber ich weiß, wirmüssen darüber reden, ob wir wollen oder nicht. Damit es irgend-wann mal eine Generation geben kann, die nicht das Gleiche erlebenwird, was wir erlebt haben. Dass es irgendwann eine Generation ge-ben kann, deren Namen 12, 14, 15 Buchstaben haben kann und nie-mand fragen wird, niemand sich über diese Namen lustig machenwird, fragen wird, wie diese Namen geschrieben werden. Als ich mei-ne zweite Poetik-Dozentur an der Universität Bayreuth hatte zumThema Mehrsprachigkeit, schrieb eine Lokaljournalistin, der Shoo-ting-Star der Literatur mit dem schwer auszusprechenden Namen.Ihr Deutschen könnt Schostakowitsch sagen, ihr Deutschen könntDostojewski schreiben und Varatharajah bricht eure Zunge? Ja, zuRecht bricht dieser Name eure Zunge. Als ich 2017 den Bremer Litera-tur Förderpreis erhalten hatte – Terézia Mora hat den Hauptpreis er-halten – hat der Bürgermeister von Bremen, mit dem ich vorher einFotoshooting hatte, in dem alten, ehrwürdigen Bremer Rathaus, d. h.es gab die Gelegenheit zu fragen, wie dieser Name ausgesprochenwird, und daran ist nichts Schlimmes, das ist ein Zeichen des Re-spekts –, da hat er vor versammelten Publikum,vor all den Ehrenbür-gern und Honoratioren, vor all dem ehrwürdigen hanseatischen Pu-blikum, auch Leuten aus dem Literaturbetrieb, viermal meinen Na-men falsch ausgesprochen. Viermal, bis das Publikum angefangenhat, laut zu werden. Ich war verwundert darüber, dass das Publikumlaut geworden ist, nicht darüber, dass derName falsch ausgesprochenworden ist. Ich war verwundert, auf einmal zu sehen, dass es Men-schen gab, die sagten: Hey, das ist so dreist, das ist so unverschämt, sofrech, das ist eine Form der Respektlosigkeit und des Nicht-Sehens,weil nicht gesehenwerdenwill,weil nicht gesehenwerden soll.Wennwir heute lieber über die Gewalt in Amerika sprechen, die schwarzeMenschen erleben, ist das nicht die Angst der weißen Menschen. Dasist der Hass der weißen Menschen. George Floyd, Sandra Blant, EricGarner,TrayvonMartin, Briona Taylor und so weiter und so fort: Die-
Do this Book or Die Do this Book or Die
88 89
se Menschen sind nicht gestorben, weil weiße Menschen Angst ha-ben. Sie haben gar keinen Grund, Angst zu haben. Ihnen gehört jedeInstitution, jede Autorität. Es ist der blanke Hass und das Erleben indiesem Land. Als sich Hanau zum halben Jahr gejährt hat, war das inder Tagesschau die vorletzte Nachricht. Dort wurde gesprochen voneinem Anschlag, nicht von einem rassistischen Terroranschlag. Dortwurde gesprochen vonMenschenmit ausländischenWurzeln.Das istnichtmal die Diktion, dasWording des gegenwärtigen Diskurses.Wiewichtig sind wir diesem Land? Wie wichtig waren wir diesem Land?Und was passiert eigentlich,wenn wir in diesem Land unseren Mundöffnen? Ist das immer noch die gebrochene Sprache? Nein. Ich sageIhnen,was aus unseren Mund kommt. Es ist die Fremdsprache. Es istdie Sprache, die die Deutschen, die weißen Deutschen für eine Mut-tersprache gehalten haben.Aber die jetzt ihnen wieder erscheint unddie jetzt wiederkehrt als Lyrik.Guido GrafMely Kiyak hat in einer Kolumne in der ZEIT das,was als Gedenkver-anstaltung und -demonstration in Hanau untersagt worden ist, miteiner Corona-Demo in Berlin verglichen und hat vor allem auf die ro-ten Punkte hingewiesen, die in Hanau auf die Straße gemalt wurden,wo die Leute sich hinstellen sollten, sie dort stramm stehen sollten,wenn sie gedenken wollen.Senthuran VaratharajahDamit kommen wir wieder zu der Erinnerung zurück. In Sri Lankahaben die singhalesische Regierung, die srilankische Armee, die sin-ghalesische Mehrheitsgesellschaft die tamilischen Mahnmale,Mahnmale unserer Erinnerung für unsere Freiheitskämpfer:innenzerstört. Aber sie haben den Sockel gelassen, damit wir ganz genauwissen, wer über Erinnerung verfügt, wer bestimmt. In der Bestim-mung gibt es die Stimme und damit auch die Stimmlosigkeit,welcheErinnerung von Bedeutung ist undwelche Erinnerungen erzählt wer-den kann: Vielleicht gilt das für fürmanche von uns nichtweißen Au-tor:innen, dass das stimmt, was Ocean Vuong in seinem Lyrikbandsagt: »You were born because no one else was coming«. D.h. auch,dass unsere Aufgabe ist, dass sich die Menschen unsere Namen mer-ken. Es ist unsere Aufgabe, dass jeder weiß, wie unsere Namen ge-schrieben werden, was wir erzählt haben. Es ist unsere Aufgabe, dasswir nur noch Nachnamen sind, dass wir heute, dass wir irgendwannmal so sprechen können. Flaubert, Duras und wir wissen, wer ge-meint ist. Sie müssen sich folgendes vorstellen: Meine Eltern lebenimmer noch in der Kleinstadt in Bayern, in der ich groß geworden bin.Es spielt keine Rolle, wer meine Mutter war vor der Flucht. Es spieltkeine Rolle, wer mein Vater war vor der Flucht. Aber seit meinem Ro-
man begegnen die Menschen in dieser Stadt meinen Eltern mit einbisschen Respekt. Wie grausam ist das. Dass das erreicht werdenmusste, damit wir nicht nur die N-Wort sind, damit wir nicht nur dieDahergeschleiften sind, damit wir nicht nur in den Wind geschissensind, damit wir nicht nur die Ausländer sind, die Sozialschmarotzer.Diejenigen, die keine Sprache haben, die bis heute unser schönesDeutsch nicht ehren.Wieviel muss noch geschehen?Wie viele Leben,wie viele Generationen? Wenn wir nicht von uns singen, wird sichniemand an uns erinnern.Guido GrafUnd es reicht nicht zu schreiben. Es muss gesungen werden.Senthuran VaratharajahSo ist es. Es gibt diesen politischen Diskurs und es gibt auch eine Li-teratur, die sehr nahe an diesem politischen Diskurs ist. Ich möchteauch damit nichts zu tun haben.Wir reden heute von BIPOC und alldiesen Formulierungen. Das ist amerikanische Terminologie, ameri-kanische Theorie.Wenn etwas in Amerika passiert, ist es leicht zu sa-gen, das ist rassistisch.Wenn eine nichtweiße Autorin, ein nichtwei-ßer Autor aus dem angelsächsischen Bereich nach Deutschlandkommt und über Rassismus spricht, wird es ohne Frage angenom-men. Wenn jemand, der hier aufgewachsen ist, durch den die ganzeSprache gegangen ist, jeder deutsche Blick davon spricht, dann heißtes: Sei doch nicht so sensibel, du übertreibst. Und jetzt kommen wirin den Bereich der Religion. Ich glaube dir keinWort. Natürlich,wennniemand von uns singt, wenn niemand von uns erzählt, wenn nie-mand über uns spricht, dannmüssenwir das tun. Ich habe keine Lust,über diese Themen zu reden. Ichwürde so viel lieber über Poetik spre-chen.Aber ich weiß, dass es unsere Aufgabe ist, eine andere Termino-logie zu finden, jenseits von BIPOC, einen anderen Referenzkanon zufinden, jenseits von Malcom X, jenseits von Audre Lorde, derenWerkesowichtig auch fürmichwaren und es bis heute sind.Aberwir dürfennicht so faul sein und die Geschichte und die Rassismen und die Se-xismen, die Homosexuellenfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, dieFeindlichkeit gegen arme Menschen in diesem Land nicht analysie-ren. Das funktioniert nicht mit amerikanischer Geschichte alleine.Unsere Geschichte in diesem Land ist eine andere.Wir brauchen neueTheorien, neue Terminologien, neue Narrationen.Wir brauchen neueReferenzen.Wir brauchen andereMelodien.Wir brauchen andere No-tenschlüssel. Wir brauchen andere Namen. Es gibt da eine gewisseZärtlichkeit für mich, die ich immer nur für Paul Celan reservierthabe, für Paul Celan und für Stefan Zweig. Ich war 2017 mit einemFreund in Petropolis, in dem Ort, in dem Stefan Zweig die Schachno-velle geschrieben hat, im Exil. Sie müssen sich vorstellen, wir kamen
Do this Book or Die Do this Book or Die
90 91
aus Rio mit dem Auto. Auf einmal sehe ich überall nur Fachwerkhäu-ser und dieser Freund sagte, Petropolis ist 300 Meter über demMee-resspiegel gebaut worden von Einwanderern aus Tirol, weil dort dieTemperatur ähnlich sei wie in Tirol. Dort war auch die Sommerresi-denz des portugiesischen Kaisers. Überall gab es Fachwerkhäuser. Alswir dort an diesem Samstag ankamen, gab es ein bayerisches Bierfest,auf dem sie Heavy Metal gespielt haben. Die Stadtteile hießen Wies-baden und Bingen, aber ich dachte mir, wie grausam muss das fürStefan Zweig gewesen sein? An diesemOrt zu sein, auf einem anderenKontinent, in einer anderen Sprache, auf einer anderen Meereshöhe,und überall ist er umgeben mit der Sprache, die ihm all das angetanhat, die seine Sprache ist.Wie soll ein Mensch das ertragen? Und PaulCelan: Immerwenn ich Paul Celan gehört habe, aber ich Porzellan ge-hört. Ich glaube,das ist auch die Sanftheit und die Zartheit, die ich fürPaul Celan reserviert habe, sowie das auch für Stefan Zweig gilt.Mehrfür ihn als für seine Literatur. Der Zweig ist der zerbrechlichste Teileines Baumes.Das ist nicht Anselm Kiefer.Das ist nichtmonumental,aber weil es gerade der zerbrechlichste Teil eines Baumes ist, ist dasfür mich der wesentliche Teil eines Baumes. Das ist genau das: DieZerbrechlichkeit ist die gebrochene Linie. Das ist der Bereich der Ly-rik. Das ist der Bereich des Gesanges. Hölderlin hat das verstanden.Aus der Einsamkeit vonHölderlin kam dieAnrufung,die Hymne.Aberwas ist,wenn es keine Hymne gibt? Was ist,wenn wir niemanden an-rufen können? Keinen Gott, keine Namen, keine Referenzen, keine El-tern, keine Vorväter undVormütter? Dannmüssenwir selbst daswer-den. Dann müssen wir uns selbst erinnern an die Menschen, die unsvorangegangen sind.Was mich an Hölderlin immer berührt hat, wardas traurige Herz seiner Hymne. Das ist aber nicht identisch mit derHymne. Dort gibt es keinen Glanz, keinen Heiligenschein. Dort gibtes keinen Gott. Aber wo Gefahr ist, Sie wissen, dort wächst das Ret-tende auch.Das Literaturhaus Stuttgart und das Schauspiel Stuttgarthaben mich zu den Hölderlin-Tagen eingeladen. Ich habe gesternmeinen Text fertig geschrieben und das ist eine Bearbeitung der Frie-densfeier. Der erste Teil meiner Bearbeitung – I blanked it out – heißtdann: »ich bitte, dieses Blatt zu lesen. So wird es sicher sein.« GanzamAnfang heißt es: »zur Seite / zurAbendstunde denke ich,wenn duschon dein Ausland verleugnest, vom Auge vergessen bist du nicht.«Guido GrafDo this book or die.Senthuran VaratharajahAber ich denke: Do this book and die. Das ist der Abschied vom Kör-per. Das ist der Abschied von der Erzählung.Das ist der Abschied vomRoman. Das ist der Abschied von der Sprache.
Guido GrafIm Vorfeld haben wir kurz über ein Stück von Radiohead gesprochen–Where I end and you begin –, das endet mit den sich immerwieder-holenden Zeilen: »I will eat you alive« und »There'll be nomore lies«.So gesehen bekommt es einen gewissen Sinn, dass im Singen dieserZeilen auch die Möglichkeit aufscheint, in einer vollendeten Zukunft,was auch immer das sei, keine Lügen mehr haben zu müssen.Senthuran VaratharajahManchmal glaube ich,dassWalter Benjamin recht hat, so zuwidermirdas Konzept seiner Geschichtsphilosophie ist, seiner Geschichtstheo-logie, nämlich dass es diese schwache messianische Kraft gibt, die inderVerabredung der Generationen dann von einer anderen Generati-on eingelöst und erlöstwerdenmuss.Hegel spricht von derGeschich-te als Schlachtbank.Wie soll es eine Versöhnung geben, wenn so vielgeschlachtet worden ist, wenn so viel verspeist worden ist? Was füreine Zukunft steht uns bevor? Was für ein heiliges Jerusalem kanndas sein? Was für ein Paradies? Was geschieht, wenn die Wiederho-lung nicht mehr dieWiederholung ist, sondern die letzte und die ein-zige Wiederholung, nämlich die Rückkehr des Messias? Welche Welterscheint uns dann? Ich erinnere mich an die Traktate der Zeugen Je-hovas, Erwachet und Wachtturm. Es gab immer diese extrem ameri-kanischen, kitschigen Gemälde und Bilder. Sie kennen sie vielleicht:stuck in time, stuck in a cliche. Dort wird vom Jüngsten Gericht er-zählt in Bildern. Das waren die Bibelgeschichten, mit denen ich großgeworden bin. Es gab dieses Bild, in dem eine Großstadt zerstört wor-den ist, so wie Sodom und Gomorrha zerstört wurden. Ein kleinerPfad, der Pfad der Gerechten führt aus dieser Stadt heraus. DieseMenschen, die Rechtschaffenen, die Zeugen Jehovas, die Jehova be-zeugen – das ist natürlich auch die Armut Gottes, dass Gott Zeugenbenötigt, um sich seiner selbst gewiss zu sein – diese Menschen, die-ser kleine Treck, man kann fast sagen von einer Drohne aufgenom-men wie auf der Balkanroute, läuft langsam, hat gelacht. Die Men-schen waren glücklich. Die Menschen haben sich bei der Hand gehal-ten und sind einer frohen Zukunft, blühenden Landschaften entge-gengelaufen. Wenn das die rechtschaffenen Menschen sein sollen,dann möchte ich nicht Teil von ihnen sein, dann möchte ich nicht zuihnen gehören. Dann möchte ich kein Zeuge sein. Diesen Gott werdeich nicht bezeugen.Guido GrafIst das derGrund,warum Sie häufig die Form des Futur II verwenden?
Do this Book or Die Do this Book or Die
92 93
Senthuran VaratharajahJa, das ist genau das.Manche Freunde nennen das schon die Varatha-rajahsche Zukunft. Aber ich glaube nicht an die Zukunft. Ich glaubedaran, dass das stimmt: Der Messias kommt nicht am letzten Tag. Erkommt am allerletzten Tag. Er kommt zu spät und nutzlos, wenn al-les schon getan ist, wenn es nichts mehr zu tun gibt. Aber das, wasgetan werden muss, ist eine Frage unserer Hände. Das ist eine Frageunserer Sprache, die sich keinerVorstellungskraft, die limitiert ist fürdiese Sprache, hingibt. Wenn ich »versende« lese, lese ich »Vers/en-de«. Diese Form des Lesens, das ist die Form, die uns etwas andereserzählen kann, jenseits traditioneller konventioneller Erzählungen,jenseits der Erzählungen, die wir für unser Leben halten. Das heißteben, bis zur äußersten Bedeutung müssen wir gehen. Und es wirdnicht weit genug gewesen sein. So gehen wir, nicht auf dem Pfad derRechtschaffenen, einer anderen Zukunft entgegen. Ich denke auchjetzt, 2020, das ist kein verrücktes Jahr. Das ist ein Jahr, in dem nie-mand etwas mehr leugnen kann, weil diese Bilder überall sind undauch wir als rassifizierte Menschen:Wenn ich mit meinen Freund:in-nen spreche und alle sagen: von wo kommt das her?Was passiert mituns? Zum ersten Mal müssen auch wir unsere Vergangenheit an-schauen. Zum ersten Mal kann uns niemand sagen: Ich glaube dirnicht.Du bist zu sensibel. Stell dich nicht so an. Zum erstenMal müs-sen wir auch etwas Glaube für uns haben, dass wir uns glauben kön-nen, dass all das uns geschehen ist. Dass wir all das erfahren haben,das uns all das widerfahren worden ist. Entweder eine andere Welt,eine andere Zukunft oder keineWelt und keine Zukunft mehr.
Do this Book or Die Do this Book or Die
Anmerkungen
Anuk Arudpragasam: Die Geschichte einer kurzen Ehe.München: Hanser, 2017.
Georges Bataille: Die Erotik.München: Matthes & Seitz,1994.
Shida Bazyar: Nachts ist es leise in Teheran. Köln:Kiepenheuer &Witsch, 2017.
Shida Bazyar: Drei Kameradinnen. Köln: Kiepenheuer &Witsch, 2021.
Maurice Blanchot: Das Unzerstörbare: Ein unendlichesGespräch über Sprache, Literatur und Existenz.München: Hanser, 2007.
Jacques Derrida: Aporien.München: Fink, 1993.
Jean-Luc Nancy: Der Eindringling. Berlin: Merve, 2000.
Barnett Newman – the Stations of the Cross: LemaSabachthani. Düsseldorf: Richter Verlag 2005.
Yoko Tawada: Verwandlungen. Tübinger Poetik-Vorlesungen. Tübingen: Konkursbuchverlag, 1998.
Senthuran Varatharajah: Vor der der Zunahme derZeichen. Frankfurt a.M.: S. Fischer, 2016.
Senthuran Varatharajah: »Eine Poetik desKnochenbrechens.« Freitext-Blog 2016. (https://blog.zeit.de/freitext/2016/11/02/krieg-koerper-sprache-ocean-vuong-varatharajah/).
Senthuran Varatharajah: »Etc. (warten; Notizen zurleeren Hand)«.Merkur Blog (https://www.merkur-zeitschrift.de/2018/09/26/etc-warten-notizen-zur-leeren-hand/).
Senthuran Varatharajah: Rot / Hunger. Frankfurt a.M.:S. Fischer, 2022.
Amerigo Vespucci: NeueWelt – Mundus Novus: undVier Seefahrten. Lenningen: Edition Erdmann, 2014.
94 9594 95
falten flächen friktionenIm Gespräch mit Annette Pehnt
Ein halbes Jahr lang haben Annette Pehnt und ich ein Theoriegedichtgeschrieben, zusammen, kollaborativ in einem Google Doc. Auszügedaraus haben wir jeden Mittwoch 12 Uhr auf »Pfeil und Bogen« ver-öffentlicht, der Literarischen Online-Revue des Literaturinstitut Hil-desheim. Annette Pehnt, geboren 1967 in Köln, studiert und arbeitetein Irland, Schottland,Australien und den USA.Heute lebt sie mit ihrerFamilie in Freiburg und Hildesheim, wo sie das Institut für Literari-sches Schreiben und Literaturwissenschaft leitet. 2001 veröffentlichtesie ihren ersten Roman »Ich muss los«, für den sie unter anderemmitdem Mara-Cassens-Preis ausgezeichnet wurde. 2002 erhielt sie inKlagenfurt den Preis der Jury für einen Auszug aus dem Roman »Insel34«. Neben ihren weiteren Romanen und Prosa-Bänden schrieb siemehrere Kinderbücher, unter anderem »Der Bärbeiss«. Seitdem er-schienen zahlreiche weitere Romane und Erzählbände, unter ande-rem »Mobbing«, »Chronik der Nähe« und zuletzt »Alles was Sie se-hen ist neu« (2020). Außerdem schreibt Annette Pehnt für Kinder, zu-letzt »Hieronymus oder: Wie man wild wird« (2021).
Annette PehntIn dem Begriff Theoriegedicht haben wir ja eigentlich absurderweiseschon die Komponenten vereint. Und für mich war auch genau daseigentlich die Herausforderung.Denken findet statt, Schreiben findetstatt. Fürmich findet Erkenntnis oderAuseinandersetzung eigentlichimmer im Schreiben statt. Das muss ich aber oft herausnehmen ausmeinen narrativen Texten.Und hier habenwir beidewas versucht,wogenau das eigentlich Raum hatte: miteinander schreibend zu denken.Das kann ich,wenn ich erzählerisch arbeite, sonst nicht so direkt ver-arbeiten. Die Konvention ist eine andere. Die haben wir hier einfachweggelassen.Dafür gab es dann diesen Raum für das Theoriedichten.Guido GrafWas ist das für eine Konvention? Ich bin mir da gar nicht so sicher, obdas wirklich ein Gegensatz ist.
96 97
Annette PehntDer Gegensatz erweist sich in der Praxis des Literaturbetriebs. Ichglaube auch nicht,dassman,wennman erzählerisch arbeitet,Theorieausklammert. Denn auch im Erzählen bringt man ja ein Nachdenkenüber Sprache hervor. Trotzdem gibt es im klassischen Erzählen, wieich es vielleicht früher gemacht habe, im Auserzählen von Handlungz.B., von Figuren oder von Erzählräumen so viel anderes zu tun, dassdas Essayistische oder dass Reflexionsprozesse einen anderen Raumhaben. Eigentlich weniger Raum, jedenfalls in der Art, in der ich frü-her erzählt habe. Es hat sich bei mir auch über die Jahre geändert. Ichversuche inzwischen auch Formen zu finden, in denen das ein Teil desSchreibprozesses und auch des fertigen Textes sein kann.Aber früherhabe ich schon so gearbeitet, dass ich einen »richtigen« Roman er-zählt habe und alle meine Reflexionen, Notizen, die ganze Schrei-bumgebung habe ich auch notiert, aber eben woanders, in einemJournal.Was wir jetzt hier gemacht haben,war ja die Möglichkeit, dasalles in eins zu legen. Das kann man sonst auch tun, aber es ist ersteinmal nicht unbedingt vorgesehen in Büchern, die auf dem Marktdann eine größere Leserschaft finden wollen, das so anzubieten, weilHandlungen erzählt werden soll und so weiter. Ich habe mich davonüber die Jahre hinweg zunehmend gelöst. Aber ich merke schon auchimmer noch, dass es so etwas wie Stoff gibt. Bei mir ist es gibt eineGeschichte, die erzählt werdenwill, auchwenn sie fragmentarisch ist.Diesen Druck hatte ich hier bei unserem Theoriegedicht überhauptnicht.Guido GrafMir scheint, als wäre diese Unterscheidung als eine grundsätzlicheUnterscheidung etwas, mit dem wir aus einer Tradition heraus ver-dorben sind, die wir in der Schule eingeimpft bekommen haben, dassesWissensbestände auf der einen und die literarischen Repräsentati-onen auf der anderen Seite gäbe. Stattdessen könnte man sagen, dassLiteratur oder die literarische Praxis ständig auf sich selbst verweist,dass literarische Praxis immer in einem Modus der Selbstreflexionist, dass das, was Du jetzt beschrieben hast, dass Du versuchst, Dichin Deinen erzählerischen Arbeiten Dich von einer Erzählhaltung, dieDu als Konvention bezeichnest,wegzubewegen, auch darauf verweist,dass es graduelle Unterschiede sind, die da eine Rolle spielen, dassaber eben dieses Suchen nach einer Form und die Form im Erzählen,im Beschreiben, auf der Mikroebene eines Satzes, des richtigen Wor-tes, genau diese Reflexivität eben schon transportiert.Annette PehntGenau, ganz wie Du sagst, graduell mehr oder weniger. Dein eigenesMaterial immer auch zu reflektieren,währendman es vorantreibt, ist
ja etwas, das wir auch im ganz klassischen Erzählen immer wiederfinden. Sowieso seit der klassischen Moderne. Aber z.B. der GedankederGeschlossenheit, dass ich einenText,der irgendeine FormvonAn-fang hat, auch zu irgendeiner Form von Ende bringe, und sei es nochso offen, auch mit dem Gedanken, dass es hinterher ein lesbarer, insich abgeschlossener Text wird, der auch ein Buch sein kann: Das isteine Konvention und ich habe mir andere Schreibweisen immer ein-geräumt, in Journalen und so weiter, wo ich mich darum überhauptnicht kümmere. Aber in meinen erzählenden Texten habe ich bisherimmer versucht, eine Art von vorläufigemAbschluss zu finden, um esdann fortzusetzen im nächsten Buch, aber auch wieder mit einemneuen Anfang. Wenn man aber so arbeitet, wie wir jetzt mit unsererTheoriegedicht gearbeitet haben, gibt es diese Setzung nicht. Mankann sich irgendwann dazu durchringen, einen Schlussstrich zu zie-hen. Aber eigentlich schreibt sich das ja voran und hat diese Ge-schlossenheit nicht im Visier. Das ist überhaupt nicht das, worum esgeht. Und das sind Konventionen, die ich jetzt gerne mal über Bordgeworfen habe, weil die reflektierende Schreibpraxis, die ich sowiesoauch immer betreibe, hier die Bühne frei hatte.Guido GrafWir versuchen uns gegenseitig zu beschreiben, was wir da eigentlichgemacht haben, wie wir angefangen haben und wie sich das danneben weiterentwickelt hat.Annette PehntWie haben wir eigentlich angefangen? Du hast ja den Aufschlag ge-macht. Es war sowohl Deine Idee als auch hast Du den ersten Einsatzgespielt. Und ab dann hat es sich weiterentwickelt.Guido GrafIch bin von Begriffen ausgegangen, etwas wie »Falten«.Wir hatten jaden Vorsatz, uns mit den Leitbegriffen des letzten Prosanova ausein-anderzusetzen: Glätte und Reibung. Ich habe versucht, diese Begriffeernst zu nehmen, bzw. sie wiederzufinden, in Bildern, in Texten, siespiegeln zu lassen in Lektüren.Dann habe ich Notizen dazu gemacht.Das war in den erstenWochen eine Leitidee, die immer wieder diver-sen Metaphern zum Ausdruck kommt oder das Bildfeld von Glätteund Reibung zu eröffnen, dafür eine Spur zu finden. Allerdings hatsich rasch mit Deinen ersten Texten und dann in einigem Hin undHer eine Binnenreibung ergeben. Aber diese Spur haben wir irgend-wann verlassen.Annette PehntDer Begriff der Reibung hat uns am Anfang ins Schreiben gebracht.Ich finde es sehr schön, dass wir diese Begriffe,mit denen wir begon-
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
98 99
nen haben, nach und nach verrücken, einfach dadurch, dass wir sieuns gegenseitig hin und her spielen. Wir hatten am Anfang relativeinfache Zuordnungen, im Grunde sogarWertungen, die relativ binärwaren.Was ist Glätte? Sind das Momente, in denen z.B. in der Gesell-schaft alles glatt läuft, in der eben kein Widerstand entsteht, in deralles wohl geordnet ist? Und ist Reibung dasWiderständige,vielleichtauch das Kratzige, Subversive, das die herrschenden Strukturen inFrage stellt? Wir haben das ein halbes Jahr gemacht, ein halbes Jahrlang gemeinsam geschrieben und all diese Zuordnungen sind fürmich schon nach mehreren Wochen ins Schwimmen geraten. Das istfür mich ein sehr weitreichender Prozess. Das, was wir gemacht ha-ben, ist für mich eine Art Experiment, miteinander Schreiben als so-ziale Praxis zu üben. Am Anfang habe ich einfach nur gedacht, wirschreiben jetzt miteinander zu diesen Begriffen und wir beziehenuns aufeinander. Es war ja auch eine Möglichkeit, auf die Pandemiezu reagieren. So hatten wir es ja anfangs auch mal angelegt, einenSchreibraum zu haben, in demwir reagieren können auf das,was ge-rade mit Corona passiert. Davon hat es sich aber zunehmend gelöst,obwohl auch solche aktuellen Bezüge durchaus noch quer schießen.Es hat sich vor allem von den für mich fixierten Zuordnungen gelöst,die ich amAnfang hatte.Auch davon,wie manmiteinander schreibenkann. Wir haben ja schon mal gemeinsam Texte geschrieben, aberaber nicht über solch einen langen Zeitraum hinweg. Ich hatte an-fangs schon eine konkrete Vorstellung, wie wir uns gegenseitig ant-worten, in einem dialogischen Schreiben.Der eine schreibt, die ande-re antwortet, oder umgekehrt, als ein geordnetes Gespräch. Aber daswar es dann nicht. Stattdessen gibt es viele verschiedene Möglichkei-ten, miteinander in so einer Polyphonie zu sein. Das hat mich wirk-lich sehr überrascht, wie wir das durchkreuzen, was ich anfangs er-wartet habe.Guido GrafEs gibt in der Psychologie der frühkindlichen Entwicklung den Be-griff des kollektiven Monologs. Ein typisches Bild dafür sind Kinder,die in einem Sandkasten spielen und sich scheinbar etwas erzählen.Das hört sich an wie ein mehrstimmiger Dialog, doch wenn man ge-nauer hinhört, ist es vielmehr ein Monologisieren. Das funktioniertaberwiederum nicht,wenn nur ein Kind sich äußert und alle anderenwären stumm. Ein wenig scheint es mir in diese Richtung zu gehen,weil die Bezüge sich sichwie von selbst lösen.Manchmal sind sie sehroffen, dass sie so wirken wie Parallelen, die nebeneinander herlaufen.Aber wo sind die Momente, in denen eine Referenz hergestellt wird?
Annette PehntDiese Referenzen sind sehr vielfältig und sehr unterschiedlich. Wel-che Möglichkeiten gibt es, sich gegenseitig aufzugreifen? Es gibt jaüber den direkten Bezug hinaus viele andere Möglichkeiten, z.B. dieStörung. Das ist etwas, was ich streckenweise ausprobiert habe, weilwir sehr unterschiedliches Textvolumen erzeugen,wenn wir gearbei-tet haben. Manchmal war ich also konfrontiert mit größeren Text-mengen und habe dann versucht, kleine Strukturelemente einzufü-gen. Vielleicht haben wir uns stillschweigend geeinigt. Zumindestwurde das nie thematisiert.Wir haben uns nie auf einer Meta-Ebeneausgetauscht über das, was wir da tun, sondern wir haben es einfachgemacht, sodass alles, was wir vorhatten, im Text stattfinden musste.Es gab also keine weitere Ebene der des Redens über das, was wir datun. Das ist ja auch etwas, das man sonst sehr, sehr selten macht.Manchmal habe ich auch eine Art Verdichtungsvorgang versucht. Ichhabe Begriffe aus Deinen Passagen genommen und die neu zusam-mengesetzt. Das waren Verfahren, die im Prozess entstanden sind.Bei Dir hab ich auch immerwieder versucht festzustellen: wo sind dieBerührungspunkte? Für mich gehört dazu zu reflektieren, wie dieserProzess verläuft.Was ist das für ein Experiment? Wo triggern wir unssozusagen in neue Spuren hinein?Guido GrafWenn ich manchmal einen längeren Text am Stück geschrieben habeund ein paar Tage später darauf geguckt habe, sah er auf einmal ganzanders aus. Dann hast Du überall etwas dazugeschrieben. Aber so,dass es jeweils immer weit über das hinausgeht, was was man einenKommentar oder eine Randbemerkung nennen könnte. Etwa so wieman vielleicht ein Buch liest und sich dann etwas in den Randschreibt. So arbeite ich selbst oft auch, dass ich mir die Ränder vonBüchern voll kritzle, mit einer komischen Schrift, mit Bleistift, weilich einen Widerwillen habe, mit einem Kugelschreiber oder einemanderen Stift in das Buch hineinzuschreiben, obwohl ich den Bleistiftnoch nie wegradiert habe. Aber eben so, dass ich es Wochen, Monateoder gar Jahre später gar nicht mehr lesen kann.Annette PehntDas ist es ja, wenn man Spuren hinterlässt im Text des anderen.Wo-bei auch diese Zuordnung fürmich sich nach und nach aufgelöst hat.Ich habe versucht, nochmal über unseren gesamten Text nachzuden-ken undwusste teilweise nicht mehr, auf welche Passagen sichmeineGedanken beziehen. Sind die eigentlich von mir oder von Dir? Das istkeine esoterische Symbiose, die da entstanden ist. Aber es ist trotz-dem so, dass ich es, weil ich so intensiv Deine Passagen ja nicht nurgelesen, sondern sie als Material verwendet habe, ich es nicht mehr
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
100 101
richtig unterscheiden kann.Teilweise schon auch ganz deutlich.Abergerade bei einzelnen Wendungen, mit denen ich jetzt immer nochumgehe, kann ich das nicht mehr zuordnen. Das z.B. finde ich aucheine sehr produktive Erfahrung.Was wir ja auch gemacht haben: Wirhaben den Raum geöffnet, über Zitate von anderen Autorinnen, fürandere literarische Stimmen, die wir beide in der Zeit gerade gelesenhaben oder die uns in die Hände gefallen sind. Oder für Lektüren, dieuns begleitet haben. Diese Texte flechten sich hinein in dieses Mus-ter, das wir dann nach und nach gewoben haben. Sie sind jetzt auchda drin, ob sie wollen oder nicht und tragen bei zu diesem kollektivenMonolog oder dialogischen Kollektiv. Wir haben ja viele Autor:innenin der Zeit gelesen,von Barbara Köhler über Rachel Cusk, zeitgenössi-sche englischsprachige Lyrik, Ror Wolf und natürlich auch Theorie.Das ist zu einem veritablen Chor geworden. Aber wir haben uns jaauch angemaßt, uns das zu nehmen, was unser Gespräch vorange-bracht hat. Wobei: »Vorangebracht« ist auch kein passender Begriff,denn das fand ja nicht auf einer zeitlich zielführenden Achse statt.Das Schreiben konnte sich ausbreiten, in alle Richtungen. Wenn ichüber den Text bildlich nachdenke, sehe ich ihn nicht linear voran-schreiten, sondern ausbreitend, ausufernd, als eine Art Landkarte.Guido GrafIch empfinde diese Art zu schreiben und zu denken als höchst pro-duktiv. Dieses Wechselspiel reproduziert die Art und Weise, wie ichlese, und auch das,was ich lese und damit weiter arbeite. Gleichzeitigsind diese Notizen, Gedanken,Texte, die da entstehen, nicht für michallein in irgendein Dokument eingesperrt, sind irgendwo im Regalabgestellt oder auf der Festplatte in irgendeinem Ordner abgelegt,sondern werden immer gleich ins Spiel gebracht. Und sie werdennicht nur Dir gegenüber ins Spiel gebracht, das wäre die erste Eskala-tionsstufe, sondern wir haben dann ja in einem nächsten Schritt ei-nen Großteil dessen, was wir geschrieben haben bei Pfeil und Bogenveröffentlicht und damit weiter eskaliert.Annette PehntDu hast geschrieben: »Was mir widerfährt, ist produktiv. In diesenStrukturen bin ich zuhause, allein, gerade noch allein.Und auf einmalmitten in der Sprache, Kontexte trainieren und vermehren. Nichtmehr alles sein. Nicht länger Ich-Besetzung.« Das finde ich auch ei-nen wichtigen Gedanken für mich.Woanders sagst Du auch, Schrei-ben ist für Dich diese Kippfigur. Wir sagen »ich« und Du hast dochoft »wir« gesagt, und zugleich ist es aber auch eine Übung darin,mich nicht in mir zu fixieren und dieses Ich durchlässig zu machen.Das kann man ja philosophisch beschließen. Aber hier, in diesenSchreibweisen haben wir das auch ausprobiert. Wenn ich nur starr
»ich« sage, bei meinen Lektüren bleibe, bei meinen Gedankengän-gen, funktioniert diese Art zu schreiben ja nicht.Guido GrafDas ist es, wenn man von Literatur als einer Theorie der Praxisspricht. In meiner Vorstellung spielt eine immer größere Rolle, dassdiese Subjektfixierung, die das Ich ins Zentrum stellt, subjektbezoge-ne Autorschaft immer uninteressanter wird, dass die Überkreuzun-gen, das Zurückdrängen dieser Subjektkonstitution zugunsten einermöglichst großen Durchlässigkeit viel eher in der Lage ist, Neues zuproduzieren.Annette PehntDas ist aber auch dieser Konflikt, den ich amAnfang versucht habe zubeschreiben und denman in unseremTheoriegedicht auch zuordnenkann. Es gibt so etwas wie theorieaffines Schreiben und dann auchimmer wieder Versuche, in narrative Passagen auszuufern. Das habeich zumindest immer wieder probiert. Wenn man aber erzählt, eineGeschichte, muss es ja irgendeine Form von Ich geben, an dem sichdas Erzählen andockt. Fürmich ist dann die Herausforderung, ein Ichzu finden, in einem Text Ich zu sagen, ein Pronomen zu verwendenund trotzdem so zu arbeiten, dass dieses Pronomen, diese Entitätnicht vollkommen zubetoniert ist. Wie kann ich deutlich machen,dass ich von einem Ich erzähle, das ich aber gar nicht wirklich kontu-rieren kann? Wie kann ich das auch in der Sprache deutlich machen,das ist für mich auch erzählerisch eine Herausforderung. In dem Ex-periment, das wir gemacht haben, hat sich das durch die Form erge-ben. Und trotzdem kehren wir auch hier immer wieder zurück zu ei-nem Wir oder einem Ich. Auch Du, Du hast oft das Wir und ich habeoft schon ein Ich verwendet. Aber es muss ein Ich sein, das porös ist,das sich trotzdem anmaßt, ich zu sagen. Sonst habe ich keinen Trägermehr fürs Erzählen. Sonst komme ich in einen Sprachfluss, der sichgar nicht mehr festmacht an so etwas wie Subjekt oder Entitäten.Dann gibt es keine Erzählverläufe, keine Figuren mehr.Mich interes-siert aber schon, ein Erzählen zu versuchen, in dem es das noch gibt,das aber trotzdem diesen anderen Gedanken auch mitschreibt.Guido GrafNatürlich, das würde schnell auf ein formalistisches Experiment hin-auslaufen, das man nicht sonderlich weit treiben kann, wenn manetwa versuchen wollte, völlig unpersönlich, also im sprachlichen Sin-ne unpersönlich zu schreiben.Annette PehntDarum beneide ich die Lyriker:innen. In so einem literarischen Raumist das ehermöglich. Und da sind wir doch wieder bei den Konventio-
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
102 103
nen.Wenn ich mich davon verabschiede, überhaupt einen Verlauf zuerzählen, zeitlich zu erzählen,mit Subjekten,dann kann ich – undDuhast das in manchen Textpassagen auch gemacht – mit Klang arbei-ten, mit Bildern, mit Metonymien, losgelöst von Subjekt, Prädikat,Objekt. Dann hab ich eine andere Art von Grammatik zur Verfügung.Ich kann dann herkömmliche Grammatik aufsprengen. Das hast DuDir ja teilweise auch erlaubt.Guido GrafFür mich war tatsächlich ein Experiment, als ich versucht habe, zuSeiten aus einem Coffee Table Book, das New York Interieurs heißt, zuSeiten mit Fotos aus dem Trump Tower in Manhattan etwas zuschreiben.Das sind Fotos aus den 1980er Jahren, frühe neunziger Jah-re vielleicht. Die Einrichtung der privaten Räume von Trump dortscheint aber, wenn man das mit neueren Aufnahmen abgleicht, bisheute weitgehend unverändert. Eher ist es noch voller, noch goldenergeworden. Ich hatte mir vorgenommen, die fünf Doppelseiten in die-sem Buch zu beschreiben, sominutiös zu beschreibenwie es nur geht.Und mir die Frage zu stellen,was ich eigentlich alles auf diesen Fotosübersehe. Es sind keine Personen auf den Bildern.Nach einer Doppel-seite habe ich aufgegeben. Ich habe etwa zwei Seiten geschrieben undwar erschöpft danach.Es hatmich angeekelt und ich fand es auch un-glaublich anstrengend. Es ist eine Form von Leere, die produziertwird, die nicht nur etwas mit dem Gegenstand zu tun hat, sondernauch mit dem Versuch, dafür eine sprachliche Form zu finden.Annette PehntAus politischen Gründen erschöpft, oder?Guido GrafNatürlich könnte man das aus irgendeinerWarte als Versuch der An-näherung verstehen. Ich suche mir einen Gegenstand, der weiter wegvon meiner Person, von meinem Leben, von meiner sozialen Wirk-lichkeit ist, wie er weiter weg kaum sein kann und versuche, denschreibend zu erfassen.Annette PehntUnd Du bist sowieso angewidert,weil Du von Trump angewidert bist.Das ist doch aber eine problematische Voraussetzung. Ich finde dasBeschreiben als Technik sehr ermüdend. Als Leserin, aber auch alsSchreibende. Und das nun exzessiv zu tun, heißt ja, sich den Dingenhinzugeben, darauf zu setzen, dass, wenn ich sie so genau wie mög-lich beschreibe, sie dann anfangen zu mir zu sprechen. So recht habeich daran noch nie glauben können. Das ist auch eine grundsätzlicheFrage: Was kommt in meiner literarischen Welt vor? Und das ist beimir nicht das Ding in der Fülle seines Seins. Denn dann muss man ja
diesen ganzen Beschreibungszauber souverän handhaben. Auf dieDauer finde ich das ein bisschen unergiebig. Je mehr man beschreibt,desto kompletter taucht dieses Ding vor mir auf. Aber was kann ichdamit anfangen? Wie kann ich mich dazu dann in Beziehung setzen,außer dass ich es genau erfasse? Das bringt mich zum anderenSchlüsselwort, nämlich demWort Beziehung,was für mich bei unse-rem Schreibprojekt und auch sonst eine wichtige Frage ist, die wiruns immer wieder poetologisch gestellt haben: Wie kann ich mich inBeziehung setzen sowohl zum anderen, der gerade schreibt, als auchzu der Gegenwart da draußen, die gerade verrückt spielt, als auch zumeiner eigenen Sprache und zu der Sprache des oder der anderen?Und in diesemTrump-Experiment, das Du da gemacht hast, entstandfür mich die Leere dadurch, dass es keine Beziehung gab. Es war eineinziger großer Schauraum, in demman immer nur in die eine Rich-tung guckt, aber es kein Hin und Her der Blicke gibt.Guido GrafIch glaube, dass es auch wichtig ist, sich der Randständigkeit immerauch bewusst zu sein, in dem Moment, wo man es versucht. Was Duals Fülle der Beschreibung ermüdend findest, ist mir gerade nicht sowichtig, in der Beschreibung, sondern eher Konturen zu finden unddie nachzuzeichnen.Annette PehntDuwillst es benennen, um eine Art Gegenwart aufzurufen, aber ebennicht im Einzelnen durchdeklinieren? Für mich ist es so, dass dasSchreiben etwas Abwesendes aufruft, ohne es festhalten zu können.Ob es Stimmen sind oder andere Texte, oder auch Dinge. Aber dasSchreiben kann das nicht halten. Es gibt ja oft diesen Gedanken: Ichschreibe, um etwas festzuhalten. Ich glaube nicht daran. Es gibt auchin der Theorie diesen Gedanken: Ich schreibe und damit zerstöre iches.Mit demGedanken habenwir auch gespielt.Das istmir näher,weilmich dieses beschwörende Schreiben, das alles festhalten und fixie-ren will, nicht interessiert.Guido GrafEs muss deutlich werden, dass es sich – und das ist dann die theore-tische Bewegung – immer um eine doppelte Strategie handelt, diedarum weiß, dass es eine verbindende, eine Beziehung herstellendePraxis ist, genauso wie eine, die die um die Unmöglichkeit dieser Be-ziehungsherstellung weiß.Annette PehntGenau, das ist auch vielleicht diese Kippfigur, die wir schon benannthaben.Das gilt ja genauso fürs Ich.Wirmüssen mit diesem Ich arbei-ten und zugleich löst es sich unter unseren Händen auf,wennwir da-
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
104 105
mit arbeiten.Trotzdem geht es nicht ohne. Es ist zugleich an- und ab-wesend. Es gibt einen Begriff, den ich gerne verwende und Du hastihn auch aufgegriffen: Das große Gemurmel. Das ist für mich das,worin ich mich einschreibe. Es gibt für mich ein fast schon physischerfahrbares Murmeln von Texten, von Lektüren, nicht so sehr vonbiographischen Schriftsteller:innen, aber von Sprache, die mich um-gibt, als Leseerfahrung in mich eingelagert. Immer, wenn ich schrei-be, ist das alles schon da.Darauf kann ich antworten. Es gibt auchAu-torinnen oder Texte, da hab ich sofort das Gefühl, auch dieses Mur-meln will ich mit in meinen Text hineinnehmen. Bei Friederike May-röcker geht es mir so, dass ich sofort mit ihr schreibenwill oder an siezurück,mit ihr zusammenweiterschreibenwill.Das ist fürmich auchetwas Akustisches, tatsächlich auch etwas Körperliches. In einemProjekt, wie wir es hatten, hört man das Murmeln des anderen imText die ganze Zeit mit.Guido GrafJedes Buch ist eine Entlastung.Gleichzeitig ist es eine Projektion undes kann aber auch zur Last werden.Annette PehntDu hast in unserem Text auch dieses Ich thematisiert, wie es immerkleiner wird. Und das ist es ja nach und nach auch. In dem Text isteine Poetik entstanden, die wir miteinander formuliert haben. EinerDeiner Schlüsselsätze war: weniger werden oder klein werden. Waskann ich als Schreibende also überhaupt tun? Wie kann ich auf dieGegenwart reagieren? Ich kann mich versuchen herauszunehmenund mich zu verzwergen und zum Wicht-Ich zu werden. Also nichtmehrwichtig zu sein, sondern zum kleinenWicht zuwerden,der viel-leicht auch Teil dieses großen Gemurmels ist. Aber auch das großeMurmeln hat sehr viele kleine Murmler. Und wenn man da – Demutist so ein großes Wort – ein bisschen einschrumpft, ist das vielleichtgar nicht das Schlechteste.Guido GrafDas hab ich von Jean Paul, der das einmal in irgendeiner Notiz in ei-nem Entwurf zumUmfeld des Titan-Romans aufgeschrieben hat.Dasfand ich schön.Wie ein vorauseilendes Echo dessen,was man auf un-sere Gegenwart hin theoretischmit der kleinen Literatur vonDeleuzeund Guattari formulieren kann.Annette PehntIch sehe diese vielen Stimmen, über die wir gesprochen haben, auchals notwendigen Hintergrund für diesen Gedanken an. Es ist nicht so,dass gar nichts da ist, weil ich klein werde, sondern es ist dann eherPlatz für sehr viele andere Stimmen, die vielleicht auch klein sind, die
ich dann aber besser hören kann, wenn ich nicht nur mich höre, wieich alles volldröhne. Das ist eine grundsätzliche Frage: Wie versteheich meine Autor:innenschaft? Wie mächtig bin ich überhaupt? Oder:wie ohnmächtig? Das ist auch der Gedanke vom Anfang: Wenn ichmich traditionell als jemand sehe, die die erzählerischeWelt aufbaut,die alles souverän entscheidet, die alles setzt und erfindet und danndas Ganze in Gang bringt, bin ich die Herrscherin über meine fiktiveWelt. Dagegen taucht in unserem Text der Satz auf: Ich bestimmenichts.Wenn ich nichts bestimme und nicht groß bin, sondern klein,und es gibt viele andere,murmelnde Stimmen, ist es eine ganz ande-re Grundhaltung. Man muss dann aufpassen, dass man irgendwannnicht ganz aufhört zu erzählen.Guido GrafDas ist eine Bewegung,die ich in Deinen Texten immerwieder gefun-den habe als eine Form der Selbstvergewisserung, aber als eine, dienicht darauf aus ist, irgendeine Dominanz zu formulieren, sonderneine Ich-Behauptung als eine der permanenten Dekonstruktion oderSelbst-Dekonstruktion. Das finde ich toll zu beobachten. Ich merke,dass ich immer mehr und immer lieber Texte lese, die so ähnlich ar-beiten. In Dorothee Elmigers Aus der Zuckerfabrik etwa funktioniertdas so. Und schnell abgestoßen oder gelangweilt bin ich von von die-sen typisch männlichen Gesten, die platzhirschhaft daherkommenund,wie Du es eben so schön gesagt hast, alles voll dröhnen.Annette PehntEs gibt ja eine Poetikvorlesung aus Frankfurt von einem Kollegen, dieheißt »Ich«, in Großbuchstaben.Das ist dann eben auch eine Positio-nierung, die mich inzwischen langweilt. Das heißt nicht, dass ich fürdiese autoritativ entworfenen, in sich geschlossenen Welten nichtauch Respekt hätte. Das kann man schon machen, das hat auch seineBerechtigung. Ich selber fühle mich da aber nicht mehr eingeladen.Ich fühle mich viel mehr eingeladen in einen Text, wenn er zerfasertund offen ist, wenn ich die Denkbewegungen, die darin beschriebenwerden, selber auch mitmache oder dann auch in andere Richtungenweitermache. Aber wenn es für mich eine Einladung ist, gemeinsamzu denken, dann müsste ich ja im Schreiben auch darauf reagierenund eben auch versuchen, solche Texte zu schreiben, die einladen, ge-rade weil sie zerfasert sind,weil sie porös sind, unvollständig.Guido GrafWo führt diese Bewegung hin? Du hast darüber gesprochen, dass soein Schreiben einladend ist, dass es Beziehungen herstellt. Aber wirhaben beschlossen, dass wir das beenden, aus pragmatischen Grün-
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
106 107
den.Aber es gibt sicher auch ein paar Gründe, die mit dem zu tun ha-ben,was wir geschrieben haben.Annette PehntDiese Klarheit haben wir ja, da wir ja nicht zielführend, begrifflichdiskursiv gearbeitet haben, auch nicht hergestellt, sondern es gab im-mer wieder kleine Punkte von Klarheit und dann wieder Verwirrung.Ich glaube nicht, wenn wir den Text weiter geführt hätten, wäre ir-gendwann die Klarheit gekommen und eine ganz präzise poetologi-sche Positionierung des Ich. So arbeitenwir nicht, oder? Ich arbeite sonicht. Ich merke auch, dass ich mich davor scheue. Das ist auch im-mer die Crux bei einer Poetikvorlesung, das zu fixieren,was ich da ei-gentlich tue.Weil es sich einfach auch ständig ändert.Weil ich immervorübergehende Arbeitsfragen habe, an die Sprache, an mein Schrei-ben, abermich schwer tue, das dann in poetologische Befunde zu gie-ßen oder in Poetikvorlesungen. Unsere Form hat uns erlaubt, dasauch so offen zu lassen. Trotzdem sind wir immer sprachreflexivergeworden.Aber irgendwann,wenn es gar kein Außen mehr gibt – In-nen und Außen haben wir ja auch in Frage gestellt -, wenn man nurnoch im eigenen Mundraum unterwegs ist und im eigenen Gehirn,ist ja auch die Frage, wie ich mit der Welt, die mich umgibt, noch in-teragieren kann.Wo ist mein Material,wenn es sich ganz in die Spra-che zurückzieht? Ich mache damit wahrscheinlich wieder eine Tren-nung auf, die so nicht sinnvoll ist, aber irgendeine Form von InnenundAußen,von Porösität muss bleiben. Sonst ist man nur noch in derselbstreflexiven Mundraum-Grammatik. Ich glaube nicht, dass unsdas passiert ist.Aberwennman so ein Schreiben auf die Spitze treibt,könnte ich mir vorstellen, dass es auf diese Weise dann auch trockenläuft, dass es dann nur noch reibt, dass es dann reine Reibung ist. Rei-ne Reibung kann man einen Moment lang ertragen, aber dann zer-fällt alles in Brösel und geht erst mal nicht weiter. Ich weiß, dass Dumit Metaphern immer so ein bisschen haderst, aber wenn man diesereine Reibung hat, braucht manwieder etwas Schmieröl durchMate-rial. Das haben wir uns auch immer wieder geholt. Vielleicht kannman auch in dieser Bewegung bleiben, aber das haben wir nicht bisins Unendliche ausgereizt.Guido GrafGibt es etwas, was Du im Laufe der Monate für Dich, etwa in Bezugauf Material entdeckt hast?Annette PehntVerdichtete Passagen zu schreiben, die man auch als Lyrik bezeich-nen könnte, erlaube ich mir sonst nie,weil ich das für ein Territoriumhalte, das ich eigentlich gar nicht bespielen kann. Es gibt andere, die
das machen. Da wir aber Gattungsgrenzen aufgehoben haben in un-serem Schreiben, in unserem Text, habe ich das öfters mal gemacht,oft mit Material, das ich von Dir genommen habe.Das fand ich groß-artig. Ich habe das Gefühl gehabt, das beurteilt jetzt auch keiner,weiles sich einfach einbettet in diesen großen Zusammenhang.Dann die-se Schreibbewegung des Störens, jemandem dazwischenzufunken, indiesem Fall Dir: das würde ich mir sonst nie herausnehmen. Ich binein sehr höflicher Mensch. Also Schreiben als einen Störvorgang zusehen, indem ich auf bestehende Sprache reagiere, die umordne, diehinterfrage oder auflöse.Und das dritte,was wir auch ausprobiert ha-ben,was ich sonst auch sehr seltenmache, ist das Übersetzen.Wir ha-ben mehrere Gedichte oder andere Texte als Fundstücke hineinge-bracht und haben dann teilweise parallel, teilweise auch jede:r fürsich Übersetzungsversuche gemacht. Die Arbeit an diesen anderenSprachmaterial und sich das dann zu eigen zu machen, aber sichtrotzdem in den Dienst eines anderen Gedankengangs, einer anderenBildlichkeit zu stellen, fand ich unglaublich produktiv.Guido GrafDas müsste noch intensiviert werden, auch für unsere Studiengänge.Uljana Wolfs jüngstes Buch Etymologischer Gossip zeigt auch,was fürein Motor dieses Übersetzen für das Schreiben, für die Dichtung undauch für das Nachdenken über Literatur sein kann.Annette PehntJa, man wird ständig zu Entscheidungen herausgefordert, bei jederSilbe, auf allen Ebenen, die die Sprache anbietet. Diese Entscheidun-gen bei sich selbst zu beobachten, das als ästhetische Praxis zu sehenund das nicht, um die perfekte Übersetzung zu bekommen, sondernimGrunde als das engste Gesprächmit demText, das ich haben kann,wirkt produktiv. Ich war mal auf einem Übersetzer-Workshop mitrussischen Übersetzer:innen und habe mit denen zusammen an ei-ner Kurzgeschichte vonmir gearbeitet und habemich noch nie so ge-lesen gefühlt wie von diesen zehn jungen Übersetzer:innen, die jedesWort und natürlich auch mich befragt haben.Wir mussten gegensei-tig unsere Sprachgewohnheiten befragen und das war produktiv,wenn auch sehr mühsam. Aber diese kleinteilige, mühselige und zu-gleich beglückende Arbeit an jeder einzelnen Sprachentscheidungfinde ich sehr gut.Was für Entdeckungen hast Du denn gemacht?Guido GrafIch habe vieles wiedergelesen, auch neu gelesen, Texte, die ich langenicht mehr gelesen habe oder Autor:innen, von denen ich vor Jahr-zehnten mal was gelesen habe. Das hat mir sehr gut gefallen und ge-fällt mir noch.Das ist etwas,was ich tagtäglich mache, abermit einer
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
108 109
viel höheren Intensität, als ich das vielleicht sowieso schon mache.Für mich ist wichtig, diese Kreuz- und Querverbindungen herzustel-len, um damit weiterzuarbeiten. Spannend fand ich auch, dass sichjeden Tag Türen geöffnet haben,wenn ich in das Dokument gesehenhabe. Oh, noch eine Tür, durch die ich auch gehen müsste.Annette PehntEs hat ein hohes Maß an Schreibenergie absorbiert und das Bild mitden Türen passt genau. Ich möchte auch darüber nachdenken, wieman im Schreibleben überhaupt einen solchen Schreibraum einrich-ten kann, bei dem sich ständig immer andere Türen auftun, in denman hineingehen kann und zwar jeden Tag, wenn man möchte. Daskann zur Schreib – Routine ist das falscheWort – aber zum Schreible-ben könnte es dazugehören, so einen Raum zu haben, indem mannicht alleine ist, sondern in dieser micro-community mit anderenund auf diese Weise sich in die Produktivität bringt und sich gegen-seitig Gedankengänge öffnet.Das finde ich einen enormen Luxus,deraber gar nicht so schwer zu bekommen ist,weil er nur darauf gründet,dass man sich entscheidet, diesen Raum gemeinsam zu haben undauch darin Zeit zu verbringen.Das ist Zeit, die sich im kommerziellenSinne überhaupt nicht auszahlt.Das schlägt sich nicht nieder in einervermarktbaren Publikation. Aber so einen Raum zu haben: Ich habemal vor ein, zwei Jahren eine Ausstellung von Alexander Kluge gese-hen,Gärten der Kooperation.Da gab es Denkinseln,wie Gärten, in dieman hineingehen konnte. Für mich war das ein Garten der Koopera-tion. Solche Gärten zu haben, verhindert ja niemand.Man könnte diehier haben undwir hatten das für ein halbes Jahr.Das begeistert michauch so daran. Weil es das Gegenteil ist zu dem Schreiben, das ichsonst habe, alleine an einem längeren Text. Das ist dann kein Garten.Da sitze ich alleine auf einem Jägerstand, mit einem Fernglas undwarte. Da tun sich dann auch nur die Türen auf, die ich selber vorhererfinde. Das ist ein grundlegend anderer Vorgang. Dieses gemeinsa-me Herumirren in Gärten wird mich auch weiterhin sehr interessie-ren.Guido GrafFür unseren Fachbereich Kulturwissenschaften & ästhetische Kommu-nikation ist die Verbindung von Theorie und Praxis von großer Be-deutung und immer auch Gegenstand von Diskussionen. Wie kannman das formulieren? Wie kann man das noch stärker machen? DieBeschäftigung mit unserem Theoriegedicht, aber auch mit dieserVorlesung, mit diesem Podcast, hat mich immer mehr dazu geführt,dass dieses »Und« das Entscheidende ist. Und zwar auf eine andereArt und Weise, als man das in den Konventionen versteht, nämlichviel mehr das Verbindende und das Trennende in eins zu denken,
dass die Theorie ohne Praxis nicht zu haben ist und die Praxis nichtohne Theorie. Das ist essentiell für die Künste,mit denen wir uns be-schäftigen, in denen wir stecken. Das ist, was ich eine soziale Poetiknenne. Die haben wir u.a. praktiziert als Text und wir praktizieren sieauch in anderen Formen, also in den Gesprächen mit Studierenden,mit Kolleg:innen und so weiter.Annette PehntDas,was ich immer noch als Konflikt wahrnehme, also einerseits lite-rarisch erzählen, andererseits theoretisch reflektieren, hebt sich aufin dem, was man vielleicht »doing Theory« nennen könnte. Es isteine Praxis der Theorie.Manmuss nicht mal »und« sagen.Man kanndas einfach ineinander schreiben, weil es sich überlagert, ineinandergreift, ineinander aufgeht,wennmanTheorie so versteht,dass Litera-tur auch immer Theorie hervorbringt. Das finde ich einen sehr hilf-reichen Gedanken, weil ich nicht mehr in diesen Entweder-Oder-Ka-tegorien denken muss – und dann vielleicht auch anders schreibenkann.
falten, flächen, friktionen falten, flächen, friktionen
Anmerkungen
https://pfeil-undbogen.de/visier/glaette-und-reibung/
110 111110 111
Dirty Bird TranslationIm Gespräch mit Uljana Wolf
Mit UljanaWolf spreche ich über Dirty Bird Translation und über dieTheorie der schlechten Architektur. Wir sprechen über Theresa Hak-Yung-Cha und Yoko Tawada, über Ilse Aichinger und schlechteWörter,über Derrida und die Einsprachigkeit des Anderen, über translingua-le Dichtung, Else Lasker-Schüler, Erasures und über Gap-Gardening,das RosemarieWaldrop empfiehlt.Die Lyrikerin und Übersetzerin Ul-janaWolf debütierte 2005 mit ihrem Gedichtband kochanie, ich habebrot gekauft 2009 folgten falsche freunde und 2013 meine schönstelengevitch. 2012 veröffentlichte sie zusammen mit ihrem Mann, demamerikanischen Lyriker Christian Hawkey Sonne from Ort, einenBand mit Erasures. Zuletzt ist ein umfangreicher Band mit Essaysund Reden erschienen: Etymologischer Gossip.
Guido GrafUljana, Du hast Dich in Deinem neuen Buch einmal als »vielleichtOst-, vielleicht Postost-, wahrscheinlich mehrdeutschliche Schrift-stellerin« bezeichnet.Was meinst Du damit?Uljana WolfIch habe jetzt zehn Jahre in New York gelebt, bin immer hin und hergependelt, aber doch sehr deutlich so, dass ich mich da auch mentalangesiedelt habe. In dieser Zeit ist es mir immer klarer, merkwürdigdeutlich geworden, wie sehr ich doch Ostdeutsche bin, obwohl ichzehnwar, als die Mauer fiel, und zwar in derArt,wie ich mich im civicspace, im gesellschaftlichen Raum definiere, wie ich Solidarität defi-niere, wie ich anders über Herkünfte nachdenke. Das ist mir immerdeutlicher geworden. Was auch hineinspielt, ist die Wahrnehmung,dass ich zur Sprache gekommen bin über eine unsichtbare Immigra-tion.Was meine ich damit? Da ich mich in New York oft auch als Im-migrantin reflektiert habe, ist eigentlich die erste Migration in mei-nem Leben, nämlich die von ostdeutsch in gesamtdeutsch plötzlichimmer deutlicher geworden. Ein biographischer Bruch, der für michauch sprachlich relevant war. Das kann ich erst jetzt aus der Rück-schau merken. Das habe ich damals nicht gemerkt. Aber der Gang in
112 113
ein offenes Unbestimmtes, der Bruch der Biografien unserer Eltern-generation, auch was die Sprache mitgemacht hat, wie die Sprachemöglicherweise zwei Sprachen war, zwei deutsche Sprachen, die sichdann irgendwie zusammen warfen.All das hat damit zu tun, dass ichmich als Ost und Post-Ost definiere und eben als eine deutscheSchriftstellerin, die Deutschsein oder auch deutsche Sprache immerals Vielfaches und als Gebrochenes wahrnimmt.Guido GrafDu hast mal davon erzählt, wie Du angefangen hast, Gedichte zuschreiben.Duwarst 13 oder 14 Jahre alt.Wann hast Du angefangen zuübersetzen?Uljana WolfDas begann mit einer Übersetzer-Werkstatt in Berlin, einer deutsch-polnischen Übersetzer-Werkstatt, organisiert von Ewa Slaska, die denVereinWir gegründet hatte, einen deutsch-polnischen Schriftsteller-Verein. Das war im Jahr 2000 und die Idee war, junge deutsche undpolnische Dichter für drei, vier Tage zusammen zu bringen und sichgegenseitig übersetzen zu lassen auf der Basis von vorher angefertig-ten Interlinearversionen, also das klassische Nachdichten. Das warfür mich die Initiation. Da habe ich zum ersten Mal übersetzt, zumerstenMal Lyrik geschrieben, die nicht meine Lyrik war.Den Vorgangdes Übersetzens habe ich als vielerlei erlebt, als kommunikative Situ-ation, in der Bedeutung verhandelt wird, nicht nur zwischen mir unddem Text, sondern zwischen mir und dem Original-Autor, der danndaneben saß. Mit Händen und Füßen hat man sich da versucht zuverständigen. Aber auch mit dem Interlinear-Übersetzer oder derÜbersetzerin ging das so. Eine hochkommunikative Situation. Unddann diese Zündung, die Auseinandersetzung mit der anderen Spra-che, mit dem Wissen und Nichtwissen um die eigene Sprache. Dennwas passiert, wenn man anfängt, Lyrik zu übersetzen, ist ja, dass dieeigene Sprache einem fernrohrmäßigwegrutscht,weil man sie plötz-lich ganz anders befragt und das richtige Wort doch nicht zur Handhat,was in der anderen Sprache das Richtige ist. Das war für mich alsÜbersetzerin der Anfang: als Nachdichterin. Das waren auch kollabo-rative Übersetzungen. Das war aber auch der Beginn, mich mit demPolnischen auseinanderzusetzen, mit der polnischen Geschichte. Ichbin danach nach Polen gegangen zum Studieren und das war aucheine Initialzündung für ein Dichten im Echoraum anderer Sprachen.Meine eigene Gedichte haben dadurch unglaublich gewonnen undmein Nachdenken über Sprache, indem ich immer neben einer ande-ren Sprache oder überhaupt in der »Anwesenheit aller Sprachen derWelt« gedacht und gedichtet habe. So kam es dann auch zu dem ers-ten Gedichtband kochanie, ich habe Brot gekauft.
Guido GrafEs gibt eine Dreier-Bewegung,die ich zumindestmit diesemÜberset-zen bei Dir immer wieder in den Texten, die jetzt in dem neuen Buchversammelt sind, wiederfinde. Du sprichst oft von Ankunft, vom An-kommen, vom Begehren auch, das damit einhergeht, und etwas, wasman vielleicht eher als eine Funktion betrachten kann, nämlich Ge-dächtnis herzustellen. Das sind Schritte, die zusammengehören, aberdann nicht nur fürs Übersetzen, sondern auch fürs dichterischeÜbersetzen oder für das Übersetzen von Dichtung. Ein Gedächtnis,das überhaupt hergestellt werden kann, eines, das in den Texten auf-gehobenwird oder über die Texte erst erreichtwird,über das Überset-zen, also dieses »Über« von einer Herkunft, die unsicher ist, zu einemOrt, der genauso unsicher ist, aber als eine Notwendigkeit, weil wirdarum bemüht sind, so Gedächtnis zu sichern, das eigene genausowie ein gemeinsames und kollektives.Uljana WolfBeim Übersetzen wird man sich der vielfachen Brechung von Ge-dächtnis bewusst. Was übersetzen wir denn? Wir übersetzen das ge-schriebene Wort. Wir übersetzen einen Funken von Autor:innenin-tention, aber wir übersetzen auch die Materialität und das, was wirinterpretativ lesen, was zwischen den Worten geschieht und nichtnur zwischen den Worten, sondern auch zwischen den Vokalen, zwi-schen den Konsonanten, zwischen den Zeilen. Das sind die Möglich-keiten,wo sich viele verschiedene Formen von Gedächtnis einschrei-ben in ein Gedicht, die ich als Übersetzerin sehe und mit meinem ei-genen kurzschließe.Das ist eine Art derWahrnehmung von Gedächt-nis, diemir sehr liegt,weil ich selbst biographisch diese doch ostdeut-schen Brüche oder auch Migrationsbrüche in NewYork hatte. Gleich-zeitig bin ich ein Mensch mit einem furchtbar schlechten Gedächt-nis. Ich weiß nicht, ob das biographisch begründet ist, aber ich kannunglaublich schwer Dinge behalten. Aber was ich kann, ist im Aus-tauschmit einemGegenüber, ob es ein Text oder einMensch ist, frak-talhaft Dinge zusammen zu schauen.Was ich nicht kann, ist Dir jetztzu sagen,was ich vorher gelesen habe undwo es herkommt usw.MeinGedächtnis ist wie Perlen auf einer Schnur, die sind da, aber dieSchnur ist nicht immer spürbar. Das kommt mir sehr entgegen beimÜbersetzen von Gedichten. Ich kann wahrscheinlich auch keine Ro-mane übersetzen,weil ich dazu das Gedächtnis nicht habe, geschwei-ge dass ich welche schreiben könnte. Vielleicht ist das diese Verbin-dung, die Du meinst: die Ankunft und das Gedächtnis. Das war Der-rida, den ich da zitiert habe, der davon schreibt, dass es Ankommens-sprachen gibt, die – so habe ich es immer verstanden – eigentlichtranslinguale Sprachen sind, Sprachen,die durch die Übersetzung ge-
Dirty Bird Translation Dirty Bird Translation
114 115
gangen sind, die in der Lage sind, auch das in der Sprache zu bergen,was nicht erinnert werden kann, weil es traumatisch verschüttet ist.Nicht im Sinne davon, dass es irgendwann vollständig vorliegt, son-dern dass es immer nur momenthaft aufscheint. Meine VorstellungvonAnkommen ist eigentlich nicht die, dass es settlingwäre, sondernein Anzetteln, also wiederum neu etwas zu beginnen und neue Unsi-cherheiten herzustellen.Guido GrafDiesen Text von Derrida – Die Einsprachigkeit des Anderen – zitierstDu häufiger in verschiedenen Texten. So wie auch andere, etwa vonIlse Aichinger: die Texte in diesem Buch sind über einen relativ gro-ßen Zeitraum hin entstanden, wo – ähnlich wie Du auch beim Über-setzen und beim Schreiben arbeitest – ein Tunnelbau sichtbar wird.Du verwendest häufig Vokabeln, die dieses Tunnelsystem ebenfallsstützen, wenn Du etwa von Unterwanderungsplänen sprichst. Nor-bert Wehr spricht gern in Bezug auf das Kompositionsverfahren fürdas Schreibheft von einem System der kommunizierenden Röhren. Istso etwas damit gemeint?Uljana WolfJa, auf jeden Fall. Es ist dieses Maulwurfs-Prinzip. Da können wir di-rekt zu Aichinger und Eich umschalten, weil das einfach eine schöneVorlage ist,wie sie das Prosagedicht definiert haben als Maulwurfsar-beit, als Texte, die wie Maulwürfe arbeiten. Wenn man sieht, wo sieErde aufwerfen, sind sie schonwiederwoanders.Als Leser ist man im-mer voraus und hinterher und ahnt die Zusammenhänge unter denTunneln. Das ist eine Möglichkeit, das zu denken, diese Unsicherhei-ten, aber auch Kommunikationsröhren. Ich habe so ein kleines Archi-pel von Texten und Bildern.Das ist meine Theorie. Ich denke viele Sa-chen in Formvon Bildern, die fürmich funktionieren. Ich komme im-merwieder an völlig anderer Stelle heraus und merke, es bezieht sichja wieder zurück auf das Ursprungsgebilde der Röhre. Ob es jetzt dasÜbersetzen sei oder das Prosagedicht oder andere Sachen. Ich machenicht ein großes System, ich brauche nicht viel Theorie als Initiati-onszündung, um poetisch zu denken. Das ist einfach mein Haushalt.Guido GrafVielleicht sind diese Tunnelsysteme ja genau die Theorie, die herge-stellt wird.Uljana WolfJa, und das Erstaunliche ist bei diesem Buch mit Essays, die dreizehnJahre an Produktion und Denken umfassen, diesen Moment derRückschau zu wagen und zu sehen,wie sich das gebaut hat, zu sehen,wie die vielen Sachen, die ich tue, zusammenhängen, auch wenn ich
in dem Moment, wo ich sie tue, nicht ahne, wie sie miteinander zu-sammenhängen. Als ich kochanie ich habe brot gekauft geschriebenhabe, war das Thema Mehrsprachigkeit oder Translingualität über-haupt nicht auf der Tagesordnung. Der Band an sich ist auch keintranslingualer Gedichtband, ganz und gar nicht. Aber wie dort einigeGedichte schon die Arbeit anstoßen, die dann später passiert, »krzyżpolny«, die Feldkreuze oder das Titelgedicht kochanie ich habe brotgekauft, wo schon ein translingualer Moment passiert: Das ist fürmich selbst interessant zu sehen,wie eigentlich eine große Offenheitund viele Zerfallsprodukte im Denken, dann miteinander meineSicht auf die Welt und auf die Literatur immer wieder herstellen.Guido GrafDu hast die Erasures erwähnt. Bei den Texten in Deinem Essay-Bandzu Ilse Aichinger habe ich gedacht, dass es wahrscheinlich schwierigsein dürfte, mit Ilse Aichingers Schlechte Wörter, um die es haupt-sächlich geht, Erasures herzustellen, weil die so etwas eigentlich jaschon beinhalten.Uljana WolfJa, das ist hochinteressant.Aber erst einmal zum Begriff Erasure: Era-sure Poetry ist Lyrik, die sich schreibt, indem sie von bereits beste-henden Texten die meistenWorte wegnimmt. In den USA ist das eineeigene Gattung geworden. Anfänge liegen ungefähr in den 1960erJahren bei Tom Phillips, der ein Buch geschrieben hat oder immernoch schreibt: Human Document heißt das eigentliche Buch, das ersich genommen hat aus einem Antiquariat. Es musste unter einenDollar kosten und dann hat er es bearbeitet. Herausgekommen ist AHumument. Das ist das Erasure des Titels AHuman Document. Und esgibt sehr viele verschiedene Varianten davon. Ich fand es in dem Pro-jekt sehr reizvoll, das wir mit Elizabeth Brownings Gedichten ge-macht haben und vor allen Dingen in den Übersetzungen durch Era-sure, also durchWegnehmen dermeistenWorte,Varianten herauszu-kitzeln, und da auch nochmal genau diese Zusammenhänge zwi-schen Übersetzung und Original sich anzuschauen. Warum kannman das bei Ilse Aichingers Schlechte Wörter nicht machen? Sieschreibt in dem wichtigsten Text Schlechte Wörter: »Niemand kannvon mir verlangen, Zusammenhänge herzustellen, solange sie ver-meidbar sind«.Das meinst Duwahrscheinlich.Diese Zusammenhän-ge sind bereits weg undman hat nur das Gerüst.Gleichzeitig sehe ichbei Aichinger in den Schlechten Wörtern immer so etwas wie eine pa-ranoide Paranomasie. Es gibt Zusammenhänge zwischen den Wort-formen und zwingende Logik zwischen den Sätzen, wenn man sichauf sie einlässt, zwischen den Pronomen, zwischen dem Ding, denwinzigen, sehr sparsamen Bildern, die sie einbringt, ob es die Flecken
Dirty Bird Translation Dirty Bird Translation
116 117
auf dem Sofa sind oder eben die Untergänge, das Fenster usw. Es gibteinen unglaublichen Sog, aber man kann ihn eigentlich nicht mehrmit irgendwas abgleichen, das man kennt in der wirklichen Welt. Daist das Erasure der common sense oder: das Einverständnis zwischenuns und der Welt wurde erased. Ich war im Archiv in Marbach undhabemir die Typoskripte oder,was es anMaterial gibt zu den Schlech-ten Wörtern, angeschaut. Ilse Aichinger hat auf Schreibmaschine ge-schrieben und sie hat immer auch auf den Rückseiten von anderenTexten geschrieben, immer zwei Seiten verwertet, meistens auf denNachrichten des Evangelischen Pressedienst epd. Das Typoskriptzeigt sehr voll beschriebene Seiten, bis an den Seitenrand. Genau sohat sie auf der anderen Seite auch geschrieben. Es fängt vorne an,hört hinten auf und es gibt keine Absätze. In diesen Texten ist allesimmer schon mitgedacht, auch in der in der Art, wie sie Sprachedenkt, in der Poetik. Sie sind nicht im Nachhinein bearbeitet worden,wie man es ja so kennt, dass man einen Text schreibt und dannkämmt man ihn aus, bis das Wichtigste noch übrig bleibt. Zum Zeit-punkt, als sie Schlechte Wörter geschrieben hat, war das schon garnicht mehr nötig. Diese Sätze waren so klar. Das geht einher mit derunglaublichen Offenheit des Endes. In einem Interview sagte sie die-sen unglaublichen, wie gedruckten Satz: »Das Nichtwissen um denInhalt dieser Texte Schlechte Wörter geht einher mit demWissen vonder Stimmigkeit des ersten Satzes.« Der erste Satz musste stimmenund der entzündet alles andere.Guido GrafDiese ersten Sätze bei Isa Aichinger haben ja eine merkwürdige Zün-dung. Das sind keine starken, herrischen Sätze oder dergleichen. Siescheinen immer eine Blöße offenlegen zu müssen.Uljana WolfJa, z.B.: »Ich gebrauche jetzt die besserenWörter nicht mehr«.Guido GrafDu hastmit Christian Hawkey zusammen die SchlechtenWörter über-setzt und über die Arbeit an dieser Übersetzung geschrieben. 2018 istdas Buch erschienen.Uljana WolfJa, genau. Nach 10 Jahren Arbeit.Guido GrafWahnsinn. Aber wenn man den Text gelesen hat, bekommt man eineAhnung davon,warum es so lange gedauert hat. In einem Text zu IlseAichinger sprichst Du auch von der schwachen Architektur. Ist dasdamit eigentlich auch gemeint? Also auf die zweitbesten Wörter zu
achten, dem nicht auszuweichen, nicht zu versuchen, zu kompensie-ren mit starken Gesten,mit machtvollen Sätzen?Uljana WolfMan kann es sowohl fürs Übersetzen als auch fürs Schreiben anwen-den. Von vielen Übersetzungstheoretikern und Übersetzern selbstwird oft betont, dass man als Übersetzer ungeschickt sein muss,wenn man es muss. Man darf, wenn die Vorlage es von einem ver-langt, dieses oder jenes ungeschickte Wort immer verwenden, mandarf nichts polieren. Man darf nicht der starken Architektur nachge-ben, die man bauen könnte. Nicht alle Texte verlangen das, aber vieletun es.Wennman Lyrik übersetzt, ist allein der Gedanke, dass man soübersetzt, dass es ein schöner Text wird in der eigenen Sprache, abergleichzeitig das Übersetztsein spürbar ist, die Voraussetzung für eineschwache Architektur. Das ist eigentlich eine unmögliche Architek-tur.Aber ich denke, dass es möglich ist. Nur im Einzelfall und das im-mer wieder. Schleiermacher hat darüber gesprochen und hat in einermanchmal missverstandenen Wendung, weil sie nämlich sehr iro-nisch gemeint ist, gesagt: »Welcher Übersetzer möchte denn gerneBlendlinge produzieren anstatt reine Kinder?« Die reinen Kinderwä-ren die, die mit der Schönheit des Originals und der Schönheit derMuttersprache gepaart werden. Die werden mit dem Vaterland undderMuttersprache gezeugt.Die Blendlinge oder Bastarde sind die, dieunnatürliche Verrenkungen machen, weil sie mit der anderen, mitder fremden Sprache und der Muttersprache gepaart sind. Ein ganzmerkwürdiges, problematisch biologisches Bild, in der Zeit verankert.Aberwas er damit eigentlich sagenwollte, ist nicht: Übersetzer bewa-re! Mach keine Blendlinge. Sondern eigentlich wollte er sagen: Wirmüssen das tun, um spannende Übersetzungen zu produzieren, umunsere Sprache weiterzubringen und eben nicht zu domestizieren.Man muss manchmal ungeschickt sein oder schwache Architekturbauen oder Verrenkungen machen. Das ist schwer. Es gibt viele Bei-spiele,wo ich beim Übersetzen denWiderstand in den Fingern spüre,weil ichwirklich gerne die schönere Lösung hinschreibenmöchte, dieich weiß, die in mir ist, aber mich bezähmen muss, damit es diesenspeziellen touch hat und ein bisschen rauer an der Oberfläche kratzt.Beim Schreiben ist die schwache Architektur das gleiche Problem:nicht zu perfektionistisch, nicht die starken Gesten, nicht das Be-haupten,nicht das,wasman ja sehr gut kann,Manipulierenmit Spra-che. All das gilt es zu vermeiden.Guido GrafDas ist das,was Du von RosmarieWaldrop zitierst: das gap gardening,die Lückenpflege.
Dirty Bird Translation Dirty Bird Translation
118 119
Uljana WolfEin Schreiben, das die Lücke in der Syntax schon mitdenkt oder oderin der Art, wie die Sätze verbunden werden, ist solche Lückenpflege.Rosemarie Waldrop, auch für mich eine wichtige Schriftstellerin, ar-beitet mit der schwachen Architektur, indem sie Genres aufbricht,den patriarchalen Diskurs aufbricht und Hybridisierung zulässt, alsoSchwachstellen und Fertigkeiten im Schreiben. Das ist sicherlichauch begründet durch ihren Sprachwechsel, den Umstand, dass sieerst sehr lange übersetzt hat, dann zum Schreiben gekommen ist ineiner Nicht-Muttersprache.Guido GrafWir umkreisen im Grunde ja schon die ganze Zeit auch die kleine Li-teratur, von Deleuze und Guattari sprechen, auf die Du auch mehr-fach in Deinen Essays Bezug nimmst, also die Minorisierung undMi-grantisierung von Sprache. Du nennst die drei Punkte von Deleuzeund Guattari, dass kleine Literatur deterritorialisiert, politisch istund gerade dadurch eben Kollektive produziert. Kannst Du vielleichtversuchen, an diesem Beispiel zu erklären, was mit MinorisierungundMigrantisierung von Sprache in diesem Kontext gemeint ist? AmBeispiel von Waldrop, aber natürlich etwa in Bezug auf die von Direbenfalls diskutierten Theresa Hak Kyung Cha oder Yoko Tawada.Uljana WolfJa, oder auch Dagmara Kraus. Es geht darum, so zu schreiben, dass dieSprache sich nicht gehört, dass das Gehören ihr nicht eingeschriebenist. Das verstehe ich als Deterritorialisierung. Das kann sich äußernin Fehlern, in programmierten Fehlern. Das kann sich äußern in klei-nen Abweichungen von der Syntax der Normsprache, aber wenn eseben nicht nur unterläuft, sondern dann irgendwann das Gedichtauch poetisch als Programm diesen Fehler macht und sich späterdann anschaut beim Fehlermachen und daraus wieder poetischenFunken schlägt. Das geschieht, um einen Abstand, eine Distanz ein-zubauen zwischen Sprache, Sprecher und und Text, dass nicht dieseSelbstverständlichkeit da ist. Ich übe diese Macht aus, in der Sprache,in der ich geboren wurde, schreibe ich in dieser Form, die ich gefun-den habe, die mir gehört und so weiter und so fort. Ob das jetzt Dag-mara Kraus macht, die Französisch und Polnisch mischt im Deut-schen, ob das Yoko TawadamachtmitGrammatik der deutschen Spra-che und über Personalpronomen schreibt oder auch Aichinger, die janie eine andere Sprache hatte, aber die ihr so fragwürdig gewordenist durch die Verwerfungen des 20. Jahrhundert als sogenannte Halb-jüdin in Wien, so dass sie bei einen Satz ankommt wie: »Meine Spra-che ist eine, die zu Fremdwörtern neigt«. Das meine ich mit Deterri-torialisierung und das kann sehr spielerisch sein und schön. Und es
kann auch sehr ernst sein und sehr spröde. Warum ist es politisch?Weil die Haltung dahinter eine politische ist, selbst wenn der Inhaltnicht dezidiert sich politisch äußert, aber einfach die Haltung, diediese Distanz einzieht und diese Nichtübereinstimmung, die ist poli-tisch,weil sie die Aufmerksamkeit lenkt auf die Machtstrukturen, diedahinter liegen: Wie wird etwas als deutsch gedacht? Wie wird etwasals Heimat gedacht, als angestammt, als gegeben und selbstverständ-lich.Nicht sicher bin ich mir über den Punkt des Kollektiven, also wasfür eine Idee von Kollektiv dahinter steht,wenn man sagt, das drücktsich dann kollektiv aus. Vielleicht könnte man das als eine neue Artvon Kollektiv sehen: ein neues Kollektiv, das sich aus den vielfach in-tersektional durchkreuzten Identitäten ausmacht. »Making kin«,mit Donna Haraway gesprochen, also verschiedene Formen der Soli-darisierung zu finden in so einem Text oder, wie ich es bei DagmaraKraus, gezeigt habe, wo dann ein Gedicht »deutschyzno moja« Kol-lektive aufzeigt, die eigentlich zwischen polnischen Solidarność-Flüchtlingen, Flüchtlingen aus Schlesien, aus Deutschen und Mi-granten und Geflüchteten aus Syrien plötzlich kollektiv aufzeigenkann, indem einfach die Sprache verfremdet, verfehlert, verwandelt,also deterritorialisiert wird.Guido GrafVielleicht sind das ja keine starken Kollektive, sondern höchst insta-bile, temporäre Gebilde.Aber es sind eben welche.Wennwir nochmalauf das, was wir zu Aichinger gesagt haben, zurückkommen: Nichthergestellte Zusammenhänge sind eben auch Zusammenhänge.Uljana WolfDas ist doch eigentlich ganz angstfrei, oder? Ich finde das sehr beru-higend. DiesesWissen, dass nicht hergestellte Zusammenhänge auchZusammenhänge sind und dass in den »gap gardens« eben auch gar-dens wachsen, dass Kollektive instabil sind, aber trotzdem sich im-mer wieder finden.Mich stimmt das froh und hoffnungsvoll und ichsehe das nicht angstbesetzt, obwohl es sicher vieleMenschen gibt, diees so sehen, weil die Sicherheiten und die Strukturen wegbrechenoder einfach eine viele Jahrhunderte westlich überlieferte Art, dieDinge zu sehen,wie sie sein sollen, die Poetiken zu sehen,wie sie seinsollen, die Sprachenzuordnung. Das macht ja Angst, wenn das plötz-lich so in Frage gestellt wird.Guido GrafDie anderen Poetiken oder die Details zu den Poetiken sind ja genau-so angstbesetzt. Ichmussmir ja nur unsere Studienordnungen in Hil-desheim anschauen: Da steht es war so nicht, aber dieser Drang etwa,eine eigene Stimme zu finden, steckt natürlich ganz stark darin. Und
Dirty Bird Translation Dirty Bird Translation
120 121
das ist die Motivation vieler, die in Hildesheim oder wahrscheinlichauch in Leipzig oder Biel anfangen zu studieren. Sie wollen eine eige-ne Stimme finden und damit ist in der Regel diese starke Stimme ge-meint, nicht unbedingt die eigene Stimme, die sie gar nicht haben.Die fremde Stimme. Was sich unter anderem auch darin nieder-schlägt, dass der Anteil der migrantischen Stimmen unter den Stu-dierenden relativ gering ist.Uljana WolfDer Anspruch, die eigene Stimme zu finden, setzt meistens schonvoraus, dass ich die Lizenz habe, sie zu finden.Dass mir der Status zu-geteilt wurde, dass ich das finden darf. Das ist leider so in unseremBildungssystem, in dem es immer noch migrantische Stimmen sehrschwer haben, in sich die Lizenz zu finden,weil sie ihnen nicht gege-ben wurde von der Leitkultur Deutschlands. Aber natürlich habe ichals Autorin auchmeine Stimme.Man fängt an undmacht Sachen. Ichglaube,man kann schon,währendman anfängt zu schreiben und umsich zu finden, sich sehr wohl stark oder schwach finden. Man kannsich dominant eine Poetik zurechtlegen und dominante Formen be-dienen. Den klassischen Roman oder den superklugen, literaturwis-senschaftlich durchgearbeiteten Essay. Oder man sucht sich seineStimme schon von Anfang an in hybriden Strukturen. In Dirty BirdsTranslation habe ich geschrieben, dass man mit Fehlern übersetzenkann, aber man muss erst genug wissen, um die richtigen Fehler zumachen oder die Fehler, die dann poetisch zünden. Es geht nicht dar-um, dass man alles in einen Topf wirft und ein Kessel Buntes kommtraus in der Hybridisierung, sondern es muss schon poetisch und po-litisch und vom eigenen her alles seinen Platz finden und durchdachtwerden. Die Tools muss man kennen, um das Haus des Meisters aus-einanderzunehmen, um Audre Lorde zu zitieren.Guido GrafEine Strategie, die Du verfolgst, mit Deiner Lektüre, ist eine Art no-madisches Lesen, was ich besonders eindrucksvoll an den Beispielenvon M. NourbeSe Philips Zong! oder Dictee von Theresa Hak KyungCha fand. Das ist eine translinguale Dichtung, in der transnationaleIchs eine Rolle spielen oder die Suche nach einer dritten Stimme.Uljana WolfJa, ich finde Chas Buch Dictee auch immer noch sehr eindrucksvoll.1981 ist es erschienen, das Buch einer koreanischen Immigrantin, dieautobiographische, kurze Prosatexte neben eher experimentelle Tex-ten stellt, die teils französisch, teils englisch sind. Interessant ist da,wie dieses »Eine Stimme finden« in diese vielfachen Prozesse gespie-gelt und gebrochen wird. Die Sprachgeschichte der Mutter: Korea-
nisch, chinesisch, japanisch. Die Schule, auf die sie gegangen ist, diefranzösische Klosterschule und dann das Französische, das Englische,das sie wirklich sehr rausschreibt, also teilweise Sätze, die fast falschklingen in englischen Ohren und die auch sehr schwer zu übersetzensind. Das wäre ein Beispiel für die schwache Architektur beim Über-setzen. Deswegen kann man das Buch wahrscheinlich nicht in Gänzeübersetzen. Ich habe nur ein paar Auszüge übersetzt, weil es schwerist, das abzubilden, und dann ein Deutsch zu übersetzen, das auchklumpig klingt, weil es bewusst so sein soll. Was ich an diesem Buchso schön finde, ist einerseits die Möglichkeit von Literatur, die Dikta-te abzubilden, die politischen, biografischen Diktate, die uns eineStimme eingeben.Ob es die Diktate sind einer Sprachpolitik, die eineSprache unterdrückt, oder ob es die nicht ausgesprochenen Sprachenunserer Großeltern-Generation ist,was sich da alles nicht ausgespro-chen hat und traumatisch verzweigt.Das ist ja auch eine Art von Dik-tat.Diese Diktate werden in dem Buch abgebildet durch die hybridenGenretexte wie auch durch das Zusammenspiel zwischen Fotografieund Bild. Dadurch aber entsteht eine Literatur, die sich der Diktatedann doch entledigt oder sich davon befreit und in dieser translingu-alen Stimme, in dieser Vermischung der Schichten unglaubliche Poe-sie entstehen lässt, ohne dass es ganz wird und ohne dass ein völligneues, klar definiertes sprachliches Subjekt herauskommt. Diese Of-fenheit auszuhalten, auch in einem Buch, auch als Autorin, das hatmich sehr beeindruckt.Guido GrafVilém Flusser hat in seinem Gestenbuch davon gesprochen, dassMasken eigentlich erst als Masken erkannt werden können, wennman sie wendet. Sind diese Zuschreibungen, von denen Du eben ge-sprochen hast, also diese Zuschreibung der Mehrheitskultur, die ei-nen einschließen, die abschließen, einkerkern, die disziplinieren undstrafen, auchMasken,diemanwenden kann,um sie dadurch sichtbarzu machen?Uljana WolfMasken heißt ja im Grunde etwas Aufgesetztes, eine Persona, die ichannehme. Zusätzlich zu meiner eigentlichen Person. Ich glaube aber,dass Menschen, die durch Kolonialisierung, Besetzung, traumatischeEmigration die Zuschreibung der Mehrheitsgesellschaft, die sie er-lebt haben, teilweise gewaltvoll, nicht als Maske definieren würden,dass sie diese abnehmen und wenden können, sondern dass sich dasviel, viel tiefer eingearbeitet hat und nicht zu trennen ist von der Per-sona, von der Person. Aber das Wenden und Umwenden sieht manschon. Das sieht man in vielen Kiez-Kulturen in Deutschland oder inallen möglichen Formen, wo man die Minderheitenkultur appropri-
Dirty Bird Translation Dirty Bird Translation
122 123
iert und die negative Zuschreibung beendet, annimmt und weiter-führt. Else Lasker-Schüler hat mal in einem ihrer wilden Briefe ge-schrieben, dass sie sich dem Zirkus anschließen würde. Und dann hatman gefragt: Warum? Weil sie sowieso schon als orientalisierte Lyri-kerin mit dunklen Augen und einfach als nicht zugehörig, auch alsjüdische Autorin, als nicht zugehörig zurMehrheitsgesellschaft gese-hen wurde. Auch mit ihrem Stil, mit ihrer Unangepasstheit, mitihrem Gender-Crossing. Wenn man dann aber sagt, man geht zumZirkus, ist das genau diesesWenden der Zuschreibung. Ich bin sowie-so schon exotisiert von der Mehrheitsgesellschaft, da kann ich mirdamit wenigstens auch noch eine materielle Sicherheit verschaffen.Das war das Argument.Manchmal bleibt einem nichts anderes übrigund manchmal ist es einfach auch Empowerment, eine Affirmation,Bestärkung, das zu nehmen und umzuwenden.Guido GrafDu sprichst von der Zunahme einermehrsprachigenWirklichkeit, diewir in allen Ebenen unserer Gesellschaft in Deutschland und nichtnur in Deutschland erleben. Ist translinguale Dichtung die mögliche,die genau richtige Reaktion oder ist sie immer schon Teil davon?Uljana WolfBeides. Sie ist eine Reaktion darauf insofern, als dass sie nicht abbil-det. Translinguale Lyrik bildet nicht code switching ab, sondern sieschafft einen ästhetischen Neugewinn, der sich verbindet mit Mehr-sprachigkeit imwirklichen Leben, aber sie nicht abbildet. In der Prosahaben wir ja viel länger schon translinguale Diskurse oder sprechenüber Mehrsprachigkeit in der Prosa, vor allem, weil sich das durchSprecher sehr viel leichter abbilden lässt.Man hat Figuren im Roman,die mehrsprachig sind und die sich dann so auch ausdrücken.Da gibtes verschiedene Grade der Intensität und der Schroffheit. In der Lyrikhat man nicht die Sprecher, sondern ein Zusammentreffen von Spra-chen, in verschiedenen Möglichkeiten, so wie bei Dagmara Krauss alsPortemonteau-Wörter zwischen verschiedenen Sprachen. Eine ande-re Spielart sind translinguale Gedichte, die auf der Oberfläche nureinsprachig sind. Das ist aber keine neue Erfindung, sondern wir ler-nen jetzt erst durch unsere mehrsprachige Wirklichkeit, wie das inGedichten funktioniert, also wie Gedichte von Paul Celan mehrspra-chig sind, wie vielleicht auch viele andere Texte mehrsprachig sindoder wie eben die falschen freunde, die ich geschrieben habe, mehr-sprachig sind, obwohl eigentlich die Oberfläche deutsch ist. Es isteine Reaktion, aber eben kein Abbild der mehrsprachigen Wirklich-keit. Translingualität in der Lyrik heißt auch Wissen und Nichtwis-sen. Es ist eine neue Art poetisch zu sprechen, von der wir noch nichtso viel wissen, die sich auch erst gerade entwickelt. Ich hoffe, dass wir
die Arten sehen und lernen werden, das zu lesen und zu sehen, weilwir von unserer Wirklichkeit lernen. Wir sind nicht alle mehrspra-chig, sondern nehmen unsere unterschiedlichsten Kompetenzen undauch Unübersetzbarkeiten im Leben deutlicher wahr. Ich fand es im-mer toll, aber ich habe es eigentlich nie richtig benutzt. Erinnerst DuDich an Chatroulette, eine App, in der man ganz schnell mit immerneuenMenschen aus der ganzenWelt verbundenwurde? Translingu-ale Lyrik ist Chatroulette in der Sprache.
Dirty Bird Translation Dirty Bird Translation
Anmerkungen
Ilse Aichinger: SchlechteWörter. Frankfurt a.M.: S.Fischer, 1991.
Ilse Aichinger: BadWords. Selected Short Prose.Translated by UljanaWolf and Christian Hawkey.London, NewYork, Calcutta: Seagull Books, 2018.
Theresa Hak Kyung Cha: Dictee. Berkeley: University ofCalifornia Press, 2001.
Jacques Derrida: »Die Einsprachigkeit des Anderenoder die Prothese des Ursprungs.« In: AnselmHaverkamp (Hg.), Die Sprache der Anderen. Frankfurta.M.: S. Fischer 1997, S. 15−42.
Vilem Flusser: Gesten.Versuch einer Phänomenologie.Bensheim: Bollmann, 1991.
Christian Hawkey / UljanaWolf: Sonne from Ort.Austreichungen / Erasures. Berlin: kookbooks 2012.
M. NourbeSe Philips: Zong! Toronto: University Press ofNew England, 2008.
Rosemarie Waldrop: Dissonance (if you are interested).Tuscalosa: The University of Alabama Press, 2005.
UljanaWolf: kochanie ich habe brot gekauft. Gedichte.Idstein: kookbooks, 2005.
UljanaWolf: falsche freunde. Idstein: kookbooks, 2009.
UljanaWolf: meine schönste lengevitch. Gedichte.Berlin: kookbooks, 2013.
UljanaWolf: Etymologischer Gossip. Essays und Reden.Berlin: kookbooks, 2021.
124 125124 125
WasimmerwitzGespräch mit Ulrich Blumenbach
Der Übersetzer Ulrich Blumenbach wurde 1964 in Hannover geboren.Heute lebt er in Basel. Er übersetzt vom Englischen ins Deutsche. Fürdie Übersetzung von David FosterWallace’ Roman Unendlicher Spaßwurde er mit dem Übersetzer-Preis der Leipziger Buchmesse ausge-zeichnet. Seit einigen Jahren arbeitet Blumenbach nun schon an derÜbersetzung von Witz, so der jiddische Originaltitel des umfangrei-chen Romans von Joshua Cohen, der 2010 erschienen ist. Ein extremkomplexer Text mit unendlich vielen Details, die bei anderen schnellals unübersetzbar gelten würden und in dem Assonanzen, Kalauerund poetische Elemente sich ineinander schichten und zu einemebenso widerspenstigen wie vielsprachigen Werk verdichten.Witz istein Roman über einen jüdischen Messias der Jahrtausendwende, dermit dem Entsetzen auf burlesk bösartige Weise umgeht. Ein Post-Ho-locaust-Roman als Prosagedicht, in dem das Jiddische ebenso wichtigist wie die Stand-up-Comedy. Eine Strategie rhetorischer Reizüber-flutung. Spätestens mit diesem Roman gilt Joshua Cohen, Jahrgang1980, einerseits als Vertreter einer US-amerikanischen jüdischen Li-teratur in der Nachfolge von Isaac B. Singer und Philip Roth.Anderer-seits wird er auch mit James Joyce und David Foster Wallace vergli-chen.
Guido GrafDu arbeitest jetzt seit wie vielen Jahren anWitz?Ulrich BlumenbachIch habe vor sieben Jahren angefangen, 2014 glaube ich.Guido GrafWie schätzt Du das ein? Ist das ein Zeitraum, der extrem ungewöhn-lich ist oder passt er einfach zu dem Buch?Ulrich BlumenbachEr passt sicher zu dem Buch.Aber ichmuss gleich dazusagen, dass ichnicht die ganze Zeit nurWitz übersetzt habe. Sondern ich hab da et-was praktiziert, was man vielleicht produktives Prokrastinieren nen-
126 127
nen kann. Immer wenn ich auf Witz keine Lust mehr hatte, weil esmir zu schwer wurde, habe ich ein anderes Buch gemacht. Das heißt,dass neben Witz noch sieben andere Bücher entstanden sind, um-fangreiche wie die Essays von Wallace, die Du ja ebenfalls im Regalstehen hast.Guido GrafUnd Dorothy Parker hast Du übersetzt.Ulrich BlumenbachParkers Gedichte waren wohl fast fertig, als ich mitWitz angefangenhabe. Vielleicht nicht ganz. Aber es waren auch wirklich kleine Büch-lein dabei.Guido GrafDu sagst, Du hast was anderes gemacht,wenn es Dir zu schwierig ge-worden ist. Hilft es auch, mit anderen Texten zu operieren, um dannbesser wieder reinzukommen?Ulrich BlumenbachJa und nein. Es macht sicher mehr Spaß oder spornt an, mich dannwieder mitWitz und seinen Komplexitäten zu beschäftigen. Es heißtandererseits natürlich auch, dass ich mich erst wieder einarbeitenmuss in die Materie, in seinen Sprachgebrauch, in seine Ästhetik,auch in seineWelt.Guido GrafWenn Du das jetzt vergleichst mit der ja ebenfalls sehr langen Zeit,die Du für Infinite Jest aufgewendet hast?Ulrich BlumenbachMit Infinite Jest ist es natürlich zu vergleichen.Quantitativ, die LängederArbeitszeit, die Schwierigkeit der beiden Texte. Zwei Unterschiedegibt es wohl. Der eine ist wesentlich:Wallace ist in Infinite Jest immerpräzise. Er ist schwer. Ichmuss Fachsprachen recherchieren. Ichmussmich auf verschiedene Figuren und Sprachen einlassen.Aber alles istpräzise, hyperrealistisch.Cohen schreibt besonders inWitz, tendenzi-ell aber auch in anderen Werken – man könnte sagen: areferentiell.Hinter der reinen Sprachoberfläche ist keine Welt zu erkennen. Undbei zwei, drei Seiten ging es mir so: Ich habe sie übersetzt, und auchnach dem Übersetzen wusste ich nicht, was auf diesen Seiten steht.Übersetzen im Blindflug. Das ist mir wirklich noch nie passiert. Viel-leicht mal einen Satz lang oder so, aber nicht eine ganze Seite lang,dass ich hinterher nicht sagen konnte,was da eigentlich passiert.Gut,welche Wörter da stehen, welche Sätze da stehen und was ich aufDeutsch daraus gemacht habe. Ja, das kann ich benennen. Aber es istkeine Welt plastisch geworden. Das ist der ganz große Unterschied.Der zweite ist ein anderer und hat eher mit meiner beruflichen Situ-
ation zu tun. Infinite Jest war mein erstes Riesenwerk. Ich bin in die-sem Buch irgendwie versackt. Ich wusste nicht, ob ich es schaffe, undich wusste nicht,wie die Öffentlichkeit hinterher darauf reagiert. Obdieses Buch total floppt oder ob es, wie sich dann, natürlich auch zumeinem Glück, herausgestellt hat, ein Erfolg wird. Das wusste ichzwischendurch nicht. Das weiß ich natürlich auch jetzt bei Witznicht. Aber zumindest bin ich die Langstrecke inzwischen gewohnt.Und das verändert tatsächlich das Übersetzen. Wenn Du eine ganzandere Geduld entwickeln musst, um ein solches Monstrum und umeinen solchen Ziegelstein zu bewältigen.Guido GrafErnestWichner hat vor einiger Zeit in Bezug auf seine Übersetzungenvon Mircea Cartarescu etwas ganz Ähnliches beschrieben. Er hat dar-auf vertraut, dass er einen ähnlichen Erfahrungshorizont hat wieCartarescu. Vom Alter her, auch in dem, was sie zur gleichen Zeit inihrer Jugend in Rumänienwahrgenommen haben.Ansonsten aber seier sehr blind in die Texte gegangen und hat etwa den letzten Roman,den er von Cartarescu übersetzt hat, nicht vorher gelesen, sonderneinfach angefangen. In Anbetracht dessen,was für ein komplexes Ge-bilde das darstellt, kommtmir das einigermaßen halsbrecherisch vor.Ulrich BlumenbachIch habe zwar sowohl Infinite Jest als auchWitz vor Beginn der Über-setzung angelesen, beide Bücher aber erst lange nach Beginn derÜbersetzung, Jahre danach wirklich zu Ende gelesen. Ich weiß nicht,wie esWichner geht, aber mir ging es mit beiden Autoren so, dass ichziemlich schnell festgestellt habe, dass sie an den Grenzen der Über-setzbarkeit sind, dass sie einfach wahnsinnig schwierig sind. Und esist nicht halsbrecherisch, wenn Du schon am Anfang weißt: Nochschlimmer als es jetzt ist, kann es nicht werden. Und zwar von denSchwierigkeiten her, die an Dich als Übersetzer gestellt werden. An-sonsten unterscheidet sich speziell bei Witz meine Überschneidungmit dem Erfahrungshorizont des Autors entscheidend von Wichnerund seinem Autor, weil es eben nicht so viele Gemeinsamkeiten gibt.Ich komme als deutscher Übersetzer aus einem protestantischen El-ternhaus und habe es hier mit einem eminent jüdischen Text zu tun.Jüdisch auf allen Ebenen, religionsgeschichtlich, alltagskulturell undnatürlich – und da kommt dann nicht nur christlich-jüdisch dazu,sondern auch deutsch-israelisch – der Holocaust. Da haben wir einenentscheidend anderen Zugang und eine Gadamersche Horizontver-schmelzung kann es da nicht geben. Ich bin ein Nachkomme des Tä-tervolks. Ich übersetze den Roman eines Nachkommen des Opfer-volks und ich bin heilfroh, dass Joshua Cohen und ich gut befreundetsind.
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
128 129
Guido GrafIst vielleicht dieses Herangehen, das nicht von einem umfassendenWissen ausgeht, indem ich z.B. das gesamte Werk eines Autors gele-sen habe, um mich dann in ein so komplexes, schwieriges Buch hin-einbegeben zu können, sondern, wie Du es beschrieben hast, amehesten mit der Lektüre vergleichbar, die wir generell mit Literaturanstellen? Dass wir einfach anfangen zu lesen und dann versuchen,uns einen Text zusammenzubuchstabieren. Ist das mit diesem Über-setzungsprozess vergleichbar?Ulrich BlumenbachJa, grundsätzlich natürlich. Wobei ich beim Übersetzen anders alsbeim bloßen Lesenmir natürlich die zusätzlichen Bildungshorizonte,die ich brauche, zum Übersetzen draufzu schaffenversuche. ExtremkomplexeWerke wie Infinite Jest oderWitz erfordern immerzu paral-lele Lektüren, parallele Recherchen und das nicht nur nach einzelnenWortbedeutungen, sondern ich muss mir wirklich ganze Wissensho-rizonte aneignen.Guido GrafDas wäre dann die potenzierte Lektüre, die da ansWerk geht.Ulrich BlumenbachJa, beim normalen Lesen schlage ichmanchmalWörter nach. Ich sitzeim Lesesessel und da kommt ein mir unbekanntesWort. Ich habe dasiPhone danebenliegen und schaue nach,was das eigentlich bedeutet,worauf der Autor an dieser Stelle gerade hinauswill. BeiWitz bleibt eseben nicht punktuell, sondern ich muss dann im Extremfall, etwa imEpilog des Romans mir wirklich eine Geschichte des Ghettos vonLodz draufschaffen, weil er einfach immer wieder Detailanspielun-gen einbaut, einflicht in sein Werk. Ich muss einen Stadtplan dane-benliegen haben und so weiter.Guido GrafDraufschaffen heißt, Du musst das nicht punktuell nachschlagen,sondern schon auch wirklich ganzeWissensgebiete erschließen.Ulrich BlumenbachBeides und beides parallel. Und das hat es mir auch so schwer ge-macht, bei einer einzelnen Anspielung, bei einer einzelnen Referenzschon den Kontext kennen zu müssen, um dann zu wissen,wo genauich nachschlagen muss. Der Extremfall war, wo ich anfangs gedachthabe, das wäre ein Satzfehler. Da taucht mitten in einer ohne Inter-punktion und als stream of consciousness geschriebenen Passage nur»IIc« auf. Da stand ich erst auf dem Schlauch. Ich habe es für einenSatzfehler gehalten, bis ich irgendwann gemerkt habe, Block IIc warin Auschwitz-Birkenau der Block, in dem die Ungarinnen unterge-
bracht waren, also ein Teil des Frauenlagers. Um zu wissen, wo ichnachgucken muss,was ein einfaches IIc heißen kann,muss ich schonwissen, in welchem Kontext ich mich befinde.Guido GrafDas ist ja für Leser:innen, die auf so ein Buch stoßen,weil sie sich fürliterarische Verarbeitungen des Holocaust interessieren, eigentlicheine ähnliche Erfahrung. Menschen, die zum Beispiel Imre Kertészgelesen oder Shoah von Claude Lanzmann gesehen haben, werdenmöglicherweise in ihrer Lektüre an bestimmten Stellen ihre gespei-cherten Resonanzräume abrufen können und müssen, weil sie sonstnicht weiterlesen können.Was geht einem da verloren?Ulrich BlumenbachDiese zusätzlichen Anspielungen. Und in dem Epilog kommt dasnicht zusätzlich, sondern das ist dasWesentliche.Undwenn ich nichtverstehe, dass Cohen bzw. seine Figur, sein vor sich hin monologisie-render Erzähler von einer historischen Epoche der Judenverfolgungzur anderen springt, dann verstehe ich ja überhaupt nicht, worauf erin genau dieser Passage hinauswill. Das heißt, das gesamte literari-sche Projekt geht dann anmir vorbei.Deswegen glaube ich,das ist einMüssen. Ich muss solche Kontexte des Buches beim Lesen aktualisie-ren.Guido GrafWir sprechen hier nicht über einen Roman, der lauter surplus bietet,Anspielungsreichtum oder dergleichen, sondern diese Komplexitäteigentlich zu seinem Konstruktions- oder Schreibprinzip macht. Duhast davon gesprochen, dass Cohen der Schwierigkeit des Erzählensvom Holocaust eine Entsprechung in der Form gibt, eine Entspre-chung in der Brüchigkeit der Sprache.Was ist damit gemeint?Ulrich BlumenbachErstmal einfach: Joshua Cohen erzählt eine Geschichte, aber erzähltsie nicht konventionell. Die Figuren werden nicht eindeutig, die Sze-nen wechseln sprungartig, die Chronologie geht wild durcheinanderund zwar nicht nur mit Vor- und Rücksprüngen, sondern auch Kreis-bewegungen mit Alternativerzählungen. Manche Passagen, habe ichden Eindruck, werden zweimal erzählt, aber dann mit verschiedenenSchwerpunktsetzungen. Es sind nicht einfach Wiederholungen. Essind aber auch nicht einfach Spiegelungen. Es sind auch nicht Rück-wärtserzählungen, sondern es sind parallele Erzählungen. Am ehes-ten kann man Vergleiche aus der Science-Fiction heranziehen, wo esParalleluniversen gibt.Auf der tatsächlichen Oberfläche der Prosa ge-hen seine Sätze manchmal nicht auf, fehlen tatsächlich einfach diePrädikate oder eswerden Listen über Seiten vorangeschrieben,wo die
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
130 131
Handlung gar nicht mehr weitergeht, sondern nur Details aufeinan-dergestapelt, aufeinandergehäuft werden. Die Referentialität ver-schwindet. Ich kann diese Schilderungen, diese Beschreibungen oftnicht mehr auf eine Welt zurückführen, die mir plastisch vor Augenstünde.Guido GrafIst das etwas,was Dich besonders reizt oder affiziert?Ulrich BlumenbachNein, ehrlich gesagt, ich mag es nicht besonders. Es frustriert michganz einfach beim Übersetzen, weil daraus ja keine schönen Sätzewerden. Als Übersetzer möchte ich aber eigentlich schön schreibenoder wenigstens gute oder präzise Sätze hinschreiben. Das kann ichhier nicht, das darf ich nicht. Das heißt, ich muss partiell gegen mei-nen eigenen Instinkt vorgehen, z.B. auch verständlich zu schreiben.Mein großes Vorbild beim Übersetzen ist wirklich immer Martin Lu-ther, der einfach versucht hat, die Sinngehalte, aber auch die lebens-weltlichen Gehalte seiner Texte, nämlich des Alten und des NeuenTestaments für die Menschen seiner Zeit, also des 16. Jahrhunderts,nachvollziehbar zu machen, das heißt gelegentlich auch kulturell zutransponieren in seineWelt.Also dieses berühmte: Man muss auf dieStraße gehen und den Leuten aufs Maul schauen. Er hat versucht, dieMetaphern zu übersetzen in die Bildwelten seiner Leser:innen. Dasmöchte ich auch. Das darf ich bei Joshua Cohen tendenziell nicht bisnie. Und so etwas geht mir gegen den Strich. Es sind eigentlich diebeiden Punkte: a: Ich muss Brüchigkeit reproduzieren. Ich darf keineKohärenz herstellen, keinen guten, flüssigen, stimmigen, plastischenText. Und b darf ich nicht Vertrautheit der Welt herstellen mit einer,die die Leser:innen der Übersetzung kennen werden.Guido GrafEin Beispiel, wo jemand mit ähnlichen literarischen Mitteln vorge-gangen ist, scheint mir The Tunnel vonWilliam H.Gass,was in weitenTeilen ja ein ebenso widerwärtiges wie schönes Buch ist. Manchmalfinde ich es schwer erträglich, diese Geschmacklosigkeiten, die Gasspermanent produziert, um einen Menschen über Aufstieg und Falldes Dritten Reiches fantasieren zu lassen, aber eigentlich dessenschreckliche Kindheit und von Gewalt geprägte und von Alkohol ge-sättigte Kindheit, dessen Gewaltfantasien und masochistische Phan-tasien Sprache werden zu lassen. Dafür verwendet er lauter Kalauer,die oft sehr bewusst gegen die political correctness lanciert zu seinscheinen. Das alles aber macht er in einer musikalisch sehr geform-ten Sprache. Was macht Cohen ähnlich oder eben ganz anders alsGass?
Ulrich BlumenbachWas er ähnlich macht, ist die Musikalität seiner Sprache. Da habendie beiden ähnliche Verfahren oder Poetiken. Es ist eine musikalischeProsa, die zum lauten Lesen einlädt, die teilweise tatsächlich auchganz einfach unglaublich schön ist. Eine Szene, die ich zu gern auchals Vorabdruck gesehen hätte, wäre die Beschreibung des DrittenTempels in Manhattan. Mitten im Central Park wird der dritte Tem-pel erbaut und Cohen beschreibt den über Seiten. Seine Figur gehtdurch diesen Tempel und das sind ekstatische Schilderungen diesesTempels, die aus der frühen Kabbala kommen. Es gibt diese früheMerkaba-Mystik, die auch die himmlischen Thronwelten beschreibtund an die fühlte ich mich erinnert bei diesen Schilderungen desneuen Tempels. Gass und Cohen schreiben beide extrem satirischeTexte über den Holocaust. Das heißt, es sind Formen des nichteigent-lichen Sprechens. Natürlich darfst Du ihre Figuren bzw. ihre Erzäh-linstanzen, ihre Positionen,nicht für bareMünze nehmen,denn dannbist Du verloren. Dann hast Du beide Romane schlicht und einfachnicht verstanden. Es sind satirische Texte, die versuchen, den Holo-caust nicht zu bewältigen, sich aber demHolocaust wieder zu nähern,ohne nur ernst zu werden, plus ohne in Kitsch oder Besänftigungoder philosophische Einholungen des Holocaust, also Verständlich-machungen auszulaufen. Aber diese Satire läuft bei beiden auch ver-schieden. Es gibt bei Gass diese grauenhaften Holocaust-Limericks,die ich so unerträglich finde wie Du wahrscheinlich auch. Aber eineKomik gibt es auch bei Cohen. Wobei ich die palatabler finde. Ichkann sie eher goutieren oder annehmen. Es sperrt sich in mir nichtalles dagegen. Es ist eine kalte Komik. Es ist keine fröhliche, sonderneine bittere Komik. Aber es ist eben eine Verzerrung des Beschriebe-nen. Es ist ein satirischer Umgangmit demHolocaust.AmAnfang desRomans, das ist die Idee, die Ausgangssituation, kommen alle Judenauf Erden um. Am Anfang bleiben die Erstgeborenen übrig. Die ster-ben aber danach auch peu à peu weg. Wie es dazu kommt, wird garnicht erläutert. Ob das eine Seuche ist oder so,wird einfach nicht ge-sagt. Sie sterben einfach. Einer bleibt übrig. Und da wird dieser Ro-man auch magisch, phantastisch, denn Ben, der letzte Jude, kommtals erwachsener Mann mit Vollbart und Brille auf die Welt.Wie seineMutter das schafft,wird auch nicht erzählt.Das ist einfachmagischerRealismus.Nach demAussterben der Juden bildet sich eine weltweiteBewegung oder Religion, eine Art Neo-Judentum. Allerdings fällt imganzen Roman nicht ein einziges Mal das Wort Jude oder Judentumoder jüdisch. Kein einziges Mal. Das heißt, das ist alles schon meineübersetzerische oder interpretatorische Zutat. Aber dieses Neo-Ju-dentum breitet sich auf der ganzen Welt aus und erklärt Ben zum
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
132 133
Messias. Ben spielt eine Zeit lang mit und da setzt eben ein sehr ko-misches und auch wirklich genießbare Element der Satire ein. DennBen propagiert im Auftrag des Neo-Judentums das Judentum nachdenVerfahren des amerikanischen Showbusiness. Er tritt in Las Vegasauf und lässt sich dann als Messias feiern. Es gibt also inWitz komi-sche Passagen. Die nicht so bitterböse, nihilistisch, pessimistisch de-struktiv sind wie bei Gass. Daneben gibt es auch Kalauer, auf derkleinteiligen Prosaoberfläche. Da gleichen sich die beiden vielleichtauch. Cohen spielt einfach wahnsinnig viel mit diesem angelsächsi-schen Muster der Puns, also Doppelbedeutungen, die im Deutschenals Kalauer einen herzlich schlechten Ruf haben, die im angelsächsi-schen Raum aber ein sehr beliebtes Konversationsmuster sind. Mitdiesem Puns wird ein Großteil der Konversation im Pub gefüttert.Guido GrafDerWitz,wie das Buch hier im Original eben auch heißt,wie derWitzin Auschwitz ist da eher schwer erträglich. Das »-witz« dann noch zulassen, aber zeigt direkt darauf, was man vielleicht auch aushaltenmuss, wenn man sich überhaupt dem Holocaust nähert. Weil dieNähe genau dieses Unerträgliche, nicht allein mit Schweigen, son-dern mit Reden erzeugt wird. Und dann ist das ein Weg, um dieseNähe aushalten zu können.Ulrich BlumenbachEs ist ein Verfahren, um es auszuhalten, ohne den Holocaust zu ver-harmlosen oder zu nivellieren. Das ist natürlich das Wesentliche. Essoll eben keine closure stattfinden. Man soll am Ende des Romansnicht seinen Frieden mit dem Holocaust gemacht haben. Wie das –und das ist Cohens großerVorwurf – ein Großteil der amerikanischenHolocaust-Literatur noch der dritten Generation macht. Also eigent-lich auch schon eine Post-Holocaust-Literatur, in der am Ende einFrieden gemacht wird, man irgendwie diesen Zivilisationsbruch ein-gemeindet oder verstanden hat. Und dagegen sträubt er sich. Er siehtihn als Bruch und in der Brüchigkeit seiner Sprache, die nicht geheiltwerden kann, die nicht gekittet oder repariert werden kann, wie dieWelt nach dem Holocaust nicht wieder repariert werden kann. Daswill er ausstellen.Deswegenwehrt er sich auch so lauthals gegen eineBetroffenheitsreaktion. Claude Lanzmann, der Regisseur von Shoahhat nach Erscheinen von Spielbergs Schindlers Liste, der den Holo-caust sentimentalisierte, damals in der FAZ gesagt: »Ihr sollt nichtweinen«. Und Cohen setzt das gewissermaßen programmatisch um.Es darf nicht diese Betroffenheitsreaktionen im Umgang, im Versuchder Aufarbeitung oder Bearbeitung des Holocaust geben, indem wireinfach sagen: Oh mein Gott, wie furchtbar, dass da fünf MillionenMenschen gestorben sind, ermordet worden sind. Und so makaber es
erst einmal klingt: Eines seiner Verfahren ist eben die Komik. Okay,wir sollen nichtweinen,dann versuchenwir esmit Lachen.Es gibt einkleines Bändchen von Marie Luise Knott über Hannah Arendt, unddie beschreibt in einem kurzen Exkurs das Lachen als eine Art Atem-holen, um überhaupt wieder eine Reflexion zu ermöglichen, umwie-der einen Neuansatz zu finden. Ich glaube, das ist eine der Möglich-keiten, den Witz, die Komik in Cohens Roman Witz zu analysierenoder zu bewerten.Guido GrafDu hast in Deinem Essay zur Übersetzung ein Beispiel gebracht da-für, wie Du im Deutschen mit Verfremdungstechniken versuchst, et-was von dem,was Cohen macht,wiederzugeben und verweist darauf,dass Du Dich dann z.B. am Vorbild von Arno Schmidt orientierst,wasetwa orthographischeVerfremdungstechniken angeht.Das ist etwas,was mich gerade in Bezug auf Arno Schmidt schon immer beschäf-tigt, auch tendenziell immer etwas gestört hat: Ob eigentlich nichtdieser Glaube, dadurch, dass ich orthographisch etwas sichtbar ma-chen, so heillos naiv ist, weil die Annahme dahinter ist, etwas hand-habbar zu bekommen, damit es in seiner Mehrdeutigkeit fixiert wer-den kann.Ulrich BlumenbachEs gibt bei Cohen eine Beschreibung einer Straße am Central Park inManhattan, die vereist ist. Und Joshua schreibt das nicht, er sprengteinfach dieWortgrenzen auf. Er verschiebt dieWortgrenzen, die Leer-räume,die Spatienwerden anders verteilt als vomWort her gefordert.Und das habe ich nachgeahmt auch mit Grenzverschiebungen derWorte, aber eben wie Arno Schmidt mit orthographischen Verfrem-dungen.Guido GrafDu hast dann aus dem Asphaltieren das Präfix sozusagen weggelas-sen und von einem Faltieren der Teerrassen geschrieben. Mir geht eshier um die Differenz. Bei Arno Schmidt wird das aus seiner Autor-perspektive noch aufgeladen mit dem Versuch, das theoretisch zuunterfüttern. In seiner Schreibweise sieht er die Möglichkeit, ortho-graphisch etwas sichtbar zu machen, Mehrdeutigkeiten in ihrerGleichzeitigkeit transparent machen zu können. Ist das nicht irgend-wie eine sehr naive Vorgehensweise, also eher auch ein Versuch derVereindeutigung , der Materialisierung?Ulrich BlumenbachIch verstehe es anders als Du.Wir reden jetzt nicht mehr über Cohen,denn weder hat er solche Verschreibtechniken theoretisiert, noch wieArno Schmidt sexualisiert oder erotisiert.Wenn Schmidt der Eindeu-
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
134 135
tigkeit den Boden unter den Füßen wegzieht, weil er Mehrdeutigkei-ten produziert, dann fixiert er es doch gerade nicht.Guido GrafIn dem Moment, wo es graphisch wird, soll sich etwas materialisie-ren, und dadurch wird dieser Resonanzraumwieder abgedichtet.Ulrich BlumenbachDir wäre also lieber ein wirklicher Hallraum? Es wird etwas angedeu-tet, aber die zusätzlichen Bedeutungen, die sich ergeben werden vonDir im Leseprozess konnotiert, sie sind aber nicht auf der Buchseitedenotiert, sie sind nicht hingeschrieben. Dann ist das auf jeden Falletwas, was Cohens Schreibpraxis näherkommt. Diese Art der Fixie-rung, dass tatsächlich zwei Eindeutigkeiten dastehen, macht Cohennicht, sondern bei ihm werden Mehrdeutigkeiten, Echokammern,Anspielungen anders produziert.Guido GrafDa soll etwas fremd gemacht werden, um durch das Unvertraute aufMöglichkeiten und Bedeutung zu stoßen. Diese Fremdheitserfah-rung in der Lektüre und dann entsprechend auch im Übersetzungs-prozess scheint im Zentrum dessen zu stehen, was man als denkünstlerischen Impuls bei Cohen finden kann.Ulrich BlumenbachJa und das ist auch etwas, das einen Großteil der Arbeit ausmachte.Ich habe erst mal versucht, eine Art Skelett herzustellen oder eineRohübersetzung für mich, und dann die Abweichungen vom über-haupt Gemeinten, die das Eigentliche ausmachen, wiederherzustel-len. Also dann eben auch wieder von der Konvention abzuweichen,um den Romantext mit dem surplus aufzuladen, der bei Cohen mit-schwingt.Guido GrafIn Deinem Essay in der NZZ hast Du ein schönes Zitat von Hans Blu-menberg von 1966 gebracht. 1966, wir sind ein ganzes Stück in derVergangenheit und da ist der Blick auf avantgardistische Literaturund Moderne noch ein völlig anderer als ein halbes Jahrhundert spä-ter. Aber Blumenberg erwarte, schreibst Du, eine Literatursprache,»deren Metaphern sich gegenseitig stören und aufheben, in der dieangesetzten Bilder nicht aufgehen,die keine beruhigende Interpreta-tion ihrer Syntax zulässt, in der die Herkunftsorte mythischer An-spielungen ständig und ohne Hilfen wechseln.« Etwas, was Cohenund sicherlich auch noch ein paar andere einlösen,was aber vielleichtauch unsere medial gestählte eigene Praxis beschreibt?
Ulrich BlumenbachEs ist vielleicht kein Wunder, dass Joshua nach Witz, also seinemzweiten großen Post-Holocaust-Roman zunehmend überNetzphäno-mene geschrieben hat, über soziale Medien, über die Auseinanderset-zung vonMenschenmit derWelt, über Bildschirme,über digitaleMe-dien und so weiter,weil es vermutlich da schon angelegt ist, in dieserSchreibpraxis.Guido GrafAber was ist das für eine Sprache, wenn Metaphern sich gegenseitigstören und aufheben? Metaphern, die sich aufheben, wären dann jaeigentlich die Verkörperung der romantischen Idealsprache. DieSphäre, in die sich Anselmus in E.T.A.HoffmannsDer goldene Topf amEnde begibt, die nur noch fantastisch ist, wo es nicht mehr um dieDifferenz zwischen Realität und Phantasma geht, sondern die Ent-scheidung eigentlich gefallen ist.Ulrich BlumenbachCohen bewegt sich nur noch im Spiel der Signifikanten. Die Meta-phern sollen gar nichtmehr für etwas stehen, sondern es soll wirklichnur noch ein Spiel zwischen Bildwelten inszeniert werden, die nichtmehr aufgehen. Für jede einzelne Beschreibung, die er bringt, kannich Dir Beispiele nennen.Aber so einfach ist es eben doch nicht.Guido GrafWir haben also eine Sprache, die keine beruhigende Interpretationihrer Syntax mehr zulässt.Ulrich BlumenbachSätze, die nicht aufgehen, syntaktisch, grammatisch nicht aufgehen,stehen in einem fragmentarischen Kontext und folgen damit aucheinemmodernistischen Verfahren. Das ist ja nichts Neues, das habenJoyce und Pound oder Eliot auch schon gemacht.Guido GrafDie Herkunftsorte mythischer Anspielungen ständig und ohne Hil-fen wechseln: Was ist damit eigentlich gemeint?Ulrich BlumenbachDas ist vielleicht gar nicht so schwer. Cohen kann tatsächlich in ver-hältnismäßig kurzen Passagen von Kafkas Prag – Kafka taucht aufoder die Dohle, Kafkawirdmit V geschrieben – zu Spinoza in Amster-dam kommen. Beide waren Juden. Beide waren Juden in tendenziellantisemitischen Umfeldern, haben dort irgendwie zu überleben ver-sucht. Der eine hat Philosophie, der andere Literatur produziert undCohen überblendet sie.Wobei es natürlich nicht aufgehen kann.Oderanderes Beispiel: In Amsterdam werden dann Spinoza und AnneFrank übereinander geblendet. Sie haben zwar beide in sehr enger
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
136 137
Nachbarschaft, also im jüdischen Viertel gelebt, aber natürlich Jahr-hunderte auseinander. Auch Anne Frank ist für uns eine mythischeFigur geworden in den letzten Jahrzehnten.Guido GrafEs geht also darum, die Gleichzeitigkeit aller möglichen Erzählungenaufzurufen.Ulrich BlumenbachJa, genau. Das macht er im extremsten, im abschließenden Monolog.einem 50 Seiten langen Monolog des im Sterben liegenden Au-schwitz-Überlebenden, der vor seinem geistigen Auge die Geschichteder Judenverfolgungen Revue passieren lässt, aber eben nie chronolo-gisch, sondern er kann in einem Satz von den Kreuzzügen über dieAufklärungszeit zum Holocaust, zum polnischen Antisemitismus,zumNachkriegsantisemitismus springen.Die Orte verschwinden im-merzu. Du bist einerseits in Köln-Deutz, wo die rheinischen Judensich sammeln mussten, um deportiert zu werden, dann wird derBahnhof aber plötzlich überblendet und räumlich in eins gelegt mitden Vernichtungslagern in Polen. Und dann bist Du plötzlich wiederauf der anderen Seite des Ozeans, in Amerika.Guido GrafEin solches Schreiben,wie Cohen es praktiziert, verfolgt ja die Strate-gie einer Überwältigung.Ulrich BlumenbachJa, eine Überwältigungs-, eine Überforderungstrategie und das ganzbewusst. Was einen hübschen Begleiteffekt hat, jetzt rein anekdo-tisch ergänzt: Ich habe ihn irgendwann mal zu einer Stelle gefragt –er ist zum Glück ein wahnsinnig hilfsbereiter Autor, der alle meineFragen mit einer Lammsgeduld beantwortet hat – ich habe ihn ge-fragt, ich hätte ein, zwei, drei Bedeutungen rausgekriegt, aber denEindruck, das wäre noch immer nicht alles. Er sagte, ja, stimmt, dawären noch zwei weitere Bedeutungen drin. Und dann meinte er: Naja, an der Stelle habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Da kannich als Übersetzer fast nur noch kapitulieren, wenn ich wirklich ver-suchen soll, in einem Satz fünf verschiedene Sinnhorizonte unterzu-bringen. Ichmuss dann eben auch kompensieren oder zu kompensie-ren versuchen. Aber er war sich dessen bewusst. Er wollte seine Lese-rinnen überfordern.Manchmal hat er gemerkt, dass er selbst für sei-ne eigenen Ansprüche zu weit gegangen ist.Guido GrafBist Du eigentlich gefordert, als Übersetzer diese Überwältigungs-und Überforderungsstrategien zu reproduzieren, sie abzumildern,
um sie besser vermitteln zu können oder sogar in Teilen auch noch inDeiner eigenen Sprache weiterzutreiben?Ulrich BlumenbachNicht weiterzutreiben. Da gilt wirklich dieses ganz alte Wirkungs-äquivalenz- bzw. Funktionsäquivalenzprinzip. Das heißt, ich bin ge-fordert, den Text wieder genauso schwierig zu machen,wie er im Ori-ginal ist. Nicht abzumildern, damit Leser:innen ihn besser verstehenkönnen, aber auch nicht zu verschärfen.Die Leser:innen der Überset-zung müssen denselben Eindruck dieses Werks vermittelt bekom-men wie die Leser:innen des Originals.Guido GrafKennst Du Übersetzungen in andere Sprachen vonWitz?Ulrich BlumenbachNein, es könnte die erste sein. Ein perfiderWitz ist, dass eben ein Ho-locaust-Roman als erstes in die Sprache der Nachkommen der Täterübersetzt wird. Andere Werke von Cohen werden rege übersetzt. ImFranzösischen und im Spanischen gibt es einige seiner Bücher, aberdie deutsche Übersetzung vonWitz könnte die erste sein.Guido GrafIch kenne sonst nur das Buch der Zahlen und auch Auftrag für die Mo-ving KingsDie hatten verschiedene Übersetzer.Denkst Du, das machtsich bemerkbar in dem Bild,was man dann von Cohen bekommt?Ulrich BlumenbachJa, es macht sich wohl bemerkbar. Das Buch der Zahlen ist von RobinDetje übersetzt worden, den ich bewundere. Die Bücher von JoshuaCohen sind so verschieden, dass man Schwierigkeiten hätte, da eineeinheitliche Autorstimme wiederzufinden. Insofern schadet es beidiesem Autor weniger als bei anderen Autor:innen, wenn er von ver-schiedenen Leuten übersetzt wird.Guido GrafMit denMoving Kingshatte ich große Schwierigkeiten,das überhauptzu Ende zu lesen,weil ich es auch gegenüber dem Buch der Zahlen alsein bisschen enttäuschend gefunden habe.Ulrich BlumenbachImVergleich zum Buch der Zahlen ist es das natürlich auch.Das ist einganz anderes Projekt. Er wollte sich wirklich mit israelischer Gegen-wart beschäftigen. Es geht um diese israelischen Soldaten nach demEnde ihrer Militärzeit, auch wenn sie dann in den USA sind.Guido GrafWitz ist nochmal deutlich älter, jetzt schon zehn Jahre alt. Hast DuDich mit der Rezeption vonWitz in den USA befasst?
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
138 139
Ulrich BlumenbachSoweit ich Rezensionen finden konnte, ja. Es hat nicht viele gegeben.Einige grundlegende große Rezensionsessays, aber nicht viele, ange-sichts der meiner Meinung nach Bedeutung und Substanz diesesWerks. Es ist auch hauptsächlich in der jüdischen Community derVereinigten Staaten rezipiert worden und ich habe bisher noch über-haupt nichts an akademischen Reaktionen gesehen. Die Literatur-wissenschaft scheut entweder vor ihm zurück oder hat ihn nochnicht entdeckt.Guido GrafDen Eindruck hatte ich auch. Es gibt weder in Sammelbänden nochin Zeitschriften irgendwelche Aufsätze. Ist das Bedürfnis auch in derLiteraturwissenschaft da, sich eher beruhigen zu lassen?Ulrich BlumenbachEigentlich nicht. Die Literaturwissenschaft, wie ich sie wahrnehme,stürzt sich eigentlich gerne auf komplizierte Bücher, weil sie einfachviel Stoff zur Analyse bieten. Das sind ja dankbare Objekte. Warumdas hier nicht der Fall ist? Das kann ich nicht beantworten. In derdeutschen Literaturlandschaft wird Witz ja ein Fremdkörper sein,weil wir keine kontinuierliche und organisch sich entwickelt haben-de jüdische Literatur und Beschäftigungmit jüdischer Literaturmehrhaben.Natürlich habenwir jüdische Autor:innen enmasse.Trotzdemist das was anderes. In den USAhat Joshua Cohen seinen Roman auchfür eine jüdische Community geschrieben.Die gibt es in Deutschlandso nicht oder sie ist sehr viel kleiner und nicht so organisiert. Insoferngibt es eine ganz andere Rezeptionssituation.Wobei ich es auch span-nend fände, zu gucken,was es in der deutschsprachigen Literatur ei-gentlich fürWerke gibt, die auch nur annähernd mit ähnlichen Stra-tegien verfahrenwürden? Es gibt einen einzigen, der in Deinenwie inmeinen Kosmos gehört, nämlich Hans Wollschläger. In diesem klei-nen Text aus dem zweiten nicht fertig gewordenen Band der Herzge-wächse.Was er da ähnlichmacht, ist nur über dasWortmaterial plötz-lich die Gaskammern zu assoziieren. Bei Joshua Cohen tauchen aufeiner Seite die Worte Haarescheren, Duschen und süßlicher Geruchauf. Und bei Wollschläger gibt es eine Passage, wo mit denselbenReizwörtern gearbeitet wird. Es wird nicht benannt. Es geht schein-bar um etwas ganz anderes, aber die Reizworte sind dieselben und ichwar völlig verdattert, als ich das gelesen habe. Das ist eine ganz ähn-liche Technik. Es gibt Autoren, in die ich nicht mal reingeschnupperthabe, wie Oswald Egger oder Michael Lentz. Die suchen ähnlich überreferenzielle Prosa hinauszugehen, haben aber einen ganz anderenund weit theoretischeren Ansatz, habe ich den Eindruck.
Guido GrafOswald Eggerwäre sicherlich ein Beispiel. UndWollschläger finde ichabsolut nachvollziehbar. Da könnte man vermutlich noch weiter ge-hen. Die Herzgewächse arbeiten häufig mit mit solchen Techniken,wenn auch noch mit anderem thematischen Fokus. Bei Egger ist essystematisch schwer, das überhaupt einzugrenzen. Aber man be-kommt eine Ahnung davon, wie er mit Wortagglomerationen han-tiert. Die Lektüre der Essays von Uljana Wolf bringt mich auf einschmales Buch von Ilse Aichinger. Es heißt Schlechte Wörter. Da sindviele eigenartige Vokabeln drin, die Ilse Aichinger in Sätze zusam-menbaut, die auch in der Auseinandersetzung imwahrsten Sinne desWortes mit dem Holocaust stehen, sehrminiaturistisch, sie packt dassehr klein und knapp.Aber diese Form der Verdichtung und Verfrem-dung in eins könnte man da auch finden. Aber man muss suchennach solchen Verfahren. Und das ist auch das, was mich im Rahmendieser Vorlesung beschäftigt. Du hast auf die Bücher verwiesen, ge-gen die Cohen sich abgrenzt, die versuchen zu beruhigen, abzuschlie-ßen, etwas rund zu machen oder zu sentimentalisieren, Strategienalso, die eben nicht öffnen. Dem gegenüber scheint es mir wichtig,eine literarische Strategie dagegen zu finden, eine Theorie der Öff-nung möglicherweise auch wiederzufinden.
Wasimmerwitz Wasimmerwitz
Anmerkungen
Joshua Cohen: Witz. Roman. Übersetzt von UlrichBlumenbach. Frankfurt: Schöffling, 2022.
HansWollschläger: Herzgewächse oder Der Fall Adams.Göttingen: Wallstein, 2011.
140 141
kommen sehenGespräch mit Anja Utler
In diesem Gespräch mit Anja Utler geht es vor allem um ihre Dich-tung kommen sehen. lobgesang, im September 2020 in der WienerEdition Korrespondenzen erschienen.Anja Utler, geboren 1973, ist Sla-wistin, Anglistin und ausgebildet in Sprecherziehung. Sie arbeitet alsDichterin, Essayistin und Übersetzerin. Sie wurde mit einer Arbeit zuGeschlechterfragen in der russischen Lyrik der Moderne promoviertund lebt heute in Leipzig. Anja Utler war Thomas-Kling-Poetik-Do-zentin an der Universität Bonn, Gast-Professorin für Sprachkunst ander Angewandten in Wien und unterrichtete als Writer in Residenceam Oberlin College, Ohio. Es geht in kommen sehen um eine lyrischeAnalyse der Passivität und Gleichgültigkeit angesichts der Klimakri-se, deren bedrohliche Konsequenzen sich längst überall auf der Weltzeigen. Eine alte Frau versucht ihrer Tochter zu erklären, wie sich diephysische Welt, aber auch die Existenz der Menschen verändert ha-ben. Was war vor der Katastrophe? Und wie kann immer noch nichtsprachlich auf das Geschehene geantwortet werden? Aus Alltag undWissenschaft Politik, aus Mythologien wird ein großes Gedicht kom-poniert und rhythmisiert. Wenn Anja Utler ihre Dichtung nicht liest,sondern aufführt, spricht sie sitzend auf einem Stuhl und klopft. DerStuhl kommt mit ins Spiel.
Anja UtlerDas Stehen ist zu einfach. Beim Stehen signalisiere ich dem Körper:Ich kann jetzt auch gleich wiederweggehen. Ich kann aber nicht weg-gehen. Stehen ist einfach. Sitzen ist schwieriger, es hat aber auch et-was mit dem Buch zu tun. Es wiederholt gewissermaßen die Situati-on in dem Buch, wo diese Frau bei ihrer Tochter ist und ihr etwas er-zählen möchte. Da sitzt sie auch auf einem Stuhl. Da steht sie auchnicht herum, sondern sitzt.Guido GrafUnd wenn man auf dem Stuhl sitzt, bewegt man sich anders. DerRaum, den man zum Atmen hat und zum Sprechen hat, ist ein ande-rer als im Stehen. Setzt sich das auch in dieser Dichtung fort?
142 143
Anja UtlerDer Raum, den man zum Atmen hat, ist ein geringerer. Das ist einwichtiger Punkt. Es entsteht eine Art von Gedrängtheit des Atmens,die sich auch motivisch im Text wiederfindet, weil diese Frau etwassagenmöchte,was sie eigentlich nicht sagenwill und schon daher eingewisser Druck sich aufbaut in ihr. Auch vom Bewegungsmuster herist es so, dass man von diesem Stuhl eigentlich am liebsten aufsprin-genmöchte, und ich habe auf der Bühne eine gesteigerte Bewegungs-energie.Das ist ja das Problem des Lampenfiebers, dass ich eigentlicheine Bewegungsenergie habe, die ich nicht ablassen kann, die ichdann in den Sprechprozess legenmuss.Dann pflanzt die sich auf demStuhl in die Körperlichkeit fort und produziert auch Bewegungen,eben so wie sie auf diesem Stuhl möglich sind. Es ist dann ein sehrunruhiges Sitzen auf diesem Stuhl, und man weiß, man kann abervon diesen Stuhl nicht weg. Das ist ein Echo aus der Gesamtanlagedes Buches. Man kann nicht weg: Das ist eine Art Leitmotiv, das sichdurchzieht, nämlich die Frage: Was passiert denn, wenn sich unsereGrundkonzeption des Denkens, die sich immer noch daraus speist,dass es ein Innen gibt und ein Außen, als falsch herausstellt? Daschwingen diese Ideen mit, man könne auswandern, man könne ir-gendwo anders hin, man könne vielleicht sogar einen Planeten B be-siedeln, man könne irgendwie weg. Und was passiert, wenn tatsäch-lich diese Erde auch in unserem Kopf und in unserem Bewusstsein soklein wird,wie sie ist und sich herausstellt, es gibt kein Außen, es gibtnur ein Innen, aus dem wir nicht weg können? Das ist eine Motivik,die sich durchzieht durch das Buch, eine Fragestellung, die dann inder Performance umgesetzt wird in eine körperliche Tatsache.Guido GrafIst das auch dieserWeltinnenraum von Rilke?Anja UtlerIch glaube nicht, dass man da mit Rilke weiterkommt. Es geht umganz andere Sachen. Wir konzeptualisieren uns ja in Innen und Au-ßen.Wir müssen das ja auch. Der Körper hat eine Grenze, aber sie istdurchlässig und das zieht sich durch unsere ganze Kulturgeschichte.Man kann immer irgendwo anders hin. Man kann wandern oder eskommt von draußen etwas anderes rein. Meine Frage zielt darauf,wenn dieses Innen absolut wird und man nicht mehr weg kann, weildas Problem, egal wo man hin gehen könnte, überall gleich ist.Guido GrafDiesen Prozess, diesesWechselspiel von Innen undAußen, das Du be-schreibst,würde ich auch als Erkenntnisprozess verstehen.
Anja UtlerJa, definitiv.Guido GrafEin Prozess, der – und das gilt vermutlich für alle anderen Bücherauch, die Du geschrieben hast, schon antizipiert ist. Kannst Du dasbeschreiben,wie dieser Schreibprozess und dieser Auflösungsprozesseigentlich zusammengehen?Anja UtlerDas ist schwer zu sagen,wie die zusammen gehen. Ich habe eigentlichimmer beim Schreiben eine akustische Vorstellung und ich habe eineGesprächssituation im Kopf und muss dann sehen, dass ich auf derBühne diese Sprechsituation umsetzen kann, dass ich mir eine ge-naue Vorstellung davonmache,wie es auf der Bühne aussieht. Das istaber etwas, was nicht im Nachhinein kommt, sondern was den gan-zen Prozess des Arbeitens schon begleitet. Das Niederschreiben, dasAufschreiben ist der Versuch, etwas so aufzuschreiben, dass sich vonder performativen Qualität, die es auf der Bühne hat, auch noch et-was auf eine andere Art und Weise erschließt. Für die Person, die vordem Text sitzt und den Text liest, so dass da auch eine performativeStruktur des Selberlesens entsteht, in der sich Teile dieser Perfor-manz auf der Bühne, wie ich es dann mache, wiederfinden oder wosich Richtungen eröffnen, und die Leute diesen Text bei sich im Kopfaufführen,wenn sie lesen.Guido GrafWenn ich kommen sehen lese und dann auch höre,wie Du diesen Textsprichst, ist das Hören eineVerstärkung dieses Leseprozesses.Du hastbeschrieben, wie Du das aufführst.Wenn ich den Text sehe und lese,wird dieser Rhythmus vorbereitet. Es handelt sich um einen Lobge-sang, der eine Formtradition in der Dichtung hat, die weit zurück-liegt, im 20. und im 21. Jahrhundert nicht verbreitet, sondern aus demBarock kommt und dann noch bis Hölderlin ragt, aber kaum eigent-lich darüber hinaus, zumindest in der deutschsprachigen Dichtung.Wir haben nun einen Text, der hauptsächlich aus Zweizeilern besteht,aus fünf- und sechshebigen Distichen. Und wenn ich richtig gezählthabe, sind es meistens 14 Silben.Anja UtlerEs sind immer höchstens 14 Silben. Der Text darf darunter bleiben,aber nicht drüber hinausgehen.Guido GrafUnd es gibt in diesen Zeilen immer Unterbrechungen, Lücken. Wasmachen diese Lücken?
kommen sehen kommen sehen
144 145
Anja UtlerDas ist die große Frage. Warum kann das nicht – der Verlag hat dasauch gefragt – auch ohne die Lücken stehen? Ich habe das probiert.Es ist ja nicht immer gesagt, dass das,was im Schreibprozess passiert,tatsächlich das ist,was am Ende die gültige Form ist. Ich habe es aus-probiert und es geht nicht ohne die Lücken. Also machen die Lückenirgendetwas. Ich glaube, die Lücken haben die Aufgabe, den Atem zutakten. Sie signalisieren etwas von diesem Sitzen auf dem Stuhl, woderAtem sich drängt. Es gibt hier als sich durchziehendeMotivik eineProblematik des Anknüpfens an bestehende sprachliche Erklärungs-modelle der Welt und an bestehende Bewegungsmuster, sich durchdie Welt hindurch zu bewegen und sich zu entwickeln. Das ist davondas sprachliche Echo. Es gibt diese Lücken, wir müssen sie überbrü-cken. Aber das geschieht nicht dadurch, dass wir sie schließen, son-dern versuchen, durch sie hindurch anzuknüpfen. Man hat die Pau-sen, die Entsprechung zur Motivik und man hat durch diese Lückeneine gewisse Brüchigkeit, die das Lesen verlangsamt und auch irri-tiert, die Leserin und den Leser auch fordert, in einem positiven Sinn:Nämlich Möglichkeiten der eigenen Interaktion mit dem Text zu öff-nen und zu sagen: Schaumal her, da steht nicht alles da, sondern die-ser Text braucht auch dich, als Leserin, als Leser mit deinen eigenenGedanken und mit deiner eigenen Interaktionsbereitschaft mit die-sem Text.Guido GrafEs ist ja ein doppelter Prozess.Diese Lücken sind imRaum, so dass ichhineingehen kann. Gleichzeitig kann ich aber auch hindurchfallen.Anja UtlerMan kann hindurch fallen. Und sie geben Raum. Aber sie haben unddas würde ich auch anerkennen, natürlich auch etwas Bedrängende.Denn ich muss mich zu diesen Lücken in Beziehung setzen, ob ichwill oder nicht. Es ist nicht allein eine angenehme Form des Raumge-bens, sondern auch eine, die nahe tritt.Guido GrafWas haben diese Lücken mit der Figur zu tun, die da spricht? Eine ge-alterte Frau, die zu ihrer Tochter spricht, erzählt.Was spielt das dafüreine Rolle?Anja UtlerDas spielt eine doppelte Rolle oder sogar eine dreifache. Einerseits istes tatsächlich die Frage: Wie kann ich denn sagen, was ich zu sagenhabe?WelcheWörter finde ich,die diese Lücken produzieren?Weil ichimmerwieder nachdenken und neu ansetzenmuss.Andererseits sinddiese Lücken auch etwas,was diese Rede selbst durchzieht. Sie sagt ja
nicht alles. ImVerlauf des Buches wird es dann stärker und klarer. Siewill etwas ganz Bestimmtes sagen und am Ende sagt sie es dannauch.Aber es ist schwierig für sie, dorthin zu kommen.Und ich hoffe,dass in diesem von Lücken durchsetzten Text deutlich wird, dass siemit dem, was sie sagt, tatsächlich nur an dem kratzt, was sie eigent-lich übermitteln möchte. Sehr viele Lücken bleiben einfach.Das Drit-te ist das Abschneiden. Das Buch schildert eine Situation, in der tat-sächlich die Welt sich radikal verändert hat, in der es schwierig ge-worden ist, anzuknüpfen an dieMuster, die man ererbt hat.Diese Lü-cke, die entstanden ist zwischen der Vergangenheit und der Gegen-wart, in der die Frau sich befindet, setzt sich grafisch um. Sie findetsich in einer Zukunft, wo sie nicht mehr anknüpfen kann an die Ver-gangenheit undwirklich etwas abgeschnitten ist.Das ist eine Situati-on,die Gesellschaften erleben und die ich nicht in die Zukunft verlegthabe als etwas,was dort passieren kann, aber noch nie passiert ist, alssei das ein Schreckgespenst. Sondern ich glaube tatsächlich, dass dasdurchaus passiert in Gesellschaften und dass es gerade in der deut-schen auch schon passiert ist.Guido GrafKann man sagen, dass sie auch aus einer Zukunft heraus spricht, umdie Vergangenheit vielleicht sogar zu ändern?Anja UtlerIch glaube nicht, dass sie darauf hinspricht, um die Vergangenheit zuändern. Ihr geht es darum, die Zukunft zu ändern und zu sagen: Nurwenn wir die Spuren, das Imaginäre, das wir von dieser Vergangen-heit ererbt haben, aufgreifen und in die Zukunft hineinschreiben,wird es eine Zukunft geben, in der sich das Vergangene in einer ad-äquaten Weise noch fortschreibt und damit erst eine Art von Dauerund Fortsetzung, von Wiederolung, aber auch Nicht-Wiederholungsichergestellt wird.Guido GrafMich hat das oft an eine Perspektive erinnert, die manmit dem FuturII umschreibt.Anja UtlerGenau.Wenn man das heute liest, ist es eine Futur II Perspektive zusagen,daswird passiert sein.Es heißt ja auch: »kommen sehen«.Abernatürlich nicht in dem Sinne, das wird passiert sein, sondern: daskönnte passiert sein. Ich greife also verschiedene Fäden auf und pro-jiziere die in die Zukunft. Verrückte Erklärungsmodelle, von denenich dachte, das geht zuweit.Nach diesem letzten Jahrmuss ich sagen,nein, das ist genau so verrückt. Totalitäre Tendenzen, ein großer, un-aufhaltsamer technischer Fortschritt, eine Neigung, Probleme nicht
kommen sehen kommen sehen
146 147
dort zu lösen, wo sie sind, sondern sie einfach auf irgendeine Men-schengruppe abzuwälzen und sie dann vermeintlich zu lösen, indemman diese Menschengruppe attackiert. Das alles zusammengenom-men und in die Zukunft projiziert: das könnte passiert sein und allesunter diesem umfassenden Schild, dass sich das Klima so verändert,dass es hier sehr ungemütlich wird.Guido GrafDieses »Wie wird es gewesen sein«, diese Frage, steckt da permanentdrin undman kann das,wie Du es jetzt getan hast,modellhaft reflek-tieren. Es gibt immer wieder ein »sagt« in dem Gedicht. Die Überlie-ferung, die dieses »sagt« macht, heißt: »Schließlich platzt in der Er-innerung, in die sich breit und langsam die Brücke kringelt, wie siesich verwandelt hat in das Ding fester Unmöglichkeit, das niemandmehr transferieren würde«. Überlieferung und Erinnerung: Ist dieseArt von Überlieferung mit diesen Projektionen, die Du machst, über-haupt möglich?Anja UtlerEs ist ein Versuch darzustellen, was sowieso die Überlieferung aus-zeichnet, dass es immer diese diese Indirektheit gibt, dass ich immerdarauf angewiesen bin, was jemand sagt oder schreibt. Es wird wei-tergegeben durch diese unendlichen Brechungen. Ich habe nichts un-ter Kontrolle.Was macht mein eigenes Gehirn damit? Es verändert esdann nochmal. Also dieses dauernde »sagt« ist ein Verweis darauf,dass es diese unendlichen Brechungsmuster gibt in der Überliefe-rung.Aber auch, dass ich darauf angewiesen bin, dass mir jemand et-was sagt. Was ich in diesem Buch versuche hoch zu halten, ist tat-sächlich die innerfamiliäre Überlieferung. Das braucht man, dieseZeugenschaft innerhalb des Nahfelds, dass einer Person vermitteltwird: Das ist vorher geschehen, bevor du da warst, oder: das ist in derZeit geschehen, als du noch klein warst.Das ist insofern erheblich, alses wichtig ist, dass weitergegeben wird, wie etwas war. Wie war dasfür uns, die da durchgelebt haben? Damit es möglich wird, sich dazuin Beziehung zu setzen. Nicht nur zu den Ereignissen, sondern auchzu den Personen und ihrem Verhalten, wie sie durch diese Zeit ge-steuert sind oder versucht haben zu steuern. Das andere ist, dass die-se Rede natürlich eine Fiktion ist. Vor allen Dingen auf der Bühne istmirwichtig, dass es diese Brechungen gibt und dass nicht ich als Per-son mit dieser Figur verschmelze, sondern dass da eine Indirektheitzum Ausdruck kommt. Und in diesem Buch kollabiert immer wiederdas Außen und man hat dieses Innen, das aber dann ein Außen er-möglicht, und zwar für mich als Autorin, ein Außen, von dem aus ichauf diese Figur schauen kann,mit der ich nicht verschmelze.Auch fürdie Zuhörerinwird ein Außen ermöglicht, das immerwieder dieMög-
lichkeit gibt zu sagen: Wir sind jetzt nicht nur in einem Strom, deruns mitnimmt, sondern es gibt diese Inseln, auf denen wir stehenkönnen und sagen können: Das sagt die, aber das sagt die nicht wirk-lich zu mir, sondern wir sind in einer Situation, die sich jemand aus-gedacht hat und die wir modellhaft betrachten.Guido GrafUnd indem ich das lese, indem ich das höre, vollziehe ich es nach daoder produziere es auch weiter?Anja UtlerDavonwürde ich immer ausgehen,dass Poesie stärker als die anderenGattungen die Gattung ist, in der ich etwas nachvollziehe.Mir gefälltdas Modell des Selbstgesprächs gut und zwar in einem antiken Sinn,nämlich dass ich etwas in der Sprache vorfinde und das ausprobierean mir und mich über diese Gedanken hinweg selber anspreche, umdie Interaktion und die Beziehung, die da möglich sind, auszumes-sen.Davon hängt Poesie ab und dadurch hat sie die Fähigkeit, stärkermit den imaginären Dimensionen, also mit dem,was etwas für michbedeutet, zu interagieren.Guido GrafWas für eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang für Dich Präsenz?Anja UtlerDiese indirektenMarker sind auch da,um die Präsenz ein bisschen zuzügeln. In der Bühnensituation ist Präsenz ganz einfach herzustellen.Man muss einfach nur da sein. Das, was das Wort Präsenz sagt. Manmuss da sein, dann ist man präsent, und zwar in demMoment,wo ichauf der Bühne dem Text begegne. Nicht, indem ich den Text verkör-pere, sondern indem ich ihm selber begegne, so wie auch die Zuhöre-rinnen diesem Text begegnen. Dann entsteht diese Form von Akut-heit und Präsenz. Und diese ganzen Marker, dieses »sagt« und diesesHeraustreten stehen eher für das Bedürfnis, die Präsenz zu zügeln, sieeinzuhegen und zu sagen: Es gibt noch dieses Außen im Text. Das istetwas, was ich auch dem poetischen Register oder der poetischenSprechweise zuschreiben würde. Sie operiert in der Präsenz, also mitder Gegenwart,mit dem,was da ist, und damit, die Dinge sich entfal-ten zu lassen in der Sprache.Die Zuhörer:innenwerden in diesen Ent-faltungsprozess mit hereingenommen, sodass sich die Präsenz in ih-nen selbst ereignet. Statt einen Standpunkt anzubieten, der wirklichnarrativ draußen ist und von dem aus man sich alles mit Sicherheits-abstand anschauen könnte.Guido GrafKönnte man sagen, wenn man das ausdehnt auf den Schreibprozess,dass es so etwas gibt wie eine innere und äußere Reflexivität in Bezug
kommen sehen kommen sehen
148 149
auf das Geschriebene, sodass wir zugleich innerhalb und außerhalbder Sprache sind? Dass Literatur oder literarische Praxis, das Schrei-ben immer auf sich selbst verweist, ist die immanente Reflexivitätdes Schreibens. Aber was heißt das in der Praxis auch der Rezeptionoder in diesem Prozess, den Du jetzt eben als Präsenz derAufführungbeschrieben hast? Wenn ich das weiter denke, auf den Schreib- undden Rezeptionsprozess, sindwir eigentlich immer im selbenMoment– und das ist vielleicht auch dieser Raum,den die Lücken imText auf-machen – innerhalb und außerhalb der Sprache.Daswas geschriebenist, birgt eine Reflexivität in sich, die aber gleichzeitig immer wiederveräußert wird und aufgenommen, nachvollzogen werden kann.Anja UtlerDa ist man bei Roman Jakobson und demKommunikationsmodell, indem er sechs Arten der Kommunikation aufstellt und eine ist die po-etische Kommunikation. Und da sagt er: Der poetische Text verweistauf sich selber zurück. Das wäre diese Reflexivität des Schreibprozes-ses, die Du genannt hast. Ich habe mich mit diesem Satz lange aus-einandergesetzt, weil ich ihn sowohl richtig als auch falsch finde.Man darf nicht vergessen, was in dieser Schleife des Auf-sich-selbst-zurück-Verweisens passiert. Der Text kann das nur, indem er einemanderenMedium begegnet, einemmenschlichenWesen, das ihn liestoder rezipiert. Das führt zu einer Schleife. Während der Text aufge-nommenwird und bevor er auf sich zurück verweisen kann,muss et-was passieren in der Rezeption.Die Person, diemit diesemText inter-agiert, stellt sich diese ganz einfache Frage: Was sagt mir das? Gibt esetwas in mir, dem dieser Text etwas sagt und das mit diesem Text inein Gespräch eintritt, in einen Aushandlungsprozess? Erst,wenn die-ser Aushandlungsprozess eine bestimmte Stufe erreicht hat, kannman sagen, was dieser Text mit mir macht, was er sagt. Von hier auskomme ich nicht weiter, weil ich das, was der Text mit mir macht,nicht paraphrasieren kann. Ich komme wieder auf das Gedicht zu-rück.Der Text sagt das,was da steht und das ist eine rezeptive Schlei-fe. Man darf diesen langen Weg, den der Text zurücklegt, wenn erdurch einen Menschen hindurchgeht, auf keinen Fall vergessen, weilman sonst in eine Leere, in einen automatischen Rückverweiskommt, der leer bleibt. Der Text ist nicht selbstreflexiv, sondern erbraucht den- oder diejenigen, die sich damit auseinandersetzen. Unddas nicht nur mit dem eigenen Kosmos, mit der eigenen Bubble imKopf, sondern mit dem,wie der Text diese Bubble aufsticht.Guido GrafWenn man Selbstreflexivität als potentiellen und leeren Loop be-greift oder das Potenzial von Dichtung, das überhaupt erst etwas er-öffnet, das einen Raum und eine Zeit schafft, als unbedingt Originä-
res verstehen muss, vermute ich, dass es eher darum geht, wie diesebeiden Prozesse Reflexivität undWerden zusammengehören.Anja UtlerIch weiß nicht, ob ich originär sagen würde. Es ist ja nicht neu. Es istja nicht etwas Unerhörtes, sondern es ist einfach nur spezifisch. Alsoich denke, dass die Dichtung dort, wo sie etwas ausrichten oder an-richten kann, genau ist und spezifisch in der Frage, wie und was undaus welcher Perspektive angesprochen wird. Dass diese beiden Dingezusammengehören, das sehe ich auch so. Du hast noch gefragt nachdem Schreibprozess. Der Schreibprozess ist etwas, was dauernd undzwar ununterbrochen diese Perspektive des Außen braucht. Kannsich der Text tatsächlich öffnen auf eine Rezipient:in hin? Oder ist erin sich selbst verkapselt? Das ist ein Loop, der mitlaufen muss, dennsonst kommt man ja nirgendwo hin.Guido GrafWenn Du jetzt nochmal zurück schaust. Da ist jetzt ein neues Buch,das vor kurzem erschienen ist, aber es handelt sich ja um ein Projekt,an dem Du lange gearbeitet hast. Kannst Du von dem Entstehungs-prozess dieser Dichtung kommen sehen etwas erzählen?Anja UtlerDer Entstehungsprozess liegt auch für mich bis zum gewissen Gradim Dunkeln. Ich hatte da offenbar so einen Dampfkochtopf auf derPlatte, bei dem irgendwann das Ventil aufgegangen ist. Es geht umdie Erhitzung derWelt undmirwar schon sehr lang klar, dass ich dar-über was machen will. 1992, in dem Jahr, als ich Abitur gemacht habe,ist mir das als Thema erstmals begegnet. Seither ist einiges passiert,aber so viel dann auch wieder nicht, außer, dass der Prozess fort-schreitet. Es warmir immer klar, dass ich dazu etwas machenwill, ichwusste nur nicht genauwie.Das hat einfach sehr lange gedauert. 2017lag das plötzlich eines Tages klar vor mir. Nicht der Text, aber dieGrundanlage. Wie kann man das ansprechen? Wie kann ich das auf-spießen? Wer spricht? Was für eine Motivation zu sprechen hat dieseStimme? Und was ist passiert? Dann habe ich ihn halt geschriebenund bin verzweifelt gegen Wände gerannt, wo man nicht weiter-kommt und dann irgendwann eben doch die Tapetentür findet,durchdie man gehen kann.Guido GrafDas bezieht Jahrzehnte der eigenen Lebensspanne mit ein. Im Jahr2020 hat der Durchschnitt der zugelassenen Autos 139 PS gehabt.Gleichzeitig ist der Flugverkehr auf ein Niveau zurückgegangen, dasdem von 1985 entspricht. Das Jahr, in dem ich Abitur gemacht habe.In der Zwischenzeit ist also eine Menge passiert. Das haben auch wir
kommen sehen kommen sehen
150 151
angerichtet, alle zusammen.Wenn ich darüber und über die Auswir-kungen und das, was da noch kommt,was wir zumindest ahnen,waswir kommen sehen, – wenn ich darüber schreiben will, muss ich dasmit einbeziehen. Lauter Sedimente, lauter Sprachen, Sätze, die mir inErinnerung kommen oder die ich höre oder die ich selbst sagen will.Anja UtlerSedimente: Genau das hätte ich auch gesagt. Ich brauche diese Sedi-mente.Aber sie haben natürlich nicht mehr die exakte Gestalt, die sieheute haben.Wenn ich diesen Sedimentierungsprozess ernst nehme,sind diese Dinge immer schon verformt, sind schon dem Druck aus-gesetzt gewesen, einer Temperatur und haben sich dadurch verän-dert. Da findet immer auch ein Prozess des Extrapolierens statt. Umzu sagen: Wie sieht es denn im Moment aus und wie kann es dannaussehen, wenn es noch weiter sedimentiert? Das ist das Abarbeiteneiner Schicht, die sich im Durchleben der letzten Jahrzehnte aufge-baut hat. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten mit dem Klimawan-del. Es ist genau diese jahrzehntelange Beschäftigung, dass die Sa-chen schon abgehangen sind und schon mit dem ganzen Körper re-agiert und sich eingeschrieben haben in das gesamte körperliche Be-wusstsein und in die Wahrnehmungsroutinen. Damit habe ich gear-beitet und nicht mit einer aktuellen Information, die es gestern an-gespült hättte und die mit hoher Wahrscheinlichkeit einer Informa-tion von vor 15 Jahren sehr stark ähnelt.Guido GrafDas heißt, ich muss, wenn ich darüber nachdenke und das in einenSchreib- und Sprechprozess einspeise, meinen Körper mitschreiben,mit dem ganzen Alterungsprozess, die da etwa mit einhergehen.Anja UtlerMan muss immer mit dem Körper schreiben, so und so. Es gibt jaauch kein Außerhalb des Körpers.Guido GrafIn einem Essay aus dem Band Von den Knochen der Sanftheit zitierstDu William Wordsworths »The world is too much with us«. Du hastin diesem Essay auch gefragt, wie man das eigentlich übersetzt. Viel-leicht liegt die Betonung gerade nicht auf »the world«, sondern auf»with us«. Etwas später sagt Wordsworth: »Little we see in Naturethat is ours«. Es geht um dieses »Wir« oder dieses »Uns«, oder?Anja UtlerEs geht schon auch um»theworld«, ohne diewir ja nichts sehen.Undzu »Little we see in Nature that is ours« würde der Anthropozän-Dis-kurs sagen:Wir sehen in derNatur nur noch,was unser ist.Das glaubeich eben nicht. Wir sehen in der Natur nach wie vor ganz wenig, was
unser ist. Ganz viel verstehen wir nicht, das allermeiste eigentlich.Sehr viel könnenwir überhaupt nicht nachvollziehen.Die Kommuni-kationsprozesse, die ökologischen Zusammenhänge: Wir haben ganzwenig begriffen.Wir haben nur begriffen,wie wir es uns nutzbarma-chen. Wir machen es uns nutzbar und deshalb ist es alles uns. Aberwas ist das eigentlich für ein »us«, das so eine eigenartige Perspekti-ve einnimmt? Wie geht es diesem »uns«, wenn dann tatsächlich ein– wovon die Klimaforschung immer spricht – Kipppunkt kommt, andem die Dinge so umschlagen, dass wir uns gar nicht mehr kennen,dasswir dieses »uns« nichtmehr kennen,weil es mit derWelt,wie siedann plötzlich da ist, nicht mehr in adäquater Form interagierenkann, weil die Selbstständigkeit der Welt über uns wie eine großeWelle zusammengeschlagen ist.Guido GrafIst dann also dieses »For this, for everything, we are out of tune / Itmoves us not« -Anja UtlerJa, »It moves us not«.Wir haben über die Sedimente gesprochen unddieses »It moves us not« ist etwas, womit ich mich schon die ganzeZeit beschäftige, seit ich angefangen habe zu schreiben. Es bewegtuns nicht. Es ist eine unfassbar bewegteWelt undwir bewegen uns inihr und sie bewegt uns auch, rein faktisch und physisch, aber »It mo-ves us not«. Es bewegt uns nicht. Das ist einer der Punkte, warum esauch Lobgesang heißt. Bei mir ist das eine gewisse Fassungslosigkeit.Schaut euch das doch an, Leute, bewegt euch das denn nicht? Ist daseuer Ernst? Das kann ja wohl nicht wahr sein.Guido GrafDasmüsste ja dann unmittelbar Konsequenzen haben undman kannsie ja durchaus beobachten. Es gibt soziale Kontexte, in denen es auchanders läuft.Wahrscheinlich eben zu marginal, als dass sie irgendwierelevant wären. Aber Haltung dazu ändern, damit wir bewegt werdenund damit wir uns bewegen,wäre ja gemeinschaftlich konstruktiv zuagieren, kooperativ zu sein und zwar in einem reparierenden Sinn, alseine Kritik, die nicht etwas zerschneidet, sondern die versucht zu re-parieren, vorzubereiten, zu unterstützen.Anja UtlerDann bin ich als Autorin an einer ganz interessanten Abzweigung,nämlich an der Frage: Was schreibe ich denn eigentlich? Schreibe icheine Utopie oder schreibe ich etwas,was ich geschrieben habe, für dasich den Begriff Dystopie nicht verwenden würde, worauf man ihnaber anwenden könnte? Warum mache ich das eine und warum dasandere? Das ist keine leicht zu beantwortende Frage. Ich habe sie of-
kommen sehen kommen sehen
152 153
fensichtlich für mich beantwortet. Wenn man mit dem Begriff desökologischen Imaginären arbeitet, wie ihn der Literaturwissen-schaftler undAnglist Hubert Zapf immerwieder anführt, der sagt, dasökologische Imaginäre, unsere Verknüpftheit, unsere Abhängigkeitvon der materiellen Welt sei eigentlich eine Art Tabu. Das werdekaum thematisiert. Und daraus ziehe ich den Schluss, dass es wichtigist, dieses ökologische Imaginäre zu bearbeiten, und zwar durchausin der Art und Weise, dass man die ganzen Ängste, die damit ver-knüpft sind, die ganze Bedrängtheit, nimmt und sie aus dieser trau-matischen Landschaft heraus bearbeitet. Traumatisch in dem Sinne,dass es dafür nicht genug Sprache gibt. Das Trauma besteht darin,dass es die Sprache übersteigt und in ihr keinen Ort findet. Ich ver-such es in die Sprache einzuästeln, um es betrachtbar zu machen,denkbar, um der Wahrnehmung mit einem sprachlichen Respons zubegegnen und um zu verstehen. Das ist dann die Arbeit mit dem In-dividuum. Das greift in die individuelle Denkbewegung, um dannwiederum so etwas, wie Du sagst, das Kollaborative et cetera über-haupt erst möglich zu machen, weil das auf einer anderen Ebenestattfindet.Guido GrafEinästeln ist dafür ein wunderbares Wort. Kannst Du sagen, wie Dujetzt weiter einästelst,woran Du imMoment oder als nächstes arbei-test?Anja UtlerIch kann es noch gar nicht sagen. Ich arbeite seit 2015 an einem ande-ren Projekt, das heißt »Aus der Welt«. Das ist eine dem literarischenMarkt entzogene Tätigkeit. Ich schreibe kleine Triptychen, Porträtsfiktiver Figuren, die in Schicksalsmustern gefangen sind, aber dannauf eine sehr idiosynkratischen Art und Weise Widerstand leisten.Das sind Auseinandersetzungen mit Mustern, die es bei mir anspült,mit denen ich aber eigentlich als Individuum nichts zu tun habe. Fürdieses Projekt publiziere ich diese kleinen Texte nur in Zeitschriftenund verpacke sie für Lesungen in Tütchen aus Transparentpapier undverschenke sie ans Publikum. Das eignet sich nicht dazu, es in einkonsumierbares Produkt zu verwandeln. Das ist ein Langzeitprojektund an demwerde ich zunächst weiterarbeiten.
kommen sehen kommen sehen
Anmerkungen
Anja Utler: münden – entzüngeln.Wien: EditionKorrespondenzen, 2004.
Anja Utler: brinnen. Buch und CD.Wien: EditionKorrespondenzen, 2006.
Anja Utler: jana, vermacht. Buch und CD.Wien: EditionKorrespondenzen, 2009.
Anja Utler: ausgeübt. Eine Kurskorrektur. Wien:Edition Korrespondenzen, 2011.
Anja Utler: Von den Knochen der Sanftheit.Wien:Edition Korrespondenzen, 2016.
Anja Utler: kommen sehen. Lobgesang.Wien: EditionKorrespondenzen, 2020.
Hubert Zapf: Literature as Cultural Ecology:Sustainable Texts. London: Bloomsbury, 2016.
154 155154 155
Am Rand der SätzeIm Gespräch mit Ulf Stolterfoht
Mit Ulf Stolterfoht geht es um primäre Theorien, um Gedichte, diesich auf sich selbst beziehen.Wie kann ein Gedicht aufhören.Was istSchreiben, das Spaß macht, und was realistische Dichtung? Es gehtum Oskar Pastiors Sätze und darüber, wie sprachliche Strukturen dieWelt verändern können, um Freiheit, J. Dilla und Zombies. Unnatürli-che Nachtigallen, Goethes schlechtestes Gedicht und Hilfestellungenspielen ebenso eine Rolle wie die Theorien, die wir nicht mehr benöti-gen. Ulf Stolterfoht wurde 1963 in Stuttgart geboren. Nach dem Abiturmachte er Zivildienst, Forstarbeit mit Obdachlosen. Danach folgte einStudium der Germanistik und Allgemeinen Sprachwissenschaft inBochum und Tübingen. Seit 1994 lebt er in Berlin, seit 2000 als freierSchriftsteller und Übersetzer, unter anderem von Gertrude Stein, J. H.Prynne und Tom Raworth. Er ist Lyriklehrer an den Instituten inWien, Biel, Kopenhagen und immer mal wieder in Leipzig. 2009 hatteer die Poetikdozentur an der Universität Hildesheim inne. Ulf Stolter-foht ist Knappe der Lyriknappschaft Schöneberg und seit 1982 Teil desImpro-Kollektivs Das Weibchen. Im Herbst 2014 nahm sein Verlagbrueterich press die Tätigkeit auf: »Schwierige Lyrik zu einem sehrhohen Preis« lautete das Motto.
Guido GrafTheorien lese ich oft so, dass sie ohne Verbindung stehen zu dem,wasihr Gegenstand oder ihr Anlass war und ich mich dann an der Perfor-mance dieser Theorie erfreue, ohne dass ich mit dem Vorhaben oderdemWunsch herangehe, das alles verstehen zu müssen.Ulf StolterfohtJa klar, und es gibt ja auch genug Fälle, wo ich gar nicht in der Lagewäre zu trennen, ob ich einen poetologischen Text vor mir habe odereinen »primären« oder »künstlerischen« Text. Bei Oswald Egger z.B.kann man jeden Text als poetologischen Text lesen. Bei Oskar Pastiorvielleicht auch, und bei Inger Christensen gibt es Texte, wo ich nichtsagen könnte, ob das Theorie oder Praxis ist. Das sind die Extremfälleund bei den anderen Fällen ist es so, wie Du sagst, dass gar nicht so
156 157
ganz klar ist, ob man die auf das Werk der betreffenden Person über-haupt anwenden muss.Guido GrafEs ja auch eine merkwürdige Vorstellung, dass man Theorien anwen-den muss.Ulf StolterfohtTheoretische Texte, die aus der Sprachphilosophie kommen, sind vielpraktikabler als echte poetologische Texte. Da könnte ein Hinweisdarauf liegen, dass es eine Trennung gibt zwischen der Poetologieund dem primären Schreiben.Aber das finde ich auch schon komischzu sagen: primäres Schreiben. Da stimmt auch schon was nicht. The-oretische Texte aus anderen Bereichen, die dann aber keine Metatex-te sind, sondern der eigentliche Text, also etwa einWittgenstein-Text,den ich als poetologisch lese, sind primäre Texte und keine erklären-den Texte. Der wird dann auch wichtiger als irgendwelche Poetikvor-lesungen.Guido GrafIch fand es sehr lehrreich, in einem Forschungsprojekt, an dem ichdrei Jahre lang mit Wirtschaftsinformatiker:innen, Bildungsfor-scher:innen und Computerlinguist:innen zusammengearbeitet habe,andere Methoden kennenzulernen.Wir haben versucht,mit Massen-daten Online-Rezensionen und Veränderungen z.B. im Sprachge-brauch zu untersuchen, etwa einen wissenschaftlichen Sprachge-brauch, der von Theoriebildung spricht.Wir müssen versuchen, nichtetwas zu verstehen, sondern wir versuchen Theoriebildung. Da wirdklar, dass wir uns scheinbar sehr weit auseinander bewegen in unse-rer Idee davon, was Theorien sind. In der Computerlinguistik oderüberhaupt in der Linguistik haben Theorien einen viel niedrigerenHorizont und stellen eher Hilfsmittel dar, wie Probiersteine, mit de-nen man irgendein Modell baut, das man dann falsifiziert oder auchbestätigt,was aber nicht darauf ausgelegt ist, eine Schule oder ähnli-ches zu gründen. Du hast früh angefangen, Dich mit Sprachtheorienzu beschäftigen, auch in Deinem Linguistikstudium, aber auch inDeiner dichterischen Praxis. Ist das ein ähnliches Interesse?Ulf StolterfohtMoment, wenn ich das richtig verstehe, hat das einen fast normati-ven Charakter, den Ihr festgestellt habt, oder?Guido GrafIm Gegenteil.Wir haben zum Beispiel gefragt, was eigentlich Rezen-sionen, die online stattfinden, sind und haben dann festgestellt, dassder Begriff der Rezension, wie er von Literaturwissenschaftlern ge-braucht wird, nicht sonderlich viel taugt. Also haben wir stattdessen
von rezensiven Texten gesprochen. Ein Neologismus, der erst mal nurversucht, Eigenschaften, die man bei Rezensionen finden kann, aufTexte anzuwenden, die sich darin aber nicht erschöpfen, sondern im-mer noch auch etwas anderes sind.Ulf StolterfohtDa wäre Euer Verfahren für mich das Interessante und nicht die Re-zension, die Ihr auswertet, sondern das,was Ihr damit anstellt.Guido GrafGenau darum geht es. Theoriebildung heißt dann,Modelle zu entwi-ckeln,mit denen ich diese Texte untersuchen kann.Ulf StolterfohtDie Rezension, die Ihr untersucht habt, die ja so etwas wie ein Meta-text ist, ändert bei Euch ihren Status und Ihr macht sie zum Primär-text. Das lässt sich ganz gut übertragen, wenn man das Gedicht, dasja eigentlich auch primär funktionieren sollte, dazu benutzt, Unter-suchungen anzustellen, die sich auf das Gedicht selbst richten. BeimGedicht würde ich es im gleichen Text machen und ihr seid aufgefor-dert, noch einen weiteren Text hinzuzufügen. Ihr könnt ja nicht denUrsprungstext bearbeiten. Aber da sehe ich schon eine Ähnlichkeit,wennman permanent dabei ist, den Status von Texten zu ändern, daseine zum anderen zu machen und wieder zurück.Guido GrafGibt es für Gedichte auch so ein Iterationsverfahren? Was Du sagst,würde ja so eine Feedbackschleife erzeugen. Wenn ich das Gedichtauf sich selber anwende, um es zu seinem eigenen Metatext zu ma-chen, erfahre ich dann, wie es gemacht ist? Wie prozessiert es sichselbst?Wie setzt sich dieses Verfahren fort?Werde ichwieder zurück-geworfen und muss dann einen neuen Anlauf nehmen? Oder verän-dert sich dadurch auch das Schreiben von Gedichten?Ulf StolterfohtIch glaube, das verändert sich tatsächlich.Mir geht es eigentlich dar-um, immer wieder zu fragen: Was soll das eigentlich sein, was ich damache? Also alles infrage zu stellen,was Leute von Gedichten norma-lerweise erwarten. Und immer wieder sich zu überlegen, und zwarwirklich im Gedicht selbst: Was mach ich denn da eigentlich, wennich Gedichte schreibe und welche Erwartungen will ich erfüllen undwelche will ich nicht erfüllen? Welche Erwartungen werden an michherangetragen und welchen möchte ich entsprechen? Am liebstenwürde ich sagen, ich will dem überhaupt nicht entsprechen. Aber esgibt ja durchaus Sachen, die ich sinnvoll finde und doch erfüllen will.Aber viele finde ich auch schrecklich und dann ist es ein ganz geeig-netes Verfahren, um sich und anderen klarzumachen, dass Gedichte
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
158 159
auch etwas anderes sein können als das, was man gemeinhin als Ge-dicht versteht oder unter dem Begriff Gedicht.Guido GrafKannst Du ein Beispiel für solche Erwartungen nennen?Ulf StolterfohtIch habe z.B. von Anfang an und immer noch Probleme mit dem letz-ten Vers, weil ich denke, da muss irgendwie nochmal was kommen.Man kann das Gedicht nicht einfach auslaufen lassen.Man kann daszwar machen, aber vielleicht auch nur einmal pro Gedichtband. Einwenig löst sich das Problem dadurch, dass ich die Einzelgedichtenicht mehr als einzelne Gedichte empfinde, sondern als Teil einesfortlaufenden Textes. Aber trotzdem hört die Seite auf und bei mirhört auf der Seite in der Regel auch das Gedicht auf. Ich habe mittler-weile gemerkt, dass es auf rhythmische Sachen ankommt, um das lö-sen zu können. Man braucht keine Pointe und keinen Knalleffekt,sondern man muss es rhythmisch lösen. Ich finde es eigentlich nichtgut, dass das Gedicht vonmir verlangt, dass ich es beendenmuss undsehe aber die Notwendigkeit und versuche also, die auch zum Themazumachen.Kannst Du Dich erinnern, dass Dumir immerTipps gege-ben hast,wenn ich die gelesen habe,wie ich betonen soll? Da habe ichauch einiges gelernt und ich hab gemerkt, dass letzte Zeilen gutfunktionieren, und zwar völlig egal, was man da inhaltlich bringt,wenn man die möglichst als Staccato-Zeile hat,wo jede Silbe eine Be-tonung hat, dann lösen sich viele Probleme von allein.
»Gedichte zeigen wenig Neigung, sich von allein zu bilden. Lyri-ker sagen, sie weisen diese Neigung nur geringmaßig auf. Esbraucht sanften Zwang. Hier Tipps aus dem Gestaltzusammen-hang. Die geometrische Anordnung der Teilchen im Gedichtheißt Gitter. Sind Teilchen geladen,heißen sie Seme.Deren Gitternennen wir Struktur. Anziehende und abstoßende Kräfte haltendie Seme in strukturellem Wasser. Starke Bindung führt häufigzum Bündel. Kompakt gebundene Bündel heißen Begriff. Begrif-fe sind ungerichtet. Wörter sind loser geschnürt und wirkengleichmäßig nach allen Seiten. Metrische Berechnungen habenergeben, dass noch zwischen gebundensten Bündeln Platz ist füreine Art zitternde Lexikbewegung rund um die tatsächliche Ru-helage.Die Zahl 6 gibt an,wie viele Nachbarschaften ein Sem ein-gehen kann. Andere Sätze haben eine andere Struktur. Bei kom-plexen, mächtigen Lexemen wächst die Zahl direkter Nachbarnsehr schnell an. Das Wissen um den Bau lyrischer Gitter ermög-licht es, den Begriff Satz folgendermaßen zu definieren: FesteSätze bilden eng vergitterte Texte.Diese Setzung gilt auch für un-geläufige Struktur. Erst in Schmelze werden sie beweglich und
können Inhalte transportieren. Strukturenergie nennen wir dieEnergie, die aufgewendet werden muss, um ein Wort in eineEmotion zu überführen. Die Überführungsbilanz sollte im Ab-gleich ausgeglichen sein. Zur Probe kürztmanThema durch Lem-ma. Bitte kein Rest.«
Guido GrafDas ist ein wunderbares Beispiel, finde ich. Ich habe mehrere Rezen-sionen neulich gelesen zu dem Band von Marcel Beyer Dämonen-räumdienst und auch ein Kritikergespräch im Radio dazu gehört. Ichwar überrascht,wie schnell sich Leute, die immerwieder betonen,wiesehr sie das schätzen, was er da macht, darauf geeinigt haben, dassdas doch auch etwas Erwartbares, ein langweiliges Verfahren sei,wasviel mit Pointen arbeiten würde. Ich hab mir das daraufhin nochmalangesehen. Vielleicht habe ich etwas übersehen. Vielleicht bin ich zuverliebt in dieserArt von Dichtung, dass mir das gar nicht aufgefallenwäre.Aber mir scheint, das wird nur auf das Ende hin gelesen und siebemerken nicht genug, dass es nicht um Pointen geht, sondern dassdas im besten Falle, wenn es gelingt, immer Klammern sind, die auf-gemacht werden, und dass viel wichtiger ist, wie diese Klammerntransportiert werden, nicht über Schlüsselwörter, sondern wie Dusagst, über Rhythmen oder Klammern. Das sind Bilder, die angerei-chert werden, Lautlichkeiten, die über einen ganzen Text hinweg ge-tragen werden. Marcel Beyer arbeitet häufig mit bestimmten Konso-nantenkonstellationen oder Vokallautlichkeiten, die über einen gan-zen Text hin gestreut sind und damit einen Zusammenhalt bieten.Ulf StolterfohtIch habe das Gespräch gehört und fand es ebenfalls ein wenig unbe-friedigend. Da wurde auf Popkultur abgehoben, die immer wiederdurchkäme und einen Widerspruch formuliere zwischen hohem Tonund Pokémon.Das stimmt ja alles überhaupt nicht.Wennman das soeinfach trennen könnte, wäre es schön. Tatsächlich geht es ineinan-der über. Ich glaube auch, dass gerade bei Marcel das Rhythmischegenau beides hat. Die deutsche Klassik und die Jamaika-Tradition,um das Offensichtlichste zu sagen. Da kommt man wirklich inSchwierigkeiten,wennman das auseinanderklamüsern will,was wel-che Rolle spielt. So einfach ist das alles nicht.Dadurch, dass sie gesagthaben, die Gedichte seien durchschaubar und relativ einfach kon-struiert, haben sie es sich einfach gemacht. Man muss da genauerhinsehen. Etwa die Tatsache, dass es immer zehn Vierzeiler sind. Zukonstatieren, dass das beim dritten Gedicht nicht mehr überra-schend sei, ist banal. Es kommt ja darauf an, was man damit macht.Diese gewählte Form hat Marcel sehr geholfen,weil sie absolut offenist. Das ist nur irgendeine Festlegung.
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
160 161
Guido GrafHast Du solche Reaktionen in Bezug auf die fachsprachen auch ge-habt, weil Du immer das Gleiche machen würdest und Dich wieder-holst?Ulf StolterfohtKomischerweise nicht, obwohl das durchaus gerechtfertigt wäre. Ichdenke immer, beim nächsten Band passiert das, aber dann geht esdoch noch mal gut.Guido GrafBeim zweiten Band hieß es, es kommt jetzt noch einer. Du wusstestvermutlich selbst nicht, wie weit Du das treiben willst, als Du damitangefangen hast.Aber es hat sich ja schon einiges verändert im Laufeder Zeit.Ulf StolterfohtKlar. Vielleicht habe ich es ein bisschen auch selbst gedacht, dass esvorbei ist und alles ausgereizt. Aber dann ist mit dem vierten Bandnochmal etwas Neues passiert. Ich schreibe gerade den Siebten unddas wird nochmal anders. Dass sich etwas wiederholt, lässt sich auchnicht ganz vermeiden. Neun Bände werden reichen. Das kriege ichhin.Also wenn der Körper mitmacht.Guido GrafWie würdest Du denn die Veränderungen beschreiben, die sich imLaufe der Zeit vollzogen haben? holzrauch über heslach dazwischenwar schon ein Einschnitt, oder?Ulf StolterfohtJa, das war der entscheidende Einschnitt. Ich habe mir früher so vielverboten. Das Narrative z.B. wäre früher undenkbar gewesen. Ichhabe gedacht, die experimentelle Literatur muss das Narrative soweit wie möglich draußen halten, das darf überhaupt nicht vorkom-men. Und andere Dogmata mehr. Das betrifft auch das Ich und nochein paar andere Sachen. Auch den Reim. In den ersten Bänden derfachsprachen sind noch nicht so viele Reime vorgekommen. Ich habezunehmend gemerkt, dass es mir auf das Schreiben selbst ankommt.Je älter ich werde, ist es mir umso egaler,was aus den Gedichtenwird.Ich gehe nach wie vor jeden Tag ins Café Jonas zum Schreiben. Mor-gens um 11,wenn die aufmachen. Dann möchte ich mich ja 6, 7 Stun-den mit etwas beschäftigen, was mir Spaß macht. Wenn ich mir soviel verbiete, dann macht es mir irgendwann keinen Spaß mehr. Ichwill das ja noch ein paar Jahre machen. Dann wäre ich bescheuert,wenn ichmir Sachen, die ich bei anderen gut finde undwo ichmerke,dasmacht beim Schreiben auch Spaß,verbietenwürde.Vor allem die-ses »Als-ob«-Theater macht ja nochmal ein ganz neues Feld auf. Der
nächste Schritt ist wahrscheinlich, dass das »Als ob« tatsächlich zu»realistischen« Gedichten führt. Da ich nicht weiß, was ein realisti-sches Gedicht ist, ist es vielleicht auch ganz interessant.Vielleicht so-was wie die späten Gedichte von Ernst Jandl,wo er nur noch über sei-nen Körper schreibt.Guido GrafDas würde niemand glauben, wenn Du realistische Gedichteschreibst.Ulf StolterfohtKennst Du realistische Gedichte?Guido GrafIch fürchte nicht. Und wenn, habe ich sie schnell vergessen.Ulf StolterfohtDiese Jandl-Gedichte, wo er über den verfallenden Körper schreibtund über die durchaus noch vorhandene sexuelle Energie, sind so et-was. Und – wir haben auch darüber schon mal gesprochen – auch diespäten Gedichte von Heißenbüttel gehen ja in die Richtung. Das istzumindest am nächsten dran an dem, was ich mir unter realistischvorstellen kann. Eine schonungslose Selbstoffenbarung im Gedicht.Ob das erstrebenswert ist, ist tatsächlich eine andere Frage. Aber dasist der andere Pol,wennman ganz ehrlich über sich selbst im Gedichtschreibt.Guido GrafIch würde behaupten, dass solche Gedichte immer eine unglaublichdestruktive Kraft haben.Ulf StolterfohtJa, das glaube ich auch. Man denkt immer, das wäre was Heilendes.Aber ich glaube auch, das sind zerstörerische Gedichte. Deshalb sindsie überhaupt möglich. Sonst hätte Jandl sowas gar nicht machenkönnen. Wenn das therapeutisch gewesen wäre, hätte er die sichernicht geschrieben.Guido GrafIch habe neulich relativ späte Texte von Robert Creeley gelesen.Ulf StolterfohtJa, genau. Das ist z.B. auch so etwas.Guido GrafIch habe versucht, etwas davon zu übersetzen und fand das außeror-dentlich deprimierend,was er da geschrieben hat.Ulf StolterfohtCreeley ist ein sehr gutes Beispiel.
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
162 163
Guido GrafIch habe nach diesen Veränderungen auch gefragt, weil ich mich mitden Poetikvorlesungen, die Du in Heidelberg gehalten hast, beschäf-tigt habe. Wir haben ja schon mal über Sätze gesprochen, über DeinInteresse an Sätzen. Dieses wunderbare Gedicht von Oskar Pastior,das Du am Ende Deiner Vorlesung zitierst: Am Rande denkst du stelltdie Frage noch einmal, was eigentlich ein Satz ist, wie sich eine Ant-wort darauf möglicherweise in Bezug auf das literarische Schreibenverändert hat. Die Sätze, die uns denken, die wir denken und diesesDenken eigentlich immer so ein Denken vom Rande her ist, stellenetwas dar, was ich spannend finde, aus dem ich aber genauso wenigschlau werde.Ulf StolterfohtWenn ichmich richtig erinnere an unserGespräch,habe ichmich vondem damaligen Stand gar nicht so weit entfernt. Ich habe damals ge-sagt, und daswürde ich heute auch noch sagen, dass das,was mich anSätzen interessiert oder was für mich Sätze ausmacht, eher das ist,was strukturell vermittelt wird, als das, was semantisch passiert. Ge-sellschaftliche Verhältnisse schlagen sich eher in Syntaxstrukturennieder oder werden deutlicher, als wenn ich sage, ich stehe für dieFrauenquote oder ich möchte, dass die Krankenpfleger anständig be-zahlt werden oder dergleichen. Ich will das nicht gegeneinander aus-spielen, nur interessiert mich dieses Strukturelle einfach mehr. Ichglaube natürlich,dass es auf einerDemowichtig ist, dassman formu-liert,warumman jetzt hier ist. Das will ich überhaupt nicht diskredi-tieren. Das halte ich sogar für sehrwichtig.Wenn man aber mit Spra-che arbeitet, sind die Strukturen doch wichtiger als das, was die of-fensichtliche Botschaft sein könnte oder seinmüsste. Ich habe immergedacht, am Ende von solchen strukturellen Untersuchungen oderVersuchen müsste so etwas wie eine Erkenntnis stehen. Das glaubeich überhaupt nicht mehr. Ich glaube, dass man sich immer nur imKreis dreht, aber eher weiß, was man mit Sprache anstellt und be-wirkt. Aus diesem Kreislauf kommt man nicht so leicht heraus,wennüberhaupt. Früher habe ich gedacht, man muss nur die Struktur bisin die Mikrostruktur hinein erfassen, untersuchen und analysieren.Dann ändert sich auchwas.Aber da bin ichmir überhaupt nichtmehrsicher. Ich glaube eher nicht, dass sich da was ändert. Da ändert sichdurch eine Demo wahrscheinlich doch mehr. Also Demo im Sinnevon semantisch verwertbarer oder in anderer Form in Anspruch ge-nommener Sprache. Früher hätte ich gesagt, die Gesellschaftsstruk-turen lassen sich vielleicht wirklich nur durch veränderte Sprach-strukturen sprengen. Das glaube ich nicht mehr. Ich halte es für sehrunwahrscheinlich.
Guido GrafDie Mikrostrukturen oder das Sich-im-Kreis-drehen sind gegenläufi-gen Bewegungen, die uns sofort Probleme bereiten, wenn wir versu-chen, diesen essentiellen Gedanken von Pastior ernst zu nehmen.»Am Rande denkst du, denkst du Sätze, die dich denken? Du denkst,sie denken dich. In deinen Sätzen bist du an ihrem Rand.Du bist eineAnrandung von Sätzen, die dich an den Rand stoßen, Gegensätzen,doch an denenwandelst du entlang.« Das ist jawie eine Karambolageund man läuft durch oder kann sich nicht wieder zurückschießen insSpiel. Aber diese Karambolage lässt uns nicht unverändert zurück.Auch ein einzigesWort kann ein Satz sein. Das sprengt das Nachden-ken über Sprache,was mit Sprache möglich ist,weil diese Strukturen,wie Du sagst, so wichtig sind.Aber es gibt keine Satzung für die Sätze.Es gibt keinen verlässlichen Bau. Diese Vorstellung von Subjekt, Prä-dikat, Objekt, die Linearität vermittelt, hat mit der Realität nichts zutun.Ulf StolterfohtIn den Philosophischen Untersuchungen zeigtWittgenstein genau mitdiesem Beispiel, mit Bauarbeitern, die sich nur zurufen »Hammer«und »Schaufel« usw., dass das vollständige syntaktische Sätze sind,indem er den Satz baut, der eigentlich in demWort Hammer vermie-den oder abgekürzt wird. Ich finde nicht, dass aufgrund solcher Ein-wortsätze oder noch kleinerer Einheiten wie Ausrufe der Überra-schung das Modell kaputt geht. Struktur gibt es immer, auch inkleinsten Einheiten.Guido GrafDie Strukturen sind nicht immer die gleichen.Ulf StolterfohtNein, natürlich nicht.Guido GrafMir scheint, dass der Sprachgebrauch, der sich nicht an Kodifikatio-nen orientiert, der sich nicht für einen bestimmten Zweck festlegenmuss, aber prinzipiell darunter leidet, einer Vorstellung entsprechenzu müssen, dass Sätze einen Zweck, eine Funktion haben und linearverlaufen. Ein wenig so wie bei den Pointen: sie müssen, im Sinne derVollständigkeit, auf etwas zulaufen, richtig im Sinne von folgerichtig.Tatsächlich wirken diese Strukturen, in dem, wie wir reden, aber wiewir auch Texte lesen, ganz anders, nämlich mit dieser Gegenläufig-keit.Wir lesen und springen immer wieder vor und zurück.Ulf StolterfohtDas steht ja auch in dem Pastior Gedicht – es gibt einerseits die Be-schränkung dadurch, dassman sich nur in den Grenzen äußern kann,
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
164 165
die die Sprache bietet, dass, wie Pastior sagt, die Sprache spricht undnicht jemand. Einfach weil sie festlegt, was sagbar und was nichtmehr sagbar ist, in einem ganz praktischen Sinn, ohne Metaphysik.Auf der anderen Seite ist die Struktur natürlich auch ein Angebot, ir-gendetwas damit anzustellen. Das ist ja nicht so starr,wie es manch-mal scheint. Ich glaube, auch innerhalb dieser durch die Spracheselbst gezogenen Grenzen gibt es große Freiheiten. Und die sollteman nutzen. Ich weiß nur nicht, zu welchem Ziel hin.Wenn Du sagst,wir lesen ja auch anders undwir sprechen anders, stimmt das. Ich lesegerade die neue Ponge-Übersetzung von Thomas Schestag, das Son-nen-Buch.Das ist so großartig und da scheint es manchmal so auf alsob – und das ist jetzt das Problem – ein Jenseits darin wäre oder, dassman aus der Sprache vielleicht doch herauskommt. Die Sprache bie-tet eventuell Möglichkeiten, von denen wir bisher noch gar keine Ah-nung hatten. Das klingt jetzt sehr bescheiden, aber wenn es nur dasgäbe, dann wäre das ja auch schon viel. Ich hoffe, dass es vielleichtsogar noch ein bisschen mehr ist, dass dieses Freiheitsgefühl aucheine politische Dimension hat.Guido GrafDas heißt dann erst einmal nichtsweiter, als dass es fürDichtung im-mer darum geht, die Möglichkeiten zu erweitern, Sätze zu bilden.Ulf StolterfohtDas ist auch so. Du hast da den Peter Waterhouse. In den ersten bei-den Waterhouse-Bänden, Menz und passim, sind Sätze, da habe ichdamals gedacht, jetzt fängt etwas ganz Neues an.Das denke ich heuteeigentlich immer noch, wenn ich das lese. Beglückung ist eigentlichdas falscheWort, aber es ist wirklich ein Gefühl von Freiheit.Als hätteman eine Unabhängigkeit im Denken erlangt, einfach dadurch, dassman in der Lage ist, solche Sätze zu lesen und irgendwie auch zu ver-stehen, was immer das sein soll. Wenn das Dichtung schafft, ist daswirklich was. Aber ich tue mich schwer, wenn ich dann definierenmüsste ich, was das z.B. für unser alltägliches Sprechen bedeutet, obsolche Erfahrung von Freiheit in irgendeiner Form gesellschaftlichnutzbar sein könnte. Vielleicht muss einem das auch egal sein. Aberich fände es schön,wenn es doch sowäre.DerWiderspruch bleibt. Ichwürde immer sagen, Dichtung muss von jedem Nützlichkeitsgedan-ken gelöst sein. Gedichte sollen nicht nützlich sein. Auf der anderenSeite erwarte ich aber doch, dass dieses Gefühl,was für Gedichte pro-duziert wird, mehr ist als nur die Äußerung von Euphorie, dass esdoch Konsequenzen hat für das, was ich im Leben mache und bin –und für andere natürlich auch. Aber vielleicht sollte man das nichtdenken.
Guido GrafAber dann sind diese Gedichte, wenn sie eine solche Wirkung haben,auch eine solche Karambolage. Sie prallen irgendwo gegen und abund lösen etwas aus, dessen Wirkung immer nur eine indirekte seinkann.Ulf StolterfohtNein, das glaube ich nicht.Das erste Pastior-Buch, das ichmir gekaufthabe, warWechselbalg. Da war ich 17 oder 18. Es muss um 1980 gewe-sen sein. Da könnte ich Dir heute zu jedem Satz zu sagen, was ich daempfunden habe. Es gibt einen Zusammenhang zwischen dem tat-sächlichen Vers und dem,was derVers auslöst. Nicht so wie bei einemKonzert, bei dem man dann hinterher sagt: Das war aber jetzt einschönes Erlebnis. Sondern da findet ein Prozess statt. Elke Erb will soetwas immer sagen. Das hat auch nichts mit Genauigkeit und Hand-werk zu tun. Das ist auch nichts Inhaltliches. Die Semantik spieltemit rein, aber das ist nur ein kleiner Teil von dem,was stattfindet.Guido GrafWir lernen Strukturen zu bauen,mitWörtern und Sätzen und Texten.Und jederText,den ich lese, bautmeineArt undWeise,wie ich danachmeine eigenen Sätze bilde, neu zusammen.Ulf StolterfohtJa, genau.Guido GrafJe konkreter das wird, je mehr ein Text in der Lage ist, diese Struktu-ren zu öffnen, desto notwendiger wird dann auch die Arbeit, die dar-auf folgt.Wirmüssenmit diesen Öffnungenwieder klarkommen.Ab-wehr ist das, was in der Regel am ehesten erfolgt. Ich will mich jetztin meiner Art zu lesen, zu denken und zu schreiben nicht beeinträch-tigen lassen. Der andere Weg wäre, so offen zu sein dafür, dass mansich permanent in alle möglichen Richtungen katapultieren lässt.Ulf StolterfohtIch sehe noch ein Problem. Ich glaube, dass man das, wovon wir jetztsprechen, nur verstehen kann,wenn man sehr viel Text in seinem Le-ben aufgenommen hat. Das ist nichts, was man schon als Kind odervon Natur aus kann. Man muss viele Kinderlieder gesungen haben,die Bibel gelesen und viele Lieder im Radio gehört haben.Es läuft ein-fach vieles über Differenz.Wennman die Norm nicht kennt, funktio-niert die Differenz auch nicht.Guido GrafWeil es so voraussetzungvoll ist. Ist das nicht einfach Praxis? Vor vie-len Jahren habe ich Marcel Beyer mal in Dresden besucht und er hatu.a. ein paar Sachen von J Dilla vorgespielt. Bis dahin hatte ich den
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
166 167
Namen in der SPEX mal gelesen, aber das war auch alles. Marcel hatmir die Instrumentals von J Dilla vorgespielt und ichwar davon völligfasziniert. Aber etwas anfangen damit kann ich im wahrsten SinnedesWortes nur dann,wenn ich tatsächlich auch damit etwas anfange,wenn ich also diese Bausteine, die er da zusammenbastelt, selbst wie-der benutze und damit weiterarbeite.Ulf StolterfohtDa gibt es ja tatsächlich viele Beispiele.MF Doom hat eine Platte mitdem Titel Special Herbs gemacht. Er nennt sich da Metal Fingers.Neun CDs in einer Box.Das ist so herrlich und bestehtwahrscheinlichzu 80 Prozent aus Vorgaben von J Dilla, die er da bearbeitet. Aber esist genauso wie Du sagst: Das funktioniert mit dem Bezug auf dieerste Stufe der Dilla-Samples und er geht dann weiter. Das ist eineendlose Kette.Man muss die nicht ganz kennen. Es reicht,wenn manversteht,wie es funktioniert.Guido GrafWas ist das für ein Wissen? Das ist Praxiswissen. Dilla hat ja auchnicht irgendwo bei einem Nullpunkt angefangen.Ulf StolterfohtNein, eben.Guido GrafWarum hat dann Dilla so eine enorme Wirkung gehabt? Oder wirddas aus heutiger Perspektive, stark personalisiert, so dargestellt?Wenn wir das auf die Ponge-Übersetzung von Thomas Schestag an-wenden, auf die Art wie Schestag liest und schreibt, kann man vielessehr deutlich an ihm festmachen. Es gibt einen hohen Wiedererken-nungswert, aber er hat mit dieser Art zu schreiben auch nicht ange-fangen. Schestag würde nicht so schreiben, wenn Paul Celan andersgeschrieben hätte, zum Beispiel. Und Du würdest anders schreiben,wenn Du mit siebzehn nicht Pastior, sondern Ulla Hahn gelesen hät-test.Ulf StolterfohtWahrscheinlich.Guido GrafWas für ein schreckliches Beispiel. Tut mir leid.Ulf StolterfohtAber das wäre doch ein Beispiel, oder? Angenommen,man liest imAl-ter von 14 bis 25 nur Mascha Kaléko. Heißt das dann, dass man auto-matisch so schreiben muss? Dass glaube ich nicht. Vielleicht kommtda ja auch etwas ganz anderes heraus? Das würde dann heißen, manbraucht überhaupt nur Praxis. Mit was die stattfindet, ist vielleicht
gar nicht so wichtig. Pastior hat in Siebenbürgen nichts gehabt, aufwas er sich beziehen konnte. Da gab es mal Arp, hat er mir mal er-zählt.Aber die Moderne hat dort nicht stattgefunden.AmAnfang zu-mindest hat er aus dem Nichts heraus gearbeitet und das ging auch.Und erst dann hat er nach und nach entdeckt, dass es Ähnlichesschon gibt.Aber es hilft ja nichts,wahrscheinlichmussman trotzdemHölderlin, Schiller oder Uhland lesen. Irgendetwas muss man wahr-scheinlich lesen, damit man anfängt, selbst Gedichte zu schreiben,damit man anfängt, mit Strukturen etwas anzustellen. Aber nichtmal da bin ich mir sicher.Guido GrafWir eifern immer irgendwelchen Vorbildern nach und lernen aus denEnttäuschungen, die sie produzieren.Was jemanden dazu bringt, Ge-dichte zu schreiben, ist auch ein Lernprozess. Worin besteht diesesLernen? Etwas nachzumachen und sich anzueignen? Wenn es pro-duktiv sein soll, müsste das Schreiben immer eine Form der Öffnungdarstellen. Sinneseindrücke müssten dann immer etwas öffnen undnicht verschließen.Ulf StolterfohtWäre denn vorstellbar, dass Nachtigallen singen, auch wenn alleNachtigallen taub wären?Guido GrafDiese Frage würde voraussetzen, dass Nachtigallen schon immer sogesungen haben,wie Nachtigallen singen.Ulf StolterfohtDie ändern ja ständig alles. Es gibt einen amerikanischen Klarinettis-ten, der sich Nachtigallen sucht und sich in der Dämmerung mit sei-ner Klarinette da hinstellt und mit denen zusammen spielt. Damithat er in den Sozialen Netzwerken einen Shitstorm provoziert, weildie Nachtigallen auf einmal alle so klangenwie er.Das fanden die Na-turfreunde nicht gut,weil es nicht mehr natürlich ist,was die Nachti-gallen machen. Das finde ich interessant.Guido GrafUnnatürliche Nachtigallen wäre eine sehr schöne Bezeichnungen fürdas,was etwas Dichter:innen sind.Ulf StolterfohtDas Papageihafte ist schlecht angesehen, aber wahrscheinlich ist esder Ursprung von ganz vielem.Guido GrafDas ist das PrinzipWiederholung und Variation.
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
168 169
Ulf StolterfohtGanz genau.Wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, war, was wiran Gedichten mitbekommen haben als unser lyrisches Rüstzeug, inStuttgart, damals am humanistischen Gymnasium, ausschließlichSchiller und Uhland.Vielleicht habenwirmal einMörike-Gedicht be-sprochen. Hölderlin kam überhaupt nicht vor. Dann im Leistungs-kurs gab es zwei, drei Sachen von Gottfried Benn und das war's. Auswenig kann auch noch einiges resultieren.Guido GrafDieses Öffnen und Schließen findet ja nach wie vor statt. In Schulenwird im Lesen von Gedichten, im Sprechen über Gedichte nach wievor noch sehr viel Verschließung betrieben. Es werden Texte vorge-stellt, die Löcher haben und diewerden dann nach und nach gestopft.Wer am besten stopfen kann, bekommt eine gute Note. Daraus ent-steht keine neue Dichtung.Ulf StolterfohtDas wäre vielleicht wirklich interessant, wegen der Nachtigall. Viel-leicht ist es ja doch nicht nur die Nachahmung. Wegen der Gedicht-analyse,wie sie an der Hochschule, im Gymnasium oder an jederwei-terführenden Schule stattfindet, wird wahrscheinlich niemand an-fangen,Gedichte zu schreiben.Trotzdem ist eswahrscheinlich besser,dass es das gibt, auch wenn es vielleicht nicht so ist, wie wir es unswünschen würden.Guido GrafDu hast ja nun auch schon des öfteren an verschiedenen Instituten inLeipzig, Wien, in Hildesheim mit jungen Leuten zu tun gehabt, dieGedichte schreiben. Wenn Du das jetzt reflektierst und vergleichst,bestätigt das Deine Überlegung?Ulf StolterfohtFür mich ist es jedesmal aufs neue ein Wunder, wie gut die schonsind. Ich denke immer an mich, was ich mit Anfang 20 wusste undwas ich geschrieben habe.Wenn ich die Erst-, Zweit- oderDrittsemes-ter sehe, wie weit die sind, wie viel die wissen und auf welchem Ni-veau die sich über diese Sachen unterhalten können: Das konnte ichüberhaupt nicht. Ich stand fassungslos vor den Texten und hätteüberhaupt nichts dazu sagen können. Ich weiß nicht, woher daskommt. Aber ich merke auch an meinen eigenen Kindern, dass diemit Texten besser umgehen können.Die halten viel mehr Referate, eswird viel weniger abgefragt. Es geht vielmehr darum, dass man mitirgendwas etwas anderes macht. Ich weiß, es ist natürlich nur eineMinderheit. Es gibt viel mehr Leute, die mit Lyrik überhaupt nichtszu tun haben, die überhaupt keinen Kontakt mit Gedichten hatten.
Aber bei denen, die den Kontakt hatten und bei denen es funktio-niert, hat sich wahnsinnig was getan seit den Sechziger-, Siebziger-jahren.Guido GrafKönnte es sein, dass zum einen Theorien von Sprache und Literaturdurchgesickert sind in Sphären, die diejenigen, die Theorien gebildethaben, gar nicht im Auge hatten? Heute ist es relativ selbstverständ-lich, schon sehr frühzeitig, nicht nur in schulischen Kontexten, überSubjekte und Objekte zu sprechen, über Bezeichnungen und Bezeich-netes, also solche Unterscheidungen überhaupt zu treffen. Zum an-deren lesen wir allesamt – je jünger die Menschen sind, desto mehr– immer mehr. Nur auf eine andere Art undWeise.Ulf StolterfohtDas ist das eine. Und dann kommt noch etwas hinzu. Ich kann micherinnern, als zum erstenMal ein Buch von Stephen King auf derTitel-seite der FAZ-Buchmessenbeilage besprochen wurde. Da hab ich ge-dacht: So, das war's jetzt mit der Literatur. Aber das ist eben genaunicht so gewesen. Auf einmal gab es Besprechungen von Batman imFeuilleton der FAZ. Das wäre zu meiner Zeit unvorstellbar gewesen.Komplexe Besprechungen,wie es heute üblich ist, so dass man denkt,die Gesellschaft findet sich wieder in einem solchen Blockbuster.Man kommt viel leichter rein in die Theorie,weil die Schwelle niedri-ger ist.Man schaut sich den Joker-Film an und kann dazu vernünftigeSachen lesen. Das gab es früher nicht: einen popkulturellen Diskursauf hohemNiveau.Das hat Ende der 80er Jahre erst angefangen.Dar-über haben viele denWeg gefunden in Kontexte von Theorie von wasauch immer. Bei euch in Hildesheim ist es ja noch viel extremer,weiles nicht so fokussiert ist auf eine kleine Nische, sondern viel breitergefasst ist.Guido GrafKürzlich sprach ichmitmeinem Sohn über Zombiefilme und ichweißnoch, dass ich als ich 13jähriger in leicht verschwörerischerWahrneh-mung mit ein paar anderen zusammen das erste Mal einen Zombie-film gesehen habe, wovon auch niemand etwas wissen durfte. Aberich habe eigentlich kaum hingeschaut. Ich habe mich nicht getraut.Ich wusste für mich, dass das ganz furchtbar ist und habe die ganzeZeit weggesehen. Aber hinterher natürlich groß davon erzählt. Daranhat sich bis heute nichts geändert: Ich kann das nicht sehen.Vor eini-ger Zeit habe ich eine großartige Bachelorarbeit betreut, in der eineStudierende sich mit Zombie-Traditionen nicht nur in im Film, son-dern auch in Texten beschäftigt hat. Sie diskutierte da viele theoreti-
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
170 171
sche Texte, die ich aus ganz anderen Kontexten kannte, und ich hatteGefühl, nun überhaupt erst etwas davon zu verstehen.Ulf StolterfohtGenau das meine ich.Guido GrafDa kamen diese Texte auf einmal in eine bildliche, imwahrsten SinnedesWortes plastische Praxis hinein.Ulf StolterfohtIch habe vorgestern im Autoradio gehört, dass das Missy Magazineaktuell ein Zombie-Dossier hat. Die Herausgeberin hat über die Arti-kel gesprochen, nicht nur über Zombies, auch anderer Horror. Alleindieses Interview ersetzt wahrscheinlich anderthalb Stunden härtesteLektüre, einfach weil da so viel mitkommt und die Leute so wahnsin-nig viel wissen, dass ich immer nur mit offenem Mund da sitze undzuhöre.Guido GrafWas Dumachstmit Deinen Texten, ist eigentlich nichts anderes. Pop-kulturelle Kontexte hast Du auch schon immer verarbeitet. Ob dasjetzt Captain Beefheart oder Freejazz ist oder das, was in den fach-sprachen vorkommt. Die Spezialvokabulare von Fachsprachen sindqualitativ doch ein ähnlicher Kontext wie jener popkulturelle Kon-text auch.Ulf StolterfohtIch hab mich z.B.mit Pokemonspielen beschäftigt, ohne jemals Poke-mon gespielt zu haben, mit Profilen und mit den Avataren, was diealles können, dass man Elixier braucht usw. Das interessiert michauch sehr, aber ich habe keine Ahnung was Baudrillard zu Pokemonsagt.Das hab ich nie gelesen. Ich habe es auch nicht sowichtig gefun-den. Mittlerweile glaube ich, das war ein Fehler. Ich hätte früher vielmehr französische Theorie lesen sollen. Ich habe immer gedacht, dasist für Weicheier. Man muss die analytische Fahne hochhalten unddie anderen, die können ja die Franzosen lesen. So überheblich istman halt manchmal. Aber im Ernst, wenn Dietmar Dath einen Hor-rorfilm in der FAZ bespricht, fehlt mir alles.Da fehlenmir die anderenHorrorfilme, auf die er Bezug nimmt, auf die der Film Bezug nimmt.Mir fehlt die Theorie, alles. Aber umso erfreuter lese ich den Artikel,weil ich keine Ahnung habe und mir nochmal ein ganz neues Fensteraufgeht.Guido GrafAber liest DuTheorien, zum Beispiel jemandenwie Frege, anders? An-ders als zum Beispiel Dietmar Dath?
Ulf StolterfohtVielleicht nicht mal so sehr anders. Frege hab ich eigentlich auch ge-lesen,weil ich dachte, ich habe dawas gefunden,was ich für Gedichtebenutzen kann. Ich lese das meiste eigentlich aus Verwertungsinter-essen. Das darf man ja gar nicht sagen, aber es ist so. Wittgensteinnicht,da habe ich einfach zu früh angefangen,das zu lesen.Aber alles,was ich nach Wittgenstein gelesen habe, habe ich eigentlich gelesen,weil ich dachte, dass ich das fürs Schreiben als Material gebrauchenkann, nicht als theoretische Grundlage fürs Schreiben. Manchmalauch beides, aber vor allem als Material. Die Dath-Artikel lese ich na-türlich auch als Material, nur mache ich mir ganz selten die Mühe,die Quellen, auf die er Bezug nimmt, auch zu lesen.Guido GrafSo viel Zeit passt auch nicht in ein einzelnes Leben hinein, um dashinbekommen zu können.Ulf StolterfohtJa, aber es ist noch mehr.Mir ist die Haltung auch fremd. Es gibt eineFormvon Philosophie, bei der ich die Haltung gar nicht richtig verste-hen kann,woher das kommt undwohin das geht. Ich habe das Gefühl,ich müsste mich da entweder richtig einarbeiten oder als Menschverändern, damit ich es von allein verstehe. Irgendwannmal habe ichwieder angefangen,Georg Lukács zu lesen. Eigentlich aus schlechtemGewissen und war dann auch nur so halb erfreut über die Leseerfah-rung. Ich müsste einfach öfter mein Herz in beide Hände nehmenund auch Sachen lesen,die ich nicht verstehe oder diemir fern liegen,denn bei allen anderen Sachen mach ich es ja auch und schaue mirPokemon an. Das liegt mir auch fern und nur bei Theorie denke ich,dass mich das nichts angeht.Guido GrafIch finde es überraschend, dass Du das so für Dich beschreibst, weilich eigentlich immer annahm,dass auch die Art wie Dumit z. B.Witt-genstein, den Du ja wirklich gut kennst, hantierst, ihn zitierst oderweiterdenkst, in Gedichte einbaust, sich einer offensichtlich produk-tiven Art der Lektüre verdankt, die etwas damit zu tun hat,wasWitt-genstein schreibt und wie er schreibt, die aber auch Deine Art ist,Theorie zu lesen und zu verarbeiten, ein Verfahren, das eigentlich aufalles angewendet werden kann, vielleicht nur nicht in gleicher Pro-duktivität. Aber wovor sollte diese Art von Offenheit haltmachen?Ulf StolterfohtDas hat vielleicht auch damit zu tun, wie Hans-Jost Frey, ThomasSchestag oderWerner Hamacher, die Du bei Dir im Regal stehen hast,Theorie wieder zum Text machen. Ich brauche etwas Habhaftes, um
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
172 173
damit umzugehen. Obwohl, das stimmt nicht. Ich benutze Literaturauch als Ausgangspunkt, aber ich glaube, eine Theorie, die zu nahe ander Literatur ist, lädt mich weniger ein dazu,was damit zu veranstal-ten. Das ist der Punkt. Die hat selbst schon etwas damit veranstaltet.Guido GrafAber gilt das nicht für Wittgenstein auch? Die Art und Weise, wieWittgenstein-Sätze baut,wie er Beispiele erzählt,wie er Pointen baut.Ulf StolterfohtFür die Philosophischen Untersuchungen stimmt das wahrscheinlich.Guido GrafFür den Tractatus auf eine andere Art undWeise sicherlich auch.Mankann ja auch über die ästhetische Gestalt des Tractatus sprechen.Ulf StolterfohtJa, klar.Das leuchtet mir ein,was Du sagst.Aber trotzdem finde ich, esist was anderes. In den Philosophischen Untersuchungen, auch wenndie keine logische Untersuchung mehr sind, sondern eine alltags-sprachliche, hält er doch fest an einemWahrheitsbegriff.Guido GrafLass uns nochmal auf die produktive Selbstreferentialität von Ge-dichten zurückkommen, die ja bedeutet – und so habe ich jedenfallsDeine Texte immer wieder gelesen –, dass sie immer auch eine theo-retische Reflexion darstellen,die sich nie darauf reduzieren ließe.DasNachdenken und das Bauen solch fragiler sprachlicher Modelle, diefragen: Was ist denn jetzt Verstehen? Was ist ein Satz? Was ist Spra-che? Das ist in jedemText. Insofernwärst Du auch immerTheoretikerin dem,was und wie Du schreibst.Ulf StolterfohtFake-Theoretiker vielleicht. Das ist ja das Schöne an diesen Metaebe-nen, die man aufeinander bauen kann, dass das »als ob« manchmalgenauso gut ist wie das echte Tun.Oft ist es nicht Theorie und Praxis,oft sind es auch nur Haltungen, die aufeinander getürmt werden,oder? Da spricht einmal der, der das Gedicht schreibt und einmalspricht der, der über dass Gedicht nachdenkt.Dann spricht der, der esvorliest und sagt: Hört ihr mir überhaupt noch zu? Ist da noch je-mand dabei? Könnt ihr mir noch folgen? Das ist das, was mir Spaßmacht. Man kann verschiedene Sprechhaltungen übereinander tür-men. Wie ein Feedback. Viel von diesem angeblichen theoretischenNachdenken,was nebenher noch stattfindet, ist fürmich Haltung.Dawird die Haltung dessen eingenommen, der neben dem Schreibenauch noch übers Schreiben nachdenkt, es aber dann gar nicht wirk-lich tut, sondern eigentlich nur die Hülsen benutzt, in denen man
über Gedichte nachdenkt.Dass dabei manchmal trotzdem etwas Pro-duktives rauskommt, kann passieren,muss aber nicht.Guido GrafKann diese Haltung desjenigen, der Theorien bildet, je etwas anderessein als eine Haltung?Ulf StolterfohtDas ist eine gute Frage. Das weiß ich nicht. Ich dachte, ja. Aber wennDu sagst, es ist immer »als ob«,würde mich das sehr beruhigen.Guido GrafIch würde dieses berühmte Bild von Wittgenstein von der Leiter, dieman,nachdem sie erstiegenwurde, dannwegwirft, einfach sehr ernstnehmen.Ulf StolterfohtSagt dieses Bild von der Leiter nicht, dass man dann der Theorie ei-gentlich nicht mehr bedarf?Guido GrafJa, und zwar die Theorie, die man bis dahin hatte. Das heißt abernicht, dass ich aufhöre damit. Ich bauemir dann neue Leitern. In demMoment, wo ich eine Leiter weggeworfen habe, brauche ich schonwieder die nächste.Ulf StolterfohtWeil Du ein neues Problem hast?Guido GrafJa. Ich schreibe weiter. Ich schreibe den nächsten Text. Ich lese dennächsten Text. Ich bin ja nicht, nachdem ich meine erste Leiter weg-geworfen habe, ins Paradies des Verstehens eingetreten.Ulf StolterfohtAber im Vorwort zum Tractatus schreibt Wittgenstein, dass er derMeinung ist, die Probleme im Wesentlichen gelöst zu haben, oder?Ich habe immer die Leiter auch so verstanden, als ob das dann für al-les gilt. Wenn man im Denken insgesamt so weit fortgeschritten ist,dass man die Leiter nicht mehr braucht, dann braucht man sie niemehr. Das wäre doch auch eine mögliche Interpretation. Ich glaubeeher, dass Du recht hast, aber ich finde, so kann man es auch lesenoder verstehen. Das Vorwort vom Tractatus ist sowieso der Hammer.Ich würde gern mal einem Gedichtband voranstellen: Ich bin derMeinung, die Probleme der Lyrik im Wesentlichen gelöst zu haben.Und jetzt muss ich sagen,was denn die Probleme der Lyrik eigentlichsein sollen.Guido GrafFällt Dir ein Problem ein?
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
174 175
Ulf StolterfohtDas sind wahrscheinlich im Wesentlichen Rezeptionsprobleme. Kei-ne Probleme des Schreibens. Man muss den Leuten auf eine Art bei-bringen, dass sie Gedichte anders lesen sollen, als sie es gelernt ha-ben. Das ist das größte Problem von Gedichten. Aber das lösen Ge-dichte, glaube ich, nicht.Guido GrafSind dann Gedichte nicht immer schon Theorien des Lesens?Ulf StolterfohtIdealerweise schon. Das würde ich auch sagen. Ich glaube nur, dassman sie so dann auch verstehen muss. Man muss nichts verstehen,aber das muss man dann doch verstehen. Ich habe kürzlich einenWorkshop gemacht mit 14 ganz unterschiedlichen Leuten, die wirk-lich Dichter – in dem Fall waren es zweiMänner –werdenwollen undandere, die das eher hobbymäßig oder ambitioniert hobbymäßig be-treiben. Ich war wirklich überrascht, dass auch, wenn man es erklärt,es trotzdem nicht ankommt. Viele sind dem traditionellen Verste-hens- und auch Lyrikbegriff so sehr verhaftet. Es gab einige Leuteund vielleicht aus guten Gründen, die das einfach nicht akzeptierenwollten oder konnten.Wennman es akzeptiert, dann sind für die Ge-dichte nichts mehr wert. Dann denken sie, dass sie sich 30 Jahre fürsFalsche interessiert und begeistert haben, dass, wenn das wirklichstimmt, dass es diesen Verstehensbegriff im konventionellen Sinnnicht gibt, sie aufs falsche Pferd gesetzt haben.Guido GrafDas ist die Theorie der Enttäuschung. Ich weiß nicht, ob heute Sport-unterricht immer noch so aussieht, aber ich erinnere mich an eineReferendarin, die ich mal hatte. Einige meiner Mitschüler haben sichbeim Turnen sofort beschwert: Die kann keine Hilfestellung leistenund ich springe da nicht drüber.Ulf StolterfohtBeim Bockspringen?Guido GrafJa, und alles was sie nicht konnten, haben sie auf die Hilfestellungdieser Referendarin bezogen.Ulf StolterfohtWeil sie als Frau zu schwach sei, richtig helfen zu können?Guido GrafNatürlich waren das auch misogyne Anwandlungen von ein paar pu-bertierenden Jungen. Und es ist immer auch ein Autoritätsproblem.Diejenigen, die es dann aber geschafft haben, dachten überhaupt
nicht über eine Hilfestellung nach. Die konnten es dann einfach, ob-wohl sie natürlich von ihrerAnleitung profitiert haben.Und vielleichtverhält es sich ähnlich mit dem, was Du in so einem Workshopmachst oder was wir in Hildesheim in Seminaren machen, aber ebenauch mit dem, was wir machen, wenn wir Theorien bilden oder überTheorien nachdenken und diese Wut des Verstehens versuchen, we-nigstens ein wenig zu dekonstruieren.Manchmal bestätigt man ein-fach nur die Ängste, die Leute haben und sie fallen in ihre Ängste zu-rück und leiden.Andere können sich davon befreien.Ulf StolterfohtWir hatten in Stuttgart einen ganz komischen Sportlehrer,Major derReserve. Da haben wir immer alle gesagt: aber bitte ohne Hilfestel-lung. Ich weiß jetzt nicht, ob das in Deinem Beispiel etwas Positivesoder eher etwas Negatives wäre. Kann beides sein, oder?Guido GrafDie Angst, über diesen Kasten oder Bock zu springen, projiziere ichauf die Person, die daneben steht und die einen Fehlermachen könn-te.Ulf StolterfohtWenn jetzt jemand, ob in Hildesheim oder in Heidelberg, sagt: ichwillmir meine eigenen Gedanken über Sachen machen, ich brauche Dei-ne Hilfestellung nicht?Guido GrafDer Punkt, auf den es dann ankommt, wenn wir Theorien als Hilfe-stellungen begreifen, wäre dann zu sagen: »Ich brauche die nicht,weil …«. Denn dann ist man gefordert, selbst Theoriebildung zu be-treiben.Ulf StolterfohtEs gibt ja Gedichte, die hohen theoretischen Aufwand betreiben undviele Ansprüche stellen, und es gibt Gedichte, die zumindest ver-meintlichwenig Aufwand betreiben und ganz einfach sind.Trotzdembraucht man für beide Textsorten oder für beide Formen solcher Ge-dichte eine Theorie. Es ist ja nicht so, dass ein einfaches Gedicht keineTheorie erfordern würde, wenn man sich damit beschäftigt. Das istirgendwie ganz tröstlich, dass das so ist. Es gibt ein Goethe-Gedicht:»Wie glänzt dein Auge, wie liebst du mich.« Es kommt immer: »Wieliebst dumich,wie lieb ich dich.« Das allerblödeste Gedicht der deut-schen Klassik. Das fand ich so blöd, dass ich mich trotzdem immerwieder damit beschäftigt habe, es immerwieder gelesen habe und daauch noch an kein Ende gekommen bin. Das ist wirklich das an-spruchsloseste Goethe-Gedicht, das ich kenne. Und trotzdem löst esirgendetwas aus,was man theoretisch fassen will. Nicht mal ex nega-
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
176 177
tivo. Es ist blöd und banal und trotzdem ist etwas drin, was sich ei-nem entzieht. Das will man zu fassen kriegen. Es gibt ja auch in ganzeinfachen Volksliedern Irritationsmomente. Oft ist es nur ein ande-resWort als das,wasman üblicherweise erwartenwürde.Das ist danndem Rhythmus geschuldet oderweil man etwas Dreisilbiges braucht.Trotzdem hat es etwas Irritierendes. Das will man verstehen. Und dafängt es schon an.Guido GrafDas eine sehr schöne Bestimmung dessen, was Theorien von Litera-tur oder für Literatur sein können.Mir wird überhaupt der Bedarf aneiner Stelle bewusst, an der sich etwas entzieht, meinem Zugriff ent-zieht, meiner Kontrolle, meinem Verstehen. Dieser Entzug, dieserKontrollverlust: das ist der Boden, auf dem Theorien wachsen.
Am Rand der Sätze Am Rand der Sätze
fachsprachen XIX-XXVII. Gedichte. 128 Seiten,gebunden mit Schutzumschlag. Urs Engeler Editor,Wien und Basel/Weil am Rhein 2005.
traktat vomwidergang. Gedichte.Mit einem Abspannvon Ulf Stolterfoht und einer Biographischen Notiz. 48Seiten, Broschur. Verlag Peter Engstler, Ostheim/Rhön2005.
holzrauch über heslach. Gedicht. 128 Seiten, gebundenmit Schutzumschlag. Urs Engeler Editor, Basel/Weil amRhein 2007.
fachsprachen XXVIII-XXXVI. Gedichte. 128 Seiten,gebunden mit Schutzumschlag. Urs Engeler Editor,Basel/Weil am Rhein 2009.
das nomentano-manifest. Gedichte.Mit einerNachbemerkung von Ulf Stolterfoht und einerBibliographischen Notiz. 56 Seiten, Broschur. VerlagPeter Engstler, Ostheim/Rhön 2009.
Ammengespräche. Herausgegeben von Urs Engeler. 82Seiten, Broschur. roughbooks, Berlin und Holderbank(Solothurn) 2010.
handapparat heslach. Quellen, Dokumente undMaterialien. Herausgegeben von Florian Höllerer. 96Seiten, Broschur. roughbooks, Berlin, Rettenegg,Stuttgart und Solothurn 2011.
Das deutsche Dichterabzeichen. 56 Seiten, Broschur.Reinecke & Voß, Leipzig 2012.
wider die wiesel. Gedichte.Mit einem Nachwort von UlfStolterfoht und einer Bibliographischen Notiz. 52Seiten, Broschur. Verlag Peter Engstler, Ostheim/Rhön2013.
Die 1000 Tage des Brueterich, roughbooks, Solothurn2013; Schupfart 2020.
neu-jerusalem. Gedicht. Kookbooks Verlag, Berlin 2015.
Wurlitzer Jukebox Lyric FL – über Musik, Euphorie undschwierige Gedichte.Münchner Reden zur Poesie.Stiftung Lyrik Kabinett,München 2015.
fachsprachen XXXVII–XLV. Gedichte. Kookbooks Verlag,Berlin 2018.
Methodenmann vs. Grubenzwang und mündelsichereRübsal. UniversitätsverlagWinter, Heidelberg 2019.
AnmerkungenMarcel Beyer: Dämonenräumdienst. Suhrkamp: Berlin2020.
Jordan Ferguson: J Dilla – Donuts. 33 1/3. Bloomsbury:NewYork/London 2014.
Oskar Pastior: Wechselbalg. Gedichte 1977−1980.VerlagKlaus Ramm: Spenge 1980.
Francis Ponge: Die Sonne. Übersetzt von ThomasSchestag. Berlin: Matthes & Seitz, 2020.
LudwigWittgenstein: Logisch-philosophischeAbhandlung, Tractatus logico-philosophicus. KritischeEdition. Suhrkamp, Frankfurt amMain 1998.
Werke von Ulf Stolterfoht:
fachsprachen I-IX. Gedichte. 128 Seiten, gebunden mitSchutzumschlag. Urs Engeler Editor, Basel,Weil amRhein undWien 2005. [Gebundene, leicht verbesserteNeuausgabe des Erstdrucks von 1998]
fachsprachen X-XVIII. Gedichte. 128 Seiten, gebundenmit Schutzumschlag. Urs Engeler Editor, Basel/Weil amRhein 2008. [Gebundene, leicht verbesserteNeuausgabe des Erstdrucks von 2002]
178 179178 179
Kritik in der LiteraturGespräch mit Jan Drees
Wir sprechen über Bibelstunden und den vielrachen Schriftsinn, überLiteraturkritik und die Differenz in Systemen wie der Literatur, überBlut auf dem Papier und über die Gegenwart von Der Mond ist auf-gegangen. Jan Drees wurde 1979 geboren und ist Journalist, Radiomo-derator und ehemaliger Leichtathlet. Und er ist Schriftsteller. Seinjüngster Roman erschien 2019: Sandbergs Liebe, eine Geschichte übernarzisstische Gewalt und Gaslighting. Seit 2016 ist Jan Drees Litera-tur-Redakteur beim Deutschlandfunk.
Guido GrafKannst Du Dich erinnern, wann Du Dich das erste Mal für Literaturinteressiert hast? Auf eineArt undWeise,die über den bloßen Genuss,die Spannung z.B. hinausging?Jan DreesIch glaube, das war ein fließender Übergang. Gelesen habe ich schonimmer. Nicht wie die hochbegabten Kinder vor der Schule, sondernerst mit der Schule habe ich angefangen zu lesen. Und dann gab esimmer wieder neue Erfahrungen. Eine wichtige war die Kirche. Ichbin nicht mehr in der Kirche, aber mit 13, 14 war ich in der Kirche tat-sächlich aktiv, hatte auch Kindergottesdienst, aber diesen Kindergot-tesdienst nicht besucht, sondern habe ihn tatsächlich auch selber ge-geben. Das Team dieses Kindergottesdienstes hatte immer am Mitt-woch Bibelstunde beim Pfarrer. Zu dieser Bibelstunde bin ich von nie-mandem gezwungen worden. Ich wollte da tatsächlich selber hin.Meine Eltern sind auch nicht religiös. Dort haben wir dann die Bibel-stelle der Woche gelesen. Diese werden vorgegeben. Im Protestantis-mus, glaube ich, genauso wie im Katholizismus, und zwar die Stelle,über die am Sonntag gepredigt und die auch im Kindergottesdienstbehandelt wird.Der Pastor hat diese Stelle dann vor allen gelesen, amAbend, und ich habe zugehört und mitgelesen in der Bibel. Er hat im-mer wieder gesagt: und jetzt erzähle ich euch, was eigentlich in die-semText steht.Das war auch der herausgehobene Grund,weshalb ichzu dieser Bibelstunde wollte, weil ich dort zum ersten Mal erfahren
180 181
habe,dass Texte Rätsel sein können.Diese Rätsel fand ich interessant.So gesehen hat es dann doch wieder etwas mit Spannung zu tun. Ichhatte das Gefühl, an einemGeheimwissen teilhaben zu können, ohnedies von derAnschauung auf den Begriff zu bringen. Ichwusste nicht,wie man das benennen sollte, dieses Kribbeln, das, glaube ich, jederkennt, der liest und merkt, hier wird noch etwas anderes erzählt. Dasging dann immer so weiter. Ich habe immer mehr gelernt, auch ausanderen Texten und hinterher im Studium selbstverständlich mitden absurdesten Theorien gesehen,wie man auf immer neue Art undWeise Texte enträtseln kann. Dieses Texteenträtseln und Texte untereinem kriminalistischen Aspekt zu lesen, ist immer noch eine Haupt-antriebsfeder meines literaturkritischen Lesens und Schreibens.Guido GrafDu hast von einem kriminalistischen Verfahren gesprochen und dasgibt ja schon eine bestimmte Methode vor.Würdest Du diese Metho-de in den Theorien, die Du absurd genannt hast, wiederfinden kön-nen? Oder bist Du Theorien begegnet, die ganz anders funktionieren?Jan DreesIch glaube, dass jede Theorie eine anders gefärbte Brille ist, mit derich unterschiedliche Dinge sehen kann oder die immer gleichen Din-ge auf unterschiedliche Arten und Weisen. Ich kann auch sagen, essind Werkzeuge und mit den einen Werkzeugen kriegt man dieSchrauben aus dem Text und mit den anderen Werkzeugen kann icheinen Nagel aus demText ziehen und ihn mir anschauen.Was bedeu-tet das?Wir haben also am Anfang dieses Bibellesen und das ist nochsehr unschuldig. Da erfahre ich, es bedeutet auch etwas anderes. Ir-gendwann habe ich dann erfahren, im Laufe des Studiums, dass esschon im Mittelalter die Idee des sogenannten vierfachen Schrift-sinns gab.D.h. alle Texte, die biblischen Texte haben einen vierfachenSinn und sind vierfach konnotiert, d.h. es ist nicht nur so gewesen,wie mirmit 14 der Pfarrer gesagt hat, ich erzähle euch,was eigentlichdrin steht, also dass eine Alternative genannt wird, sondern es wur-den vier Alternativen gesehen. Jerusalem hat im Mittelalter mehr alsnur die Stadt bedeutet. Jerusalemwar auch ein Prinzip. Im Laufe die-ses Studiums habe ich dann immer mehr Theorien kennengelerntund gesehen, dass ich mit jeder einzelnen etwas anderes aus Textenherausholen kann.Nehmenwir Kafkas Brief an den Vater. Da wird dieGeschichte erzählt von einem Sohn, der einen Freund hat. DieserFreund ist in Russland und dem schreibt er Briefe. Der Sohn ist zuHause und lebt mit seinem Vater zusammen in einer Wohnung. Indieser Wohnung gibt es zwei Räume, den Raum des Sohns, dieserRaum ist hell. Dazwischen gibt es einen Flur und dann den Raum desVaters.Dieser Raum ist dunkel.Wennmanmit topologischen Theori-
en an diesen Text geht, mit Raum-Theorien und sich nur anschaut,wie diese Räume dem, was geschieht, zugeordnet sind, bekommtman eine Idee davon, wie dieser Text möglicherweise funktioniert,warum dieser Text uns begeistert.Wenn wir psychoanalytisch heran-gehen, werden wir ihn nochmal anders lesen, werden wir den Vater-konflikt, der dort beschrieben ist, anders beschreiben.Und das ist das,was wir in der Literaturkritik machen.Wir machen Texte über Texte.Wir haben einen Text, über den wir nachdenken und zu dem wir ei-nen anderen Text machenmüssen.Dieser Text kann ein Radiobeitragsein, ein Fernsehbeitrag, aber es sind immer Texte über Texte. Wirmöchten nicht 1:1 das nacherzählen, was in der Geschichte erzähltwird, sondernwirmöchten eineAlternative anbieten.Denn das inter-essiert die Leute.Wir können ja alle selber lesen. Sie möchten also ei-nen anderen Zugang haben. Und diesen anderen Zugang erreichtman über Theorie. Man kann diesen Zugang natürlich auch ohneTheorie erreichen und über Lebenserfahrung gewinnen. Das gehtselbstverständlich auch. Aber Theorien sind gerade in einer Zeit, inder gar nicht so viel erlebt werden kann, gar nicht so viel Lebenser-fahrung den Grund des Denkens haben kann, eine Möglichkeit, umdiesen anderen Zugang zu finden. In unserer Zeit kann man nicht dieErfahrungen machen, die andere gemacht haben, die dann ihren Zu-gang auf besondere Weise geprägt haben. Marcel Reich-Ranicki bei-spielsweise hat in der Zeit des Nationalsozialismus, als er im Ghettoleben musste und Angst hatte, Trost gefunden in der Literatur. Dar-auf hat er immer wieder rekurriert, er hat immer wieder von diesenMomenten erzählt,was Kästner in diesen einsamen Zeiten bedeutete,und jemand wie Marcel Reich-Ranicki hat selbstverständlich die Li-teratur nach ihrer eskapistischen Qualität und nach ihrer Trostfähig-keit abgesucht. Das hatte nichts mit Theorie zu tun. Bei mir war eseher das Suchen, und das Eskapistische spielte eine eher nachgeord-nete Rolle. Ich bin in einem Dorf groß geworden. Ich musste ja nichtüber die Literatur mein furchtbares Leben von mir halten.Guido GrafIch kann mir vorstellen, wenn wir jetzt ein wenig an diesem Bild derBrille hängenbleiben, dass man auch über die Trostfähigkeit zu einergewissen Theoriefähigkeit gelangen kann.Du hast gesagt,man könn-te auch ganz ohne Theorie sprechen, über Literatur nachdenken, oderLiteratur einfach lesen. Das scheint erst einmal einleuchtend. Aberkönnte man nicht sogar auch sagen, dass jede Lektüre auch Theorieproduziert? Das heißt, dass wir ständig Brillen ausprobieren, indemwir lesen. Vielleicht sind wir uns dieser Brillen aber nicht immer indemMaße bewusst, dass wir sie mit anderen Brillen vergleichen und
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
182 183
dann in der Lage wären, diese Anschauung – denn nichts anderes istja eigentlich Theorie – als eine Anschauung zu begreifen.Jan DreesIch glaube, da gibt es zwei grundsätzliche Schulen. Es gibt die eine,die man in ihrer avanciertesten Form bei Blumenberg findet, die Tex-te analysiert mit dem, was der Text selber anbietet, den man analy-siert. Und dann gibt es die Möglichkeit, etwas komplette Abwegigeszu nehmen, z.B. die Systemtheorie von Niklas Luhmann, die gar keineLiteraturtheorie entwickelt hat. Es gibt zwar eine systemtheoretischeLiteraturwissenschaft, die sehr klein und kaum beachtet ist.Abermitdieser Theorie kann man ja auch in Texte gehen, von einem ganz an-derem Beobachtungspunkt aus.Man kannmit jedem neuen Text sichauf diesen Text einlassen und mit der Theorie, die diesem Text selbstzugrunde liegt, arbeiten oder etwas völlig Fremdes nehmen. Beidesist statthaft. Ich finde beides auch interessant. Es ist natürlich inter-essant, sich erst einmal zu fragen,was etwa der Tristan von Gottfriedvon Straßburg bedeutet hat in der damaligen Zeit, als er im Hochmit-telalter entstanden ist. Um das dann genauer zu beschreiben, hilft esbeispielsweise diskursanalytisch heranzugehen und sich zu fragen,welche Diskurse werden im Tristan des Gottfried von Straßburg poe-tisiert. Es gibt tatsächlich einen sehr schönen Text von Walter Haugüber die sieben Liebesdiskurse des Tristan, darüber, was der Tristandamals alles angesprochen hat. Das ist diskurstheoretische Arbeit.Man kann aber ebenso gut systemtheoretisch hineingehen oderstrukturalistisch. Jedesmal wird man andere Texte, andere literatur-kritischen Texte bekommen. Die Theorie steht immer zwischen demText, den man selber schreibt, und dem Text, den man liest.Guido GrafMir sind diejenigen, die Theorien gebrauchen, immer dann suspekt,wenn sie an irgendeiner Stelle sagen: Nur diese Anschauung, nur die-se Brille ist gültig.Jan DreesDas hat sich ja zum Glück geändert. Der Literaturkritiker muss nichtmehr als der Allwissende auftreten. Spätestens seit diesem Internet,das sich langsam durchsetzt,wird jedem klar, dass wir nicht alles wis-sen können. Noch vor fünfundzwanzig Jahren – der Name MarcelReich-Ranicki fiel ja schon – war der Gestus des grossen Kritikers derdes Allwissenden. Erwar derjenige, der geherrscht hat über diese Tex-te, die er gelesen und kritisiert hat.Das ist vorbei.Deshalb könnenwirjetzt umsomehr diesen allwissenden oder alleingültigenAnschauun-gen in der Literaturkritik anders begegnen. Es ist verrückt, dass nach1945 und nach den Erfahrungen einer absoluten Autoritätshörigkeit
erst einmal mehrere Jahrzehnte und zwei Generationen, nämlich dieGeneration aus dem Krieg, aber auch die Nachkriegsgeneration, An-schauungen und Lebensweisen hervorgebracht haben, die wiederumselbst höchst autoritär sind. Dazu gehört auch der autoritäre Litera-turkritiker, der nur die eine Lesart hat gelten lassen. Natürlich kannman immer noch behaupten, es gäbe nur die eine Lesart. Aber ichglaube, das ist Quatsch. Wir bieten eine Lesart an und diese Lesartsollte bei guter Literaturkritik möglichst interessant sein.Da sindwirwieder bei Luhmann.Wir werten zwischen interessant und nicht in-teressant.Die Literaturkritik, die interessant ist, die ist auch nützlich.Die Uninteressante ist unnütz. Das hat ja z.B. das Literarische Quar-tett immer geschafft: interessant zu sein. Jetzt könnteman sagen,dasist alles nur Entertainment.Aber ich glaube, dass es eine herausgeho-bene Qualität von guter Literaturkritik ist, interessant zu bleiben.Und nicht nur schlau, beispielsweise. Es gibt sehr schlaue Literatur-kritik, die aber keiner versteht, die nicht anschlussfähig ist. Schonwieder ein Begriff aus der Systemtheorie.Guido GrafDumeinst aber vermutlich das Literarische Quartett von Reich-Rani-cki und nicht das Literarische Quartett, für das etwa Maxim Billerforderte, dass Lisa Eckhart wieder ausgeladen wird.Jan DreesIch vergesse tatsächlich immer, dass es eine Sendung gibt, die auchLiterarisches Quartett heißt, die weder etwas mit Literatur zu tun hatnoch wirklich mit dem Quartett, das es früher gab. Natürlich ist eseine andere Form von Literaturkritik und selbstverständlich ist esEntertainment. Fernsehen spitzt immerzu. Das, was das LiterarischeQuartett mit Karasek, Sigrid Löffler, die sehr gut war damals, undMarcel Reich-Ranicki in ihrer Diskussion gemacht haben, würde ichso nicht in einem Zeitungsartikel folgen wollen. Aber so haben sie jadann auch nicht in der FAZ oder in der Zeit oder im Spiegel geschrie-ben. Das ist eben Fernsehen. Radio funktioniert auch nochmal an-ders. Eine große Zeitungskritik, die man aufbewahrt und die Anre-gung sein kann für spätere Literatur, wissenschaftliche Arbeit, funk-tioniert wieder anders.Auch da würde ich nicht sagen, dass jede Lite-raturkritik, die sich wissenschaftlich anschlussfähig zeigt, gut ist.Das merke ich, weil ich momentan ein paar Sachen wissenschaftlichmache. Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um tatsächlich jetzt miteinundvierzig doch noch meine Dissertation zu schreiben, und leseTexte, die Joachim Kaiser Mitte der Achtzigerjahre geschrieben hat.Ich schreibe über den Autor Hartmut Lange und außerhalb der Textevon Joachim Kaiser sind wenige andere so nützlich für meine Arbeit.D. h., Joachim Kaiser hat es geschafft,Mitte der 80er Jahre einen Text
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
184 185
über einen damals noch frisch Prosa schreibenden Autor zu verfas-sen. Das sind Texte, die immer noch gültig und interessant sind unddie einen auf Fährten bringen, denen man dann weiter nachforscht.Auch das ist gute Literaturkritik. Ichwürde niemals sagen, nur das istgute Literaturkritik. Es gibt auch Literaturkritik, die mich selber her-ausfordert, die mich möglicherweise aus ideologischen Gründennervt, die aber trotzdem ihre Berechtigung hat und gut sein kann. Eskann inspirierend sein, wenn jemand jetzt nochmal den Steppenwolfliest und bemerkt, dass dort zu wenige Frauen vorkommen und dieseFigur eigentlich höchst unangenehm ist. Ich würde das so nicht for-mulieren. Und doch lese ich oder höre ich so einen Text gern, weil ermir einen neuen Blick auf den Steppenwolf gibt und ein weiteres Malerklärt oder einen erneuten Grund dafür gibt, warum ich das Buchdamals so fürchterlich fand und für eines der schwächsten von Hessehalte. Es gibt nicht die eine Literaturkritik, nicht die eine gültige undjede Theorie kann helfen. Es sind ja auch häufig nur Versuche, Test-ballons und jede Theorie kann helfen, über einen literarischen Textetwas Anständiges zu machen.Guido GrafDie Möglichkeit, das neu zu lesen, kann man ja vielleicht wenigerauch auf die Konsistenz von Theorien beziehen, sondern als dieschlichte Erfahrungswirklichkeit, die heißt, dass ich Dinge erlernenkann, dass ich in Prozessen stecke und etwas anders wahrnehmenkann, als ich es vielleicht noch vor einiger Zeit getan haben habe. Alsich vor einiger Zeit beispielsweise die Verfilmung von Kunderas Dieunerträgliche Leichtigkeit des Seins wieder gesehen habe und völligenttäuscht war, habe ich mich gefragt,wie ich diesen Film jemals gutfinden konnte. Eine regelrechte Peinlichkeitserfahrung war das Wie-dersehen von Woody Allens Manhattan, der mir auf einmal höchstzuwider war. Diese Wahrnehmungen verändern sich und das hat miteinem Lernprozess zu tun.Jan DreesRainald Goetz hat Schiller nochmal gelesen und dann danach ge-schrieben, dagegen ist die Band Schiller geradezu eine Erweckung.Undwennman sich Viscontis Der Tod in Venedig anschaut, kann manauf der einen Seite sehr inspiriert sein, auf der anderen Seite aberauch sehr gut erkennen,wie viel besser Thomas Mann ist.Guido GrafIch würde ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hastvon Deiner Bibel-Initiation erzählt. Du hast von Deiner Dissertationberichtet und Du bist jetzt seit einigen Jahren Literaturredakteurbeim Deutschlandfunk und machst dort die Sendung Büchermarkt.
Du bist also an einer herausgehobenen Position in der deutschen Li-teraturkritik tätig, als eine wichtige Schaltstelle.Jan DreesDarf ich da kurz einhaken? Das ist sehr lustig. Ich habe wahnsinnigviel rezensiert, bevor ich diese Stelle bekam.Und dann hab ich die Er-fahrung gemacht, die fast alle Literaturkritiker:innen machen, diedann neu in eine feste Stelle kommen. Ich war zunächst einmal Lite-raturredaktionssachverwalter. Ich habe wahnsinnig viel organisiertund gar nicht so viel kritisiert in den letzten Jahren. Ich fange daswieder an. Das ist ein zweischneidiges Schwert mit der festangestell-ten Literaturkritik.Die hat sich nämlich verändert in den letzten Jah-ren. Die Stellen sind weniger geworden, die Anforderungen sind hö-her. Nicht die intellektuellen Anforderungen sind höher, sondern derRadioredakteur ist gleichzeitig auch ein Internetseiten-Redakteur.Das musste er früher nicht sein. Auch der FAZ-Redakteur ist gleich-zeitig ein Internet-Redakteur, zumindest wenn er jetzt neu in die FAZkommt.Manmuss sich also,wennman auf der herausgehobenen Po-sition ist, die Literaturkritik auf eine gewisse Weise und über andereWege als die vorherigen neu erkämpfen und bewahren. Und da hilftTheorie.Theorie erinnert zumindest mich daran, und deshalb schrei-be ich auch diese Dissertation, die ich nur für mich schreibe, dassman avanciert über literarische Texte nachdenken kann, dass manauch avanciert nachdenken muss und dass das verdammt nochmalsehr, sehr viel Zeit braucht. Ich hätte bis zu dieser Festanstellung im-mer gesagt: Man muss so viel Bildung wie möglich in sich aufneh-men, um ein guter Literaturkritiker zu sein. Ich hätte auch jedesmalgesagt, dass ich mich nicht zu den guten Literaturkritikern zähle,sondern immer noch daran arbeite. Jetzt in der Festanstellung würdeich sagen, dass das Wichtigste ist, sich Zeit freizuräumen, sehr vielZeit, um sehr viel nachzudenken und sehr viel zu lesen und runterzu-kommen.Guido GrafDu hast meine Frage, die ich noch stellen wollte, schon beantwortet.Die Frage richtet sich nämlich tatsächlich danach, welchen Einflussdie medialen, institutionellen und systemischen Bedingungen des-sen, was Du tust, haben, wenn Du Literatur anschaust. Von dem be-geisterten Lesen über das Studium hin,dann in eine Tätigkeit, die vielmit freier Literaturkritik zu tun hat, die auch nicht immer unbedingtviel Zeit bereithielt, aber ein anderes Zeitmanagement jedenfalls.Und jetzt? Mit Aufgaben bist Du konfrontiert, die viel mit Verwaltungzu tun haben und die dafür sorgen, dass Du Dir überhaupt erst ein-mal die Zeit schaffen musst, um Literatur anschauen zu können, um
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
186 187
sie so reflektieren zu können, dass sich ein theoretischer Horizonteinbringen lässt.Jan DreesDieser Job funktioniert nur, wenn er einem wahnsinnig viel Spaßmacht und die Literatur von keiner Institution kaputt gemacht wer-den kann. Denn das berichten auch andere Redakteurinnen und Re-dakteure in anderen Häusern. Man muss abends lesen, man mussnachts lesen, und das funktioniert nur, wenn man es gerne macht.Ansonsten ist man nach einem dreiviertel Jahr ausgebrannt. Manmuss sich Freiräume schaffen. Das ist wichtig. Und es ist nicht so,dass man heutzutage im Büro sitzen und still lesen kann. Man mussdafür rausgehen. Mir ist klar geworden, dass man sich diese Orteschaffen muss. Es kann ein Ort in der Wohnung sein. Bei mir war esvor Corona immer der gleiche Ort im gleichen Café, um dann dort zulesen,weil ich es mag, nicht ganz alleine zu sein,während ich lese. Ichgehöre nicht zu denen, die sagen, ich bin nicht allein sobald ich in ei-nem Buch bin, dann habe ich einen Gefährten bei mir. Nein, so seheich das nicht, oderwie RogerWillemsen es mal sehr schön gesagt hat,erwürde am liebsten im Zug lesen, denn das wäre ja dann ein zweifa-ches Reisen. Nein, ich habe halt gerne Leute um mich herum, kannmich dort auch ganz gut konzentrieren.Wahrscheinlich, weil ich auseiner relativ großen Familie komme und ohnehin immer irgendwasum mich herum war und ich mich konzentrieren musste. Man musssich also einen Ort schaffen und auch eine Zeit schaffen. Dafür istman selber zuständig.Dafür ist derDeutschlandfunk nicht zuständig.Der Deutschlandfunk gibt mir mit einem Lesetag in der Woche dieMöglichkeit, nur vier Tage die Woche dorthin zu gehen. Das ist derOrt, den mir derDeutschlandfunk schaffen kann, diesen Lesetag. Under gibtmir ein Büro und in diesem Büro bin ich alleine.Da sind Türen,die ich zumachen kann. Mehr kann der Deutschlandfunk auch nichttun.Den Rest muss man selber tun.Das ist, glaube ich, neben der im-mer neuen Beschäftigung mit Theorie die Herausforderung, die auchder Festangestellte hat. Er muss sich blöderweise die Bedingungenselber schaffen. Bedingungen, die man braucht, um Literaturkritik zumachen.Wenn man genauer guckt, außerhalb von Dietmar Dath, derdie FAZ an einem Tag auch komplett alleine schreiben könnte, in derGeschwindigkeit, in der er arbeitet, also sich andere Festangestellteanschaut und sieht, wie viel die vorkommen in ihrem eigenen Medi-um und zwar als Literaturkritiker, dann sieht man: Das ist gar nichtso viel. Immer nur ein paarTexte.Marie Schmidt in der SüddeutschenZeitung schreibt auch nicht jede Woche eine Literaturkritik. Manwürde doch sagen:Wer,wenn nicht sie? Sie hat doch ihr eigenes Blatt.Sie kriegt ja jeden Tag eineweiße Seite, die sie voll machen kann.Aber
nein, sie hat auch andere Aufgaben und muss sich die Zeit freischau-feln, um dann dort in Ruhe zu lesen. Denn gehetzt zu lesen bringtnichts, dann überliest man es nur oderman versteht es einfach nicht.Wennman ein paar Jahre schon Literaturwissenschaft und Literatur-kritik gemacht hat, ist man ja auch neugierig auf bestimmte Texte.Dann möchte man gerne einen Text wie den Ulysses verstehen,wennso einer dann auftaucht. Und das dauert einfach, bis so etwas durch-gelesen, einigermaßen durchdrungen ist und bis man dann einenText darüber machen kann.Guido GrafNeugier ist ein gutes Stichwort, denn darüber würde ich auch gernenoch sprechen. Einmal nämlich über den Unterschied zwischen demshift, der zwischen Literaturwissenschaft und Literaturkritik pas-siert. Oder anders gesagt: Was passiert da eigentlich? Und dann: Wastreibt Dich eigentlich an? Du hast vorhin von der Systemtheorie alseinem Gebilde gesprochen, das vielleicht geeignet ist, anschlussfähi-ge Erkenntnisse über Texte bereitzustellen. Aber was für Erkenntnis-se,was für Erkenntnisprozesse sind das?Jan DreesEin einfaches Beispiel: Rainald Goetz hat in Klagenfurt eine Rasier-klinge herausgeholt und sich während seiner Lesung in die Stirn ge-schnitten.Während er las, tropfte das Blut aufs Papier. Nachdem dieLesung beendet war, sagte Marcel Reich-Ranicki, Blut hat nichts mitder Bewertung des Textes zu tun. Von da an gab es zwei Fraktionen.Die einen sagten: Das Blut von Rainald Goetz ist wichtig und die an-deren sagten, das Blut ist tatsächlich unwichtig. Man schaue noch-mal auf das, was Marcel Reich-Ranicki direkt im Anschluss der Le-sung gesagt hat. Wenn man jetzt mit der Systemtheorie herangeht,mit der Systemtheorie, die auch für Rainald Goetz wichtig war, dannkommt man auf die Idee der Systemtheorie, die wie gesagt keine ei-gene Literaturtheorie entwickelt hat, aber sich durchaus auch überLiteratur Gedanken gemacht hat, dass Literatur entwederTeil der Ge-sellschaft sein kann – das ist die eine Definition –, Literatur aberauch etwas sein kann,was der Gesellschaft hinzugestellt ist als etwasvollkommen anderes, um diese Gesellschaft zu beschreiben. Es kannsowohl das eine als auch das andere sein. Das Verrückte an der Sys-temtheorie ist, dass sowohl das eine als auch das andere die Differenzdavon,die Einheit ist.Grundsätzlich.Wenn die Systemtheorie sich Li-teratur anschaut, wird Literatur sowohl als das eine als auch das an-dere betrachtet. Wenn die Systemtheorie sich das medizinische Sys-tem anschaut, sagt die Systemtheorie: Das medizinische Systemschaut auf seine Umwelt nach der Frage: Gesund, krank. Das ist eineDifferenz und erst diese Zusammengehörigkeit »gesund, krank«,
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
188 189
diese Differenz beschreibt am besten das System.Umwieder zurück-zukommen zu Rainald Goetz: Wir sind bei der Frage gelandet in derSystemtheorie: Ist die Literatur Teil der Gesellschaft oder ist sie esnicht?Wennmanmit dieser Systemtheorie nun an denText geht, denRainald Goetz gelesen hat – in diesem Text geht es darum, wie er inKlagenfurt sitzt und einen Text liest, und zwar diesen Text liest –,dann merken wir folgendes: Während er sich in die Stirn schneidet,also einen Rissmacht und das Blut tropft, erzählt er davon,wie er sichin die Stirn schneidet und das Blut aufs Papier tropft. Dieses Bluttropft aufs Papier, kann aber in den Text selber nicht eindringen.Wenn man das jetzt alles zusammen sieht und sagt, vielleicht ist jadie Aktion von Rainald Goetz Teil des Textes – und auf so eine Ideekommtman ja nur,wennman sich beispielsweisemit der Systemthe-orie beschäftigt hat –, dann merkt man, dass Rainald Goetz mit die-ser Inszenierung diese nicht zu lösende systemtheoretische Frage-stellung, was Literatur ist, in ein Bild gegossen hat. Wir wissen alsonicht, ob er sich in die Stirn geschnitten hat, weil es im Text steht,oder ob er das in den Text geschrieben hat, weil er sich in die Stirnschneidet. Wir werden es auch niemals lösen können. Und diesesNicht-lösen-können des Rätsels, was einen auch so ein bisschen irremacht, ist das Faszinosum dieser Inszenierung. Also eine Möglich-keit, einen Zugang zu finden, zu Literatur, einen Zugang, der kreativist, auf man möglicherweise selber nicht gekommen ist. WeshalbLeute, die sich nicht mit Systemtheorie beschäftigt haben, damalsnatürlich eher mit Punk-Theorien oder mit Punk-Inszenierung argu-mentiert haben. Beim Punk hat man sich auch ständig irgendwo ge-schnitten und das kann doch Lust sein.Wenn man sich viel mit die-sem Text von Rainald Goetz, mit seinem Debütroman Irre, monate-lang beschäftigt – und das habe ich monatelang tatsächlich gemacht–, dann entdeckt man auf einmal etwas und Nerds wie ich finden dasdann ganz wunderbar, etwas ganz anderes gesehen zu haben als alleanderen.Das ist doch das Schöne in einer Zeit, in derwir auf fast jedeFrage eine Antwort finden, im Internet. Da ist es doch etwas beson-ders Schönes, die Erfahrung zumachen, etwas zu erkennen,was nichtüber Google gefunden werden kann, sondern was nur ich als Leser indiesem Moment gerade als erster entdecke. Das ist die große Lust.Wie ich vorhin sagte: Der Job macht nur Spaß,wenn man dafürwirk-lich brennt. Man muss es lieben und aus diesen Momenten, aus die-sen Erkenntnisaugenblicken eine Lust ziehen. Dann ist es der wun-derbarste Job der Welt. Wir können ja auch nicht verstehen – geradeläuft sehr erfolgreich Queen's Gambit auf Netflix -, wieso sich Men-schen in nahezu jeder wachen Minute eines Tages mit Schach be-schäftigen und deshalb sind auch die dort Dargestellten so gut, weil
sie das eben tun. Die Literaturtheorie hilft einem dabei. Sie kann jaauch ein Geländer sein. Und jetzt haben wir schon sehr viele Bilder.Wir haben die Bilder des Werkzeugkastens, der Brille und des Gelän-ders.Guido GrafIch kann das gut nachvollziehen, weil ich sehr gerne und sehr vielSchach spiele und die Faszination eigentlich darin sehe, dass ein we-sentlicher Motor und auch Erkenntnisprozess darin besteht, etwasim Voraus durchzuspielen, um dann rekursiv festzustellen, funktio-niert es oder funktioniert es nicht? Was Du eben beschrieben hast inBezug auf Rainald Goetz könnte man ja auch als ein rekursives Funk-tionsprinzip beschreiben. Du bist dann letztlich aber bei der Begeis-terung, bei dem Neuen gelandet. Muss man das nicht noch ein biss-chen genauer sagen, was das eigentlich ist? Geht es darum, eine Dif-ferenz zu erkennen, sie überhaupt als eine Differenzwahrzunehmen?Du liest viel, Du liest viele verschiedene Texte und es wird Texte ge-ben, die machen Dich neugierig, es gibt Texte, die ordnest Du ein undes gibt Texte, die interessieren Dich überhaupt nicht.Jan DreesVielleicht gehen wir mal psychoanalytisch daran, wenn wir von derUrmotivation ausgehen. Ich komme nicht aus einem Bildungshaus-halt. Literatur und die Beschäftigung mit Literatur oder mit Litera-turkritik waren das für mich weitest Entfernte zu dem Ort, an demich groß geworden bin. Ein Bücherregal als Mauer. Das ist doch her-vorragend. Deshalb werden Söhne von Metzgern gerne mal Bäcker,um nichts mehr mit Fleisch zu tun zu haben. Das ist die eine Lust,etwas komplett anderes und Eigenes zu machen. Da sind wir wiederbei dem,was ich vorhin gesagt habe.Da ging es ja darum, etwas Eige-nes zu entdecken, was nicht im Internet ist. Aber man kann ja auchetwas Eigenes entdecken, was beispielsweise nichts mit der Kindheitzu tun hat. Darin liegt die Lust, etwas Neues und etwas anderes zuentdecken, etwas, was nicht so naheliegend ist. Naheliegend wäre esgewesen, wenn ich BWL studiert hätte oder eher, wenn ich eine Aus-bildung gemacht hätte als Bürokaufmann oder Industriekaufmann.Ich glaube, dass bei mir die Neugierde eigentlich darin liegt, dass ichetwas anderes sehen wollte. Deshalb ja auch die Kirche. Wie gesagt,ich komme nicht aus einem christlichen Elternhaus, sondern es warerst mal das vollständig Andere. Und dieses Andere fasziniert michimmer noch. Nur jetzt kann ich sagen, es interessiert mich,weil nachfünfzehn Jahren Systemtheorie ich dort nochmal ganz andere Dingeentdecken kann und ichmich in eine Theorie hinein schrauben kann.Es ist eigentlich diese klassische journalistische Neugierde.Die meis-ten Journalistenwerden nicht deshalb Journalisten,weil sie kostenlos
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
190 191
eine Suppe bekommen bei einer Pressekonferenz, sondernweil sie alserste neue Dinge erfahren und bei mir ist diese Leidenschaft auf dieLiteratur gefallen. Sie hätte aber auch genauso gut auf den Sportjour-nalismus fallen können oder auf den Lokaljournalismus, den ich lan-ge gemacht habe. Da habe ich es auch immer interessant gefunden,etwas anders zu erkennen, anders zu sehen als die anderen.Natürlichimmer nur so lange, bis dieser Text, den ich darüber geschriebenhabe, dann in der Zeitung stand. Dieses Neue ist das was bei mir im-mer mit Lust besetzt war, auch in der Zeit, als ich Platten aufgelegthabe. Beispielsweise hat mich interessiert, Musik zu finden, die bis-lang noch nicht gespielt worden ist, Musik, die erst gestern rausge-kommen ist oder noch besser Musik, die in Deutschland gar nichtrausgekommen ist und trotzdem die Leute zum Tanzen bringt. Einwichtiger Nebenaspekt also, nicht einfach nur das Neue zu zeigenwiediese fürchterlichen intellektuellen DJ's, die einen nur langweilen,sondern die Leute damit auch zumTanzen zu bringen und eine Partydaraus zu machen. Genau das versuche ich mit der Literaturkritikauch: etwas Neues zu entdecken und mit diesem Neuen dann eineParty zu veranstalten. Manchmal funktioniert das und manchmalnicht.Guido GrafWovon hängt es ab, dass es funktioniert? Oder anders gesagt – Duhast gesagt, Literaturkritik heißt,Texte überTexte zu schreiben –,wiekommt das Neue in diese Texte über die Texte?Jan DreesWenn ich Literaturkritik mache über ein aktuelles Buch, dann be-komme ich dieses Buch ein paar Monate, bevor es erscheint. Ich be-komme es dann als PDF beispielsweise. Damit hab ich ja schon dasNeue. Und ich kann sofort anfangen zu lesen und weiß fünf Monate,bevor der neueMartinMosebach erscheint,was er uns da zu erzählenhat.Das ist das eine Neue und das muss ich dann interessant machenfür dieMenschen,die ich adressiere. Es ist ja klar, dass ichMartinMo-sebach für das Publikum im Deutschlandfunk ganz anders betrachteals früher, als ich bei 1livewar, zehn Jahre lang,wo ich versucht habe,alles, was wir vorgestellt haben, irgendwie an die Popkultur anzubin-den. Es hätte überhaupt nichts gebracht, einen 10-Minuten-Beitragfür 1live zu machen über Martin Mosebach. Es hätte dort keinSchwein interessiert. Daran liegt es, ob etwas funktioniert oder nicht.Literaturkritik funktioniert nur dann,wenn sie eingebettet ist in denOrt, an dem sie stattfindet. Ansonsten geht sie an den Leuten vorbei.Das ist ja vielleicht auch gar nicht so unwichtig, weil man sich das,wenn man etwa eine Sendung moderiert wie den Büchermarkt, auchimmer wieder klarmachen muss. Was muss ich erklären, damit das
Publikum folgt? Und was darf ich auf gar keinen Fall erklären? Eswäre für das Publikum im Deutschlandfunk wahrscheinlich nichtokay,wennman die ersten fünfMinuten lang erklärt,werDurs Grün-bein ist. Da reichen ein paar Stichworte und die können Durs Grün-bein einordnen. Bei 1live sollte ich es genauer erklären. Nicht weil dieLeute dümmer sind, sondern weil es nicht Teil ihres Diskurses ist.Wenn ichmeine Literaturkritik auf Chinesisch schreibenwürde,wür-de sie auch kaum jemand verstehen.Manmuss es an die Lebenswirk-lichkeit derjenigen anbinden, die man erreichen will. Und es gehtdarum, Sachen möglichst interessant zu verknüpfen. Dann entstehtetwas und so entstehen dann auch immer wieder diese Texte, dieman ja häufig im Feuilleton liest, beispielsweise: »Dies ist der Romanzur Pandemie«. Sowas wird ja durchaus auch über einen Roman ge-sagt, der 200 Jahre alt ist, der von dieser Pandemie nichts wusste unddas zu finden ist interessant. Franz Fühmann, den kennt man kaumnoch, DDR Schriftsteller, hat anhand von Der Mond ist aufgegangenvon Matthias Claudius versucht etwas zu zeigen, etwas, was ich zumBeispiel hochinteressant finde. Nämlich in DerMond ist aufgegangen,in diesem Lied, das wir fast alle kennen, das auch vertont worden ist,wird eine Nacht beschrieben, ein Mond, wird der Wald beschriebenals Kammer. Es wird die Wiese beschrieben und es wird der Nebelebenfalls beschrieben, der aus diesen Wiesen aufsteigt, in dem Waldhoch und der irgendwann die Sterne und denMond verdunkeln wird.Franz Fühmann sagt: Es gibt etwas, was Matthias Claudius nicht ge-wusst haben kann, nämlich dass wir, wenn wir dieses Bild uns an-schauen – Kammer, Wiesen, Nebel, der aufsteigt wie ein Gas – dieGaskammern auf einmal auch sehen. Dass dieses Bild eingefügt wer-den kann in Matthias Claudius DerMond ist aufgegangen, sieht FranzFühmann erst einmal als herausragende Qualität großer Literatur.Gleichzeitig zeigt man damit etwas, was Betrachtung von Literaturim besten Falle leisten kann, nämlich etwas sehr Ungewöhnlichesoder Altes, in dem Fall ja auch vielleicht Verdunkeltes, wieder anzu-binden an die Lebenswirklichkeit der Gegenwart. Das ist doch inter-essant. Lesen wir also Der Mond ist aufgegangen auch als Beitrag zurHolocaust-Literatur. Das ist ein hochinteressanter Text von FranzFühmann, in dem es umMythos undMystik geht, 35 Seiten. So etwaszu entdecken, auf diese Art undWeise zu lesen, ist etwas wahnsinnigBeglückendes,weil es auch zeigt,warum Literatur immerwieder neu,interessant und wichtig ist, weil Literatur uns neue Bilder gibt, neueBilder schafft undwir in der Literatur und schon in der allerfrühestenLiteratur Bilder finden,die uns dannwiederum helfen,die Gegenwartzu verstehen.Wir kriegen die ganze Zeit lang, z.B. jetzt in dieser Pan-demiezeit, Sachen mit, die wir erst mal nicht einordnen können.Aber
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
192 193
mit Hilfe des Mythos können wir sie möglicherweise einordnen. Dasist doch toll. Das ist das Reservoir der Literatur.Guido GrafIch habe das in einem vergangenen Semester versucht, als ich mitStudierenden Boccaccio, zumindest den Anfang des Decameron gele-sen habe, und dazu noch zwei weitere Texte, Kontingenz, Ironie undSolidarität von Richard Rorty und den Roman Das Bastardzeichenvon Vladimir Nabokov.Wir haben uns mit zwei Begriffen beschäftigt:Mitgefühl und Solidarität. Wie funktioniert das? Die Spur, die vonvornherein natürlich durch die Auswahl der Lektüren gelegtwar, zieltganz genau in die Richtung, die Du eben beschrieben hast.Jan DreesEs haben alleDie Pest vonAlbert Camus gelesen, als es losging.Natür-lich stimmt es, dass Die Pest von Albert Camus eigentlich keine Ge-schichte über eine Pandemie ist. Es geht um Algerien in dieser Ge-schichte und um ganz andere politische Verwerfungen.Und dochwardieses Stück Literatur in dem Moment für uns bedeutsam, weil wirMenschen mit Komplexität umgehen müssen, uns Dinge irgendwieerklären müssen. Literatur hilft uns, das einzuordnen. Während wirhier sprechen, ist es zwei Tage her, dass ein alkoholisierter, verwirrterMensch durch die Trierer Innenstadt mit seinem Geländewagen ge-fahren ist und Menschen getötet hat. In der Tagesschau wurden dieBilder gezeigt des Kerzenteppichs in dieser Innenstadt. Der Modera-tor hat gesagt, die Menschen versuchen es zu verarbeiten. Wir glau-ben durchaus, dass es uns tröstet, wenn wir nach so einer fürchterli-chen Sache eine Kerze anzünden, an den Ort gehen und im stillen Ge-denken diese Kerze anzünden und dort hinstellen. Das macht etwasmit uns. Diese Kerze kann aber auch die Literatur sein, das könnenauch Filme sein. Dafür brauchen wir sie. Wir brauchen sie, um nichtirre zu werden. Auch das hat ja diese Pandemiezeit uns allen klarge-macht. Ohne Kultur kommen wir nicht zurecht. Netflix ist auch Kul-tur.WennMenschen zuhausewaren und alles vonNetflix geguckt ha-ben, dann haben sie sich an die Literatur geklammert, um nicht irrezu werden. Das brauchen wir. Es gibt ein Transzendenzbedürfnis desMenschen.Und dieses Transzendenzbedürfnis ist nicht totzukriegen.Kein politisches System hat bislang funktioniert, dass dieses Tran-szendenzbedürfnis missachtet hat.DerMarxismus hat es missachtet.Das hat die Leute irre gemacht. Und der Kapitalismus, der eigentlichgar nicht das bessere System ist, funktioniert, weil er die Transzen-denz mit bedient. Glaube ich. Steile These, aber steile Thesen machenLiteraturkritik auch manchmal interessant.
Guido GrafDie Macht des Kapitalismus in unserem Leben ist die Traurigkeit, soJa, Panik. Das war ein gutes Schlusswort. Vielen Dank für das Ge-spräch.Jan DreesIch danke Dir.
Kritik in der Literatur Kritik in der Literatur
Anmerkungen
Jan Drees: Staring at the sun. Roman. Alibaba Verlag,Frankfurt, 2000.
Jan Drees: Letzte Tage, jetzt. Roman. Eichborn Verlag,Frankfurt, 2006.
Jan Drees: Staring at the sun / Remix. Roman. EichbornVerlag, Frankfurt, 2007.
Jan Drees: Rainald Goetz – Irre als System. Arco Verlag,Wuppertal, 2010.
Jan Drees (mit Christian Vorbau): Kassettendeck:Soundtrack einer Generation. Eichborn Verlag,Frankfurt, 2011.
Jan Drees: Teneriffa. Erzählung. SuKulTur Verlag, Berlin,2013.
Jan Drees: Twitteratur. Frohmann Verlag, Berlin, 2013.
Jan Drees: Lanzarote. Erzählung. SuKulTur Verlag,Berlin, 2015.
Jan Drees: Klagenfurt. Erzählung. Literatur Quickies,Hamburg, 2015.
Jan Drees: Sandbergs Liebe. Roman. Secession, Zürich,2019.
Jan Drees: Fesselspiele. Erzählung. Literatur Quickies,Hamburg, 2019.
194 195
Im ParkGespräch mit Jacob Teich
Die Perspektiven des Lektors Jacob Teich auf die Literatur der Gegen-wart: Jacob Teich wurde 1990 geboren, studierte den Bachelor undden Master am Literaturinstitut Hildesheim. Neben diversen Veröf-fentlichungen in Anthologien hat er Hörspiele und Musik produziertund war lange Zeit Redaktionsmitglied von Litradio. Er ist außerdemMitglied der Akademie für Letalität und Lösungen und seit einigenJahren ist er Lektor im Suhrkamp Verlag.
Jacob TeichEs gibt ein persönliches Interesse an Literatur, und dann gibt es dieFunktion, die ich als Lektor erfülle, die nochmal eine andere ist. Aberich für mich würde sagen, dass es irgendwann mal in meinem Lebenein Erlebnis gab, bei dem ich festgestellt habe, Literatur gibt mir was,was ich woanders nicht finde, gibt mir Halt oder ich sehe da Erlebnis-se, Erfahrungen, die ich sonst nicht gemacht habe oder gemacht hät-te, die mich aber bereichern. Ich sehe, dass es jemand anderem auchso wie mir geht, kann mich identifizieren. Das sind für die eigene So-zialisation die wichtigen Schlüsselmomente. Als Lektor versuche ichnochmal einen Schritt dahinter zu kommen. Natürlich, es gibt Texte,die mich genauso begeistern, und das ist immer noch sehr wichtig.Aberman versucht natürlich auch ein bisschen analytischer ranzuge-hen und zu gucken: Was wollen wir gern machen, was können wirmachen? Hier gibt es vielleicht einen Text,von dem ich nur zu 95 Pro-zent begeistert bin, aber könnte der nicht doch passen? Oder gibt eseine Kollegin, die zu 100 Prozent davon begeistert ist?Guido GrafBegeisterung für den Text heißt ja eigentlich, dass die Richtung vondemText vorgegebenwird.Wobei es vermutlich immer ein Dialog ist,der stattfindet, weil auch das Missverhältnis konstitutiv ist. Es kom-men immer mehr Texte zum Verlag, als der Verlag jetzt realisierenkönnte. Insofern spielt die Frage der Auswahl eine große Rolle. AberDu hast jetzt eben von der Begeisterung gesprochen. Ist das die Be-
196 197
geisterung, die sich immer wieder neu ausrichtet? Je nachdem, wasgerade auf Deinem Schreibtisch liegt.Jacob TeichEs gibt bestimmte Themen, auf die ich anspringe. Genauso wie es be-stimmte Themen gibt, auf die meine Kolleginnen anspringen, undman sicher Profile erstellen kann, was zu wem am besten passt. Aberich würde schon sagen, dass sich diese Begeisterung immer wiederneu ausrichtet. Das ist der schönste Moment, wenn man die Manu-skripte, die wir bekommen, liest – und man liest eine ganze Menge –und irgendwann merkt man, jetzt passiert hier etwas, das hätte ichvorher gar nicht erwartet. Jetzt spricht mich etwas an, jetzt bleibe ichbei der Stange, jetzt will ich mehr davon wissen. Dann will ich dasManuskript zu Ende lesen und wissen,wer das geschrieben hat, ob esnochmehrTexte gibt,was es da noch so drumherum gibt.Und das ist,was vom Text ausgeht. Der Suhrkamp Verlag ist ein literarischer Ver-lag, und wir machen ein sehr literarisches Programm. Das heißt, esgeht uns immer auch um die Verschränkung von Inhalt und Formund um die Sprache, die ein Text findet. Ich bin da nicht so sehr the-men- oder inhaltsgesteuert und denke, Hauptsache es kommt jetztein kleiner Hund vor, denn wenn ein kleiner Hund vorkommt, ma-chenwir das auf alle Fälle.Meistens ist es die Sprache, die etwas Eige-nes mitbringt und zu begeistern weiß. Das richtet sich immerwiederneu aus.Guido GrafGibt es auch mal die Situation, in der man sagt, uns fehlt eigentlichnoch ein Titel im Programm, der zum Beispiel den kleinen Hund hat?Jacob TeichEs gibt die Momente. Aber es gibt immer vor allem die Vorstellungeines Ideals, das man im Kopf hat.Wir sagen etwa,wenn wir über dasnächste Programm nachdenken, dass wir gern mindestens genausoviele FrauenwieMänner darin hätten,vielleicht auchmalmehr Frau-en als Männer, oder auch gern ein gutes Verhältnis von Jung und Altund verschiedene Hintergründe. Also achten wir darauf, dass Titel,die zu ähnlich sind, sich nicht gegenseitig imWeg stehen.Aber das istdas Verhältnis von Ideal und die Praxis. Man steckt viel Planung hin-ein, aber es gibt – und das ist auch wieder der Literatur geschuldet –Autor:innen, die ihre Abgabefrist reißen, weil sie eben noch nicht soweit sind. Und auf einmal fängt man an, das Programm umzubauenund vielleicht sogar auf den kleinen Hund zurückzukommen. Nichtimmer hatman ihn,nicht immer findetman ihn undmussman dannanders weitergehen, ohne kleinen Hund.
Guido GrafKannst Du anhand eines Beispiels einen solchen Begeisterungspro-zess erzählen?Jacob TeichDer letzte Roman, bei dem das so war und der jetzt auch schon er-schienen ist,war Park von Marius Goldhorn.Marius und ich kanntenuns schon aus dem Studium. Tatsächlich hatten wir uns dann aberaus den Augen verloren. Irgendwann kam er und sagte: Ich habe hierauch ein Manuskript. Ich bin fertig mit meinem Roman. Lies dasdoch mal! Nach den ersten zwei, drei Seiten war ich noch skeptisch,viele kurze Sätze, irgendwie wiederholte sich immer »Arnold sagte,Arnold machte, Arnold tat dies« und so weiter. Und ich dachte, daswird aber zäh. Dann aber ist das umgeschwungen. Mit dieser Form,die auf den ersten Blick etwas nervig wirken könnte, will er was, unddamit macht er auch was. Es geschieht noch mehr, als dass er nurmitWiederholungen arbeiten würde oder nurmit kurzen Sätzen. Unmit-telbar darauf folgte auch der Moment, dass ich mir vorgestellt habe,wie kann ich andere davon überzeugen, dass das gut ist? Welche Ar-gumente habe ich hier im Verlag dafür? Welche Argumente könnenwir dann als Verlag an Buchhandlungen und so weiter mitgeben? Dageht dann die Maschine im Hinterkopf an. Man fängt an darübernachzudenken.Aber ich habe auch gemerkt, es gibt noch etwas ande-res, was mehr als die Summe der Teile ist. Es hat mich berührt, ist inin mich eingedrungen, auf eine weniger intellektuelle Art, und ichhabe das dann gelesen und war völlig geflasht. Ich wusste, das müs-sen wir machen. Da würde ich gern der Lektor sein.Guido GrafDu sprichst eigentlich von einer Reihe von Kriterien, die sich auf For-men, auf Sprache, Gestalt abbilden, genauso von weiteren, die etwasmit dem ökonomischen Kontext, in demman sich bewegt, zu tun ha-ben.Geht es darum,diese Kriterien immerwieder neu zu überwindenoder sie auszufüllen?Jacob TeichEs gibt kein Schema F, das wir haben, keinen klaren Kriterienkatalog,von dem wir sagen, wir machen im Suhrkamp Verlag nur Bücher mitlangen Sätzen, und dann kommt eben dieses Manuskript nur mitkurzen Sätzen und deswegen können wir das nicht. Das ist immerwieder etwas, das in Bewegung ist, verhandelt wird, ausgehandeltwird, was ich auch am schönsten finde, wenn wir uns im Haus dar-über austauschen.Dann habe nicht nur ich gelesen, sondern ich sage,schaut euch das an, und dann tauschen wir uns darüber aus. Erst da-bei finden wir Kriterien. Wir verhandeln das und stellen Kriterien
Im Park Im Park
198 199
fest, die zumTragen kommen.Das können formale Kriterien sein, dieSprache, die Themen.Guido GrafVersichert sich dieses gemeinschaftliche Aushandeln der Kriterienfür dieses Buch oder geht es dabei auch darum, Schnittmengen zufinden, die repräsentativ sind?Jacob TeichZum einen gibt es Schnittmengen, was die Vorstellungen vom Verlagangeht. Natürlich fragen wir: Welches Profil haben wir als Haus ei-gentlich? Was passt gut dazu? Wir kommen dann auch mal zu demSchluss, dass wir einen Text haben, der stark ist, sich seinerMittel be-wusst, dessen Thema toll ist, aber der bei uns nicht so richtig passt,weil er zwischen die Stühle fällt. Und dannwürden wir nicht gut dar-an tun zu sagen, wir machen das trotzdem, weil es gewisse Erwar-tungshaltungen gibt. Die dann zu unterlaufen könnte vielleicht derfalsche Start bei einem Debüt sein. Eine andere Frage wäre: Wasmöchten wir in die Öffentlichkeit, in die derzeitige Gesellschaft hin-eingeben? Was sind gerade relevante Themen, die uns alle hier imHaus, aber auch darüber hinaus angehen?Guido GrafWas waren das bei dem Buch von Marius für Themen?Jacob TeichDiese kurzen Sätze kommen z. B. nicht von ungefähr, sondern daspiegelte sich der Umgang mit den neuen Medien, die ganze Zeit on-line zu sein, das Smartphone bei der Hand zu haben. Das war für unsalle ein Text, der das das erste Mal sehr natürlich verhandelt hat.Nicht, indem er es herausgestellt hat und gesagt hat: Ich bin ein Textüber das Internet, sondern die Hauptfigur hat sich einfach in dieserWelt ganz natürlich bewegt. Sonst merkt manmanchmal,wie schweres noch in der Literatur ist,wenn alle Möglichkeiten da sind,weil dasSmartphone da ist.Wolfgang Herrndorf hat mal in Bezug auf Tschickgesagt, glaube ich, dass er als Erstes das Handy töten musste, damitdie beiden Protagonisten überhaupt losfahren können. Und in Parkist das Handy ganz selbstverständlich da. Damit passiert etwas, undman weiß gar nicht mehr so genau, kommen die kurzen Sätze ausdem Internet oder von der Figur undwie hängt das eigentlichmitein-ander zusammen?Guido GrafDas Bild, das Du gerade entwickelt hast, trifft vermutlich auf vieleVerlage zu, die eine ähnliche Ausrichtung oder Größenordnung ha-ben, aber es geht darin ja auch um so etwas wie eine gemeinschaftli-che Idee von Literatur. Eine, die nicht notwendig auf Verleger:innen-
Persönlichkeit fixiert ist oder auch nur auf eine bestimmte Autor:in-nenfigur, sondern dass eine Reihe Menschen zusammenkommen,um das,waswirmeinen,wennwir Literatur sagen,überhaupt erst zu-stande kommen zu lassen.Jacob TeichDas ist ein Wandel, der sich in den letzten Jahren vollzogen hat, dasses diese starken Verleger-Persönlichkeiten nicht mehr gibt. Das istschon ein großer Unterschied zu Siegfried Unseld, den ich selbstnicht mehr erlebt habe. Aber es ist ohnehin die Zeit, in der manschaut, welche Gruppen, welche Menschen kommen wo zu Wort,können wo und wie ihre Geschichten erzählen. Ich bin sehr dankbardafür, dass es diverser geworden ist. Es kann auch immer noch diver-ser werden, aber Welt ist komplex, Welt hat viele Themen, hat vieleMenschen mit vielen Hintergründen, und es wäre doch schade,wennwir die nicht abzubilden versuchen.Guido GrafWie wichtig sind dann noch die Kategorisierungen, die sich im Pro-gramm, aber auch in der Struktur des Verlags abbilden? Zu unter-scheiden zwischen deutscher Literatur, fremdsprachiger Literatur,zwischen Theorie, Sachbuch,Wissenschaft?Jacob TeichDas ist natürlich dem geschuldet,wen wir damit am ehesten anspre-chen. Jemand, der ein stw, also Suhrkamp Taschenbuch WissenschaftzurHand nimmt, ist vielleicht nicht so sehr daran interessiert,was imHauptprogramm bei uns an literarischen Titeln erschienen ist. Es fin-den Vermischungen statt, aber es gibt ganz klar Menschen, die sichfür die Literatur interessieren, und solche, die sich nur für Sachtexteinteressieren. Teilweise gibt es da gar nicht so viele Überschneidun-gen. Für das Organisatorische im Haus ist es auch einfacher zu be-stimmen, wer für die deutschsprachige Literatur zuständig ist undwer für die internationale Literatur. Ichmuss beispielsweise nicht an-fangen, Englisch, Französisch, Spanisch oder noch eine andere Spra-che zu lesen. Da sind die Aufgaben einfach klar verteilt.Guido GrafKlar, aber ich frage auch deswegen, weil dieses Buch von MariusGoldhorn in der Edition Suhrkamp erschienen ist, einer Reihe imVer-lag, die gerade nicht diese Unterscheidungmacht, die sowohl literari-sche Texte wie auch wissenschaftliche Texte, Essays, sehr freie For-men beinhaltet.Jacob TeichAuch da wirken unterschiedliche Menschen mit, die eben die ent-sprechenden Hintergründe haben. Dass wir uns hier wie da mit der
Im Park Im Park
200 201
deutschsprachigen Literatur auseinandersetzen, heißt dann, dass dasich so ein Titel wie Park von Marius Goldhorn mache, der aber ausguten Gründen in der Edition erscheint.Guido GrafWas wären diese guten Gründe?Jacob TeichIm Prinzip das,was Du gesagt hast. Uns erschien das Umfeld der Edi-tion als das Passende. Seien es literarisch ambitionierte Titel, die inder Edition erschienen sind, die freie Formate haben oder freiere For-mate als die Romane oder die Lyrik, die wir im Hauptprogrammma-chen. Aber auch das theoretische Umfeld, Sachtexte, die da erschie-nen sind, junge, ambitionierte Autor:innen sowohl der Theorie alsauch der Literatur bestimmen dieses Umfeld.Guido GrafWas für Nachbarschaften sind z. B. für den Text von Marius wichtig?Jacob TeichTitel, die ich jetzt im Kopf habe, stehen nicht direkt neben Park vonMarius Goldhorn. Aber das sind Titel wie Eiscafé Europa von EnisMaci, die Essays geschrieben hat, die aber auch auf eine sehr natürli-che Art diesen Netzgedanken in sich tragen, in gewisser Weise ausdem Internet kommen und dadurch nochmal eine Form angenom-men haben, die sich von anderen klassischen Essays unterscheidet.Das ist z. B. so eine Nachbarschaft, die ich sehe, aber auch das Buchvon Paul B. Preciado, bei dem es um Identität und geschlechtlicheIdentität geht. Auch das ist ein Thema, das ich bei Marius angelegtfinde. Das sind die guten Nachbarschaften, die man da sehen kann.Guido GrafDas ist eigentlich auch eine gute Beschreibung dessen, was ich mitdieser Vorlesung verfolge. Es sind genau solche Nachbarschaften, diemit einer Selbstverständlichkeit einhergehen, nicht weil man siedazu erklärt, sondern EnisMaci ist ein Beispiel in Bezug auf Texte, diesich nicht entscheiden müssen, diese Vielfalt nicht als Ambivalenzverstehen, sondern als Vielfalt in Form und Inhalt umsetzen. Ich hat-te zunächst mit dem Text von Marius auch Schwierigkeiten. Aber ichlerne viel darüber,wie auf einer formalen Ebene etwas funktionierenkann. Das galt auch für Texte, die ich früher schon nicht verstandenhabe, als er noch bei uns in Hildesheim studiert hat. Gibt es,wenn DuDeine Tätigkeit bei Suhrkamp überschaust, mehr davon? Siehst Dueine gewisse Kontinuität in solchen Titeln, ist dieses Relevanzpoten-zial ein Kontinuum,was Du wiederfindest?
Jacob TeichWenn wir in dem Sinne von Relevanz sprechen, dass wir überlegen,für wen wir das machen, welche Menschen das lesen sollten, ob daswichtig ist für eine Gesellschaft, dann würde ich sagen, dieses Konti-nuum gibt es auf alle Fälle. Das Schöne dabei ist, dass ich Titel ge-macht habe und jetzt gerade mache, die sehr unterschiedlich sind inihren Zugriffen, auch sprachlich, die natürlich auch bestimmte As-pekte immer in den Blick nehmen, aber die am Ende doch dadurchgeeint werden, dass sie wichtige Themen bearbeiten. Sei das wie beiMarius der Umgang mit dem Netz, aber auch der Umgang miteinan-der, oder sei es Benjamin Maack, der über seine Depression geschrie-ben hat und mentale Gesundheit in den Blick nimmt. Sei es StephanLohse, der in Johanns Bruder ein Brüderpaar beschreibt, das auf denSpuren Adolf Eichmanns unterwegs ist. Es sind immer sehr unter-schiedliche Themen, unterschiedliche Zugänge. Aber ich glaubeschon, dass es Bücher sind, von denen wir hier sagen würden, dass siegesellschaftlich und politisch wichtig sind, die etwas in den Blicknehmen, was noch fehlt, wo wir eine Unwucht wahrnehmen, oderweil das nicht untergehen sollte.Guido GrafWas liest Du außer den Manuskripten, die Du für Deinen Beruf lesenmusst?Jacob TeichAlso ich lese – und das ist sicher eine »Grauzone« – viel Gegenwärti-ges, deutschsprachige Gegenwartsliteratur anderer Verlage. Manu-skripte, die wir gar nicht erst angeboten bekommen haben, weil derVerlag schon feststand. Das ist eigenes Interesse, aber auch der Ver-such, die Verlags- und Literaturwelt im Blick zu behalten. Ich lese ge-nauso fremdsprachige Literatur.Aber ich lese tatsächlich sehr viel Li-teratur und eigentlich so gut wie keine Sachbücher und auch wenigUnterhaltungstitel.Guido GrafIch habe es lange Zeit als eine gewisse Einschränkung empfunden beieigentlich größtmöglicher Freiheit, als ich früher das BüchermagazinGutenbergs Welt auf WDR 3 gemacht habe, über viele Jahre ständigGegenwartsliteratur zu lesen. Ich habe immer viel gelesen, aber dannals Literaturkritiker und als Redakteur immer mit einem Verwer-tungsblick gelesen: Ist das was für die Sendung, wer könnte das be-sprechen odermit wem könnte ich darüber reden usw.Dann habe iches als Erholung empfunden,wenn ich etwas von Niklas Luhmann ge-lesen habe oder von Derrida. Kennst Du das auch, diese Betriebsfi-
Im Park Im Park
202 203
xiertheit, erlebst Du das auch als Einschränkung oder eine gewisseScheuklappenhaftigkeit?Jacob TeichZum Glück noch nicht. Meine Grundhaltung gegenüber allem, wassehr stark Betriebsgeruch annimmt, ist eher skeptisch, obman z. B. sosehr Konkurrenzen im Kopf haben sollte, ob man nach Zahlen gehtoder nachwelchen Zahlen,wie dawer taktiert.Das sind Dinge des Be-triebs, die mir nicht angenehm sind, sodass ich die auch nicht inmei-ne private Lektüre lasse. Zum anderen kann ich Bücher, die ich privatlese, und auch wenn es jetzt irgendwie Gegenwärtiges ist, lesen, ohnesie zu lektorieren, ohne sie verkaufen zu wollen oder andere Dingedamit anstellen zu wollen. Ich kann auch gut ein Buch eines anderenVerlags hernehmen und das lesen,weil es mich interessiert. Ich kanndavon auch begeistert sein.Guido GrafKennst Du Leute im deutschsprachigen Gegenwartslektorat, die sichauch mit Theorie beschäftigen?Jacob TeichDiese Bereiche sind sehr spezialisiert geworden, immer ausdifferen-zierter, und dadurch wird es schwieriger, den Überblick zu behalten.Eigentlich könnteman immer noch einManuskript lesen.Davon gibtes einfach sehr viele.Man könnte immer einen Konkurrenztitel lesen,und ich habe den Eindruck, dass wir schon sehr bei unseren Dingenbleiben. Ich weiß von einer Kollegin, die feministische Theorie liest.Aber ich habe schon den Eindruck, dass alle schon bei ihrem Gebietbleiben.Guido GrafIch frage auch, weil es z. B. für Übersetzer wichtig ist, dass sie, wennsie einen Text aus der einen in die andere Sprache übersetzen, sichWissensgebiete heranziehen und dannmanchmal auf entlegene The-men hinaus müssen. Und mir scheint schon, wenn ich in die Alters-gruppe von Marius Goldhorn oder Dir schaue, dass da viel Theorie-wissen vorhanden ist, das aber eher eklektizistisch gebraucht wird.Enis Maci hast Du erwähnt, Pascal Richmann hat dergleichen in sei-nem Buch Über Deutschland, über alles en passant auch unterge-bracht. Ich nehme es als eine gewisse Durchlässigkeit wahr, gegen-über dem,was ich als theoretisches Wissen bezeichne, so wie es auchumgekehrt Texte gibt, wie etwa ein Verlag wie Merve sie publiziert,die dann wiederum auch durchlässig sind für Formationen, die manmindestens als literaturähnlich bezeichnen könnte.
Jacob TeichMir fallen auch noch andere Namen ein,Ann Cotten etwa, die zuletztErzählungen veröffentlicht hat, davor bei uns ein Versepos, fürMervehat sie übersetzt. Das könnte auch so eine Figur sein, die tatsächlichso eine Durchlässigkeit hat und sich mit vielen Dingen beschäftigt,mit Theorie und Literatur. Wenn solche Dinge aber en passant ge-dropptwerden,wirdmir das zunehmend unangenehm.Und zwar im-mer dann, wenn ich den Eindruck habe, dass da jemand eigentlichnicht so richtig weiß,wovon gesprochenwird.Da finde ich es mittler-weile für mich viel attraktiver zu sagen: Ah, Entschuldigung, ich ken-ne diese Theorien nicht, ich weiß nicht, von wem du sprichst. Als Ro-land Barthes im Studium das erste Mal auftauchte und der Name danur geschrieben stand, wusste ich nicht, wie man den Namen auss-pricht. Diese Momente, in denen andere davon ausgehen, dass mandiese Dinge weiß, die werden mir zunehmend unangenehm,weil ichnicht davon ausgehen kann, dass jemand einen bestimmten Bil-dungsgrad hat, oder selbst wenn er den hat und auch Geisteswissen-schaften studiert hat, dass man diesen oder jenen Theoretiker gele-sen hat. Ich mag es nicht mehr, so voraussetzungsreich zu sein unddann zu sagen, wir wissen ja alle, wovon wir hier sprechen. Lieber er-kläre ich eine Sache einmal mehr. Für die, die es wissen, ist es eineMinute verschenkte Lebenszeit, aber für die, die es nichtwissen, ist esschöner, inkludierend zu sein und Menschen abzuholen.Guido GrafInkludieren finde ich gut, »abholen« aber finde ich einen ganzfurchtbaren Begriff. Menschen sollte man nicht abholen, das ist ei-gentlich noch nie eine gute Idee gewesen.Jacob TeichAber man kann ihnen ja Brücken bauen.Guido GrafJa, genau.Aber der Punkt ist natürlich gut und wichtig, also genau zuunterscheiden zwischen dem autoritären Gestus, dermit Namedrop-ping verbunden ist oder mit dem Droppen von Begriffen, die mannicht erklärt, sondern voraussetzt und damit andere exkludiert. Aberes gilt auch, einen solchen autoritären Gestus zu unterscheiden vondieser Durchlässigkeit, die Du anhand von Ann Cotten beschriebenhast.Monika Rinckwäre auch noch eine Dichterin, die dafür beispiel-haft wäre,wie man ohnehin in der Lyrik sehr viel mehr findet,wo die-se Durchlässigkeit mit der größeren Selbstverständlichkeit da ist, alsdas in Romanen passiert.
Im Park Im Park
204 205
Jacob TeichEs gibt schon auch Romane, bei denen ich den Eindruck habe, dasfließt viel ein. Ich hatte ja schon Johanns Bruder von Stephan Lohsegenannt. Da machen die Figuren sich auf den Weg und folgen AdolfEichmanns Spuren. Das hat auch mit viel Recherche zu tun.Was Duin Bezug auf das Übersetzen gesagt hast, dass man sich bestimmteWissensbestände aneignen muss, trifft für uns Lektor:innen tatsäch-lich auch zu.Wir machen einen Faktencheck, so gut wir das können,und versuchen, die Dinge nachzuvollziehen. Und da setzt man sichmit den kuriosesten Dingen auseinander, weil sie in einen solchenText eingeflossen sind. Mir scheint das auch eine spannende Ent-wicklung in der Romanliteratur, das etwas in die Fiktion hineinge-holt und beobachtet wird:Wo sind Grenzbegegnungenmöglich? Gibtes Grenzen?Wie kann man sie verwischen? Das findet auch in Roma-nen statt.Guido GrafDu hast eigentlich schon ziemlich zeitig angefangen zu lektorieren.In welchem Semesterwarst Du, als Du das erste Mal für die Landpar-tie Lektorat gemacht hast?Jacob TeichWir haben im Studium ab dem ersten Semester lektoriert. Es gab dasTutorium, wo ich das erste Mal mit Textarbeit konfrontiert wurde.Seitdem ging es immer gemeinschaftlich hin und her. Ich habe nieeine Textwerkstatt besucht während meines Studiums, jedenfallskeine offizielle. Aber bei uns im WG-Wohnzimmer haben immerTextwerkstätten stattgefunden, sei es für die Landpartie oderweil je-mand einen Text geschrieben hatte, der irgendwo eingereicht werdensollte. Manchmal denke ich auch, dass ich das Lektorieren eher vonmeinen Kommiliton:innen gelernt habe als von den Lehrenden.Guido GrafKannst Du Momente finden und gar rekapitulieren, die für Dich die-sen Lernprozess repräsentieren? Wo hast Du gemerkt, dass Du dasgerne machst?Jacob TeichAnfangs habe ich festgestellt, dass, wenn andere über meinen Textsprechen, ich das ziemlich schwierig finde. Aber es hat mir wahnsin-nig viel Freude bereitet, über andere Texte zu sprechen.Während desStudiums war ich überhaupt nicht vertraut mit Korrekturzeichenoder dergleichen. Ich habe immer sehr viel neben den Text geschrie-ben und erklärt, warum ich an einer Stelle ein anderes Wort verwen-den würde, das den Rhythmus besser macht. Meine Änderungsvor-schläge standen da in sehr kleiner Schrift, und daneben habe ich
kommentiert, um zu begründen, warum ich das mache. Das hat mirvon Anfang an viel Freude gemacht. Ansonsten ist das ein Lernpro-zess, der noch nicht beendet ist. Durch das Lektorieren hier imVerlagund die Auseinandersetzung mit Autor:innen, die ihre eigenen Krite-rien mitbringen, ihren eigenen Anspruch haben, kommen bei mirauch Dinge in Bewegung, und ich sehe Neues. Ich sehe Dinge auf ein-mal anders. Sonst gab es nur einzelne Sätze, von denen ich leidernicht mehr weiß, wer sie wann zu mir gesagt hat. Aber es gab nichtdiese Creative-Writing-Regeln wie »Kill your darlings« oder Ähnli-ches.Die kenne ich schon, aber daswar dann so etwaswie »einmal istkeinmal«. Das hat jemand gesagt in einem Theaterzusammenhang:Wenn auf der Bühne einmal was passiert, dannwäre es keinmal.Manmüsste das schon häufiger machen, damit es als Regel oder Elementdes Stücks erkennbar ist. Das ist etwas, was mir manchmal in denKopf kommt, dass ich in einemText was lese und sehe, hier schert derText aus.Wenn er aber nur einmal ausschert, dannwirkt das eher feh-lerhaft als bewusst gesetzt.Guido GrafGibt es ein Buch, das Du gerne lektoriert hättest?Jacob TeichViele. Es gibt die, bei denen es besonders schmerzhaft ist,weil wir sieauch auf dem Schreibtisch hatten,diewir gelesen haben und gern ge-macht hätten, sich dann aber die Autorin oder derAutor für einen an-deren Verlag entschieden hat. Es gibt auch andere Bücher, bei denendas gar nicht zur Frage stand. Aber vielleicht wären die auch nichtmehr so toll, wenn ich sie tatsächlich lektoriert hätte, weil ich dannweiß, wie viel Arbeit es war da hinzukommen. Dann ist es schöner,einfach nur zu lesen.
Im Park Im Park
AnmerkungenMarius Goldhorn: Park. Roman. Berlin: Suhrkamp,2020.
206 207206 207
superfetteSPRACHINSTALLATION.
Thomas KlingGespräch mit Marcel Beyer
Thomas Kling war ein Dichter, der eine ganze Generation von ande-ren Dichtern geprägt hat und für die deutschsprachige Lyrik der Ge-genwart außerordentlich wichtig war. Ich spreche mit Marcel Beyer,einem anderen Dichter und Schriftsteller, ein paar Jahre jünger alsKling, der wiederum für seine Generation genauso wichtig ist mit sei-nen Romanen undmit seinen Gedichtbänden.Der letzte BandDämo-nenräumdienst ist 2020 erschienen. Ebenfalls 2020 erschien eine ers-te umfassende Ausgabe derWerke Thomas Klings mit allen Gedichtenund Essays sowie zahlreichen Veröffentlichungen aus dem Nachlass.Herausgeber derWerkausgabe ist Marcel Beyer.
Marcel BeyerIch gebe die nicht allein heraus. Ich bin zwar der offizielle Haupther-ausgeber, intern aber eher der Moderator. Ich musste also alle Fädenim Blick halten.Aber eigentlich sind wir zu viert.Wir haben vier Bän-de gemacht und jeder von uns vieren hat sich einen Band ausgesucht,für den er oder sie so die Verantwortung übernommen hat.Das ist fürBand eins, für frühe Gedichte bis 1991, bis zum Gedichtband brenn-stabm Gabriele Wix; dann für die Gedichtbände der 90er Jahre PeerTrilcke; den dritten Band Gedichte 2000 bis zu Thomas Klings Tod2005 und Gedichte aus dem Nachlass habe ich übernommen; undden vierten Band, den umfangreichsten Band mit Essays und eigent-lich mit allem,was nicht Gedicht ist, gibt Frieder von Ammon heraus,der sich schon vor vielen Jahren mal in einemAufsatz gewünscht hat,es sollte doch einmal die gesamte Essayistik von Thomas Kling ge-sammelt werden. Jetzt gibt es die.
208 209
Guido GrafDie Essays sind eine wahre Fundgrube von Sachen, von denen ichnicht mal eine Ahnung gehabt hätte, dass sie existieren. Aber zu-nächst mal zum Ratinger Hof.Warum ist das eigentlich ein nicht nurals Ort, sondern jetzt auch mit mit dem,was Thomas Kling dafür ge-schrieben hat, so bedeutend?Marcel BeyerMan kann mit dem Ratinger Hof einen Punkt festmachen in dieserunglaublich lebendigen und produktiven Szene Düsseldorfs und desRheinlands Ende der 70er und Anfang der 80er Jahre, wo Musik undBildende Kunst, in Düsseldorf auch High-Society-Publikum zusam-menkamen.Thomas Kling ist zwar in Bingen geborenworden,wo sei-ne Verwandtschaft herkam, mütterlicherseits im Sommer 1957, aberer ist in Düsseldorf aufgewachsen mit seiner Mutter und seinenGroßeltern mütterlicherseits, die beide sehr wichtig für ihn waren.Sein Großvaterwar promoviert, ein großer Leser und hat immer klas-sische deutschsprachige Moderne gelesen. Da hat Thomas Kling sichschon als Schüler am Bücherregal bedient, ist dann irgendwann, wieman das eben macht, in der Jugend ausgegangen und hat sehr früheinen sehr guten Riecher gehabt für die Orte, wo wirklich was pas-siert,wo interessanteMenschen zusammenkommen.Er gehörte auchzum Stammpublikum einer Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt: Ra-tinger Hof. Ratingen ist ein Ort im Umkreis von Düsseldorf. Der Ra-tinger Hof ist fünf Minuten Laufweite von der Kunstakademie ent-fernt. In dieser Kneipe ist aus der Punk-Bewegung heraus auch eineneue Art des Ausgehens und Feierns entstanden. Das war ein Ort, woman, wenn man im Kino war oder im Konzert, nachher noch hinge-gangen ist.Musiker kamen auch dorthin.Thomas Kling war in diesenKunst- und Musikkreisen einer der wenigen, der ganz dezidiert ausder Literatur kam.Thomas hat schon ganz früh angefangen,Gedichtezu schreiben. 1973 sind die ersten Gedichte entstanden, die wir heutekennen, und er kam nicht nur aus der Literatur, war also in diesenfreakigen Kreisen noch mal wieder ein Freak – »was will denn so einBücherwurm hier« –, sondern hatte eine ganz starke Persönlichkeit,einen starken Auftritt. Das war das eine. Auf der anderen Seite besaßer eine ungeheure Fähigkeit, Menschen zuzuhören. Das ist ja unterKünstlern nicht so verbreitet. Man arbeitet vor sich hin im Atelier.Aber dass jemand ins Atelier kommt und ein sehr konkretes Gesprächüber die künstlerischeArbeit führt, ein Gespräch, das kunsthistorischenorm bewandert ist – Thomas Kling konnte zwischen den Jahrhun-derten und zwischen den Epochen immer ganz schnell Verbindungenziehen –, war etwas, was die bildenden Künstler sehr an ThomasKling angezogen hat, so dass er auch früh gefragt wurde von jungen
Künstlern, und nicht nur Gleichaltrigen – er war zum Beispiel auchbefreundet mit Sigmar Polke –, ob er nicht in seiner Art zu schreibeneinen Katalogbeitrag schreiben wolle. Er ist also auf der Szene, wieman damals noch sagte, in den unterschiedlichsten Bereichen unter-wegs gewesen. Er hatte mit Musikern zu tun,mit Frank Köllges etwa,der damals schon eine Legende war, als Thomas Kling noch ein tota-ler Newcomer war. Dieser legendäre Schlagzeuger, Dirigent und Or-chesterleiter Frank Köllges fing nun auf einmal an, mit ihm zusam-menzuarbeiten, einfach weil der Ratinger Hof so ein Treffpunkt war.Auch die Leute von der Zeitung gingen da hin. Thomas Kling hatteschon früh in seiner Jugend in Düsseldorf an einer Zeitschrift mitge-arbeitet, die Zwiebelzwerg hieß. Da war er Literaturredakteur und hatTexte geschrieben, informativ über Dada Berlin, über Richard Huel-senbeck, über García Lorca, aber auch eine hinreißende BesprechungvonDer Butt von Günter Grass oder über Klaus Kinski. So hat ThomasKling, weil er so offen in alle Richtungen war, auch anknüpfen kön-nen. Und wenn er Geld brauchte – erwar auch eine Art Dauerstudent–, konnte ermit dem Redakteur der Rheinischen Post, der großen Zei-tung am Ort ins Gespräch kommen, und wurde vom einen Tag aufden anderen Filmkritiker für die Rheinische Post. Fortan ging er im-mer ins Kino und besprach laufende Filme, gerne auch Filme, dieman heute als Trash bezeichnen würde.Guido GrafDie sind auch in diesem vierten Band derAusgabe enthalten,wo mandann über Chuck Norris oderClever und Smart, aber auch überGérardDepardieu lesen kann. Erstaunlich finde ich, dass er jedes Mal ohneHemmungen und mit sehr viel Mut zum entschiedenen Wort Positi-on bezieht und keine Scheu hat, irgendwas als den Schrott zu be-zeichnen, der er ist.Marcel BeyerDass er urteilsfreudig war, ist auch etwas, was Menschen immer fas-ziniert hat an Thomas Kling. Er hat aber sein Urteil auch immer sehrgut begründen können. Er hat nicht herumlaviert, das hat ihn nichtinteressiert. Er hatte die Haltung, dass man Position beziehen muss.Ich finde selbst in diesen Filmkritiken, die ja wirklich viel auf Pointegeschrieben sind, merkt man seine Bühnenerfahrung. Er hat schonals SchülerTheater gemacht. Erwusste,wennmanman die Bühne be-tritt, muss man sofort das Publikum fesseln. Entsprechend auch mitdem ersten Satz der der Filmkritik muss man das schaffen. In Aufsät-zen und Vorträgen hat er das auch immer gemacht. Man hat nichterst mal fünf Minuten Zeit, damit das Publikum sich an einen ge-wöhnt hat. Dieses Arbeiten auf den Punkt und dieses Pointensetzenfindet man in seinen Gedichten, das Umspringen von Sphären und
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
210 211
Milieus in andere Milieus, das findet man in den Brotarbeiten undauch in seinen großen Essays.Guido GrafDu bist ein paar Jahre jünger als Thomas Kling.Als er im Ratinger Hofaufgetreten ist,warst Du noch Schüler.Marcel BeyerJa und ich war nicht mal in Düsseldorf.Guido GrafWie hast Du ihn kennengelernt?Marcel BeyerDas ist fast umgekehrt zustande gekommen. Ich habe in Neuss ge-wohnt und da auch am Rand von Neuss, im Süden. Der Weg nachDüsseldorfwarweit.Da ist man nicht schnell in die Kneipe gegangen.Dafür war ich wirklich zu jung. Die acht Jahre Altersunterschied sindja in der Jugend Jahrhunderte. Ich habe Frank Köllges zuerst gekannt,von einem Auftritt in Neuss mit seinem Trio Härte Zehn. Da war alsodieser Schlagzeuger, den ich vorher nicht kannte. Eine enorm faszi-nierende Figur, der auch selbst Theater gemacht hat. Frank Köllgeshat immer mimisch gearbeitet beim Schlagzeugspielen. Frank Köll-ges war mir ein Begriff. Und es gab damals in Düsseldorf eine Ein-richtung, die Literaturtelefon hieß.Dort konnteman anrufen und un-ter der Nummer meldete sich ein Tonband, auf dem jemand seineTexte vorlas. Da hatte ich dieses Irrsinnsereignis, das jemand nachder Anwahl der Nummer gerade nicht etwas über den Niederrhein,die Kopfweiden und die Nebellandschaften sprach, sondern es mit ir-rem Schlagzeug losging. Gegen dieses Schlagzeug behauptete sicheine Stimme. Das war die Stimme von Thomas Kling. Sie haben sichwirklich eine Art Duell geliefert und das auf einer Telefonleitung, dienun auch vor fast 40 Jahren noch völlig anders war. Es gab nicht glas-klaren digitalen Klang,wiewir ihn heute kennen.Daswar also an sichschon ziemlich verschrumpelt und verrauscht.Aber, 1983, einfach einunfassbares Erlebnis. 1986 ist dann der erste Gedichtband von Tho-mas Kling erschienen, den man zur Kenntnis genommen hat, den erauch selbst hat gelten lassen: erprobung herzstärkender mittel, in derEremiten-Presse in Düsseldorf. Das war ein Verlag, den ich ohnehinbeachtet habe.Die Eremiten-Presse hat in bibliophiler Edition, aber zuerschwinglichem Preis sehr feine Bücher gemacht. Da ich selberschon ein Leser von Friederike Mayröcker war, habe ich auch immerdarauf geachtet,wo sie Beiträge in Zeitschriften undAnthologien hat.So kam das zusammen. Friederike Mayröcker schrieb einen Begleit-text zu Thomas Klings Gedichten in seinem Band in der EremitenPresse und diesen Namen Thomas Kling kannte ich ja vom Literatur-
telefon her. Im Rückblick kann man auch einfach nur sehen, dass dieKreise klein waren. Ich habe also Thomas Kling erst mal gar nichtkennengelernt, sondern nur seine Gedichte. Daraufhin habe ichselbst eine Zeit lang aufgehört, Gedichte zu schreiben, und ich habeLesungen von ihm erlebt in Düsseldorf.Daswar schon sehr eindrück-lich.Wäre das nicht unter Lesung angekündigtworden,hätteman garnicht gewusst, wie man das rubrizieren soll. Es waren immer Veran-staltungen, bei denen Thomas Kling sehr auf die Stimmung im Publi-kum, auf Reaktionen aus dem Publikum geachtet hat. Er hat auchdarauf reagiert. Ich erinnere mich an eine Lesung, bei der eine Dameim Publikum erbost aufgesprungen ist und den Saal verlassen hat.Kling hat ein »Auf Wiedersehen« mitten in seinen Text integriert,woraufhin der ganze Saal lachte und der Abgang dieser Dame nochnur noch umso blöder war.Guido GrafEs gibt in diesem Essayband auch so ein paar kurze Texte über Dichvon Thomas Kling.Da schreibt er: »legt er auf, frage ichmichmanch-mal,wenn ich Gedichte lese von Marcel Beyer«.Vielleicht eine rheto-rische Frage, denn dasmachst Du ja, zumindest zu Hause, tatsächlich.Früher auch nicht nur zu Hause. Ein anderer Satz – und da ist derWegzu Deiner heutigen Rolle als Herausgeber der Werke nicht so weit –lautet: »Beyer, der wie jetzt schon gesagt werden kann, noch vorGrünbein« – ganz wichtig noch dieser Seitenhieb – »bedeutendsteLyriker der 60er Jahrgänge, liebt den Gang vorbei am Kohlenkeller derGeschichte«.Marcel BeyerJa, das ist ein sehr schöner Text. Da steckt einfach so viel drin.WeißtDu, 2000 hat er den Text geschrieben. Da wohnte ich seit vier Jahrenin Dresden, und wir haben tatsächlich hier in einer Altbauwohnungüber einem Kohlenkeller gewohnt. Das gab es ja imWesten schon garnicht mehr. Das war zwar manchmal anstrengend und lästig, dassman Kohlen aus dem Keller holen musste, aber das hatte natürlichauch ein großes Faszinosum. In Dresden haben die Keller außerdemnochmal eine andere Bedeutung vor demHintergrund der Geschich-te, dass Dresden 1945 bombardiert wurde.Dass er auf Musik hinweistin dem Text ist, ist wieder so ein Distinktionsmoment. Das ist ganzinteressant. Man kann die Essays von Thomas Kling Satz für Satz,Halbsatz für Halbsatz daraufhin lesen, was er gerade im Momentbeabsichtigt, manchmal auch, was er im Schilde führt. In einem frü-hen Gespräch, das wir mal geführt haben, da habe ich ihn interviewtfür die Zeitschrift Konzepte, für die ich damals gearbeitet habe, im Ja-nuar 1991 und das war eigentlich unsere erste richtige Begegnung, dahabe ich ihn auch aufs Musikhören angesprochen und er sagte: »Ich
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
212 213
habe meinen letzten Plattenspieler beim letzten Umzug am Straßen-rand stehen lassen. Für mich ist nur die bildende Kunst wichtig. Füreuch andere Schriftsteller ist Musik so wichtig. Für mich ist nur bil-dende Kunst wichtig.« Das war seine Distinktionsbewegung. Er wartatsächlich sehr verankert in den Kunstkreisen wie kein zweiterSchriftsteller. In Bezug auf die Musik ist es einerseits Lob, anderer-seits sagt es auch: Du machst das und ich mache dieses und das istmein Revier. Du bleibst deinem Revier.Was aber nicht heißt, dass ichihm nicht fröhlich immer Kassetten aufgenommen und geschickthätte, dass sie da auf der Raketenstation mal ein bisschen was ande-res hören oder überhaupt was zu hören bekommen.Guido GrafEin wenig mit Musik hatte er dann ja auch zu tun. Köllges hast Duschon erwähnt, aber da gab es dann auch noch andere. Gestern hastDu mich noch auf etwas völlig Unglaubliches hingewiesen, das manbei YouTube finden kann, wo Thomas Kling als Texter für ein 80er-Jahre Popstück fungiert hat.Marcel BeyerAls Praktiker hat er sehr gernemitMusikern gearbeitet und es ist ihmauch sehr entgegengekommen, weil man ja, wenn man gemeinsamauf der Bühne mit Musikern ist, hypersensibel auf die Regungen desanderen reagiert. In diesem Wechsel von Pause und Überforderungdes Publikums war er eigentlich selbst Musiker, ohne dass er ein In-strument gespielt hat. Aber er hat sich nicht aktiv ums Musikhörenbemüht. Er hat zwar in Köln fast unmittelbar neben Saturn gewohnt,was der größte Plattenladen Europas war und eine ungeheure Fund-grube.Aber ich glaube nicht, dass er da ein einziges Mal hingegangenwäre, um eine Schallplatte zu kaufen. Es war bei Thomas Klings Ge-dichtbänden immer so: Wenn die erschienen, haben wir die alle auf-genommen wie ein neues Album von der Band. Wie ist das neue Al-bum anders als das vorherige? Das war wirklich eine völlig andereWahrnehmung als andere Bücher, andere Gedichtbände. Man wollteimmerwissen,weil derThomas Kling immer ganz vornewarmit dem,was er gemacht hat, wie sehen seine nächsten Schritte aus. Wohingeht er? Drückt er noch mehr auf die Tube, nimmt der Tempo totalraus und wenn er Tempo rausnimmt,wie gelingt ihm das, nicht so zuwerden wie die von ihm verachteten schläfrigen 70er-Jahre Lyriker.Man hat das wie ein Album erwartet, wie ein Album gelesen und ei-gentlich in solchen musikalischen Kategorien auch wahrgenommen.
Zartschatten1(“echsenmeisterin”)blond geschuppt, recht dunkel; legtdie drachenbüchse auf mich an;Schuppung: blattförmig, ginkgo (nichtlinde, kein lindgrün!); legtan auf mich, legt ihre schuppung(»zartschatten«) mir an imgingkolicht so drängeln wir uns aneinander;überm -baum ein zartschatten,so bonsaidrachen2(»hortensienfrau«)ein sehr jenseitiger fleuropdienst,eine berührbar dezembererscheinung(heute noch greifbar): ihre beidensommerstiefel hortensiengefüllt!zwei füße, zwei blütn; (anrufungdes schlüsseldienst, ein außenstehendes flehen)
Guido GrafEin ganz anderer Kling, der Ton zurückgenommen und mir schiensich beim Lesen gleich eine Brücke zu schlagen zu KlingsWespen undauch zu DeinemWespen-Gedicht.Marcel BeyerDas heißt nicht umsonst Zartschatten. Da sitzt auf seine Weise einstiller Beobachter im Schatten und beobachtet zart. In dieses feine,innige Liebesgedicht lässt er auch Motive aus der Weltliteratur ein-fließen. Ganz beiläufig, man kann die zur Kenntnis nehmen, wennman die Hintergründe kennt. Man muss das aber nicht. Ginkgo, dasist der Goethe-Baum. Dann legt sie die Drachenbüchse an, dannkommt »ginkgo nicht linde«. Von der Linde ist man gleich bei Sieg-fried. So fein baut er das ein. Da merkst Du, dass er nicht der reineBühnendämon ist, sondern ein enormer Hintergrund da ist, der ohneBildungsprotz einfließt. Er hausiert nicht mit seinem Bildungsschatz.Guido GrafEs gibt diesen schönen Satz »die sprache des gedichts hat mit dersprachsituation des dichters sich zu decken«.
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
214 215
Marcel BeyerJa, und jetzt wollen wir zu den Wespen. Wir haben im Nachlass vonThomas Kling auch frühe Prosaversuche entdeckt, Texte, die nicht sosehr Erzählungen als Zustandsbeschreibungen sind, in denen einKippmoment steckt.Die sind anderthalb, höchstens zwei Seiten lang.Da gibt es eine Geschichte, in der das Erzähler-Ich von den Bienenentdeckt wird. Die Bienen nehmen den Erzähler als Bienenkorb an.Da kommt tatsächlich vor, dass die Bienen ihm zum Mund hineinund heraus fliegen. Das ist ein Text, den ich nun seit vier oder fünfMonaten kenne. In einemGedicht, das ich nach demTod von Thomasgeschrieben habe, in Erinnerung an ihn,Wespe, komm gibt es dieselbeBewegung, nur dann eben mit derWespe, die eigentlich dasWappen-tier von Thomas Kling war, in der das lyrische Ich die Wespe auffor-dert, ihm in den Mund zu fliegen.
Wespe, kommWespe, komm in meinen Mund,mach mir Sprache, innen,und außen mach mir was amHals, zeig’s dem Gaumen, zeig es
uns. So ging das. So gingen dieachtziger Jahre. Als wir jungund imWesten waren. Sprache,mach die Zunge heiß,mach
den ganzen Rachen wund, gib mirFarbe, kriech da rein. Zeig mirWort- undWespenfleiß,mach’sdem Deutsch am Zungengrund,
innen muß die Sprache sein. Immerauf Nesquik, immer auf Kante.Das waren die Neunziger.Warendie Nuller. Jahre. Und: So geht das
auf dem Land. Halt die Außensprachekalt, innen sei Insektendunst,maches mir,mach mich gesund,Wespe, komm in meinen Mund.
Guido GrafThomas Kling ist 2005 gestorben,mit nur 47 Jahre alt. Bis zuletzt hater diese Krankheit thematisiert, das Atmen, das immer schwerer fiel.Das wird auch in diesem Gedicht von Dir reflektiert.Marcel BeyerJa, natürlich.DieWespe aufzufordern, in denMund zu fliegen, um ei-nen gesund zu machen, hat ja auch etwas von einem Zauberspruchoder einer Beschwörung.Da kannst Du auch den Bogen schlagen zumLorscher Bienensegen, einem der ganz frühen Zeugnisse nicht-lateini-scher Literatur, diewir imDeutschen haben,wo die Bienen besänftigtwerden.DieWespe war für Thomas Kling das angriffslustige Tier.Derurteilsfreudige Dichter hatte lange einen schwarzgelb gestreiftenPullover. Er hat ein Stirnband in schwarzgelb besessen, das hat UteLanganky, seine spätere Frau, ihm gestrickt. Das stand immer dafür,dass er keinen Angriff scheute, wo der Angriff nötig ist. In meinemGedicht ist die Wespe natürlich etwas, was herbeigesehnt wird, wasdie tödliche Erkrankung Lungenkrebs heilen oder zumindest lindernkönnte.Guido GrafDu hast mal in einem Text erzählt, wie Thomas Kling 1986 bei einerLesung »Löwen-Senf extra scharf« auf den Tisch gestellt hat. Hat erdavon während der Lesung was genommen?Marcel BeyerDas war nur eine Requisite. Von jeder Lesung, von der ich erzählenkönnte, könnte ich behaupten, das war eine legendäre Lesung. Daswar jene Lesung beim sogenannten nordrheinwestfälischenAutoren-treffen. Da hat man anonymisiert Texte eingereicht, von denen inmehreren Sparten jeweils zehnAutoren ausgewählt wurden,die dannvorlesen durften. Eine Jury hat entschieden, wer den Preis bekommt.Der Auftritt, wo er den Löwensenf aufs Pult stellte, war 1986, kurznach Erscheinen von erprobung herzstärkender mittel, in der Kunst-halle. Und es war dieselbe Lesung, aus der die Dame empört davonge-laufen ist und er ihr »Auf Wiedersehen« hinterher gerufen hat. Dagibt es auch Fotos und für mich hat es auch noch was Autobiografi-sches. Meine Mutter war dabei. Thomas Kling bekam als Preisträgervom Düsseldorfer Oberbürgermeister einen Blumenstrauß in dieHand gedrückt und er sagte leicht verächtlich: Ja,wasmache ich dennjetzt damit? MeineMuttermeinte: verschenken Sie den doch.Und er:Ja, hier, bitteschön.Guido GrafIch möchte noch mal auf ein anderes Gedicht eingehen und an eineBeobachtung anknüpfen, die Hans Jürgen Balmes, Programmleiter
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
216 217
bei S. Fischer,mal in einem Gespräch mit Thomas Kling gemacht hat,wo er Ihn als Wörterbuch- und Lexikonkritiker bezeichnet hat. EineBeschreibung, die Thomas Kling, scheint mir, auch ganz dankbar an-genommen hat. Dazu eines der späten Actaeon-Gedichte.
Actaeon 4die luft voller späne,wie späte loops aus der antike. nichtgehorchen dem Actaeon die worte mehr. kühlkammer, vonblauen lippm belichtungen: Actaeon hängt in der landschaft
ab. tankstelle, blau. in blauen wintern eingeeist. dies. nichtzu übersteigen: ein steif-bereifter, krummgefrorener clip vonhaufen toten wilds,wie säcke, trophäen wortlos weggesägt
der den boden in einem kachelraum bedeckt. da ist nichtdurchzukommen. in thermo-jägerstiefeln folgt ein zähesübersteigen, staksen: leiberwust mit stöcken (läufen) die
knirschend ihre winkel ändern müssen. schwergewichte,rauhe decken. elektrisch frißt die knochensäge, singt sichdurch die hirschwelt durch, von spänen kleines regnen.
Guido GrafDas ist von 2001, aus dem fünfteiligen, Actaeon überschriebenen Ge-dichtzyklus.Marcel BeyerWenn man das zusammen mit Frank Köllges am Schlagzeug hört,kann man sehr genau beobachten,wie die sich aufeinander verlassenund aufeinander reagieren. Allein, wie Thomas die Pausen gelassenhat. Das würde nicht so funktionieren, wenn man alleine auf derBühne ist.Wenn man mit Musikern auf der Bühne ist und liest, wirdman getragen. So wenig Frank Köllges da macht: er geht nurmit demStock außen an der Kante des Beckens entlang, hält das Becken sogarnoch fest, dass es gar nicht richtig wiederklingen kann.Wenn man sogetragen wird, kann man extrem mit Pausen arbeiten und erzeugteine ungeheure Intensität. Es gab früher Rezitatoren, die vom Thea-ter kamen. Heute machen die wahrscheinlich alle Hörbücher. Aberwenn die auf offener Bühne waren und den Erlkönig rezitiert haben,gab es auch die Langsamkeit, aber die Gefahr, dass die Pause zu langwerden könnte und die Spannung absackt, wurde immer mit Pathosabgefangen. Das machte Thomas Kling überhaupt nicht. Er geht in
den Raum hinein und hinten arbeitet die Knochensäge. Er zoomt sichmit dem Auge heran. Wir hören die Knochensäge nur ganz entfernt,von Frank Köllges bedient. Und Kling bleibt ganz still und konzen-triert.Guido GrafThomas Kling hat seine Auftritte gerne als Sprachinstallation be-zeichnet. Ihm ging es darum, Sprache mit der Stimme, aber auchSprache mit der Stimme der Schrift zu gestalten. Wie wird die Spra-chinstallation im Gedicht zu einer Installation?Marcel BeyerWir haben es gerade bei Actaeon und auch bei anderen Gedichten undZyklen, in denen Thomas Kling mit der Antike umgeht, immer mitVergegenwärtigung zu tun.Auf eine verrückt und gut funktionieren-deWeise baut er Gegenwartsszenerien. Bei Actaeon ist es eine elektri-sche Knochensäge. Nicht jemand, der mit dem Hackebeil in einemMittelalter-Reenactment oder ähnlichem versucht die Antike nach-zuspielen. Er setzt das alles immer in die Gegenwart und vermittelt,dass in dieser Gegenwart die Antike sich abspielt. Er geht nicht in dieGeschichte zurück oder in die antiken oder mittelalterliche Mythen,sondern holt sie heran.Darum kann er auch so leise reden, er zieht esuns ja direkt vor die Augen.Und nunmüssen diese Figuren, die in derantiken Mythologie ihren Platz haben, sich in einer Gegenwartssze-nerie zurechtfinden. Damit ist das Räumliche schon durch die zweiZeitebenen und zwei Szenerieebenen gegeben,die ineinander gewen-det werden. Zusätzlich passiert viel über Rhythmus. Gerade in späte-ren Werken gibt es immer häufiger die sehr feinen Reime, aber ermacht es über die Position des absolut gegenwärtigen Beobachters.Hier suhlt sich niemand in Vergangenheit oder Bildungsgut. Darausnimmt sich er sich deutlich zurück. Er will nicht werden wie die, son-dern diese antiken Figuren interessieren ihn unter dem Gesichts-punkt, dass er sie als gegenwärtige Figuren auffassen kann. Mirkommt gerade etwas in den Sinn, bei dem ich gar nicht weiß, ob dasstimmt.Aber ich könnte mir vorstellen, dass er das auch ein bisschenbei Heiner Müller beobachtet hat, wie der mit alten Stoffen umgingund die in die Präsenz der Bühne zog. Da will ja niemand eine Histo-rienklamotte aufführen, sondern man nimmt das, was sich aus die-semMaterial verlebendigen lässt. Das ist der Raum, in dem etwas in-stalliert wird. Sprachlich hat man so eine Bühnensituation. Da er aufsehr gekonnte von Zeile zu Zeile zwischen Milieus und historischenund auch literarischen Räumen springt,wird man immerwie von ei-nem hellsichtigen Reporter, der zugleich Fremdenführer ist, durchdas Gedicht geführt.
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
218 219
Guido GrafMich erinnert das auch an die Pathosformeln, von denen Aby War-burg geschrieben hat. Ganz ähnlich dem,wie auch heute noch in derKunstwissenschaft Pathosformeln beispielsweise in der Politik beob-achtet werden und man dann bestimmte Gesten aus antiken Skulp-turen etwa in Fotos von heutigen Diktatoren wiederentdeckt.Marcel BeyerEs gibt ein berühmtes Foto, auf dem Thomas Kling vor einem Halbre-lief steht, das Oswald von Wolkenstein darstellt. Er steht als OswaldvonWolkenstein aus Fleisch und Blut vor einem Oswald vonWolken-stein aus Stein und signalisiert damit, dass er etwas weiterführt. Ersignalisiert, dass er ein historisches Bewusstsein hat. Er signalisiert,dass er sich selber in einer Tradition verortet. Thomas Kling war esimmer wichtig, sich selber in einer Tradition zu verorten und sichdiese Tradition auch selbst herzustellen. Er hat nicht abgewartet, bisdie Literaturgeschichte, die Kritiker oder die Germanistik das tun.Das Pathos, das Ausdruck von Energiegeladenheit ist, hat er ja selbstauch. Gerade da,wo es ganz still wird in seinen Texten.Aber ohne dasPathos der Feiertagsreden. Das hat ihn verrückt gemacht.Guido GrafEs gibt von 2001 Thomas Klings vierWünsche für den professionellenVortrag des Gedichts. Der erste und der vierte sind gleich: »kein Ge-nuschel bitte«. Unter Viertens steht: »siehe eins«. Ich habe ThomasKling nur einmal persönlich gesprochen und er schien mir völlig un-fähig zum Smalltalk.Mich hat das damals erst überfordert,wie er so-fort sehr zugewandt auf das einging,was ich gerade mache und dazudetailliert nachgefragt hat. Die Disputation meiner Dissertation warfast lächerlich im Vergleich zu diesen sehr nachdrücklichen Fragenspätabends in Hombroich, bei einem Fest, auf dem alle schon etwasgetrunken und gegessen hatten, ein solches forderndes, aber auchsehr spannendes Gespräch anzufangen.Marcel BeyerJa, das konnte er. Er hat in Hombroich auf der Raketenstation derenkünstlerisches Klimamit aufgebaut.Daswar die Idee des Stifters KarlHeinrichMüller, dass Leute aus verschiedenen Bereichen zusammen-kommen, Ute Langanky aus der bildenden Kunst, Thomas Kling ausder Literatur, dann Forscher, Wissenschaftler, ein Komponist und soweiter.Die sollten ein künstlerisches und intellektuelles Klima schaf-fen, in dem sie sich sicher fühlen und herausgefordert, aber eben her-ausgefordert vomDenken. In diesemMilieu waren viel stärker solcheintensiven Gespräche möglich, wie Du das jetzt gerade beschriebenhast, als es in einer Kölner Kneipe gewesen wäre. Das hat auch noch
mal eine andere Seite an Thomas Kling verstärkt hervorgebracht.Dasgilt auch für die Lesereihe, die in Hombroich veranstaltet hat, für dieer in die Rolle des Organisators, Kurators und Moderators geschlüpftist. Thomas Kling in solch dienender Funktion wäre Mitte der 80erJahre und auch Anfang der 90er Jahre noch sehr schwer vorstellbargewesen. Er hat seine Entdeckerfreude ans Publikumweitergetragen.Guido GrafZum Schluss würde gern noch mal auf die Werkausgabe zurückkom-men. Du kennst Thomas Klings Texte lange und gut. Aber was warenfür Dich die merkwürdigsten und überraschendsten Entdeckungen?Marcel BeyerNachdem Thomas tot war, ging es darum, eine allererste Sichtungseiner Materialien vorzunehmen, um einzuschätzen, was überhauptanMaterial da ist.Thomas Kling hat immer gesagt: Ich bewahre dochnicht alles auf, nicht jedes Zettelchen. Ich dachte, hoffentlich sindnicht seine ganzen Manuskripte nur Kraut und Rüben und Fetzen.Damals sind dann Ute Langanky, meine Frau und ich zu dritt allesdurchgegangen und haben festgestellt, dass er seine Materialienschon sehr gut gesammelt hat.Wir haben Jugendgedichte ab 1973. Esgab mal einen schlimmen Computerzusammenbruch im Sommer2004. Da ist offenbar viel verloren gegangen. Texte, die nicht ausge-druckt waren. Den wirklichen Einstieg in die Materialien habe icherst im Januar 2019 gemacht, als ich dort im inzwischen eingerichte-ten Thomas-Kling-Archiv war und mithilfe von Raphaela Eggers, diedas Archiv betreut, zehn Tage lang konsequent von morgens bisabends acht Stunden am Tag Manuskripte, Typoskripte,Vorabdruckeusw. als Grundlage für die Werkausgabe fotografiert habe. Ein tollerFund waren die Filmkritiken aus der Rheinischen Post. Ich erinneremich, dass ich 1991 Thomas Kling in einem Interview gefragt habe, ober sonst noch journalistisch gearbeitet habe. Da sagte er: »erinnereich mich jetzt nicht dran«. Da lag das gerade mal sechs Jahre zurück.Er wird sich also schon daran erinnert haben. Der Thomas ist mit 47gestorben. Er hat sein Selbstbild immer wieder justiert, je nachdem,welche Position er in der literarischenWelt hatte. Er hat mit den Jah-ren vom Angriff sehr stark zurück zurück geschaltet, hat die Litera-turreihe gemacht, hat sehr schöne Buchbesprechungen geschrieben,um die sich die großen Zeitungen gerissen haben. Ich glaube, er hättespäter auch einen anderen Blick auf seine Filmkritiken gehabt.Wennman das heute liest, der ganze Witz, der da drin steckt, hat man denechten Thomas Kling. Das ist nichts, wo man sagen sollte, das seinicht so wichtig. Es wird einfach eine weitere Facette gezeigt und dasBild weitet sich. Erst jetzt mit dieser Werkausgabe sieht man, in wievielen Bereichen er zu Hause war. Eine andere Entdeckung waren
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
220 221
Texte, von denen wir wussten, dass sie existieren, von denen wir imArchiv nur sehr stark bearbeitete Entwürfe gefunden haben und kei-ne abgeschlossenen Manuskripte, nämlich von einer Reihe vonRundfunkaarbeiten, die er Ende der achtziger Jahre gemacht hat.Davon hat er erzählt. Thomas Kling war ungeheuer begeistert, alsDurs Grünbeins erster Gedichtband Grauzone morgens erschien. Erhat von sich aus den Kontakt zum Radio gesucht, um das Buch be-sprechen zu können. Aber wir hatten kein Manuskript davon. Oderüber den österreichischen Dichter Reinhard Priessnitz, der 1985 ge-storben ist und den Thomas Kling aber noch kennen gelernt hat, mitdem er befreundet war und der einer der größten Dichter der letztenzwanzig Jahre ist, wollte er was fürs Radio machen. Und wieder hat-ten wir kein vernünftiges Skript. In den Rundfunkarchiven warendiese Sachen zwar da, aber nicht so leicht zu recherchieren. Im Zugeder Digitalisierung von Rundfunkarchiven hat sich das geändert.Alleverlorenen Schätze, sofern sie denn noch vorhandenwaren, sind jetztgreifbar. Das heißt, wir haben diese Radiosendungen, auch ein sehrschönes Porträt von demDadaisten und KriminalschriftstellerWalterSerner, auch so eine Stifterfigur für Thomas Kling. Oder ein Porträtdes Schriftstellers und ZeitzeugenAdolfMolnar.Die hattenwir plötz-lich in der Originalaufnahme, gesprochen von Thomas Kling. Nochvor fünf Jahren, bevor beim SWR digitalisiert wurde, hätte man ge-sagt, dass man da nichts machen kann. Diese Texte erscheinen nundas erste Mal im Druck. Für Thomas Klings Selbstverständnis alsDichter sind das ganz wichtige Texte.Guido GrafIn einer der letzten Ausgaben vom Schreibheft gab es einen Auszugaus dem Briefwechsel zwischen Thomas Kling und Oskar Pastior. Dawird auch noch mal eine weitere Stimmlage sichtbar,wie Du es auchangesprochen hast. Thomas Kling als derjenige, der nicht nur etwasholt und empfängt, sondern auch etwas geben will. Hier mit einerganz eigenen Kunstform, eben diesen kurzen Briefen. Da gibt das Ar-chiv wahrscheinlich auch noch mehr her.Marcel BeyerEs gibt über und für niemanden so viele Texte von Thomas Kling wiefür und über Oskar Pastior. Das wäre selbst noch ein kleines schönesBuch von 30, 40 Seiten. Er hat schon früh eine erste kleine hymnischeBesprechung des Sammelbandes Jalousien aufgemacht von OskarPastior geschrieben, erschienen in der Düsseldorfer Illustrierten, alsBuchtipp des Monats. So etwa muss man auch erst mal finden. Dannzu Oskar Pastior siebzigstem Geburtstag hat er gleich zwei große Es-says geschrieben, beide völlig unterschiedlich. Es gibt immer wiederGedichte, die auf Oskar Pastior antworten, die Oskar Pastior gewid-
met sind. Ja, das war etwas ganz Wichtiges. Der Briefwechsel setztauch ein mit einem Brief von Thomas Kling an Oskar Pastior im Jahr1985, bevor der erste Gedichtband von Thomas Kling erschien, mitdem er wirklich für Aufsehen gesorgt hat. Die beiden waren bis zumSchluss eng befreundet.Wir hatten, als Thomas Kling gestorben war,in der FAZ am 1. April 2005 eine eigene Todesanzeige geschaltet. AlleFreundewurden gefragt, ob siemit dabei seinwollen. Jeder zahlte sei-nen Anteil, damit die die Anzeige bezahlt werden kann. Ich erinneremich, wie auf der Beerdigung von Thomas Kling Oskar Pastior aufmich zukam undmir abgezählt in bar seinen Beitrag überreichte.Un-glaublich!
superfette SPRACHINSTALLATION superfette SPRACHINSTALLATION
Anmerkungen
Thomas Kling: Werke in vier Bänden. Herausgegebenvon Marcel Beyer in Zusammenarbeit mit Frieder vonAmmon, Peer Trilcke und Gabriele Wix. Berlin:Suhrkamp, 2020.
theoriender
literatur
guido graf
theorie und praxis 1theorie und praxis gespräche mit
Wir schreiben, lesen, erzählen, sprechen,experimentieren, forschen und lehren. Wirbewegen uns durch literarischeProduktionsräume, erproben Techniken undFormen. Wir beobachten dieGegenwartsliteratur, ihre Entstehung,Vermittlung und Rezeption. Wir erschließenKontexte der Jetztzeit. In dieserSchriftenreihe buchstabieren wir Methoden,Poetiken, Werkprozesse und Inszenierungendes literarischen Schreibens durch.Regelmäßig erscheinen neue Bände, diesich essayistisch, literarisch oder auchwissenschaftlich mit den für dasLiteraturinstitut Hildesheim zentralenFragen auseinandersetzen.
armen avanessianmarcel beyer
ulrich blumenbachjan drees
anke hennigannette pehntsimon roloffsylvia sasse
ulf stolterfohtjacob teichanja utler
senthuran varatharajahuljana wolf
guidograf
theoriender literatur