Gottes Weisheit in Jerusalem. Sirach 24 und die biblische Schekina-Theologie, in: H. Lichtenberger /...
-
Upload
uni-tuebingen -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Gottes Weisheit in Jerusalem. Sirach 24 und die biblische Schekina-Theologie, in: H. Lichtenberger /...
Gottes Weisheit in Jerusalem
Sirach 24 und die biblische Schekina-Theologie
BERND JANOWSKI
Für Johannes Marböck
Die Frage nach der Gegenwart Gottes in Israel hat das Alte Testamentimmer wieder umgetrieben. Die Antworten, die es in der langen Ge-schichte seiner Entstehung darauf gab, entsprechen seinem dynami-schen Gottesbild. JHWH offenbarte sich nicht nur in Gewitter- oderVulkanerscheinungen (Ex 19,16 – 20), sondern – jene Erscheinungentransformierend – auch in der geheimnisvollen Stimme, die Elia amGottesberg vernahm (1 Kön 19,11ff ). Nach dem alten Tempelweihe-spruch von 1 Kön 8,12f hatte JHWH sogar erklärt, im Dunkel des Al-lerheiligsten wohnen zu wollen, und in spätnachexilischer Zeit wurdeschließlich der Himmel sein Thron und die Erde der Schemel seinerFüße (Jes 66,1f ). Gottesberg, Tempel und Himmel sind nicht die ein-zigen, aber doch markante Bezugspunkte des ursprünglich familien-und sippenbezogenen Israel-Gottes. Sie bezeugen eine dramatischeMetamorphose des alttestamentlichen Gottesbildes, die in der antikenReligionsgeschichte ihresgleichen sucht.
Integraler Bestandteil dieser Metamorphose ist auch die Schekina-Theologie, d. h. die Vorstellung, dass JHWH im Jerusalemer Tempeloder in seinem erwählten Volk „Wohnung genommen“ (ñkÅ wÏÄ )1 habe undin dieser Weise in Israel gegenwärtig sei. In der spätnachexilischenWeisheitstheologie enthält die Vorstellung von der „Einwohnung
1 Siehe dazu die Hinweise unten Anm. 13. Der Terminus Schekina taucht erst nach 70n. Chr. bei den Rabbinen auf und „besagt die Fortdauer der Bundes-Treue Gottesbzw. der Erwählung Israels in der tempellosen Exilszeit. Die Schekhina-Traditionenstützen sich auf viele biblische Aussagen, wonach Gott sich stets zu Israel hin bewegtund im Bundeszelt, im Tempel und im Kreis der sündigen, bangenden und hoffen-den Israeliten Wohnung nimmt“ (THOMA, Schekhina 352). Zur rabbinischen Scheki-
na-Theologie siehe die klassische Darstellung von GOLDBERG, Untersuchungen, fer-ner KUHN, Gottes Selbsterniedrigung; SCHÄFER, Vorstellung; SCHÄFER, Gott 84f.110f.117ff; ERNST, Schekına, und SIEVERS, Begriff.
2 BERND JANOWSKI
Gottes“ Aspekte, die auf eine Hypostasierung oder Personalisierunghindrängen und in rabbinischer Zeit schließlich die Konturen einer„Biblical Figure“ – so die Themaformulierung dieses Symposions –annehmen. Ein prominentes Beispiel dafür ist das Selbstlob der Weis-heit in Sir 24, das im Folgenden im Zentrum steht. Um die Rezeptionder alttestamentlichen Schekina-Theologie in Sir 24 nachzuzeichnen,gebe ich zunächst einen Überblick über die traditionsgeschichtlichenAspekte (1.) und frage dann nach ihrer Funktion in Sir 24 (2.). AmEnde steht ein biblisch-theologischer Ausblick (3.).
1. Zur Religions- und Traditionsgeschichte
der Schekina-Theologie
Der Ausdruck „Einwohnung Gottes“ umschreibt einen Sachverhalt,der nicht auf die alttestamentlich-jüdische Gottesvorstellung beschränktist, hier aber eine besondere Ausprägung erfahren hat.2 Mit dem Ter-minus Schekina ist
„die ,Einwohnung’ Gottes im Volk Israel und in seinen Institutionen ge-meint, d. h. die praesentia Dei specialis in Heiligtum und Gemeinschaftund die heilvolle Begleitung Israels durch die Geschichtszeit hindurch biszur endzeitlichen Fülle von seiten des sich herabneigenden Gottes Israels“.3
Es geht dabei, wie das Beispiel Ägypten zeigen kann, wesentlich um den„Ort der Gottheit“ 4 in der Spannung von himmlischer ,Herkunft’ undirdischer ,Ankunft’.
1. 1 Ägypten
Mit der Vorstellung von der Einwohnung der Gottheit wurde schon inÄgypten die Beziehung der Götter/Göttinnen zur Welt der Menschenthematisiert, zunächst im Opferritual und im königlichen Totenkultdes Neuen Reichs (18. – 20. Dynastie) und dann besonders im Rahmender späten Bildtheologie der griechisch-römischen Zeit.5 Die ägypti-sche Idee der „Einwohnung“ 6 lässt sich am besten durch den Begriff
2 Siehe dazu den Überblick bei NIEWÖHNER, Schechina.3 THOMA, Schekhina 352.4 Dazu aus ägyptologischer Sicht HORNUNG, Der Eine 242ff, und ASSMANN, Ägypten 25ff.5 Siehe dazu MORENZ, Religion 157ff; ASSMANN, Ägypten, und ASSMANN, Einwohnung.6 Der Terminus „Einwohnung“ wurde offenbar von H. JUNKER in die Ägyptologie ein-
geführt, siehe dazu ESCHWEILER, Bildzauber 287ff. Für Mesopotamien siehe DIETRICH,Kultbild 35ff, und BERLEJUNG, Theologie 281ff.
3Gottes Weisheit in Jerusalem
der descensio, d. h. der „Herabkunft“ der Gottheit auf ihr Kultbild, fas-sen: Die Gottheit steigt als „Ba“ (Verkörperung der vitalen Lebens-energie) vom Himmel, ihrer ältesten Heimat, herab, um in Gestalt ihrerBilder am Kult teilzunehmen. Dabei wird die Unterschiedenheit vonGott und Bild gewahrt: Die Götter/Göttinnen sind als „Ba“ im Him-mel und ihre Bilder sind auf der Erde, aber im Kult ereignet sich täg-lich ihre „Einwohnung“ oder „Einkörperung“. Schematisch dargestellt:
Himmel „Ba“ (Verkörperung der vitalen Lebensenergie)der Gottheit
Vorgang der „Herabkunft“ (descensio, ägyptischTempel/Kult h j „herabsteigen“ und anderes) in Gestalt eines
Vogels (Horusfalke, Sperber und anderes)
Kultbild (sh˘
m „Verfügungs- oder Machtbild“) derErde Gottheit, Wandrelief ( h
¯mw und anderes)
Die in den Tempeln vollzogenen Riten sorgen demnach dafür,
„daß die himmlischen Götter auf die Erde hinuntersteigen und ihre Bilderbeseelen, so daß, im Falle eines unablässig vollzogenen Kults, die Götter inÄgypten eine Art ständigen Wohnsitz nehmen und Ägypten auf diese Wei-se zum ,Tempel der ganzen Welt’ (templum totius mundi) machen“.7
So heißt es in einem Morgenlied aus Edfu von Horus:
Er kommt vom Himmel Tag für Tag,um sein Bild zu sehen auf seinem Großen Thron.Er steigt herab (h j) auf sein Bild (sh
˘m)
und gesellt sich zu seinen Kultbildern ( h¯
mw).8
Und ein entsprechender Text in Dendera sagt von Hathor:
Sie fliegt vom Himmel herab ( pj) . . .,um einzutreten in die Achet ihres Ka auf Erden,sie fliegt herab auf ihren Leib,sie vereinigt sich mit ihrer Gestalt.9
7 ASSMANN, Einwohnung 124. Zu dieser spätägyptischen „Theologie der Einwohnung“siehe umfassend KURTH, Treffpunkt.
8 Zitiert nach ASSMANN, Ägypten 52. Zur ägyptischen Terminologie der „Herabkunft“siehe ESCHWEILER, Bildzauber 288.
9 Zitiert nach ASSMANN, Ägypten 52.
4 BERND JANOWSKI
Die „Herabkunft“ der Gottheit gilt aber nicht nur dem Kultbild, son-dern auch den Wandreliefs:
Sie vereinigt sich mit ihren Gestalten,die eingemeißelt sind in ihrem Heiligtum.
Sie läßt sich nieder auf ihre Gestalt,die auf der Wand eingemeißelt ist.10
Besonders eindrücklich ist wieder ein spätägyptischer Text aus Den-dera, der die Vereinigung des Gottes Osiris mit seinen Darstellungen inden Osiris-Kammern beschreibt:
Osiris . . . kommt als Geist ( h˘
),um sich mit seiner Gestalt in seinem Heiligtum zu vereinigen.Er kommt vom Himmel geflogen als Sperbermit glänzendem Gefieder, und die Ba’s der Götter mit ihm.Er schwebt als Falke herab auf sein Gemach in Dendera . . .Er erblickt sein Heiligtum . . .in Frieden zieht er ein in sein herrliches Gemachmit den Ba’s der Götter, die um ihn sind.Er sieht seine geheime Gestalt an ihren Platz gemalt,seine Figur auf die Mauer graviert;da tritt er ein in seine geheime Gestalt,läßt sich nieder auf seinem Bild (sh
˘m) . . .,
und die Ba’s der Götter nehmen Platz an seiner Seite.11
Typisch für die ägyptische Idee der „Einwohnung“ sind nach diesenTexten drei Aspekte: zum einen das Moment der „Herabkunft“ (de-
scensio), die Gott und Bild in eine vertikale Beziehung zueinander setzt,sodann eine Art ,Zwei-Naturen-Lehre’, die zwischen dem Ba der Gott-heit und ihrem Bild unterscheidet, und schließlich die Terminologieder „Vereinigung“, die den „Ba“ der Gottheit und ihr Kultbild in eineinnere Beziehung zueinander bringt. Kennzeichnend für diese Art derGottesgegenwart ist das Moment des Prozess- bzw. Ereignishaften, dasder lokalen Dimension der göttlichen Zuwendung den Aspekt des Sta-tischen nimmt.
„Die Götter »wohnen« nicht auf Erden, was ein Zustand wäre, sondern sie»wohnen ein«, und zwar ihren Bildern: Das ist ein Vorgang, der sich zwarregelmäßig und immer wieder ereignet, dessen Realisierung aber von derMitwirkung der Menschen, dem Kult abhängig ist.“ 12
10 Zitiert nach ASSMANN, Ägypten 52.11 Zitiert nach ASSMANN, Einwohnung 126; vgl. ASSMANN, Ägypten 52.12 ASSMANN, Ägypten 53. Zum Thema „Einwohnung der Gottheit“ in mesopotami-
schen Texten siehe DIETRICH, Kultbild 35ff (mit Beispiel aus neuassyrischen Konse-krierungsritualen), und BERLEJUNG, Theologie 281– 283.
5Gottes Weisheit in Jerusalem
1. 2 Altes Testament
Im Unterschied zu Ägypten und Mesopotamien hat sich die Vorstel-lung von der „Einwohnung Gottes“ im Alten Testament nicht im Um-kreis der (Kult-)Bild-, sondern der Tempeltheologie entwickelt.13 AmAnfang steht dabei – den ägyptischen Texten und ihrer Terminologieder „Herabkunft“ vergleichbar – die vertikale Sinndimension: JHWH„wohnt“ (ñkÅ wÏÄ ) als Königsgott im Tempel/auf dem Zion (1 Kön 8,12f;Jes 8,18),14 der durch seine vertikale, an der Gottesthronmotivik ori-entierten Achse als kosmischer Ort („Weltberg“) qualifiziert ist:
12 Damals sprach Salomo:„JHWH hat erklärt, im Wolkendunkel zu wohnen.
13 Ich habe dir wahrhaftig ein herrschaftliches Haus gebaut,eine Stätte für dein Wohnen (fT b wÏÇ l ñu´kmÄ ) für alle Zeiten.“ (1 Kön 8,12f )
Als Stätte der kultisch repräsentierten Gottesgegenwart ist der Tempel– so die Grundkonzeption der Jerusalemer Tempeltheologie – der Ort,an dem himmlischer und irdischer Bereich ineinander übergehen unddie Kultordnung mit ihrer komplexen Symbolik in Relation zum Welt-ganzen steht. Hier, auf dem kosmisch dimensionierten Gottesberg Zi-on, hatte JHWH als Weltkönig Wohnung genommen, und hier wird erbei der erhofften Heilswende wieder gegenwärtig sein. Der Text, derdies in geradezu klassischer Weise zum Ausdruck bringt, ist der Rah-men der „Denkschrift Jesajas“ (Jes *6,1– 8,18), der in Jes 8,16 –18 unterRückgriff auf Jes 6,1– 5 die Vorstellung von der Einwohnung JHWHsauf dem Zion tradiert: 15
Jes 6,1– 5
1 Im Todesjahr des Königs Ussiasah ich den Herrn,sitzend (bwÏÈ iÊ) auf einem hohen und aufragenden Thron,wobei seine Gewandsäume den Tempelraum ausfüllten.
2 Seraphen standen über ihm:Je sechs Flügel hatte einer:mit zweien bedeckte er sein Gesichtund mit zweien bedeckte er seine Füßeund mit zweien flog er (ständig).
13 Zur alttestamentlichen Schekina-Theologie siehe GESE, Johannesprolog 173ff; GESE,Weisheit 226ff; JANOWSKI, Mitte; JANOWSKI, Gott 265ff; JANOWSKI, Shekhina; GÖRG,ñkÅ wÏÄ 1344ff; HULST ñkÅ wÏÄ ; SCHOLTISSEK, Sprache 88ff; SCHREINER, Wohnen; SEDLMEIER,Mitte.
14 Vgl. sachlich Joel 4,17.21; Ps 135,21, ferner Jes 33,5; 57,15.15 Siehe dazu BARTHEL, Prophetenwort 228ff, besonders 239ff.
6 BERND JANOWSKI
3 Und einer rief dem anderen zuund sprach:„Heilig, heilig, heilig ist JHWH Zebaoth,die Fülle der ganzen Erde ist seine Herrlichkeit!“
4 Da bebten die Zapfen der Schwellen vor der Stimme des Rufers,und das Tempelhaus füllte sich mit Rauch.
5 Da sagte ich:„Weh mir,denn ich bin vernichtet/verloren!Denn ein Mann unreiner Lippen bin ichund inmitten eines Volkes unreiner Lippen wohne ich;denn den König JHWH Zebaoth haben meine Augen gesehen!“
Jes 8,16 –18
16 Einwickeln will ich die Bezeugung,versiegeln die Weisung unter denen, die ich belehrt habe,
17 und warten auf JHWH, der sein Gesicht verbirgtvor dem Haus Jakobs,
und auf ihn hoffen.
18 Siehe, ich und die Kinder, die mir JHWH gegeben hat,wir sind Zeichen und Vorbedeutungen in Israelvon JHWH Zebaoth, der auf dem Berg Zion wohnt (ñkÈÊWÏhÅ ).
Wie sehr Jes 6,1– 5 der religiösen „Symbolik des Zentrums“ 16 ver-pflichtet ist, ergibt sich aufgrund des vertikalen Gefälles, das im Motivdes „hohen und aufragenden Throns“ (V. 1a) sowie im Motiv der (Tür-)Zapfen/Schwellen (V. 4a) zum Ausdruck kommt, die vor der Stimmeder Seraphen erbeben. Da dieses „Beben“ der (unten befindlichen)Tempelschwellen eine Reaktion auf die Präsenz des (in der Höhe) thro-nenden Königsgottes sowie auf das Trishagion („Heilig, heilig, heilig. . .“) der Seraphen ist, ergibt sich für das Weltbild der JerusalemerTempeltheologie der (mittleren/späten) Königszeit eine dominante ver-
tikale Achse, die um eine horizontale, auf die „ganze Erde“ (V. 3b) be-zogene Dimension ergänzt wird: In der räumlichen Achse der Vertika-len überragt der Gottesthron den Tempel so hoch wie ein Berg („Got-tesbergvorstellung), während die davon abhängige horizontale Achseden Herrschaftsbereich dieses Königsgottes darstellt, nämlich die gan-ze Erde, in der sich seine verzehrende Heiligkeit Ehrfurcht gebietendäußert und auswirkt (V. 3b). Der von Jesaja im Jerusalemer Tempelvisionär geschauten Gegenwart JHWHs auf einem „hohen und aufra-
16 Siehe dazu METZGER, Wohnstatt; HARTENSTEIN, Unzugänglichkeit 30ff.41ff.109ff, undJANOWSKI, Wohnung.
7Gottes Weisheit in Jerusalem
genden Thron“ (V. 1a) entspricht damit die „Ausstrahlung“ der wirk-mächtigen Präsenz des Königsgottes in die „ganze Erde“ (V. 3b), d. h.bis an die Peripherie des von der Herrlichkeit des Königsgottes erfüll-ten und belebten Weltganzen. Schematisch lassen sich diese Relationenfolgendermaßen darstellen:
Gottesthron
HÖHE
Bewohnte Erde Bewohnte Erdeversus versus
Wüste/Meer Wüste/Meer
ZENTRUMPERIPHERIE
Tempel/StadtPERIPHERIE
(Randgebirge/Meer) (Randgebirge/Meer)
TIEFE
Tempelschwellen
Diese kosmisch dimensionierte Schekina-Vorstellung der JerusalemerTheologie, zu der auch die „Mitte“-Aussage von Ps 46,5f zu zählen ist,hat bei den klassischen Propheten ein kritisches Echo gefunden undihre Gerichtstheologie mitinspiriert (vgl. Am 5,17; Mi 3,11). Erst diedeuteronomische Zentralisationsformel spricht wieder von dem „Ort,den JHWH erwählt, um dort seinen Namen wohnen zu lassen (ñkÅ wÏÄPi el)/zu deponieren (ÕiwÊÇ )“: 17
dann sollt ihr alles, wozu ich euch verpflichte, zu der Stätte bringen, dieder Herr, euer Gott, erwählt, indem er dort seinen Namen wohnen lässt(ñkwÏ Pi el): eure Brandopfertiere und Schlachtopfertiere, eure Zehnten und
17 Vgl. Dtn 12,5.21; 14,23f; 16,2.6.11 und öfter; siehe dazu REUTER, Kultzentralisation121ff.130ff.134ff; LOHFINK, Kultzentralisation; ferner KELLER, Untersuchungen, undRICHTER, History.
8 BERND JANOWSKI
Handerhebungsopfer, und alle eure auserlesenen Gaben, die ihr demHerrn gelobt habt. (Dtn 12,11)
Die vertikale Dimension der vorexilischen Schekina-Theologie wird inder Exilszeit aufgrund der Zerstörung des Tempels (vgl. Ps 74,1f ) undder Neugestaltung der Zionstheologie transformiert,18 d. h. von derVertikalen gleichsam in die Horizontale überführt: Die Schekina-Theo-logie erhält jetzt eine nationale, auf die Restitution Israels als „VolkGottes“ bezogene, geradezu ,ekklesiologische’ Dimension, denn stattim Tempel oder auf dem Zion will JHWH nun „inmitten der Israeliten“wohnen.19 Signifikant dafür ist etwa Ez 43,7– 9 innerhalb der großenHeiligtumsvision Ez 40 – 48:
7 Und er sagte zu mir:
A „Menschensohn, (siehe) den Ort meines Thrones und den Ort mei-ner Fußsohlen, wo ich für immer inmitten der Israeliten wohnen will.
B Das Haus Israel aber soll meinen heiligen Namen nicht mehrverunreinigen,weder sie noch ihre Könige, durch ihre Buhlerei und die(Toten-)Opfer ihrer Könige ‹bei ihrem Tod› –
C 8 dadurch, dass sie ihre Schwelle neben meine Schwelle undihren Türpfosten neben meinen Türpfosten setzten,so dass (nur) eine Wand zwischen mir und ihnen lagund sie (immer wieder) meinen heiligen Namen
durch ihre Greuel,die sie begingen, verunreinigten,so dass ich sie in meinem Zorn vernichtete.
B 9 Nun mögen sie ihre Buhlerei und die (Toten-)Opfer ihrer Königevon mir entfernen,
A so will ich für immer in ihrer Mitte wohnen.“ (Ez 43,7– 9) 20
Dieser explizite Israel-Bezug ist das Novum der exilischen Schekina-Theologie. Wieder einen Schritt weiter führt demgegenüber die Sche-
kina-Theologie der persischen Zeit, die JHWHs Rückkehr zum Zion mitseinem Wohnen „in der Mitte Jerusalems“ verbindet. Dafür kommenneben dem dritten Nachtgesicht Sach 2,5 – 9 vor allem das HeilswortSach 2,14f und das Prophetenwort Sach 8,3 in Frage: 21
18 Siehe dazu JANOWSKI, Mitte 119ff.19 Vgl. Ez 43,7.9; Ex 25,8; 29,45f P g (siehe dazu unten), ferner Lev 16,16; Num 5,3; 35,34
(jeweils P s) und 1 Kön 6,11–13 (spätdeuteronomisch).20 Zur Interpretation dieses Textes siehe JANOWSKI, Mitte 122ff.21 Vgl. Joel 4,17.21; Ps 135,21 und öfter.
9Gottes Weisheit in Jerusalem
8 Und er sprach zu ihm:„Lauf, sprich zu diesem Bediensteten also:Als offene Siedlungen daliegen soll Jerusalem wegen der Menge von
Mensch und Tier in seiner Mitte.
9 Ich aber werde ihm werden, Spruch JHWHs,zu einer Feuermauer ringsherum,
und zur Herrlichkeit werde ich werden in seiner Mitte.“ (Sach 2,8f )
14 Juble und freue dich, Tochter Zion!Denn siehe, ich kommeund wohne (ñkÅ wÏÄ ) in deiner Mitte, spricht JHWH.
15 Und es werden sich versammeln viele Völker zu JHWH an jenem Tag,und sie werden mein Volk sein:Ich werde wohnen (ñkÅ wÏÄ ) in deiner Mitte,und du wirst erkennen, dass JHWH Zebaoth mich zu dir gesandt hat.(Sach 2,14f) 22
So sprach JHWH:„Ich kehre zurück zum Zionund wohne (ñkÅ wÏÄ ) inmitten Jerusalems.Dann wird Jerusalem ,Stadt der Wahrheit’ genanntund der Berg JHWH Zebaoths ,Berg der Heiligkeit’.“ (Sach 8,3)
Das ist eine neue ,Theologie der Stadt’, die eine Kombination der tem-pelorientierten Schekina-Theologie der vorexilischen Zeit mit der is-raelorientierten Schekina-Theologie der Exilszeit darstellt. Im ,neuenJerusalem’ wird JHWHs Herrlichkeit nicht mehr exklusiv an denZion/Tempel gebunden, sondern seinen Bewohnern unmittelbar undimmer sichtbar sein (vgl. Sach 2,8f ).
In der hellenistischen Zeit vollzieht sich abermals eine Transfor-mation, wenn die spätnachexilische Weisheitstheologie – Schöpfungs-konzeptionen der (spät-)persischen Zeit aufnehmend (Ijob 28,20 – 28;Spr 8,22 – 31) – die Frage nach dem „Ort“ der Weisheit in der Welt stelltund über die mediatrix Dei-Vorstellung von Ijob 28 und Spr 8 hinaus-gehend offenbarungstheologisch beantwortet: Nach dem Willen desSchöpfers soll die Weisheit als göttliche Schekina in Jakob Wohnungnehmen und in Israel ihren Erbbesitz erhalten (Sir 24,7f.9 –12).23 Auchdiese Verbindung wird umgeprägt – z. B. im äthiopischen Henoch(äthHen 42,1f ),24 wo die Einwohnung der himmlischen Weisheit nochnicht in diesem Äon Wirklichkeit wird, sondern wo sie zu den Engeln
22 Siehe dazu LUX, Jhwh Zebaot 385f.23 Siehe dazu unten.24 Siehe dazu unten Anm. 48.
10 BERND JANOWSKI
zurückkehrt und von dort in der messianischen Zeit auf die Gerechtenausgegossen wird (vgl. äthHen 62,13f).
Es geht bei allen diesen Bestimmungen einer mehrere Jahrhunderteumfassenden, hier nur in kurzen Strichen skizzierten Traditionsbil-dung immer um die Inhabitatio Dei in ihrer räumlichen (Tempel/Zion),personalen (Israel/Volk Gottes) und zeitlichen (Zukunft/Erfüllung derZeit) Dimension. Inhabitatio („Einwohnung“) bedeutet, dass Gott in dieWelt des Menschen eintritt, und dass er, indem er das tut, „die Para-meter der menschlichen Existenz, einschließlich der Räumlichkeit,nicht scheut“.25 Mit dem Sirach-Buch aus dem ersten Viertel des 2.Jahrhunderts v. Chr. erreicht diese Traditionsbildung eine Prägnanz,die für die weitere Entwicklung von grundlegender Bedeutung ist,26
auch wenn sie in Judentum und Christentum eine unterschiedlicheGestalt angenommen hat.27 Der im Folgenden zu besprechende Text Sir24,1–12 ist dabei sowohl sprachlich als auch theologisch einer der zen-tralen Brückentexte zwischen Frühjudentum und Urchristentum.
2. Zur Rezeption der alttestamentlichen Schekina-Theologie
in Sir 24
2. 1 Kompositorische Aspekte
Die Versuche, die 51 Kapitel des Sirach-Buchs zu gliedern, haben bis-lang noch nicht zu einem konsensfähigen Ergebnis geführt. Nach J.MARBÖCK 28 etwa weisen mehrere Indizien auf eine Struktur mit dreiTeilen (1,1– 23,27/28; 24,1– 42,14; 42,15 – 51,30) und einem Rahmen(1,1– 2,18 und 51,1– 30) hin. Das Selbstlob der Weisheit in Sir 24 bildetdiesem Vorschlag zufolge den Abschluss des ersten, mit dem program-matischen Weisheitsgedicht 1,1–10 einsetzenden Teils und zugleich,wie 24,32 – 34 zeigen, den Übergang zum zweiten Teil. „So steht“, wieG. SAUER formuliert, „wie ein tragendes Gerüst die Aussage über dieWeisheit am Anfang, in der Mitte und am Ende des Buches“.29 Auch
25 WYSCHOGROD, Inkarnation 22; vgl. WYSCHOGROD, Gott 24ff.188f.191.26 Siehe dazu zuletzt FRANKEMÖLLE, Frühjudentum 169ff.27 Siehe dazu unten.28 Siehe dazu MARBÖCK, Weisheit im Wandel 41ff; vgl. MARBÖCK, Gottes Weisheit 77,
und MARBÖCK, Jesus Sirach 409ff.29 SAUER, Jesus Sirach 35, vgl. 179. Zu einem neuen Gliederungsversuch anhand der
über das Buch verteilten Weisheitsgedichte siehe demnächst REITERER, F., Die Weis-heit als Strukturprinzip des Buches Ben Sira/Jesus Sirach.
11Gottes Weisheit in Jerusalem
nach O. KAISER, der einen anderen Aufbau zugrunde legt,30 markiertSir 24 die Mitte des Buchs, das seines Erachtens aber in zwei Hauptteile(Lehren Ben Siras: 1,1– 43,33; Lob der Väter: 44,1– 50,24) samt Prologund Schluss (50,25 – 51,30) gegliedert ist.
Die erste größere Einheit von Sir 24 umfasst als Ich-Rede der Weisheit
die V. 1– 22, auf die in V. 23 – 34 das Schlusswort des Weisen, d. h. desSiraziden, folgt. Die Ich-Rede der Weisheit setzt nach einer Ankündi-gung ihres Selbstlobs (V. 1f) mit der Beschreibung ihres Ausgangs ausdem Mund des Höchsten ein (V. 3 – 8), schildert danach ihre intensiveSuche nach einem Ruheort (V. 9 –12) und lädt nach einer Darstellungihres Wachstums (V. 13 –18) die Menschen dazu ein, von ihren Früch-ten zu genießen (V. 19 – 22):
I. Selbstlob der Weisheit
1– 2 Ankündigung3 – 8 Weg durch die Schöpfung und Einwohnung in Jakob/Israel9 –12 Einsetzung auf Zion und Verwurzelung im Volk Israel13 –18 Bilder vom Wachstum und von den Früchten der Weisheit19 – 22 Einladung an die Menschen zur Annahme der Weisheit
II. Schlusswort des Weisen
23 – 29 Identifikation von Weisheit und Tora 31
30 – 34 Autobiographische Notiz
Der Text, der im Folgenden im Zentrum steht (V. 1–12), schildert nacheiner Ankündigung ihres Selbstlobs (V. 1f) den Weg der Weisheit – dievon Anfang an in einem personalen Verhältnis zu Gott steht (V. 3f) 32 –durch den Kosmos und die Menschenwelt (V. 5 –7) bis zu ihrer Ein-wohnung in Jakob/Israel (V. 8), wo sie im heiligen Zelt auf dem ZionDienst tut und endgültig Wurzeln im Volk Israel schlägt (V. 9 –12):
30 Siehe dazu KAISER, Weisheit 130f.31 Siehe dazu GRUND, Himmel 348ff.32 Zur „Personifizierung“ der Weisheit siehe etwa GESE, Weisheit 223f, und VON LIPS,
Traditionen 153ff, zur Abgrenzung vom Begriff „Hypostasierung“ siehe FRANKE-MÖLLE, Frühjudentum 151.173ff.
12 BERND JANOWSKI
I. Ankündigung
1 Die Weisheit lobt sich selbst,und inmitten ihres Volkes rühmt sie sich.
2 In der Versammlung des Höchsten öffnet sie ihren Mund,und vor seiner Macht rühmt sie sich:
II. Weg der Weisheit durch die Schöpfung
3 „Ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor„aus dem Mund
und wie ein Nebel bedeckte ich die Erde.des Höchsten . . .“
4 Ich nahm Wohnung in den Höhen,und mein Thron stand auf einer Wolkensäule.
5 Den Kreis des Himmels umschritt ich allein,und in der Tiefe der Abgründe wandelte ich umher.
Ziel:6 Über die Wogen des Meeres und über die ganze Erde,Einwohnungund über jedes Volk und jede Nation herrschte ich.
in Israel7 Bei allen diesen (scilicet Völkern) suchte ich Ruheund in wessen Erbteil ich weilen könnte.
8 Da befahl mir der Schöpfer des Alls,�und der, der mich erschaffen, stellte mein Zelt hin,
„in Jakob/und sprach: ,In Jakob nimm Wohnung
in Israel . . .“und in Israel nimm Erbbesitz!’
III. Wirken der Weisheit in der Geschichte
9 Von Ewigkeit her, am Anfang, erschuf er mich,„von Ewigkeit
und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht.her . . .“
10 Im heiligen Zelt tat ich vor ihm Dienst,und so wurde ich auf Zion fest eingesetzt.
Ziel:11 In der Stadt, die er gleicherweise liebt,Verwurzelungließ er mich ruhen,
in Israelund in Jerusalem ist mein Machtbereich.�12 Und ich schlug Wurzeln in einem Volk,
„in einemdem Herrlichkeit verliehen ward,
Volk . . .“im Anteil des Herrn, in seinem Erbbesitz.“
Während V. 3 – 8 durch Verben der Bewegung – „hervorgehen“/„um-kreisen, umschreiten“/„umherwandeln“/„Ruhe suchen“ – charakte-risiert ist, so V. 9 –12 durch Verben der Ruhe und des Feststehens: „(stän-dig) Dienst tun“/„fest eingesetzt werden“/„ruhen lassen“/„Wurzelnschlagen“.33 An der Grenze zwischen diesen beiden Seinsweisen derWeisheit – ihrem Weg durch die Schöpfung auf der Suche nach einem
33 Vgl. MARBÖCK, Gottes Weisheit 78.
13Gottes Weisheit in Jerusalem
Ruheplatz (V. 3 –7) und ihrem Wirken in der Geschichte an einem kon-kreten Ort (V. 9 –12) – wird mit V. 8 der entscheidende Hinweis daraufgegeben, dass die Bewegung der Weisheit zur Ruhe kommt (vgl. V. 7),indem der Schöpfer ihr „Zelt“ (skhnh ≅ lhà aÊ/ñKÄ wÏ mÇ ) 34 an einen be-stimmten Ort hinstellt und deklariert: „In Jakob nimm Wohnung undin Israel nimm Erbbesitz!“ Diese Anordnung, die nicht nur die Klimaxvon V. 3 – 8, sondern auch die Spitzenaussage des gesamten Kapitelsdarstellt, lässt sich als Sapientialisierung der alttestamentlichen Sche-
kina-Theologie verstehen.
2. 2 Traditionsgeschichtliche Aspekte
Theologiegeschichtlich gehört Sir 24 in den Zusammenhang einer Tra-ditionsströmung des alten Israel,35 die man als „Theologisierung derWeisheit“ 36 bezeichnen kann und die in Spr 8,22 – 31 einen ihrer frühenReferenztexte (4. Jahrhundert v. Chr.) hat. Im Unterschied zur altenWeisheit und ihrem im Tun-Ergehen-Zusammenhang 37 prägnant zumAusdruck kommenden praktischen Lebenswissen geht die jüngere,theologisierte Weisheit davon aus, dass die Weisheit der Schöpfungeingestiftet ist und als Gabe des Schöpfers um Annahme durch dieMenschen wirbt. Diese Verbindung bzw. Identifizierung von Weisheitund Offenbarung/Tora ist das Charakteristikum der Selbstvorstel-lungsrede der Weisheit in Spr 8, die in V. 22 – 31 38 in Aussagen überihre kosmische Bedeutung gipfelt:
34 Siehe dazu MARBÖCK, Gottes Weisheit 80.35 Zum Ausdruck „Traditionsströmung“ siehe STECK, Strömungen.36 Siehe dazu den Überblick bei KEEL/SCHROER, Schöpfung 226ff; ZIMMERMANN, Theo-
logisierung 117ff; ZENGER, Eigenart 331f; WITTE, Schriften 437; FRANKEMÖLLE, Früh-judentum 150f.179ff.
37 Siehe dazu JANOWSKI, Tat; JANOWSKI, Vergeltung; RÖSEL, Tun-Ergehen-Zusammen-hang; SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, Vergeltung; FREULING, Grube, und GRUND, Tun-Ergehens-Zusammenhang.
38 Siehe dazu GESE, Weisheit 224ff; MEINHOLD, Sprüche 143ff; BAUMANN, Weisheitsge-stalt 111ff, und andere.
14 BERND JANOWSKI
Thema: Vorgeschöpflichkeit der Weisheit
22 JHWH schuf mich als Anfang seines Weges, chiastische Struktur:
als erstes seiner Werke, damals, Formulierungen mit
23 von uralters her wurde ich gewebt, tiwÏÇ arÈ und temporalem
von Anfang, von den Vorzeiten der Erde an. ñmÇ „von her/weg“
I. Erschaffung der Weisheit
24 Als es noch keine Fluten gab,wurde ich geboren,
als es noch keine Quellplätze schwervon Wasser gab, Vorzeitigkeit
25 bevor die Berge eingesenkt wurden, der Weisheit:vor den Hügeln wurde ich geboren, -ñiaÈ B /ÕrÃjà BÂ
26 als er Erdreich und Fluren noch nicht Formulierungengemacht hatte
und die frühesten Staubschichtendes Erdkreises.
II: Schöpfungshandeln JHWHs
27 Als er den Himmel festsetzte, war ich dort,als er den Kreis auf der Oberfläche
der Flut einritzte,28 als er die Wolken oben stärkte, Gleichzeitigkeit
als die Quellen der Flut stark wurden, der Weisheit:
29 als er dem Meer seine Grenze setzte, Infinitivus constructus
so dass die Wasser seinen Befehl nicht + BÂ -Formulierungen
überschreiten können,als er die Grundfesten der Erde anordnete,
Schluß: Spielende Weisheit vor Gott
30 da war ich neben ihm als Pflege-/Schoßkind,39 chiastische Strukur
und ich war Entzücken Tag für Tag, (V. 30ab.31):
spielend vor ihm zu jeder Zeit, „Entzücken“der
31 spielend auf dem Kreis seiner Erde, Weisheit vor Gott
und mein Entzücken war bei den Menschen. und bei den Menschen
39 Vgl. GESE, Weisheit 225: „da war ich bei ihm auf dem Schoß“, zu ñu´maÄ siehe nochMEINHOLD, Sprüche 134 Anm. 31; 147; BAUMANN, Weisheitsgestalt 131ff; KEEL/SCHROER, Schöpfung 220f („Expertin“), und andere. Mit einer „Infantilisierung derFrau“ (KEEL/SCHROER, Schöpfung 221 Anm. 13) hat die Übersetzung „Pflege-kind/Schoßkind“ meines Erachtens nichts zu tun.
15Gottes Weisheit in Jerusalem
Die präexistente Weisheit (V. 22f), deren Vorzeitigkeit vor aller Schöpfung
in V. 24 – 26 mithilfe von „als noch nicht“/„(be-)vor“-Wendungen undderen Gleichzeitigkeit mit der geschaffenen Welt durch „als“-Formulierun-gen ausgedrückt wird, erscheint nach V. 30f als mediatrix Dei, d. h. alseine personale Gestalt, in der sich Gott an die Welt vermittelt und –gemäß der chiastischen Struktur von V. 30ab – 31 40 – diese ihr Entzü-cken an der Schöpfungsweisheit hat:
„In der Schöpfungsordnung vermittelt sich Gott an die Welt, und in derErkenntnis der Weisheit kommt diese Vermittlung zum Ziel. [. . .] Die So-phia erscheint als mediatrix Dei. Jede Erkenntnis der Sophia auf seiten desMenschen führt zur Teilnahme an Gott. In ihr erschließt sich Gott demerkennenden und denkenden Menschen. In der Welt ist der Mensch nichtabsolut von Gott getrennt, sondern in der Erkenntnis der Schöpfungsord-nung nimmt er teil am Werk der Schöpfung und ist der Welt nicht nurdumpf und bewußtlos unterworfen.“ 41
Wenn wir von hier aus zum Sirach-Text zurückkehren, so lässt sichbeobachten, dass Sir 24,3 –12 an bestimmte Aspekte von Spr 8,22 – 31(und Ijob 28,20 – 28) anknüpft,42 im Übrigen aber darüber hinausgeht.Die größte Differenz besteht in der Verbindung von Schöpfung und Ge-
schichte in Sir 24,3 –12 (V. 3 – 8/V. 9 –12) gegenüber der Vermittlung der
Weisheit an die Menschen ohne Zuspitzung auf Israel in Spr 8,30f.43 Dieseinterpretatio israelitica der Schöpfungsweisheit geht deutlich aus Sir24,3 – 8 hervor, wo sich der Weg der Weisheit von der Totalität der
Schöpfung (V. 5 – 6a) über alle Menschen (V. 6b.7) auf Jakob/Israel (V. 8)zuspitzt: 44
40 Vgl. MEINHOLD, Sprüche 147.41 GESE, Weisheit 226.42 Und zwar besonders im Blick auf die Vorgeschöpflichkeit der Weisheit (Spr 8,22f.24 –
26/Sir 24,3f.9) und auf ihre Anwesenheit bei der Schöpfung (Spr 8,27– 29/Sir 24,5f),siehe dazu auch SKEHAN, Structures; MARBÖCK, Weisheit im Wandel 55f.61; MAR-BÖCK, Gottes Weisheit 79, und andere. Nach RICKENBACHER, Weisheitsperikopen 121,fehlen von Sir 24,8 an alle Parallelen zu Spr 8. Zum Vergleich zwischen Ijob 28 undSpr 8,22ff siehe GESE, Weisheit 223ff, und die Beiträge bei VAN WOLDE, Job 28.
43 Vgl. MARBÖCK, Weisheit im Wandel 56.44 Zur Theologie der „Gegenwart Gottes“ in Sir 24 siehe MARBÖCK, Weisheit im Wandel
46; MARBÖCK, Gottes Weisheit 78; GILBERT, eloge 348; TERRIEN, Play 139f, und GESE,Johannesprolog 182f.
16 BERND JANOWSKI
3 eÆ gvÁ aÆ poÁ sto matow yë ciÂstoy eÆ jhÄlûon
kaiÁ vë w oë miÂxlh kateka lyca ghÄn
4 eÆ gvÁ eÆ n yë chloiÄw kateskh nvsa
kaiÁ oë ûro now moy eÆ n sty l ìv nefeÂlhw
5 gyÄron oyÆ ranoyÄ eÆky klvsa mo nh
kaiÁ eÆ n ba ûei aÆ by ssvn periepa thsa
6 eÆ n ky masin ûala sshw kaiÁ eÆ n pa s ìh t ìhÄ g ìhÄ
kaiÁ eÆ n pantiÁ la ìvÄ kaiÁ eÍûnei eÆ kthsa mhn
7 metaÁ toy tvn pa ntvn aÆ na paysin eÆ zh thsa
kaiÁ eÆ n klhronomi ìa tiÂnow ayÆ lisûh somai
8 to te eÆ neteiÂlato moi oë ktiÂsthw aë pa ntvn
kaiÁ oë ktiÂsaw me kateÂpaysen thÁ n skhnh n moy
kaiÁ eiÆÄpen eÆ n Iakvb kataskh nvson
kaiÁ eÆ n Israhl kataklhronomh ûhti
3 „Ich ging aus dem Mund des Höchsten hervor Ursprung:
und wie ein Nebel bedeckte ich die Erde. Mund des
4 Ich nahm Wohnung in den Höhen, Höchsten
und mein Thron stand auf einer Wolkensäule.
5 Den Kreis des Himmels umschritt ich allein, �und in der Tiefe der Abgründe wandelte ich umher. Weg:
6 Über die Wogen des Meeres und über ganzer Kosmos/
die ganze Erde, alle Völker
und über jedes Volk und jede Nation herrschte ich. �vergebliche
7 Bei allen diesen (scilicet Völkern) suchte ich Ruhe Suche nachund in wessen Erbteil ich weilen könnte. einem Ruheort
8 Da befahl mir der Schöpfer des Alls, �und der, der mich erschaffen, Ziel:
stellte mein Zelt hin, Einwohnung in
und sprach: ,In Jakob nimm Wohnung Jakob/Israel
und in Israel nimm Erbbesitz!’“ � inclusio V. 12
Der Weg der Weisheit aus der unmittelbaren Nähe Gottes (V. 3f) zueinem konkreten irdischen Ort (V. 8) 45 bildet das geheimnisvolle Zu-sammenspiel von Transzendenz (Hervorgehen aus dem Mund Gottes)und Immanenz (Einwohnung in Jakob/Israel) und damit die Konde-
szendenz der göttlichen Weisheit ab. Dieser Weg beginnt – der Struktur
45 Zu V. 3 – 8 als Stanze, die durch den Aspekt der Bewegung (V. 3: „aus dem Mund desHöchsten . . .“; � V. 8: „in Jakob/Israel . . .“) zusammengehalten wird, siehe auchGILBERT, eloge 330f.
17Gottes Weisheit in Jerusalem
von Gen 1,1– 2,4a (V. 3 – 5!) und Ps 104 (V. 1– 4!) entsprechend 46 –,oben’, d. h. „in den Höhen“ // „auf einer Wolkensäule“ (V. 4),47 wo dieWeisheit zuerst „Wohnung nimmt“ (kataskhnoyÄn ≅ ñkÅ wÏÄ , vgl. V. 8b), umvon dort aus in vertikaler Richtung (Komposita mit kata-) den Weg überden Horizont („Kreis des Himmels“) nach ,unten’ bis zum Abyssos(„Tiefe der Abgründe“) und weiter in horizontaler Richtung bis zu allenVölkern der Erde zu nehmen (V. 5 – 6a/V. 6b). Und er kommt schließ-lich, weil die „Ruhe“ (aÆ na paysiw ≅ hxÄ Unm ) bei keinem dieser Völkergefunden wird (V. 7),48 an einem Ort zum Ziel, der aufgrund des Zu-satzes „in Jakob // in Israel“ das Spezifikum dieser Traditionsbildungausmacht, insofern er gegenüber Spr 8,30f (vgl. „bei den Menschen“V. 31b) die Korrelation von Weltschöpfung und Israel-Geschichte 49 ins Zen-trum rückt. „Damit ist bei Ben Sira und im Weisheitsdenken Israelsüberhaupt zum ersten Mal der Schritt auf eine Lokalisierung und Ein-grenzung der eben noch universal waltenden Weisheit hin getan.“ 50
Die präexistente Weisheit (V. 9) ist jetzt im „heiligen Zelt“ auf demZion wirksam, wo sie dem Höchsten dient und so zu ihrer „Ruhe“kommt (V. 10f). Abschließend werden die Themen von V. 7f (Israel alsVolk Gottes, Erbbesitz) durch die inclusio von V. 12 wieder aufgegrif-fen:
46 Zum Vergleich zwischen Ps 104 und Sir 24 siehe HOSSFELD, Schöpfungsfrömmigkeit 132.47 Unter Hinweis auf Sir 24,9 („vor aller Zeit“); Ex 25,8 –10 und 26,30 fragt MARBÖCK,
Gottes Weisheit 79 mit Anm. 21, meines Erachtens zu Recht, ob „vielleicht sogarangedeutet [ist], daß sie [scilicet die Weisheit] im himmlischen Modell des Heiligtumsgewohnt hat, das in Zelt und Tempel in Israel Wirklichkeit wird“, siehe dazu imFolgenden.
48 Vgl. äthHen 42,1– 3, wo die Weisheit allerdings wieder an ihren himmlischen Ortzurückkehrt, weil sie keinen Ort in der Welt findet (vgl. äthHen 84,3: die Weisheit alsThronbeisitzerin Gottes):
„1 Die Weisheit fand keinen Platz, wo sie wohnen konnte, da hatte sie eine Woh-nung in den Himmeln. 2 Die Weisheit ging aus, um unter den Menschenkindernzu wohnen, und sie fand keine Wohnung; die Weisheit kehrte an ihren Ort zurückund nahm ihren Sitz unter den Engeln. 3 Und die Ungerechtigkeit kam hervoraus ihren Kammern: die sie nicht suchte, fand sie, und wohnte unter ihnen, wieder Regen in der Wüste und wie der Tau auf dem durstigen Land“ (ÜbersetzungUHLIG, Henochbuch 584; siehe dazu auch GESE, Weisheit 231, und LÖNING/ZEN-GER, Anfang 107ff ).
Zur Figur der „entschwundenen“ Weisheit siehe noch 4 Esra 5,9f und syrBar 48,36.Die Aussage vom Erscheinen der Weisheit (?) auf Erden und ihrem Aufenthalt unterden Menschen in Bar 3,38 dürfte ein frühchristlicher Zusatz sein, siehe dazu SCHI-MANOWSKI, Weisheit 63f, und STECK, Baruch 53f.
49 Vgl. oben. Zur „Weisheit in der Geschichte Israels nach dem Siraziden“ siehe denExkurs bei MARBÖCK, Weisheit im Wandel 68ff.
50 MARBÖCK, Weisheit im Wandel 62. GILBERT, eloge 331, nennt den Weg der WeisheitV. 3 – 8 treffend „un mouvement de descente et de concentration“.
18 BERND JANOWSKI
9 proÁ toyÄ aiÆvÄnow aÆ p’ aÆ rxhÄw eÍktiseÂn me
kaiÁ eÏvw aiÆvÄnow oyÆ mhÁ eÆ kliÂpv
10 eÆ n skhn ìhÄ aë gi ìa eÆ nv pion ayÆ toyÄ eÆ leitoy rghsa
kaiÁ oyÏtvw eÆ n Sivn eÆsthriÂxûhn
11 eÆ n po lei hÆ gaphmeÂn ìh oë moiÂvw me kateÂpaysen
kaiÁ eÆ n Ieroysalhm hë eÆ joysiÂa moy
12 kaiÁ eÆ rriÂzvsa eÆ n la ìvÄ dedojasmeÂn ìv
eÆ n meriÂdi kyriÂoy klhronomiÂaw ayÆ toyÄ
9 „Von Ewigkeit her, am Anfang, erschuf er mich, Präexistenz und
und bis in Ewigkeit vergehe ich nicht. Ewigkeit
� Sir 1,1.4
10 Im heiligen Zelt tat ich vor ihm Dienst,und so wurde ich auf Zion fest eingesetzt. Kult im Tempel
11 In der Stadt, die er gleicherweise liebt, und Ruhen in der
ließ er mich ruhen, Stadt Jerusalem
und in Jerusalem ist mein Machtbereich.
12 Und ich schlug Wurzeln in einem Volk, Verwurzelungdem Herrlichkeit verliehen ward, in Israel
im Anteil des Herrn, in seinem Erbbesitz.“ � inclusio V. 7f
Als Hintergrund für diese neue Form der Schekina-Theologie kommtnicht nur die alttestamentliche menuh
˙ah- und nah
˙alah-Tradition von Dtn
12,9f; 25,19 und Ps 132,7f.14,51 sondern auch die priesterliche Scheki-
na-Tradition in Frage, für die – ebenso wie für Sir 24,1– 22 – der Zu-sammenhang von Schöpfung und Tempel konstitutiv ist.52 Damit stelltdie Weisheitstheologie von Sir 24 „eine überaus kühne, umfassendeVerbindung alttestamentlicher Traditionen“ 53 dar, die G. T. SHEPPARD
als „hermeneutical construct“ bezeichnet hat.54
Dieser Sachverhalt soll noch etwas vertieft werden. Wie ich an an-derer Stelle gezeigt habe, hat sich die priesterliche Grundschrift (Pg) inihrer Verwendung von ñkÅ wÏÄ + Subjekt JHWH/„Herrlichkeit JHWHs“/„Wolke“ auf wenige, jedoch theologisch zentrale Texte beschränkt
51 Siehe dazu GESE, Johannesprolog 182f; GESE, Weisheit 228; MARBÖCK, Weisheit imWandel 68ff; MARBÖCK, Gottes Weisheit 80, und SCHOLTISSEK, Sprache 102. Zur deu-teronomisch/deuteronomistischen „Ruhe“-Konzeption siehe BRAULIK, Konzeption.
52 In diese Richtung gehen offensichtlich auch die Andeutungen bei MARBÖCK, Weis-heit im Wandel 64; MARBÖCK, Gottes Weisheit 79f, vgl. GESE, Weisheit 228.
53 MARBÖCK, Gottes Weisheit, 85.54 Siehe dazu SHEPPARD, Wisdom 12ff.159f.
19Gottes Weisheit in Jerusalem
(Ex 24,16; 25,8; 29,45f; 40,35).55 Wichtig für deren Verständnis ist dieBeachtung ihres jeweiligen Ortes im Gesamtaufriss der priesterlichenSinai-Geschichte (Ex *19,1– 40,35Pg).56 Während die ñkÅ wÏÄ -Aussagen Ex24,16 und Ex 40,35 jeweils in den Rahmenstücken Ex 19,1 + 24,15b –18aa (Gegenwart der JHWH-Herrlichkeit auf dem Sinai) und Ex 40,17+ 40,34f (Gegenwart der JHWH-Herrlichkeit auf dem Begegnungszelt)begegnen, gehören Ex 25,8 und Ex 29,45f zum Mittelstück (Ex *25,1–39,43: Heiligtumsbau) der priesterschriftlichen Sinai-Geschichte. Hierwiederum bildet die JHWH-Rede Ex 29,43 – 46 den sachlichen Höhe-punkt:
43a Dort werde ich den Israeliten begegnenb und mich als heilig erweisen in meiner Herrlichkeit:
44a Ich werde das Begegnungszelt und den Altar heiligenb und Aaron und seine Söhne werde ich heiligen, dass sie mir
als Priester dienen.45a Und ich werde inmitten der Israeliten wohnen
b und ich werde ihnen Gott sein (BF).46ab Und sie werden erkennen (EF), dass ich JHWH, ihr Gott, bin (SF),
der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hat (HF),ag um in ihrer Mitte zu wohnen.b Ich bin JHWH, ihr Gott (SF).
Diese JHWH-Rede stellt „eine pointierte Zusammenfassung der Ge-danken von P über den Sinn des gesamten Heiligtums samt seinerPriesterschaft“ 57 dar. Denn dieses Zeltheiligtum, dessen himmlisches„Modell, Urbild“ (tinÇ b TÅ ) Mose auf dem Sinai gezeigt wird (Ex 24,15b –18aa) und dessen Bauanweisungen Ex 26* detailliert entfaltet, ist nachPg der irdische Ort, an dem JHWH inmitten seines Volkes „wohnen“(Ex 25,8) oder – wie Ex 29,43 – 46 formuliert – an dem er den Israeliten„begegnen“, ihnen „sich offenbaren“ (V. 43) will. Dabei führt in Ex29,43 – 46 die thematische Linie vom dyÅ u´n „begegnen, sich offenbaren“(V. 43) über das wÏDÈqÇ „heiligen“ (V. 44) zu den ñkÅ wÏÄ -Aussagen in V. 45aund V. 46ag, denen mit ihren formelhaften Wendungen (eingliedrigeBundesformel: BF, Erkenntnisformel: EF, Selbstvorstellungsformel: SF,Herausführungsformel: HF) eine rahmende Funktion zukommt. Mitdiesem Stilmittel hat die Priesterschrift erreicht, dass nicht das Wohnen
55 Siehe dazu JANOWSKI, Tempel; ferner OWCZAREK, Vorstellung, und DOHMEN, Exodus273f.399ff.
56 Siehe dazu und zum thematischen Zusammenhang von Ex 29,45f mit Gen 17,7f undEx 6,6f ausführlicher JANOWSKI, Sühne 195ff.303ff.328ff.356f.
57 KOCH, Priesterschrift 31.
20 BERND JANOWSKI
JHWH in Israel als solches, „sondern – und damit führt P g das Woh-nen Jahwes auf seinen tiefsten Bedeutungsgehalt zurück[. . .] – die Vor-stellung von Jahwe als dem Gott Israels die eigentliche Sinnspitze vonEx 29,45.46 bildet“.58
Schlägt man nun von dieser Sinnmitte der priesterlichen Sinai-Geschichte einen Bogen zu der die Sinai-Theophanie abschließendenDarstellung in Ex 40,17.34f,59 so wird deutlich, dass mit dieser ,Besitz-ergreifung’ des Heiligtums durch die JHWH-Herrlichkeit das auf demSinai begonnene Geschehen der Gott-Mensch-Begegnung (Ex 24,15b –18aa) zu seinem (vorläufigen) Abschluss kommt: Indem die „Herrlich-keit JHWHs“ ihren Erscheinungsort vom Sinai zum fertiggestellten„Begegnungszelt“ (dyÈ u
Çm lhà aÊ) verlagert, repräsentiert dieses von nun
an – gleichsam als der ,Sinai auf der Wanderung’ (B. JACOB) – den Ortder Offenbarungsgegenwart JHWHs in Israel.
Ebenso wichtig für Sir 24,1– 22 wie die ñkÅ wÏÄ -Aussagen von Ex 29,45fist die schöpfungstheologische Dimension der priesterlichen Sinai-Ge-schichte. Diese Dimension zeigt sich vor allem an der strukturellenEntsprechung zwischen der priesterlichen Schöpfungsgeschichte (Gen1,1– 2,4a) und der priesterlichen Sinai-Geschichte (Ex *16,1– 40,35), diejeweils von einem Sieben-Tage-Schema geprägt sind (Gen 1,3 – 31: 6Tage/Gen 2,2f: 7. Tag bzw. Ex 24,*15b –18aa: 6 Tage � 7. Tag).60 DieserSachverhalt weist darauf hin, dass Ex *25,1– 39,43 als der komposito-risch zentrale Abschnitt der priesterlichen Sinai-Geschichte – der dieAnweisungen zum Bau des Heiligtums (Ex 25,8a.9*; *26,1– 27,8) unddie Ankündigung vom „Wohnen“ JHWHs inmitten der Israeliten (Ex29,*43 – 46,61 vgl. 25,8b) zum Thema hat – die Konkretisierung des En-des der priesterlichen Schöpfungsgeschichte sein will. Damit kommtdie in der Schöpfung grundgelegte Hinwendung Gottes zur Welt zurEntfaltung – und zwar als Hinwendung JHWHs zu Israel oder mit denWorten der Priesterschrift: als „Wohnen“ (ñkÅ wÏÄ ) JHWHs inmitten derIsraeliten.
Das ist nun auch der für Sir 24,1– 22 entscheidende Gesichtspunkt:Wie nach der Priesterschrift erst vom Sinai her erkennbar wird, wasmit Gottes Schöpfungshandeln „am Anfang“ intendiert war – nämlichGemeinschaft mit dem Menschen/mit Israel zu haben –, so besteht auch
58 WEIMAR, Untersuchungen 135; vgl. WEIMAR, Meerwundererzählung 227f, und GÖRG,dyÅ iÄ 706.
59 Siehe dazu JANOWSKI, Tempel 224ff.60 Siehe dazu ausführlicher JANOWSKI, Tempel 232ff.237ff.61 Siehe dazu oben.
21Gottes Weisheit in Jerusalem
nach Sir 24,1– 22 der tiefste Sinn des Wegs der göttlichen Weisheit inder Zuwendung zur Schöpfung (V. 5f), die in ihrer „Einwohnung“ inJakob/Israel (V. 8) ihr Ziel erreicht. Mit diesem Konzept, das Schöp-fung und Geschichte integriert und damit der im Hellenismus längst inGang befindlichen, folgenreichen Diastase von Schöpfung und Offen-barung, von „geistiger Weltdurchdringung und transzendenter Offenba-rung“ 62 entgegentritt,63 erreicht die alttestamentlich-frühjüdische Weis-heitstheologie eine gedankliche Tiefe, die ihresgleichen sucht. Es istdarum alles andere als verwunderlich, dass gerade dieses Weisheits-konzept im Urchristentum aufgegriffen wird, um das Geheimnis derInkarnation auszusagen.
3. Zusammenfassung und Ausblick
Das Selbstlob der Weisheit Sir 24,1– 22, so können wir unsere Überle-gungen zusammenfassen, stellt eine überaus kühne Synthese und zu-gleich Zuspitzung der vorexilischen und exilisch-nachexilischen Sche-
kina-Theologie(en) dar. Während die Schekina-Theologie der vorexili-
schen Zeit einen tempel- bzw. zionstheologischen Hintergrund hatte(Jes 8,18; Ps 46,5f; Dtn 12,5.11; 14,23f; 16,2.6.11 und öfter; prophetischeKritik in Am 5,17; Mi 3,11 und öfter), geschah in der Schekina-Theologieder Exilszeit insofern ein Umbruch, als sie jetzt eine nationale, auf dieRestitution Israels als Volk Gottes bezogene, gleichsam ,ekklesiologi-sche’ Komponente erhielt (Ps 74,1f; Ez 43,7.9; Ex 25,8; 29,45f; 1 Kön6,11–13, vgl. Ex 33,5 und öfter). In persischer Zeit trat dann mit dem Baudes Zweiten Tempels der Heiligtumsbezug wieder in Erscheinung,ohne dass der Israel-Bezug zurückgenommen wurde (Sach 2,9.14f; 8,3;Joel 4,17.21; Ps 135,21 und öfter). Ein für die urchristliche Profilierungdes Themas (vgl. Lk 17,20f; Joh 1,14; Off 21,3 und öfter) entscheidenderSchritt wurde schließlich in hellenistischer Zeit mit dem Theologumenonder Einwohnung der Weisheit in Jakob/Israel bzw. auf dem Zion ge-tan (Sir 24,7f.9 –12, Vorläufer in Ijob 28,20 – 28 und Spr 8,22 – 31), fürdas die Integration von Weltschöpfung und Heilsgeschichte, d. h. Gottes„Zuwendung zur Schöpfung – insbesondere zu Israel“,64 charakteristischist.
62 GESE, Weisheit 230.63 Vgl. MARBÖCK, Gottes Weisheit 86, und ausführlich KAISER, Anknüpfung.64 MARBÖCK, Gottes Weisheit 85 (Kursive im Original).
22 BERND JANOWSKI
Auf der anderen Seite bildet Sir 24,1– 22 eine traditionsgeschicht-liche Brücke zu den johanneischen Immanenzaussagen 65 und hier be-sonders zur Inkarnationschristologie des Johannes-Prologs:
KaiÁ oë lo gow saÁ rj eÆ geÂneto
kaiÁ eÆ skh nvsen eÆ n hë miÄn
kaiÁ eÆûeasa meûa thÁ n do jan ayÆ toyÄ
do jan vë w monogenoyÄw paraÁ patro w
plh rhw xa ritow kaiÁ aÆ lhûeiÂaw
Und das Wort wurde Fleischund wohnte unter uns,66
und wir sahen seine Herrlichkeit,eine Herrlichkeit als des Einziggeborenen vom Vater,voll Gnade und Wahrheit. (Joh 1,14)
Wie im Alten Testament die Vorstellung von der Einwohnung JHWHsauf dem Zion unter den Israeliten oder in Jerusalem mit dem LeitverbñkÅ wÏÄ ausgedrückt wird, so wird auch im Johannes-Prolog 67 jene Bewe-gung des Logos von seinem Sein bei Gott/in der Schöpfung (1,1– 3)hin zu seiner spezifischen Anwesenheit unter den Menschen als„wohnen/Wohnung nehmen“ ( skhnoyÄn ≅ ñkÅ wÏÄ ) 68 bezeichnet. Und wieim Alten Testament wird das, was die Gegenwart des göttlichen Logoskennzeichnet, als dessen „Herrlichkeit“ (do ja ≅ du
ÇbKÄ ) bestimmt. Diese
„sehen“ die Wir und erkennen darin die Gegenwart des lebendigenGottes, der sich in seinem Sohn inkarniert hat.69 Jesus, so schreibt derjüdische Religionsphilosoph M. WYSCHOGROD,
„diese Knechtsgestalt, dieser verachtete, gekreuzigte Jude, war nicht ein-fach Mensch, sondern in ihm konnte die Gegenwart Gottes entdeckt wer-den. Die Kirche hielt an diesem Glauben fest, weil sie an diesem Judenfesthielt, an seinem Fleisch und nicht nur an seinem Geist, an seinem jü-dischen Fleisch am Kreuz, an einem Fleisch, in dem Gott gegenwärtig war,inkarniert, die Welt des Menschen durchdringend, Mensch werdend“.70
65 Vgl. SCHOLTISSEK, Sprache 102f.66 HOFIUS, Struktur 22 mit Anm. 132, übersetzt ingressiv: „nahm Wohnung“; SCHWINDT,
Gesichte 409, plädiert demgegenüber für ein Ineinander von ingressivem („nahmWohnung“) und komplexivem („wohnte“) Bedeutungsaspekt.
67 Zu den hier interessierenden Aussagen des Johannes-Prologs siehe GESE, Johannes-prolog 152ff; GESE, Weisheit 243ff; THEOBALD, Anfang 102ff; THEOBALD, Gott 79ff;MARBÖCK, Gottes Weisheit 86f; SCHIMANOWSKI, Weisheit 53ff; HOFIUS, Struktur 1ff;MÜLLER, Menschwerdung 40ff; LÖNING/ZENGER, Anfang 90ff; SCHOLTISSEK, Sprache189ff; THYEN, Johannesevangelium 88ff; PAROSCHI, Incarnation 111f; SCHWINDT, Ge-sichte 397ff, und andere.
68 Siehe dazu MICHAELIS, skhno v; BÜHNER, skhno v; HOFIUS, Struktur 22 mit Anm. 132;THYEN, Johannesevangelium 93f, und andere.
69 Vgl. HOFIUS, Struktur 22f.70 WYSCHOGROD, Inkarnation 26.
23Gottes Weisheit in Jerusalem
Ob man die Menschwerdung des Logos im Sinne einer „Ersetzung“des Tempels durch Christus oder als „Vollendung“ des alttestamentli-chen Offenbarungsgeschehens versteht (für beide Deutungen gibt esprominente Vertreter) – festzuhalten bleibt, dass die Gegenwart Gottesim fleischgewordenen Logos ihre ursprüngliche Bindung an den Tem-pel/Kult, die das Kennzeichen der alttestamentlichen Schekina-Theo-logie ist, transzendiert und in Jesus Christus menschliche Gestalt an-genommen hat.71 Darin liegt das Neue der johanneischen Inkarnati-onschristologie, die aber – bei aller Differenz – ohne den Rekurs auf diealttestamentliche Schekina- und die frühjüdische Weisheits-Theologienicht zu verstehen ist.72
Dieser Bezug von Joh 1,14 zum Alten Testament (und zum Früh-judentum) kann allerdings, wie vor allem H. SEEBASS hervorgehobenhat, nur als ein dialektischer bezeichnet werden:
„Dies Wort [scilicet Joh 1,14], so scheint mir, ist überhaupt nur verständlich,wenn man es in seinem dialektischen Bezug zum Alten Testament sieht.Als wollte es all das in einer Formel, besser noch in einem Lehrsatz zusam-menfassen, [. . .] daß der Gott der Bibel nur in Bezug zu seinen Menschenerkennbar sein will. Ineins damit aber unterscheidet es sich von allen nurdenkbaren Sätzen des Alten Testaments, weil dies von keinem seiner Gro-ßen sagen könnte: das Wort ward Fleisch. Das Wort geht also einerseitsüber das alttestamentlich Denkbare in schockierender Weise hinaus, weil esGott in einem ungeheuer eindeutigen Bezug zu einem ganz bestimmtenMenschen sieht, in dem das Wort Fleisch ward. Andererseits haftet es ge-rade mit seiner Grundvorstellung ganz im Gottesverstehen des Alten Testa-ments“.73
Die eigentliche Aussageabsicht von Joh 1,14 dürfte darin zu sehen sein,dass sich der Logos, der im Anfang bei Gott war (Joh 1,1f), erniedrigt
71 Darin liegt die differentia specifica zwischen Joh 1,14 und der alttestamentlich-frühjü-dischen Schekina-Theologie, vgl. SCHOLTISSEK, Sprache 91: „Nach alttestamentlichemZeugnis wohnt Gott in der Höhe bzw. im Himmel und auf dem Zion bzw. inmittenseines Volkes (vgl. Jes 33,5; Ps 2,4; 9,12; Tob 5,17; die Bundesformel), aber nicht imMenschen“, vgl. FRANKEMÖLLE, Frühjudentum 199, und SCHWINDT, Gesichte 409.Von der Immanenz Gottes im Menschen spricht zum ersten Mal TestXII: TestDan 5,1;TestJos 10,2 und TestBenj 6,4, siehe dazu SCHOLTISSEK, Sprache 98f.191, und zur Sacheim Folgenden.
72 Zu den motivlichen Querverweisen zwischen dem Johannes-Prolog und frühjüdi-schen Weisheitstexten siehe THEOBALD, Anfang 102ff. Speziell zu der These, dass dieLogostheologie Philos von Alexandrien eine Brücke zur neutestamentlichen Christo-logie darstellt, siehe zuletzt FRANKEMÖLLE, Frühjudentum 186ff, der im Übrigenebenfalls an der diesbezüglichen Differenz zwischen Frühjudentum und Urchristen-tum festhält, vgl. unten Anm. 74.
73 SEEBASS, Gott 50, vgl. 217f, ferner SEEBASS, Theologie 45; MÜLLER, Menschwerdung50f, und andere.
24 BERND JANOWSKI
hat und Mensch geworden, d. h. in die volle Kreatürlichkeit desMenschseins eingetreten ist.74 Nach rabbinischem Verständnis nimmtGott zwar einzelne Züge einer irdischen Existenz an, doch ist er nie ineiner endgültigen Weise „Fleisch geworden“ und hat so „unter unsWohnung genommen“.75 Das aber ist die Sinnspitze von Joh 1,14. Dergöttliche Schöpfungslogos hat in einem geschichtlich begrenzten Le-ben, in Jesus dem Christus, seine eschatologische Gestalt gefunden, dieals „Herrlichkeitserscheinung“ offenbar wurde, indem sie „unter unsWohnung nahm“.76 Das Sehen dieser Herrlichkeit wird vom Text alsWahrnehmung der im Sohn vollkommen repräsentierten Offenbarungdes Vaters beschrieben. Für das Judentum ist diese Zuspitzung nichtakzeptabel, weil das Christentum die „jüdische Tendenz zur Räumlich-keit“ 77 so zugespitzt hat, dass sie eine „körperliche Form“ 78 annimmt.Damit wird die alttestamentliche Schekina-Tradition, die schon mit Sir24,1– 22 eine umfassende Transformation erfahren hatte, noch einmaltransformiert, indem Jesus Christus zum fleischgewordenen Wort Got-tes wird, das „unter uns wohnte“.
Bibliographie
ASSMANN, J., Ägypten. Theologie und Frömmigkeit einer frühen Hochkultur(UB 366), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1984.
ASSMANN, J., Einwohnung. Die Gegenwart der Gottheit im Bild, in: ASSMANN,J., Ägyptische Geheimnisse, München 2004, 123 –134.
BARTHEL, J., Prophetenwort und Geschichte. Die Jesajaüberlieferung in Jes 6 – 8und 28 – 31 (FAT 19), Tübingen 1997.
BAUMANN, G., Die Weisheitsgestalt in Proverbien 1– 9. Traditionsgeschichtlicheund theologische Studien (FAT 16), Tübingen 1996.
BERLEJUNG, A., Die Theologie der Bilder. Herstellung und Einweihung vonKultbildern in Mesopotamien und die alttestamentliche Bilderpolemik(OBO 162), Freiburg Schweiz/Göttingen 1998.
74 Vgl. FRANKEMÖLLE, Frühjudentum 199: „Die in den ntl Texten behauptete exklusiveKonzentration auf Jesus Christus bleibt der unaufhebbare Dissens zwischen christ-lichem und jüdischem Glauben, letztere auch in seiner griechischen Interpretationdurch Philon und durch die Weisheitstheologen.“
75 Vgl. THOMA, Inkarnation.76 Vgl. BÜHNER, skhno v, ferner THEOBALD, Anfang 53ff.118ff.77 WYSCHOGROD, Inkarnation 22.78 WYSCHOGROD, Inkarnation 22.
25Gottes Weisheit in Jerusalem
BRAULIK, G., Zur deuteronomistischen Konzeption von Freiheit und Frieden, in:BRAULIK, G., Studien zur Theologie des Deuteronomiums (SBAB 2), Stutt-gart 1988, 219 – 230.
BÜHNER, J.-A., skhno v, in: EWNT III, 1983, 603f.
DIETRICH, M., Das Kultbild in Mesopotamien, in: DIETRICH, M./LORETZ, O.,„Jahwe und seine Aschera“. Anthropomorphes Kultbild in Mesopotamien,Ugarit und Israel. Das biblische Bilderverbot (UBL 9), Münster 1992, 7– 38.
DOHMEN, C., Exodus 19 – 40. Übersetzt und ausgelegt (Herders TheologischerKommentar zum Alten Testament), Freiburg/Basel/Wien 2004.
ERNST, H., Die Schekhına in rabbinischen Gleichnissen (JudChr 14), Bern u. a.1994.
ESCHWEILER, P., Bildzauber im alten Ägypten. Die Verwendung von Bildernund Gegenständen in magischen Handlungen nach den Texten des Mitt-leren und Neuen Reiches (OBO 137), Freiburg Schweiz/Göttingen 1994.
FRANKEMÖLLE, H., Frühjudentum und Urchristentum. Vorgeschichte – Verlauf –Auswirkungen (4. Jahrhundert v. Chr bis 4. Jahrhundert n. Chr.) (KStTh 5),Stuttgart 2006.
FREULING, G., „Wer eine Grube gräbt . . .“. Der Tun-Ergehen-Zusammenhangund sein Wandel in der alttestamentlichen Weisheitsliteratur (WMANT102), Neukirchen-Vluyn 2004.
GESE, H., Der Johannesprolog, in: GESE, H., Zur biblischen Theologie. Alttesta-mentliche Vorträge, Tübingen 3 1989, 152 – 201.
GESE, H., Die Weisheit, der Menschensohn und die Ursprünge der Christologieals konsequente Entfaltung der biblischen Theologie, in: GESE, H., Alttesta-mentliche Studien, Tübingen 1991, 218 – 248.
GILBERT, M., L’eloge de la Sagesse (Siracide 24): RTL 5 (1974) 326 – 348.
GÖRG, M., dyÅ iÄ , in: ThWAT III, 1982, 697–706.
GÖRG, M., ñkÅ wÏÄ , in: ThWAT VII, 1993, 1337–1348.
GOLDBERG, A., Untersuchungen über die Vorstellung von der Schekhinah in derfrühen rabbinischen Literatur – Talmud und Midrasch (SJ 5), Berlin 1969.
GRUND, A., „Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes“. Psalm 19 im Kon-text der nachexilischen Toraweisheit (WMANT 103), Neukirchen-Vluyn 2004.
GRUND, A., Tun-Ergehens-Zusammenhang. I. Biblisch, in: RGG 4 VIII, 2005, 654 –656.
HARTENSTEIN, F., Die Unzugänglichkeit Gottes im Heiligtum. Jesaja 6 und derWohnort JHWHs in der Jerusalemer Kulttradition (WMANT 75), Neukir-chen-Vluyn 1997.
HOFIUS, O., Struktur und Gedankengang des Logos-Hymnus in Joh 1,1–18, in:HOFIUS, O./KAMMLER, H.-C., Johannesstudien. Untersuchungen zur Theo-logie des vierten Evangeliums (WUNT 88), Tübingen 1996, 1– 23.
HORNUNG, E., Der Eine und die Vielen. Altägyptische Götterwelt, Darmstadt6 2005.
26 BERND JANOWSKI
HOSSFELD, F.-L., Schöpfungsfrömmigkeit in Ps 104 und bei Jesus Sirach, in:FISCHER, I./RAPP, U./SCHILLER, J. (Hg.), Auf den Spuren der schriftgelehr-ten Weisen. Festschrift für Johannes Marböck anlässlich seiner Emeritie-rung (BZAW 331), Berlin/New York 2003, 129 –138.
HULST, A. R., ñkÅ wÏÄ , in: THAT II 5, 1995, 904 – 909.
JANOWSKI, B., Die Tat kehrt zum Täter zurück. Offene Fragen im Umkreis des»Tun-Ergehen-Zusammenhangs«, in: JANOWSKI, B., Die rettende Gerechtig-keit. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments, II, Neukirchen-Vluyn1999, 167–191.
JANOWSKI, B., Der eine Gott der beiden Testamente. Grundfragen einer Bibli-schen Theologie, in: JANOWSKI, B., Die rettende Gerechtigkeit. Beiträge zurTheologie des Alten Testaments, II, Neukirchen-Vluyn 1999, 249 – 284.
JANOWSKI, B., Sühne als Heilsgeschehen. Traditions- und religionsgeschichtlicheStudien zur Sühnetheologie der Priesterschrift (WMANT 55), Neukirchen-Vluyn 2 2000.
JANOWSKI, B., Die heilige Wohnung des Höchsten. Kosmologische Implikatio-nen der Jerusalemer Tempeltheologie, in: JANOWSKI, B., Der Gott des Le-bens. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments, III, Neukirchen-Vluyn2003, 27–71.
JANOWSKI, B., »Ich will in eurer Mitte wohnen«. Struktur und Genese der exi-lischen Schekina-Theologie, in: JANOWSKI, B., Gottes Gegenwart in Israel.Beiträge zur Theologie des Alten Testaments, I, Neukirchen-Vluyn 2 2004,119 –147.
JANOWSKI, B., Tempel und Schöpfung. Schöpfungstheologische Aspekte derpriesterschriftlichen Heiligtumskonzeption, in: JANOWSKI, B., Gottes Ge-genwart in Israel. Beiträge zur Theologie des Alten Testaments, I, Neukir-chen-Vluyn 2 2004, 214 – 246.
JANOWSKI, B., Shekhina, in: RGG 4 VII, 2004, 1274f.
JANOWSKI, B., Vergeltung. II. Altes Testament, in: RGG 4 VIII, 2005, 1000.
KAISER, O., Anknüpfung und Widerspruch. Die Antwort der jüdischen Weis-heit auf die Herausforderung durch den Hellenismus, in: MEHLHAUSEN, J.(Hg.), Pluralismus und Identität (Veröffentlichungen der Wissenschaftli-chen Gesellschaft für Theologie 8), Gütersloh 1995, 54 – 69.
KAISER, O., Weisheit für das Leben. Das Buch Jesus Sirach übersetzt und einge-leitet, Stuttgart 2005.
KEEL, O./SCHROER, S., Schöpfung. Biblische Theologien im Kontext altorien-talischer Religionen, Göttingen/Freiburg, Schweiz 2002.
KELLER, M., Untersuchungen zur deuteronomisch-deuteronomistischen Na-menstheologie (BBB 105), Weinheim 1996.
KOCH, K., Die Priesterschrift von Exodus 25 bis Leviticus 16. Eine überliefe-rungsgeschichtliche und literarkritische Untersuchung (FRLANT 71), Göt-tingen 1959.
KUHN, P., Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie der Rabbinen (StANT 17),München 1968.
27Gottes Weisheit in Jerusalem
KURTH, D., Treffpunkt der Götter. Inschriften aus dem Tempel des Horus vonEdfu. Eingeleitet, übersetzt und erläutert, Zürich/München 1994.
LIPS, H. VON, Weisheitliche Traditionen im Neuen Testament (WMANT 64),Neukirchen-Vluyn 1990.
LÖNING, K./ZENGER, E., Als Anfang schuf Gott. Biblische Schöpfungstheolo-gien, Düsseldorf 1997.
LOHFINK, N., Kultzentralisation und Deuteronomium. Zu einem Buch von Eleo-nore Reuter: Zeitschrift für Altorientalische und Biblische Rechtsgeschichte1 (1995) 117–148.
LUX, R., „. . . damit ihr erkennt, daß Jhwh Zebaot mich gesandt hat“. Erwägun-gen zur Berufung und Sendung des Propheten Sacharja, in: LUX, R./WASCHKE, E.-J. (Hg.), Die unwiderstehliche Wahrheit. Studien zur alttesta-mentlichen Prophetie. Festschrift für Arndt Meinhold (Arbeiten zur Bibelund ihrer Geschichte 23), Leipzig 2006, 373 – 388.
MARBÖCK, J., Gottes Weisheit unter uns. Zur Theologie des Buches Sirach. Her-ausgegeben von Irmtraud Fischer (Herders Biblische Studien 6), Freiburgim Breisgau u. a. 1995.
MARBÖCK, J., Weisheit im Wandel. Untersuchungen zur Weisheitstheologie beiBen Sira. Mit Nachwort und Bibliographie zur Neuauflage (BZAW 272),Berlin/New York 1999.
MARBÖCK, J., Das Buch Jesus Sirach, in: ZENGER, E. u. a., Einleitung in das AlteTestament (KStTh 1,1), Stuttgart 6 2006, 408 – 416.
MEINHOLD, A., Die Sprüche. Teil 1: Sprüche Kapitel 1–15 (ZBK.AT 16,1), Zürich1991.
METZGER, M., Himmlische und irdische Wohnstatt Jahwes, in: METZGER, M.,Schöpfung, Thron und Heiligtum. Beiträge zur Theologie des Alten Testa-ments. Herausgegeben von Wolfgang Zwickel (BThSt 57), Neukirchen-Vluyn 2003, 1– 38.
MICHAELIS, W., skhno v, in: ThWNT VII, 1964, 386 – 388.
MORENZ, S., Ägyptische Religion (RM 8), Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz 1960.
MÜLLER, U. B., Die Menschwerdung des Gottessohnes. Frühchristliche Inkar-nationsvorstellungen und die Anfänge des Doketismus (SBS 140), Stuttgart1990.
NIEWÖHNER, F., Schechina, in: HWP VIII, 1992, 1226 –1230.
OWCZAREK, S., Die Vorstellung vom „Wohnen Gottes inmitten seines Volkes“ inder Priesterschrift. Zur Heiligtumstheologie der priesterschriftlichen Grund-schrift (EHS.T 625), Frankfurt am Main 1998.
PAROSCHI, W., Incarnation and Covenant in the Prologue to the Fourth Gospel(John 1:1–18) (EHS.T 820), Frankfurt a. M. 2006.
REUTER, E., Kultzentralisation. Entstehung und Theologie von Dtn 12 (BBB 87),Frankfurt am Main 1993.
RICHTER, S. L., The Deuteronomistic History and the Name Theology. l esakken
s emo sam in the Bible and the Ancient Near East (BZAW 318), Berlin/NewYork 2002.
28 BERND JANOWSKI
RICKENBACHER, O., Weisheitsperikopen bei Ben Sira (OBO 1), Freiburg Schweiz/Göttingen 1973.
RÖSEL, M., Tun-Ergehen-Zusammenhang, in: NBL III, 2001, 931– 934.
SAUER, G., Jesus Sirach/Ben Sira. Übersetzt und erklärt (ATD Apokryphen 1),Göttingen 2000.
SCHÄFER, P., Die Vorstellung vom Heiligen Geist in der rabbinischen Literatur(StANT 28), München 1972.
SCHÄFER, P., Der verborgene und offenbare Gott. Hauptthemen der frühen jü-dischen Mystik, Tübingen 1991.
SCHIMANOWSKI, G., Weisheit und Messias. Die jüdischen Voraussetzungen derurchristlichen Präexistenzchristologie (WUNT II,17), Tübingen 1985.
SCHOLTISSEK, K., In ihm sein und bleiben. Die Sprache der Immanenz in denjohanneischen Schriften (Herders Biblische Studien 21), Freiburg im Breis-gau/Basel/Wien 2000.
SCHREINER, J., Wohnen der Weisung Gottes in Israel. Zur Entstehung einesTheologumenons, in: SEDLMEIER, F. (Hg.), Gottes Wege suchend. Beiträgezum Verständnis der Bibel und ihrer Botschaft. Festschrift für Rudolf Mosiszum 70. Geburtstag, Würzburg 2003, 15 – 29.
SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER, L., Vergeltung, in: LThK 3 X, 2001, 654 – 656.
SCHWINDT, R., Gesichte der Herrlichkeit. Eine exegetisch-traditionsgeschichtli-che Studie zur paulinischen und johanneischen Christologie (Herders Bi-blische Studien 50), Freiburg im Breisgau u. a. 2007.
SEDLMEIER, F., „Ich werde in ihrer Mitte wohnen . . .“. Gottes Gegenwart inseinem Volk: das prisma 1 (2005) 10 –17.
SEEBASS, H., Biblische Theologie: VF 27 (1982) 28 – 45.
SEEBASS, H., Der Gott der ganzen Bibel. Biblische Theologie zur Orientierungim Glauben, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1982.
SHEPPARD, G. T., Wisdom as a Hermeneutical Construct. A Study in the Sapi-entializing of the Old Testament (BZAW 151), Berlin/New York 1980.
SIEVERS, J., „Wo zwei oder drei . . .“. Der rabbinische Begriff der Schechina undMatthäus 18,20: das prisma 1 (2005) 18 – 29.
SKEHAN, P. W., Structures in Poems on Wisdom: Proverbs 8 and Sirach 24: CBQ41 (1979) 365 – 379.
STECK, O. H., Strömungen theologischer Tradition im Alten Israel, in: STECK,O. H., Wahrnehmungen Gottes im Alten Testament. Gesammelte Studien(TB 70), München 1982, 291– 317.
STECK, O. H., Das Buch Baruch. Übersetzt und erklärt, in: STECK, O. H./KRATZ,R. G./KOTTSIEPER, I., Das Buch Baruch. Der Brief des Jeremia. Zusätze zuEster und Daniel. Übersetzt und erklärt (ATD Apokryphen 5), Göttingen1998, 9 – 68.
TERRIEN, S., The Play of Wisdom. Turning Point in Biblical Theology: HBT 3(1981) 125 –153.
THEOBALD, M., Im Anfang war das Wort. Textlinguistische Studie zum Johan-nesprolog (SBS 106), Stuttgart 1983.
29Gottes Weisheit in Jerusalem
THEOBALD, M., Gott, Logos und Pneuma. „Trinitarische“ Rede von Gott imJohannesevangelium, in: KLAUCK, H.-J. (Hg.), Monotheismus und Christo-logie. Zur Gottesfrage im hellenistischen Judentum und im Urchristentum(QD 138), Freiburg/Basel/Wien 1992, 41– 87.
THOMA, C., Inkarnation, in: PETUCHOWSKI, J. J./THOMA, C., Lexikon der jü-disch-christlichen Begegnung, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1989,157–161.
THOMA, C., Schekhina, in: PETUCHOWSKI, J. J./THOMA, C., Lexikon der jüdisch-christlichen Begegnung, Freiburg im Breisgau/Basel/Wien 1989, 352 – 356.
THYEN, H., Das Johannesevangelium (HNT 6), Tübingen 2005.
UHLIG, S., Das äthiopische Henochbuch, in: JSHRZ V, 1984, 461–780.
WEIMAR, P., Untersuchungen zur priesterschriftlichen Exodusgeschichte (fzb 9),Würzburg 1973.
WEIMAR, P., Die Meerwundererzählung. Eine redaktionskritische Analyse vonEx 13,17–14,31 (ÄAT 9), Wiesbaden 1985.
WITTE, M., Schriften (Ketubim), in: GERTZ, J. C. (Hg.), Grundinformation AltesTestament. Eine Einführung in Literatur, Religion und Geschichte des Al-ten Testaments. In Zusammenarbeit mit Angelika Berlejung, Konrad Schmidund Markus Witte (UTB 2745), Göttingen 2006, 403 – 508.
WOLDE, E. VAN (Hg.), Job 28. Cognition in Context (Biblical Interpretation Se-ries 64), Leiden/Boston 2003.
WYSCHOGROD, M., Inkarnation aus jüdischer Sicht: EvTh 55 (1995) 13 – 28.
WYSCHOGROD, M., Gott und Volk Israel. Dimensionen jüdischen Glaubens,Stuttgart/Berlin/Köln 2001.
ZENGER, E., Eigenart und Bedeutung der Weisheit Israels, in: ZENGER, E. u. a.,Einleitung in das Alte Testament (KStTh 1,1), Stuttgart 6 2006, 329 –334.
ZIMMERMANN, R., Theologisierung der Ethik: Relikt oder Richtmaß? Die im-plizite Ethik der alttestamentlichen Weisheit und ihre Impulse für die ge-genwärtige Diskussion: BThZ 19 (2002) 99 –124.










































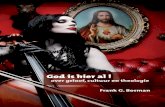




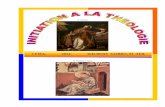
![Die Didache [Theologie]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6325a09b545c645c7f09cc1a/die-didache-theologie.jpg)


