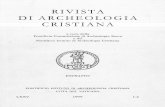À la recherche d’une citoyenneté globale. L’expérience des adolescents migrants en Europe
Globale Ungleichheiten: Arbeitsverhältnisse in Entwicklungs- und Schwellenländern
-
Upload
uni-frankfurt -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Globale Ungleichheiten: Arbeitsverhältnisse in Entwicklungs- und Schwellenländern
Friedrich Hirler
Adresse:
Hannah-Arendt Straße 6
35394 Gießen
Tel.: 015772576647
E-Mail: [email protected]
giessen.de
Studiengang: BA Social Sciences
Matrikelnummer: 4015777
Semester: 6. Fachsemester
Globale Ungleichheiten:
Arbeitsverhältnisse in Entwicklungs-
und Schwellenländern
Justus-Liebig-Universität Gießen
Fachbereich 03 Kultur- und Sozialwissenschaften
Institut für Soziologie
Veranstaltung: Von Arbeit, Märkten Macht und Geld
Leitung: Kerstin Schmidt-Beck M.A.
1
Bildquellen http://www.flickr.com/photos/yuna_lee/5953141/sizes/m/ http://www.unescap.org/unis/What_s_Ahead/2009/Nov/employment.jpg
Inhalt 1. Einleitung ..................................................................................................................... 2
2. Hauptteil ...................................................................................................................... 3
2.1 Definitionen ............................................................................................................ 3
2.2 Arbeitsmarktstrukturen in less- und least-developed countries .............................. 5
2.3 Globalisierung und andere Veränderungsprozesse sowie deren Auswirkungen ... 9
3. Moralische Implikationen und Schlussfolgerungen .................................................... 12
Literaturverzeichnis ....................................................................................................... 16
"Die Früchte der Globalisierung sind sowohl in als auch zwischen den Ländern
ungleich verteilt worden."
(Weltkommission für die soziale Dimension der Globalisierung 2004: 4)
2
1. Einleitung
Der Begriff der Globalisierung hat sich insbesondere seit Ende des Kalten Krieges zu
Beginn der 1990er zum geflügelten Wort in vielen Fachwissenschaften, der Politik
und der Öffentlichen entwickelt. Globalisierung wird gemeinhin als Prozess der
Vernetzung und Entgrenzung der Welt auf allen gesellschaftlichen Ebenen,
insbesondere im Bereich der Wirtschaft beschrieben. Grundlage der wirtschaftlichen
Globalisierung bildet die Marktöffnung, welche eine Form der globalen Arbeitsteilung
ermöglicht wie wir sie heute vorfinden. Diese Hausarbeit setzt sich mit den
gravierenden Ungleichheiten zwischen den beteiligten Nationen auseinander auf
denen diese Arbeitsteilung beruht. Ein Großteil des Außenhandels und
ausländischen Direktinvestitionen (FDI1) findet zwar zwischen den ‚developed
countries‘ statt, allerdings nahm z.B. das Verhältnis zwischen Warenhandel und BIP2
in den ‚less- und least-developed‘ countries‘3 zwischen 1990 und 2007
durchschnittlich von 31% auf 57% zu (vgl. ROBERTSON ET.AL. 2009: 1). Wie ist der
Arbeitsmarkt in den weniger Entwickelten Ländern strukturiert und welche
Auswirkungen hat diese Veränderung? Das sind die Fragen die in dieser Arbeit
behandelt werden sollen.
Zunächst wird auf einige relevante Definitionen eingegangen, um dann die
Arbeitsmarktstrukturen in den less- und least-developed countries dazustellen.
Darauf folgend werden Prozesse der Globalisierung und die moderne globale
Arbeitsteilung, sowie deren Einfluss auf die dortigen Arbeitsmärkte erläutert. Es gilt
die Etablierung moderner Arbeitsstrukturen in den vormals agrarwirtschaftlich
geprägten Ländern zu beleuchten, wobei auch die Rolle der Urbanisierung zu
beachten ist. Zudem sollen die Gründe für das Ungleichgewicht zwischen den
developed countries und den least-developed countries untersucht werden.
1 Foreign Direkt Investments
2 Brutto Inlandsprodukt
3 Die deutschen Begriffe ‚Industrienationen‘ und ‚Entwicklungsländer‘ bilden definitorische Unschärfen
ab, da Industrienationen ursprünglich solche Länder beschreibt, die einen Großteil ihrer Wirtschaftsleistung durch die Herstellung industriellen Güter erwirtschaften. Dies trifft auf viele höher entwickelte Staaten jedoch nicht mehr zu und ist im Gegenzug in vielen Schwellenländern anzutreffen, die jedoch vom gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsstand nicht als ‚entwickelte‘ Länder bezeichnet werden können. Ebenso impliziert der Begriff Entwicklungsländer, dass tatsächlich eine prozessuale Entwicklung stattfindet, was jedoch auf viele wenig entwickelte Länder nicht zutrifft. Der Autor wird daher im Folgenden auf die differenzierteren englischsprachigen Begriffe zurückgreifen.
3
Zum Ende werden die moralischen Implikationen der ungleichen Auswirkungen der
Globalisierung und der momentanen transnationalen Ungerechtigkeit
herausgearbeitet. Dabei wird auf die Frage eingegangen, inwiefern eine begrenzte
räumliche und gesellschaftliche Reichweite moralischer Vorstellungen für die
Toleranz und Ignoranz der momentanen Zustände verantwortlich ist und welche
Handlungsmöglichkeiten daraus entstehen könnten.
2. Hauptteil
2.1 Definitionen
Die folgenden vier Definitionen beruhen auf den von der International Labour
Organization (ILO) auf der 13. International Conference of Labour Statisticians 1982
festgelegten Begriffserläuterungen (vgl. ILO 1982: 2ff.).
Arbeitskräfte/ Ökonomisch aktive Bevölkerung
Personen beiden Geschlechts und über einem bestimmten Alter (zwischen 12 und
16) die ihre Arbeitskraft während einer bestimmten Zeitraumes (normalerweise ein
Jahr) der Produktion von wirtschaftlichen Gütern und Dienstleistungen zur Verfügung
stellen, unabhängig davon ob dies für den Markt, den Tauschhandel oder die
Selbstversorgung geschieht. Dies trifft somit auf all jene zu die entweder arbeiten
oder aktiv nach Arbeit suchen.
Beschäftigung
Als beschäftigt gelten alle Personen über einem bestimmten Alter die während eines
bestimmten Zeitraums eine der folgenden Bedingungen erfüllen: Formelle oder
informelle Lohnarbeit4; Selbstständigkeit für monetären Profit oder die
Familienversorgung; unbezahlte Familienarbeit die eine bestimmte
Wochenarbeitszeit überschreitet.
4 Trifft auch auf Personen zu die für eine bestimmte Zeit z.B. durch Krankheit, Urlaub
Schwangerschaft oder Streik nicht Arbeiten.
4
Arbeitslosigkeit
Unter diese Kategorie fallen all jene Personen über einem bestimmten Alter, die sich
nicht wie unter Beschäftigung beschrieben während eines bestimmten Zeitraums in
Lohnarbeit oder Selbstständigkeit befinden, jedoch zurzeit für diese Art der Arbeit zur
Verfügung stehen, oder sich aktiv auf Arbeitssuche befinden bzw. die Bereitschaft
sich bei Vorhandensein der nötigen Ressourcen selbstständig zu machen.
Wirtschaftlich inaktive Bevölkerung
All jene Personen, unabhängig vom Alter, die keiner Form von oben beschriebenen
Tätigkeiten nachgehen und auch nicht aktiv nach solchen suchen und solche die
durch anderweitige Verpflichtungen wie z.B. Schule, Studium oder Haushaltsarbeit
nicht am normalen Arbeitsmarkt teilhaben.
Formen der Arbeitslosigkeit
Weiterhin sollen hier die verschiedenen Formen von Arbeitslosigkeit und ihre
primären Ursachen kurz erläutert werden. Deren Anteil an der tatsächlichen
Arbeitslosigkeit eines Landes, hängt stark von den dortigen Bedingungen ab.
Zyklische Arbeitslosigkeit die konjunkturbedingt ist und aufgrund zu niedriger
Nachfrage nach Arbeitskraft entsteht.
Strukturelle Arbeitslosigkeit die durch einen sogenannten ‚missmatch‘ am
Arbeitsmarkt auftritt. Dies heißt, dass nicht die Art von Arbeitskräften am Markt
vorhanden ist, die vom Arbeitgeber gesucht wird (z.B. durch mangelnde
Qualifikation oder geographische Hürden).
Vorübergehende Arbeitslosigkeit entsteht in Übergangsphasen z.B. bei einem
freiwilligen oder unfreiwilligen Wechsel des Arbeitsplatzes oder nach Beendigung
von Studium und Schule.
Saisonale Arbeitslosigkeit kommt in erster Linie in der Landwirtschaft (Ernte/
Saat) aber auch in manchen Handwerksberufen vor und begründet sich durch
jahreszeitliche Schwankungen im Wetter.
(vgl. FIELDS 2012: 45)
Um einen Überblick über die terminologischen Bezeichnungen der nachfolgend
verwendeten Ländergruppen zu erhalten werden diese hier kurz erläutert und
5
aufgezählt. Die Aufteilung basiert auf einer ILO Veröffentlichung (GHOSE ET. AL 2008:
5f.) und wurde zum Zwecke dieser Hausarbeit angepasst, bzw. etwas vereinfacht.
Developed countries: Hierzu zählen alle hochentwickelten Staaten, deren
Wirtschaft sich auf den tertiären Sektor fokussiert und die somit weniger
Industriestaaten, als vielmehr Dienstleistungsstaaten darstellen. Dazu zählen
beispielsweise die USA, Deutschland, Australien, Japan, Schweden etc.
Less developed countries: Dieser Begriff ließe sich auf Deutsch wohl am besten
mit Schwellenländern gleichsetzten und enthält vor allem die Gruppe der Medium-
income developing countries und Teile der petroleum exporter developing countries.
Dazu zählen Länder wie China, Indien, der Großteil Südamerikas, Nordafrikas und
Südostasien, aber auch Südafrika, Namibia und Pakistan.
Least-developed countries: Diese Gruppe enthält die wirtschaftlich am geringsten
entwickelten Länder. Hierzu zählt ein Großteil des subsaharischen Afrikas, sowie
einige lateinamerikanische und asiatische Länder, wie Myanmar (Burma), Haiti,
Bhutan, Nepal und Bangladesch.
Es gibt weitere Gruppen und Unterteilungen wie die petroleum exporter developing
countries, den Commonwealth of Independent states, medium-income developing
countries und other high-income countries, die hier jedoch keine Rolle spielen oder in
den aufgeführten Gruppen enthalten sind.
2.2 Arbeitsmarktstrukturen in less- und least-developed
countries
Verglichen mit den developed countries weist der Arbeitsmarkt in least-developed
countries starke Unterschiede auf. Ein wesentlich geringerer Anteil der
Erwerbstätigen arbeitet in Büros oder Fabriken, vielmehr arbeiten zwischen 44%
(Südostasien und Pazifik) und 66% (Subsahara-Afrika) in der Landwirtschaft. In den
developed countries sind es durchschnittlich 4% (vgl. FIELDS 2012: 51f.). Das
Lohnniveau im Agrarbereich der least-developed countries ist dabei wesentlich
geringer als im produzierenden Sektor, wobei allerdings auch meistens ein Teil zur
Selbstversorgung genutzt wird (vgl. ILO 2012b). Ein weiteres Merkmal der least
6
developed countries ist der große Anteil unbezahlter Familienarbeit, selbständig
Beschäftigter ohne weitere Angestellte, sowie der geringe Anteil von regulär
lohnabhängig Beschäftigten. In der Regel gilt, je ärmer ein Land desto größer ist der
Anteil der Menschen, die ihren Lebensunterhalt durch Selbstständigkeit und
unbezahlte Familienarbeit verdienen: 80% der Frauen und 70% der Männer in
Südasien und Subsahara-Afrika, über 50% der Erwerbsfähigen in Südostasien und
über 30% im Nahen Osten, Nordafrika und Lateinamerika (vgl. FIELDS 2012: 52f.).
Zudem spielt in diesen Ländern der Staat als Arbeitgeber einer eher untergeordnete
Rolle, stellt jedoch gleichzeitig oft einen großen Teil der Arbeitsplätze im formellen
Sektor, welcher jedoch einen geringen Anteil des Gesamtarbeitsmarkts ausmacht.
Durch die geringe Anzahl an Arbeitsplätzen in diesem Sektor sind
arbeitsplatzbezogene Vorteile nur für einen Bruchteil der Bevölkerung vorhanden,
meist für Beschäftigte im Staatsdienst. Informelle Beschäftigung steht außerhalb der
Arbeitsgesetzgebung und deren Durchsetzung, sodass Arbeitsplatzsicherheit,
Mindestlöhne, Überstundenzuschlag, Betriebskrankenkassen, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, bezahlter Urlaub, Alterspensionen nur Wunschdenken darstellen (vgl.
ebd.: 56.). Laut einer Veröffentlich der OECD sind der Anteil des informellen Sektors
am nicht landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt und der Wohlstand (gemessen am
BIP/Kopf) negativ korreliert, selbiges gilt für den Anteil der oben beschriebenen
Selbstständigen (vgl. JÜTTING; LAIGLESIA 2009: 65f.).
Abbildung 1 Korrelation zwischen BIP/Kopf und Anteil des informellen Sektors
Quelle: Jütting; Laiglesia 2009: 65
7
Zugleich gibt es eine positive Korrelation zwischen Anteil der Menschen mit einem
Einkommen unter 2$/Tag und dem Anteil des informellen Sektors am Arbeitsmarkt.
Überraschend erscheint hingegeben, dass der Anteil des informellen Sektors in den
letzten Jahrzehnten, trotz konstanten Wachstums in einem Teil der Länder, nicht
abgenommen hat, sondern in vielen Fällen sogar angestiegen ist. Besonders davon
betroffen sind Süd- und Ostasien sowie das subsaharische Afrika (vgl. JÜTTING;
LAIGLESIA 2009: 69f.).
Abbildung 2: Arbeitslosenquoten nach Region und Veränderung der ökonomisch aktiven
Bevölkerung
Quelle: ILO 2012a: 35f.
Unerwartet ist auch die Tatsache, dass in den less-/ least-developed countries die
durchschnittliche Arbeitslosenquoten mit 4,3% in Ostasien, 4,7% in Südostasien,
8,2% in Subsahar-Afrika und 10,9% in Nordafrika, unter dem Weltdurchschnitt von
6,0% liegen, während die developed countries mit 8,5% darüber liegen (vlg. ILO
2012a: 35f.). Allerdings heißt dies nicht, dass der Rest der Arbeitskräfte in diesen
Ländern in einer gutbezahlten Vollzeitstelle beschäftigt ist. Ein Großteil der nicht als
Arbeitslos definierten Personen wollen wöchentlich mehr Stunden arbeiten, jedoch ist
das Arbeitsangebot zu gering. In besonderem Ausmaß trifft dies auf Lohnarbeiter in
der Landwirtschaft zu, die vor allem in der Saat- und Erntezeit benötigt werden und
8
durch die wiederkehrende saisonale Arbeitslosigkeit zwischen diesen Zeiten wenige
Verdienstmöglichkeiten haben. Zudem sind die Löhne vieler ganzjährig
Vollzeitbeschäftigten so gering, dass sie sowohl in ihrem eigenen Land als auch
nach internationalen Maßstäben unter der (absoluten) Armutsgrenze leben.
Diejenigen die von ihrem Verdienst alleine nicht leben können, werden oft als
‚underemployed‘ beschrieben (vgl. ebd.: 46). Die Löhne liegen oft zwischen 1$ und
2$ am Tag. Selbst im produzierenden Sektor mit vielen multinationalen Konzernen
als Arbeitgeber liegen die durchschnittlichen Monatslöhne beispielsweise bei 145$ in
Zentralchina, 104$ in Vietnam, 87$ in Indien, sowie 60$ in Kambodscha und das bei
einer wesentlich höherer Wochenarbeitszeit (vgl. FIELDS 2012: 47; ILO 2012b).
Zusätzlich sind die Einkommen in hohem Maße unsicher und wesentlich stärker
anfällig für Schwankungen auf dem Weltmarkt, da der Arbeitsschutz wesentlich
schwächer ist und ein Großteil der Bevölkerung sich entweder in informeller
Beschäftigung oder Selbstständigkeit befindet und von gesetzlichen Normen somit
völlig unberührt bleibt.
Die relativ geringe Arbeitslosigkeit ist somit kein Zeichen dafür das die Situation auf
dem Arbeitsmarkt besonders gut wäre, sondern vielmehr dadurch begründet, dass
die Menschen es sich nicht leisten können die ganze Woche nicht zu arbeiten, da es
keine soziale Absicherung gibt und die Menschen so in den meisten Fällen dazu
gezwungen sich Arbeit, egal welcher Art zu suchen, um zu Überleben. Die
strukturelle und zyklische Arbeitslosigkeit erscheint dadurch geringer als sie ist.
Problematisch ist auch der durch die sogenannten push und pull Effekte5 bedingte
hohe Zuwanderungsdruck auf die Großstädte. Fields beschreibt hohe Arbeitslosigkeit
somit auch als ‚Luxusproblem‘, da sie auf finanzielle Absicherung durch soziale und
sozialstaatliche Unterstützung basiert (vgl. ebd.: 46).
Folglich erscheint es erkenntnisreich auf die Veränderungsprozesse einzugehen,
denen die Arbeitsmärkte und die Wirtschaft insgesamt in less- und least-developed
countries unterliegen.
5 Push Effekte werden durch den Problemdruck in den ländlichen Gebieten ausgelöst und ‚treiben‘ die
Bevölkerung in die Städte. Pull Effekte basieren auf der Hoffnung auf einem besseren Lebensstandard und z.B. besserbezahlte Arbeit im formellen Sektor.
9
2.3 Globalisierung und andere Veränderungsprozesse
sowie deren Auswirkungen
Der Globalisierung und ihren Begleiterscheinungen, kann sich keine Volkswirtschaft
entziehen. Prinzipiell muss sie keine negativen Auswirkungen haben, allerdings ist
die politische Ausgestaltung dafür verantwortlich, dass sich globale Ungleichheiten
noch verstärken. Dies betrifft primär die least-developed countries. In den
vergangenen Jahrzehnten kam es in vielen Nationen in Subsahara-Afrika und
Südamerika zu Schuldenkrisen. IWF und Weltbank bilden dabei internationale
Organisationen die Länder in solchen Situationen mit Hilfskrediten und
Schuldenerlassen unterstützen sollen. Diese sind jedoch immer an Bedingungen,
sogenannte Strukturanpassungsprogramme, geknüpft die seit den 70er Jahren vom
sogenannten Washington Consensus geprägt wurden und zunehmend neoliberale
Züge angenommen haben (vgl. KRECKEL 2006: 10). So wurden
Marktliberalisierungen und Privatisierung (dies betraf oft Rohstofffirmen in
öffentlicher Hand) gefordert, ohne die gesellschaftlichen Folgen solcher Reformen zu
bedenken. Somit sicherten die westlichen Nationen sich Zugang zu den dortigen
Märkten. In Verbindung mit der erzwungenen Liberalisierung kam es zu
Veränderungen der sogenannten ‚Terms of Trade‘, den Tauschbedingungen im
internationalen Warenhandel.6 (vgl. WELTKOMMISSION FÜR DIE SOZIALE DIMENSION DER
GLOBALISIERUNG 2004: 4f.) Die für die less-/least-developed countries nachteiligen
Terms of Trade beruhen darauf, dass sie vor allem unverarbeitete Rohstoffe mit
geringem Mehrwert exportieren. Diesen wird dann im Ausland durch die Verarbeitung
ein großer Mehrwert hinzugefügt, sodass ihnen die fertigen Industriegüter aber z.B.
auch raffiniertes Benzin zu hohen Preisen zurückverkauft wird. Zudem erschwert der
ungesteuerte Import von Industriegütern es der heimischen Industrie sich zu
entwickeln, da sie ohne staatliche Protektion zu Beginn nicht Konkurrenzfähig ist.
Auch ermöglichte die Marktöffnung auch den westlichen Agrarfirmen, ihre zum
Großteil staatlich subventionierten Güter in diesen Ländern anzubieten. Dies führt oft
zur Zerstörung der lokalen Bauern, bzw. erschwert den Export von Agrargütern, da
diese mit den subventionierten Preisen der Bauern aus Nordamerika oder der EU
nicht mithalten können. Dies treibt Prozesse wie die Landflucht bzw. Urbanisierung
6 Der Preis von Exporten im Verhältnis zu den Preisen der Importe.
10
voran, da die ländliche Bevölkerung auf der Suche nach Arbeit in die Städte strömt,
obwohl diese die wachsende Bevölkerung weder aufnehmen noch gut versorgen
können. Die Arbeitsplätze im formellen Sektor sind sehr knapp und, so muss sich ein
Großteil der Menschen im informellen Sektor seinen Lebensunterhalt erwirtschaften.
Diese oben beschriebene Form der ‚Entwicklungspolitik‘ sorgte somit eher für eine
Verschlechterung der Situation. Dies wurde seit Anfang der 90iger auch den
Internationalen Akteuren der Entwicklungspolitik bewusster, zumal das
Wirtschaftswachstum in Ländern mit starker staatlicher Steuerung wie Taiwan,
Singapur, Hongkong und Südkorea ihre staatsfeindliche Ideologie in Frage stellte
(vgl. KRECKEL 2006: 10f.).
Treibende Kraft hinter der Entwicklung vieler Länder - allen voran Chinas und
anderen less-developed countries wie Brasilien und Südafrika - in den letzten zwei
Jahrzehnten war die Verlagerung von arbeitskraftintensiver weniger produktiver
Arbeit, v.a. in der Zuliefererindustrie und Manufaktur. Dies hat die Anziehungskraft
der dortigen Städte und Ballungszentren weiter vergrößert. Sie hat für beide Seiten
jedoch keinesfalls nur positive Folgen. Die Vorteile für den westlichen Konsumenten
beschränken sich auf die niedrigeren Preise der Konsumgüter, führte
gesamtwirtschaftlich jedoch zu Arbeitsplatzverlusten, die in den vergangenen
Jahrzehnten, zusammen mit den durch Automatisierungsprozesse freigesetzten
Arbeitskräften, zu einer Strukturanpassung hin zu einer Wirtschaft geführt hat, in der
ein Großteil des Umsatzes durch Dienstleistungen erwirtschaftet wird. Dies hat
durchaus auch Vorteile, für die Arbeitnehmer, da körperliche stark belastende und
tendenziell schlechter bezahlte Arbeit dadurch in starkem Ausmaß ebenfalls
verschwunden ist. Allerdings beschränken sich diese Vorteile primär auf die
gutausgebildeten Arbeitnehmer. Für schlecht ausgebildete und ungelernte Arbeiter,
verschwanden auch viele Arbeitsmarktchancen und so bleiben diesen lediglich die
Arbeitsplätze deren Verlagerung nicht oder kaum möglich ist.7 Das hat in den
developed countries große gesellschaftliche Probleme zur Folge die relevant für das
Thema der wachsenden intranationale Ungleichheiten sind, welche allerdings nicht
im Fokus dieser Arbeit liegen. Für die westlichen Konzerne geht mit der Verlagerung
von Produktionsstätten auch oftmals eine Erschließung neuer Absatzmärkte einher,
7 V.a. schlecht bezahlte Dienstleistungen die keine oder nur eine geringe Ausbildung benötigen z.B.
in der Logistik- und Sicherheitsbranche.
11
wobei dies in den least-developed countries eine untergeordnete Rolle spielt. In den
less- und in geringerem Maße auch den least-developed countries führt dieser
Prozess zu einer Schaffung von Arbeitsplätzen und Verdienstmöglichkeiten im
sekundären und tertiären Sektor, was zunächst positiv und auch
Wohlstandsvergrößernd wirkt. Allerdings sind die Profiteure sehr ungleich verteilt und
es werden primär die Arbeitsplätze ausgelagert die prinzipiell schlechtere
Arbeitsbedingungen mit sich bringen und körperlich sehr beanspruchen. Eine zweite
Form der ‚Auslagerung‘, die verstärkt auch die least-developed countries betrifft, ist
die Ausbeutung der dortigen Rohstoffe durch multinationale Großkonzerne. Dem liegt
zugrunde, dass steigende Arbeitskosten und schwindende Lagerstätten, den Abbau
in den developed countries unrentabel machten und diese Länder oft nicht die
Infrastruktur und das Know-how haben die Rohstoffe selbst abzubauen.8 Für beide
Prozesse ist entscheidend, dass die Unternehmen in diesen Ländern völlig andere
gesellschaftliche Bedingungen und Gesetzesrahmen vorfinden, die es ihnen
ermöglichen die Arbeitnehmer unter wesentlich schlechteren/ gefährlicheren
Bedingungen und bei bedeutend geringerem Gehalt anzustellen. Zudem ist der
gewerkschaftliche Organisationsgrad wesentlich geringer, bzw. besitzen
Gewerkschaften nicht die Macht die sie in vielen westlichen Nationen haben,
wodurch eine effektive Vertretung von Arbeiterinteressen nicht vorhanden ist (vgl.
ROBERTSON ET.AL. 2009: 4f.). Hier machen sich die Unternehmen das oft große
Überangebot von Arbeitskraft zunutze, um durch die starke Konkurrenz ein
Aufkommen gewerkschaftlicher Organisation und somit von Forderungen nach
höheren Lohnen möglichst zu verhindern.
Laut ROBERTSON ET.AL (ebd.: 5) kann in less-developed countries im Gegensatz zu
developed countries keine eindeutig positive Beziehung zwischen Lohn und
Arbeitsbedingungen gefunden werden, da hohe Bezahlung teilweise zur
Kompensation eines gefährlichen Arbeitsumfelds genutzt wird, woraus sich die
Notwendigkeit ergibt auf andere schwerer messbare Indikatoren auszuweichen.
Neben dem Lohn bilden Gesundheit und Sicherheit, Arbeitszeiten,
Arbeitsplatzsicherheit wichtige Kriterien (vgl. ebd.: 1). Gerade die
Arbeitsplatzsicherheit spielt für viele Menschen eine große Rolle, ist aber sehr selten
8 Aufgrund der hohen Preise für fossile Energie, kann hier beobachtet werden, dass auch der Abbau
in developed countries wieder attraktiver wird.
12
vorhanden. Der Grad der gewerkschaftlichen Organisation spielt dabei für die
Arbeitsbedingungen vor allem im formellen Sektor eine entscheidende Rolle.
Allerdings steht den Unternehmern besonders in less-/least developed countries
durch die ständige aktive und passive Drohung mit Kündigung oder einer erneuten
Arbeitsplatzverlagerung ein Instrument zur Verfügung das effektive
Gewerkschaftsarbeit enorm erschweren kann (vgl. ROBERTSON ET.AL. 2009: 75). Die
International Labour Organization (ILO) bildet einen wichtigen Akteuer in der
Ausarbeitung und Durchsetzung internationaler Mindeststandards. Dazu hat sie vier
Kernarbeitsnormen festgeschrieben: Vereinigungsfreiheit und das Recht auf
Kollektivverhandlungen, die Beseitigung der Zwangsarbeit, die Abschaffung der
Kinderarbeit und das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (ebd.:
74). Die Durchsetzung stößt jedoch auf ähnliche Probleme wie bei den
Menschenrechten, da sie immer von der Gesetzgebung und Rechtsstaatlichkeit der
einzelnen Länder, sowie deren Durchsetzungskraft abhängig ist. Von Seiten der
westlichen Unternehmen scheint das Interesse nur dann vorhanden zu sein wenn es
zu öffentlichkeitswirksamen Skandalen kommt die dem Image schaden können. Eine
nachvollziehbare und verlässliche Kontrolle der Zuliefererkette gibt es kaum. Dies
betrifft fast alle Produktionsbereiche und insbesondere den Rohstoffabbau und die
Agrarindustrie, da die Herkunft der Güter dort oft über große Zwischenhändler
‚verschleiert‘ wird.
3. Moralische Implikationen und Schlussfolgerungen
Doch welcher Verantwortung unterliegen die Bewohner der developed countries
gegenüber den Arbeitern, die für ihre Produkte unter Bedingungen arbeiten, denen
sie sich selbst nie aussetzen würden und die gleichzeitig den Gewinn der Firmen
erhöhen bei denen diese ggf. selbst angestellt sind und von denen zumindest indirekt
über Steuereinnahmen auch alle anderen Bürger profitieren? Der Markt ist kein
Mechanismus der solche ethischen und moralischen Fragen und Ungleichgewichte
beantworten bzw. regeln kann, vielmehr stellt sich die Frage nach der Reichweite
moralischer Werte und deren Grenzen.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Vorstellungen von Ungerechtigkeit und auch das
Ausmaß moralischer Empörung hängt von verschiedenen Bedingungen ab. So wird
letztere umso stärker empfunden, je konkreter es Akteure gibt, denen die
13
Verantwortung in Bezug auf die Ursache für einen Zustand oder eine Handlung
zugeschrieben werden kann. Jede Verantwortungszuschreibung beinhaltet dabei
auch immer eine Analyse der Machtbeziehungen, welche eine Einschätzung der
eigenen Handlungsmöglichkeiten beinhaltet (vgl. TERPE 2009:130f.). Hier könnte ein
grundlegendes Problem liegen, da z.B. der einzelne Konsument, aber auch
Manager, seinen Handlungen keinen Einfluss auf den Lauf der Dinge beimisst, da er
sich selbst nur als kleinen Teil eines großen Mechanismus wahrnimmt. Zudem lässt
sich kein einzelner Akteur als Verantwortlicher der aktuellen Situation identifizieren,
wodurch Schuldzuweisungen nur bedingt möglich sind.
Ungerechtigkeitswahrnehmungen verweisen laut TERPE (vgl. 2009.: 146) auf
Beziehungskonstellationen welche Solidarität erst ermöglichen. Terpe sieht zwar in
der modernen Welt ein wachsendes „universe of moral Obligation“, jedoch scheint es
weiterhin Abstufungen zu geben. So stellten Akteure bei der Bewertung von
Situationen nach Gerechtigkeitskriterien „in ihrer Vorstellung einen Bezug zu anderen
her: sei es zu dem vermeintlichen Auslöser der Ungerechtigkeit oder zu anderen
Personen oder Gruppen, mit denen sie sich vergleichen.“ (ebd.: 149) So setzt die
Wahrnehmung einer Ungerechtigkeit eine Identifikation mit den Beteiligten voraus,
und sei es „in Bezug auf ihren Status als Mensch“ (ebd.). Diese scheinbare
Selbstverständlichkeit, wurde und wird sowohl in der Geschichte, als auch in der
Gegenwart häufig „auf der Basis sozial aufgeladener Unterschiede eben nur
bestimmten Personen und Gruppen zuteil, während andere, denen es abgesprochen
wird, damit zugleich aus dem Bereich der Moral und somit der Möglichkeit von (Un-
)Gerechtigkeit ausgegrenzt werden.“ (ebd.) Dies bedeutet, das zu den
Ausgeschlossenen keine Form der sozialen Beziehung mehr besteht und diesen in
egal welcher Situation keine Empathie entgegengebracht wird. Die Bewertung von
Abweichungen von den individuellen Gerechtigkeitsnormen, hängen somit von der
Grenzziehung des Bereichs moralischer Verpflichtung ab. Diese basiert meist auf
ethnischen, religiösen, nationalstaatlichen oder politischen Unterscheidungskriterien
und geht oft mit Gewalt zwischen den gebildeten Gruppen einher. Dies spielt
besonders im Fall von Kriegen und Genozid eine entscheidende Rolle, in denen die
Gegner, bzw. Opfer entmenschlicht werden und außerhalb des Bereichs moralischer
Verpflichtung liegen.
Die ‚Betrachter‘ oder indirekten Teilnehmer solcher Ereignisse können in drei
Gruppen eingeteilt werden. In die rescuer, für die die Opfer gleiche unter gleichen
14
sind, deren Behandlung eine Verletzung ihrer Ungerechtigkeitsvorstellungen
darstellt. Sie fühlen sich zum Handeln gezwungen und versuchen den Opfern zu
helfen, bzw. gegen die Täter vorzugehen. Die zweite Gruppe bilden die nonrescuer,
für die die Opfer außerhalb des universe of moral Obligation stehen und die somit
kein Mitleid mit diesen empfinden, da sie nicht als Menschen wahrgenommen
werden. Die dritte Gruppe sind genaugenommen ebenfalls nonrescuer, allerdings
nicht aus denselben Gründen. Sie empfinden wie die rescuer Mitgefühl mit den
Opfern und stufen deren Behandlung als ungerecht ein, jedoch sehen sie keine
Handlungsmöglichkeit, da sie die Schuld für die Ungerechtigkeit einem
unspezifischen übermächtigen Anderen oder den Bedingungen/ der Struktur
zuschreiben, gegen den/die sie ohnmächtig erscheinen. Dies wird oft von Gefühlen
der Angst, Hoffnungslosigkeit und Unsicherheit begleitet, die das Mitgefühl mit den
Opfern überlagern (vgl. TERPE 2009: 153 ff.).
Angesichts der Hilf- und Machtlosigkeit, „besteht nun allerdings auch die Gefahr,
dass sich eine für die Opfer unheilvolle Dynamik entfaltet“ die dazu führt „den oder
die von einer Ungerechtigkeit Betroffenen abzuwerten“ (ebd.: 155), um der Scham
und den Schuldgefühlen nichts getan zu haben zu entkommen. So kann es zu
Schuldzuweisungen kommen, die „die Opfer selbst als Verursacher ihrer Lage
ausmachen“ und es ermöglichen „den Glauben an eine gerechte Welt bewahren zu
können.“ (ebd.: 156)
Es stellt sich die Frage nach der Relevanz der oben beschriebenen Prinzipien und
Prozesse auf die Lage in den less- und least-developed countries. Sie ergibt sich
daraus, dass der „Weg zu einem die gesamte Menschheit umfassenden universe of
moral obligation“ (ebd.: 157) vorgezeichnet scheint und durch die Deklaration der
Menschenrechte und weitere internationale Konventionen eine konkrete Form
bekam, die auch vom überwiegenden Großteil der Nationen ratifiziert wurde (vgl.
EVZ 2012). Jedoch scheinen „faktische Abhängigkeiten, wie sie durch
wirtschaftlichen Austausch oder politischer Vereinbarungen und Institutionen
geschaffen werden, noch nicht, dass damit notwendig auch jene sozialen Bindungen
einhergehen, die ein universe of moral obligation kennzeichnen.“ (ebd. 158)
Welche Mittel gibt es, um soziale Bindung, empathisches Empfinden und ethisches
Handeln auf globaler Maßstabsebene zu etablieren? Wie kann eine Ausweitung des
universe of moral obligation ermöglicht werden und eine weltweite Solidarität
15
zwischen den Menschen gefördert werden? Dafür müsste zunächst einmal eine
mediale Öffentlichkeit vorhanden sein, die solche Themen aufgreift, um bei den
Bürgern der einzelnen Staaten ein Bewusstsein für die momentanen Verhältnisse zu
schaffen. Dies darf nicht auf punktuelle Ereignisse wie Naturkatastrophen,
Hungersnöte oder Selbstmordserien von Arbeitern beschränkt sein. Diese schon
lange gehegte Wunschvorstellung einer Weltöffentlichkeit hat, durch das Internet die
nötige Infrastruktur erhalten, sie muss nur dafür genutzt werden. Dabei ist die Suche
nach den Gründen bzw. den Verantwortlichen der momentanen Situation müßig,
aber notwendig, um Handlungsmöglichkeiten aufzudecken und den Menschen das
Gefühl der Ohnmacht zu nehmen.
Die Durchsetzung globaler Mindeststandards für Arbeitnehmer, eine Fokussierung
auf den Menschen, als Objekt der Globalisierung und das Anstoßen einer
nachhaltigeren Entwicklung, kann nicht Aufgabe der Unternehmen sein, sondern
muss durch politische Steuerung auf nationaler und globaler Ebene vorangetrieben
werden. Organisationen wie die ILO und UNO sind dabei wichtig, aber machtlos,
solange auf Differenzen statt Gemeinsamkeiten gesetzt und keine soziale Bindung
zwischen den Menschen hergestellt wird, die eine Wahrnehmung der Ungleichheiten
und Ungerechtigkeiten erst ermöglicht und dadurch Handlungszwänge auf Mikro-
und Makroebene hervorruft.
16
Literaturverzeichnis
FIELDS, GARY S. (2010): Labor Market Analysis for Developing Countries. Hg. v. Cornel University. Cornel University ILR School.
FIELDS, GARY S. (2012): Working hard, working poor. A global journey. New York: Oxford University Press.
GHOSE, AJIT KUMAR; MAJID, NOMAAN; ERNST, CHRISTOPH (2008): The global employment challenge. Geneva: International Labour Office.
EVZ-STIFTUNG ERINNERUNG, VERANTWORTUNG UND ZUKUNFT (Hg.) (2012): UN-Ssozialpakt / UN-Zivilpakt. Stand der Ratifizierung. Online verfügbar unter http://www.stiftung-evz.de/themen/allgemeine-erklaerung-der-menschenrechte/infografik-stand-der-ratifizierung/, zuletzt geprüft am 04.11.2012.
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (Hg.): Global Employment Trends 2012. Geneva.
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (Hg.) (1982)): Resolution concerning statistics of the economically active population, adopted by the.
INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (Hg.) (2012): Labourstat Internet. Online verfügbar unter laborstat http://laborsta.ilo.org/, zuletzt aktualisiert am 29.10.12, zuletzt geprüft am 31.10.12.
JÜTTING, JOHANNES; LAIGLESIA, JUAN R. DE (2009): Is informal normal? Towards more and better jobs in developing countries. [Paris]: Development Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development.
KRECKEL, REINHARD (2006): Soziologie der sozialen Ungleichheit im globalen Kontext. Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Der Hallesche Graureiher 2006, 4).
ROBERTSON, RAYMOND (2009): Globalization, wages, and the quality of jobs. Five country studies. Washington D.C: World Bank.
STEVENS, GINA MARIE (2012): World of work report 2012. Better jobs for a better economy. Geneva, Switzerland: International Labour Organisation, International Institute for Labour Studies.
TERPE, SYLVIA (2009): Ungerechtigkeit und Duldung. Die Deutung sozialer Ungleichheit und das Ausbleiben von Protest. Konstanz: UVK-Verlagsges.
WELTKOMMISSION FÜR DIE SOZIALE DIMENSION DER GLOBALISIERUNG (Hg.): Eine faire Globalisierung. Chancen für alle schaffen. Neuaufl., April. Genf.