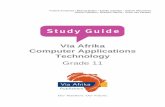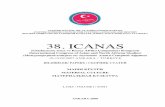Ginas uber Afrika
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ginas uber Afrika
In den 1960er-Jahre sah sich Portugal gleichzeitig mit Aufstandsbewegungen in allen drei afrikanischen Überseeprovinzen konfrontiert. Die Situation wurde derart kri-tisch, dass die Forca Aérea Portuguese (FAP) zu Hilfe gerufen werden musste. Dabei kamen vermehrt auch die zunächst nur als Behelfslösung von der deutschen Luftwaffe übernommenen Jagdbomber Fiat G.91 (»Gina«) zum Einsatz. Sie bewährten sich entgegen aller Erwarten gut, das Ende des Kolonialismus vemochten aber auch sie nicht aufzuhalten.Tom Cooper / José Matos
»Ginas« über Afrika
Blick auf vier G.91R-4 der Esquadra 121 in Bissau/Bissalanca im Jahr 1966. Das Staffelwappen und andere Symbole der Einheit – als Auf-kleber – sind alle gut zu erkennen.Dahinter stehen T-6 Texan.Sammlung Sousa via Matos
»Ginas« über Afrika
– Heute ist Portugal ein kleines und bescheidenes Land. Vor 40 Jahren war es allerdings der letzte große Koloni-
alstaat Europas. Entdeckungen, die von Heinrich dem Seefahrer im 15. sowie frühen 16. Jahrhunderts gemacht wurden, verwandelten Portu-gal zum drittgrößten Kolonialreich, dessen Streitmacht in zahlreiche Konflikte verwickelt wurde, von denen die meisten mittlerweile in Vergessenheit geraten sind. Obwohl in Portugal zahlreiche Publikati-onen zu diesem Thema erschienen sind, bleiben diese außerhalb des Landes weitgehend ohne große Resonanz. Noch in den 1950er-Jahren bestand das portugiesische Kolonialreich aus drei Territorien in Afrika, kleineren Gebieten in Indien (Goa, Damão e Diu), Timor in Indonesien sowie Macao in China. Im Dezember 1961 annektierten indische Truppen Goa und Damão e Diu im Rahmen der Operation »Vijay«. Damit begann der Anfang vom Ende des portugie-sischen Kolonialreichs. Verglichen mit dem portugiesischen Besitz in Indien waren die drei Kolonien in Afrika – Angola, Portugiesisch-Guinea und Mosambik
– nicht nur weitaus bedeutender, sondern seit 1953 auch zu Übersee-provinzen und damit zum integralen portugiesischen Staatsgebiet deklariert worden.
Portugals Luftwaffe
Obwohl die portugiesische Armee und Marine jeweils schon seit 1917 ihre eigenen Luftstreitkräfte unterhielten, waren diese in den 1950er-Jahren noch immer nicht sehr entwickelt. Die Situation änderte sich erst durch den NATO-Beitritt Portugals im Jahr 1951. Per Dekret des Verteidigungsministers vom 1. Juli 1952 wurde die ehemalige Aeronautica Militar der Armee mit der Aviacao Naval der Marine in gleichberechtigte Luftstreitkräfte, die Forca Aérea Portu-guesa (FAP), zusammengefasst. Offiziell am 27. Mai 1952 gegründet, konnte die FAP in den darauf folgenden Jahren durch die Zuführung moderner amerikanischer Düsenjäger wie North American F-86F
»Ginas« über Afrika konflikte8
Sabre, Republic F-84G Thunderjet und Lockheed T-33A bedeutend verstärkt werden.
Die seinerzeitige Organisationsstruktur der FAP ist wenig bekannt. Die Grundlage bildeten Geschwader, je nach Quelle als Esquadra oder Esquadron bezeichnet. Mit wenigen Ausnahmen wurde in den 1950er-Jahren jedes Geschwader auf einen Flug-zeug- oder Hubschraubertyp profiliert. Bis 1960 gab es insgesamt 17 Esquadras, welche neben überwiegend amerikanischen Flug-zeugen französische Hubschrauber Aérospatiale SA.316B Alouet-te III betrieben.
Die wichtigsten in den afrikanischen Konflikten verwickelten Esquadras der 1960er- und 1970er-Jahre waren:
Einheit Typen Stützpunkte
Esquadra 101 PV-2 Beira, Mosambik
Esquadra 102 Noratlas Beira, Mosambik
Esquadra 103 PV-2 Beira, Mosambik
Esquadra 131 DC-6 Portela, Portugal
Esquadra 132 Boeing 707-3F5C Portela, Portugal
Esquadra 121 Do 27, später Fiat G.91R-4 Bissau/Bissalanca, Guinea
Esquadra 122 SA.316B Bissau/Bissalanca, Guinea
Esquadra 123 Noratlas, Do 27 Bissau/Bissalanca, Guinea
Esquadra 501 T-6, Do 27 Nacala, Angola
Esquadra 502 Fiat G.91R-4 Nacala, Angola
Esquadra 503 SA.316BN Nacala, Angola
Esquadra 701 T-6, Do 27, Cessna 185 Tete, Mosambik
Esquadra 702 Fiat G.91R-4 Tete, Mosambik
Esquadra 703 SA.316B, SA.330 Puma Tete, Mosambik
Esquadra 801 C-47 Lourenço Marques, Angola
Zum weiteren Verständnis der Organisation der portugie-sischen Luftwaffe in Afrika gehört die Struktur ihrer Stützpunkte, welche in den 1960er-Jahren innerhalb der NATO recht einzigar-tig war. An der Spitze der Hierarchie befanden sich Basas Aere-as (BA) – voll ausgebaute Luftwaffenstützpunkte mit ständiger Belegung.
Die ´5418´ diente bei der Esquadra
121 auf Bissau/Bissalanca in
den späten 1960er-Jahren.
Anschließend wurde die Maschi-
ne überholt und nach Mosambik
geschickt, wo sie bei der Esquadra 502
bis Kriegsende verblieb. Wie bei
der FAP üblich, wurde die Bord-
nummer auch auf der Unterseite der linken Tragfläche
vermerkt.
Zwei G.91R-4 kurz nach ihrer Ein-
kunft in Bissau/Bissalanca, als
ihre Staffelwap-pen noch nicht
aufgetragen waren.
Es blieb noch nicht einmal Zeit, den Tarnanstrich
der deutschen Luftwaffe zu
entfernen.
Eine G.91R-4 der Esquadra 121 beim Start in
Bissau/Bissalanca
9»Ginas« über Afrika konflikte
In den 1960er- wie auch 1970er-Jahren unterhielt die FAP fol-gende Basen:
Bezeichnung Bemerkungen
BA.1 Lissabon-Sintra, Portugal
BA.2 Ota, Portugal (später aufgegeben)
BA.3 Tancos, Portugal (später aufgegeben)
BA.4 Lajes, Azores
BA.5 Monte Real, Portugal
BA.6 Montijo, Portugal
BA.7 Sao Jacinto, Portugal
BA.8 ursprünglich in Beira, Mosambik, geplant,
aber nie wirklich realisiert
BA.9 Luanda, Angola
BA.10 Beira, Mosambik
BA.11 Beja, Portugal
BA.12 Bissau/Bissalanca, Portugiesisch-Guinea
Weiter unten in der Hierarchie standen die sogenannten Aérodromo Basas (AB) – kleinere Flugplätze, die nicht für militärische Zwecken gebaut wurden, aber für derartige Aufgaben verwandt werden konn-ten. In den 1960er- und 1970er-Jahren waren dies:
Bezeichnung Bemerkungen
AB.1 Cabo Verde, Guinea
AB.2 Bissau/Bissalanca, Guinea; später BA.12
AB.3 Negage, Angola
AB.4 Henrique de Carvalho, Angola
AB.5 Nacala, Mosambik
AB.6 Vila Cabral, später Nova Freixo, Mosambik
AB.7 Tete, Mosambik
AB.8 Lorenco Marques, Mosambik
AB.9 Luanda, Angola; später BA.9
AB.10 Beira, Mosambik; später BA.10
AB.12 Bissau/Bissalanca, Guinea
Die erste an Por-tugal gelieferte G.91R-4 erhielt die Bordnummer 5401. Ursprünglich war die Maschine für Griechenland bestimmt und wurde als einziges Exemplar auch ausgeliefert. Die Griechen zogen jedoch die von den USA plötzlich aus dem Hut gezauberte F-5A Freedom Fighter vor, worauf die Fiat G.91 1961 zurück nach Italien ging, um später als über-zähliger Posten an Deutschland verkauft zu werden. Alto via Matos
Die ´5425´der Esquadra 121 in Bissalanca kurz vor einem Einsatz Anfang der 1970er-Jahre. Die Bewaffnung besteht aus sechs 112-kg-Bomben.Nico via Matos
»Ginas« über Afrika konflikte10
Portugals afrikanische Kolonien
Angola
Angola war schon seit 1655 portugiesische Kolonie. Das riesige, an
Naturressourcen reiche Land wurde von Luanda – das als schönste
Stadt Afrikas galt – aus regiert, welches sich bis 1960 zu einer Stadt mit
einem wichtigen Hafen und prosperierender Wirtschaft mauserte. Im
Unterschied zu früheren Zeiten erhielt die
einheimische lokale Bevölkerung gleiche
Rechte und wurde in die portugiesische
Gesellschaft integriert.
Nicht desto trotz, mit dem Aufflammen
antikolonialer Bewegungen in Afrika der
1950er-Jahre, gab es auch immer mehr an-
golanische Intellektuelle, welche mit dem Status ihres Landes nicht
zufrieden waren. Schon 1954 wurde die erste bedeutende natio-
nalistische Bewegung im Norden Angolas gegründet, die União
dos Povos do Norte de Angola (UPNA). Vier Jahre später wurde
die UPNA in die konservative Unioa das Populacoes de Angola
(UPA) umorganisiert. Die vorgeblich mar-
xistisch orientierten Politiker sammelten
sich vor allem um die Movimento Popular
de Libertação de Angola (MPLA) Ende der
1950er-Jahre.
Trotz ihrer manchmal recht scharfen
Rhetorik forderten beide Organisationen
zunächst noch nicht die Unabhängigkeit ihres Landes von
Portugal. Im Jahre 1960 gab es eine weitere Reorganisation der
UPA, welche in Frente Nacional da Libertação de Angola (FNLA)
umbenannt wurde und eine bewaffnete Miliz zur Führung eines
Befreiungskriegs aufstellte. Die Portugiesen reagierten sehr ent-
schlossen auf die ersten Aktionen der FNLA, verhafteten ihre
Anführer und schlugen Protestveranstaltungen in Luanda teils bru-
tal nieder. Anfang 1961 breitete sich der Aufstand trotzdem auf die
Baumwollplantagen im Nordosten des Landes aus. Bis März gleichen
Jahres starteten die Rebellen eine Terrorkampagne gegen weiße Siedler
und deren einheimische Arbeiter, bei der Tausende ums Leben kamen.
Als sich die lokalen portugiesischen Sicherheitskräfte von der Situation
überfordert fühlten, mussten sie die Streitkräfte um Hilfe bitten.
Mosambik
Mit einer Fläche halb so groß wie Frankreich, war Mosambik die
größte portugiesische Überseeprovinz – die älteste Kolonie, eta-
bliert schon im Jahr 1498. Trotzdem entwickelte sich ein be-
waffneter Widerstand gerade hier erst ab 1960, als sich mit der
Frente da Libertação de Moçambique (FRELIMO) eine recht fragi-
le bewaffnete Organisation aus zwei kleineren Gruppen bildete.
Während der ersten Jahre ihrer Existenz
war FRELIMO wegen der Uneinigkeit zwi-
schen ihren Mitgliedern vor allem mit sich
selbst beschäftigt. Nachdem aber 1964
das ehemals britische UN-Treuhandgebiet
Tanganjika als Vereinigte Republik Tansania
seine Unabhängigkeit erlangt hatte,
fand die FRELIMO dort genügend staatliche Unterstützung und
Rückzugsmöglichkeiten, um den Kampf gegen die portugiesischen
Besatzer aktiv aufzunehmen.
Portugiesisch-Guinea
Portugiesisch-Guinea war relativ klein und
die am wenigsten bevölkerte portugie-
sische Kolonie in Afrika. Dieses durch dichten
Dschungel und weite Sümpfe charakterisier-
te Gebiet war auch die am schlechtest ent-
wickelte Überseeprovinz. Daher war es we-
nig überraschend, dass sich hier schon 1956
eine besonders starke bewaffnete antikoloniale Bewegung entwickelte,
die Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC).
Portugal betrachte aber diese Kolonie als außerordentlich wichtig, da
sie durch ihre Flugplätze und Häfen eine Brückenfunktion zwischen
Portugal, Angola und Mosambik ausübte.
Das portugiesische
Kolonialreich war das erste globale
Weltreich und das am längsten
bestehende Kolo-nialreich Europas.
Seine Geschichte begann 1415 mit
der Eroberung von Ceuta und
endete mit der Rückgabe von
Macao an die Volksrepublik China im Jahr
1999. Um die Han-delsrouten nach
Indien zu sichern, wurden an den Küsten Afrikas
Stützpunkte errichtet, die wie eine Perlenkette
aufgebaut wur-den. 1822 wurden
die Kolonien und das Mutterland
offiziell gleichge-stellt. Den letzten
Gebietsgewinn erhielt Portugal
nach dem Ersten Weltkrieg,
als ihm das Kionga-Dreieck
zugesprochen und an Mosambik
angeschlossen wurde. In den
ehemaligen Kolonien haben
Portugiesen auch in der Bevölke-
rung ihre Spuren hinterlassen. In
allen gibt eine Mischbevölke-
rung mit den einheimischen
Ethnien, die Mestiços
genannt wird. Die Bezeichnung
Überseeprovinz wurde ab 1951
für alle Kolonien verwendet.
Man wollte auf diese Weise als
„multiethnische und plurikonti-
nentale Nation“ auftreten.
FNLA
FRELIMO
Guinea-Bissau
MPLA
11»Ginas« über Afrika konflikte
Am Ende dieser Organisation befanden sich die vorgeschobenen Stützpunkte, sogenannte Aeródromo de Manobras (AM) sowie die Transitflugplätze Aeródromo de Transito (AT). Diese wurden in großer Zahl Anfang der 1960er-Jahre eingerichtet, um Flugzeuge und Trup-pen schnell im ganzen Land disponieren zu können.Beispielsweise sah die Organisation der FAP in Angola wie folgt aus: Hauptstützpunkt war BA.9 in Luanda, während die Flugplätze in Negage (AB.3) und Henriques de Carvalho (AB.4) ebenfalls zur zeitweisen Stationierung der Kampfeinheiten eingesetzt wurden. Daneben existierten Aeródromo de Manobras (AM) mit befestigten Start- und Landebahnen in Maguela do Zombo (AM.31), Toto (AM.32), Portugalia (AM.41), Camaxilo (AM.42), Cazombo (AM.43), Cabinda (AM.95) sowie in Nova Lisboa und Cuito. Unbefestigte Landebahnen befanden sich in Cacolo, Santa Eulailia und Vial Texeira de Sousa. Maquela do Zombo und Toto wurden vor allem zum vorgeschobenen Einsatz der in AB.9 stationierten Einheiten verwandt, während die in AB.4 stationierten Staffeln vor allem aus Portugalia, Camaxilo und Cazombo operierten.
Ein ähnliches Netzwerk bildete sich nach und nach auch in Mosam-bik. Der Hauptstützpunkt war Beira, während die in Nacala (AB.5), Tete (AB.7) sowie Lourenço Marques (AB.8) vorübergehend stationierten Einheiten den Norden, Westen und sowie Süden des Landes abzude-cken hatten. Aeródromo de Manobras (AM) und Aeródromo de Tran-sito (AT) befanden sich – von Norden nach Süden – in Mueda, Porto Amelia und Nova Freixo.
Jeder dieser Flugplätze wurde von einer Staffel der Militärpoli-zei der Luftwaffe (Policia Aéra) bewacht, während die gesamte FAP-Struktur in drei Zonen – sogenannte Regiões Aèreas – aufgeteilt wurde.
Aufstand in Portugiesisch-Guinea
Der Ausbruch des bewaffneten Aufstandes im August 1961 über-raschte die Portugiesen nur wenig. Hingegen sorgte die gute Ausbil-dung und Ausrüstung der Aufständischen umso mehr für Erregung, da viele ihrer Kämpfer zuvor in der Sowjetunion und der ČSSR ausge-bildet worden waren. Als nämlich bereits im Juli 1961 die PAIGC ihre ersten Operationen im Grenzgebiet zum Senegal unternahm, wurde bereits offensichtlich, dass es den Aufständischen im Vergleich zu regulären portugiesische Truppen vor allem an Feuerkraft nicht man-gelte. Die PAIGC operierte zwar in kleinen und beweglichen Gruppen, welche teils aus »regulären« Kämpfern und teils aus lokalen Milizen bestanden. Tatsächlich schätzte die Regierung in Lissabon schon bald nach dem Ausbruch der Feindseligkeiten ein, dass die Lage in Portugiesisch-Guinea äußerst kritisch. Man konnte das Territorium aber wegen seiner strategischen Bedeutung aber auf keinen Fall aufgeben.
Nach den ersten Schusswechseln hatte die portugiesische Luft-waffe schon einige Einheiten in AB.2 stationiert, darunter eine Staf-fel mit Übungsflugzeugen North American T-6G Texan. Im August wurde die mit acht North American F-86F Sabre ausgestattete Abtei-lung 52 der Esquadra 51 von BA.5 in Monte Real nach Bissau/Bissa-lanca verlegt. Darunter befanden sich die schon reichlich betagten Sabre mit den Bordnummern 5307, 5314, 5322, 5326, 5354, 5356, 5361 und 5362. Die Abteilung 51 sah sich sofort in schwere Kämpfe ver-wickelt und flog Dutzende Einsätze. Es überrascht daher nicht, dass die Einheit innerhalb nur eines Jahres bereits zwei Unfälle hinneh-men musste. Schon im August 1961 kollidierte die Sabre 5361 mit
Diese beiden Aufnahmen zei-gen eine G.91R-4 der Esquadra 51 Anfang 1966 in Monte Real. Die ´5440´ war die letzte der von Deutschland an Portugal gelieferten 40 Maschinen. Das Flugzeug verfügt bereits den portugiesischen Standard-Sicht-schutzanstrich Leichtgrau. Zu beachten sind die letzten zwei Ziffern der Bord-nummern auf den Bremsklappen sowie der Zusatz-träger für zwei 50-kg-Bomben auf den äußeren Pylonen.
»Ginas« über Afrika konflikte12
einem Vogelschwarm; der Schaden konnte erst Wochen später beho-ben werden. Ein Jahr später schoss die Sabre ́ 5314´ mit zwei Bomben unter ihren Tragflächen über die Landebahn hinaus, explodierte und ging in Flammen auf.
Die Intensität der Auseinandersetzungen nahm bis 1963 weiter zu, zumal die PAIGC sich zu gut organisierten Großangriffen auf Poli-zeistationen in Buba, Tite und Falacunda in der Lage zeige. Im Mai des gleichen Jahres ging auch die erste F-86F (Nr. 5322) durch Boden-beschuss verloren. Hauptmann Fausto Vala landete sicher mit dem Fallschirm und konnte wenig später von einem Hubschrauber geret-tet werden.
Obwohl es mittlerweile immer mehr Problem mit der Instand-haltung der Sabre gab, verfügte die FAP über keine Alternative. Im August 1963 attackierten F-86F Flak-Stellungen der PAIGC bei Incas-sol sowie Stützpunkte in Cachaque Balanta, wobei zum ersten Mal Napalmbomben zum Einsatz kamen.
Weitere schwere Einsätze folgten im September und Dezem-ber des gleichen Jahres. Die allgemeine Situation verschlimmerte sich allerdings zunehmend und kulminierte Anfang 1964, als die Auf-ständischen die Insel Como einnahmen. Die portugiesische Armee startete sofort einen wuchtigen Gegenangriff, der wieder von F-86F unterstützt wurde. Dieser misslang allerdings völlig. Kurz daraufhin war die FAP gezwungen, den Einsatz der Sabre in Portugiesisch-Gui-nea abzubrechen. Das lag nicht nur an den nahezu völlig abgeflo-genen Zellen, sondern am Druck der USA, welche dagegen prote-stierten, dass die zur Verteidigung Portugals gelieferten F-86 in einem »Kolonialkrieg« Verwendung fanden.
Die Sabre mussten daher durch die weitaus weniger geeigneten T-6 ersetzt werden – gerade rechtzeitig, um den zweiten Gegenan-griff auf Como zu unterstützen. Die Operation »Tridente« sollte eine konzertierte Aktion von Armee, Luftwaffe und Marine werden. Es kam jedoch zu keiner schnellen Entscheidung, sondern zu einem Abnut-zungskrieg, welcher beiden Seiten schwere Verluste – vor allem durch Krankheiten und Unterernährung – einbrachte. Nach 71 Tage erbit-
terter Kämpfe konnten die Portugiesen zwar Como wieder besetzen, waren allerdings nicht im Stande, es auf Dauer zu halten. Schon zwei Monate später eroberte die PAIGC einige ihrer Stellungen auf der Insel zurück. Diesmal gab es keinen portugiesischen Gegenangriff. Zudem vermochten die Aufständischen weitere Gebiete auch im Süden Por-tugiesisch-Guineas einzunehmen, darunter in Cantanhez sowie auf der Halbinsel Quitafine, wodurch die portugiesischen Stützpunkte in Catió und Bedanda praktisch eingeschlossen wurden.
Wie intensiv die Kämpfe um Como waren, zeigen am besten die Statistiken der FAP aus dieser Zeit. Demnach wurden innerhalb von zwei Wochen 851 Kampfeinsätze geflogen, davon 73 durch Sabre.
Die »deutsche« Alternative
Nach dem Abzug der Sabre aus Portugiesisch-Guinea befand sich die FAP in einer prekären Lage, denn die langsamen T-6 erwiesen sich als sehr beschussempfindlich. Aus diesem Grund begab sich die Regierung in Lissabon sofort auf die Suche nach einem geeigneten Kampfflugzeug, dessen Einsatz vor allem nicht vom politischen Wohlwollen der USA abhing. Gleichzeitig musste aber auch das inzwischen verhängte internationale Embargo auf die Ausfuhr von Rüstungsgütern, welche Portugal in Afrika ein-setzen könnte, umgangen werden. Umso größer war die Über-raschung, dass ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland, die bisher aus ihrer Sympathie für Unabhängigkeitsbewegungen in Afrika – und hier vor allem in Algerien – keinen Hehl gemacht hatte, ein Lieferangebot unterbreitete. Die deutsche Luftwaffe war nämlich gerade damit beschäftigt, ihre Candair CL-13 Sabre F.Mk.6 auszumustern und durch die Lockheed F-104G Starfighter zu ersetzen. Natürlich waren die Portugiesen – vor allem nach ihren bisherigen Erfahrungen mit der Sabre – nicht unbedingt von dieser Offerte begeistert. Da aber keine Alternative in Sicht war, blieb Lissabon keine Wahl. Schon im Mai 1965 wurden zehn portugiesische Piloten nach Oldenburg geschickt, um die Ausbildung aufzunehmen. Doch erneut sorgten die USA für ein Stoppsignal. Da die in Kanada gebauten Sabre nämlich eine US-Exportlizenz benötigten, wurde die kanadische Regierung dazu gebracht, Druck auf die Regierung in Bonn auszuüben. Der Deal musste wieder storniert werden. Doch die Bundesregierung verfügte noch über ein weiteres Kampfflugzeug, welches gera-de ausgesondert wurde und nicht vom Veto der USA abhing: Die Fiat G.91R-4, welche mittlerweile von Flugzeug-Union Süd – einem Konsortium aus Messerschmitt, Heinkel und Dornier – gebaut wurde.
Ursprünglich auf dem Design der F-86 basierend, war die G.91 ein kleiner Jagdbomber, der auch unter relativ primitiven Bedingungen eingesetzt werden konnte. Die italienische Firma Fiat baute ihn als einen Kandidaten für ein standardisiertes NATO-Muster in dieser Klas-se, welches vor allem für Griechenland und die Türkei bestimmt war. Tatsächlich wurde die Fiat G.91 aber nur von Deutschland und Italien bestellt. Die deutsche Luftwaffe war – milde ausgedrückt – von dem neuen Einsatzmuster nicht unbedingt begeistert. Zwar verfügte ihre Version über vier Waffenträger unter den Tragflächen, doch die aus vier Maschinengewehren Browning 12,7 mm bestehende Hauptbe-waffnung galt als unzureichend, genauso wie die geringe Nutzlast von 908 kg, welche über eine Entfernung von lediglich 315 km beför-dert werden konnte. Zudem verfügte die Maschine über keine Ausrü-stung für Schlechtwetter- und Nachteinsätze, was für deutsche Ver-hältnisse ein erhebliches Manko darstellte.
Als sich die Portugiesen die deutschen G.91 näher ansahen, stell-ten sie zu ihrer Freude aber fest, dass die »Gina« nicht nur einfach zu warten war, sondern auch sehr robust erschien und ein verläss-liches Triebwerk Bristol Orpheus besaß. Außerdem war die angebo-tene Version G.91R-4 auch noch mit drei Kameras Vinten F-95 Mk 3 für Aufklärungszwecke ausgestattet. Dazu konnten die Maschinen mit praktisch allen der FAP zur Verfügung stehenden Waffen aus-
Zwei ZPU-Stellungen der
PAIGC, aufgenom-men von G.91 der Esquadra 121. Die
14,5-mm- MGs wurden häufig
von kubanischen »Instrukteuren«
bedient und erwiesen sich
als gefährliche Gegner. Ihre Posi-tionen wurden zu
den wichtigsten Zielen der FAP bei Beginn fast jeder
Operation. .
13»Ginas« über Afrika konflikte
gerüstet werden. Jetzt beeilte sich die portugiesische Regierung und unterschrieb schon im Herbst 1965 den Kaufvertrag, der teil-weise dadurch bezahlt wurde, dass Portugal der deutschen Luftwaf-fe seinen Übungsstützpunkt Beja zur Verfügung stellte. Der Vertrag enthielt übrigens auf Wunsch der deutschen Seite den Passus, dass die Fiat nie »außerhalb Portugals« zum Einsatz kommen dürften. Die-se Festlegung war aber nicht die Tinte auf dem Papier wert, denn wie bereits erwähnt betrachtete Portugal seine afrikanischen Kolonien seit 1953 als Inland.
Die Übernahmen der Fiat begann im November 1965, als acht por-tugiesische Piloten – angeführt von Generalmajor Gomes Amaral – zwecks Umschulung zum Leichten Kampfgeschwader (LeKG) 44 nach Leipheim reisten. Kaum einen Monat später, am 4. Dezember 1965, traf die erste Fiat G.91 in Portugal ein. Die insgesamt 40 Maschinen mit den neuen Bordnummern 5401 bis 5440 wurden zunächst gründ-
lich von der Firma Oficina Geral de Material Aeronáutico (OGMA) in Alverca überholt. Die ersten acht Exemplare behielten den deutschen Tarnanstrich, die meisten übrigen »Ginas« bekamen ein neues Sicht-schutzschema. Als erster Verband rüstete die in Monte Real statio-nierte Esquadra 51 »Falcons« von der F-86F auf zunächst zwölf G.91 um. Monte Real wurde daraufhin auch zum Ausbildungszentrum für alle zukünftige portugiesische Fiat-Piloten.
Kampfeinsatz bei den »Tigern«
Nur wenige Monate nach ihrer Ankunft in Portugal wurden die ersten acht Maschinen mit den Bordnummern 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5406, 5417 und 5418 auf dem Seeweg nach Bissau/Bis-salanca verlegt. Nachdem sie dort montiert und eingeflogen waren,
Eine F-86F Sabre der Esquadra 51, Abteilung 52, 1962/63 auf AB.12 in Bissau/Bissalanca. Die Maschine wurde nach harten Ein-satzbelastungen im Mai 1963 abgeschossen.
Die ersten acht bei der Esquadra 121 in Dienst gestellten G.91R-4 trugen noch den von der deutschen Luftwaffe aufgetragenen Sichtschutz aus Gelboliv (RAL 6014) und Basalt-grau (RAL 7012) an der Oberseite bzw. Blau (RAL 5014) an der Unterseite. Das Staffelwappen der »Tigres« wurde unterhalb des Cockpits, zusammen mit einem riesigen Tiger-Maul aufgetragen.
Vor ihrem Einsatz in Afrika wurden die meisten »Ginas« in Tropisch-Hellgrau getarnt, um die Wirkung der Sonnenstrahlung abzumindern. Bei den später bei der Esquadra 121 eingesetzten Maschinen wurde das Tiger-Maul recht grob von Hand aufgetragen, Staffelwappen und Augen weg-gelassen. Nach dem Auftauchen guineischer MiG-17 im Jahr in 1968 erhielten einige Maschinen Abschussvorrich-tungen für Luft-kampfraketen Sidewinder.
»Ginas« über Afrika konflikte14
begann im Juli 1966 der Flugbetrieb unter dem Kommando von Major Armando Santos Moreira, dessen neuaufgestellte Esquadra 121 »Tigres« die Fiat übernahm. Die Ausbildung der Piloten und der Bodenbesatzungen schritt derart schnell voran, dass sie innerhalb weniger Tage ihre Maschinen schon im Alarmzustand »+2« halten konnten (d.h. ein Start war innerhalb von zwei Minuten nach der Befehlsausgabe möglich). Die Fiat G.91 waren in der Lage, das gesamte Territorium von Portugiesisch-Guineas abzudecken. Auch der letzte Winkel im Süden des Landes und jede vorgelagerte Insel konnte innerhalb von 15 Minuten nach der Startfreigabe erreicht werden. In Portugiesisch-Guinea operierten die Fiat üblicherweise paarwei-se. Anfänglich wurden sie vorrangig für Aufklärungszwecke ein-gesetzt, vor allem entlang der Grenze zum südlichen Nachbarland Guinea. Dabei flogen die Kampfjets üblicherweise in einer Höhe von 180 Metern mit einer Geschwindigkeit von 750 km/h. Obwohl in späteren Jahren die Bodennahunterstützung immer mehr an Bedeutung gewann, bildeten Aufklärungsmissionen auch weiterhin einen Schwerpunkt. 1966 richtete die FAP in Bissau/Bissalanca eine Zentrale zur Luftbildauswertung mit hoch qualifizierten Spezialisten ein. Die dadurch gewonnenen Erkenntnisse wurden später für die Planung und den Verlauf einiger Operationen von entscheidender Bedeutung. Wenngleich – wie schon erwähnt – praktisch mit allen Waffen im FAP Arsenal kompatibel, setzte die FAP ihr neues Kampfflugzeug vor allem mit ungelenkten Raketen vom Kaliber 70 mm und verschie-dene Bomben von 45, 50, 200, 227 kg und 340 kg – letztere war die amerikanische M-117 – ein. Napalmbehälter mit einer Kapazität von 300 Litern kamen später dazu. Die vorrangig genutzte Waffenkon-figuration bestand aus zwei 200-kg-Bomben auf den inneren und vier 50-kg-Bomben oder ungelenkten Raketen auf den äußeren Waffenträgern.
Gefährliche Erdabwehr
Als Major Moreiras »Tigres« ihre Operationen intensivierten, rea-gierte die PAIGC vor allem im Südteil mit der Einführung schwerer sowjetischer Maschinengewehre vom Typ ZPU-1 (einrohrig) und ZPU-4 (vierrohrig) vom Kaliber 14,5 mm. Diese – meist von kubanischen »Instrukteuren« bedienten Flugabwehrwaffen erwiesen sich als sehr mobil und tauchten immer wieder überraschend auf neuen Posi-tionen auf, was ihre Verfolgung und Vernichtung zur einer echten Herausforderung machte. Die Fiat begegneten ihnen zum ersten Mal während der Operation »Estoque«. Dieses Unternehmen sollte mit einem Nachtangriff einiger zu Bombern umgerüsteter Douglas C-47 Dakota am 9. August 1966 mit 50-kg-Bomben und Napalmbehältern zwecks Zerstörung der Flak-Stellungen des Gegners seinen Anfang nehmen. Als am darauf folgenden Morgen die Fiat über der Kampf-zone auftauchten, mussten ihre Piloten allerdings feststellen, dass die meisten Flak-Stellungen der PAIGC nicht nur noch immer intakt waren, sondern auch deren Feuerkraft keineswegs beeinträchtigt war. Gleich zwei Jagdbomber wurden durch den Beschuss vom Boden beschädigt, von denen einer auf dem Behelfslandeplatz bei Cufar zur Landung gezwungen wurde.
Im November 1966 unterstützten die Fiat die Operation »Samu-rai« auf der Insel Como. Zuerst unternahmen sie einige Aufklärungs-einsätze, um später zusammen mit C-47, T-6G und einigen Alouette III einer Fallschirmjägerkompanie Feuerunterstützung zu geben. Am 19. und 20. Dezember des gleichen Jahres beteiligten sich G.91 an der Operation »Valquiria« zur Versorgung der auf der Halbinsel Cantan-hez abgeschnittenen Besatzung eines Armee-Stützpunktes. Dabei galt es, die langsam entlang des Flusses Cumbija vordringenden und mit frischen Truppen und Verpflegung beladenen Versorgungsboo-ten durch Nahunterstützung unter die Arme zu greifen. Die meisten
Die S-61A-4 Nuri sind nunmehr 40
Jahre im Dienst und genießen seit mehreren fatalen
Abstürzen in der Öffentlichkeit
kein großes Vertrauen
mehr. Ersatz ist dringend
nötig. Dieser grünbemalte Nuri
wartet auf einen VIP-Gast auf der MiG-29-Basis in
Kuantan.
Guinea-Bissau war bis 1836 ein Zentrum für den Sklavenhandel. 1879 wurde das
Land zur Kolonie Portugiesisch-
Guinea und von den Kapverden
getrennt. 1951 wurde es
portugiesische Überseeprovinz.
Zu dieser Zeit hat-te Portugiesisch-Guinea bei einer
Fläche von 36 125 km² etwa 510 000 Einwoh-ner, um 1960 lag die Zahl bei rund
600 000, davon 2600 Europäer.
Der Krieg war das „Vietnam
Portugals“. Es fielen 1875
portugiesische Soldaten und
etwa 6000 von 10000 Kämpfern
der PAIGC.
15»Ginas« über Afrika konflikte
der von den Fiat geflogenen Angriffe wurden als »sehr erfolgreich« bewertet. Zwischen Juni und Ende Dezember 1966 warfen die in Por-tugiesisch-Guinea eingesetzten Fiat zusammen mit C-47 und T-6G alles in allem 5930 kg Bomben ab.
Die nächste Operation, an der die »Tigres« teilnahmen, nannte sich »Barracuda« und begann am 4. Februar 1967, um mehrere Flak-Stellungen im Wald von Gã Formoso zu zerstören. Bis zu diesem Zeit-punkt wurde die Esquadra 121 durch mehrere T-6G der Esquadrillha (Abteilung) »Roncos«, einige Dornier Do 27 sowie sieben Alouette III verstärkt und zugleich ihr Flugplatz in Bissau/Bissalanca zur einer »vollwertigen« BA.12 erweitert.
Sorgfältig geplant, sah die Operation »Barracuda« eine sehr enge Zusammenarbeit der G-.91 mit anderen Kampfflugzeugen und Hubschrauber sowie den Kriegsschiffen der portugiesischen Marine vor. Das Unternehmen verlief dann auch recht erfolgreich, denn Fiat trafen alle Flak-Stellungen. Eine ZPU-1 der PAIGC fiel in die Hände der portugiesischen Streitkräfte, die selbst keine Ver-luste erlitten.
Dennoch nahmen Stärke und Einfluss der PAIGC – die inzwischen auch offiziell von der Organisation für Afrikanische Einheit (Organi-
zation of African Unity, OAU) unterstützt wurde – kontinuierlich zu. Fast täglich kam es zu Angriffen auf portugiesische Garnisonen und Fahrzeugkolonnen.
Am 22. Februar 1967 wurde die G.91R-4 (5407) durch die vorzei-tige Detonation ihrer gerade abgeworfenen Bomben schwer beschä-digt. Der Pilot war wenige Sekunden später zum Verlassen der Maschi-ne mit seinem Schleudersitz gezwungen und konnte kurze Zeit später gerettet werden. Eine zweite G.91R-4 erhielt Treffer durch eine ZPU-1. Oberstleutnant Costa Gomes konnte sich aber ebenfalls mit seinem Schleudersitz und Fallschirm in Sicherheit bringen.
Die sowjetischen ZPU waren nicht die einzige Bedrohung für die auf zwölf Fiat verstärkte Esquadra 121, welche mittlerweile unter dem Kommando von Major Fernando Joao de Jesus Vasquez stand. Im April 1968 meldete die portugiesische Presse einen Zwischenfall, an dem zwei Fiat und zwei MiG-17 der Force Aérienne de Guinea (FAG, guineische Luftstreitkräfte) beteiligt waren. Der Vorfall wurde nie-mals von offiziellen Stellen in Lissabon bestätigt, doch ist bekannt, dass Guinea als einer der ersten afrikanischen Staaten sowjetische MiGs bekam. Bereits 1960 waren zehn MiG-17F und zwei MiG-15UTI geliefert worden, die ein Jahr später den Dienst bei der 1. Jagdbom-berstaffel der Force Aérienne de Guinea aufnahmen. Ein Indiz dafür, dass derartige Zwischenfälle nicht aus der Luft gegriffen sind, liefert auch der Umstand, dass die FAP kurzerhand ihre in Portugiesisch-Guinea eingesetzten G.91R-4 mit Abschussvorrichtungen für ameri-
kanische Luft-Luft-Raketen AIM-9B Sidewinder versah und mit ihnen in den darauffolgenden Jahren zahlreiche Kampfpatrouillen entlang der Grenze zu Guinea ausführte.
Im März 1969 beteiligte sich die Esquadra 121 an der Operation »Vulcano« bei Cassabeche im Süden des Landes. Mittlerweile waren die Piloten gezwungen, die meisten ihrer Angriffe am frühen Mor-gen aus Richtung der tiefstehenden Sonne zu fliegen. »Vulcano« begann am 7. März von Behelfslandeplätzen, um kurze Anflugzeiten zu ermöglichen. Kurz daraufhin landeten Alouette eine Kompanie Fallschirmjäger. Die ZPU ließen sich diesmal nur sehr schwer ausfindig machen und blieben nahezu unbehelligt. Eine Fiat und eine Alouette wurden durch ihren Beschuss beschädigt. Als die Anwesenheit wei-terer ZPU-4 festgestellt wurde, sahen die Portugiesen eine Nahunter-stützung aus der Luft als nicht mehr durchführbar an. »Vulcano« mus-ste daraufhin abgeblasen werden und die Fallschirmjäger kehrten zu Fuß zu ihren Stützpunkten zurück.
Nach dieser Erfahrung wurden die »Tigres« im April 1969 durch weitere vier G.91R-4 mit den Bordnummern 5402, 5415, 5418 und 5427 auf einen Bestand von zwölf Maschinen verstärkt und die Staffel unter das Kommando von Oberstleutnant José Almeida Brito gestellt.
Radar ist Fehlanzeige
Der dichte Dschungel in Portugiesisch-Guinea erwies sich während dieses Kriegs als eine echte Gerüchteküche. Trotz der Tatsache, dass die PAIGC von praktisch allen benachbarten Staaten unterstützt wurde, und obwohl bekannt war, dass sich die Aufständischen im unzugänglichen Terrain und durch den dichten Dschungel recht schnell bewegen konnten, hieß es immer wieder, dass sie von »unbekannten« Flugzeugen unterstützt würden. Zunächst war nur von MiG-17 aus Guinea die Rede, aber Anfang 1967 machten auch erste Gerüchte über Transportflugzeuge und Hubschrauber die Runde. Tatsächlich kursieren im Internet bis heute Berichte über angebliche Luftkämpfe zwischen Fiat G.91 und MiGs. Die Verlässlich-keit derartiger Meldungen dürfte eher gering sein, zumal sich nach so langer Zeit Bestätigungen hätten finden müssen, und seien es Äußerungen der Beteiligten. Auch offizielle portugiesische Quellen enthalten keine Aussagen zu derartigen Zwischenfällen. Dies kann allerdings auch andere Gründe haben, denn die FAP verfügte in ganz Portugiesisch-Guinea nur über eine einzige und überdies veraltete Radaranlage, die mehr für die Wetterbeobachtung denn für die Luftraumüberwachung taugte. Die Luftwaffe wusste folglich selbst nicht so recht, was sich über Portugiesisch-Guinea alles abspielte. Die eigenen Piloten mussten sich ausschließlich visuell orientieren.
G.91R-4, Bord-nummer 5417m, bei der Rückkehr von einem Einsatz gegen die PAIGC, Ende 1973 in Bissau/Bissalan-ca. Die Spuren des schweren Einsatzes sind deutlich auf dem olivgrünen infrarotdäm-menden Anstrich auszumachen.
»Ginas« über Afrika konflikte16
Bezeichnend für dieses »Blinde-Kuh-Spiel« ist ein Vorfall vom 10. September 1967, als die Besatzung einer C-47 der FAP über Bafatà einen unbekannten Hubschrauber sichtete und versuchte, diesen anzufunken. Nachdem eine Reaktion auslieb, wurde die BA.12 informiert, welche zwei Fiat nach »beschleunigtem Verfahren« in die Luft schickte. Eine davon musste jedoch wieder umkehren, da das Bodenpersonal vergessen hatte, die Abdeckung der Maschi-nengewehrbucht zu schließen. Die zweite »Gina« setzte ihren Auf-trag allein fort. Von der Besatzung der C-47 per Funk geleitet, fing sie den unbekannten Hubschrauber zwei Minuten vor der Grenze zum Senegal ab. Nachdem dessen Besatzung auch weiterhin nicht antwortete, gab der Pilot der G.91 einige Warnschüsse ab. Erst jetzt änderte die unbekannte Maschine ihre Flugrichtung und signali-sierte die Bereitschaft, auf einem portugiesischen Stützpunkt zu landen. Es handelte sich um eine zivile Westland WS-55, welche ohne Freigabe von Senegal über Guinea nach Gambia unterwegs war und in keinem Zusammenhang mit der PAIGC stand.
Der Vorfall lieferte daher eher Beweise dafür, dass die Aufstän-dischen von keinen Transportflugzeugen oder Hubschraubern unter-stützt wurden, sondern dass immer wieder unautorisierte Überflüge stattfanden, da die portugiesischen Behörten keine wirkliche Luft-raumkontrolle auszuüben in der Lage waren.
Im Übrigen waren die Aufständischen für den Transport ihrer Truppen, der Ausrüstung und der Verpflegung auf Luftunterstüt-zung auch gar nicht angewiesen. Die Portugiesen taten nämlich nicht mehr als notwendig, um die PAIGC nicht zu gefährlich werden zu lassen und hielten die eigenen Bodentruppen lieber in den strate-gisch wichtigsten Siedlungen zusammen. Damit waren der PAIGC von vornherein weiter Teile des Landes überlassen, in denen sie sich ungehindert bewegen konnte. Darüber hinaus verfügten die Rebellen Zugriff auf reguläre Straßenverbindungen aus Senegal, Gui-nea und Ghana, über welche sie ihren Nachschub weitgehend unge-stört organisieren konnten.
MiGs im Anflug
1968 wurde General António Spinola zum Militärgouverneur in Portugiesisch-Guinea ernannt. Er startete eine intensive Kampagne mit dem Ziel, den Lebensstandard der Bevölkerung zu steigern, gleichzeitig aber auch eine neue Offensive gegen die PAIGC. Die Fiat der Esquadra 121 verfügten mittlerweile über Napalmbehälter und konnten außerdem Herbizide aussprühen, um entlang der wenigen – und meist neu gebauten – Straßen die Pflanzenwelt zu entlauben. Damit sollte das Risiko von Überfällen auf Militärkonvois verringert werden. Bis zum Jahr 1971 wurden die Fiat auch zu Angriffen gegen
Stützpunkte der Aufständischen entlang der Grenzen zu Guinea und Senegal ausgesandt.
Spinola nahm auch Verhandlungen mit dem Präsidenten Gui-neas, Sekou Touré, auf, um diesen einerseits zur Abkehr von der PAIGC zu veranlassen und um andererseits einige gefangene portugiesische Soldaten, die in Conakry festgehalten wurden, frei zu bekommen. Da die Gespräche im Sande verliefen und Spinola sich durch einige Erfolge im Kampf gegen die PAIGC gestärkt sah, entschied er sich zu einem Schlag gegen Guinea.
Die Landoperation begann am 22. November 1970 unter dem Namen »Mar Verde« und führte zur Befreiung einiger in Conakry fest-gehaltener Gefangener, darunter auch Besatzungen von der PAIGC abgeschossener Flugzeuge und Hubschrauber. Um gleich noch die MiG-17 der guineischen Luftstreitkräfte zu zerstören, wurde der Flug-platz der Hauptstadt ebenfalls angegriffen. Allerdings befand sich keine einzige MiG vor Ort, denn die gesamte 1. Staffel der FAG übte mit algerischen und nigerianischen Piloten im Osten des Landes. Erst zwei Tage später, am 24. November, tauchte eine MiG-17 der FAG auf – aber nicht über Conakry, sondern hoch über Bissau! Die Maschine machte eine Kehrtwendung direkt über Spinolas Gouverneurspalast und verschwand, bevor eine Fiat aufsteigen konnte. Dies war eine unmissverständliche Warnung für den neuen Militärgouverneur, des-sen misslungener Putschversuch gegen Präsident Sekou Touré damit endgültig gescheitert war.
Von diesem Tag an musste die portugiesische Luftwaffe täglich damit rechnen, mit MiGs zusammenzutreffen. Als »hoch« wurde auch die Gefahr eingestuft, dass der Stützpunkt BA.12 aus der Luft ange-griffen würde. Die Lage verschärfte sich im März 1971 weiter, als zwei von algerischen Piloten gesteuerte MiG-17 der FAG eine Aufklärungs-mission über dem Stützpunkt Bissau/Bissalanca unternahmen.
Unter diesen Umständen mag die Operation »Mar Verde« zwar auf den ersten Blick erfolgreich gewesen sein, doch ihre politischen Auswirkungen waren für Portugal verheerend. Im Dezember 1970 reiste der Anführer der PAIGC, Amilcar Cabral, nach Moskau und trat überzeugend als »sozialistischer Bruder« auf. Die Sowjets ließen sich auch nicht lumpen und weiteten ihre Militärhilfe aus. In wenigen Wochen brachten mehrere sowjetische Frachtschiffe zwei Transport-flugzeuge Iluschin IL-14 und mehrere Schwimmpanzer PT-76 sowie andere schwere Waffen nach Conakry. Bald wurde berichtet, dass die PAIGC in Conakry eine eigene Luftwaffe aufstellen wolle, deren Piloten aus Osteuropa kämen.
Derartige Meldungen waren allerdings verfrüht. Die ersten 17 PAIGC-Piloten wurden erst im Jahre 1973 zur Ausbildung in die UdSSR geschickt. Ein Jahr später wurden fünf MiG-17F und zwei MiG-15UTI für die erste Staffel der zukünftigen Forca Aérea da Guinea-Bissau (FAGB) nach Conakry geliefert. Bis dahin verfügte die PAIGC über kei-
Wrackteile der G.91R-4,
Bordnummer 5419, welche am
28. März 1973 als erste von einer
durch die PAIGC eingesetzten
Strela (SA-7) abge-schossen wurde. Oberstleutnant
José Fernando Brito kam dabei
ums Leben.via Matos
17»Ginas« über Afrika konflikte
ne Luftwaffe, und es wird an dieser Stelle nochmals auf die Einsätze ausschließlich guineischer MiG-17 im Grenzbereich verwiesen.
Die portugiesische Luftwaffe betrachtete derartige Opera-tionen als Provokation und fragte bei der Regierung in Lissabon nach Verhaltensregeln an. Im November 1973 eröffnete der soeben neu ins Amt gelangte Verteidigungsminister Silva Cunha Verhand-lungen mit Südafrika über den Ankauf von zwei französischen Fla-Raketenbatterien R.440 Crotale. Diese wurden schon Anfang 1974 zur Verteidigung der BA.12 aufgestellt. Mittlerweile gelang einem portugiesischen Waffenhändler die Beschaffung von 500 Boden-Luft-Raketen FIM-42A Redeye aus Deutschland, während Cunha in Frankreich über den Ankauf von zwölf Dassault Mirage III verhandel-te. Paris zeigte sich einverstanden, stellte aber die Bedingung, dass diese nur auf Kap Verde stationiert werden dürfen. Damit konnte sich die portugiesische Regierung nicht abfinden und der Handel platzte ebenso wie die Anschaffung der Ein-Mann-Raketen Redeye, nachdem am 25. April 1974 die »Rosenrevolution« für völlig konträre politische Verhältnisse in Portugal gesorgt hatte.
Der »Strela-Schock«
Dagegen hatte es die PAIGC vermocht, sich lange vor der portugie-sischen Verstärkung auf welchen Wegen auch immer sowjetische infrarotgelenkte Ein-Mann-Luftabwehrraketen des Typs Strela-2 (SA-7 Grail) zu beschaffen. Schon Anfang 1973 wurde die erste Sen-dung in die guineische Hauptstadt Conakry geliefert. Zu dieser Zeit hoffte Cabral noch, den Konflikt durch Verhandlungen mit Spinola zu lösen. Doch Cabral wurde im Januar 1973 ermordet und die neue Führung der PAIGC setzte nur noch auf die militärische Karte. Am 22. März machten zwei Fiat-Piloten erste Erfahrungen mit den Strela der Aufständischen, ohne dass ihnen dies bewusst wurde. Oberstleutnant José Fernando Brito und Leutnant Cardoso Pessoa sprachen später von einer vorbeifliegenden »Schockwelle«, vermochten aber keine Beschädigungen an ihren Maschinen festzustellen. Die Existenz der Strela blieb also vorläufig noch ungelüftet und dementsprechend erging auch keine Warnung an die übrigen Piloten.
Russland SA-7A GRAIL (9K32 Strela-2): 1. Serienversion SA-7A GRAIL (9K32E Strela-2E): vereinfachte Exportversion der 9K32 SA-7B GRAIL (9K32M Strela-2M): 2. Serienversion mit verbessertem Suchkopf SA-7B GRAIL (9K32ME Strela-2ME): vereinfachte Exportversion der 9K32M SA-7B GRAIL (9K32MV Strela-2MW): Version für Hubschrauber SA-7C GRAIL (9K32M2 Strela-2M2): Version mit dem Suchkopf der SA-16 GIMLET SA-N-5 GRAIL (9K32MF Strela-2MF): Version für Marinefliegerkräfe
China HN-5A: Version der 9M32M mit gekühltem Suchkopf und neuem Sprengkopf Anza Mk 2
Pakistan Anza Mk 1: Lizenzfertigung der 9K32 Anza Mk 2: Lizenzfertigung der 9K32M Anza Mk 3: Version der 9M32M mit gekühltem Suchkopf und neuem Sprengkopf
Ägypten SAKR EYE: Version der 9K32M mit digitalem Suchkopf der französischen Firma Thomson-CSF
Rumänien CA-94M: Version der 9K32M mit digitalem Suchkopf
Serbien Strela-2MA: Version der 9M32M mit gekühltem Suchkopf und neuem Sprengkopf
Die Strela-2 (стрела für Pfeil, NATO-Code SA-7 GRAIL, GRAU-Index 9K32)
ist eine infrarotgelenkte Boden-Luft-Rakete, die von einer Person abge-
feuert wird. Daher auch die englische Bezeichnung Manpad.
Entwickelt wurde sie 1968 in der Sowjetunion. Da der Infrarotsuchkopf
nicht sehr zuverlässig war, folgte 1972 die verbesserte Strela-2M (SA-7b,
9K32M), welche auf dem internationalen Waffenmarkt große Verbreitung
fand. Mit der Strela-3 (SA-14 GREMLIN) existiert seit 1978 ein moder-
nerer und etwas leistungsfähigerer Nachfolger, der sich in Bauweise und
Erscheinung aber nicht von seinen Vorgängern unterscheidet. Das System
besteht aus der Rakete (9M32 oder 9M32M), einem Startrohr inklusive
Visier und einem Griffstück mit integrierter Elektronik (GRAU-Index 9P54
& 9P54M) sowie einer thermoelektrischen Batterie (GRAU-Index 9B17).
Außerdem kann ein Freund-Feind-Kenngerät an den Helm des Schützen
montiert werden. Eine passive Antenne, die akustische Signale in den
Kopfhörer des Schützen abgibt, dient dem Entdecken und Erfassen
eines Zieles. Die Rakete ist binnen sechs Sekunden feuerbereit. Nach
Einschalten der Stromversorgung verfolgt der Schütze das Ziel mit dem
optischen Sucher und betätigt den Abzug. Damit wird der Suchkopf akti-
viert und die Elektronik versucht, auf das Ziel aufzuschalten. Ist das Signal
stark genug und die Winkelgeschwindigkeit im zulässigen Bereich, wird
dies durch eine rote Lampe und einen Summton angezeigt. Der Schütze
muss nun weitere 0,8 Sekunden das Ziel verfolgen, bis die Rakete zündet.
Eine gescheiterte Aufschaltung wird durch einen abweichenden Ton mar-
kiert, wonach der Zielversuch wiederholt werden kann.
Beim Start brennt der Feststoffmotor im Startrohr komplett ab und be-
schleunigt die Rakete auf 30 m/s und eine Umdrehungszahl von 20 s-1.
Nach dem Verlassen des Rohres klappen die vorderen und hinteren
Technische Daten Strela-2M (SA-7b, 9K32M) Typ infrarotgelenkte Kurzstrecken-Boden-Luft-Rakete Geschwindigkeit 430 m/s (Mach 1,25) aktive Reichweite 4200 m aktive Gipfelhöhe 2300 m Antrieb Feststoff Gesamtmasse 10 kg Gefechtskopf 1,8 kg HTA-Sprengstoff Länge 1,4 m Durchmesser 0,07 m
Leitflächen aus. Weiterhin wird ein Selbstzerstörungsmechanismus ak-
tiviert, der nach 17 Sekunden die Rakete in der Luft zerstört, sofern kein
Ziel getroffen wurde. Nach etwa 0,3 Sekunden und etwa fünf Metern
zündet der Raketenmotor, der den Flugkörper auf 430 m/s beschleu-
nigt. Nach etwa 120 Metern wird der letzte Sicherheitsmechanismus
abgeschaltet und der Sprengkopf aktiviert. Der Sprengkopf zündet bei
Aufschlag auf das Ziel. Er kann ein Luftfahrzeug nicht im Ganzen zerstö-
ren, sondern nur wichtige Teile schwer beschädigen.
Die Waffe wurde in einer ganzen Reihe von Konflikten eingesetzt. Der
erste Einsatz hat 1969 im Nahen Osten stattgefunden. Bis Juni 1970 feu-
erte die ägyptische Armee 99 Strela ab und erzielte 36 Treffer gegen is-
raelische Kampfflugzeuge. Im Jahre 1974 erzielten syrische Streitkräfte
elf Treffer. Die moderne Strela-2M stand auch nordvietnamesischen
Streitkräften in der Spätphase des Vietnamkriegs zur Verfügung, wo
zwischen 1972 und 1975 gegen US-Kampfflugzeuge 204 Treffer bei 589
Einsätzen erreicht wurden.
Im November 2002 entkam eine vollbesetzte Boeing 757 der isra-
elischen Luftfahrtgesellschaft El Al nur mit Glück einem Angriff,
als kurz nach dem Start in Mombasa (Kenia) zwei Strela auf das
Passagierflugzeug abgeschossen wurden. Die Angreifer hatten es je-
doch versäumt, den Vorbeiflug ihres Zieles abzuwarten, so dass die
Suchköpfe der Raketen den heißen Abgasstrahl der Triebwerke nicht
erfassen konnten.
Am 2. November 2003 wurde ein US-amerikanische Transporthub-
schrauber vom Typ CH-47 Chinook bei Fallujah von zwei irakischen SA-7
getroffen. Der Hubschrauber stürzte ab und riss 15 US-Soldaten in den
Tod.
Strela-2 (SA-7 GRAIL)
Ägypten, Botswana, Burkina Faso, Deutschland (nach der Wiedervereini-gung), DDR, Eritrea, Guinea, Irak, Iran, Je-men, Jordanien, Kirgisistan, Kuba, Kuwait, Laos, Libanon, Libyen, Mali, Marokko, Mauretanien, Nicaragua, Nordkorea, Oman, Polen, Pakistan, Rumänien, Russ-land, Simbabwe, Sudan, Syrien, Ungarn, Zypern, Ex-Jugoslawien
»Ginas« über Afrika konflikte18
Aber nur drei Tage später, am 25. März, fand die erste Strela ihr Ziel. Die G.91 mit der Bordnummer 5413 wurde von Leutnant Pessoa über dem Gebiet um Guilege geflogen, als der Sprengkopf in sei-ner Maschine detonierte. Pessoa schleuderte sich in sehr niedriger Höhe heraus und brach sich bei der Landung ein Bein, da sich sein Schirm nicht vollständig öffnete. In der Annahme, er sei umgekom-men, suchten die Aufständischen nicht nach ihm. Eine Alouette III brachte ihn schließlich hinter die eigenen Linien. Aber auch Pessoa hatte nicht wirklich mitbekommen, was zu seinem Abschuss führte und sprach in seinem Bericht von einer »unbekannten Waffe«.
Noch immer ohne Ahnung von der neuen Bedrohung, verrich-teten die Fiat-Piloten ihre Arbeit wie bisher. Am 28. März wurde die von Oberstleutnant José Fernando Brito gesteuerte »Gina« mit der Bordnummer 5419 getroffen. Diesmal schaffte es der Pilot nicht mehr, rechtzeitig sein Flugzeug zu verlassen.
Erst dieser zweite Verlust innerhalb von drei Tagen ließ bei der Esquadra 121 den Verdacht reifen, dass die PAIGC im Besitz einer neu-en Waffe ist. Als dann klar wurde, um welch hocheffizientes System es sich handelte, kam es fast zu einer Panik. Sofort wurden alle Ein-sätze der langsameren Flugzeuge und Hubschrauber in der Kampf-zone strengstens untersagt. Selbst die Fiat durften vorläufig nur noch in sehr niedriger Höhe und mit höchster Geschwindigkeit operieren. Damit war die portugiesische Luftwaffe zu einem Zeitpunkt quasi paralysiert, als sie von Bodentruppen und der Marine mehr gebraucht wurde denn je zuvor. Selbstverständlich stellte das plötzliche Ver-schwinden der eigenen Luftwaffe auch ein schwere moralische Bela-stung der Bodentruppen dar, die sich bisher auf ihre fliegenden Kame-raden verlassen konnten.
Das Ende naht
Mit dem Einsatz der Strela verlor die FAP die Luftvorherrschaft und letztendlich auch den Krieg. Dies wurde allerdings nicht sofort offen-sichtlich, denn zunächst versuchte die portugiesische Luftwaffe der neuen Gefahr Herr zu werden. Die vorliegenden Informationen deu-ten darauf hin, dass die Strela nur von hinten auf Flugzeuge abgefeu-ert werden konnte und dann auch nur auf solche Ziele, deren Flug-höhe zwischen 300 und 2400 Metern lag. Gewöhnlich trugen zwei Mann Abschussrohr und Raketen, während 15 andere Kämpfer eine Art Eskorte bildeten, um den Verlust des Systems auszuschließen.
Bereits im Frühjahr 1973 hatten die portugiesischen Piloten ihre Taktik verändert. Angesagt waren jetzt Tiefstflüge in hoher Geschwin-digkeit. Gleichzeitig kümmerte sich die OGMA darum, alle Maschinen mit einem olivgrünen Anstrich zu versehen, um die Wärmeabstrah-lung zu dämmen. Diese Gegenmaßnahmen erwies sich als nützlich, denn im letzten Kriegsjahr fiel nur eine Fiat einer Strela zum Opfer, obwohl wieder vermehrt geflogen wurde.
Eine der Operationen, bei der die Fiat erneut geschlos-sen zum Zuge kamen, wurde am 19. Mai 1973 im Gebiet zwi-schen Guidaje, Guleje und Gadamle entlang der Grenze zu Gui-nea ausgelöst. Zwar hatte die PAIGC einige Trupps mit Strela-Raketen bereitgestellt, vermochte es aber nicht, auch nur ein portugiesisches Flugzeug zu beschädigen. Erst als die Kämp-fe im Spätsommer an Heftigkeit zunahmen, ging am 1. Sep-tember 1973 die Fiat mit der Bordnummer 5416 durch Treffer einer ZPU verloren. Am 4. Oktober wurde die 5409 unter nicht bekannten Umständen abgeschossen. Zuletzt wurde im Janu-ar 1974 die von Leutnant Castro Gil geflogene G.91R-4 von einer Strela getroffen. Gil rettete sich mit seinem Schleudersitz, lande-te aber tief innerhalb einer von der PAIG gehaltenen Zone. Der Rest ist filmreif: Gil kaufte von einem Einheimischen ein Fahrrad und radelte ungeschoren bis zu den eigenen Stellungen. Sei-ne Maschine war die letzte »Gina«, die während dieses Kriegs verloren ging. Noch im gleichen Monat einigten sich die portu-giesische Regierung und die PAIGC, Guinea-Bissau in die Unab-hängigkeit zu entlassen. Am 24. September 1973 wurde diese
proklamiert. Den Staat Guinea-Bissau erkannte Portugal am 10. September 1974 offiziell an.
Alle Flugzeuge der FAP wurden zurück nach Portugal gebracht. Die Fiat der Esquadra 121 hatten es in diesem Krieg auf über 14 000 Flugstunden gebracht.
Jaguare in Mosambik
Im Gegensatz zu Portugiesisch-Guinea entwickelte sich der bewaff-nete Konflikt im Mosambik behäbig. Nicht nur, weil die Portugiesen wenige Truppen im Land hatten, sondern vor allem, weil die Auf-
Das seit 1569 einem General-
kapitän unter der Oberhoheit
Goas unterstellte Mosambik wurde 1609 zur Kolonie
unter Goa und 1752 zur Kolonie
unter direkter Herrschaft Portu-gals. 1971 wurde
es in den Rang eines Staates
(estado) erhoben. Mit einer Fläche von 801 590 km²
nimmt Mosambik den Weltrang
34 ein. Auf dem Staatsgebiet existieren 78
Ethnien und über 40 Sprachen, vor
allem Bantu-Sprachen.
Hier wird gerade die Tragfläche einer Fiat G.91
in eine Nord No-ratlas verladen.
Auf diese Art und Weise wurden die
»Ginas« in den 1960er-Jahren überwiegend
zwischen Afrika und Portugal
verlegt.
19»Ginas« über Afrika konflikte
ständischen längere Zeit benötigten, um sich für einen Guerilla-Krieg zu organisieren. Trotzdem befanden sich 1963 bereits 16 000 portugiesische Soldaten im Land und wurden durch T-6G und C-47 unterstützt. Nach dem Ausbau der Flugplätze in Nampula und Vila Cabral überführte die FAP weitere T-6G sowie acht Lockheed PV2 Harpoon und etwa ein Dutzend Dornier Do 27 nach Mosambik. Auch danach kam es bis 1966 zu keinen ernsthaften bewaffneten Ausei-nandersetzungen. Erst ab diesem Zeitpunkt hielt sich die FRELIMO für stark genug, um in die Provinz Tete einzudringen und den strategisch wichtigen Staudamm Cabora Bassa zu bedrohen.
Die ersten acht Fiat G.91R-4 der FAP mit den Bordnummern 5404, 5410, 5412, 5414, 5418, 5424, 5428 und 5431 trafen Ende 1968 auf dem Seeweg in Beira ein. Alle Jets wurden bis zum 31. Dezember aufmon-tiert und der neu aufgestellten Esquadra de Caca 502 »Os Jaguares«
(Jaguare) übergeben, welche auf AB.5 in Nacala stationiert und von Hauptmann Fernandes kommandiert wurde. Zusammen mit Ein-heiten, welche T-6G und Do 27 flogen, formierte Fernandez die Gru-po Operational 5001. Diese Einheit war für ein riesiges Gebiet verant-wortlich, was den Ausbau weiterer kleiner Behelfsplätze in Mueda, Porto Amélia, Nova Freixo und Vila Cabral erforderlich machte. Zwar waren Hauptmann Fernandes’ Piloten dadurch schon binnen weni-ger Tage nach ihrer Ankunft in Mosambik einsatzbereit, konnten aber angesichts der Sandpisten keine Abwurfbewaffnung mitführen. Von Angriffen auf die durch ZPU-1 und ZPU-4 verteidigten Stützpunkte der FRELIMO musste daher zunächst abgesehen werden.
Die Ankunft der ersten Fiat in Mosambik fiel mit der Ernennung des neuen Militärgouverneurs Kaulza de Arriaga zusammen. De Arri-aga – bald bekannt als »Rosa Panther« – erwies sich als unerbittlicher Vertreter portugiesischer Kolonialinteressen und veranlasste rasch
ausgedehnte Operationen gegen die FRELIMO. Allein 15 000 Solda-ten wurden zur Verteidigung des Cabora-Bassa-Staudamms abge-stellt, während Luftwaffe und Elite-Einheiten die Jagd auf Aufstän-dische eröffneten.
»Fiat Abarth«
Die erste Großoffensive trug den Namen »Nó Górdio« (Gordischer Knoten) und begann am 10. Juni 1970 im Norden von Mosambik. Da diese Operation mehrere Monate andauern sollte und außerhalb der Reichweite der in Nacala stationierten Flugzeuge verlief, entschied sich die FAP zur Verstärkung ihrer Ressourcen. Weitere acht G.91R-4 (Bordnummern 5421, 5423, 5426, 5429, 5435, 5436, 5438 und 5439) bildeten fortan auf dem Stützpunkt AB.7 in Tete unter Hauptmann
Die ersten drei G.91R-4 bei ihrer Ankunft in Mosambik. Die Aufnahme entstand auf dem Flugplatz Gago Coutinho in Lourenço Marques. Alle drei Jets dienten anschließend bei der Esquadra 502 »Jaguares«.
Die Fiat mit der Bordnummer 5403 gehörte zur Esquadra 502, als sie Ende der 1960er-Jahre in Nacala an einer Flugschau teilnahm. Die FAP rochierte ihre »Ginas« regel-mäßig zwischen Portugal und Afrika, um die Instandhaltung zu sichern.
Ebenfalls Ende der 1960er-Jahre auf der Basis Lourenço Marques entstand das Foto der ´5404 .́ Das Staffelwap-pen der Esquadra 502 befindet sich unterhalb der Windschutz-scheibe.
»Ginas« über Afrika konflikte20
Azabuja die neu aufgestellte Esquadra 702, welche wiederum der Grupo Operational 7001 unterstellt wurde. Dort befanden sich auch mehrere mit T-6G und Do 27 ausgerüstete Staffeln. Die gesamte Gruppe war für den Westen und Norden Mosambiks zuständig.
Zum fliegenden Personal der Esquadra 702gehörte auch der ehemalige T-6G-Pilot Hauptmann João Vidal. Als ein großer Liebha-ber von Sportwagen schlug er »Fiat Abarth« als Einheitsname vor. Dem wurde zwar nicht entsprochen, doch zumindest übernahm die Esquadra 702 einen Teil des Abarth-Markenlogos und wurde auf die-se Weise zu »Os Escorpiones« (Skorpione). Die Gemeinsamkeiten zwi-schen den G.91 und Fiat-Autos endeten damit aber noch nicht. Da
es immer wieder Schwierigkeiten mit der Beschaffung von Ersatztei-len aus Italien gab und Mosambik das vom Mutterland entfernteste Einsatzgebiet war, mussten die beiden Fiat-Einheiten immer wieder lange auf Nachschub warten. Vor allem der Mangel an Bremsschei-ben bereitete große Probleme und zwang die Piloten zu möglichst behutsamen Landungen. Als dann aber ein Mechaniker der Esqua-dra 702 herausfand, dass die Bremsscheiben der G.91R-4 mit den des PKW Fiat 125 identisch waren, war das Problem behoben. Ab sofort waren die Bremsscheiben nicht nur schneller, sondern auch deutlich billiger zu bekommen, allerdings nicht auf den offiziellen Bezugswegen!
Drei Fiat der Esquadra 702 in
Tete (1971)OGMA Matos
Die ´5423´ wäh-rend der Wartung
in Tete. Das Staffelwappen
der Esquadra 702 auf dem Rumpf
wurde vom Logo des Sportwagens
Fiat Abarth abgeleitet.
Eine Alouette III (Bordnummer
8386) beim Absetzten
portugiesischer »Commandos Africanos« in
Zentralmosam-bik, Ende der 1960er-Jahre
Venter
»Gina und Alo« – eine
Fiat G.91R-4 der Esquadra 502 und
eine Alouette III in Beira, Anfang
der 1970er-Jahre. Die aus mit
sandbefüllten Blechtonnen
gebauten Shelter bewährten sich, als die FRELIMO
am 20. Januar 1974 AB.10 mit
»Katjuschas« beschoss.
Venter.
21»Ginas« über Afrika konflikte
Das Auftauchen der sowjetischen Strela (SA-7) in Portugiesisch-Guinea und Mosambik erforderte einen neuen Sicht-schutzanstrich bei fast allen portugiesischen Flugzeugen. Dieser sah nur eine Farbe vor: ein »infrarot-dämmendes« Olivgrün. Die Hoheitszeichen wurden auf einen Durchmesser von 20 cm verkleinert oder entfielen ganz. Zusatztanks blieben ungetarnt.
Fiat G.91R-4 der Esquadra 702 »Os Scorpiones« auf AB.7 in Tete (Mosambik) im Jahr 1970. Meh-rere Flugzeuge dieser Staffel trugen das große Abarth-Symbol, einen schwarzen Skorpion, auf dem hinterem Rumpf. Die Maschine wurde in dieser Bemalung Anfang 1970 auch in Beira gesichtet.
Fiat G.91R-4 der Esquadra 502 «Jaguares” auf AB.5 in Nacala (Mosambik) im Jahr 1973. Zu sehen sind das Staffelwappen, die Art, wie die letzten zwei Ziffern der Bord-nummer auf den Bremsklappen aufgetragen wurden sowie einige Abwurf-waffen. Von links: Bombe M-117, 100-kg-Bombe, 50-kg-Bombe, Napalmbehälter.
»Ginas« über Afrika konflikte22
Der »Gordische Knoten«
Im Verlauf der Operation »Nó Górdio« flogen die Fiat der Esquadra 702 zunächst vor allem Aufklärungseinsätze und setzten dabei erstmals den Pod K-20 ein, welcher nicht nur das Erstellen präziser Landkar-ten von Mosambik ermöglichte, sondern auch einen Blick über die Landesgrenze möglich machte. Mehrere auf diese Weise entdeckte FRELIMO-Stützpunkte wurden anschließend mit Napalm-Bomben angegriffen. Dennoch hielt sich das Verständnis von General de Arriaga – so wie die meisten portugiesischen Offiziere jener Zeit – in Sachen Guerillakrieg in engen Grenzen. Er analysierte nicht das bis-herige Geschehen und kümmerte sich auch nicht um die Ausstattung seiner Truppen mit besserem Funkgerät. Die Folge war auch weiterhin eine miserable Kommunikation zwischen Luftwaffe und Armee, was wiederum dazu führte, dass die Fiat so gut wie keine Nahunterstüt-zungs- und Nachteinsätze flogen. Der »Gordische Knoten« blieb folgerichtig ein halbherziges Alibiunternehmen und die FRELIMO weiterhin in der Provinz Tete.
Die 16 G.91 flogen ungeachtet dessen immer mehr Kampfeinsät-ze. Neben den Stützpunkten Nacala und Tete wurde häufig auch die Basis Nampula benutzt, obwohl bei solch kleinen Plätzen die Gefahr feindlicher Angriffe besonders groß war. Eine solche Attacke ereig-nete sich am 18. September 1972, als Mueda von 122-mm-Raketen-
werfern unter Beschuss genommen wurde. Die Portugiesen waren aber gewarnt und hatten ihre Flugzeuge rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Am folgenden Morgen startete die FAP einen Gegenangriff mit Alouette III. Einer der Hubschrauber wurde dabei durch starkes Bodenfeuer abgedrängt und ihre Besatzung bat um Unterstützung. Als zwei T-6G eingriffen, wurde die von Sergeant Vilela geflogene Maschine getroffen und stürzte ab. Daraufhin schickten die Portu-giesen zwei Fiat zu Hilfe. Trotz schwerer Verluste konnten die FRELI-MO-Kämpfer anschließend alle ihre schweren Waffen aus dem Kampf-gebiet evakuieren.
Anfang 1973 bekam auch die FRELIMO ihre ersten Strela-Rake-ten. Gemeldet wurde deren Einsatz von den beiden portugiesischen Piloten Major Costa Joaquim und Leutnant Macario, die den Lenkkör-pern relativ leicht ausweichen konnten. Später stellte sich heraus, dass es sich dabei um die verbesserte Version Strela-2M handelte, die weni-ger Rauch emittierte und somit für die Angegriffenen schwerer auszu-machen war. Entsprechend höher war die Trefferquote. Trotzdem gab es keinen Totalverlust. Auch die Fiat blieben von Beschussschä-den weitgehend verschont. Lediglich die von Leutnant Emilio Lou-renço geflogen ´5429´ ging durch vorzeitige Detonation ihrer Bom-
Angola (Portugie-sisch-Westafrika)
wurde 1575 zur Kolonie
erklärt, 1589 zur Kronkolonie
erhoben und 1971 zum Staat (es-
tado) innerhalb Portugals erklärt. Die Fläche beträgt
1 246 700 km². Die Bevölkerung setzt sich mehr-heitlich aus drei Bantu-Gruppen zusammen, von denen jede ihre eigene Sprache
spricht. Am 10. November
1975 verließen die letzten
portugiesischen Soldaten und
Funktionäre das Land.
Diese beiden Auf-nahmen zeigen
zwei Fiat G.91R-4 der Esquadra 702
Anfang 1975 im Tiefflug über dem
Flugplatz von Luanda.via Matos
23»Ginas« über Afrika konflikte
ben bei einem Angriff auf FRELIMO-Stellungen am 15. März 1973 samt Piloten verloren.
Ein gutes Jahr später, am 20. Januar 1974, unternahm die FRELIMO ihren spektakulärsten Angriff auf einen Stützpunkt der FAP in Mosam-bik. Dabei wurde die AB.10 Beira tief in der Nacht mit ungelenkten Raketen beschossen, wobei der Treibstofftank getroffen wurde. Die Portugiesen warteten bis zum Morgengrauen. Um 07:00 Uhr star-teten die G.91 Nr. 5412 und eine Alouette zum Gegenangriff. Von der Hubschrauberbesatzung geführt, flog die Fiat wiederholte Angriffe und machte mehrere Raketenwerfer unbrauchbar. Trotzdem hörte der Beschuss erst drei Stunden später auf. Zwar räumte die FAP kei-ne Flugzeugverluste ein, doch wurden anschließend drei zusätzliche Fiat per Boeing 707 nach Beira eingeflogen.
Am 8. September 1974 wurden die Kämpfe eingestellt, worauf-hin fast alle portugiesischen Siedler das Land verließen, Tausende von ihnen an Bord von Flugzeugen der portugiesischen Luftwaffe. Die verbliebenen Fiat der Esquadra 702 wurden nach Angola ausge-flogen, während die Maschinen der Esquadra 502 direkt nach Portu-gal verschifft wurden.
Der kurze Krieg in Angola
Auch der Krieg in Angola entwickelte sich anfangs recht langsam, was vor allem der MPLA die Möglichkeit zur Aufrüstung verschaffte. Obwohl offiziell unter der Kontrolle der noch 1956 eingerichteten FAP-Region 2, kam die portugiesische Luftwaffe vor 1960 – als der Aufstand im Norden aufbrach – in Angola praktisch nicht vor. Auch danach standen lediglich zwei Lockheed P2-V Harpoon der Esquadra 91, sieben Lock-heed P2V-5 Neptune sowie mehrere C-47 zur Verfügung, um die Sicher-heitskräfte in den ersten Wochen und Monaten zu unterstützen. Da der Flugplatz von Luanda noch im Aufbau war, operierte die FAP zunächst vom Flugplatz der zivilen Gesellschaft Direcção dos Transportes Aéros (DTA) in der Nähe der Hauptstadt. Erst im Juli 1961 konnten die ersten F-84G der Esquadra 21 in Luanda stationiert werden.
Zu ernsthaften Kampfhandlungen kam es erst ab 1965, als das benachbarte Sambia unabhängig wurde und den Aufständischen Stützpunkte jenseits der Grenze anbot. Von diesem Zeitpunkt an bekam die Guerilla immer mehr Hilfe aus dem Ausland, wobei die FNLA von den USA, die MPLA von der Sowjetunion und die neu ent-standene União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA) von der Volksrepublik China unterstützt wurden. Ende der 1960er-Jahre startete die portugiesische Regierung eine Kampagne der »Herzen und Sympathien« und ließ eine Anzahl Schulen, Kran-
Eine Do 27 der portugiesischen Luftwaffe in Angola. Einige der leichten Transport- und Verbindungsflug-zeuge wurden mit weitreichenden Funksystemen ausgerüstet und dienten während der Kampf-handlungen als fliegende Relaisstation.Venter
Als General António Maria da Cardoso zum Hochemissär für Angola bestellt wurde, para-dierten fünf G.91 in V-Formation über Luanda.via Matos
Im Tiefflug über Angola: eine Fiat über einer Sand-piste in Ambrizete in der Nähe des Flugplatzes Cabindavia Matos
»Ginas« über Afrika konflikte24
Die mit infra-rotdämmenden
Sichtschutz versehen ´5410´
trug den Anstrich noch 1978, als sie in Montijo aufge-nommen wurde.
Beachtenswert sind die deutlich
verkleinerten Kennzeichen.
Guhl via Matos
Anfang der 1970er-Jahre
entstand diese Aufnahme der
G.91 mit der Bordnummer
5430 während eines Zwischen-
stopps in Luanda. Sie trägt noch
das Wappen der aufgelösten
Esquadra 502. Im Hintergrund ist
eine A-26 Invader zu erkennen. Die Invader dienten
nie außerhalb Angolas.
Zwei G.91R-4 der Esquadra 51
»Falcões«, welche zur Umschulung
in Monte Real verwendet
wurden.OGMA via Matos
25»Ginas« über Afrika konflikte
Die »Nelkenrevolution«
»Revolução dos Cravos« bezeichnet den Aufstand
der Armee in Portugal am 25. April 1974 gegen die
herrschende Diktatur. Die Revolte verlief beina-
he unblutig – es gab nur vier Tote –, eröffnete den
Weg zur demokratischen dritten Republik und mar-
kiert den Anfang vom Ende des ursprünglichen
Nachkriegseuropas.
In Portugal kam 1926 eine Militärjunta unter General
Carmona durch einen Putsch an die Macht. Portugal
verbündete sich im Zweiten Weltkrieg mit Spanien
zum Bloco Ibérico. Die Diktatur blieb aber von den
Alliierten unangetastet und bestand fort. 1949
wurde Portugal Gründungsmitglied der NATO.
1968 wurde Salazar von Marcello Caetano abge-
löst. Am Charakter der Diktatur änderte dies nur
wenig. Das Unvermögen Caetanos wurde auch
in der Außenpolitik sichtbar: Portugal, die älteste
Kolonialmacht Europas, besaß mit Angola, Mosambik und Guinea-Bissau
in Afrika noch größere Territorien als England und Frankreich, die ihre
Besitzungen dort schon längst in die Unabhängigkeit entlassen hatten.
Im Februar 1974 veröffentlichte General António de Spínola sein Buch
»Portugal e o Futuro« (Portugal und die Zukunft), das besonders in mi-
litärischen Kreisen Furore machte. Spínola analysierte darin Portugals
»systemimmanente Diskrepanz« gegenüber den anderen westeuropä-
ischen Staaten, die es in die wirtschaftliche und politische Isolation ge-
bracht hätte. Die Zukunft Portugals hänge vor allem vom Ausgang des
Kolonialkriegs ab, der zu viele Menschenleben kostete und bis zu 50
Prozent des Staatshaushaltes verschlang, militärisch aber nicht zu ge-
winnen sei. Spínola schlug eine »neue nationale Strategie« vor, in der
die Teilnahme des Volkes am politischen Willensbildungprozess und das
Recht der Kolonien auf Selbstbestimmung gewährleistet sein sollte.
Für die »Bewegung der Streitkräfte« (Movimento das Forças Armadas,
MFA) war dieses Buch das Signal zum Aufbruch.
Am 24. April 1974 um 22:50 Uhr spielte der portugiesische Rundfunk das
Liebeslied »E depois do adeus« (Nach dem Abschied). Dies war das ver-
schlüsselte Signal an die aufständischen Truppen. Knapp 18 Stunden
später hatte die »Bewegung der Streitkräfte« Europas älteste Diktatur ge-
stürzt. Die Mehrheit der Regierungstruppen lief zu den Aufständischen
über. Die ersten roten Nelken, die der Revolution den Namen geben
sollten, tauchten auf, leuchteten an den Uniformen der Soldaten und
aus ihren Gewehrläufen. Caetano flüchtete sich hinter die Mauern der
Kaserne der Guarda Nacional Republicana (GNR). Die Belagerung dau-
erte bis zum Abend, bis der Diktator sich bereit erklärte, die Regierung
General Spínola zu übergeben. Dies war nicht der Wunschkandidat der
Aufständischen und die zornige Bevölkerung forderte die vollständige
Erhebung. Der unblutigen Übergabe wegen akzeptierten die MFA-
Führer um Otelo Saraiva de Carvalho aber dieses Angebot.
»Sofortiges Ende des Kolonialkrieges – Generalamnestie für Deserteure
und Kriegsdienstverweigerer« lauteten die Kundgebungsparolen, die für
rund 100 000 Fahnenflüchtige und Kriegsdienstverweigerer sprachen.
Das Amnestiegesetz wurde am 1. Mai 1974 erlassen, das Ende des Kriegs
ließ noch auf sich warten, doch erste Schritte waren eingeleitet. Die por-
tugiesischen Provinzen Mosambik und Angola wurden am 25. Juni bzw.
11. November 1975 unabhängig.
Im Gegensatz zu Militärputschen in anderen Ländern hatte der Aufstand
der portugiesischen Offiziere durch die Unterstützung der Bevölkerung
eine Legitimation erhalten.
Die wichtigsten Waffenkonfigura-tionen der von der portugiesischen Luftwaffe in Afri-ka eingesetzten Fiat G.91R-4 Matos
kenhäuser und Straßen bauen. Gleichzeitig wurde ein Großteil der ansässigen Bevölkerung in etwa 150 »strategische Dörfer« umgesie-delt, um den Kontakt zu Aufständischen zu verhindern. Am 10. Juni 1970 startete die portugiesische Armee schließlich eine Großoffen-sive und drängte die MPLA und die FNLA aus dem Lande. Lediglich kleine isolierte Teile im Südosten Angolas blieben unter Kontrolle der UNITA. Der Aufstand gegen die Portugiesen war damit zwar nicht
beendet, doch der Krieg beschränkte sich nur noch auf eine Fläche von zehn Prozent des Landes.
Trotz gegenteiliger Vermutungen setzte die FAP zu dieser Zeit noch keine G.91 in Angola ein. Dazu kam es erst während der letz-ten Phase der portugiesischen Herrschaft. Nach der »Nelkenrevolu-tion« im April 1974 bemühte sich die neue Regierung um Verhand-lungen mit den Aufständischen, um Angola in die Unabhängigkeit
a b c
a 4 MG Colt-Browning M3 (12,7 mm), 4 Boden-Luft-Raketen LAU-32/A
b 4 MG Colt-Browning M3 (12,7 mm), 2 Sprengbomben a 200 kg, 4 Sprengbomben a 50 kg
c 4 MG Colt-Browning M3 (12,7 mm), 2 Napalmbehälter a 200 l
»Ginas« über Afrika konflikte26
zu entlassen. Obwohl kein Vertrag zustande kam, erklärten die Por-tugiesen ihre Bereitschaft, dass Land zu verlassen. Dies brachte aber noch lange keinen Frieden, denn das dadurch entstandene Macht-vakuum führte zu einem brutalen Bürgerkrieg, der noch bis 2003 andauern sollte, und in dem sich die einst verbündeten Rebellen-organisationen gegenüber standen. Tatsächlich war es ein Stellver-treterkrieg der Großmächte, aber das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte.
Mit dem Rückzug der portugiesischen Truppen und Siedler aus Mosambik wurde auch die Esquadra 702 nach Luanda verlegt, um anschließend aufgelöst zu werden. Ihre letzten acht G.91R-4 mit den Bordnummern 5415, 5421, 5426, 5430, 5432, 5433, 5436 und 5438 übernahm die Esquadra 93, die zuvor mit Douglas A-26 Inva-der ausgerüstet war.
Obwohl der Krieg offiziell beendet war, flogen die Fiat noch eini-ge Kampf- und Aufklärungseinsätze, vor allem zur Deckung jener Bodentruppen, welche mit der Evakuierung der Siedler beschäftigt waren. Im Januar 1975 wurde auch die Esquadra 93 aufgelöst. Im Bauch portugiesischer Noratlas kehrten anschließend sechs und an Bord von Boeing 707 die restlichen zwei Fiat nach Portugal zurück und wurden später der Esquadron 62 in Montijo unterstellt. Trotz anderslautender Meldungen blieb keine einzige Fiat G.91 in Afrika zurückgelassen.
In fast neun Jahre Afrikaeinsatz absolvierten die portugie-sischen Fiat G.91R-4 rund 20 000 Flugstunden. Dabei gingen acht Flugzeuge verloren, wobei zwei Piloten den Tod fanden. Obwohl ursprünglich nur als Notlösung beschafft, bewährte sich die »Gina« selbst unter schwierigsten Bedingungen als leistungsstarker tak-tischer Jagdbomber und taktischer Aufklärer und blieb noch bis 1993 bei der portugiesischen Luftwaffe im Einsatz.
Bord-nummer
Einheit Stütz- punkt
Bemerkungen
5401 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966
5402 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966
5403 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966; zurück in Afrika nach Überholung durch OGMA in April 1969
5404 Esquadra 121 Tigres, später Esquadra 502 Os Jaguares
BA.12, dann AB.5
in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966; in Mosambik ab Dezember 1968
5405 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966
5406 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966
5407 Esquadra 121 Tigres BA.12 in BA.12 ab 1967; abgeschrieben durch vorzeitige Bombendetonation, Februar 1967; Pilot OK
5409 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab 1969; abge-schrieben unter unbekannten Umstän-den am 4. Oktober 1973; Pilot OK
5410 Esquadra 502 Os Jaguares
in Mosambik ab Dezember 1968
5411 Esquadra 121 Tigres BA.12 1967 durch ZPU-1 abgeschossen; Pilot Oberstleutnant Costa Gomes OK
5412 Esquadra 502 Os Jaguares
AB.5 in Mosambik ab Dezember 1968
5413 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Afrika ab 1969; abgeschossen durch SA-7 am 25. März 1973; Pilot Leutnant Cardoso Pessoa verletzt
5414 Esquadra 502 Os Jaguares
in Mosambik ab Dezember 1968
5415 Esquadra 121 Tigres, später Esquadra 702 Os Escorpiones und Esquadra 93
BA.12, dann AB.7, dann BA.9
in Portugiesisch-Guinea ab April 1969; in Mosambik in 1974, dann nach Angola in 1975
5416 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea spätestens ab 1973; abgeschossen durch ZPUs am 1. September 1973; Pilot OK
5417 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966
5418 Esquadra 121 Tigres, später Esquadra 502 Os Jaguares
BA.12, dann AB.5
in Portugiesisch-Guinea ab Juli 1966; in Mosambik ab Dezember 1968; wieder in Guinea in April 1969
5419 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab 1969; abge-schossen durch SA-7 am 28. März 1973; Pilot Oberleutnant José Brito tot
5421 Esquadra 702 Os Escorpiones, später Esquadra 93
AB.7, dann BA.9
in Mosambik ab 1970; in Angola ab 1975
5423 Esquadra 702 Os Escorpiones
AB.7 in Mosambik spätestens ab 1970
5424 Esquadra 502 Os Jaguares
AB.5 in Mosambik ab Dezember 1968
5426 Esquadra 702 Os Escorpiones, später Esquadra 93
AB.7, dann BA.9
in Mosambik spätestens ab 1970; in An-gola ab 1975
5427 Esquadra 121 Tigres BA.12 in Portugiesisch-Guinea ab April 1969
5428 Esquadra 502 Os Jaguares
AB.5 in Mosambik ab Dezember 1968
5429 Esquadra 702 Os Escorpiones
AB.7 in Mosambik spätestens seit 1973; abgeschrieben durch vorzeitige Bom-bendetonation, am 15. März 1973; Pilot Leutnant Emilio Lourenço tot
5430 Esquadra 702 Os Escorpiones, später Esquadra 93
AB.7, dann BA.9
in Mosambik spätestens ab 1974; in An-gola ab 1975
5431 Esquadra 502 Os Jaguares
AB.5 in Mosambik ab Dezember 1968
5432 Esquadra 702 Os Escorpiones, später Esquadra 93
AB.7, dann BA.9
in Mosambik spätestens in 1974; in An-gola ab 1975
Fotos: AHFA via Matos, sofern nicht anders bezeichnet. Farbrisse und Karten: Tom Cooper.
Die Autoren möchten sich ausdrücklich beim Archiv der portugiesischen Luftwaffe (AHFA) für sei-ne freundliche Unterstützung bei der Fotorecherche bedanken. Andere benutzen Quellen sind die Zeit-schriften »Mais Alto« Nr. 264 (1990) und »AirFan« Nr. 5 (1979) sowie die Bücher »Guerra Colonial« (Aniceto Afonos & Carlos de Matos Gomes, 2000), »Fiat, 20 Anos na Forca Aérea Portuguese« (António Mimoso & Luis Tavares, 1985), und »Fiat G.91« (Richard J Caruana, 2004. —
General Diogo Neto,
Kommandeur der FAP-Region 3, mit der ´5402´ im Jahr
1972, vermutlich in Mosambik.
Beachtenswert ist die amerikanische
Bombe M-117 unterhalb des
linken inneren Waffenträgers
der »Gina« (rechte Bildseite).
via Matos
27»Ginas« über Afrika konflikte
Die nach dem Krieg gemachte Aufnahme der G.91R-4, Bordnummer 5433, belegt, dass einige Fiat trotz der Strela-Gefahr weiterhin ihren hellgrauen Anstrich trugen. Die von MG-Feuer herrührenden Schmauchspuren auf dem Vorder-rumpf wurden vom Bodenper-sonal meistens entfernt, vor allem unterhalb des Cockpits. OGMA via Matos
Diese ehemals belgische F-84G stand Anfang der 1960er-Jahre bei der in Luanda stationierten Esquadra 93 im Einsatz. Sie ging bei
einem Zwischenfall nahe Vale do Loga am 23. Juni 1962 verloren.
Abkürzungsverzeichnis
Name Kürzel ÜbersetzungAeródromo Basas AB temporäre LuftwaffenbasisAeródromo de Manobras AM vorgeschobene LuftwaffenbasisAeródromo de Transito AT TransitflugplatzBasas Aéreas BA ständige LuftwaffenbasisDirecção dos Transportes Aéros DTA (ziviles Luftfahrtunternehmen) Forca Aérea da Guiné-Bissau FAGB Luftwaffe von Guinea-BissauForca Aérea Portuguese FAP portugiesische LuftwaffeForce Aérienne de Guiné FAG guineische LuftwaffeFrente da Libertação de Moçambique FRELIMO Front zur Befreiung MosambiksFrente Nacional da Libertação de Angola FNLA Nationale Front zur Befreiung AngolasMovimento Popular de Libertação de Angola MPLA Volksbewegung zur Befreiung AngolasOficina Geral de Material Aeronáutico OGMA Allgemeine FlugzeugwerkstattOrganization of African Unity OAU Organisation für Afrikanische EinheitPartido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde PAIGC Afrikanische Partei für die Unabhängigkeit von Guinea und Kap VerdeUnião Nacional para a Independência Total de Angola UNITA Nationale Union für die völlige Unabhängigkeit AngolasUnioa das Populacoes de Angola UPA Volksbewegung für AngolaUnião dos Povos do Norte de Angola UPNA Volksbewegung für Nordangola