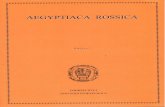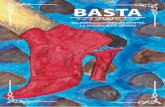Ein Zeugnis von Tell Basta für die interpretatio Aegyptiaca der Dioskuren, in: Göttinger...
Transcript of Ein Zeugnis von Tell Basta für die interpretatio Aegyptiaca der Dioskuren, in: Göttinger...
113GM 234 (2012)
Für Ulrike und Ela
Ein Zeugnis von Tell Basta für die interpretatio Aegyptiaca der Dioskuren*
Zu den selbstgestellten Pflichten des Tell Basta Project1 gehört nicht nur die Ergrabung der
bisher weitgehend unbekannten antiken Deltastadt Bubastos, sondern auch die Sichtung der
Ergebnisse früherer Untersuchungen. Letztere blieben nicht selten in Anfängen stecken und
hinterließen bruchstückhafte und ungenügende Dokumentationen2. Zu den Forschern, die sich
nach Edouard Naville am ernsthaftesten und nachhaltigsten mit dem Tell und seiner
Geschichte auseinandersetzten, gehört zweifellos Labib Habachi (1906-1984)3, dessen
Arbeiten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs erst Jahre später publiziert werden konnten4. In
der Veröffentlichung beschreibt Habachi unter anderem seine Ausgrabungen und deren
Ergebnisse im östlichen Vorfeld des Bastet-Tempels, also etwa an der Stelle, die sich das Tell
Basta Project zum Ausgangspunkt seiner aktuellen Arbeiten erkoren hat5. Zur Erwähnung
kommen der jüngst wieder freigelegte Plattenbelag und die Reste von Einbauten, die von
Habachi irrtümlich als Tempel des Agathos Daimon angesprochen werden. Bei der partiellen
Freiräumung des besagten Fußbodens entdeckte der Ägyptologe im Jahr 1944 mehrere, teils
auch von ihm abgebildete Objekte, die er kaiserzeitlich datieren konnte: “On clearing the
pavement we picked up many an object of the Graeco-Roman period, among them some coins
of the period and an ear-ring and amulet, both of gold. This last object bore the figures of two
persons perhaps saints with the inscription: 'Good Luck'.”6
Der erwähnte Ohrring ist vom sogenannten Barretta-Typus und kann deswegen sicher ins 2.
* Für ihre kritische Lektüre dieses Textes wie auch für zahlreiche Hinweise bin ich sehr verbunden: Alexandra von Lieven und Gertrud Platz (beide Berlin), Willy Clarysse (Leuven), Marius Gerhardt und Klaus Hallof (beide Berlin). Ohne die Teilnahme an der DAI-Winter School 2011 im Fayum unter Leitung von Cornelia Römer (Kairo) wären mir wichtige Zusammenhänge verborgen geblieben.
1 Das Tell Basta Project ist seit 2011 ein Gemeinschaftsprojekt der Georg-August-Universität Göttingen, des Supreme Council of Antiquities (SCA) und der Egypt Exploration Society (EES); Leitung: Eva R. Lange.
2 Die fragmentarische Publikationslage ist umso bemerkenswerter, als im letzten Jahrhundert kaum eine Dekade verging, in der nicht irgendwer irgendwo auf Tell Basta gegraben hätte. Jean Leclant und andere notierten solche Unternehmen regelmäßig seit 1963 in der Zeitschrift Orientalia in der Übersicht Fouilles et travaux etc.
3 J. Kamil, Labib Habachi. The Life and Legacy of an Egyptologist (2007), zur Grabung auf Tell Basta ebd. 77-82.
4 L. Habachi, Tell Basta. Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte 22 (1957).5 E. Lange, The EES Amelia Edwards Project Fund: Tell Basta, Egyptian Archaeology 39, 2011, 7-9.6 Habachi, Tell Basta (Fn. 4) 93f. – Ich danke den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Registratur des
Ägyptischen Museums Kairo für die Gelegenheit zur Prüfung der Einträge in den Inventaren. Das Amulett hat die Nummer JE86987, der Ohrring die Nummer JE86988. Eine Autopsie war noch nicht möglich.
GöMi234.indd 113 31.07.12 16:06
114 GM 234 (2012)
oder 3. Jh. n. Chr. datiert werden. Zum Vergleich bieten sich sehr ähnliche Ohrringe auf
hochkaiserzeitlichen Mumienporträts an7. Römisch wird auch eine kleine bronzene Applike
von 6,0 cm Höhe sein, die Habachi ebenfalls in besagter Gegend entdeckte und die eine
geographische Personifikation mit einer Elephantenexuvie darstellt (Africa, Alexandria?)8.
Von besonderem ikonographischen Interesse ist das merkwürdige Amulett mit den zwei
Figuren und der Inschrift, für das die sich abzeichnende Datierung der anderen Funde noch zu
überprüfen wäre. Ohne Autopsie sind Aussagen über die technische Beschaffenheit dieses
Amuletts nur schwer zu treffen (Abb. 1). Mit Sicherheit aber handelt es sich um ein Stück
Goldblech, in welches das figürliche Relief und die Inschrift von hinten hineingetrieben
wurden9. Laut Journal d'Entrée im Kairiner Museum mißt diese hochrechteckige lamella etwa
4,0 mal 5,0 cm10, der obere Rand ist annähernd halbrund beschnitten. Auf dem bei Habachi
veröffentlichten und hier abgedruckten Foto kann an der Rückseite eine aufgelötete Öse
erkannt werden. Das Stück ist nicht unbeschädigt, sondern in der Mitte leicht geknickt und
verbeult. Der rechte Rand ist fragmentiert und eingerissen, die Substanz der figürlichen
Darstellung bleibt davon weitgehend unbeeinträchtigt. Allerdings reicht das Blech auf beiden
Seiten nicht aus, das Relief vollkommen zu erfassen.
Dargestellt sind zwei stehende unbärtige und offenbar in soldatische Tracht gekleidete
männliche Figuren. Bei beiden sind die Oberschenkel von einem Schurz aus einzelnen
Streifen oder Laschen bedeckt, deren unterer Saum nicht gerade, sondern diagonal verläuft.
Die Oberkörper müßten konsequenterweise von Muskelpanzern bedeckt sein, die aber nicht
konkret auszumachen sind. Das jeweils innere Bein ist entlastet. Die äußeren Arme halten
stab- oder stangenartige Gegenstände, wahrscheinlich Lanzen. Die linke Figur hält den
Oberarm gesenkt und parallel zur Flanke, damit den Schaft mittig fassend; die rechte aber
hebt ihren Arm an und greift den Schaft im oberen Drittel11. In mittlerer Höhe ist dieser
7 B. Borg, Mumienporträts. Chronologie und kultureller Kontext (1996) 170f.; dies., „Der zierlichste Anblick der Welt...“ Ägyptische Porträtmumien (1998) 50f., Abb. 63; G. Platz-Horster, Römischer Schmuck bei Mumienporträts aus Ägypten, in: Augenblicke. Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit. Ausstellungskatalog Frankfurt, hrsgg. v. K. Parlasca – H. Seemann (1999) 89ff., 197, Kat.-Nr. 103.
8 Äg. Mus. Kairo, JE86986 – Habachi, Tell Basta (Fn. 4) 93, Taf. 25a, c. – Ich danke Frau Florentine Dietrich, Berlin, für die Einsicht in ihre noch unpublizierte Magisterarbeit mit einer umfänglichen Zusammenstellung von vergleichbaren Objekten: F. Dietrich, Herrscher und Gott. Zwei kleinplastische Werke des Hellenismus aus Ägypten. Magisterarbeit Humboldt-Universität zu Berlin (2003).
9 Nach einer Vermutung von Frau Gertrud Platz könnte das Blech über einem Model gepreßt worden sein, was auf eine Serienproduktion schließen ließe. Allerdings wäre zur Bestätigung dieser These die Autopsie abzuwarten.
10 Das Inventar gibt zusätzlich das Gewicht mit 3,2486 Gramm an. Einen besonderen Feingehalt des Goldes (spezif. Gewicht 19,32g/cm3) vorausgesetzt, folgert daraus eine Wandungsdicke von ca 0,08 cm.
11 Von unterschiedlicher Seite wurde mir vorgeschlagen, im Utensil der rechten Figur ein sogenanntes was-
GöMi234.indd 114 31.07.12 16:06
115GM 234 (2012)
merkwürdig gebrochen und reicht einerseits in einem Bogen bis zur Schulter hinauf, beginnt
aber parallel dazu erneut. Dies erklärt sich wahrscheinlich aus einem zweimaligen Ansetzen
bei der Prägung des Reliefs. Beide Figuren senken den jeweils anderen Arm und halten
gleichartige Kränze mit abstehenden Bändern. Identisch ist auch der Kopfschmuck aus einem
runden, scheibenartigen Element. Haare sind nicht erkennbar, jedoch stehen links und rechts
der Schläfen in beiden Fällen ringförmige Elemente zur Seite ab, bei denen es sich eigentlich
nur um Hörner handeln kann. Zwischen diesen beschriebenen Gestalten sind zwei kleinere
(Tier?-)Figuren mit menschlichen Gesichtern zu erkennen, deren Identifikation aufgrund der
schlechten Photographie zunächst Rätsel aufgibt. Erkennbar sind jedoch die Beine und der
verhältnismäßig kurze Rumpf sowie derselbe Kopfschmuck wie bei den größeren Figuren.
Die Inschrift, die Habachi nur in flüchtiger Übersetzung wiedergab, lautet: e)p' a)gaqw=i, es
folgt wenigstens ein zur Füllung des Raumes verwendetes Blatt (hedera). Die Formel ist eher
mit “für das Glück, zum Wohle, zum guten Ende (des NN / von NN)” zu übersetzen. Sie ist
bereits in klassischer Literatur geläufig12 und scheint als Teil von Steininschriften, vor allem
einfachen Weihungen, besonders in Ägypten verwendet worden zu sein. In römischer Zeit
konnte sie zudem auf Schmuckstücken eingetragen werden, um das gute Geschick der
Trägerin oder des Trägers zu beschwören13. Dieser Brauch wird auch im vorliegenden Fall zu
einer Datierung in die Kaiserzeit oder in die Spätantike führen; so ebenfalls das oben
geöffnete kursive Omega14.
Der Stil der figürlichen Darstellung steht in seltsamem Widerspruch zum kostbaren Material.
Der Handwerker hat von einem differenzierten räumlichen und organischen Aufbau
weitgehend abgesehen, beherrschend ist vielmehr ein eher zweidimensionales, skizzenhaftes
Darstellungsprinzip. Die anatomischen Elemente sind in die Fläche gebreitet, erkennbar an
den runden, flachen Gesichtern und an den in einfachen, ungelenken Bögen zu den Seiten
geführten Armen. Die Kennzeichnung des Spielbeins beschränkt sich auf ein leichtes
Szepter zu erkennen. Anlaß dieser (nicht befolgten) Deutung ist der Unterarm, der sich in Kopfhöhe diagonal vor den Schaft schiebt. Natürlich erschwert die Beschaffenheit des vorliegenden Stücks die Erkennbarkeit, aber das beschriebene Armhaltungsmotiv ist doch in der Antike zu häufig, um hier nicht zuerst in Frage zu kommen. Als prominentes Beispiel kann der hellenistische „Thermen-Herrscher“ im römischen Nationalmuseum dienen: N. Himmelmann, in: Herrscher und Athlet. Die Bronzen vom Quirinal. Ausstellungskatalog Bonn (1989) 126-149.
12 LSJ 4, s. v. a)gaqo/j, II 4 a)gaqo/n, to/.13 A. van den Hoek – D. Feissel – J. J. Herrmann, Lucky Wearers: A Ring in Boston and a Greek Epigraphic
Tradition of Late Roman and Byzantine Times, Journal of the Museum of Fine Arts, Boston 6, 1994, 41-62, bes. 44f.; 53 mit Liste.
14 B. H. McLean, An Introduction to Greek Epigraphy of the Hellenistic and Roman Periods from Alexander the Great down to the Reign of Constantine (323 B.C.-A.D. 337) (2002) 41.
GöMi234.indd 115 31.07.12 16:06
116 GM 234 (2012)
Vortreten des jeweiligen Knies, unterstrichen von der plastischen Angabe der Kniescheibe.
Davon abgesehen sind beide Beine parallel geführt, Rümpfe und vordere Extremitäten
reagieren nicht rhythmisch auf die unterschiedliche Belastung der Körperseiten. Der
diagonale Saum des Fransenschurzes ist ebenfalls ein Produkt dieser inkohärenten Reihung
der Elemente: Hier handelt es sich nicht etwa um ein Trachtenmotiv, sondern um die
(offenbar verständnislose) Nachbildung der sich auf der jeweiligen Spielbeinseite durch den
angewinkelten Oberschenkel ergebenden Hebung des Gewandes. Weitere Details, etwa des
Oberkörperreliefs, sind detailliert, aber unorganisch und disproportional ausgeführt: Die
beiden Großen Brustmuskel sitzen als klobige Segmente direkt und unvermittelt auf dem
vorgewölbten Abdomen, dessen Mitte von einem übergroßen Nabel markiert ist. Wie gesagt,
läßt sich nicht feststellen, ob es sich dabei um Brustpanzer oder Karnat handeln soll.
All diesen Schwächen zum Trotz wird deutlich, daß die Darstellung insgesamt in der
Tradition griechischer Kunst steht. Die achsensymmetrische Komposition ist nicht als
Merkmal des bescheidenen Stils zu erkennen, sondern als Zitat einer älteren ikonographischen
Vorstellung. Wie treu der Toreut trotz seiner begrenzten formalen Möglichkeiten diese
Vorlage vermittelte, ist etwa anhand des rudimentären, aber unmißverständlichen Kontrapost
wie auch an der Haltung der jeweils äußeren Arme zu begreifen: Letztere vollziehen bei
gleicher Funktion eine jeweils andere Bewegung. Wäre die Gleichartigkeit der Figuren allein
aus dem Unvermögen des Anonymus entstanden, so hätte er auf diese Variation doch
wahrscheinlich verzichtet. In der griechisch-römischen Kunst gibt es nun eigentlich nur ein
mythologisches Paar junger Männer, die in identischem Habitus und symmetrisch
zueinander15 entweder nackt oder gewappnet auftreten: Es muß sich bei den beiden Figuren
auf der lamella um die Dioskuren, um Kastor und Polydeukes handeln.
Auf die Mythologie der göttlichen Zwillinge mit ihren vielfältigen Sagensträngen ist an dieser
Stelle nicht ausführlich einzugehen16. Von besonderer Bedeutung sind sie als Beschirmer der
Seefahrt17. Der abwechselnde Aufenthalt der heroischen Brüder im Hades befähigt sie
15 Die Ähnlichkeit der beiden Götter sowie ihre sonstige Erscheinung ironisiert Lukian und liefert damit gleichsam die notwendigen Grunddaten zu den Dioskuren: dial. deorum 26.
16 W. H. Roscher (Hrsg.), Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie 1 (1884-1890) 1154-1177, s. v. Dioskuren (A. Furtwängler); RE 5 (1903) 1087 – 1123, s. v. Dioskuren (E. Bethe); DNP 3 (1997) 673-677, s. v. Dioskuroi (T. Scheer – A. Ley); H. Hunger, Lexikon der griechischen und römischen Mythologie 6(1974) 115-117.
17 So nutzten der Apostel Paulus und seine Gefährten für ihre Überfahrt von Malta nach Italien ein alexandrinisches Schiff, dessen para/shmon die Dioskuren darstellte: Apg. 28, 11. Dazu und zu anderen möglichen Nennungen der Brüder in der Bibel: Dictionary of Deities and Demons in the Bible, hrsgg. v. K.
GöMi234.indd 116 31.07.12 16:06
117GM 234 (2012)
ebenfalls als Helfer der Kranken und Verstorbenen18. Sie sind Garanten jedes glücklichen
Vorhabens, sind Schützer im Krieg, in sportlichem oder musischem Wettkampf. Auch im
vorliegenden Fall scheinen die beiden Kränze auf die Gewährleistung eines Sieges
hinzudeuten. Das Erscheinungsbild hat zudem Parallelen unter zahlreichen Darstellungen der
Dioskuren, die zwar seit der griechischen Archaik lieber in heroischer Nacktheit und allenfalls
mit einem Schultermantel, aber gerade in römischer Zeit auch gerne in militärischer Tracht
dargestellt werden19. Die für die Brüder typischen Piloi und die die Scheitel überragenden
Sterne sind auf dem Amulett von Tell Basta durch besagte Scheibensymbole ersetzt. Die
Pferde oder Pferdeprotome, welche die Zwillinge gewöhnlich begleiten, werden hier von den
zwei wunderlichen (Tier?-)Gestalten vertreten. Beide Substitute können weiter unten erklärt
werden.
Zunächst stellt sich die Frage, ob der Fundort des sonderbaren Amuletts bei dessen Erklärung
weiterhelfen kann; oder anders gesagt: ob das Amulett weniger zufällig nach Ägypten
verbracht als dort vielmehr unter Rückgriff auf ägyptische Vorstellungen produziert worden
sein könnte, die folglich in Erwägung zu ziehen wären. Drängender wird diese Frage nicht so
sehr aufgrund der Gattung des aus Edelmetall getriebenen Schmuckreliefs, die für sich
genommen keine besondere kulturelle Signifikanz besitzt, sondern durch den Umstand, daß
gerade für die vorliegende Kombination aus Bildfeld und Inschrift eine prägnante Parallele
vorliegt: In deutschem Privatbesitz befand sich vor kurzem ein Pektoral, dessen
Zusammenstellung original sein soll20. Neben länglichen Perlen aus Goldblech umfaßt das
Schmuckstück noch zwei getriebene Götterbüsten aus demselben Material sowie ein ebenfalls
getriebenes, dem Fundstück aus Tell Basta sehr ähnliches Goldtäfelchen (Abb. 2): Zu sehen
ist eine Dreiheit von zwei weiblichen Gottheiten, beide mit der charakteristischen Knotenpalla
van der Toom u. a. 2(1999) 258f., s. v. Dioskouroi (K. Dowden). Vgl. P. Oxy. 24, 2415, 22 (3. Jh. n. Chr.). Eine Liste der antiken Literaturstellen für Gleichsetzung der Dioskuren mit den Elmsfeuern in: M. Campagnolo, „Dioscures pour les grecs, Castor et Pollux pour les romains“, Genava. Revue d'Histoire de l'art et d'archéologie 51, 2003, 243-254, bes. 243f mit Fn. 3-4.
18 Antike Medizin. Ein Lexikon, hrsg. v. K.-H. Leven (2005) 227; J. Larson, Ancient Greek Cults. A Guide (2007) 189-192.
19 LIMC 3 (1986) 567-593, s. v. Dioscouroi (A. Hermary); LIMC 3 (1986) 593-597, s. v. Dioscouroi in peripheria orientali (C. Augé – P. Linant de Bellefonds); S. Geppert, Castor und Pollux. Untersuchung zu den Darstellungen der Dioskuren in der römischen Kaiserzeit. Charybdis 8 (1996) bes. 85-130. Siehe auch Beispiele in der Münzprägung: Y. Meshorer, City-Coins of Eretz-Israel and the Decapolis in the Roman Period (1985) 28, Nr. 51 (Askalon, Commodus); 61, Nr. 169 (Aelia Cap., Ant. Pius); D. Gricourt, Les Dioscures sur les monnaies romaines impériales, Dialogues d'histoire ancienne 20, 1994, 189-224; U. Kampmann – T. Ganschow, Die Münzen der römischen Münzstätte Alexandria (2008).
20 H. W. Müller – E. Thiem, Die Schätze der Pharaonen 4(2004) 46, 251, Nr. 77. Das Pektoral wurde vor kurzem in der Baseler Galerie Cahn angeboten: Auktion 4. Kunstwerke der Antike (2009) 158f., Nr. 305.
GöMi234.indd 117 31.07.12 16:06
118 GM 234 (2012)
der Isis bekleidet, die einen Harpokrates in langem Mantel flankieren. Unterhalb der
Standlinie dieser Triade findet sich erneut die – diesmal jedoch gepunzte – Inschrift e)p'
a)gaq=. Bezüglich der Interpretation dieses Täfelchens ist an die zahlreichen
Gruppendarstellungen zu erinnern, die das Horuskind von zwei weiblichen Gottheiten
gerahmt abbilden21. Um wen es sich im Falle der letzteren handeln mag – Isis und Nephthys,
Demeter und Kore o. ä. –, die ägyptische Deutbarkeit ist bei allen Beispielen gegeben. Die
Verwendung vergleichbarer Motive als amuletthafte Stuckauflage römischer
Mumienmasken22 klärt nicht nur über die Verwendungsweise, sondern auch über die
Datierung des Objekts auf, die im übrigen wiederum paläographisch gestützt werden kann.
Die technischen und formalen Übereinstimmungen dieses zweiten Goldtäfelchens mit dem
von Tell Basta sind nun aber so evident, daß derselbe kulturelle Hintergrund zu vermuten ist.
Zur Klärung des Sachverhalts ist folgend kursorisch auf die weitere Überlieferung zu den
Dioskuren in Ägypten einzugehen. Die letzte exklusive Arbeit zu diesem Thema ist vor fast
sechs Jahrzehnten erschienen23. Der vorliegende Beitrag kann weder alle damaligen Resultate
evaluieren noch die seitdem zugänglich gewordenen Quellen umfassend erörtern24. Im
Zentrum soll vielmehr die Frage stehen, ob und inwieweit die Dioskuren unter
Rahmenbedingungen geschätzt und verehrt wurden, die eher der ägyptischen als der
griechischen Mythologie und Religion zuzuordnen sind.
Im Vergleich zu anderen griechischen Gottheiten soll das göttliche Brüderpaar anfänglich
eine eher marginale Bedeutung in Ägypten besessen haben. Diese Einschätzung fußt jedoch
allein auf der Bemerkung Herodots, wonach die beiden am Nil unbekannt und nach Begriffen
21 Nur eine zufällige Auswahl: E. S. G. Robinson, A Gold Comb- or Pin-Head from Egypt, JHS 57, 1937, 79; G. Roeder, Ägyptische Bronzefiguren. Mitteilungen aus der Ägyptischen Sammlung 4 (1956) 492, §664g; 492, §664i, Taf. 66g; P. Pamminger, Ägyptische Kleinkunst aus der Sammlung Gustav Memminger (1990) 143, Nr. 100; LIMC 4 (1988) 441, Nr. 407, s. v. Harpokrates (V. Tran Tam Tinh u. a.); J.-C. Grenier, Bronzes du Museo Gregoriano Egizio (2002) 236, Nr. 418, Taf. 68; Charles Ede Limited Catalogue 178. Auktionskatalog (2007) Nr. 7 (ehem. Slg. Mustaki).
22 G. Grimm, Die römischen Mumienmasken aus Ägypten (1974) Taf. 14, Abb. 1-2 ; S. Walker – M. Bierbrier, Ancient Faces. Mummy Portraits from Roman Egypt. Catalogue of Roman Portraits in the British Museum 4 (1997) 80f., Nr. 58-59. Das Triadenmotiv findet sich auch auf einer Münze Alexandriens aus der Zeit Trajans: LIMC 4 (1988) 441, Nr. 406, s. v. Harpokrates (V. Tran Tam Tinh u. a.)
23 W. Fr. von Bissing, Il culto dei Dioscuri in Egitto, Aegyptus 33, 1953, 347-357; ders., Der Kult der Dioskuren im alten Ägypten. Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen Klasse der Bayerischen Akademie der Wissenschaften München 9 (1954) 7-9; vgl. davor L. Barry, Sur une lampe en terre cuite. Le culte des Tyndarides dans l'Égypte gréco-romaine, BIFAO 5, 1906, 165-181.
24 Vgl. G. Ronchi, Lexicon theonymon rerumque sacrarum et divinarum ad Aegyptum pertinentium quae in papyris ostracis titulis graecis latinisque in Aegypto repertis laudantur 2 (1977) 240-244, s. v. Dioskourei=on, Dioskouriako/j, Dio/skouroi etc.
GöMi234.indd 118 31.07.12 16:06
119GM 234 (2012)
der ägyptischen Religion nicht als Götter vorstellbar gewesen wären25. Unter den dort
wohnenden Griechen hatten die Dioskuren allerdings zu jener Zeit oder auch schon früher
Verehrung gefunden. In Naukratis verehrte man sie wohl, wie Inschriften verraten, bereits im
6. Jh. v. Chr. in einem eigenen Tempel26 und betrachtete sie auch später noch als griechische
Gottheiten; so etwa im Rahmen der höfischen Propaganda der Ptolemäer, die sich – wie
andere hellenistische Herrscher27 – gerne mit den Dioskuren assoziieren ließen28. Aus dem 3.
Jh. v. Chr. gibt es den Hinweis, daß das als göttlich verehrte Ptolemäerpaar sich einen Tempel
mit den Dioskuren teilte29. Unter der Bevölkerung der Chora erreichten die beiden Götter in
der Folgezeit eine besondere Prominenz, die eine Verehrung durch Ägypter bzw. nach
ägyptischen Maßstäben nicht mehr ausschließt. Noch skeptisch konnte Ulrich Wilcken die
Situation beurteilen: „Höchstens die öfter begegnenden Dioskuren möchte ich wohl für
griechische Götter halten, aber nur aus dem Grunde, weil ich kein ägyptisches Götterpaar
kenne, dem sie gleichgesetzt sein könnten.“30 Doch sah er bereits, daß dieselben Personen
sowohl ägyptische Gottheiten wie auch die griechischen Brüdergötter anbeten würden31. In
einer Orakelfrage an die Dioskuren32, die zunächst als rein griechisch angesehen wurde,
könnte vielleicht doch ägyptische Religiosität zum Ausruck kommen, zumal der Text im
25 Hdt. 2, 43: kaiì dio/ti Ai¹gu/ptioi ouÃte Poseide/wnoj ouÃte Dioskou/rwn ta\ ou)no/mata/ fasi ei¹de/nai, ou)de/ sfi qeoiì ouÂtoi e)n toiÍsi aÃlloisi qeoiÍsi a)podede/xatai; s. auch Hdt. 2, 50.
26 A. Bernand, Le Delta égyptien d'après les textes grecs I. Les confins libyques (1970) 673-676, 690f., 824-827; A. Möller, Naukratis. Trade in Archaic Greece. Oxford Monographs on Classical Archaeology (2000) 92f., 99f.; F. Leclère, Les Villes de Basse Égypte au Ier millénnaire av. J.-C. Bibliothèque d'Étude 144, 1 (2008) 126.
27 R. Thomas, Eine postume Statuette Ptolemaios' IV. und ihr historischer Kontext. Zur Götterangleichung hellenistischer Herrscher. Trierer Winckelmannsprogramme 18 (2001) 26f.
28 H.-C. Noeske, Die Münzen der Ptolemäer. Die Bestände des Münzkabinetts – Historisches Museum Frankfurt am Main (2000) Nr. 138; Nr. 188; Nr. 221-222; W. Huss, Ägypten in hellenistischer Zeit 332-30 v. Chr. (2001) 534; G. Weber, Dichtung und höfische Gesellschaft. Die Rezeption von Zeitgeschichte am Hof der ersten drei Ptolemäer. Hermes – Einzelschriften 62 (1993) 175, 255, 271, 346f.; S. Barbantani, Goddess of Love and Mistress of the Sea. Notes on a Hellenistic Hymn to Arsinoe-Aphrodite (P. Lit. Goodspeed 2, I-IV), Ancient Society 35, 2005, 141 mit Fn. 18. Wie andere sieht auch Alexander Sens Anspielungen auf die Herrscherideologie der ersten Ptolemäer im zweiundzwanzigsten, den Kampf der heroischen Brüder mit Amykos schildernden Idyll des Theokrit: A. Sens, Theocritus: Dioscuri (Idyll 22). Introduction, Text and Commentary. Hypomnemata 114 (1997) 23.
29 O. Rubensohn, Neue Inschriften aus Ägypten, APF 5, 1913, 158f., Nr. 2; S. Pfeiffer, Herrscher- und Dynastiekulte im Ptolemäerreich. Systematik und Einordnung der Kultformen (2008) 55, 57f. Letzterer weist auch auf die Möglichkeit hin, daß es sich bei diesem Tempel um den ägyptischer Götter gehandelt haben könnte, dazu weiter unten.
30 U. Wilcken, Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde I. Historischer Teil – Grundzüge (1912) 118.31 So will Chairemon im Fayum ein Fest des Souchos-Sobek feiern und schwört bei den Dioskuren: BGU I 248,
12f. (75-85 n. Chr.); zu dem angeschlossenen Archiv: R. Smolders, Two Archives from the Roman Arsinoites, Chronique d'Égypte 79, 2004, Nos 157-158, 233-240 (hier bes. 237). – Bissing, Culto (Fn. 23), 356: „É evidente, che il culto die Dioscuri in Egitto prosperava in località dove vivevano insieme Egizi e Greci o Romani.“
32 P. Fay. 138 = W. Chr. 95. Auch in M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion. Subsidia Epigraphica 12 (1985) Nr. 55 im Vergleich mit anderen Orakelanfragen, ebd. 131-139.
GöMi234.indd 119 31.07.12 16:06
120 GM 234 (2012)
Tempel des Sokanobkoneus (Sbk nb Gnwt, Sobek, Herr von Genout/Bakchias) gefunden
wurde33. Ein fayumischer Kultverein listet Beiträge für das Fest der „Bekleidung“ der
Dioskuren auf34. Dabei wird man doch an die altehrwürdige Einkleidung ägyptischer
Kultbilder denken können35. Auch onomastisch läßt sich die vermehrte Verehrung der
Dioskuren unter Ägyptern gut fassen: So tragen einige Personen den Namen Dioskourides,
aber auch ein ägyptisches Alias36. Zusätzlich handelt es sich bei manchen theophoren
Personennamen um Komposita wie Dioskorammon37 und Sarapodioskoros38. Dieses
Phänomen weist auf ein anderes hin: In der Römerzeit wurden die Dioskuren zunehmend mit
prominenten ägyptischen Gottheiten vergesellschaftet. Ein Offizier der kaiserlichen Flotte
weihte in Akoris/Tenis eine figürliche Darstellung der göttlichen Brüder dem
Amun/Ammon39. In der bekannten Isis-Litanei auf einem kaiserzeitlichen Papyrus aus
Oxyrhynchos40, die aber wahrscheinlich einer hellenistischen Vorlage folgt und überdies von
einer viel älteren theologischen Tradition abhängig ist41, wird die Göttin als Urheberin des
segensreichen Wirkens der Dioskuren gepriesen42. Im Tempel von Nadura, in der Oase
Kharga, könnten die Dioskuren innerhalb der traditionellen Registerordnung wiedergegeben
33 Vgl. S. Pernigotti, Le domande oracolari e il culto dei Dioscuri, Fayyum Studies 3 (2009) 63-75.34 SB 9348, 1f. (2./3. Jh) mit BL XI 127: lo/goj d[apa/n]hj stolism[ou=] qew½n Dio?[s]k?[o]u/?rwn.35 F. Perpillou-Thomas, Fêtes d'Égypte ptolémaïque et romaine d'après la documentation papyrologique
grecque. Studia Hellenistica 31 (1993) 83-87, 218f. Natürlich spielten heilige Gewänder oder die Einkleidung von Götterbildern auch außerhalb eine große Rolle: Thesaurus cultus et rituum antiquorum 2 (2004) 427-437, s. v. Vetements, parures (A. Kauffmann-Samarras – A. V. Szabados), aber der Terminus stolismo/j scheint doch ein epigraphisches Privileg Ägyptens zu sein.
36 Z. Bsp. P. Lond. 604B, 319 (47 n. Chr.): ¹Arei¿ou Diosko(uri¿dou) tou= (kaiì) Semfq(e/wj); O. Bodl. 1346, 3f. (140 n. Chr.): o)no/(matoj) Dioskouri¿d(ou) tou= ka?iì Yansnw½(toj) Fqoum?i¿?(nioj); vgl. O. Bodl. 1353, 8 (141 n. Chr.); Rubensohn, Inschriften (Fn. 29), 163f., Nr. 11.
37 Inscr. Syringes 1550: Dioskora/mmwn eiådon th\n mani¿an kaiì e)qau/masa; s. auch P. Oxyr. 58, 3927, 45 (246 n. Chr.); SEG 40, 1568, 15 (220 n. Chr.); P. Sakaon 61, 2; 30 (299 n. Chr.); O. Bodl. 2089, 5; 8 (303 n. Chr.); O. Bodl. 2092, 7 (3./4. Jh.); O. Leid. 339, 6 (303 n. Chr.).
38 SEG 40, 1568, 10; 48 (220 n. Chr.)39 Inscr. Akoris 19 (1./2. Jh. n. Chr.): qe%½ ãAmmwni megi¿st[%] Dioskou/rouj swth=raj Xariklh=j
nau/arxoj sto/lou Sebastou= ¹Alecandri¿nou u(pe\r tou= te/knou kaiì th=j sumbi¿ou eu)ca/menoj a)ne/qhken. Bernand scheint vorzuschlagen, eher eu)ca/menoj als a)ne/qhken auf den Akkusativ Dioskou/rouj zu beziehen, wonach eine unbekannte Statuette für Ammon errichtet worden wäre, während das Versprechen dazu an die Dioskuren gerichtet war. Es ist jedoch auch möglich, daß der Kapitän Bildnisse der Dioskuren aufgrund eines Gelübdes errichtete. Eine prominente Parallele für das Beschenken des einen Gottes mit der Statue eines anderen ist das epigraphische Zeugnis eines Askaloniten, der – unter Verwendung derselben Verba – dem Sarapis von Kanopos das Bildnis des heimatlichen Herakles-Baal verehrte: Inscr. Delta I, 242ff., Nr. 14 (228 n. Chr.). Dazu N. Belayche, Iudaea-Palaestina. The Pagan Cults in Roman Palestine (Second to Fourth Century) (2001) 230, 288 mit Fn. 58. Vgl. auch RICIS 311/0102-0103 (Ancyra, beide 176 n. Chr.).
40 P. Oxy. 11, 1380 = Totti, Texte (Fn. 32), 62-75, Nr. 20 41 J. F. Quack, Einführung in die altägyptische Literaturgeschichte 3. Die demotische und gräko-ägyptische
Literatur 2(2009) 107f.; H. Kockelmann, Praising the Goddess. A Comparative and Annotated Re-Edition of Six Demotic Hymns and Praises Addressed to Isis. Archiv für Papyrusforschung Beiheft 15 (2008) 52-59.
42 P. Oxy. 11, 1380 = Totti, Texte (Fn. 32), Nr. 20, 235: s?[u\] Dio?s?kou?/[rouj s]w[th=]r?[aj] e)poi/hsaj.
GöMi234.indd 120 31.07.12 16:06
121GM 234 (2012)
worden sein, dabei ihr klassisches Darstellungsschema beibehaltend43. Die Identifikation
bleibt gleichwohl hypothetisch44, unklar ist auch der genaue Zusammenhang mit dem lokalen
Hauptgott.
Natürlich wurden die Dioskuren durch solche Kombinationen am Nil nicht endgültig zu
Ägyptern. Die Vorstellung von ihnen als griechische Götter bzw. Heroen, mit traditionellen
Zuständigkeiten, existierte im kaiserzeitlichen Ägypten sicher weiter45, wie auch die meisten
ikonographischen Belege demonstrieren46. Allerdings ist doch ebenso offenbar, daß sie am Nil
nicht mehr ausschließlich und etwa im Sinne Herodots oder Wilckens als integrationsunfähige
Immigranten agierten, sondern den Rahmenbedingungen spätägyptischer Religion angepaßt
werden konnten. In diesem Sinne ist es vielleicht auch nicht zufällig, daß die Dioskuren in
Alexandria und außerhalb Ägyptens gerne mit Isis und Sarapis zusammen auftraten47. Für sich
43 S. Sauneron, Les temples gréco-romains de l'oasis de Khargéh, BIFAO 55, 1955, 23-31, hier: 26, 31, Taf. 2; vgl. J. Willeitner, Die ägyptischen Oasen. Städte, Tempel und Gräber in der Libyschen Wüste (2003) 41 und 39, Abb. 52.
44 Eine andere Erklärung („zweifache Darstellung des Herakles-Harpokrates“) bietet D. Kurth, Einige Anmerkungen zum oberen Tempel von Nadura in der Oase Charga, in: Dielheimer Blätter zum Alten Testament 27, 1991, 172-180. Jüngst hat Heribert Aigner der Deutung von Serge Sauneron widersprochen und aufgrund der „anmutig ausladend geschwungenen Hüften“ der in Nadura zur Linken befindlichen Figur eine weibliche Göttin rekonstruieren wollen: H. Aigner, Ein geraubtes „Herakles-Relief“ aus dem oberen Nadura-Tempel der Oase Charga, in: Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag, hrsgg. v. C. Franek u. a. (2008) 39-42. Ausführlicher zum Hauptgott des Tempels und zum Yale Nadura Temple Project: D. Klotz, Chons at Nadura Temple, Göttinger Miszellen 226, 2010, 25-34.
45 Als Beispiel eine Weihung aus Ägypten eines siegreichen Dichters, SEG 18, 716 (2./3. Jh.): Ma=rkoj De/krioj Dekriano/j, e)pw½n kaiì melw½n poihth/j, nikh/saj to\n na§ i¸ero\n triethriko\n a)gw½na, pa<t>r%¯oij qeoiÍj Dioskou/ro<i>j a)ne/q<h>k<e>n, <e)>p' a)gaqw½i. Das erinnert an die Worte von Theokrit, Id. 22, 23f. – S. auch das Gebet an die Dioskuren auf einem kaiserzeitlichen Ostrakon in Michigan: H. C. Youtie, Ostraca from Karanis, ZPE 16, 1975, 272f.
46 Zum Beispiel orientieren sich Terrakottastatuetten der Dioskuren im römerzeitlichen Ägypten ausschließlich – so weit ich sehen kann – an griechisch-römischen statuarischen Typen: P. Perdrizet, Les terres cuites grecques d'Égypte de la collection Fouquet (1921) 99-102, Kat.-Nr. 250-255, Taf. 52 u. 72; E. Breccia Terrecotte figurate greche e greco-egizie del museo di Alessandria. Monuments de l´Égypte gréco-romaine II 1 (1930) 51, Kat.-Nr. 230, Taf. 25, 4; S. Pingiatoglou, Mousei/o Mpena/kh. H koroplastikh/ thj Aigu/ptou kata/ touj Ellenistikou/j kai Rwmaikou/j xro/nouj (1993) 69, Kat.-Nr. 82-83; J. Fischer, Griechisch-römische Terrakotten aus Ägypten. Die Sammlungen Sieglin und Schreiber, Dresden, Leipzig, Stuttgart, Tübingen (1994) 327f., Kat.-Nr. 802-803, Taf. 84; L. Török, Hellenistic and Roman Terracottas from Egypt. Monumenta Antiquitatis extra fines Hungariae reperta 4 (1995) 43f., Kat.-Nr. 33, Taf. 25; s. auch unten Fn. 55.
47 Dioskuren und die ägyptischen Götter werden gemeinsam inschriftlich aufgeführt: RICIS 202/0273 (Delos, 118/7 v. Chr.); RICIS 301/1202 (Pergamon, 1. Jh. n. Chr.); RICIS 311/0102-0103 (Ancyra, beide 176 n. Chr.). – W. Hornbostel, Sarapis. Studien zur Überlieferungsgeschichte, den Erscheinungsformen und Wandlungen der Gestalt eines Gottes. Études préliminaires aux religions orientales dans l'Empire romain 32 (1973) 307; R. Veymiers, (/Ilewj t= forou=nti. Sérapis sur les gemmes et les bijoux antiques (2009) v. a. 135-6, 146-7, 152; vgl. auch S. Barnard, The Dioscuri on Cyprus, Thetis 10, 2003, 71-75. Ein bestimmter alexandrinischer Lampentyp thematisiert die Verbindung zwischen Sarapis und den Dioskuren: Der längliche Lampenkorpus von 9 bis 10 cm Länge ist dabei der Form eines Schiffes oder Bootes angenähert; ein thronender Sarapis ziert en relief den Übergang zum Griff, während die Dioskuren den Rand des Spiegels besetzen: V. Tran Tam Tinh – M.-O. Jentel, Corpus des lampes à sujets isiaques du Musée Gréco-Romain
GöMi234.indd 121 31.07.12 16:06
122 GM 234 (2012)
genommen dürfte dieses Phänomen gleichermaßen auf die allgemeine Beliebtheit der
göttlichen Brüder und auf die funktionale Konvergenz mit den der glücklichen Seefahrt
verpflichteten alexandrinischen Göttern zurückgeführt werden. Zusätzlich aber könnte in der
besagten Zusammenstellung auch eine gemeinsame religiöse Idee unter spezifisch
ägyptischen Voraussetzungen erkannt werden.
Am nachdrücklichsten ist Jan Quaegebeur dafür eingetreten, daß die griechische Nennung der
a)delfoi/ oder der Dio/skouroi auch in ägyptischer Weise hätte verstanden und daß selbige
mit einheimischen Gottheiten hätten gleichgesetzt werden können48. Zahlreiche Forscher sind
ihm bei dieser These gefolgt49. Als geeigneter Kandidat für eine solche Gleichsetzung kommt
danach die Krokodilgötter-Dyade „Die beiden Brüder“ (Sn.wj, griechisch Yosnau/j oder
Yansnw½j) in Frage. Als Argumente können unterschiedliche, bereits angesprochene Fakten
angeführt werden: etwa die Orakelanfrage aus Bakchias oder der stolismo/j der
Dioskouriasten (s. oben). Aufschlußreich ist weiterhin, daß „Die beiden Brüder“ ebenso wie
die griechischen Dioskuren eine besondere Aufgabe darin besaßen, die Verstorbenen zu
begleiten und zu schützen50.
Ein Problem aber besteht bisher nicht nur darin, daß bei vielen Erwähnungen der Dioskuren
und ihrer Tempel im Einzelfall über die griechische oder ägyptische Lesbarkeit kaum
endgültig entschieden werden kann51 – ein Problem ergibt sich auch durch die Ikonographie:
d'Alexandrie (1993) 50-53, 63, Nr. 26-30, Taf. 7f., Abb. 26-29bis. 48 J. Quaegebeur, Cultes égyptiens et grecs en Égypte hellénistique. L'exploitation des sources, in: E. Van 't
Dack u. a. (Hrsgg.), Egypt and the Hellenistic world. Kolloquium Leuven 1982. Studia Hellenistica 27 (1983) 303-324, hier 312-316; s. auch ders., Greco-Egyptian Double Names as a Feature of a Bi-Cultural Society. The Case Yosneuj o( kai\ Tria/delfoj, in: J. H. Johnson (Hrsg.), Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Constantine and Beyond. Studies in Ancient Oriental Civilization 51 (1992) 269.
49 H. Kockelmann, Sobek doppelt und dreifach. Zum Phänomen der Krokodilgötterkonstellationen im Fayum und in anderen Kultorten Ägyptens“, in: S. Lippert – M. Schentuleit (Hrsgg.), Graeco-Roman Fayum. Texts and Archaeology, Symposium Freudenstadt 2007 (2008) 153-164, hier bes. 161-163. Ebenfalls positiv aufgegriffen und weitergesponnen wurde die These Quaegebeurs durch Marie Drew-Bear, La triade du rocher d'Akôris, in: N. Fick – J.-C. Carrière (Hrsgg.), Mélanges Étienne Bernand. Annales littéraires de l'Université de Besançon 444 (1991) 227-234. Ausgehend von dem bekannten Dioskurenrelief von Akoris/Tenis in Mittelägypten, wies sie auf die gleichzeitige Bedeutung des Krokodilgottes Sobek in selbiger Stadt hin und kam zum Schluß, daß auch die Dioskuren des besagten Reliefs wie auch die von ihnen flankierte Frauengestalt ägyptisch zu deuten wären bzw. in der Antike entsprechend gedeutet werden konnten. S. ebf. Perpillou-Thomas, Fêtes (Fn. 35), 85ff.; M. Malaise, Pour une terminologie et une analyse des cultes isiaques (2005) 123; D. Frankfurter, Religion in Society: Graeco-Roman, in: A Companion to Ancient Egypt I, hrsg. v. A. B. Lloyd (2010) 530.
50 Kockelmann, Sobek (Fn. 49), 161.51 Als Beispiel das in P. Cair. Zen. 59168, 3 (256/255 v. Chr.) erwähnte Dioskou/rwn i¸er?o?/n im Fayum, nahe
einem Isieion und einem Sarapieion.
GöMi234.indd 122 31.07.12 16:06
123GM 234 (2012)
Während Quaegebeur noch überlegte, ob es sich bei den zwei antithetisch angeordneten
Krokodildarstellungen im Giebelfeld griechischer (Asyl-)Inschriften aus Theadelphia im
Fayum52 nicht um eine Illustration der beiden Krokodilgötter handeln könne53, wird dies von
Holger Kockelmann bezweifelt, nach dem die Anordung mit der „Achsensymmetrie der Stele
zusammenhängen“ könnte54. In der Tat gibt es bisher zahlreiche Indizien für die These
Quaegebeurs, aber noch keinen visuellen Beweis: Keine Darstellung zeigt die beiden
Dioskuren in einem ägyptischen Habitus oder mit Attributen, die sonst eher der ägyptischen
Kunst eigen sind.
Dies läßt sich mit dem Amulett von Tell Basta vielleicht ändern. Die Dioskuren tragen hier
nicht wie gewohnt Piloi, und ihre Scheitel sind auch nicht von den obligatorischen Sternen
bekrönt, sondern als Kopfschmuck dient vielmehr jeweils das Zeichen der ägyptischen
Sonnenscheibe55. Die Hörnchen an den Seiten der Schläfen erinnern deutlich an
Darstellungsweisen des Gottes Amun-Re/Ammon56, was wiederum gut mit der solaren
Symbolik zusammenpassen würde. Die beiden Begleiter der Dioskuren lassen sich ebenfalls
ägyptisch erklären: Um Pferde kann es sich nicht handeln, vielmehr verrät der gedrungene
Corpus und das anthropomorphe Gesicht, daß hierin Sphingen zu begreifen sind57. Es ist
aufgrund dieser Beschreibung offensichtlich, daß die beiden Figuren auf dem Amulett aus
Tell Basta nur mehr in ihrer ikonographischen Grundsubstanz als griechische Derivate zu
erkennen, darüberhinaus aber deutlich ägyptisiert worden sind. Daß dann der solare Aspekt,
52 Inscr. Fayoum II 110; 116; 117; 135 (alle 1. Jh. v. Chr.)53 Quaegebeur, Cultes (Fn. 48), 314: „N'est-il pas tenant d'y reconnaître cette divinité double appelée >les deux
frères<?“54 Kockelmann, Sobek (Fn. 49), 162.55 Keinesfalls kann hier gemeint gewesen sein, einen Reliefhintergrund zu schaffen, in den die Sternsymbole
erst einzutragen wären. Eine solche Vorgehensweise mag aus technischen Gründen bei Terrakotten notwendig sein – als Beispiel: S. Schmidt, Katalog der ptolemäischen und kaiserzeitlichen Objekte aus Ägypten im Akademischen Kunstmuseum Bonn (1996) 90f., Kat.-Nr. 105, Taf. 36. Die kleinteilige Anordnung der Elemente im Tell Basta-Amulett verrät dagegen, daß der Künstler die Sterne sehr wohl ohne diese Stütze einzutragen in der Lage gewesen wäre. – Gestirne wurden in der ägyptischen Ikonographie teils beliebig mit Sternen- oder mit Scheibensymbol illustriert: A. v. Lieven, Scheiben am Himmel – Zur Bedeutung von i)tn und i)tn.t, Studien zur altägyptischen Kultur 29, 2001, 277-282. Ob ein Zusammenhang existiert, kann ich nicht beurteilen.
56 Normalerweise sollte sich dort das Widdergehörn zu den Seiten des Kopfes hin entwickeln, jedoch gibt es bei frontalisierten Flachbildnissen (Reliefs, Lampenspiegel, etc.) die natürliche Tendenz zur zweidimensionalen Anlage; zahlreiche Beispiele in: LIMC 1 (1981) 666-689, s. v. Ammon (J. Leclant – G. Clerc).
57 Die ägyptischen Sphingen sind zwar entweder menschen- oder widderköpfig, auch nehmen gerade in römischer Zeit die Sphingen am Nil ganz absonderliche, teils wieder an die griechische Mischgestalt erinnernde Formen an: s. z. Bsp. die Sphingen, die sich im New Valley Museum von Kharga befinden: M. I. Bakr, Mathaf al-wadi al-djedid. Wizarat al-thaqafah. Al-madjlis al-ali lal-athar (1993) Taf. 6 (ohne Paginierung). Allerdings ist mir kein ägyptischer Sphinx mit Menschenkopf und Widdergehörn bekannt! Die Gleichartigkeit aller vier Gesichter auf dem Amulett von Tell Basta läßt auf eine gewisse formale Verlegenheit des Künstlers schließen.
GöMi234.indd 123 31.07.12 16:06
124 GM 234 (2012)
der sich aus der Sonnenscheibe und den Ammon-Hörnern ergibt, sich gut mit anderen
Indizien der interpretatio Aegyptiaca der Dioskuren zusammenfügt, stützt diese These
zusätzlich: Es wurde ja gezeigt, daß die beiden Brüder im Fayum, vielleicht auch anderswo,
an eine äquivalente Krokodilgötter-Dyade angepaßt wurden. Nun werden den Darstellungen
dieser Krokodilgötter in griechisch-römischer Zeit nicht ohne Grund Sonnenscheiben als
Kopfschmuck beigegeben58, sondern weil Sobek/Souchos als Form oder auch als Sohn des
Ur-, Schöpfer- und Sonnengottes Re galt und sogar die Sonnenbarke trägt bzw. verteidigt59.
Eine Verschränkung mit Ammon/Amun könnte sich auch durch dessen Analogie mit dem
griechischen Zeus, Vater der Dio\j kou=roi60, erklären lassen.
Einen ikonographischen Hinweis auf die Annäherung zwischen griechischen Dioskuren (bzw.
deren Ikonographie) und dem Brüderpaar der Krokodilgötter liefert eine ägyptische Votivstele
aus Kalkstein von ca. 26,0 cm Höhe, die vor einigen Jahren bei Christie's in London
versteigert wurde und zuvor zur Sammlung des bekannten ägyptischen Antikenhändlers
Maurice Nahman (1868-1948) gehörte61 (Abb. 3). In einem naosartig tiefen, von Säulen mit
Kapitellen gerahmten Relief erkennt man die Göttin Isis-Renenutet oder Thermouthis in ihrer
gewohnten Gestalt als aufgerichtete Kobra, deren Schwanz zu beiden Seiten des
frontalisierten Schildes symmetrische Schlaufen bildet. Über dem Schlangenkopf ragt eine
Krone empor, bestehend aus einem undefinierbaren wulstigen, horizontalen Element (ein
Kranz?), von dem aus links und rechts die Bänder eines Diadems herabfallen, und darüber
einer Isiskrone gewöhnlichen Musters mit von Hörnern gerahmter Sonnenscheibe und zwei
Federn. Die Schlange wird flankiert von zwei identischen Pfeilern mit einfachen Kapitellen,
auf denen jeweils ein Pilos mit Stern ruht. Das Datum der an der Oberfläche stark
abgewitterten und bestoßenen Stele läßt sich zunächst nicht näher als ptolemäisch bis
kaiserzeitlich bestimmen, allerdings fällt das schlichte Erscheinungsbild der Schlangengöttin
58 Zum Beispiel: Inscr. Fayoum II 116; 117; 135.59 LÄ 5 (1984) 995-1031, bes. 1010ff., s. v. Sobek (E. Brovarski); H. Beinlich, Das Buch vom Fayum. Zum
religiösen Eigenverständnis einer ägyptischen Landschaft. Ägyptologische Abhandlungen 51 (1991) 319ff.; F. Hoffmann, „Herrscher der Flüsse, … der die Räuberei liebt“ – Das Nilkrokodil, in: V. Vaelske u. a. (Hrsgg.), Ägypten. Ein Tempel der Tiere. Ausstellungskatalog Berlin (2006) 66-68; C. Leitz, Der Lobpreis des Krokodils. Drei Sobekhymnen aus Kom Ombo, in: H. Knuf u. a. (Hrsgg.), Honi soit qui mal y pense. Studien zum pharaonischen, griechisch-römischen und spätantiken Ägypten zu Ehren von Heinz-Josef Thissen. Orientalia Lovaniensia Analecta 194 (2009) 291-355, bes. 298ff., 313ff., 334f.
60 Vielleicht nicht zufällig kombiniert eine antoninische Doppelherme im Vatikan einen Kopf des Ammon mit dem eines Dioskuren: Geppert, Castor und Pollux (Fn. 19), 72, Kat.-Nr. P42, Abb. 97.
61 Christie's London. Antiquities, including the Heidi Vollmoeller Collection, Part 2 and Property from the Maurice Nahman Collection, 28. April 2004 (2004) 55, Nr. 287. Die Erlaubnis des Auktionshauses zur Verwendung einer Abbildung wurde dankenswerterweise von Frau Victoria Hearn (London) erteilt.
GöMi234.indd 124 31.07.12 16:06
125GM 234 (2012)
auf, die hier rein theriomorph ist und nicht die reiche Mischikonographie der Kaiserzeit
aufweist. Isis-Thermouthis und die fraglos durch ihre Piloi vertretenen Dioskuren bilden auf
dem Relief eine Dreiheit62, die in dieser Form an eine kulttopographische Situation in
Narmouthis/Medinet Madi ganz im Süden des Fayum erinnert: Während der dortige Tempel
bereits im Mittleren Reich der Renenutet geweiht war und unter den makedonischen Königen
für dieselbe Göttin wieder eingerichtet wurde, entstand in der Ptolemäerzeit auf dem Hügel
unmittelbar im Osten des großen Heiligtums ein weiterer Tempel, der offenbar – wie das
charakteristische Zweiersanktuar verrät (Abb. 4) – der kultischen Verehrung eines
Krokodilgötterpaares diente63. Dieser sogenannte Tempel C wurde während der 1990er Jahre
durch die Mission der Universität Pisa freigelegt und ist heute zu besichtigen64.
Zuletzt ist noch einmal zu dem Amulett von Tell Basta zurückzukehren. Wahrscheinlich hat
es sich hier wie auch bei den erwähnten Parallelen aus Metall oder Stuck, die Göttertriaden
zeigen (s. oben), um den Schutz einer Bestattung gehandelt65. Unter Voraussetzung einer
etablierten Vergleichbarkeit der Dioskuren und der beiden Krokodilgötter verstand es der
Verfertiger des Schmuckstücks, durch eine gemessene Ägyptisierung der erstgenannten die
funeräre Kompetenz der einen mit der der anderen Dyade zu potenzieren. Es liegt auf der
Hand, daß dann der Ort der Auffindung des Amuletts nicht seiner originalen Nutzung
entsprechen kann. Hinweise aus den jüngsten Arbeiten des Tell Basta Project, wonach der
Plattenbelag vor dem großen Tempel der Bastet in der Spätantike durch Schutt, unter anderem
aus einer nahen Nekropole, verfüllt wurde, erhalten auf diese Weise weitere Bestätigung.
62 Eine ähnliche, aber viel schlichtere Stele im Louvre (AF 11687, H. 39,5 cm) zeigt dieselbe Kombination: L'Égypte romaine. L'autre Égypte. Ausstellungskatalog Marseille (1997) 204f., Abb. 207. Das Arrangement – Frau zwischen Piloi – erinnert an eine kleine Skulptur in Kairo von nur 7,5cm Höhe: C. C. Edgar, Catalogue General des Antiquités Égyptiennes du Musée du Caire. Greek Sculpture (1903) Nr. 27502, Taf. 11. Dargestellt ist eine bekleidete Frau, die auf einer breiten Kline sitzt und von zwei Piloi flankiert ist. Vgl. oben Drew-Bear, La triade (Fn. 49), mit weiterführender Literatur.
63 E. Bresciani – R. Pintaudi, The discovery of a new temple at Medinet Madi, Egyptian Archaeology 15, 1999, 18-20; R. S. Bagnall – P. Davoli, Archaeological Work on Hellenistic and Roman Egypt, 2000-2009, AJA 115, 2011, 120f.
64 E. Bresciani u. a., Medinet Madi. Archaeological Guide (2010) 44-47. 65 Vgl. K. Parlasca, Apotropäische Goldbleche bei Mumienporträts, Archäologisches Korrespondenzblatt 28,
1998, 435-443. Die hier vorgeführten Bleche sind zwar von grundsätzlich anderer Gestalt als die besprochene lamella, haben aber wohl dieselbe Aufgabe.
GöMi234.indd 125 31.07.12 16:06
126 GM 234 (2012)
post scriptum
Auch ohne den Anspruch, ein vollständiges Dossier der Dioskuren in Ägypten bieten zu
wollen und zu können, sind bestimmte Informationen nachzutragen, die zum Zeitpunkt der
Abgabe dieses Artikels noch nicht berücksichtigt worden waren. Am Gesagten ändert sich
dadurch nichts.
Zwei Orakelanfragen an die Dioskuren (zu Fn. 32), beide von unbekannter Herkunft: P.
Münch. III 117 aus dem 1. Jh. n. Chr. richtet sich gleichzeitig an Isis sowie Sarapis und ist
also ein weiterer Beleg für die Vergesellschaftung all dieser Gottheiten, die sich oben
bereits in anderen Quellengattungen abgezeichnet hat (s. Fn. 47). PSI Congr. XX 3 des
Jahres 5 v. Chr. richtet sich an toi=j dusi\ a)delfoi=j, die Herausgeberin hat hier mit
Recht die Dioskuren identifiziert.
Trotz des verheißungsvollen Namens kann die römische Militärstation Di/dumoi in der
ägyptischen Ostwüste, an der Straße von Berenike nach Koptos, wenig zum vorliegenden
Zusammenhang beitragen. Gleichwohl werden die dortigen Verkehrsrouten unter dem
Schutz der Dioskuren gestanden haben1. Eine hellenistische Inschrift, die sich nun in
Warschau befindet und die über eine diplomatische Mission für das Ptolemäerhaus
berichtet, könnte aus Koptos stammen2. Dennoch kündigt darin die Nennung der beiden
Dioskuren – neben anderen Gottheiten – nicht notwendig deren Zuständigkeit für die
kaiserzeitlichen Karawanenroute in der Ostwüste an. In einem Gepanzerten mit Pferd auf
einem fragmentierten, römerzeitlichen Relief aus Di/dumoi wurde ein Dioskur erkannt3,
was ikonographisch gut möglich wäre. Ähnliches gilt für ein besser erhaltenes Relief von
Tell el-Herr im Ostdelta4. Die beigefügte Inschrift e)[p'] a)gaq= würde ebenfalls zum
Goldamulett aus Bubastis passen.
Veit Vaelske
1 H. Cuvigny (Hrsg.), Didymoi. Une garnison romaine dans le désert Oriental d'Égypte I (2011) 6, 51. Man bezieht sich dabei auf O. Did. 458, das neben anderen Schriftzeugnissen im Folgeband Didymoi II (2012) publiziert werden wird.
2 A. Łajtar, Die Kontakte zwischen Ägypten und dem Horn von Afrika im 2. Jh. v. Chr. Eine unveröffentlichte griechische Inschrift im Nationalmuseum Warschau, JJP 29, 1999, 51–66 = ders., Catalogue des inscriptions grecques du Musée National de Varsovie. The Journal of Juristic Papyrology Suppl. 2 (2003) 130–140, Nr. 47.
3 Didymoi I (s. oben) 51, 89 mit Abb. 121.4 D. Valbelle – J.-Y. Carrez-Maratray, Le camp romain du Bas-Empire à Tell el-Herr (2000) 63 mit Abb.
50; 152 (= SEG 50, 1609).
GöMi234.indd 126 31.07.12 16:06