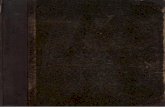Falsche Freunde. Von der Unversöhnbarkeit von Theater und Theorie
Ein japanischer Hegel? Zum Werk von Karatani Kōjin anlässlich der Veröffentlichung von „Auf der...
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Ein japanischer Hegel? Zum Werk von Karatani Kōjin anlässlich der Veröffentlichung von „Auf der...
1Berliner Debatte Initial 25 (2014) 4
Ulrich Brieler, Axel Rüdiger, Florian Heßdörfer
Ein japanischer Hegel? Zum Werk von Karatani Kōjin anlässlich der Veröffentlichung
von „Auf der Suche nach der Weltrepublik“
Die internationale Debatte über eine Erneue-rung der materialistischen Denkungsart ist frag-los unterentwickelt. Was weiß die ergraute Neue Linke von den Diskussionen in Asien, Afrika, Osteuropa und Südamerika? Selbst das Wenige an „subaltern studies“ oder „colonial studies“ scheint nur Insidern bekannt. In Deutschland etwa herrscht schon großes Unwissen darüber, was in Frankreich gedacht wird. Wer kennt Jean Claude Michéa und Bernard Stiegler, Paul Jorion oder Isabelle Garo? Schon Alain Badiou wird als theoretischem Unhold die Tür gewie-sen. Und was an radikalem Denken außerhalb des europäisch-nordamerikanischen Kosmos geschieht, findet noch weniger Beachtung. Wir wissen zu wenig, was und wie woanders gedacht wird.
Unter diesen Index fällt auch der 1941 geborene japanische Literaturkritiker und Philosoph Karatani Kōjin.1 Karatani, der sich selbst als globaler Intellektueller versteht, ist spätestens seit seiner Arbeit „Transcritique. On Kant and Marx“2 mehr als ein Geheimtipp. Im Ringen um ein Verständnis der Krisenpro-zesse in Japan und der Systemumbrüche nach 1989/90 entwirft er eine ganz eigene Kritik des globalen Kapitalismus, die primordial und aktualitätshistorisch zugleich ist. Gleichsam ein Nomade in den Geisteswissenschaften versucht er in immer neuen Anläufen, verkrustete Apri-ori aufzubrechen, um Weltgeschichte als ein tatsächlich globales Geschehen in historisch-systematischer Dimension zu entfalten. Mit „The Structure of World History: From Modes of production to Modes of Exchange“ ist 2014 ein weiteres großes Werk von ihm in englischer Übersetzung erschienen. So trifft es sich gut,
dass nun die erste deutsche Veröffentlichung der geschichtsphilosophischen Ideen Karatanis vorliegt: „Auf der Suche nach der Weltrepublik. Eine Kritik von Kapital, Nation und Staat“.3 Das Buch ist eine für das deutsche Publikum verdichtete Edition seiner „Structure of World History“. Es gibt einen vorzüglichen Einblick in Karatanis Denken, in seine theoretischen Referenzen und politischen Optionen.
Die „Weltrepublik“ ist zunächst ein bemer-kenswerter, weil ungewöhnlicher Beitrag zu einer materialistischen Diskussion der globalen Verhältnisse. Richtet sich sein diagnostischer Blick doch in einer global-, ja gattungsgeschicht-lichen Perspektive ein. Diese Ambition einer neuen universalen Meistererzählung gibt der Arbeit etwas maximal Unzeitgemäßes. Denn eine geschichtsphilosophische Anstrengung traut sich die materialistische Denkungsart seit langem nicht mehr zu. Immanuel Wallerstein, nicht zufällig an Achsenpunkten des Buches ein Gesprächspartner Karatanis (14, 39, 135, 218), war der letzte, der zumindest für die Geschichte des Kapitalismus ein derartiges Unternehmen in Angriff nahm. Dies ist der geschichtsphilosophische Einsatz: Karatani will in einem umfassenden Zugriff die Welt-geschichte neu erzählen.
Er will diese Geschichte aber auch anders erzählen. Das Buch versteht sich als eine Polemik innerhalb der materialistischen Den-kungsart und hält dem „westlichen Marxismus“ (Perry Anderson) den Spiegel seiner Fehler vor. Es zielt auf die Kritik derjenigen, die Karatani, ohne konkrete Adressaten zu nennen, als „die Marxisten“ bezeichnet. Der Kern seiner Po-lemik ist die Vernachlässigung von Staat und
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 1 04.12.2014 07:13:21
2 Ulrich Brieler, Axel Rüdiger, Florian Heßdörfer
Nation als geschichtsmächtigen Größen, ein Versäumnis, das er schon bei Marx angelegt sieht (16). In dieser Hinsicht bewegt Karatani sich fraglos in einem post-marxistischen Raum. Dieser Post-Marxismus versteht sich nicht als melancholische Geste eines bloßen Abschieds oder gar eines zynischen Selbsthasses, der zu-meist nur die Passage von der marxistischen zur liberal-demokratischen Orthodoxie markiert. Post-Marxismus erscheint hier vielmehr als Voraussetzung für die notwendige Wiederauf-nahme des emanzipatorischen Projektes, dem Marx seine wichtigste Stimme verlieh.
In der „Weltrepublik“ will Karatani ein Projekt fortführen, das er in „Transcritique“ begonnen hat – ein Buch, dass international für Furore sorgte, in Deutschland aber meist nur den Lesern von Slavoj Žižek bekannt ist, der sich in „Parallaxe“ (2006) positiv auf „Transcritique“ bezog. Dort nahm Karatani Marx und insbesondere dessen Wertlehre vor denjenigen „Marxisten“ in Schutz, die begin-nend mit Friedrich Engels dazu neigten, die antinomische Dialektik von Kant und Hegel aus Marx‘ Werk zu tilgen. Der „Marxismus“, so seine Hauptthese in „Transcritique“, reduziere Marx auf die undialektische Arbeitswertlehre der klassischen Ökonomie von Adam Smith und David Ricardo und transportiere mehr oder weniger unbewusst die Ideologie des modernen Industrialismus. So betrachtet, beansprucht Karatanis Post-Marxismus auch eine direkte Rückkehr zum dialektischen Marx.
Der Anspruch ist also kein geringer. Was Marx im „Kapital“ für die industrielle Wa-renproduktion entschlüsselt hat – „ähnliches will ich für Staat und Nation tun“ (44). „Nicht Staat und Kapital sind durch die industrielle Revolution zu erklären, sondern umgekehrt.“ (62) Karatani will vor allem „den Staat als akti-ves Subjekt wiedereinführen“ (218), allerdings ohne den Staatstheoretikern des westlichen Marxismus jenseits der kritischen Erörterungen in „Transcritique“ noch weitere Beachtung zu schenken. Zumindest tauchen weder Antonio Gramsci noch, bis auf einen dezenten Hinweis, Louis Althusser (28), weder Nicos Poulantzas noch Pierre Bourdieu auf, um nur einige nicht eben unwichtige materialistische Staatstheo-retiker zu nennen.
Allemal trifft Karatani einen Grundton des materialistischen Denkens im 21. Jahrhundert. Denn in unterschiedlicher Grundierung finden sich bereits bei Michel Foucault und Gilles Deleuze, unverkennbarer bei Michael Hardt und Antonio Negri, bei John Holloway, bei Étienne Balibar oder Slavoj Žižek Impulse einer Überwindung des Ökonomismus, ohne Grund-kategorien der Kritik der politischen Ökonomie preiszugeben. Ihr gemeinsamer Nenner: Diese sind nur zu retten, indem man sie fortschreibt. Der materialistische Blick auf die Welt kann nicht mehr von der bloßen Produktionssphäre, im schlimmsten Fall von der ‚Fabrik‘ – was immer diese heute sein mag – auf ‚alles Restli-che’ schließen. Der materialistische Blick muss die historische Totalität der Verhältnisse – ihr Wechselspiel, ihre Transformationen, ihre In-terferenzen – in Augenschein nehmen. Und er muss von Beginn an die räumliche Dimension, die „Welt“ in ihrer historischen Verfügbarkeit, mit bedenken. Karatani will, dies betont er im Vorwort zur deutschen Ausgabe ausdrücklich, „die Geschichte der Gesellschaftsformationen aus dem Blickwinkel ihrer wirtschaftlichen Basis […] erfassen“ (9). Aber diese „Basis“ erfährt eine Neustrukturierung. Sie wird, so sein zentraler Begriff, zur „Austauschform“, die an die Stelle der „Produktionsweise“ (20, 23) tritt. Die Austauschformen sind die mate-rialistischen Weltgeister.
Die geschichtsphilosophische Matrix
Nicht zufällig steht Hegel am Anfang. Nicht nur der geschichtsphilosophische Einsatz He-gels reizt Karatani, sondern vor allem dessen Interpretation der Französischen Revolution. Hegel hat die Forderungen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit als Matrix ei-ner endlich zu sich gekommenen Menschheit verstanden. In dieser trinären Beziehung aus Freiheit der Marktteilnehmer, Gleichheit vor dem Gesetz und Brüderlichkeit als imaginierte Gemeinschaft findet Karatani ein Grundmus-ter für das, was er die „borromäischen Ringe Kapital-Nation-Staat“, die „KNS-Ringe“ (10), nennt. Diese drei Elemente finden sich bei ihm unaufhebbar miteinander verklammert. Die
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 2 04.12.2014 07:13:21
3Ein japanischer Hegel?
Weltgeschichte ist nichts anderes als die Route dieser sich stetig verstärkenden Verflechtung. Kein Element kann isoliert betrachtet werden, nur in den spezifischen Formen ihrer Verkop-pelung offenbart sich die historische Realität. Die „Kritik an Hegel zu erneuern“ (20), heißt, ein „transzendentales Verständnis des Zu-sammenhangs“ der KNS-Ringe zu entfalten und gleichzeitig die Achsen ihrer historischen Entwicklung, die „Struktur der drei Übergän-ge in der Weltgeschichte zu entschlüsseln“ (44). Die idealistische Lesart Hegels von der Totalität der KNS-Ringe „muss auf marxsche Weise in materialistische Begriffe übertragen werden.“ (20)
Am Anfang ist also die Austauschform. Ka-ratani meint dies in einem geschichtlichen wie anthropologischen Sinn. Denn die Genealogie der Austauschform A, der Reziprozität, beginnt in dem Moment, in dem Gemeinschaften sich im Medium von Gabe und Gegengabe begeg-nen. Der von Marcel Mauss entlehnte Begriff der „Gabe“ markiert nicht nur den ersten menschheitsgeschichtlichen Übergang: vom Nomadentum in die Sesshaftigkeit. Er liefert zugleich Matrix und Norm einer kritischen Haltung: „Die Gabe ist eine Art Gesellschafts-vertrag.“ (52) Wie bei Mauss entwickelt orga-nisiert und festigt das reziproke Gabensystem den gesellschaftlichen Zusammenhalt, in der Verbindlichkeit seiner Wirkungsweise gibt sich jedoch sein umfassender Zwangscharakter zu erkennen. Dass dem Geber seine Gabe wieder vergolten werden wird, ist genauso sicher, wie die Blutrache am verfeindeten Stamm. (55) In einer von Austauschform A geprägten Gesell-schaftsformation begegnen sich die Einzelnen als Gleiche, ihre Gleichheit meint jedoch nicht primär die Gleichheit verschiedener Indivi-dualitäten, sondern die vor dem unbedingten Gesetz der Reziprozität.
Die Wechselseitigkeit der Gabe, die Gleich-heit voraussetzt und befördert, schlägt sich schließlich in entfremdeter Form in den Austauschformen B („Raub und Umver-teilung“) und C („freier Warenaustausch“) nieder. Damit sträubt sich die Erzählung von den weltgeschichtlichen Übergängen gegen eine eindimensionale Verfallsgeschichte. Die Gleichheit der Gabe wird zwar unterbrochen,
um einem hierarchisierten Herrschaftssys-tem Platz zu machen. Diese Unterbrechung eröffnet aber zugleich den Raum für neue Formen der Kollektivität und neue Kämpfe um Gleichheit. Diese Kämpfe erhalten bei Karatani ein eigenwilliges Ziel: Die Austauschform D, die er mit dem Namen X belegt, figuriert als Rückkehr in die Zukunft der Reziprozität, der wechselseitigen Anerkennung der Menschen als Freie und Gleiche. Sie „stellt gewisserma-ßen die Austauschform A auf einem höheren Niveau wieder her. Sie ist gleichzeitig frei und reziprok“. (26) Ein anderer Name für diese regulative Idee „X“ ist „Assoziationismus“, wobei Karatani auf Bemerkungen von Marx zur Assoziation und Produktionsgenossenschaft rekurriert, mit anderen Worten: „Sozialis-mus ist die Wiederherstellung des reziproken Austausches auf höherem Niveau“ (193). Der geschichtsphilosophische Zirkel schließt sich.
Der logische Status jenes ominösen X der Austauschform D, dies hat Karatani ausführlich in „Transcritique“ entwickelt, orientiert sich an Kants Modell der „transzendentalen Apper-zeption“. Damit ist jener logische Nullpunkt gemeint, der Voraussetzung für die Möglichkeit einer Ordnung überhaupt ist, ohne jedoch selbst über eine positive Identität innerhalb der Ordnung zu verfügen. Die transzendentale Subjektivität jenes Nullpunktes entspricht dem paradoxen Phänomen einer notwendigen Illusion, die im transkritischen Zwischenraum einer widersprüchlichen Interaktion bzw. eines Austausches entsteht.
Reziprozität strukturiert daher die ur-geschichtliche Wirklichkeit der Gabe wie die spätere Struktur politischer Herrschaft (Schutz und Gehorsam, Raub und Umvertei-lung), die Realität der Warengesellschaft wie die konkrete Utopie der „Weltrepublik“. Die unmittelbare Gegenseitigkeit der Gabe weicht dabei vermittelten Formen: Unter dem Dach des Staates erfolgt der Austausch von Schutz gegen Gehorsam, unter den Bedingungen der Warengesellschaft geht jeder Austausch den Umweg über die Geld- und Kapitalform.
Die KNS-Ringe bilden die drei „historischen Produkte der Austauschformen“ (27). Kapital, Nation und Staat sind die Namen für instituti-onalisierte Integrationsweisen der Gattungs-
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 3 04.12.2014 07:13:21
4 Ulrich Brieler, Axel Rüdiger, Florian Heßdörfer
geschichte. Kein sozialer Bund existiert ohne ein Wir-Gefühl, ohne ein Selbst-Verständnis von Zusammengehörigkeit, keine Gesellschaft existiert ohne ein Ordnungsgefüge, kein materieller Stoffwechsel ohne ökonomische Herrschaft. Nation, Staat und Kapital sind daher ‚Komplexe’: materielle Verdichtungen und his-torische Apriori, Verknüpfungen von Lebens-, Arbeits- und Denkweisen. Die historische Ge-stalt der jeweiligen Gesellschaftsformationen wird einerseits durch das interne Dominanz-Verhältnis innerhalb der Austauschformen und Integrationsweisen strukturiert, andererseits durch das variable Zusammenspiel von Aus-tausch- und Integrationsstruktur. In einer gegebenen Gesellschaftsformation dominiert stets eine Austauschform mit ihrem „jeweils eigenen Machttyp“ (31).
Die Entstehung des Staates, der zweite „Übergang“, korrespondiert so mit einem Dominanz-Wechsel der Austauschform. An die Stelle der Gabe tritt das Prinzip Raub – Umverteilung. En passant liefert Karatani hier eine Kritik der von Gordon Childe behaup-teten „neolithischen Revolution“: Nicht das Sesshaftwerden erzeugt den Staat. Der Über-gang von nomadischen Verbands- zu Clan-Gesellschaften – in beiden regiert die Pflicht zur Gabe – bringt noch keinen „Staat“ hervor. Der Staat hat seinen weltgeschichtlichen Auf-tritt im Augenblick des Dominanzübernahme einer nicht-reziproken Austauschform, die gleichzeitig die Herrschaft über andere in die Welt bringt. „Der Staat entsteht durch einen Austausch (Vertrag) zwischen herr-schender Gemeinschaft und beherrschter Gemeinschaft.“ (73) Die formal-juristische Reziprozität des Vertrags manifestiert eine soziale Ungleichheit.
Die Geburt des Staates signalisiert also auf paradoxe Weise die Regierung der neuen Ungleichheiten und die Garantie einer lebens-fähigen sozialen Ordnung für (fast) alle. Der Staat ist daher nicht nur kaltes Herrschaftsun-geheuer, er ist Sozialstaat avant la lettre, da er ein Minimum an sozialer Stabilität gewähren muss. Das ist die Antinomie des Staates, die den Staat sowohl auf gewaltsame Eroberung und Umverteilung als auch auf den reziproken Austausch zurückführt. Ist Karatani womöglich
also auch ein japanischer Gramsci, ohne dies zu wissen?
Gleichzeitig bleibt ein utopischer Über-schuss. Die Reziprozität des Gabensystems kann als eine Schutzvorrichtung und ein Versprechen gegen die endgültige Etatisierung gelesen werden: Unter ihrer Herrschaft existierte ein „System […], das sowohl Ungleichheiten als auch die Bildung des Staates unterdrückte“ (47) – ein Merkmal, das die Gabe für ihre un-geschmälerte weltgeschichtliche Wiederkehr in Austauschform „D“ qualifiziert.
Karatani besteht daher auf der systemati-schen Unverträglichkeit von Gemeinschaft und Staat: „Es ist unmöglich, dass eine Gemein-schaft sich automatisch zu einem Staat wei-terentwickelt“ (73), ein gewollt anarchistisches Argument, und auf der weltgeschichtlichen Besonderheit des Staates, der Entwicklung einer Bürokratie als „wichtigster Technologie zur Beherrschung von Menschen“ (63f.). Diese Bürokratie geht der Beherrschung der Natur voraus. Theoretische Referenzen sind hier die zu Unrecht vergessenen Lewis Mumford mit seiner „Megamaschine“ (63) und Karl August Wittfogel mit seiner Arbeit „Die orientalische Despotie“ (40, 112).
Der dritte Übergang in die Austauschform C, den freien Warenaustausch, und die Bil-dung des „Kapitals“ als einer grundlegenden gesellschaftlichen Macht reflektiert Karatani in einer eigenen Genealogie des Kapitalismus als modernem Weltsystem. Sein Interesse gilt weniger den technisch-ökonomischen oder mentalen (der berühmte „Geist des Ka-pitalismus“) Veränderungen. Er konzentriert sich zum einen auf die sozialpsychologische Dimension. „Kapital“ heißt „Kraft des Geldes“ (31f.) und meint den „Fetischcharakter“ der Warenwirtschaft, die unheimliche Herrschaft einer verkehrten Welt. Die „Kraft des Geldes“ resultiert aus seiner Monopolstellung im Reich der Waren und meint eine historisch singuläre systemische Dynamik: „das Verlangen, Geld zu akkumulieren […], hierin liegt der Grund für das Entstehen von Kapital“ (31), eine „perverse Triebkraft“ (91), die sich heute im „zinstra-genden Kapital maximiert“ (93). So weit, so vielleicht konventionell.
Zum anderen aber bringt er mit dem von
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 4 04.12.2014 07:13:21
5Ein japanischer Hegel?
Marx entlehnten Begriff des „Weltgelds“ eine globale Dimension der kapitalistischen Ge-nese „über Räume und Grenzen hinaus“ (92) ins Spiel. Warenaustausch, Kaufmanns- und Wucherkapital existieren seit „Urzeiten“ (93), blieben aber gegenüber den Austauschformen A und B, Reziprozität und Raub-Umverteilung, in einer untergeordneten Position. Erst die systematische Ausnutzung der globalen Räume erzeugt eine Dynamik, die das „Kapital“ als dominante Macht hervorbringt.
Der Mehrwert, Karatanis Clou, entsteht ur-sprünglich im Fernhandel durch den Austausch zwischen den globalen Räumen, „zwischen mehreren verschiedenen Wertsystemen“ (94). An einem globalen Ort wird billiger produziert als an anderen globalen Orten verkauft. Diese welträumliche Dimension erklärt die Entste-hung des Kapitalismus im Westen. Denn im Gegensatz zu den asiatischen Staatsdespotien, in denen Städte und Wirtschaft einer zentralen Lenkung unterliegen, fördern die westlichen Staatssubjekte, als Stadtrepubliken oder abso-lutistische Monarchien, den grenzüberschrei-tenden Warenverkehr. Vor allem die frühen westlichen Welt-Städte (Antwerpen, Ams-terdam, London) fungieren als Katalysatoren des freien Warenverkehrs. Die Bezugnahmen auf Fernand Braudel (39, 112, 135) sind hier offensichtlich.
Der Industriekapitalismus verdankt sich aber noch einer dritten und für Karatani ent-scheidenden Komponente. Er entsteht in dem Moment, in dem der Proletarier zugleich Kon-sument der von ihm produzierten Waren wird: Das „Epochale am Industriekapital“ (162) ist das Erscheinen der „Lohnarbeiter-Konsumenten“ (159) auf der historischen Bildfläche. Erst ihre Existenz sichert endgültig die Dominanz der Austauschform C, von Warenverkehr und Kapital.
Im Westen befördert seit dem 17. Jahrhun-dert der „Kapital-Staat“ der absolutistischen Monarchien die Dynamik der wirtschaftlichen Expansion. Er bleibt aber nicht das letzte Wort der Staatsgenealogie. Denn gegen die Exzesse der Industrialisierung entsteht der „Nation-Staat“. Karatani liest die Entstehung des Nationalismus seit dem 18. Jahrhundert als eine „imaginäre Wiederherstellung der
Gemeinschaft bzw. der Austauschform A“ (174).
Er übernimmt die von Benedict Anderson geprägte Formel der „vorgestellten Gemein-schaft“ (178), verwandelt sie aber in eine dia-lektische Figur. Denn der „Nation - Staat“ hebt die Widersprüche der Frühindustrialisierung in einem neuen imaginären Wir auf. Er ist „Protest und Widerstand gegen den Kapital-Staat“ (174), er „haucht dem kalten Kapital-Staat ‚Gefühle‘ ein“ (181). Der „Nation-Staat“ bildet so die institutionell-mentale Blockade einer revoluti-onären Auflösung der sozialen Widersprüche. Das „Problem des Faschismus“ (210) liegt in dieser Verkennung der Nation als einer „vom Staat getrennte(n), eigenständige(n) Existenz“ (211), wie Karatani mit Bezug auf Ernst Blochs „Erbschaft dieser Zeit“ bemerkt.
Die theoretische Wette
In Permanenz läuft Karatani gegen ein plumpes Basis-Überbau-Verständnis Sturm, um verkrus-tete Dichotomien aufzuheben. Primär ist der Austausch: „Welt“ ist da, wo Austausch ist, und Austausch ist da, wo Welt ist. (38) Es gibt kein Vorher und Nachher. Beides „ist“ und ereignet sich. Ein grundlegender Relationismus spielt sich ein. „Welt“ meint nicht Größe, sondern Eingang von Verbindungen: Begegnungen, Zirkulationen, Arbeitsteilungen.
Karatani denkt grundlegend von der „Welt“ her: nicht vom abstrakten Individuum, nicht vom ewigen Staat, nicht von „dem“ Feudalis-mus oder „dem“ Kapitalismus. Über seinen ontologischen Weltbegriff, das „Weltsystem“, den er von Wallerstein übernimmt (38ff.), refi-guriert er die Welt-Geschichte als „Geschichte der Gesellschaftsformationen“ (38). Schon die Urgesellschaft erscheint als „Mini-Weltsystem“, die asiatischen Großreiche mit ihren frühen Bürokratien und stehenden Heeren als „Welt-Imperien“. In dieser Optik werden Griechenland und Rom zu „‚Subperipherien‘ der westasi-atischen Zivilisations-Imperien“ (103). Das Fehlen einer zentralistischen Staatsmaschinerie ermöglicht Europa aber gleichzeitig Elemente einer „Welt-Wirtschaft“ zu entwickeln, ein Phänomen, das für die feudalen Gesellschaf-
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 5 04.12.2014 07:13:21
6 Ulrich Brieler, Axel Rüdiger, Florian Heßdörfer
ten Europas Geltung behält. Das „moderne Weltsystem“, das seit dem 16. Jahrhundert vom Westen her kommend „die Welt infiltriert“ (39), schreibt diesen Tendenzen fort. Gerade das Fehlen eines imperialen Zentrums und die Anerkennung der multipolaren Staatenwelt ermöglicht die Entwicklung eines Weltmarkts.
Karatani artikuliert weltgeschichtliche Wechselbeziehungen, die stufenförmigen Abfolgen und eindeutigen Kausalitäten wi-dersprechen. Er entgeht damit den endlos-unfruchtbaren Diskussionen, was zuerst da war: der Handel oder der Staat, der Akkumu-lationstrieb oder die protestantische Ethik, der Warenfetisch oder die Eigentumsstruktur... Dies ist fraglos ein Befreiungsschlag, der einen his-torischen Materialismus ermöglicht, der Zeiten und Räume tatsächlich ernst nimmt. Dessen Kern bildet die systematische Durchdringung von Staat und Ökonomie: Keine Ökonomie ist ohne Staat zu denken, kein Staat ohne Ökono-mie. Raub und Umverteilung, Warentausch und Infrastruktur, Akkumulation und Souveränität, das „‚Dazwischen‘“ (98) ist das entscheidende Terrain von Analyse und Aktion.
Anstelle der berühmten ‚letzten Instanz der Ökonomie’ könnte man von einem ‚Parallelm-aterialismus’ sprechen, in dem sich die Felder und ihre Logiken (Produktion – Reproduktion, Ökonomie – Politik, Reales – Imaginäres, Produktion – Zirkulation usw.) ständig über-schneiden, um in den Prozessen dieser perma-nenten Begegnungen die je historische Figur der Gesellschaftsformation hervorzubringen. Etienne Balibar hat in Bezug auf das Imaginäre diese Position als „Basis der Basis“4 beschrie-ben, um damit die grundlegende und ständig zu konstruierende Gestalt der geschichtlichen Materialität zu bezeichnen. Karatani radika-lisiert diese parallelmaterialistische Tendenz, indem er sie für die Geschichte der Gattung als bestimmend behauptet.
Dies impliziert eine historische Anthropo-logie ganz eigener Art. Vom ersten Moment an sind die Menschen (und nicht „der“ Mensch – eine Vokabel, die nie auftaucht) in eine „Welt“, d. h. ihre räumlichen Möglichkeiten gesetzt. Dieses Verhältnis von Sozialgruppe und Raum bestimmt die weitere Entwicklung. Weltgeschichte lässt sich nur schreiben, hat
man die Interaktion der Räume, die Dialektik von Separation und Öffnung, von Innen und „Außen“ (101, 103) im Blick. Karatani stellt sich nicht das Ziel, diese Überblendungen und Überlagerungen historisch konkreter auszuleuchten. Viele fruchtbare Beobachtungen erscheinen wie hingetuscht und offenbaren ein Großraum-Denken mit verblüffenden Paralle-len und Analogien. Wir gewinnen zum einen eine neue Vorstellung davon, wie verdichtet bereits in vorkapitalistischen Gesellschaften Ökonomie und Politik, Religion und Ökono-mie, Politik und Religion waren; zum anderen eine über Wallerstein hinausgehende globale Geschichte des Weltsystems von den humanen Anfängen her, räumlich und gattungsgeschicht-lich maximal ausgedehnt: Weltgeschichte als Denkexperiment.
Die politische Karte: Das Kommen der „Weltrepublik“
Es bleibt der vierte Übergang, den Karatani nicht so nennt, der in seinem weltgeschicht-lichen Panorama aber stets präsent ist: vom modernen Weltsystem zur „Weltrepublik“, durch die KNS-Ringe in den Assoziationismus. Das geschichtsphilosophische Unterpfand für diese Transformation ist die „Gabe“. Denn die hier verankerte Reziprozität verliert sich in keiner Etappe der Geschichte gänzlich. Die Gabe bleibt als untergründiger Motor humaner Vergesellschaftung stets präsent. Karatani ver-handelt diese beinahe Benjaminsche Figur einer messianischen Verborgenheit in der Freudschen Kategorie der „Wiederkehr des Verdrängten“ (57). In „Transcritique“ hatte er dieses Motiv eingeführt, um die Rückkehr der Gewalt der ursprünglichen Akkumulation, die Marx im „Kapital“ beschrieb, in jeder ökonomischen Krise zu thematisieren, die den vermeintlich friedlich-normalen Akkumulationsprozess regelmäßig begleitet.
Hier konzentriert sich auch der entschei-dende Unterschied zu Freuds Mythologie des kollektiven Mordes am despotischen „Urvater“. Die andauernde Verdrängungsleistung gilt Karatani zufolge nicht einer Gräueltat, son-dern einem Ideal, der „durch die Sesshaftigkeit
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 6 04.12.2014 07:13:21
7Ein japanischer Hegel?
verloren gegangene[n] Nomadenhaftigkeit (Freiheit)“ (57). In dieser eigenwilligen Figur der Wiederkehr trifft die Unabgegoltenheit eines gerade im Verlust präsenten Freiheits-versprechens auf die konkreten Versuche von dessen Rettung im Reich der religiösen bzw. emanzipativen Vorstellungskraft. Ihre histo-rische Gestalt findet diese Wiederkehr in der „Universalität der Universalreligionen“ (127). Die Universalreligionen leben substantiell vom Protest gegen den Zustand einer Welt, die von Ausbeutung und Herrschaft, Reichtum und Klassengesellschaft, Geldwirtschaft und Privatbesitz geprägt ist.
Gleichzeitig zeichnet Karatani die Ver-knüpfung der religiösen Ideen mit den herr-schenden Austauschformen nach. Während mit der „Revolution der Sesshaftigkeit“ der Animismus der Nomaden in ein System von „Ahnengöttern“ (50) übergeht und sämtliche Austauschprozesse zwischen Menschen, Toten, Tieren und Umwelt in die lückenlose Matrix der Reziprozität eingeflochten sind, etablieren sich erst mit dem Bruch zur Austauschform B personale Gottheiten: Die Eigenwilligkeit und religiöse Transzendenz der Götter reflektiert die systemische Transzendenz der entste-henden Staatsgebilde. Dass im Bildhaushalt der Religion auch widerständige Momente enthalten sind, zeigt sich schließlich im histo-rischen Durchbruch der Monotheismen und ihrem Spannungsverhältnis zu den weltlichen Gegebenheiten.
Insbesondere das Christentum – „Die ‚Sünde‘ besteht im Privatbesitz selbst“ (121) – erfährt eine ketzerische Aufwertung, aber auch die ethischen und exemplarischen Propheten einer neuen Lebensführung namens Moham-med, Buddha, Konfuzius oder Laotse. Diese Ausführungen ähneln stark Karl Jaspers „Ach-senzeit“ (125 f.). Aber diese Erinnerung muss nicht von Nachteil sein, da sie an die im Westen weitgehend verlorengegangene Erkenntnis der subversiven Genealogie der Religionen an-knüpft. Eine bemerkenswerte Tatsache, obwohl der politische Kampf zwischen Priestern und Propheten, zwischen Klerikern und Laien über Max Weber doch auch Eingang in die kritische Theorie gefunden hat. Die Universalreligion verkapselt die idealtypische Gestalt einer von
Gleichheit und Reziprozität bestimmten Ver-gemeinschaftung: „Ihre dekonstruierende Kraft ging zu keiner Zeit ganz verloren.“ (128) Ohne diesen Gedanken konsequent zu entwickeln, sieht Karatani diese „Kraft“ in den nicht näher beschriebenen „sozialen Bewegungen“ der Gegenwart neu verkörpert.
Die Wiederkehr des Verdrängten, in der sich Facetten des Vergessenen, Unterschla-genen, Besiegten, Nichtaufgearbeiteten und Möglichen verbinden, findet sich aber auch in Politik und Ökonomie. Karatani spricht von der „Struktur der Wiederholung“ bzw. der „strukturellen Wiederholung“ (214). Für die politische Arena greift er auf das berühmte Marx-Zitat von der „Tragödie“ und der „Farce“ zurück, wenn Regimewechsel, etwa von der Französischen Revolution zu Napoleon (215), in modifizierter Form an ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Für die Struktur der kapitalis-tischen Ökonomie gilt ähnliches, wenn sich der Fall der Profitraten in historisch neuen Krisenszenarien niederschlägt. Strukturelle Wiederholung heißt aber auch, dass sich stets neue Möglichkeitsfenster öffnen, das Unerledig-te in Angriff zu nehmen. Karatani sieht so eine „Ähnlichkeit und Zyklizität zwischen 1848 und 1968“ (17, Anm. 2., 14ff., 237f.). Sie scheitern am fehlenden Verständnis für die KNS-Ringe, behalten aber eine überragende Bedeutung als globale Versuche einer universellen Befreiung. In dieser Hinsicht waren sie als „‚gleichzeitige Weltrevolution‘ der führenden Länder“ (210, 235) ein programmatischer Wurf in die Zukunft. Wenn eines für Karatani passé ist, dann die Vorstellung von der Revolution in einem Land.
Kants Idee der „Weltrepublik“ dient hier als regulativer Wegweiser. Karatani liest Kant als einen radikal politischen und zeitgenössi-schen Autor. Hierzulande zum kategorischen Moralapostel gestutzt wird die Kantsche Forderung, den Menschen niemals bloß als Mittel, sondern jederzeit zugleich als Zweck zu verstehen, zu einem Ökonomie und Politik umwälzenden performativen Akt: zu einem Plädoyer für Austauschgerechtigkeit und das Ende des Nationalstaats. Die „Weltrepublik“ als regulative Idee beinhaltet die Pflicht zur „Verwirklichung von Produktionsverhältnissen (einer Austauschform), die keine Ungleichheit
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 7 04.12.2014 07:13:21
8 Ulrich Brieler, Axel Rüdiger, Florian Heßdörfer
des Reichtums erzeugen“ (192f.), und zur Etablierung internationaler Beziehungen von Gleichrangigen. Weltrepublik meint daher nicht „Weltstaat“, sondern „Entwurf eines ‚Föderalis-mus freier Staaten‘ (Kant)“ (239), mithin eine „Aufhebung des Staates“ (242), die mit einem grundlegenden Gewaltverzicht beginnen muss.
Dieses gewaltige weltgeschichtliche Pan-orama verliert an Kraft, wenn Karatani sich ins politische Handgemenge der Gegenwart begibt. So plädiert er zum einen, unter völliger Absehung von der Produktionssphäre, für das absolute Primat des kritischen Konsumenten, eine Position, benachbart der „Subpolitik“ Ulrich Becks und dessen „Einkaufswagen als Wahlurne“.5 Zum anderen träumt er von einer Reform der UNO, die sich von der Hegemonie der Großstaaten zu einem Bündnis gleichbe-rechtigter Staaten entwickeln soll. Sein eigener Anspruch, dass dem vermeintlichen „Ende der Geschichte“ mithilfe einer kollektiven Anstren-gung der in den „KNS-Ringen“ gebundenen „Einbildungskraft“ begegnet werden müsse (18f.), zeigt in der Blässe dieser Umsetzung den Umfang der Herausforderung: „Heutzutage ist die Einbildungskraft, die zum Durchbrechen der KNS-Ringe nötig wäre, nicht mehr vor-handen.“ (19) Mag diese Einbildungskraft als positive auch nicht vorhanden sein, so deuten gerade die schwächeren Momente seiner po-litischen Argumentation auf die eigentlichen Stärken der wissenschaftlichen Arbeit an der Einbildungskraft: die Arbeit an ihren Grenzen, die Kritik an jenem Bann, den die vermeintlich übergeschichtlichen Größen von Staat, Nation und Kapital ausüben.
Was Slavoj Žižek in einer großen Bespre-chung von Karatanis „Transcritique“ als Frage aufgeworfen hatte, ob nämlich das Buch „der Versuch ist, Arbeiter in ihren beiden Sphären (als Produzenten-Konsumenten) als gleich-berechtigt darzustellen oder den Consumer zu favorisieren?“6, kann nun beantwortet werden. Karatani gibt in der „Weltrepublik“ die in „Transcritique“ so fruchtbare Parallaxe der politischen Ökonomie wieder preis, indem er die unentscheidbare Antinomie zwischen Produktion und Zirkulation ganz undialektisch einseitig zugunsten der letzteren auflöst. Mit der Konzentration auf den Zirkulationssektor
führt Karatani exakt die Trennungen erneut ein, die er am Basis-Überbau-Dilemma beklagt. Falsche Alternativen werden nicht aufgehoben, sondern ins Extrem ausbuchstabiert.
Karatani übersetzt sicherlich auch konkrete politische Erfahrungen der Organisation eines libertären Konsumentenprojekts. Gemeinsam mit gleichgesinnten Intellektuellen gründete er im Jahr 2000 die „New Associationist Move-ment (NAM)“. Seiner Annahme vom Arbeiter als Produzenten und Konsumenten folgend ging es darum, Produzenten- und Konsu-mentengenossenschaften mit eigenen lokalen Währungs- und Kreditsystemen zu initiieren. So wie im großen globalen Kontext müsse auch im Kleinen und Lokalen, innerhalb des Systems und zugleich in alternativen Räumen – einem „Außen“ –, gehandelt werden. Die NAM war als ein konkretes Pendant zum Transcritique-Raum zu lesen, in dem eine ständige Zirkulation zwischen einander nicht kompatiblen, nicht aufeinander reduzierbaren bzw. nicht in einem Dritten aufhebbaren Positionen stattfindet.
Zwar löste sich die NAM bereits 2003 wieder auf, doch hat sie Karatanis Grundeinsichten nicht erschüttert. „Auf der Suche nach der Weltrepublik“ verarbeitet diese Erfahrungen der NAM, indem die Austauschform des Assoziationismus nicht mehr fixiert in kon-kreten Organisationen gefasst wird, sondern als regulative Idee, die allen Versuchen, ein freie Gesellschaft zu erfinden, gemein ist. Gleichzeitig führt sie aber zur Radikalisierung des Konsumentenstandpunkts. Anstatt Marx‘ Arbeitswertlehre aus der Perspektive der di-alektischen Antinomie von esoterischen und exoterischen Momenten zu problematisieren, wird sie in pauschal verabschiedet (85), um die Austauschsphäre umso heller leuchten zu lassen. Die anfangs postulierte ‚Wiederholung‘ der Kategorie der „Verkehrsverhältnisse“ (32ff.) – einer Begrifflichkeit, deren sich der junge Marx bediente – zielt damit ins Leere. Statt die räumliche Dimension als ‚einen’ Faktor der Wertbestimmung zu fixieren, wird die räumliche Distanz zur entscheidenden Größe.
Einige der Distanz zur europäischen Ge-schichte geschuldete Detailverschnitte kommen hinzu: Louis Bonaparte wird zum Sozialisten (16), 1848 zur Geburtsstunde des Wohlfahrts-
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 8 04.12.2014 07:13:21
9Ein japanischer Hegel?
staates (17), der Faschismus zum verkappten „Anarchismus“ (212), die Europäische Union zu einer besonderen Figuration im globalen „Großraumstaat“ (224). Die Eigentumsfra-ge spielt mit einer kleinen Ausnahme (81) nahezu keine Rolle. Žižeks Fazit von 2004 – „Karatanis Buch ist ein Muss für alle, die den toten Punkt des ‚kulturellen‘ Widerstands gegen den Kapitalismus überwinden und die Aktualität von Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie bekräftigen wollen“7 – gilt also für das vorliegende Buch nur eingeschränkt. Denn bei aller spekulativen Phantasie laufen die Austauschformen und die KNS-Ringe Gefahr, zu übergeschichtlichen Supersubjekten zu werden – Hegelsche Weltgeister, in neuer Gestalt immer wieder auftauchend. Die tran-szendentale Geschichtsbetrachtung stößt an Grenzen, agieren diese Subjekte doch frei in Zeit und Raum. Wenn dieser Materialismus nicht mehr ganz die Höhe von „Transcritique“ erreicht, aber dennoch anregender erscheint als zeitgenössische Marx-Lektüren, die einen farcenhaften Ökonomismus plagiieren oder vor dem Wertgesetz als letzter Wahrheit niederknien, so weil er theoretisch ungemein einfallsreich und großzügig ist. Den Verlust an „Einbildungskraft“, den Karatani für die Jahre nach der epochalen Wende 1989 be-hauptet (19), kann man ihm nicht vorwerfen. Er spricht zudem eine ungekränkelte Sprache: Ausbeutung, Revolution, Kapital, im Westen nur noch sagbar unter elenden Verrenkungen und Entschuldigungen, hier werden sie beim Namen genannt.
Renaissance der großen Erzählung
Karatanis Buch, wie sein gesamtes Werk, be-richtet von der überraschenden Renaissance der Geschichtsphilosophie. Diese paradoxe Wiederkehr nach Fukuyamas Hegelianischem Bannspruch vom „Ende der Geschichte“ findet bisher vornehmlich aus amerikanischen Uni-versitäten in die Welt. In evolutionsgeschicht-lich angelegten Erzählungen, etwa bei Steven Pinker8 oder Ian Morris9, deren Bücher mit enormem medialem Aufwand in die globale Öffentlichkeit geschossen werden, findet sich
eine bestimmte, eingängigen Kriterien folgende Grammatik der Geschichte.
An erster Stelle werden enorme statistische Datenmengen unterschiedlichster Couleur präsentiert, die, vulgärpsychologisch und neurobiologisch verifiziert, in der Feier des zeitgenössischen Status quo ihr Ziel finden. Keiner dieser Autoren unterzieht sich der Mühe der konkret-historischen Analyse der Gesellschaftsformationen. Zweitens sind die Handlungssubjekte dieser Narrative stets un-reflektierte Kollektivsingulare: natürlich „die“ Menschheit, „der“ Staat oder „der“ Krieg. Dies verbindet sich drittens mit einem vorkritischen Anthropologismus, der uns tatsächlich das „Tier in uns“ (Morris) oder „fünf innere Dämonen“ (Raub, Machtstreben, Rache, Sadismus, ideo-logische Verblendung) und „vier bessere Engel“ (Empathie, Selbstbeherrschung, Moralgefühl, Vernunft), so bei Pinker, als historisch invari-ante humane Grundausstattung präsentiert, selbstverständlich optimaler zu zähmen und verhaltensökonomisch zu regulieren. Und viertens enden diese postmodernen Geschichts-philosophien stets in der Hegelschen Pointe, dass alles gut wird, wenn es nicht schon so ist. Pinkers „These von der abnehmenden Gewalt“ und Morris‘ „Pax technologica“, leider nur durch einen letzten globalen Krieg zu erreichen, dürfen daher damit rechnen, die erste wirkliche Ideologie des Empire zu werden.
Karatanis Geschichtsphilosophie nimmt dagegen den ursprünglichen Impuls Hegels auf, aus der empirischen Masse der Gattungs-geschichte jene Elemente und Tendenzen zu filtern, die einem zukünftigen besseren Zu-stand beste Argumente liefern. Sie ist keine Affirmation, sondern Kritik einer Welt, in der das Verhältnis von Herr und Knecht weiter fortdauert. Damit unterscheidet sich Karatani auch von positivistischen Globalgeschichten der Gegenwart auf signifikante Weise; zu nennen wären John Darwin10 oder Christopher A. Bayly11, die eine moderne Geschichte der westlichen Landnahme der Welt unter Einbe-ziehung der asiatischen Großreiche darstellen,. Karatani begreift die Gattungsgeschichte als eine globale Aktivität. Auch die früheste Form menschlicher Gemeinschaft, der Verband der Jäger und Sammler, lebte in einer „Welt“.
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 9 04.12.2014 07:13:21
10 Ulrich Brieler, Axel Rüdiger, Florian Heßdörfer
Weltgeschichte existiert vom „ersten“ Moment an, „Assoziation“ ist das historische Schicksal der Gattung. Diese Geschichte mag vieles sein, aber sie ist keineswegs „zu Ende“.
Bei allen Problemen: „Auf der Suche nach der Weltrepublik“ bleibt selbst eine intellektuelle Gabe, ein Buch voller unkonventioneller Gedan-kenblitze und theoretischer Donnerwetter, wie Karatanis Werk insgesamt, das darauf wartet, gelesen zu werden.
Anmerkungen
1 Einen ersten Überblick über Karatanis Werg gibt Steffi Richter: Karatani Kōjin, in: Matthias Middell, Ulf Engel (Hg.): Theoretiker der Globalisierung, Leipzig 2010, 289-306.
2 Karatani Kōjin: Transcritique. On Kant und Marx, Cambridge, MA 2003
3 Karatani Kōjin: Auf der Suche nach der Weltre-publik. Eine Kritik von Kapital, Nation und Staat,
Leipzig 2013. Alle Zitate entstammen dieser Ausgabe.
4 Ètienne Balibar: Der Schauplatz des Anderen. Formen der Gewalt und Grenzen der Zivilität, Hamburg 2006, 11.
5 Ulrich Beck: Und jetzt, Herr Beck? Gespräch mit Jakob Schrenk, in: Heinrich Geiselberger (Hg.): Und jetzt? Politik, Protest und Propaganda, Frankfurt a.M. 2007, 231-248.
6 Slavoj Žižek: The Parallax View, in: New Left Review, 25 (2004), 121-134, hier: 124.
7 Žižek, a.a.O., 134.8 Steven Pinker: Gewalt. Eine neue Geschichte der
Menschheit, Frankfurt a.M. 2011.9 Ian Morris: Wer regiert die Welt? Warum Zivi-
lisationen herrschen oder beherrscht werden, Frankfurt a.M., New York 2011; ders.: Krieg. Wozu er gut ist, Frankfurt a.M., New York 2013.
10 John Darwin: Der imperiale Traum. Die Global-geschichte großer Reiche 1400–2000, Frankfurt a.M., New York 2010.
11 Christopher A. Bayly: Die Geburt der modernen Welt. Eine Globalgeschichte 1780–1914, Frankfurt a.M., New York 2006.
2014-4 Rez Brieler Rüdiger Hessdörfer.indd 10 04.12.2014 07:13:21