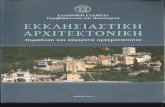ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό...
Transcript of ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό...
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................................................................ 11
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ............................................................................................................................ 13
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................................................................. 311. Αντικείµενο της µελέτης ................................................................................................................ 312. Ιστορία της έρευνας ....................................................................................................................... 323. Γεωγραφικό και χρονολογικό πλαίσιο της µελέτης. Δοµή και περιεχόµενο της εργασίας ............ 334. Πηγές .............................................................................................................................................. 35
4.1 Η αρχαία γραµµατεία .............................................................................................................. 354.2 Το επιγραφικό υλικό ............................................................................................................... 364.3 Η αττική αγγειογραφία ........................................................................................................... 384.4 Τα έργα γλυπτικής από γυµνάσια ........................................................................................... 384.5 Οι ελληνιστικές επιτύµβιες στήλες ......................................................................................... 384.6 Τα ανάγλυφα τύπου Campana ................................................................................................ 394.7 Η διακόσµηση των ρωµαϊκών επαύλεων ............................................................................... 394.8 Η διακόσµηση των θερµών .................................................................................................... 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΤO ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΩΣ ΘΕΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΣ AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΗΜΑ ......................... 41
1. O θεσµός ........................................................................................................................................ 411.1 Οἱ φοιτῶντες εἰς τὸ γυµνάσιον ................................................................................................ 421.2 Στόχοι και περιεχόµενο της γυµνασιακής εκπαίδευσης ......................................................... 451.3 Διοίκηση και οικονοµική διαχείριση του γυµνασίου. Το αξίωµα του γυµνασιάρχου ............. 471.4 Άλλοι αξιωµατούχοι και προσωπικό του γυµνασίου .............................................................. 491.5 Διδάσκαλοι ............................................................................................................................. 501.6 Εορτές και αγώνες ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας ................................................ 501.7 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 53
2. Το αρχιτεκτόνηµα .......................................................................................................................... 542.1 Ο αρχιτεκτονικός τύπος .......................................................................................................... 542.2 Οι χώροι του γυµνασίου ......................................................................................................... 572.3 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 60
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙIΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΘΕΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ................................ 61
1. Λατρείες στο γυµνάσιο .................................................................................................................. 612. Αγαλµατικοί τύποι: εικονογραφία και περιεχόµενο ....................................................................... 71
2.1 Ερµής ...................................................................................................................................... 73
!"#$"%&'"()
7
2.2 Ηρακλής .................................................................................................................................. 792.3 Έρωτας ................................................................................................................................... 862.4 Απόλλωνας ............................................................................................................................. 912.5 Θησέας και Αχιλλέας .............................................................................................................. 94
3. Ερµαϊκές στήλες: εικονογραφία και περιεχόµενο .......................................................................... 993.1 Ερµαϊκές στήλες κανονικού τύπου µε κεφαλή γενειοφόρου Ερµή ........................................ 1023.2 Ερµαϊκές στήλες κανονικού τύπου µε αγένειες κεφαλές ....................................................... 1073.3 Ερµαϊκές στήλες µε ηµίτοµο Ερµή (γενειοφόρο ή αγένειο) .................................................. 1133.4 Ερµαϊκές στήλες κανονικού τύπου µε κεφαλή γενειοφόρου Ηρακλή .................................... 1143.5 Ερµαϊκές στήλες µε ηµίτοµο Ηρακλή .................................................................................... 1143.6 Αµφιπρόσωπες ερµαϊκές στήλες ............................................................................................ 1163.7 Eρµαϊκές στήλες γυναικείων θεοτήτων .................................................................................. 1173.8 Ερµαϊκές στήλες µε εικονιστικές κεφαλές ............................................................................. 117
4. Ανακεφαλαίωση: η λειτουργία των γλυπτών ................................................................................. 1194.1 Λατρευτική λειτουργία ........................................................................................................... 1194.2 Τα γλυπτά ως αναθήµατα ....................................................................................................... 122
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙIΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ ΘΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ................................................... 127
1. Μονάρχες ....................................................................................................................................... 1301.1 Ατταλίδες ................................................................................................................................ 1311.2 Πτολεµαίοι .............................................................................................................................. 1381.3 Άλλοι µονάρχες ...................................................................................................................... 1401.4 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 140
2. Αξιωµατούχοι και άλλοι ευεργέτες ................................................................................................ 1412.1 Αξιωµατούχοι και άλλοι ευεργέτες του γυµνασίου ................................................................ 1412.2 Άλλα πρόσωπα της πολιτικής και στρατιωτικής ζωής ........................................................... 1492.3 Το είδος και η εικονογραφία των τιµητικών εικόνων ............................................................. 1502.4 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 153
3. Αθλητές .......................................................................................................................................... 1533.1 Οι γραπτές µαρτυρίες ............................................................................................................. 1553.2 Τα γλυπτά έργα ....................................................................................................................... 1573.3 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 160
4. Ήρωες ............................................................................................................................................ 1614.1 Ενταφιασµοί στο γυµνάσιο ..................................................................................................... 1634.2 Μεταθανάτια αγάλµατα .......................................................................................................... 1654.3 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 172
5. Προσωπικότητες του πνεύµατος .................................................................................................... 1725.1 Αγάλµατα φιλοσόφων στα αθηναϊκά γυµνάσια ..................................................................... 1735.2 Το άγαλµα του νοµοθέτη Λυκούργου στον Πλατανιστά της Σπάρτης ................................... 1795.3 Ιστοριογράφοι ......................................................................................................................... 1795.4 Ποιητές ................................................................................................................................... 1805.5 Ανακεφαλαίωση ...................................................................................................................... 184
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙVΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΤΟΥΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ......... 187
1. Θέσεις ίδρυσης γλυπτών στους επιµέρους χώρους του γυµνασίου ............................................... 1871.1 Είσοδοι του κτηρίου και των αιθουσών της παλαίστρας ....................................................... 1871.2 Αυλή και περιστύλιο της παλαίστρας ..................................................................................... 1891.3 Αίθουσες της παλαίστρας ....................................................................................................... 1901.4 Ξυστός και παραδροµίς .......................................................................................................... 192
2. Χώροι λατρείας .............................................................................................................................. 193
8 εἰκόνες ἐν γυµνασίῳ – ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
3. Θέσεις ίδρυσης τιµητικών ανδριάντων .......................................................................................... 1964. Η σχέση των γλυπτών µε το αρχιτεκτόνηµα: νεοτερισµοί της ύστερης ελληνιστικής περιόδου ... 198
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ .................................................................................. 203
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ......................................................................................................................................... 211Μέθοδος παρουσίασης ........................................................................................................................... 211Ι. Αττική ................................................................................................................................................... 213
1. Αθήνα, Ἀκαδήµεια ......................................................................................................................... 2132. Αθήνα, Κυνόσαργες ....................................................................................................................... 2143. Αθήνα, Λύκειον ............................................................................................................................. 2144. Αθήνα, Πτολεµαῖον ....................................................................................................................... 2155. Αθήνα, Διογένειον ......................................................................................................................... 2176. Ραµνούς ......................................................................................................................................... 217
ΙΙ. Πελοπόννησος .................................................................................................................................... 2187. Τροιζήνα, Ἱππολύτειον .................................................................................................................. 2188. Κόρινθος, γυµνάσιο στην αγορά ................................................................................................... 2199. Σικυώνα, γυµνάσιο στην αγορά (γυµνάσιο του Κλεινία;) ............................................................ 21910. Σικυώνα, Παιδιζήν ........................................................................................................................ 22211. Πελλήνη ........................................................................................................................................ 22212. Ήλιδα, Ξυστός, Τετράγωνο και Μαλθώ ......................................................................................... 22213. Ολυµπία ........................................................................................................................................ 22314. Φιγάλεια ........................................................................................................................................ 22715. Μεγαλόπολη ................................................................................................................................. 22816. Άργος, Κυλάραβις ......................................................................................................................... 22817. Άργος, γυµνάσιο στην αγορά ........................................................................................................ 22818. Σπάρτη, δρόµος και γυµνάσιο του Ευρυκλή ................................................................................. 22819. Σπάρτη, Πλατανιστάς .................................................................................................................... 22920. Λας ................................................................................................................................................ 23021. Μεσσήνη ....................................................................................................................................... 230
ΙΙΙ. Kεντρική Ελλάδα ............................................................................................................................. 24322. Μέγαρα ......................................................................................................................................... 24323. Θήβα, γυµνάσιο του Ηρακλή ........................................................................................................ 24324. Θήβα, γυµνάσιο του Ιολάου ......................................................................................................... 24425. Θεσπιές ......................................................................................................................................... 24426. Θίσβη ............................................................................................................................................ 24427. Ορχοµενός ..................................................................................................................................... 24428. Δελφοί ........................................................................................................................................... 24429. Χαλκίδα, γυµνάσιο του Ηρακλή ................................................................................................... 24730. Ερέτρια .......................................................................................................................................... 24831. Λαµία ............................................................................................................................................ 25232. Δηµητριάδα ................................................................................................................................... 25333. Αντίκυρρα, ἀρχαῖον και νεότερο γυµνάσιο ................................................................................... 25334. Λάρισα .......................................................................................................................................... 25435. Τύρναβος (Περραιβία) .................................................................................................................. 254
IV. Mακεδονία ........................................................................................................................................ 25536. Θεσσαλονίκη ................................................................................................................................. 25537. Αµφίπολη ...................................................................................................................................... 255
V. Νησιά του Αιγαίου ............................................................................................................................. 26938. Δήλος, παλαίστρα της λίµνης ....................................................................................................... 26939. Δήλος, γυµνάσιο δίπλα στο στάδιο ............................................................................................... 27240. Τήνος ............................................................................................................................................. 282
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 9
41. Παλαιόπολη (Άνδρος) ................................................................................................................... 28342. Κόρησσος (Κέως) ......................................................................................................................... 28343. Πάρος ............................................................................................................................................ 28444. Σίφνος ........................................................................................................................................... 28445. Μινώα (Αµοργός) ......................................................................................................................... 28446. Αιγιάλη (Αµοργός) ........................................................................................................................ 28547. Μήλος ........................................................................................................................................... 28648. Θήρα ............................................................................................................................................. 28949. Μυτιλήνη (Λέσβος) ...................................................................................................................... 29250. Μήθυµνα (Λέσβος) ....................................................................................................................... 29251. Ερεσός (Λέσβος), Πτολεµαῖον ...................................................................................................... 29252. Χίος, ῾Οµήρειον ............................................................................................................................. 29253. Σάµος ............................................................................................................................................ 29354. Πάτµος .......................................................................................................................................... 29555. Αστυπάλαια ................................................................................................................................... 29556. Κως, δυτικό γυµνάσιο (γυµνάσιο δίπλα στο στάδιο) .................................................................... 29657. Κως, γυµνάσιο στο λιµάνι (;) ........................................................................................................ 29758. Ρόδος, γυµνάσιο στην ακρόπολη .................................................................................................. 29959. Ρόδος, κάτω γυµνάσιο (Πτολεµαῖον;) ........................................................................................... 303
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ......................................................................................................................................... 30460. Πέργαµος ...................................................................................................................................... 304
ZUSAMMENFASSUNG ........................................................................................................................ 315
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ ....................................................................................................................... 323Α. Ιδεαλιστικά έργα: ερµαϊκές στήλες και αγάλµατα θεών ............................................................... 323
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Ιδρυτές: αξιωµατούχοι των γυµνασίων .................................................................. 323ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ. Ιδρυτές: διδάσκαλοι .............................................................................................. 325ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ. Ιδρυτές: σύλλογοι των γυµνασίων (µε τους αξιωµατούχους τους) ..................... 325ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV. Ιδρυτές: νικητές σε αγώνες .................................................................................. 325ΠΙΝΑΚΑΣ V. Ιδρυτές: ιδιώτες (χωρίς αναφορά της ιδιότητάς τους) ........................................... 326
Β. Εικονιστικά έργα: ανδριάντες και γραπτές εικόνες ηγεµόνων, αξιωµατούχων των γυµνασίωνκαι άλλων ευεργετών .................................................................................................................... 326ΠΙΝΑΚΑΣ VI. Ιδρυτές: αξιωµατούχοι των γυµνασίων ............................................................... 326ΠΙΝΑΚΑΣ VII. Ιδρυτές: σύλλογοι των γυµνασίων ..................................................................... 327ΠΙΝΑΚΑΣ VIII. Ιδρυτές: σύλλογοι των γυµνασίων από κοινού µε αξιωµατούχους τους ή συλλογικά όργανα των πόλεων ............................................................................................ 328
ΠΙΝΑΚΑΣ IΧ. Ιδρυτές: συλλογικά όργανα των πόλεων ............................................................. 328ΠΙΝΑΚΑΣ Χ. Ιδρυτές: ιδιώτες ..................................................................................................... 328
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ........................................................................................................................................... 331I. Ευρετήριο αρχαίων συγγραφέων .................................................................................................. 331II. Ευρετήριο επιγραφών ................................................................................................................... 333III. Ευρετήριο τόπων ........................................................................................................................... 339IV. Ευρετήριο µουσείων και συλλογών .............................................................................................. 341V. Γενικό ευρετήριο όρων και ονοµάτων .......................................................................................... 346
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ EIKONΩΝ .................................................................................. 353
ΠΙΝΑΚΕΣ ................................................................................................................................................ 355
10 εἰκόνες ἐν γυµνασίῳ – ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΖUSAMMENFASSUNG
Skulpturenausstattung im hellenistischen GymnasionGriechisches Festland und Inseln der Ägäis
315
Antike Bildwerke besaßen bekanntermaßen konkrete
Funktionen, die eng mit den religiösen, politischen
und gesellschaftlichen Aktivitäten der Polis verbunden
waren. Die Aussage einer antiken Skulptur wird primär
durch ihr Thema und die Art ihrer Wiedergabe be-
stimmt, d. h. durch die Auffassung der ikonographi-
schen Konzeption. Ihre zu vermittelnde „Botschaft“
wird zusätzlich durch die programmatische Einglie-
derung der Skulpturen in einen erweiterten Kontext,
d. h. durch die Bestimmung ihres Aufstellungsortes,
konkretisiert. Der Standort, aber auch die Repräsen-
tationsweise der Bildwerke tragen aktiv zum Dialog
zwischen einem Werk und seinem Betrachter bei, da
sie den Inhalt des Werkes selbst unterstreichen. Das
Studium der antiken Skulpturen als Bildträger, die in
Bauwerke mit spezifischen Funktionen eingegliedert
sind, ist eines der heutigen Ziele bei der Erforschung
antiker Skulptur. Insbesondere werden durch ihre Be-
trachtungsweise im Zusammenhang mit den öffentli-
chen städtischen Bauwerken, die im Grunde den ar-
chitektonischen Rahmen der staatlichen Institutionen
einer Polis bilden, die vielfältigen historischen, poli-
tischen, sakralen und gesellschaftlichen Dimensionen
der Skulpturenaufstellung innerhalb des öffentlichen
Lebens deutlich vor Augen geführt.
Bis heute wurde in der Forschung wiederholt auf
die Notwendigkeit einer umfassenden Analyse der
Skulpturen, mit denen die hellenistischen Gymnasia
ausgestattet waren, hingewiesen. Ziel der vorliegenden
Dissertation ist die Zusammenstellung der Skulpturen,
die aus Gymnasia griechischer Städte stammen, um
die spezifische Rolle dieser Skulpturen im Rahmen
der gymnasialen Institution zu erforschen. Im Katalog
werden erstmals etwa 300 schriftliche und archäolo-
gische Zeugnisse systematisch erfasst, die sich auf die
Aufstellung von Skulpturen in 60 Gymnasia auf dem
griechischen Festland und den Inseln der Ägäis bezie-
hen. Die philologischen, epigraphischen und archäo-
logischen Quellen werden für jedes Gymnasion ge-
sondert vorgestellt. Durch diese Methode ist es mög-
lich, die Skulpturen als einen in sich geschlossenen
Fundkomplex im Kontext des jeweiligen Bauwerks
zu betrachten, und damit werden zugleich die neuesten
Forschungsergebnisse jedes einzelnen Gymnasions als
Bauwerk vorgestellt. Einige der im Katalog aufgeführ-
ten Skulpturen werden hier zum ersten Mal ausführlich
besprochen und der Forschung zugänglich gemacht.
Aus technischen Gründen mussten die im Katalog
aufgenommenen Gymnasia auf den geographischen
Raum beschränkt bleiben, der heute dem des moder-
nen griechischen Staates entspricht. Die Zeugnisse aus
den Gymnasia der griechischen Städte Kleinasiens,
Zyperns und Großgriechenlands konnten im Text der
Arbeit nur insoweit berücksichtigt werden, als sie be-
reits bibliographisch erfasst sind.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf dem Helle-
nismus. Bei der Skulpturenaufstellung in den Gymna-
sia sind einige neuere Tendenzen zu beobachten, deren
Ursprung auf die späthellenistische Zeit zurückgeht,
die aber in den uns zur Verfügung stehenden Quellen
erst in der frühen Kaiserzeit stärker ausgeprägt sind.
Deshalb beziehen wir uns bei der Untersuchung von
Detailfragen oft auch auf Monumente der frühen Kai-
serzeit. Allerdings entwickelte sich die Funktion der
Gymnasia im Laufe der ersten kaiserzeitlichen Jahr-
zehnte weiter, ohne dass bereits gravierende Verände-
rungen sichtbar wurden. Die ersten einschneidenden
Änderungen hinsichtlich der Funktion, aber auch der
Bedeutung des Gymnasions als Institution innerhalb
der Polis, sind zunächst in den Städten Kleinasiens
und kurz darauf auch im übrigen griechischen Raum
etwa ab der Mitte des 1. Jhs. n. Chr. wahrzunehmen.
Sie betreffen Veränderungen, die sich in der baulichen
Vermischung von Gymnasia mit Thermenanlagen her-
auskristallisieren.
Im Text wird zunächst auf die Rolle des Gymnasi-
ons in der hellenistischen Stadt eingegangen, damit in
den folgenden Kapiteln die Funktionen der Skulpturen
innerhalb der Gymnasia verständlicher werden (Kap.
I). Da diese Frage in den letzten Jahren in der For-
schung intensiv und z. T. kontrovers diskutiert wurde,
ist unserer Meinung nach ein ausführlicherer Überblick
nötig, in dem unsere derzeitigen Kenntnisse von der
Funktion des hellenistischen Gymnasions als staatli-
cher Institution (Kap. I.1) und dem Bautypus des Gym-
nasions als Gebäude mit spezifischer Funktion (Kap.
I.2) zusammengefasst werden.
Das Gymnasion als Institution besteht mindestens
seit dem 6. Jh. v. Chr. Die Gymnasia bildeten Zentren
für eine gemeinschaftliche körperliche und militärische
Erziehung der Heranwachsenden einer Gemeinde. Ob-
wohl sich in der antiken Literatur zahlreiche und viel-
schichtige Berichte über das Gymnasion finden lassen,
sind grundsätzliche Fragen zu seiner Funktion im Hin-
blick auf die Gesamtheit der griechischen Städte
schwer zu beantworten. Die wesentlichen Fragen, die
uns beschäftigen, sind: An wen richtete sich die Insti-
tution des Gymnasions? Welche Zwecke erfüllte es?
Wie entwickelten sich diese im Laufe der Zeit?
Untersucht man die ständig zunehmenden Inschrif-
ten aus spätklassischer und vor allem hellenistischer
Zeit, lässt sich feststellen, dass die Funktion des Gym-
nasions nicht in allen seinen Aspekten in jeder grie-
chischen Polis gleich war und die Entwicklung der In-
stitution im Laufe der Zeit auch nicht einheitlich ver-
lief. Seine Zweckbestimmung, die Organisation und
Durchführung des Erziehungsprogrammes sowie die
Art der Administration und seiner finanziellen Unter-
stützung weisen nach unserem heutigen Kenntnisstand
lokale und zeitspezifische Besonderheiten auf. Dieses
Phänomen wird verständlich, wenn man es im Rahmen
der Autonomie untersucht, die jede Polis in der grie-
chischen Antike hinsichtlich ihrer spezifischen staat-
lichen, institutionellen, sakralen und gesellschaftlichen
Traditionen besaß. Das Gymnasion scheint jedenfalls
seit dem 4. Jh. v. Chr. in vielen Städten eine organi-
sierte Institution in dem Sinne gewesen zu sein, dass
seine Nutzung von bestimmten Regeln durchzogen
war, die im Rahmen offizieller Anordnungen systema-
tisiert und bestimmt worden waren. Bereits ab der Mit-
te des 4. Jhs. v. Chr. werden in unseren Quellen ver-
schiedene Aspekte seiner institutionellen Funktion
deutlich, die auf der Grundlage der bisherigen For-
schungsergebnisse für die hellenistische Zeit nur all-
gemein zu umreißen ist. Die Administration und wirt-
schaftliche Verwaltung übernahmen gewählte Amts-
träger der Polis, in der Regel die Gymnasiarchen, die
ihr Amt ἐκ τῶν ἰδίων gewöhnlich für ein Jahr ausübten.
Unter ihrer Leitung beteiligten sich am Betrieb des
Gymnasions auch Personen mit spezifischen Zustän-
digkeiten, wie die ὑπογυμνασίαρχοι, die παιδονόμοι
u.a. Zur finanziellen Unterstützung der Gymnasia
konnten auch je nach Epoche verschiedene Euergetai,
Hegemonen oder wohlhabende Bürger beitragen. Die
Erziehungsziele waren auf die männlichen Nachkom-
men freier Bürger ausgerichtet. Diese wurden aufgrund
ihres Alters in verschiedene Stufen eingeteilt, die ge-
mäß den jeweiligen Bedingungen, je nach Stadt und
Epoche variabel (grundsätzlich aber nach παῖδες,
ἐφήβοι und νέοι), festgelegt waren. Die Zeiten, zu de-
nen das Gymnasion als Erziehungsanstalt betrieben
wurde, waren festgelegt, und sein Zugang wurde wäh-
rend des Erziehungsbetriebes kontrolliert.
Die athletischen und – in Erweiterung – die mili-
tärischen Fähigkeiten sowie Tugenden der Disziplin
und des Fleißes blieben, wie die heutige Forschung
gezeigt hat, beständig die maßgeblichen Werte der
Lehre in den hellenistischen Gymnasia. Lehrer mit ei-
ner speziellen Ausbildung, wie die παιδοτρίβαι und
die γυμνασταί, aber auch Erzieher für militärische
Übungen, übernahmen die Erziehung der Jugendli-
chen. Die sich eher aus den Umständen ergebende Ein-
gliederung eines geistigen Unterrichts (der Philoso-
phie, Rhetorik, aber auch anderer Wissenschaften) in
das Erziehungsprogramm der Gymnasia einiger Städte,
vor allem der ionischen Welt, ist erst ab der Mitte des
2. Jhs. v. Chr. belegt. Neben seinen pädagogischen Zie-
len wurde das Gymnasion jedoch im Laufe der Zeit
als Zentrum der Initiation der jugendlichen Mitglieder
in das politische Korps der Erwachsenen einer Stadt
betrieben. Die Knaben und jungen Männer, die im
Gymnasion unterrichtet wurden, kamen im Rahmen
der Festveranstaltungen, die dem Kult der Götter, He-
gemonen und Euergetai geweiht waren, mit den reli-
giösen Traditionen der Stadt und ihren politischen Sit-
ten in Berührung. Im Rahmen dieser Feste wurden
316 εἰκόνες ἐν γυμνασίῳ – ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
auch die regelmäßigen Wettkämpfe zur Kontrolle der
Leistungen derer, die im Gymnasion unterrichtet wur-
den, durchgeführt. Die Erziehungsziele des Gymna-
sions traten insbesondere bei den Wettkämpfen zum
Vorschein, die innerhalb der Gymnasia während der
Festverrichtung der Ἑρμαῖα ausgetragen wurden, eines
Festes, das auch das Ende des gymnasialen Jahres mar-
kierte. Daneben sind Feste zu Ehren auch anderer Göt-
ter bezeugt, die in verschiedenen Gegenden innerhalb
der Gymnasia verehrt wurden, wie z. B. die Ἡράκλεια,
die Ἐρωτίδεια und die Μούσεια, aber auch verschie-
dene lokale Feste, die gewöhnlich den Charakter von
Übergangsriten besaßen.
Die hellenistischen Gymnasia bildeten in der Regel
Baukomplexe, die die Palästra, den Xystos und die Pa-
radromis umfassten. Die Palästren waren in der Mehr-
zahl rechteckige Bauten mit einem Innenperistyl, um
das geschlossene oder mit einer Säulenstellung an der
Front versehene Räume angeordnet waren, die dem
Training, dem geistigen Unterricht oder als Baderäume
dienten. Der säulenhallenartige Bau des Xystos und
die nicht überdachte Paradromis waren für das Trai-
ning, besonders der Wettläufe, bestimmt.
In Kapitel II und in Kapitel III werden die Zeug-
nisse des Katalogs, aber auch andere entsprechende
Zeugnisse aus hellenistischen Gymnasia der übrigen
hellenistischen Welt ausgewertet. Die Ikonographie,
die Stifter, der Anlass und der Aufstellungsort der Bild-
werke bilden die Grundfragen für unseren Ansatz, an
diese Problematik heranzugehen. So können wir die
spezifischen Funktionen der Skulpturen als Kultsta-
tuen, persönliche oder gemeinschaftliche Weihungen,
Ehrenstatuen oder Siegesmonumente innerhalb der
hellenistischen Gymnasia untersuchen.
Zunächst werden die Schriftzeugnisse, durch die
wir der spezifischen Verehrung der Götter und Heroen
innerhalb der Gymnasia bis zu einem gewissen Grad
nachgehen können, zusammengestellt (Kap. II.1). Die
in Gymnasia verehrten Götter sind mit ihren verschie-
denen Eigenschaften an den betreffenden Beinamen
ersichtlich, die gewöhnlich mit den Idealen der gym-
nastischen Erziehung verbunden sind. Die Götter der
Palästra (κατά παλαίστραν) schlechthin waren Hermes
ἀγώνιος, ἐναγώνιος, δρόμιος, παλαιστρίτης, ἐπιτέρμιος
oder τύχων, aber auch λόγιος und Herakles ἐναγώνιος
oder ἐπινίκιος, aber auch μουσαγέτης. Mit ihnen zu-
sammen wurde oft auch Eros verehrt, der ebenfalls
in den späteren Quellen als ἐναγώνιος bezeichnet
wird. Die Verehrung dieser drei Gottheiten in den
Gymnasia ist bereits seit archaischer Zeit belegt. Ne-
ben ihnen wurden in einzelnen Fällen Apollon
λύκειος, μουσαγέτης und κιθαρωδός, Athena und die
Musen als Beschützerinnen der musischen Künste,
Aphrodite, die Göttin der Liebe, und die Heroen The-
seus und Achilles, panhellenische Vorbilder des idea-
len Epheben, verehrt. Mitunter findet man auch die
Verehrung allegorischer Gestalten als Verkörperung
von Jugend und Erziehungswerten. In verschiedenen
Gegenden wurden in den Gymnasia auch die Schutz-
gottheiten der Städte oder verschiedene lokale Gott-
heiten verehrt.
Im Folgenden gehen wir der Frage nach, auf wel-
che Weise sich der spezifische Inhalt der Göttervereh-
rung in der Ikonographie der Skulpturen widerspiegeln
konnte. Zunächst werden die rundplastischen Werke
(Kap. II.2) und danach die Hermen (Kap. II.3) unter-
sucht. Die Eigenschaften eines Gottes drücken sich
sprachlich durch kultische Beinamen und Adjektive
aus, wohingegen in der Bildkunst ihr Wesen oft durch
die Verwendung bestimmter ikonographischer Motive
sichtbar gemacht wird. Bei einigen beliebten klassi-
schen Statuentypen der beiden Götter, Hermes und
Herakles, die in römischen Kopien erhalten sind, wie
z. B. dem Typus des Hermes von Kyrene, dem Typus
des Hermes Richelieu oder dem Typus des Herakles
Lansdowne, dürften die Nacktheit in Verbindung mit
der deutlichen Wiedergabe der trainierten Muskeln
und die jugendliche Wiedergabe der bartlosen Köpfe
mit den geschwollenen Ohren – ein Kennzeichen vor
allem der Schwerathleten – als ikonographische Hin-
weise auf die Ideale des Athletentums und der Jugend
zu deuten sein. Als Symbole der ewigen Jugend dien-
ten vielleicht auch die goldenen Äpfel der Hesperiden
bei verschiedenen Heraklesstatuen, wie z. B. bei dem
bartlosen Herakles Lenbach, aber auch bei dem Hera-
kles Farnese. Es ist zwar kein Original bekannt, von
dem überliefert ist, dass es für die Aufstellung in einem
Gymnasion aus klassischer Zeit hergestellt wurde.
Dennoch ist davon auszugehen, dass die hellenisti-
schen Bildhauer, die an Aufträgen für Gymnasia ar-
beiteten, von klassischen Schöpfungen, die die athle-
tische Natur des Hermes und Herakles verkörperten,
inspiriert wurden, unabhängig davon, wo diese Vor-
bilder aufgestellt waren. In welcher Weise die Götter
in den hellenistischen Gymnasia dargestellt worden
waren, ist aufgrund der Zeugnisse, Schriftquellen oder
erhaltenen Werke nur in den wenigsten Fällen fest-
stellbar.
Kultstatuen des Hermes und des Herakles in Gym-
nasia gab es den Zeugnissen des Pausanias zufolge
(Kat. Nr. 10.Φ1 und 20.Φ1) wahrscheinlich schon seit
archaischer Zeit. Die gemeinsame Verehrung des Her-
ZUSAMMENFASSUNG 317
mes und des Herakles ist durch verschiedene Weihun-
gen kontinuierlich bezeugt, und ihre marmornen Kult-
gruppen sind in den Schriftquellen aus dem Gymna-
sion von Pergamon (Kat. Nr. 60.E6) und dem von
Messene (Kat. Nr. 20.Φ1) erwähnt. Zu diesen Gruppen
gehörten eine Kolossalstatue des Herakles im Typus
Farnese aus der frühen Kaiserzeit, die im Gymnasion
von Messene (Kat. Nr. 21.Γ7) gefunden wurde, und
wahrscheinlich der etwa lebensgroße, späthellenisti-
sche Torso eines Sitzenden aus dem Gymnasion von
Pergamon (Kat. Nr. 60.Γ3). Überdies gehörte der ko-
lossale Torso eines sitzenden Herakles aus dem Gym-
nasion von Pergamon (Kat. Nr. 60.Γ4) wahrscheinlich
zu der Kultgruppe des Tempels R dieses Gymnasions.
Von den etwas überlebensgroßen Marmorstatuen im
Typus des stehenden Hermes, die in Gymnasia gefun-
den wurden (Kat. Nr. 21.Γ4, 21.Γ8, 21.Γ9, 47.Γ2), ist
nicht bekannt, ob sie den Gott selbst oder einen heroi-
sierten Verstorbenen zeigen. Eine Marmorstatue des
Herakles, ein Werk des Skopas, die Pausanias im Gym-
nasion von Sikyon (Kat. Nr. 9.Φ1) gesehen hatte,
könnte möglicherweise entweder in der Darstellung
auf einer sikyonischen Münze aus römischer Zeit oder
im Statuentypus Herakles Lansdowne erkannt werden.
Ferner halten wir es auch für wahrscheinlich, dass das
Original des Typus Lansdowne unabhängig von sei-
nem Aufstellungsort Herakles in seiner Eigenschaft
als ἐνάγωνιος zeigte. Ein Hinweis darauf sind die ge-
schwollenen Ohren, die wohl bereits das Original auf-
gewiesen hat, aber vielleicht auch die Tatsache, dass
der Kopf Lansdowne in römischer Zeit oft für den Ty-
pus der Herme kopiert wurde.
Abgesehen von den lebens- oder überlebengroßen
Statuen sind auch bronzene und marmorne Votivsta-
tuetten des Herakles, vielleicht auch des Hermes, be-
zeugt.
Vielfältige ikonographische Typen des Eros als
Kind oder Ephebe verweisen auf das Athletenideal.
Es handelt sich um Darstellungen des Gottes bei Wett-
kämpfen in der Palästra, in Siegesszenen, in Gruppen
mit Anteros oder neben Hermen. Erosstatuen hingegen
sind in Gymnasia selten (Kat. Nr. 12.Φ3, 38.E6).
Die anikonische Verehrung des Apollon ist im
Gymnasion von Megara bezeugt (Kat. Nr. 22.Φ1). Im
Zustand des Ausruhens nach dem Kampf ist Apollon
im Athener Lykeion dargestellt, wobei er die Charak-
teristika eines Epheben angenommen hat, d. h. den
über die Stirn gelegt Zopf (Kat. Nr. 3.Φ1). Im Typus
des Kitharoden wird er als Votivstatuette gezeigt (Kat.
Nr. 38.E6).
Unbekannt sind in den Gymnasia die Darstellungen
des Theseus und des Achilleus. Die Ansicht, dass die
Ἀχιλλείς, die Plinius als Statuen mit Lanzen in der
Hand erwähnt, mit dem polykletischen Typus des Do-
ryphoros zu verbinden sind, wird in der heutigen For-
schung häufig vertreten. Jedoch konnte die Einschät-
zung, die wiederholt von einigen Forschern vorgetra-
gen wurde, dass mehrere Kopien des Doryphoros in
Gymnasia gefunden wurden, durch unsere Untersu-
chung nicht bestätigt werden. Eine Kopie des Dory-
phoros stammt mit Sicherheit aus dem Gymnasion von
Messene. Für dieses Werk (Kat. Nr. 21.Γ5) wurde
kürzlich die Deutung als Theseus vorgeschlagen, des-
sen Statue Pausanias im Gymnasion der Stadt gesehen
hatte (4,32,1). Spuren auf der Basis, auf der diese Sta-
tue aufgestellt war, lassen erkennen, dass neben ihr
ein zweites Werk aus Bronze gestanden hat. Man kann
deshalb nicht ausschließen, dass es eine Ehrenstatue
gewesen ist, vielleicht eine heroisierte Siegerstatue.
Wie festgestellt wurde, gibt es nur sehr wenige be-
kannte Beispiele rundplastischer Darstellungen my-
thologischer Gestalten in Lebens- oder Über le -
bensgröße. Etwas zahlreicher sind die Zeugnisse klei-
nerer Bronzestatuetten. Somit lässt sich aber nicht er-
mitteln, ob eventuell bestimmte Statuentypen der zum
Wettkampf gehörenden Götter insbesondere für die
Gymnasia immer wieder bevorzugt wurden.
Die ornamenta γυμνασιώδη (Cic. Att. 1,6,2 Z. 5-
7) schlechthin dürften die gesamte Zeit über die Her-
men gewesen sein; dies bezeugt die Menge an schrift-
lichen Zeugnissen in Verbindung mit der entsprechen-
den Zahl diesbezüglicher Darstellungen in der klassi-
schen attischen Vasenmalerei und auf den hellenisti-
schen Grabstelen mit Palästraszenen, aber auch die in
Gymnasia gefundenen Skulpturen selbst. Die Hermen
wurden in einzelnen Gruppen nach dem Kriterium ih-
rer Ikonographie untersucht und dementsprechend
auch daraufhin, in welchem Bezug sie thematisch zur
Institution des Gymnasions standen (Kap. II.3).
In archaischer und frühklassischer Zeit gehören die
Hermen ausschließlich zum Typus der Schulterherme,
sind ithyphallisch und tragen bärtige Köpfe mit generell
ähnlichen typologischen Kennzeichen. Im Laufe ihrer
Entwicklung in hoch- und spätklassischer Zeit bewah-
ren die Hermen im Allgemeinen die bärtigen Köpfe,
weisen jedoch hinsichtlich der Kopftypen eine größere
Vielfalt auf und verlieren allmählich ihren ithyphalli-
schen Charakter. In späthellenistischer Zeit sind Her-
meshermen mit bärtigen Köpfen durch den archaisti-
schen Stil gekennzeichnet. Das Bild des ithyphalli-
schen, bärtigen Hermes wurde in der Antike schon früh
mit der Eigenschaft des Hermes als λογίος verbunden.
318 εἰκόνες ἐν γυμνασίῳ – ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Der Typus der Herme mit ἡμίτομον (Mantelherme),
der den bärtigen Hermes in ein Himation gehüllt zeigt,
ist seit klassischer Zeit bekannt. Das Himation wurde
auf die gewöhnliche Kleidung der Erzieher und Paläs -
triten in den Gymnasia bezogen, und folglich wurde
der Typus als Darstellung des Hermes ἐναγώνιος oder
Palästrit gedeutet.
Seit dem späten 4. Jh. v. Chr. werden Schulter- und
Mantelherme auch mit einem bartlosen Kopf verbun-
den. Diese unbärtigen jugendlichen Köpfe könnten
unserer Meinung nach als Werke angesehen werden,
die auf ein gemeinsames ikonographisches Vorbild zu-
rückgehen. Ausgehend von den in Gymnasia gefun-
denen Hermen kommen wir zu einigen Beobachtun-
gen, welche die allgemeine Entwicklung in der Iko-
nographie dieser Köpfe betrifft. Die älteren Hermen,
die mit Sicherheit bartlose Köpfe trugen, werden nach
der Mitte des 4. Jhs. v. Chr. datiert. Dennoch gibt es
frühere Darstellungen bartloser Hermen, bekannt aus
der attischen Vasenmalerei der zweiten Hälfte des 5.
Jhs. v. Chr., die in der heutigen Forschung mit dem
Fest der Anthesterien in Zusammenhang gebracht wer-
den und aus diesem Grund oft als Darstellungen des
Dionysos erkannt werden. Wir glauben jedoch, dass
es sich um Hermes handelt, der wahrscheinlich als Be-
schützer der Kinder dargestellt ist. Ungeklärt ist, was
in dieser Zeit zur Änderung der Ikonographie der Her-
men führte, die bislang ausschließlich bärtige Köpfe
getragen hatten, sodass nun der Hermenschaft auch
mit einem bartlosen Kopf versehen werden konnte. Es
ist unseres Erachtens vielleicht kein Zufall, dass die
ersten bartlosen Hermen in einer Epoche auftauchen,
in der von bedeutenden Künstlern die ersten rundplas-
tischen Typen des bartlosen Hermes geschaffen wer-
den. Diese Kohärenz zwischen dem Ursprung des iko-
nographischen Typus der bartlosen Hermen und der
rundplastischen Typen des bartlosen Hermes des 5.
Jhs. v. Chr. bedeutet nicht zwangsläufig, dass man ei-
nen konkreten Kopftypus der Rundplastik in der Iko-
nographie der Hermen annehmen muss, sondern be-
zieht sich auf die Auffassung, die sich in dieser Epoche
vom Bild des Hermes als Gott der Palästra herausge-
bildet hat. Es ist nicht auszuschließen, dass jene Ele-
mente, die in der Folge die Ikonographie der bartlosen
Hermen geprägt haben, allmählich in frühklassischer
Zeit entstanden sind, und zwar bereits unter dem Ein-
fluss der archaistischen bärtigen Hermen, wie Beispie-
le bartloser Hermen mit langer archaistischer Frisur
bezeugen. In hellenistischer Zeit waren die bartlosen
Köpfe der Hermen freie Schöpfungen, die der allge-
meinen Ikonographie des Athleten, wie sie sich bereits
in klassischer Zeit herausgebildet hatte, und zugleich
den zeitgenössischen Tendenzen des Privatporträts
folgten. Die Beispiele aus dem späten 4. und frühen
3. Jh. v. Chr. sind entsprechend der idealplastischen
Bildnisse gestaltet und weisen keine individuellen Ge-
sichtszüge auf. Bald drangen jedoch einige Elemente
von Individualisierung ein, die jedem Kopf eine Be-
sonderheit verliehen (Kat. Nr. 39.Γ1). Größere Dyna-
mik in der Tendenz, physiognomische Charakteristika
wiederzugeben, sehen wir an späthellenistischen Köp-
fen (Kat. Nr. 40.Ε/Γ1, 39.Γ2, 39.Γ3, 47.Γ4-47.Γ5), so-
dass sie von einigen Forschern mitunter für Porträts
gehalten wurden (Kat. Nr. 39.Γ6, 37.Γ4, 39.Γ4, 37.Γ2).
In diesem Rahmen gehen wir der besonderen Pro-
blematik der Deutung der Hermen mit bartlosen Köp-
fen nach, d.h. der Kontroverse, ob es sich um Götter-
darstellungen oder Porträts handelt. Die Identifizierung
mit Hermes ἐναγώνιος ist in einigen, in der Forschung
bisher nicht berücksichtigten Fällen epigraphisch be-
legt. Wir können aber nicht ausschließen, dass viel-
leicht einige bartlose Köpfe mit Porträtzügen auf Her-
men aus dem späten Hellenismus Jünglinge aus dem
Gymnasion wiedergeben. Die Ephebendarstellung im
Typus der Herme ist zudem epigraphisch im 1. Jh. n.
Chr. belegt. Dieses Phänomen hat sich unserer Mei-
nung nach im Zusammenhang mit der in den späthel-
lenistischen Gymnasia zu beobachtenden Tradition
entwickelt, Epheben postume Ehren zu erweisen.
Darüber hinaus kann, wie schon bemerkt wurde,
der Typus der Herme mit dem Bildniskopf keine Er-
findung der römischen Kunst gewesen sein, wie häufig
behauptet wird. Er muss im griechischen Raum bereits
in hellenistischer Zeit bekannt gewesen sein, wie bei-
spielsweise Inschriften auf hellenistischen Hermen-
basen, die Philosophenporträts trugen, belegen. Es ist
anzunehmen, dass es sich um eine Erfindung handelte,
die in ihren Anfängen unter dem Einfluss der Ikono-
graphie des Hermes λόγιος mit der Darstellung gelehr-
ter Persönlichkeiten in Zusammenhang zu sehen ist.
Aus Gymnasia sind ferner Schulter-, Mantel- und
Körperhermen mit bärtigem Herakles bekannt. Es wur-
de die Ansicht geäußert, dass die Mantelhermen des
Herakles seine Gestalt mit neuem Inhalt aufzeigen, in-
dem nicht seine körperliche Stärke, sondern seine geis-
tige Tugend vorgeführt wird. Wir bemerken jedoch,
dass dieses neue Heraklesbild weiterhin mit dem ath-
letischen Wettkampfideal zusammenhängt, da Hermen
dieses Typus auf den Grabreliefs, aber auch als Statu-
enstützen von Athleten dargestellt sind.
Im Weiteren wird die Funktion der Götterstatuen
und -hermen in Gymnasia eingehend untersucht (Kap.
ZUSAMMENFASSUNG 319
II.4). Es gibt nur wenige Zeugnisse zu Kultstatuen,
und diese stammen vor allem von Pausanias. Wir ge-
hen davon aus, dass die Hermen in erster Linie dem
Kult in den Gymnasia dienten, wie zahlreiche Vasen-
bilder sowie auch Weihinschriften bezeugen (Kap.
II.4.1.).
Votive, vor allem Hermen und Statuetten, seltener
Reliefs, weihten die Amtsträger der Gymnasia, die
Lehrer und diejenigen, die im Gymnasion trainierten,
insbesondere Epheben und Neoi (Kap. II.4.2). Die
Weihung der Hermen durch die Gymnasiarchen
scheint mit der Vollendung ihrer Amtszeit und der
Durchführung der Feste der Ἑρμαῖα am Ende des gym-
nasiarchischen Jahres zusammenzuhängen. Die ge-
meinschaftlichen Weihungen von Hermen durch die
Epheben und Neoi steht in Verbindung mit deren Voll-
endung der Ephebie und ihren Siegen in den gymna-
sialen Wettkämpfen. Im Rahmen dieser Diskussion
wurde darüber hinaus hervorgehoben, dass die Gym-
nasiarchen und Epheben Hermen an Hermes als Schüt-
zer der Palästra und an anderen Orten, d.h. in Heilig-
tümern, außerhalb des Gymnasions weihten.
Anschließend werden die Zeugnisse zu den Por-
trätstatuen untersucht (Kap. III). Es wurde festgestellt,
dass Gymnasia mit folgenden Bildwerken ausgestattet
werden konnten: a) Herrscherstatuen, b) Statuen und
Gemälde der Amtsträger und Euergetai des Gymnasi-
ons, c) Statuen heroisierter Epheben des Gymnasions,
d) Statuen der Athleten, die in panhellenischen Agonen
gesiegt hatten, und e) Statuen und Gemälde gelehrter
Persönlichkeiten.
Wahrscheinlich standen in den Gymnasia Statuen
der hellenistischen Herrscher, die die Gymnasia ge-
gründet oder als Euergetai gefördert hatten (Kap. III.1);
allerdings gibt es für diese Annahme nur sehr wenige
schriftliche und archäologische Zeugnisse. Diese be-
treffen hauptsächlich Statuen der Attaliden und Ptole-
mäer in Gymnasia der Städte, die unter ihrem Einfluss
standen. Der bedeutendste Fundkomplex stammt aus
dem Gymnasion von Pergamon, durch den bestätigt
wird, dass sich die attalidischen Könige im Typus der
Panzerstatue darstellen ließen. Darüber hinaus stellen
wir die Hypothese auf, dass bekannte ikonographische
Typen, in denen hellenistische Könige (vor allem Pto-
lemäer) mit den Attributen des Hermes oder des He-
rakles erkannt werden können, geschaffen wurden, um
diese Könige als Tempelgenossen (σύνναοι θεοὶ) der
Götter der Palästra darzustellen. Schließlich Konsta-
tieren wir die wichtige Rolle, die die Gymnasiarchen
bei der Aufstellung von Statuen und der Verleihung
kultischer Ehren an die Herrscher spielen.
Gemälde und Ehrenstatuen von Amtsträgern und
seltener anderen Euergetai der Gymnasia gehörten be-
reits seit dem 3. Jh. v. Chr. und noch häufiger im Spät-
hellenismus zur Ausstattung der Gymnasia (Kap. IIΙ.2).
Im Späthellenismus wurden auch Statuen anderer po-
litischer Persönlichkeiten aufgestellt, die nicht mit dem
Betrieb der Gymnasia in Zusammenhang standen, un-
ter ihnen auch römische Amtsträger. Ehrenstatuen von
Frauen, die das Amt des Gymnasiarchen bekleideten,
oder Wohltäterinnen sind in den hellenistischen Gym-
nasia nicht bezeugt. In der Regel wurden die Ehren-
statuen der Gymnasiarchen von den Epheben und Neoi
der Gymnasia, seltener von der Polis errichtet. Die
Statuen anderer politischer Persönlichkeiten und wohl-
habender Römer hingegen wurden von der Polis er-
richtet. Die Ehrenstatuen bestanden normalerweise aus
Bronze und waren lebens- oder etwas überlebensgroß.
Schriftliche Zeugnisse aus späthellenistischer Zeit zu
steinernen Statuen der Amtsträger und Wohltäter sind
mit der Verleihung kultischer Ehren verbunden. Be-
kanntermaßen wurde für die Ehrenstatuen hauptsäch-
lich der Typus des Himationträgers verwendet; bezeugt
ist jedoch auch die nackte Darstellung. Die Ehren, die
Amtsträgern und Euergetai von Gymnasia verliehen
wurden, gipfeln im Späthellenismus im Kult für die
geehrten Personen und in der Heroisierung derselben
oder ihrer Söhne innerhalb der Gymnasia.
In der heutigen Forschung ist die Auffassung ver-
breitet, dass in den Gymnasia oft Athletenstatuen auf-
gestellt wurden. Wie wir jedoch feststellen können, ist
die Zahl der entsprechenden Inschriften begrenzt (Kap.
III.3). Für Athleten ist die Errichtung von Ehrenstatuen
seltener belegt als für Amtsträger; die entsprechenden
Zeugnisse stammen mit Sicherheit nur aus späthelle-
nistischer Zeit, wobei sie in jedem Fall panhellenische
Siege betreffen. Mit dieser Schlussfolgerung auf Grund
des Befundes betonen wir zudem die Schwierigkeiten
bei der Interpretation von jugendlichen Köpfen und
Statuen aus Marmor im Athletentyp, die in Gymnasia
gefunden wurden. Es ist also fraglich, ob es sich um
die Statuen von Siegern (persönliche Weihungen oder
Ehrenerweisungen) handelt oder vielleicht um die po-
stume Darstellung Jugendlicher.
Die Bestattung und der postume Kult für Heroen
in Gymnasia bilden tief verwurzelte Traditionen (Kap.
III.4). Seit dem fortgeschrittenen 3. Jh. v. Chr. sind in
den Gymnasia Bestattungen von Personen des militä-
rischen und politischen Lebens bezeugt. Im Späthel-
lenismus wurden im Rahmen dieser Tradition jugend-
liche Nachfahren von Euergetai in den Gymnasia be-
stattet, oder ihnen wurden auch postume Statuen auf-
320 εἰκόνες ἐν γυμνασίῳ – ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
gestellt. Die Errichtung dieser postumen Bildwerke fi-
nanzierten, soweit wir wissen, Angehörige oder Freun-
de des Verstorbenen. Der bekannte „Jüngling von Ere-
tria“ war wahrscheinlich eine postume Statue im Gym-
nasion der Stadt. Dies ist aufgrund des Materials und
der technischen Details, die vielleicht auf eine jährliche
Bekränzung seines Kopfes anlässlich von Jahresfeiern
hindeuten, aber auch aufgrund der Tatsache, dass seine
Aufstellung eine private Handlung war, anzunehmen.
Auch andere Marmorskulpturen weisen Indizien auf,
die auf eine postume Herstellung schließen lassen.
Philosophenstatuen lassen sich mit Sicherheit nur
in den Musenheiligtümern der athenischen Gymnasia
nachweisen (Kap. III.5). Gruppen von Philosophen-
statuen entstanden allmählich in den Musenheiligtü-
mern der Akademie und des Lykeions, und vielleicht
auch, wie wir vermuten, in der Bibliothek des ptole-
mäischen Gymnasions. Die älteren Philosophenstatuen
in der Akademie und im Lykeion waren private Wei-
hungen von Schülern und Schulvorstehern. Die Auf-
stellung von Philosophenstatuen durch die Stadt Athen
vor dem 3. Jh. v. Chr. wird zwar angenommen, lässt
sich jedoch bislang nicht nachweisen. Retrospektive
Darstellungen von Dichtern und Historiographen in
Gymnasia auch anderer Poleis sind als Hinweis darauf
zu deuten, dass das Ausbildungsprogramm auch an-
dernorts einen erweiterten Erziehungsrahmen förderte.
Geeignete Aufstellungsorte für solche Werke könnten
Bibliotheken oder Musenheiligtümer gewesen sein,
die mitunter in den Gymnasia oder in Zusammenhang
mit diesen unterhalten wurden. Im Rahmen der Dis-
kussion wurde auch ein bislang unpublizierter, über-
lebensgroßer nackter Marmortorso aus dem Gymna-
sion von Amphipolis vorgestellt, der im Typus des sit-
zenden Intellektuellen dargestellt ist. Dieser Torso ist
deshalb besonders wichtig, weil er eine der wenigen
erhaltenen Originalstatuen aus hellenistischer Zeit ist,
die den ikonographischen Typus des sitzenden Gelehr-
ten wiedergeben; zudem handelt es sich um eines der
ganz seltenen Beispiele dieses Typus, das in seinem
ursprünglichen architektonischen Zusammenhang ge-
funden wurde. Die Statue ist unserer Meinung nach
Ende des 3. oder Anfang des 2. Jhs. v. Chr. zu datieren,
und stellt eher einen Dichter als einen Philosophen
dar, wie aufgrund seiner Körperhaltung und seines iko-
nographischen Typus zu vermuten ist.
Schließlich wurde die Funktion der Skulpturen in
Beziehung zu ihrem Aufstellungsort untersucht (Kap.
IV). Vor den Eingängen in das Gebäude, aber auch in
die Palästraräume, standen traditionsgemäß Hermen
des Hermes mit der Eigenschaft des Gottes als Propy-
laios, mitunter aber auch andere Skulpturen. Tempel,
in denen Kultstatuen aufgestellt waren, sind selten in
Gymnasia zu beobachten. Dennoch konnten den Sta-
tuen und Hermen, die in reicher ausgestatteten oder
einfacheren Räumen der Palästra oder im Freien auf-
gestellt waren, kultische Ehren zugeschrieben worden
sein. Votive standen vor den Eingängen in die Gebäude
oder die einzelnen Palästraräume, an der Startanlage
des Xystos und der Paradromis, zwischen den Säulen
des Peristylhofs sowie des Xystos, oder in Wandni-
schen der Palästraräume. Ehrenstatuen werden auf Be-
schluss der Polis ἐν τῶι ἐπιφανεστάτωι τόπωι der Gym-
nasia errichtet, d. h. an dezidierten Aufstellungsorten
in den Räumen oder im Peristyl der Palästra. Festzu-
stellen ist das überaus interessante Phänomen, dass im
Späthellenismus für die Errichtung von Ehrenstatuen
manchmal sogar in die architektonische Substanz der
Gymnasia eingegriffen wurde, um einen Teil des ei-
gentlich für den Gymnasionsbetrieb bestimmten
Raums zur Präsentation der Statuen nutzen zu können.
Durch die Analyse der Skulpturen können wir un-
sere Kenntnisse hinsichtlich der verschiedenen Aspekte
der Funktion des Gymnasions als Einrichtung in der
hellenistischen Polis, d. h. als städtische und insbeson-
dere als erzieherische Institution sowie zugleich als
Kultort und als Träger der Kultur vertiefen.
Der Betrieb im hellenistischen Gymnasion als städ-
tische Institution scheint einen »geschlossenen« Cha-
rakter bewahrt zu haben. Diese Ansicht wird durch
den Charakter der Skulpturenaufstellung bestätigt, da
als Stifter ausschließlich diejenigen gezeigt werden,
die die Gymnasia leiteten, in ihnen unterrichteten oder
studierten, hingegen als geehrte Personen alle dieje-
nigen, die zu seinem Betrieb beitrugen. Erst in spät-
hellenistischer Zeit können wir beobachten, dass die
Grenzen des Gymnasions erweitert wurden, als die
Polis im Gymnasion Statuen politischer Persönlich-
keiten aufstellt, deren Aktivität nicht ausschließlich
das Gymnasion betrifft. Das Phänomen muss damit in
Zusammenhang stehen, dass das Gymnasion insbe-
sondere in dieser Zeit zu einem Feld für die Selbstdar-
stellung und den Konkurrenzkampf von Politikern und
Wohltätern wurde, genau wie es sich in dem rasanten
Anstieg von Ehrenstatuen für Amtsträger und andere
Persönlichkeiten der politischen Szene andeutet. In
diesen Rahmen ist auch die Initiation der Epheben und
Neoi in das politische Leben der Polis einzuordnen.
Im Gymnasium als Ausbildungsstätte bleiben die
körperliche Erziehung und das agonistische Ideal im
Laufe der Zeit das vorrangige Ziel. Die agonistischen
Ideale sind durch alle Weihungen in den hellenisti-
ZUSAMMENFASSUNG 321
schen Gymnasia bezeugt, und insbesondere dadurch,
dass über den gesamten Zeitraum ihres Bestehens Her-
men als Siegesweihungen für den Palästriten oder Her-
mes ἐναγώνιος errichtet wurden und zusammen mit
diesen Preise oder Wettkampfutensilien aufgestellt
wurden.
Das Gymnasion als Kultstätte ist auf die Initiation
von Epheben und Neoi in die sakralen und zugleich
gesellschaftlichen und politischen Gebräuche der Polis
mittels Festen ausgerichtet. Es bleibt dauerhaft auf den
Kult von Göttern konzentriert, die die Ideale der Ju-
gend verkörpern, d. h. des Hermes, des Herakles und
des Eros. Zugleich bildet es jedoch einen Teil der Polis,
der unlösbar mit dieser verbunden ist und in dem die
lokalen Götter und Euergetai verehrt werden. Die Auf-
stellung von Kultstatuen übernehmen manchmal die
Gymnasiarchen. In diesem Rahmen führen sie auch
den Herrscherkult in die Gymnasien ein.
Das Gymnasium als Träger lokaler kultureller Iden-
tität umfasst – insbesondere seit späthellenistischer
Zeit – auch kulturelle Einrichtungen, wie z. B. Biblio-
theken, Odeia und Musenheiligtümer. Als Symbole lo-
kaler Kultur dienen die dort aufgestellten, retrospek-
tiven Porträts Intellektueller.
Traditionelle Elemente, die sich in hellenistischen
Gymnasia entwickelt hatten, haben sich auch weiterhin
in der Geschichte des Gymnasions in der Kaiserzeit
erhalten. Die Tradition, dass die Neoi oder die Stadt
die Amtsträger der Gymnasia ehren, ist im institutio-
nellen Rahmen ähnlich, wenn auch in Athen den Bron-
zestatuen der hellenistischen Gymnasiarchen die stei-
nernen Hermen der Kosmeten folgten. Zugleich hat
der Kaiserkult, der in Gymnasia vor allem in Klein-
asien zu konstatieren ist, seine Wurzeln in den helle-
nistischen Gymnasia der Herrscher und Wohltäter, aber
auch in der Verleihung von Ehren an römische Amts-
träger der späthellenistischen Zeit.
322 εἰκόνες ἐν γυμνασίῳ – ΕΡΓΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
![Page 1: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/1.jpg)
![Page 2: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/2.jpg)
![Page 3: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/3.jpg)
![Page 4: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/5.jpg)
![Page 6: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/6.jpg)
![Page 7: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/7.jpg)
![Page 8: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/8.jpg)
![Page 9: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/9.jpg)
![Page 10: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/10.jpg)
![Page 11: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/11.jpg)
![Page 12: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/12.jpg)
![Page 13: ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Έργα γλυπτικής στο ελληνιστικό γυμνάσιο [EIKONEΣ ΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩ. Sculptures in the hellenistic gymnasium]](https://reader039.fdokumen.com/reader039/viewer/2023051505/6344a9516cfb3d40640950b5/html5/thumbnails/13.jpg)