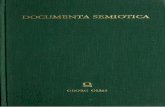Die oberösterreichische Industrie. Aufbau und Privatisierung der Verstaatlichten
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Die oberösterreichische Industrie. Aufbau und Privatisierung der Verstaatlichten
Lukas Kastner, Matrikelnummer: 1220416PS: Europäische Regionalgeschichte (Ökonomischer Föderalismus: Die wirtschaftliche Entwicklung der österreichischen Bundesländer), LV-Nummer: 603.652, Leitung: Ao.Univ.-Prof. Mag.phil. Dr.phil. Christian Dirninger, Sommersemester 2013, 30.092013.
Die Oberösterreichische Industrie
Aufbau und Privatisierung der Verstaatlichten
Inhalt:
1 Einleitung 3
2 Die Entwicklung der oberösterreichischen Industrie nach 1945
4
2.1 Die 50er Jahre 8
2.2 Die 60er Jahre 9
3 Der Beginn der wirtschaftlichen Stagnation und die Krise der
Verstaatlichten 10
4 Das Aufkommen des Neoliberalismus
13
4.1 Das Konzept des Neoliberalismus
14
4.2 Die Bedeutung des Neoliberalimus in Österreich
15
5 Die Privatisierung der oberösterreichischen Industrie
17
2
6 Schlussfolgerung 19
7 Abkürzungsverzeichnis 20
8 Quellenverzeichnis
21
9 Literaturverzeichnis
22
1 Einleitung
Die Industrie spielt in Oberösterreich eine zentrale
wirtschaftliche Rolle. Bereits in den 70er Jahren wurde
Oberösterreich zum Industrieland Nummer eins. Seine Rolle als
Industriestandort war und ist daher für Österreich von großer
Bedeutung. Die wirtschaftliche Entwicklung Österreichs stand
und steht somit auch in starkem Zusammenhang mit der
Entwicklung der oberösterreichischen Industrie. Dies wurde
besonders im Zuge der Krise der verstaatlichten Industrie
deutlich. Im Gegenzug war die oberösterreichische Industrie
3
besonders von wirtschaftspolitischen Entscheidungen der
Bundesregierung während der 1980er und 1990er Jahre betroffen.
Mein Interesse gilt besonders dem Aufbau der staatlichen
Industrie und deren Privatisierung. Diesen beiden Themen werde
ich mich im Zuge meiner Arbeit besonders widmen.
Dabei versuche ich folgende Fragen zu beantworten:
1. Wie entwickelte sich die Oberösterreichische Industrie?
2. Wieso kam es zur Privatisierung der Industrie?
3. Welche Folgen hatte die Privatisierung?
Dazu möchte ich folgende Thesen überprüfen:
1. Die oberösterreichische Industrie entwickelte sich auf Grundlage des Wiederaufbaus und profitierte dabei vom Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg.
2. Das Ende des Nachkriegsaufschwungs sorgte in Verbindung mit Managementfehlern (Fehlinvestitionen) für die Krise der Verstaatlichten. Dies stellte den wirtschaftlichen Hintergrundfür die Privatisierung dar.
3. Durch die Privatisierungen wurden neue
Investitionsmöglichkeiten für die Privatwirtschaft geschaffen.
Die Literatur zu diesem Thema ist ausgesprochen reichlich. Dies
spiegelt die Bedeutung der gesamtösterreichischen und der
oberösterreichischen Industrie wider.
2 Die Entwicklung der oberösterreichischen
Industrie nach 1945
4
Oberösterreich blieb während des Zweiten Weltkriegs im
Vergleich zu den östlichen Bundesländern relativ unbeschadet.
Der überwiegende Teil der Industrie blieb von Bombenangriffen
verschont. Auch die Anlagen, die bombardiert wurden, konnten
nicht zur Gänze vernichtet werden. Von Demontagen durch die
Alliierten war Oberösterreich kaum betroffen. Die Ausnahmen
bildeten hierbei das Mühlviertel, welches bis 1955, und das
östliche Ennsufer rund um Steyr, welches für kurze Zeit nach
Kriegsende unter sowjetischer Besatzung blieb.1
Auf dieser Grundlage wurde ein großer Teil der
oberösterreichischen Industrie weitergeführt und erweitert.
Besonders die Energiewirtschaft wurde auf dieser Grundlage
aufgebaut.2 Zu den wichtigsten Unternehmen gehörten unter
anderem die VOEST, die Linzer Stickstoffwerke, das
Zellstoffwerk Lenzing und die Aluminiumwerke in Ranshofen. Der
Raum Steyr und die Steyr-Daimler-Puch-AG verloren durch die
Demontage unter der russischen Besatzung an wirtschaftlicher
Bedeutung.3
1 Vgl. Roman Sandgruber, Sonderfall Oberösterreich?. Die NS-Zeit und dieIndustrialisierung des Landes, in: Ute Streitt u.a., Hg., TechniklandOberösterreich. Wirtschaftliche Entwicklungen und industrielle Gegenwart,(Studien zur Kulturgeschichte von Oberösterreich, Folge 32), Linz 2013.
2 Vgl. Forum OÖ Geschichte, Das Wirtschaftswunder. Das Energieproblem, http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/das-wirtschaftswunder/westorientierung-und-aufschwung/das-energieproblem/, abgerufen am 04.07.2013.
3 Vgl. Forum OÖ Geschichte, Das Wirtschaftswunder. Nachkriegswirtschaft in Oberösterreich, http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/das-wirtschaftswunder/westorientierung-und-aufschwung/nachkriegswirtschaft/, abgerufen am 04.07.2013
5
1946 wurde das erste Verstaatlichungsgesetz, welches vor allem
die Grundstoffindustrie betraf, beschlossen. 1947 folgte das
zweite Verstaatlichungsgesetz betreffend der
Elektrizitätswirtschaft.
Die Überlegungen, welche hinter der Verstaatlichung standen,
lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: Zum einen war in der
österreichischen Privatwirtschaft zu wenig Kapital vorhanden um
die teils zerstörten Unternehmen vor allem in der
Grundstoffindustrie zu übernehmen.
Zweitens waren viele ehemalige Eigentümer und Manager als
überzeugte Nationalsozialisten geflohen.
Die Aufgabe des Staates sollte somit im Aufbau sowie in der
Reorganisation und Verwaltung der betroffenen Unternehmen
bestehen.
Drittens wurde auf der Potsdamer Konferenz beschlossen, dass
die Alliierten „deutsches Eigentum“ zur Wiedergutmachung
beschlagnahmen konnten. Um das Industriepotential in
österreichischer Hand belassen zu können, wurden einige
Betriebe verstaatlicht. Die Verstaatlichung wurde allerdings
nur im Einvernehmen mit den westlichen Alliierten beschlossen.
Zwar hätten in der sowjetischen Besatzungszone ebenfalls 44
Betriebe verstaatlicht werden sollen, jedoch kamen die Sowjets
mit dem Befehl Nummer 17 dem ersten Verstaatlichungsgesetz
zuvor und konnten die gesamten deutschen Vermögenswerte unter
ihre Kontrolle bringen. Dies führte zu einer wirtschaftlichen
Teilung Österreichs.
6
Im Zuge dieser Teilung konnten die westlichen Bundesländer an
industrieller Bedeutung gewinnen. Durch die unterschiedliche
Verteilung der ERP-Mittel und den Aufbau einer Ersatzproduktion
für die östlichen Betriebe wurde dieser Trend verstärkt.4
Besonders die USA waren an der Stärkung der Grundstoffindustrie
interessiert. Man ging davon aus, dass dies für die Erholung
der österreichischen Wirtschaft von zentraler Bedeutung sei.
Dies deckte sich weitgehend mit den Interessen der
österreichischen Regierung. Wollten die anderen Alliierten eine
Schließung der VOEST und lediglich die Aufrechterhaltung von
Koksöfen zur Stickstofferzeugung, bevorzugten die Amerikaner
die Aufrechterhaltung zweier Koksofenbatterien und das
Betreiben eines Hochofens. 1947 verlangten die USA konkrete
Investitionskonzepte für die bevorstehende Marshallhilfe. Die
Modernisierung der Eisen- und Stahlindustrie war nur durch
Dollarimporte von Investitionsgütern möglich.
Die österreichische Regierung entschied zu dieser Zeit, der
Grundstoffindustrie mehr Investitionen zu widmen, um der
Finalindustrie billiges Rohmaterial und Halbzeug zur Verfügung
stellen zu können. Dies war durchaus im Sinne der Amerikaner.
Allerdings ging die Entscheidung zu Lasten der PKW-Produktion
in Steyr.
Insgesamt waren die USA den Regulierungen durch die
österreichische Regierung gegenüber positiv eingestellt. Das
erste große Planungsdokument war der Eisen- und Stahlplan.4 Vgl. Georg Turnheim, Die verstaatlichten Unternehmen zwischen 1945 und
1955, in: Georg Turnheim, Österreichs Verstaatlichte. Die Rolle desStaates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von 1918 bis2008, Wien 2009, S. 29-50, S. 32-35.
7
Dadurch sollten die Kapazitäten der Hochöfen und Stahlwerke
optimal genutzt werden und neue Produktionsprogramme, wie das
LD-Verfahren, entwickelt werden.5
Eine wichtige Aufgabe der staatlichen Industrie war es, der
Privatwirtschaft durch den Verkauf ihrer Produkte unter
Weltmarktpreisen einen Vorteil zu verschaffen. Zwischen 1946
und 1980 beliefen sich dadurch die indirekten Subventionen für
Privatunternehmen auf geschätzte 8 Milliarden Schilling.
Besonders die Preise für Industriestrom, Düngemittel, Eisen,
Stahl und Halbzeug waren im europäischen Raum besonders
niedrig.6
Beim Aufbau der Industrie war letztendlich der Marshallplan von
entscheidender Bedeutung. Ein Großteil der Hilfen floss in die
amerikanische Zone. Ziel war es, die westlichen Bundesländer
wirtschaftlich aufzuwerten, um möglichst wenig von der
östlichen Besatzungszone abhängig zu sein. Dies wurde durch
die Abschottung der COMECON Länder und der Errichtung des
Eisernen Vorhangs zusätzlich verstärkt und führte zu einer
weiteren Verlagerung der österreichischen Industrie nach
Oberösterreich.
Damit zusammenhängend entwickelte sich eine Gründungswelle, die
von 1946 bis 1952 anhielt. Insgesamt entstanden in dieser Zeit
211 Industriebetriebe neu, rund 50 gingen vom Gewerbe zur
Industrie über.5 Vgl. Kurt Tweraser, US-Militärregierung in Oberösterreich 1945-1950.
Amerikanische Industriepolitik am Beispiel VOEST und Steyr-Daimler-Puch,Linz 2009, S. 481-485.
6 Vgl. Dieter Stiefel, Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich.Illusion und Wirklichkeit, Wien u.a.2011, S. 132.
8
Zahlreiche nach dem Krieg gegründeten Industriebetriebe konnten
aufgrund der Hilfen aus dem Marshallplan auf- und ausgebaut
werden. So konnte sich die oberösterreichische Papierindustrie
bis Ende 1951 rund 70 Millionen Schilling sichern. Die
Textilindustrie erhielt 9,7, die Glasindustrie 7,4 und die
Holzindustrie 13 Millionen Schilling.
Die VOEST erhielt zwischen 1948 und 1953 rund 550 Millionen
Schilling aus ERP Mitteln. Dies machte mehr als die Hälfte
ihrer Investitionen während dieser Jahre aus. Bei den
Österreichischen Stickstoffwerken betrugen die Investitionen
rund 550 Millionen, bei den Aluminium Werken Ranshofen 55
Millionen. Sowohl bei den Stickstoffwerken, als auch bei den
Aluminiumwerken betrugen die Mittel aus dem ERP rund ein
Drittel der Investitionen. Das Zellstoffwerk in Lenzing erhielt
nur 5 Millionen Schilling, war allerdings sehr modern und
erlitt im Krieg keine Schäden, weshalb es keinen Nachholbedarf
gegenüber der Konkurrenz gab.
Im Laufe der Zeit wurde über verstärkte Subventionen der
Finalindustrie nachgedacht, dies wurde jedoch nie erfolgreich
umgesetzt.7
Die ERP Mittel bewirkten ab 1948 eine kurze besonders
dynamische Wachstumsperiode der österreichischen Wirtschaft. In
dieser Phase konnte sich die oberösterreichische Industrie
stark ausweiten und an Bedeutung gewinnen. Von einigen
Industrieprodukten war Oberösterreich der wichtigste
beziehungsweise der einzige Erzeuger. Allerdings lässt sich die
genaue Bedeutung des Bundeslandes für Österreich nicht7 Vgl. Roman Sandgruber, Sonderfall Oberösterreich?, S. 77f.
9
nachweisen, da die USIA Betriebe nicht in die
Produktionsstatistiken inkludiert wurden.
Ein wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen Erfolg und die
Produktionsausweitung der Industrie Oberösterreichs war die
Steigerung des Exports, welcher ab 1948 wieder nennenswerte
Ausmaße annahm. Im Jahr 1951 exportierten bereits 153 Firmen,
1952 waren es sogar 170, was über ein Viertel der damals 639
Industriebetriebe entsprach. Von 1948 bis 1952 konnte
Oberösterreich seinen Anteil am österreichischen
Industrieexport von geschätzten 21,6 Prozent auf 28,2 Prozent
steigern. Das Bundesland wurde in dieser Zeit zum wichtigsten
Exportland Österreichs.
Eine wichtige Rolle spielten dabei die vier großen,
verstaatlichten Betriebe aus der NS-Zeit. Alleine die VOEST war
1952 für 39 Prozent des oberösterreichischen Industrieexports
verantwortlich. Zusammen mit den Stickstoffwerken, den
Aluminiumwerken und der Zellwollfabrik sorgte sie für 50% des
gesamten Industrieexports des Landes.
Die Ursachen dafür liegen vor allem im Korea Krieg, der ab der
zweiten Hälfte des Jahres 1950 für eine ungewöhnlich hohe
Nachfrage in der Eisen-, Stahl-, und Aluminiumproduktion
sorgte.8 Auch die Zellwolle Lenzing AG konnte durch den Korea
Boom ihre Produktion erheblich steigern.
2.1 Die 50er Jahre8 Vgl. Otto Lackinger, 50 Jahre Industrialisierung in Oberösterreich, Linz
1997, S. 148-154.10
Ab 1951 schwächte der Produktionsanstieg deutlich ab und ging
1952/53 in eine Stagnation beziehungsweise einen Rückgang der
Produktion über. Die Ursachen waren unter anderem: Das
Auslaufen der ERP-Hilfe, das Abklingen des Koreakrieges, eine
restriktive Kreditpolitik, eine harte Wirtschafts- und
Budgetpolitik und eine Rückbildung der
Weltwirtschaftskonjunktur.
Dies macht sich auch in den Beschäftigungszahlen bemerkbar.
Stiegen diese in der oberösterreichischen Industrie von 1948
bis 1951 kontinuierlich, so wurde 1952 erstmals ein Rückgang
von 4,2 Prozent verzeichnet.
Allerdings konnte 1952 die Inflation gestoppt werden und 1953
bahnte sich bereits wieder ein steiler Konjunkturaufschwung
an.9 Dies wurde durch eine Abwertung des Schillings ermöglicht.
Zudem wurde von 1953 bis 1959 der österreichische Eisenpreis
niedriger gehalten als der im restlichen Europa. Dies brachte
der nationalen, eisenverarbeitenden Industrie Vorteile im
Wettbewerb.10
Diese Maßnahmen sorgten in Verbindung mit einem erneuten
Aufschwung der internationalen Konjunktur und der
einhergehenden Exportsteigerung für eine Hochkonjunktur. Die
oberösterreichische Industrie profitierte besonders von dieser
9 Vgl. Ebd. S. 148-155.
10 Vgl. Werner Clement/ Karl Socher, Wirtschaftspolitischer Hintergrund undRahmenbedingungen, in: Georg Turnheim, Österreichs Verstaatlichte. DieRolle des Staates bei der Entwicklung der österreichischen Industrie von1918 bis 2008, Wien 2009, S. 167-193, S. 179f.
11
Entwicklung, da die Industrie über 80 Prozent der Exporte
ausmachte und die Grundstoff- und Produktionsgüterindustrie
fast doppelt so stark war wie die Konsumgüterindustrie.11
Der Aufschwung der österreichischen Industrie hielt auch in den
Jahren 1956 und 1957. Allerdings verlangsamte sich 1958 das
Wachstum infolge einer Rezession in Westeuropa. Bereits ein
Jahr darauf kam es zu einem weltweiten Konjunkturaufschwung.
1960 galt bereits wieder als Konjunkturjahr.
2.2 Die 60er Jahre
Ab 1961 verlangsamte sich das Wirtschaftswachstum. Dies wurde
durch die Umstellung der Industrie von Kohle auf billiges
Benzin und einem damit zusammenhängenden Preisverfall bei
Kohle, Eisen, Stahl, Aluminium, Papier, chemischen Produkten
etc. ausgelöst. Diese Strukturkrise dauerte bis in die Mitte
der 60er Jahre an. In Oberösterreich lag die industrielle
Entwicklung während dieser Zeit zwar immer über dem
Durchschnitt – von 1955 bis 1964 stieg der Anteil der
Beschäftigten in der oberösterreichischen Industrie gemessen an
denen in der gesamtösterreichischen von 16,5 auf 17,9 Prozent
–, jedoch unterlag sie den selben Schwankungen wie die
gesamtösterreichische Entwicklung.12 In den Jahren 1966 und
11 Vgl. Otto Lackinger, 50 Jahre Industrialisierung in Oberösterreich, S.156f.
12 Vgl. Ebd. S. 175f.12
1967 war die österreichische Wirtschaft von einer
Konjunkturabschwächung betroffen. Darauf reagierte die ÖVP-
Regierung mit antizyklischen Maßnahmen. Dies beinhaltete
nachfrageorientierte Maßnahmen wie Auftragsvergaben durch
öffentliche Hand, die Zurückhaltung von Preiserhöhungen durch
die Kammer der gewerblichen Wirtschaft sowie Lohn- und
Einkommenssteuersenkungen. Im Gegenzug konnte man den ÖGB dazu
überreden, seine eingebrachten Lohnforderungen zu reduzieren.13
Zudem sah der, 1968 veröffentlichte und nach dem damaligen
Finanzminister benannte, Koren-Plan einen Strukturwandel, die
Senkung der Produktionskosten, allokative Effekte von
steuerpolitischen Maßnahmen und eine verstärkte
Wettbewerbsfähigkeit durch eine Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes vor.14
3 Der Beginn der wirtschaftlichen Stagnation
und die Krise der Verstaatlichten 13 Vgl. Christian Dirninger, Zum Wandel in der ordnungspolitischen Dimension
der Finanzpolitik, in: Christian Dirninger u.a., Hg., Zwischen Markt undStaat, Geschichte und Perspektiven der Ordnungspolitik in der ZweitenRepublik, (Schriftenreihe des Forschungsinstitutes für politisch-historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek, Salzburg, Bd.29), Wien u.a. 2007, S. 289-450, S. 354f.
14 Vgl. Christian Dirninger, Zugänge zur politischen Ökonomie derStaatsfinanzen in der Zweiten Republik, in: Reinhard Krammer u.a., Derforschende Blick. Beiträge zur Geschichte Österreichs im 20. Jahrhundert.Festschrift für Ernst Hanisch zum 70. Geburtstag, (Schriftenreihe desForschungsinstitutes für politisch-historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek, Salzburg, Bd. 37), Wien u.a. 2010, S. 115-138, S.124f.
13
In den Jahren 1968 bis 1973 kam es nochmals zu einer
Hochkonjunktur von der Oberösterreich besonders profitierte. In
dieser Zeit wurde der Grundstein für die Dominanz der
oberösterreichischen Industrie in Österreich gelegt. 1976 wurde
Oberösterreich zum wichtigsten Industrieland Österreichs. Der
Anteil der Beschäftigten in der österreichischen Industrie
stieg von 18,5 Prozent im Jahr 1965 auf 21,6 Prozent im Jahr
1975.15 Im Unterschied zur Entwicklung in der
gesamtösterreichischen Industrie stiegen die
Beschäftigungszahlen in Oberösterreich – außer im Jahr 1975 –
stetig an. Dies lag daran, dass die Regierung Kreisky
versuchte, trotz Krise die Vollbeschäftigung zu erhalten. Zudem
sollten durch die Zusammenlegung von maroden und gesunden
Betrieben Erstere saniert werden. So wurden zum Beispiel der
VOEST die Hütte Krems GmbH, die Wiener Brückenbau AG und die
Hütte Liezen angegliedert. Zudem verschmolz das Unternehmen
1973 mit der Alpine Montan AG zur VOEST Alpine. Als darüber
hinaus noch die Böhler und die Schöller-Bleckmann AG sowie die
Schiffswerften AG Linz-Korneuburg mit der VOEST fusionierten,
wurde diese zu einem Großunternehmen mit rund 80.000
Beschäftigten. Mit anderen Unternehmen – wie den 1973 in Chemie
Linz umbenannten Stickstoffwerken oder der Aluminium AG
Ranshofen – wurde ähnlich vorgegangen. Für Roman Sandgruber
sind, neben Managementfehlern, eine zu überhastete
Internationalisierung und ein Festhalten an veralteten15 Vgl. Roman Sandgruber, Die Siebzigerjahre. Generationenwechsel, in: Roman
Sandgruber, Hg., Wir Oberösterreicher. Höhepunkte aus unserer Landesgeschichte – Die Fortsetzung, Linz 2011, S. 130-135, S. 133.
14
Produktionsweisen und Produktpalletten zwei wichtige Faktoren
für die Krise der verstaatlichten Industrie in den 80er
Jahren.16 Zudem trug diese Politik zu einer erhöhten
Staatsverschuldung bei. Allerdings sollte nicht vergessen
werden, dass das Ende der Hochkonjunktur durch den
Ölpreisschock 1973 ausgelöst wurde.17 Das Jahr 1975 markierte
schließlich den Beginn einer Jahre andauernden Eisen- und
Stahlkrise. Deren Ursache war eine Marktsättigung – besonders
in der EG -, die mit zu großen Kapazitäten und verstärkter
Konkurrenz aus Lateinamerika und den Ostblockländern auf dem
Weltmarkt Hand in Hand ging.18 Dies hatte eine
Wachstumsrückgang sowie einen Verfall des Stahlpreises zur
Folge. Infolge dessen versuchte die VOEST mehr in die
Finalindustrie zu investieren und in breitere Marktbereiche –
unter anderem den High-Tech-Bereich – vorzudringen.19 Laut
Fritz Weber ergab sich dadurch allerdings das Problem, dass man
in einen Bereich investierte, mit dem man nicht vertraut war.
Die VOEST häufte in dieser Zeit ein immer größeres
Verlustpotenzial an. Die wirtschaftliche Lage war so prekär,
dass gewinnbringende Investitionen und eine wirtschaftliche16 Vgl. Roman Sandgruber, Oberösterreichische Landespolitik und Wirtschaft.
Die „Verstaatlichte“, http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/ooe-landespolitik-u-wirtschaft/ooe-wirtschaft/verstaatlichte/, abgerufen am 10.07.2013.
17 Vgl. Maria Wallner, Strategische Entwicklungen der Industrie inOberösterreich seit 1945, unv. oec. Dipl., Wien 2007, S. 37.
18 Vgl. Hans Kutscher, Die Bewältigung der Stahlkrise aus europäischer Sicht (1985), http://europainstitut.de/fileadmin/schriften/nr38.pdf, abgerufen am 11.07.2013.
19 Vgl. Voestalpine, Die VÖEST-ALPINE AG bis zur Reform der ÖIAG, http://www.voestalpine.com/group/de/konzern/historie/1974-1985.html, abgerufen am: 11.07.2013.
15
Expansion kaum möglich waren. Dies führte zu den
Ölspekulationen, die in einer wirtschaftlichen Katastrophe
endeten.20
Ein Beispiel für die schlechte wirtschaftliche Lage der
Stahlindustrie und die Managementfehler der VOEST sind die
Ereignisse rund um das Stahlwerk Bayou in den USA. Das Werk war
seit seiner Inbetriebnahme 1981 ein reines Verlustgeschäft, was
mit der Stahlkrise in den USA zusammenhing. Insgesamt beliefen
sich die Verluste 1985 laut Rechnungshof auf 432,5 Millionen
Dollar.21 Die 1982 begonnenen Ölspekulationen basierten meist
auf Term-Verträgen, welche allein im Jahr 1985 einen Verlust
von 71 Millionen Dollar zur Folge hatten.22 Die Chemie Linz AG
hatte besonders mit dem zweiten Ölpreisschock 1982 Probleme.
Ihr Verlust belief sich in diesem Jahr auf 849 Millionen
Schilling. Trotzdem wurden die Kapazitäten weiter ausgebaut. Ab
1983 begann man, wie bei der VOEST, mit Ölspekulationen, die
einen Verlust von hunderten Millionen zur Folge hatten.23
Auch die anderen verstaatlichten Unternehmen schrieben im Laufe
der 80er Jahre Verluste. Dies hatte, ähnlich wie bei VOEST und
Chemie Linz AG, die Ursachen in der Schaffung von
Überkapazitäten. Im Falle der indirekt staatlichen Steyr-20 Vgl. Fritz Weber, Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich 1946-
1986, in: Zeitschrift für öffentliche und gemeinwirtschaftlicheUnternehmen, 34/2 (2011), S. 126.147, S. 146.
21 Vgl. Bericht des Rechnungshofes über die Durchführung besonderer Akte derGebarungsüberprüfung hinsichtlich der VOEST-ALPINE AG und Chemie Linz AG,Wien 1986, S. 27-32.
22 Vgl. Ebd, S. 5f.
23 Vgl. Otto Lackinger, 50 Jahre Industrialisierung in Oberösterreich, S.251f.
16
Daimler-Puch-AG brachte der Zusammenbruch des Waffengeschäftes
1982 enorme Verluste.24
4 Das Aufkommen des Neoliberalismus
In den 80er und 90er Jahren kam es international vermehrt zur
Einführung neoliberaler Maßnahmen. Auch Österreich war von
dieser Entwicklung betroffen.
In ihrem 1985 erschienene Buch „Staat lass nach“ schreiben die
beiden ÖVP Politiker Johannes Hawlik, damaliger Wiener
Gemeinderat, und Wolfgang Schüssel, der zu dieser Zeit im
Nationalrat saß: „Kein politisches System, kein Kontinent und
kein Staat scheut sich vor der Privatisierungsdiskussion. Je
größer die wirtschaftlichen Probleme des Staates, desto größer
die Offenheit, über den Abbau der wirtschaftlichen Staatsmacht
zu reden und konkrete Privatisierungsmaßnahmen zu setzten.“25
In der Tat begann in den 80er Jahren eine umfangreiche
Privatisierungswelle, die sowohl Industrieländer als auch
Schwellen- und Entwicklungsländer erfasste. Zwischen 1980 und24 Vgl. Roman Sandgruber, Die Verstaatlichte,
http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/ooe-landespolitik-u-wirtschaft/ooe-wirtschaft/verstaatlichte/, abgerufen am 12.07.2013.
25 Johannes Hawlik/ Wolfgang Schüssel, Staat lass nach. Vorschläge zurBegrenzung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben, Wien 1985, S. 135.
17
1996 wurden weltweit rund 100.000 Groß- und 500.000
Kleinunternehmen privatisiert. Dazu kamen noch
Teilprivatisierungen in der Landwirtschaft, im Finanzwesen, bei
Grund und Boden etc. hinzu. Bei diesen Zahlen handelt es sich
allerdings um einen Schätzung, da für die genaue Erfassung die
Daten fehlen. Das tatsächliche Ausmaß der Privatisierungen
dürfte wesentlich höher gewesen sein.26
Von den großen Volkswirtschaften fing England 1979 als Erste an
konsequent Privatisierungen durchzuführen. In den 90er Jahren
zogen Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland nach. Die
kleinen Volkswirtschaften begannen ebenfalls die Anzahl der
Privatisierungen im Laufe der 90er Jahre zu steigern – allen
voran Belgien und Portugal. Auch in Österreich nahmen die
Privatisierungen in dieser Zeit zu. Die Privatisierungserlöse
im Jahre 1997 beliefen sich auf 2.02 Milliarden Dollar. Damit
waren sie die Zweithöchsten – hinter Portugals -, welche eine
kleine Volkswirtschaft in diesem Jahr erhielt.27
4.1 Das Konzept des Neoliberalismus
Zwar gibt es verschiedene Ausformungen des Neoliberalismus,
dennoch haben sie alle gemeinsam, dass der Markt und seine
26 Vgl. Friedrich Schneider, Privatisierung und Deregulierung in Österreich in den 90er Jahren. Einige Anmerkungen aus Sicht der Neuen Politischen Ökonomie, Linz 2001, http://www.econ.jku.at/papers/2001/wp0106.pdf, abgerufen am 12.07.2013.
27 Vgl. Ebd, http://www.econ.jku.at/papers/2001/wp0106.pdf, abgerufen am12.07.2013.
18
Prozesse nicht durch staatliche Planung ersetzt werden können.
Am konsequentesten vertritt diese Meinung Hayek, laut dessen
Ansichten sämtliche ordnungspolitischen Maßnahmen abzulehnen
sind. Hayeks Theorie gilt als Prototyp des modernen
Neoliberalismus. Sie besagt, dass die Entwicklung einer
Wirtschaftsordnung ein evolutionärer Prozess sei, der nicht
rationalistisch gestaltet werden könne. Im Endeffekt bedeutet
dies, dass nur der Markt sich selbst regeln könne – keine
staatlichen Eingriffe und ordnungspolitischen Maßnahmen. Damit
bildet Hayek die Grundlage für Deregulierungen und
Privatisierungen.28
Für diese Maßnahmen werden oft folgende Argumente verwendet:
- Erstens: Durch den Verkauf staatlicher Unternehmen können
Einnahmen zur Tilgung von Staatsschulden lukriert werden.
- Zweitens: Eine Privatisierung führt zur Verbesserung der
Performance staatlicher Unternehmen, durch eine Steigerung
der Effektivität sowie des Wettbewerbs. In Bezug auf
Ersteres wird argumentiert, dass staatliche Unternehmen
weniger effektiv seien als private, da sie nicht
ausschließlich das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgen
und nicht in Insolvenz gehen können.
- Drittens: Durch Privatisierungen kommt es durch
Unternehmensbeteiligungen zur Verteilung von Einkommen und
Vermögen.29
28 Vgl. Karl-Heinz Brodbeck, Die fragwürdigen Grundlagen des Neoliberalismus.Wirtschaftsordnung und Markt in Hayeks Theorie der Regelselektion, 2004,http://193.174.81.9/professoren/bwl/brodbeck/hayek.pdf, abgerufen am14.07.2013.
19
Allerdings gibt es auch Kritik am Konzept des Neoliberalismus.
Zum Beispiel behauptet ATTAC, dass Unternehmen jeder
gemeinschaftlichen Kontrolle und Verantwortung entzogen und
andere gesellschaftlich wertvolle Ziele (Vollbeschäftigung,
Umweltschutz etc.) dem Ziel, Profit zu machen, untergeordnet
werden. Laut ATTAC kommt es in Folge von Privatisierungen oft
zu Entlassungen, Preissteigerung und Qualitätsverlust. Dass
private Betriebe grundsätzlich erfolgreicher seien, ist für
ATTAC nicht ersichtlich. Auch für den Staat kann sich eine
Privatisierung zum Verlustgeschäft entwickeln, da der Erlös der
Privatisierung nur einmal ausbezahlt wird und der Staat über
mögliche zukünftige Gewinne nicht mehr verfügen kann. In diesem
Zusammenhang wird kritisiert, dass meist nur profitable
Bereiche staatlicher Unternehmen privatisiert werden, während
der Staat auf den Verlusten sitzen bleibt. Die Hauptkritik
besteht also darin, dass neue Märkte und Investitionsfelder für
Privatinvestoren auf Kosten der Allgemeinheit geschaffen
werden.30
4.2 Die Bedeutung des Neoliberalismus in
Österreich
29 Vgl. Michaela Schaffhauser-Linzatti, Ökonomische Konsequenzen derPrivatisierung. Eine empirische Analyse der Entwicklung in österreich,Wiesbaden 2000, S. 33ff.
30 Vgl. Attac Österreich, Privatisierung und Liberalisierung. AttacPositionspapier, Wien 2004, S. 1ff.
20
Die Meinung, dass der Staat so wenig wie möglich in die
Wirtschaft eingreifen sollte, existierte natürlich bereits vor
der Verstaatlichtenkrise. Die ÖVP stimmte der Verstaatlichung
nach dem Zweiten Weltkrieg nur als Übergangslösung und mit dem
Ziel, die betroffenen Betriebe später wieder reprivatisieren zu
können, zu.31 Allerdings gab es zu diesem unterschiedliche
Auffassungen der einzelnen Bünde. So vertrat der ÖAAB die
Ansicht, dass bestimmte Schlüsselindustrien verstaatlicht
werden sollten. Diese Meinung hielt er auch noch in den 80er
Jahren aufrecht. Der Wirtschafts- und der Bauernbund hingegen
sahen in ihr nur ein notwendiges Übel.32
Demgegenüber stand das Programm der SPÖ und der Gewerkschaften,
in dem von der Verstaatlichung aller wichtigen Betriebe
(Grundstoffindustrie, Banken etc.) zum Wiederaufbau der
Volkswirtschaft und der gemeinwirtschaftlichen Verwaltung die
Rede war.33
Im Zuge der Krise der Verstaatlichten befanden sich die
neoliberalen Forderungen auf dem Vormarsch. Bereits vor dem
Debakel der VOEST wurden von Seiten der ÖVP – durch
internationale Tendenzen beflügelt – Privatisierungen innerhalb
31 Vgl. Claudia Desch, Privatisierungen am Sektor der verstaatlichtenIndustrie als Instrument einer liberalen österreichischenWirtschaftspolitik. Eine Analyse von 1945 bis zum Jahr 2001, unv. phil.Dipl., Salzburg 2001, S. 18.
32 Vgl. Dieter Stiefel, Verstaatlichung und Privatisierung, S. 60f.
33 Vgl. Claudia Desch, Privatisierung am Sektor der verstaatlichtenIndustrie, S. 16f.
21
der verstaatlichten Industrie gefordert. Auch die FPÖ lehnte
die Verstaatlichung grundsätzlich ab.34
Die Forderungen der ÖVP wurden 1985 noch vehementer.35 Zwar gab
es zu dieser Zeit auch innerhalb der ÖVP Stimmen, die sich zur
Verstaatlichung bekannten. Der Wirtschaftsbund jedoch sah in
der Krise ein Scheitern der Verstaatlichung und forderte deren
Privatisierung der Unternehmen. Dem entgegnete zum Beispiel
Franz Vranitzky, dass die Krise nicht auf den Staatsbesitz
sondern auf die internationale Eisen-und Stahlkrise sowie
Managementfehler zurückzuführen sei.36
Jedoch änderte die SPÖ ihre Positionen nach dem
wirtschaftlichen Debakel der Verstaatlichten. Im
Koalitionspapier wurde auf Forderungen der ÖVP eingegangen.
Infolge dessen wurden Privatisierungen von Teilen der ÖMV,
Tochterunternehmen der VOEST, und anderer Betriebe
vorgenommen.37 1990 wurden zusätzliche Privatisierungsschritte
beschlossen. Die Grenze von 50% Privatanteil fiel. Vor dem
Hintergrund der Krise der Aluminiumindustrie konnte die ÖVP mit
dem ÖIAG- Gesetz 1993 alle ihre Forderungen nach einer
großangelegten Privatisierungswelle durchsetzten.38
34 Vgl. Oliver Wieser, Unternehmenskultureller Wandel durch Privatisierungvon Management-Buy-Outs innerhalb der verstaatlichten Industrie, (Theorieund Forschung, Bd. 469, Wirtschaftswissenschaften, Bd. 45), Regensburg1997, S. 72.
35 Vgl. Ebd. S. 74.
36 Vgl. Dieter Stiefel, Verstaatlichung und Privatisierung, S. 189f.
37 Vgl. Oliver Wieser, Unternehmenskultureller Wandel, S. 77ff.
38 Vgl. Ebd. S. 82-85.22
5 Die Privatisierung der oberösterreichischen
Industrie
Die direkt und indirekt verstaatlichte Industrie in
Oberösterreich wurde mit Ende der 80er und während der 90er
Jahre stückweise privatisiert. Unter den betroffenen Betrieben
befanden sich unter anderem: Die Steyr- Daimler- Puch Werke,
die ab 1988 an die SKF, die MAN, die CASE- Corporation, den
Magna-Konzern und das eigene Management verkauft wurden. Die
Österreichische Schiffswerften AG wurde 1990 privatisiert. Die
Austria Metall AG wurde an Hammerer Turnauer abgegeben. Die
Voest-ALPINE Technologie AG wurde 1994 zu 51 Prozent
privatisiert, die Voest-ALPINE Stahl AG zu 66,6 Prozent. Die
Chemie Linz AG wurde großteils von der holländischen DSM
übernommen. Dazu wurden noch andere Betriebe privatisiert oder
stillgelegt.39 Seit dem Jahr 2005 befindet sich die Voest
schließlich gänzlich in Privatbesitz. Die größten Aktionäre der
Voest sind aktuell die Raiffeisenkasse Oberösterreich mit 15,
die Mitarbeiterstiftung der Voest mit 14,4, die Oberbank mit
7,9 und die Norges Bank mit 4 Prozent der Anteile.40
39 Vgl. Roman Sandgruber, Oberösterreichische Landespolitik und Wirtschaft.Die Privatisierungswelle der Verstaatlichten,http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/ooe-landespolitik-u-wirtschaft/ooe-wirtschaft/privatisierung/, abgerufen am 16.07.2013.
40 Vgl. Voestalpine, Aktie,http://www.voestalpine.com/group/de/investoren/voestalpine-aktie,abgerufen am 16.07.2013.
23
Das BIP der österreichischen Industrie stieg von 1995 bis 2011
um fast 23 Milliarden Euro.41 Die oberösterreichische Industrie
macht aktuell rund 25 Prozent der gesamtösterreichischen
Industrie aus.42 Allerdings hat dieses Wachstum seine Ursachen
nicht ausschließlich in der Privatisierung. So hat laut
Wirtschaftskammer der EU-Beitritt und die Einführung des Euro,
infolge dessen die Exporte erheblich stiegen, einen
wesentlichen Anteil an diesem Wachstum.43 Währenddessen gingen
die Zahlen der Industriebeschäftigten in den Jahren der
Privatisierung sowie den darauffolgenden zurück.44
41 Vgl. WKO, Österreichs Industrie Kennzahlen 2012, Wien 2012, http://www.fmmi.at/fileadmin/content/Dokumente/Zahlen_Daten_Fakten/industriekennzahlen_2012.pdf, abgerufen am 18.07.2013.
42 Vgl. wk/ooe sparte.industrie, Industrieland Oberösterreich. Daten und Fakten, 2013, http://wko.at/ooe/Branchen/Industrie/Homepage/Daten%20und%20Fakten%202013.pdf, abgerufen am 18.07.2013.
43 Vgl. WKO, Euro ist für Oberösterreich unverzichtbar, 2012, http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?angid=1&stid=693850&dstid=678, abgerufen am 18.07.2013.
44 Vgl. Claudia Desch, Privatisierung am Sektor der verstaatlichtenIndustrie, S. 112.
24
6 Schlussfolgerung
Die oberösterreichische Industrie spielte in der
österreichischen und oberösterreichischen Wirtschaft eine
bedeutende Rolle. Die Frage: „Wie entwickelte sich die
oberösterreichische Industrie?“, lässt sich mit folgender These
beantworten: „Die oberösterreichische Industrie entwickelte
sich auf Grundlage des Wiederaufbaus und profitierte dabei vom
Wirtschaftsaufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg.“ Dabei
profitierte das Bundesland davon, dass die Industrie während
des Zweiten Weltkriegs nicht vollkommen zerstört wurde sowie
von der Förderung der westlichen Besatzungszonen – besonders in
Form des Marshallplanes. Bis in die 60er Jahre lässt sich,
trotz vereinzelter Schwankungen, grundsätzlich ein stabiles,
hohes Wachstum ausmachen, welches mit einer hohen Nachfrage in
der Phase des Nachkriegsaufschwungs zusammenhing. Einzelne
Ereignisse, wie der Koreakrieg, trugen phasenweise zu einem
starken Wachstum bei. Zudem kann man behaupten, dass die25
staatliche Intervention und der Aufbau der Industrie durch den
Staat eine wichtige Grundlage für den Aufschwung der Industrie
und der Wirtschaft im Allgemeinen war, wobei auch die
Privatwirtschaft davon profitierte.
Die Krise der Verstaatlichten hing mit dem Ende des
Nachkriegsaufschwungs, der endgültig durch die Wirtschaftskrise
in den 70er und 80er Jahren markiert wurde, zusammen. Besonders
die Eisen- und Stahlkrise, die aus dem Einbruch der Nachfrage
und einer Überproduktion resultierte, traf die
oberösterreichische Industrie hart. Die darauffolgenden
Fehlinvestitionen und Spekulationen sorgten letztendlich für
die Krise der verstaatlichten Industrie. Vor allem in dieser
Zeit waren neoliberale Forderungen nach der Privatisierung auf
dem Vormarsch, auch wenn sie seit Beginn der Zweiten Republik
vorhanden waren.
Die Privatisierung hatte letztendlich zur Folge, dass
Privatinvestoren neue Investitionsfelder vorfanden. Der Anstieg
des BIPs in den darauffolgenden Jahren lässt daraus schließen,
dass die sich Privatisierung für die Investoren zu einem
lukrativen Geschäft entwickelte. Auf der anderen Seite nahm die
Beschäftigungszahl in der oberösterreichischen Industrie
während und nach der Privatisierung ab.
7 Abkürzungsverzeichnis
26
ATTAC: association pour une taxation des transactions
financières pour l'aide aux citoyens, Deutsch: Vereinigung zur
Besteuerung von Finanztransaktionen zugunsten der BürgerInnen
ERP: European Recovery Programe
FPÖ: Freiheitliche Partei Österreichs
ÖAAB: Österreichischer Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbund
ÖIAG: Österreichische Industrieholding Aktien Gemeinschaft
ÖMV: Österreichische Mineralölverwaltung
ÖVP: Österreichische Volkspartei
SPÖ: Sozialistische Partei Österreichs, ab 1991
Sozialdemokratische Partei Österreichs
VOEST: Vereinigte Österreichische Eisen- und Stahlwerke
27
8 Quellenverzeichnis
Attac Österreich, Privatisierung und Liberalisierung. Attac
Positionspapier, Wien 2004. Bericht des Rechnungshofes über
die Durchführung besonderer Akte der Gebarungsüberprüfung
hinsichtlich der VOEST-ALPINE AG und Chemie Linz AG, Wien
1986.
Hawlik Johannes/ Schüssel Wolfgang, Staat lass nach. Vorschläge
zur Begrenzung und Privatisierung öffentlicher Aufgaben,
Wien 1985.
Voestalpine, Aktie,
http://www.voestalpine.com/group/de/investoren/voestalpine-
aktie , abgerufen am 16.07.2013.
Voestalpine, Die VÖEST-ALPINE AG bis zur Reform der ÖIAG,
http://www.voestalpine.com/group/de/konzern/historie/1974-
1985.html, abgerufen am: 11.07.2013.
WKO, Euro ist für Oberösterreich unverzichtbar, 2012,
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?
angid=1&stid=693850&dstid=678, abgerufen am 18.07.2013.
WKO, Österreichs Industrie Kennzahlen 2012, Wien 2012,
http://www.fmmi.at/fileadmin/content/Dokumente/Zahlen_Daten_F
akten/industriekennzahlen_2012.pdf, abgerufen am 18.07.2013.
wk/ooe sparte.industrie, Industrieland Oberösterreich. Daten
und Fakten, 2013,
28
http://wko.at/ooe/Branchen/Industrie/Homepage/Daten%20und
%20Fakten%202013.pdf, abgerufen am 18.07.2013
9 Literaturverzeichnis
Brodbeck Karl-Heinz, Die fragwürdigen Grundlagen des
Neoliberalismus. Wirtschaftsordnung und Markt in Hayeks
Theorie der Regelselektion, 2004,
http://193.174.81.9/professoren/bwl/brodbeck/hayek.pdf,
abgerufen am 14.07.2013.
Clement Werner/ Karl Socher, Wirtschaftspolitischer Hintergrund
und Rahmenbedingungen, in: Georg Turnheim, Hg., Österreichs
Verstaatlichte. Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der
österreichischen Industrie von 1918 bis 2008, S. 167-193,
Wien 2009.
Desch Claudia, Privatisierungen am Sektor der verstaatlichten
Industrie als Instrument einer liberalen österreichischen
Wirtschaftspolitik. Eine Analyse von 1945 bis zum Jahr 2001,
unv. phil. Dipl., Salzburg 2001.
Dirninger Christian, Zugänge zur politischen Ökonomie der
Staatsfinanzen in der Zweiten Republik, in: Reinhard Krammer
u.a., Hg., Der forschende Blick. Beiträge zur Geschichte29
Österreichs im 20. Jahrhundert. Festschrift für Ernst Hanisch
zum 70. Geburtstag, (Schriftenreihe des Forschungsinstitutes
für politisch-historische Studien der Dr.-Wilfried-Haslauer-
Bibliothek, Salzburg, Bd. 37), Wien u.a. 2010, S. 115-138.
Dirninger Christian, Zum Wandel in der ordnungspolitischen
Dimension der Finanzpolitik, in: Christian Dirninger u.a.,
Hg., Zwischen Markt und Staat, Geschichte und Perspektiven
der Ordnungspolitik in der Zweiten Republik, (Schriftenreihe
des Forschungsinstitutes für politisch-historische Studien
der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek, Salzburg, Bd. 29), Wien
u.a. 2007, S. 289-450.
Forum OÖ Geschichte, Das Wirtschaftswunder. Das
Energieproblem, http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-
2005/das- wirtschaftswunder/westorientierung-und-aufschwung/
das-energieproblem/, abgerufen am 04.07.2013.
Forum OÖ Geschichte, Das Wirtschaftswunder.
Nachkriegswirtschaft in Oberösterreich,
http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/das-
wirtschaftswunder/westorientierung-und-aufschwung/
nachkriegswirtschaft/, abgerufen am 04.07.2013.
Kutscher Hans, Die Bewältigung der Stahlkrise aus europäischer
Sicht, (Vorträge, Reden und Berichte aus dem Europainstitut,
Nr.38) Saarbrücken 1984,
30
http://europainstitut.de/fileadmin/schriften/nr38.pdf,
abgerufen am 11.07.2013.
Lackinger Otto, 50 Jahre Industrialisierung in Oberösterreich,
1938 – 1988, 1945 – 1995, Linz 1997.
Sandgruber Roman, Oberösterreichische Landespolitik und
Wirtschaft. Die Privatisierungswelle der Verstaatlichten,
http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945- 2005/ooe-
landespolitik-u-wirtschaft/ooe-wirtschaft/privatisierung/,
abgerufen am 16.07.2013.
Sandgruber Roman, Oberösterreichische Landespolitik und
Wirtschaft. Die „Verstaatlichte“,
http://www.ooegeschichte.at/epochen/1945-2005/ooe-
landespolitik-u-wirtschaft/ooe-wirtschaft/verstaatlichte/,
abgerufen am 10.072013.
Sandgruber Roman, Sonderfall Oberösterreich?. Die NS-Zeit und
die Industrialisierung des Landes, in: Ute Streitt u.a., Hg.,
Technikland Oberösterreich. Wirtschaftliche Entwicklungen und
industrielle Gegenwart, (Studien zur Kulturgeschichte von
Oberösterreich, Folge 32), Linz 2013.
Sandgruber Roman, Die Siebzigerjahre. Generationenwechsel, in:
Roman Sandgruber, Hg., Wir Oberösterreicher. Höhepunkte aus
unserer Landesgeschichte – Die Fortsetzung, Linz 2011, S.130-
135.
Schaffhauser-Linzatti Michaela, Ökonomische Konsequenzen der
Privatisierung. Eine empirische Analyse der Entwicklung in
Österreich, Wiesbaden 2000.
31
Schneider Friedrich, Privatisierung und Deregulierung in
Österreich in den 90er Jahren. Einige Anmerkungen aus Sicht
der Neuen Politischen Ökonomie, Linz 2001,
http://www.econ.jku.at/papers/2001/wp0106.pdf, abgerufen am
12.07.2013.
Dieter Stiefel, Verstaatlichung und Privatisierung in
Österreich. Illusion und Wirklichkeit, Wien u.a. 2011.
Turnheim Georg, Die verstaatlichten Unternehmen zwischen 1945
und 1955, in: Georg Turnheim, Hg., Österreichs Verstaatlichte.
Die Rolle des Staates bei der Entwicklung der
österreichischen Industrie von 1918 bis 2008, Wien 2009, S.
29-50.
Tweraser Kurt, US-Militärregierung in Oberösterreich 1945-
1950. Amerikanische Industriepolitik am Beispiel VOEST und
Steyr-Daimler-Puch, Linz 2009.
Wallner Maria, Strategische Entwicklungen der Industrie in
Oberösterreich seit 1945, unv. oec. Dipl., Wien 2007.
Weber Fritz, Verstaatlichung und Privatisierung in Österreich
1946-1986, in: Zeitschrift für öffentliche und
gemeinwirtschaftliche Unternehmen, 34/2 (2011), S. 126-147.
Wieser Oliver, Unternehmenskultureller Wandel durch
Privatisierung von Management-Buy-Outs innerhalb der
verstaatlichten Industrie, (Theorie und Forschung, Bd. 469,
Wirtschaftswissenschaften, Bd. 45), Regensburg 1997.
32