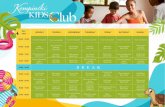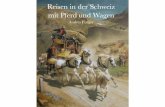Renaissance des Mittelalters? Zu den Dante-Illustrationen von Sandro Botticelli
Die "Madonna der Ertrunkenen" von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon: Ein Campioneser...
Transcript of Die "Madonna der Ertrunkenen" von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon: Ein Campioneser...
187
Das Tympanon im Salzburg Museum (Abb. 1) stellt ein faszi-nierendes Problem dar, für dessen Lösung bis heute keine geeigneten Nachweise gefunden wurden. Der ursprüngli-che Bestimmungsort des Werks, das im Jahr 1873 aus dem Paracelsus-Haus ins Salzburger Museum kam, ist unbe-kannt. Allerdings besteht wegen der Verwendung von Un-tersberger Marmor aus den nicht weit von der Salzburger Innenstadt gelegenen Steinbrüchen kein Zweifel, dass es aus einer Kirche dieser Stadt stammt. Aufgrund der Marien-darstellung auf dem Bogenfeld ist es wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher, dass es aus einem verlorengegangenen Portal der Franziskanerkirche stammt, die bereits im 12. Jahr-hundert „Zu unserer Lieben Frau“1 genannt und erstmals in der Spätgotik umgebaut wurde. Für das Tympanon selbst ist kein Zeitrahmen nachweis-bar. Nachdem die ersten Hypothesen betreffend einer sehr frühe Datierung (ca. 1150)2 verworfen wurden, ist sich die Fachwelt nunmehr darüber einig, dass das Relief der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts zuzuordnen ist, sowohl auf-grund des Stils3 als auch wegen der epigrafischen Beschaf-fenheit der Inschriften auf den von den beiden Engeln ge-haltenen Schriftrollen4. Schließlich sind uns bisher weder Identität noch Her-kunft des Schöpfers bekannt, und das Bogenfeld wurde bis-weilen als Höhepunkt der Entwicklung einer lokalen Schule präsentiert5. Ungelöst bleibt daher das Problem der engen stilistischen Verwandtschaft mit der Madonna der Ertrun-kenen im Dom San Vigilio in Trient (Abb. 2). Erst in jüngster Zeit hat Friedrich Dahm6 im Rahmen einer Abhandlung
über romanische Bildhauerei im Salzburger Land den Schöp-fer des Tympanons als „Trentiner“ bezeichnet. Somit wurde erstmals eine direkte Verbindung zur Dombauhütte in Tri-ent hergestellt. Damit scheint man auf dem richtigen Weg zu sein, denn die stilistischen Ähnlichkeiten der beiden Wer-ke sind nicht zu leugnen: ein sowohl von italienischen als auch von deutschsprachigen Experten lange vernachlässig-tes Indiz, das bisweilen damit erklärt wird, dass sich beide Skulpturen möglicherweise von einem gemeinsamen Pro-totyp ableiten lassen7. Im Dom San Vigilio in Trient war ab 1212 nachweislich eine Familie von Campioneser Baumeistern tätig, die aus Arogno, einem kleinen Ort am Luganersee im Kanton Tessin, stammt. Die Hypothese, Mitglieder dieser Familie seien in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts von Trient nach Salz-burg gezogen, ist angesichts der jüngsten Studien über die „Lombardische Schule“ (oder besser „Campioneser Schule“) in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine genauere Be-trachtung wert. Das kritische Konzept der Campioneser Bildhauerei ist Geza de Francovich8 zu verdanken, der Werke aus der Zeit vom Ende des 12. bis zur ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts, die von Meistern aus dem Gebiet der lombardischen Seen geschaffen wurden, in dem auch Arogno und Campione lie-gen, unter dieser Bezeichnung zusammenfasste. Im frühen 13. Jahrhundert waren die Campioneser Meister in einem ausgedehnten geografischen Gebiet tätig, das sich von der Poebene (Bologna, Mantua, Mailand, Modena) im Norden bis Trient und im Süden bis zur Toskana (Lucca, Pistoia, Pisa)
Luca Siracusano
Die „Madonna der Ertrunkenen“ von Trient
und das Salzburger Marien-Tympanon
Ein Campioneser Bildhauer auf Reisen?
188
Siracusano
Abb. 1 Adamo d’Arogno (?), Marien-Tympanon mit Jesuskind und Engeln, ca. 1230 (Detail).Untersberger Marmor, 97 x 197 x 40 cm. Salzburg Museum, Inv.-Nr. 154/32
189
Die „Madonna der Ertrunkenen“ von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon
Abb. 2 Adamo d’Arogno (?), Madonna der Ertrunkenen, ca. 1220. Kalkstein, 120 x 54 x 44 cm.Trient, Dom San Vigilio
190
erstreckte. Diese Meister schufen Werke von großer „plasti-scher Kraft und ausdrucksstarker Ehrlichkeit mit einer of-fensichtlichen Neigung zu polierten, glatten Formen“9. Man kann daher von einer gemeinsamen stilistischen Ausrich-tung all dieser Künstler sprechen, wie dies Costantino Baro-ni forderte, für den sich die Campioneser Bildhauerei durch „weniger gequälte und nervöse Modellierung, sanfter und rundlicher im Relief, das sich vom Hintergrund abhebt“ so-wie durch „einfache und anschauliche Unbewegtheit der Figuren“10 auszeichnete. Die These einer gemeinsamen stilistischen Ausrich-tung, über die sich diese Meister, die in geografisch weit voneinander entfernten Gebieten tätig waren, miteinander in Verbindung bringen lassen, wurde auch in jüngster Zeit mit Nachdruck vertreten11. Vor allem waren die lombardi-schen Bildhauer häufig miteinander verwandt und durch
ein untrennbares Band mit ihrer Heimat verbunden, in der ihre Besitztümer und wirtschaftlichen Interessen lagen und wohin sie in den Wintermonaten zurückkehrten, wenn die Werkstätten, in denen sie arbeiteten, zeitweilig geschlossen waren. Sowohl die Madonna der Ertrunkenen von Trient als auch das Salzburger Tympanon sind äußerst voluminös und weisen klare stereometrische Formen und eine unmittelba-re Ausdruckskraft auf, die einen Vergleich mit dem soge-nannten Virgilio im Museum San Sebastiano in Mantua (Abb. 3), einem ungefähr aus dem Jahr 1230 stammenden Campioneser Werk12, gestatten. Das kraftvolle Relief der bei-den Engel des Marientympanons, die sich deutlich vom fla-chen Hintergrund des Bogenfeldes abheben, weckt durch-aus Erinnerungen an den Diacono aus dem Museum Santo Stefano in Bologna (Abb. 4), das Werk eines anderen lombar-
Siracusano
Abb. 3 Campioneser Bildhauer, „Virgilio“, ca. 1230. Kalkstein, 124 x 73 x 41 cm. Mantua, Museo della Città di Palazzo di San Sebastiano
Abb. 4 Campioneser Bildhauer: „Diacono“ (Hl. Stefan?), ca. 1200–1225. Stein, 92 x 28 x 12 cm. Bologna, Museo di Santo Stefano
191
dischen Meisters aus dem frühen 13. Jahrhundert13, das eine ähnlich glatte Oberfläche und kraftvolle volumetrische Form der Figuren aufweist. Zwischen der Madonna der Ertrunkenen und dem Salz-burger Tympanon lässt sich jedoch eine noch stärkere Ver-bindung herstellen: Die Madonna in Trient und das Relief im Salzburg Museum stammen meiner Ansicht nach vom sel-ben Künstler. Die schwere Drapierung mit kurvenförmigen Wülsten und großen röhrenförmigen Falten, der in wellen-förmige Falten gelegte Rand des Kleides zwischen den Fü-ßen der sitzenden Figur, das Muster der Zöpfe sowie das Zick-Zack-Ornament, das den Thron in Trient ebenso wie die Krone der Salzburger Madonna schmückt, lassen den Schluss zu, dass all dies von einem Bildhauer geschaffen wurde (Abb. 5–8). Die Ähnlichkeiten sind deutlich erkennbar, trotz der kräftigen Polierung, die zu einem unbestimmten Zeitpunkt am Salzburger Tympanon vorgenommen wurde
und sich nachteilig auf die ergänzenden Restaurierungsar-beiten auswirkte, die nach den Bombenangriffen im Jahr 1944 erforderlich waren14. Wie lässt sich nun die Reise unse-res Bildhauers von Trient nach Salzburg begründen? Ein rascher Blick auf einige Werkstätten, in denen die Campioneser Meister nachweislich tätig waren, kann sich für unsere Ausführungen als nützlich erweisen. In Modena arbeiteten etwa zwischen 1190 und 1244 drei Generationen einer einzigen Familie von Meistern aus Campione15. Ihre Tä-tigkeit und ihre Verbindung zur Bauhütte sind in einem Ver-trag dokumentiert: Am 30. November 1244 erneuerte der magister lapidum Enrico mit dem massarium des Doms San Geminiano die von seinem Großvater Anselmo signierten Verträge. Auf der Grundlage dieser Verträge konnte der Bau-meister Enrico spezialisierte Arbeiter einsetzen, die nicht der Werkstätte angehörten. Hierbei handelt es sich um ei-nen äußerst wichtigen Umstand. Vermutlich aufgrund die-
Die „Madonna der Ertrunkenen“ von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon
Abb. 5 Adamo d’Arogno (?), Madonna der Ertrunkenen (Detail)
Abb. 7 Adamo d’Arogno (?), Madonna der Ertrunkenen (Detail)
Abb. 6 Adamo d’Arogno (?), Marien-Tympanon (Detail)
Abb. 8 Adamo d’Arogno (?), Marien-Tympanon (Detail)
192
ser Klausel wurde Guido Bigarelli nach Modena berufen, der einer anderen Familie von Campioneser Meistern angehör-te, die in der Toskana, in den Diözesen Lucca, Pisa und Pistoia verwurzelt war. Guido Bigarelli wurde um 1250 nach Mode-na berufen, um die Rosette an der Westfassade und die bei-den Statuen, die das Dach der Kathedrale krönen, auszufüh-ren. Auch wenn Guidos Aufenthalt in Modena bislang nicht dokumentiert werden konnte, so wird sein Wirken im Dom San Geminiano von der Fachwelt aufgrund exakter stilisti-scher Vergleiche zwischen den oben erwähnten Skulpturen und den beiden vom Künstler in Pisa und Pistoia signierten Werken doch akzeptiert16. Der Fall Trient ist in diesem Sinn ebenso interessant. Wie in Modena wurden auch in Trient Nachweise für drei Generationen einer einzigen Familie von Campioneser Meis-tern gefunden. Leiter der Bauhütte des neuen Doms San Vi-gilio, der 1212 eingeweiht wurde, war Magister Adamo d’Arogno, wie aus einer einst außen am Chor eingemauer-ten Inschrift hervorgeht17. Ebenso wie in Modena wurden zu einem bestimmten Zeitpunkt auch nach Trient Campione-ser Arbeiter geholt, die nicht der Werkstätte angehörten, sondern aus der Toskana kamen, um die beiden Baldachin-portale des Doms anzufertigen. In diesem Fall sind zusätz-lich zu den stilistischen Nachweisen auch genaue urkundli-che Bestätigungen vorhanden: Guidobono Bigarelli18, ein Cousin des oben angeführten Guido, erwähnte in seinem im Jahr 1258 in Lucca aufgesetzten Testament eine erhebli-che Summe in Bezug auf das „laborerium sancti Vigilii“19. Adamo d’Arogno und die Bigarellis stammten ursprünglich aus demselben Ort, und ihre Zusammenarbeit gipfelte in der Hochzeit von Guidobono mit einer Nichte von Adamo; aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor, der seinerseits eben-falls in Trient tätig war20.
Die oben angeführten Fälle sind Beweise für die Mobi-lität dieser Bildhauer, für die es problemlos möglich war, von der Toskana nach Modena und ins Trentin zu reisen. Daher ist auch die Reise unseres Campionesers, die ihn schließlich nach Salzburg geführt hat, keine Überraschung. Einer der Gründe dafür Reise waren möglicherweise die gute Bezie-hung zwischen den Domkapiteln der beiden Städte, die nachweislich bereits im 12. Jahrhundert bestand, als Fürstbi-schof Altmann von Trient immer wieder Schenkungen an das Salzburger Domkapitel veranlasste, dem er vermutlich vor seiner Berufung auf den Bischofsstuhl von San Vigilio angehörte21. Das Schicksal unseres Meisters, der die Alpen überqueren sollte, um nach Österreich zu gelangen, weist daher Parallelen zu dem seiner Landsmänner Guido und Guidobono Bigarelli auf, die den Appennin überquert hat-ten: Auch andere Campioneser Bildhauer waren in der ers-ten Hälfte des 13. Jahrhunderts auf Reisen. Mit einem Blick auf die Bauhütte von San Vigilio in Tri-ent ist es möglich, rein hypothetisch einen Namen für den Schöpfer des Tympanons im Salzburg Museum zu nennen und dazu einen genauen zeitlichen Ablauf zu erstellen. Beim Marien-Tympanon handelt es sich zwar um ein Einzelstück, aber die Skulpturen in Trient sind Teil der Bauhütte des 13. Jahrhunderts, für die Nachweise und epigrafische Zeugnis-se zur Verfügung stehen. Im Dom von Trient zeichnet der Schöpfer der Madonna der Ertrunkenen auch für die in der Apsis an der Südwand angebrachte Steinigung des Hl. Stefan (Abb. 9) sowie für die Gruppe Jesus Christus Pantokrator mit den Symbolen der Evangelisten (Abb. 11) im Tympanon des Nordportals verant-wortlich. Wir wissen heute, dass die Apsis an der Südwand der älteste im Rahmen der Trentiner Bauhütte errichtete Teil des Gebäudes ist, und dieses Wissen erlaubt uns die Datie-
Abb. 9a–b Adamo d’Arogno (?), Steinigung des Hl. Stefan, nach 1212. Kalkstein, jede Platte 140 cm. Trient, Dom San Vigilio
Siracusano
193
rung des Reliefs mit dem Hl. Stefan auf unmittelbar nach Beginn der Arbeiten im Jahr 121222. Am Nordportal wurde hingegen in den 30er Jahren gearbeitet: An der Konstrukti-on des Eingangs war aller Wahrscheinlichkeit nach auch Guidobono Bigarelli beteiligt, der vermutlich in diesem Jahr-zehnt in Trient tätig war23. Die Madonna der Ertrunkenen, die sich in einer Nische in der Nähe des Portals befindet, muss in diese Zeitspanne fallen. Der Bildhauer war somit in der ersten Bauphase des Doms San Vigilio tätig. Laut Nicolò Rasmo24 könnten diese Werke Adamo d’Arogno selbst zugeschrieben werden, dem ersten Baumeister der Bauhütte. Adamo war nachweislich von 1212 bis 123625 dort tätig, was zeitlich mit der Entste-hung dieser Werke übereinstimmt. Es ist keineswegs verwe-gen, wenn man in einer Zeit, in der Architektur und plasti-sche Dekoration untrennbar verbunden waren, den Namen des Baumeisters mit den in der Bauhütte hergestellten Skulpturen hoher Qualität in Verbindung bringt. Ein ande-res Problem von möglicherweise größerer Tragweite könnte damit auch für Benedetto Antelami entstehen, den „sculp-
tor Benedictus“, den Schöpfer des Architravs im Baptisteri-um von Parma, als dessen Architekt er auch für gewöhnlich gilt, wenngleich keine exakten diesbezüglichen Nachweise vorhanden sind26. Der Schöpfer des Marien-Tympanons im Salzburg Mu-seum kann somit hypothetisch als Adamo d’Arogno identifi-ziert werden. Es ist möglich, dass der Meister vorüberge-hend nach Salzburg berufen wurde, um eine neue Bauhütte zu eröffnen. Wir kehren in Kürze zu den in der Franziskaner-kirche verbliebenen Nachweisen aus dem 13. Jahrhundert zurück, dürfen jedoch nicht außer Acht lassen, dass die Wei-he der Kirche im Jahr 1224 stattfand. Dieses Datum liegt mit-ten im zeitlichen Rahmen für Adamo. Als Alternative können wir in Erwägung ziehen, dass die Tatsache, dass ab dem Jahr 1236 keine urkundlichen Nachweise für den Aufenthalt des Meisters in Trient vor-handen sind, nicht unbedingt auf seinen plötzlich eingetre-tenen Tod zurückzuführen sein muss, sondern vielmehr auf seine Reise nach Österreich. Mit dem Jahr 1236 beginnt eine kritische Phase in der Geschichte der Trentiner Fürstbischö-
Abb. 10 Adamo d’Arogno (?), Marien-Tympanon mit Jesuskind und Engeln, ca. 1230. Untersberger Marmor, 97 x 197 x 40 cm.Salzburg Museum, Inv.-Nr. 154/32x
Die „Madonna der Ertrunkenen“ von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon
194
Abb. 11 Adamo d’Arogno (?), Jesus Christus Pantokrator mit Symbolen der Evangelisten, ca. 1230. Kalkstein bemalt, ca. 200 cm.Trient, Dom San Vigilio
Abb. 13 Campioneser Meister, Südportal, ca. 1230. UntersbergerMarmor. Salzburg, Franziskanerkirche
Abb. 15 Campioneser Meister, Architrav des Südportals, ca. 1230. Kalk-stein, ca. 150 cm groß. Trient, Dom San Vigilio
Abb. 12 Campioneser Bildhauer: Tympanon mit Jesus ChristusPantokrator und zwei Figuren, die Kirchenbauten in den Händen halten, ca. 1230. Kalkstein, teilweise bemalt, 86 x 185, 5 x 25,5 cm. Salzburg, Franziskanerkirche
Abb. 14 Campioneser Meister, Nordportal, ca. 1230. Kalkstein. Trient, Dom San Vigilio
Abb. 16 Campioneser Meister, Architrav des Südportals, ca. 1230. Un-tersberger Marmor, 43 x 225 x 25,5 cm. Salzburg, Franziskanerkirche
Siracusano
195
fe. Kaiser Friedrich II., der mit dem Kampf gegen die lombar-dischen Kommunen beschäftigt war, setzte in Trient einen seiner Bevollmächtigten ein, um das Gebiet besser kontrol-lieren zu können. Zwanzig Jahre lang besaß der Trentiner Bi-schof praktisch keine weltlichen Befugnisse27. Es ist mög-lich, dass es Adamo in dieser unruhigen Zeit vorgezogen hatte, auf der Suche nach neuen Arbeitsmöglichkeiten in den Norden zu ziehen. Die Anwesenheit des Meisters in Salzburg muss jeden-falls nicht notwendigerweise von kurzer Dauer gewesen sein, denn mit dem Tympanon im Salzburg Museum lassen sich auch andere Werke in Zusammenhang bringen. In Fach-kreisen wurde das Tympanon der Franziskanerkirche (Abb. 12) bereits mit dem Werk von Meistern aus der Bauhütte von Trient in Verbindung gebracht28. Ein Vergleich mit der Adamo zugeschriebenen plastischen Gestaltung des Nord-portals des Trentiner Doms (Abb. 11) scheint diese Lesart zu bestätigen: In den Figuren ist dieselbe Vorliebe für volumi-nöse Formen zu erkennen, und die schweren Drapierungen weisen einen ganz ähnlichen Faltenwurf auf. Die stilistischen Vergleiche sind in diesem Fall nicht so zwingend, dass für die Salzburger Skulpturen zwangsläufig der Name Adamo d’Arogno fallen muss; es könnte sich auch um einen Mitarbeiter des Meisters handeln. Bedeutsam ist, dass wir den Vergleich zwischen Trient und Salzburg nun erstmals auf die Architektur ausweiten können. Auch wenn der Franziskanerkirche zur Zeit ihrer Wiederverwendung im spätgotischen Stil Umbauten vorgenommen wurden – das Fenster beim Eingang wurde vergrößert und Stützkonsolen für den Architrav hinzugefügt – , weist das Südportal der Franziskanerkirche dennoch eine enge Verwandtschaft mit den Eingängen des Doms in Trient auf.
Das Gewölbeprofil in der Salzburger Kirche (Abb. 13) zeigt einen besonderen zweifarbigen Strahlenkranz, der durch die Verwendung von Steinquadern in zwei unter-schiedlichen Farbtönen erzielt wird, genau wie bei den bei-den Portalen des Doms San Vigilio (Abb. 14). Interessant ist auch ein Vergleich zwischen dem Architrav der Franziska-nerkirche29 (Abb. 15) und jenem des Südeingangs des Doms in Trient (Abb. 16): Beide haben ähnlich modellierte kraftvol-le Rankenmotive, in denen stilisierte Weintrauben und ge-zacktes Weinlaub ganz ähnlicher Gestaltung zu sehen sind. Der Vergleich lässt sich auch auf die sekundären Dekorati-onselemente, wie die Lockenmotive unten an der Kannelie-rung der Kämpfergesimse, ausdehnen: solche Ornamente finden wir sowohl in der Franziskanerkirche (Abb. 17) als auch am Ostportal des Doms in Trient (Abb. 18). Abschließend können wir dieses Thema vielleicht noch um eine weitere Facette erweitern, auch wenn es sich hier-bei ebenso um einen Einzelfall handelt wie beim Marien-Tympanon des Salzburg Museum. Der Löwe (Abb. 19), der sich zurzeit im Hauseingang des Langenhofs in der Sig-mund-Haffner-Gasse 16 in Salzburg befindet, wurde von der Fachwelt bereits als lombardische Skulptur anerkannt. Zwi-schen den Vorderpfoten hält das Tier eine Schrifttafel mit dem Namen Bertram, was manche für den Namen des Auf-traggebers halten30, andere für den Namen des Bildhau-ers31. Es stimmt zwar, dass der Löwe in den Werken der Cam-pioneser Bildhauer immer wieder auftaucht, aber die besondere Anordnung der gewundenen Strähnen der Lö-wenmähne, die Ähnlichkeit in der Morphologie des Löwen-kopfes sowie der nervös verdrehte Nacken auf dem zum Sprung geduckten Körper mit den sich abzeichnenden Rip-pen lassen den Schluss zu, dass es sich um ein weiteres Werk
Abb. 17 Campioneser Meister, Torpfosten des Südportals, ca. 1230. Untersberger Marmor. Salzburg, Franziskanerkirche
Abb. 18 Campioneser Meister, Torpfosten des Ostportals, ca. 1230. Kalkstein. Trient, Dom San Vigilio
Die „Madonna der Ertrunkenen“ von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon
196
der Meister aus der Trentiner Werkstatt handelt. Ein Ver-gleich mit dem Löwen, der sich über dem östlichen Balda-chinportal des Doms San Vigilio befindet, ist durchaus mög-lich (Abb. 20). Obwohl der Erhaltungszustand der beiden
Skulpturen sehr unterschiedlich ist, fallen die Ähnlichkeiten sofort ins Auge, wobei sich die Salzburger Skulptur in einem sehr guten Zustand befindet, auch aufgrund der Verwen-dung eines Materials wie Marmor.
Abb. 19 Campioneser Bildhauer, Löwe, 1225–1250. UntersbergerMarmor, 86 x 42 x 124 cm. Salzburg, Sigmund-Haffner-Gasse 16
Abb. 21 Österreichischer Bildhauer, Tympanon mit Jesus Christus Pantokreator und zwei Heiligen. Untersberger Marmor, 106 x 202 cm.Salzburg, Stiftskirche St. Peter
Abb. 20 Campioneser Bildhauer, Löwe, ca. 1230. Kalkstein, H. ca. 85 cm. Trient, Dom San Vigilio
Siracusano
197
Somit scheinen also das Tympanon im Salzburg Muse-um, das Portal der Franziskanerkirche mit seiner plastischen Gestaltung und schließlich der Löwe in der Sigmund-Haff-ner-Gasse in der Salzburger Bildhauerei des frühen 13. Jahr-hunderts ein Œuvre für sich darzustellen. Es handelt sich um Werke, die sich beispielsweise von den Figuren des Tym-panons der Stiftskirche St. Peter32 deutlich unterscheiden (Abb. 21): Aufgrund der besonderen Modellierung der For-men und der Drapierung der Figuren könnte sich das Tym-panon in der Benediktinerkirche vom Tympanon des Klos-ters am Nonnberg ableiten, wobei auf die „oberflächlichen Werte“ zu achten ist, die in der lombardischen Bildhauerei völlig fehlen. Betrachten wir nun, wie sehr sich das Aussehen der Ar-chitektur des 13. Jahrhunderts in unserer modernen Zeit ver-ändert hat: Von den romanischen Gebäudeteilen aus der Franziskanerkirche sind lediglich Fragmente erhalten; die Ausstattung des Salzburger Doms im 13. Jahrhundert lässt sich nur hypothetisch rekonstruieren; das Portal der Stifts-kirche St. Peter hat im Inneren des heutigen Gebäudes über-lebt, und die Stuckkapitelle aus dem 18. Jahrhundert im dor-tigen Kirchenschiff wurden direkt auf Säulen aus dem 13. Jahrhundert aufgesetzt. Auf der Grundlage unseres derzei-tigen Wissensstands können wir somit davon ausgehen, dass die Franziskanerkirche, aus der vermutlich auch das Tympanon im Salzburg Museum stammt, die zweite Werk-stätte war, in welcher der als Adamo d’Arogno bekannte Bildhauer tätig war. Was die Geschichte der lombardischen Bildhauerei des 13. Jahrhunderts betrifft, so handelt es sich um eine interessante Hypothese, vor allem weil sie ermög-licht, das Wirken der Campioneser Bildhauer beträchtlich nach Norden hin zu erweitern. Salzburg hingegen kann in der Vielzahl von Studien über die Mobilität der lombardi-schen Meister einen Platz einnehmen, ein Problem, mit dem sich die Fachwelt erst in den letzten Jahren ernsthaft be-schäftigt hat. Den Reisen, die zuerst Guido Bigarelli aus der Toskana nach Modena und dann seinen Cousin Guidobono nach Trient geführt haben, könnte somit ein neues Kapitel hinzugefügt werden: die Reise von Adamo von Trient nach Salzburg.
(Übersetzung aus dem Italienischen: all languages, Wien)
Anmerkungen
1 Willibald Sauerländer: Tympanon mit Madonna und Engeln. In: Ausstellungskatalog: Reiner von Haussherr (Hrsg.): Die Zeit der Staufer: Geschichte, Kunst, Kultur. Württembergisches Landes- museum, Stuttgart. Bd. 1. Stuttgart 1977, S. 374–375, Kat.-Nr. 491.2 Hermann Beenken: Romanische Skulptur in Deutschland. Leipzig. 1924, S. 106–111. – Hermann Beenken: Das romanische Tympa- non des städtischen Museums in Salzburg. In: Belvedere, 8 Jg., H. 11–12, Wien 1925, S. 97–118.3 Richard Hamann: Die Salzwedeler Madonna. In: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 3. Jg., Marburg 1927, S. 77–145, hier S. 136. – Franz Fuhrmann: Das romanische Marientympanon im Salzburger Carolino Augusteum. In: Jahresschrift des Salz- burger Museum Carolino Augusteum. Bd. ???. Salzburg 1959, S. 49–103. – Elfriede Kapeller: Das Marientympanon. Ein Meister- werk romanischer Plastik. In: Salzburger Museum Carolino Au- gusteum für Kunst und Kulturgeschichte der Stadt und des Lan- des Salzburg, 9 Jg., Heft 95,??? Salzburg 1996.4 „AVE MARIA GRATIA PLE[NA] // BEATA ES D[E]I GENITRIX“. Walter Koch: Epigraphische Bemerkungen zum Marientympanon im Salzburger Museum Carolino Augusteum. In: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, 90 Jg., Heft 3–4, Wien 1986, S. 114–118.5 Wilhelm Messerer: Romanische Skulpturen in und um Salzburg. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde, 120/???, 1981, S. 305–369, hier S. 352–363.6 Friedrich Dahm: Die früh- und hoch-mittelalterliche Skulptur Österreichs. In: Hermann Fillitz (Hrsg.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. I. Früh- und Hochmittelalter. München 1998, Bd. 1, S. 337–346, hier S. 341–342.7 Siehe z.B. Bruno Passamani: La scultura romanica in Trentino. Trient 1963, S. 57–58. – Bruno Passamani: Gli apparati plastici da Adamo d’Arogno a Egidio da Campione. In: Enrico Castelnuovo und Adriano Peroni (Hrsg.): Il Duomo di Trento. I. Architettura e scultura. Trient 1992, S. 271–331, hier S. 282.8 Geza de Francovich: Benedetto Antelami architetto e scultore e l’arte del suo tempo. Bd. 1. Mailand – Florenz 1952, S. 45–109.9 G.d. Francovich (Anm. 8), S. 96.10 Costantino Baroni: La scultura gotica lombarda. Mailand 1944, S. 17.11 Laura Cavazzini: Il Maestro della loggia degli Osii: l’ultimo dei Campionesi? In: Arturo Carlo Quintavalle (Hrsg.): Medioevo: arte e storia. Atti del Convegno internazionale di studi. Parma, 18.– 22.9.2007. Mailand 2008, S. 621–630.12 Joachim Poeschke: Die Skulptur des Mittelalters in Italien. Roma- nik. München 1998, S. 141.13 Stefano Tumidei: Maestro campionese. Diacono (Santo Stefano?). In: Ausstellungskatalog: Massimo Medica (Hrsg.): Duecento. For- me e colori del Medioevo a Bologna. Venedig 2000, S. 154–156, Kat.-Nr. 33.14 Bei den Bombenangriffen im Jahr 1944 wurde die Skulptur be- schädigt, sodass die Köpfe des Kindes und des Engels auf der vom Betrachter aus gesehen rechten Seite neu aufgesetzt werden mussten.15 G.d. Francovich (Anm. 8), S. 47–69. – Roberto Salvini: Il Duomo di Modena e il romanico nel Modenese. Modena 1966. – Renzo Grandi: I Campionesi a Modena. In: Marina Armandi (Hrsg.): Il Duomo di Modena. Fotoatlas. „Quando le cattedrali erano bian-
Die „Madonna der Ertrunkenen“ von Trient und das Salzburger Marien-Tympanon
198
che“. Ausstellungen über den Dom von Modena nach der Restau- rierung. Modena. 1984, S. 545–570. – Saverio Lomartire: I campio- nesi al duomo di Modena. In: Rossana Bossaglia (Hrsg.): I maestri campionesi. Bergamo 1992, S. 37–81.16 R. Grandi (Anm. 15), S. 556–558. – Claudio Franzoni. In: Chiara Frugoni (Hrsg.): Mirabilia Italiae. Il Duomo di Modena. Modena 1999, S. 248–249. – Laura Cavazzini: La decorazione della facciata di San Martino a Lucca e l’attività di Guido Bigarelli. In: Arturo Carlo Quintavalle (Hrsg.): Medioevo: le officine, Atti del Convegno internazionale di studi. Parma, 22.-27. September 2009. Mailand. 2010 (im Druck).17 Saverio Lomartire: Schede di Epigrafia. In: Enrico Castelnuovo, Adriano Peroni (Hrsg,): Il Duomo di Trento. I. Architettura e scul tura. Trient 1992, S. 252–254.18 Zum Werk von Guidobono und Giannibono Bigarelli in Trient siehe Bruno Passamani: La scultura romanica in Trentino. Trient 1963, S. 72–78. – Valerio Ascani: La bottega dei Bigarelli. Scultori ticinesi in Toscana e in Trentino nel Duecento sulla scia degli studi di Mario Salmi. In: Mario Salmi storico dell’arte e umanista. Atti della giornata di studio. Rom, Palazzo Corsini, 30.11.1990. Spoleto 1991, S. 107–134, hier S. 122–123. – Luca Siracusano: Alcune riflessioni sulla presenza di Guidobono Bigarelli nel duomo di San Vigilio a Trento. In: Studi Trentini di Scienze Storiche, Sezione Seconda, 89 Jg., H. 1, Trient 2010 (im Druck).19 Lucca, Archivio Capitolare, Libro LL 31, f. 155v., erschienen in Pietro Guidi: Di alcuni maestri lombardi a Lucca nel secolo XIII. Appunti d’archivio per la loro biografia e per la storia dell’arte. In: Archivio Storico Italiano, 12 Jg., H. 2, Florenz 1930, S. 209–231, hier S. 227–228.20 Trento, Archivio Diocesano Tridentino, Capitolare, capsa Testa menti, rotoli corti, b. 3, erschienen in Vigilio Zanolini: Per la storia del Duomo di Trento. In: Atti dell’Accademia degli Agiati, 5 Jg., H. 2, Rovereto 1889, S. 97–166, hier S. 155–156.21 Im Jahr 1142 überlässt Altmann dem Salzburger Domkapitel das Familienschloss Hochburg. Siehe Iginio Rogger: Cronotassi dei Vescovi di Trento. In: Ferdinando Dell’oro und Iginio Rogger (Hrsg.): Monumenta liturgica Ecclesiae Tridentinae saeculo XIII antiquiora. Testimonia chronographica ex codicibus liturgicis. Bd. 1. Trient 1983–1988, S. 59.22 Zu den Bauphasen des Doms in Trient siehe Adriano Peroni: Pro- blemi di cronologia, le fasi sino al secolo XV. Progetto e struttura nel Duomo duecentesco. In: E. Castelnuovo, A. Peroni (Anm. 7), S. 103–173.23 Valerio Ascani: La bottega dei Bigarelli. Scultori ticinesi in Toscana e in Trentino nel Duecento sulla scia degli studi di Mario Salmi. In: Mario Salmi storico dell’arte e umanista (Anm. 18), S. 121–124. – Luca Siracusano: Alcune riflessioni sulla presenza di Guidobono Bigarelli nel duomo di San Vigilio a Trento. In: Studi Trentini di Scienze Storiche, Sezione Seconda, 89. Jg., H. 1, Trient 2010 (im Druck).24 Nicolò Rasmo: Adamo da Arogno. In: Luciano Borrelli und Silvia Spada Pintarelli (Hrsg.): Dizionario biografico degli artisti atesini. 1. Bd. Bozen 1980, S. 23–24. – Nicolò Rasmo: Storia dell’arte nel Trentino. Trient 1982, S. 77.25 Adamo wird zum letzten Mal in einer am 12.11.1236 in Trient auf- gesetzten Notariats-Imbreviatur erwähnt. Siehe Hans Voltelini: Die Südtiroler Notariats-Imbreviaturen des dreizehnten Jahr hunderts. Innsbruck. 1899–1951, 2. Bd., S. 258, Nr. 530. – Nicolò Rasmo: Adamo da Arogno. In: L. Borrelli, S. Spada Pintarelli (Anm. 24), S. 23–24.
26 Saverio Lomartire: Introduzione all’architettura del battistero di Parma. In: Chiara Frugoni (Hrsg.): Benedetto Antelami e il Battis- tero di Parma. Turin 1995, S. 221–235.27 Josef Riedman: Tra impero e signorie (1236–1255). In: Andrea Cas- tagnetti und Gian Maria Varanini (Hrsg.): Storia del Trentino. III. L’età medievale. Bologna 2004, S. 229–254.28 Friedrich Dahm: Tympanon. In Hermann Fillitz (Hrsg.): Geschichte der bildenden Kunst in Österreich. I. Früh- und Hochmittelalter. München 1998, S. 380–382.29 Wird von manchen für einen Teil der Kirche aus dem 12. Jahr- hundert gehalten, der wiederverwendet wurde. Siehe Rudolf Koch: Salzburg, Franziskanerkirche, Südportal. In: H. Fillitz (Anm. 28), S. 240–241.30 „HAC CELATVRA / (BER)TRAMI P[RO]VIDA / CVRA EST EX/PRESSA SATIS / DEVS HVNC CON/IVGE BEATIS“. – Willibald Sauerländer: Löwe mit Schrifttafel. In: Ausstellungskatalog: R.v. Haussherr (Anm. 1), S. 375–376, Kat.-Nr. 492.31 Anton von Schallhammer: Beschreibung der erzbischöflichen Domkirche zu Salzburg. Geschichtlich, architektonisch und ar- chäologisch bearbeitet. Mit einer Ansicht und zwei Bau-Plänen. Salzburg. 1859, S. 11. – Friedrich Dahm: 128. Löwe. In: H. Fillitz (Anm. 28), S. 380.32 Friedrich Dahm: 125. Tympanon. In: H. Fillitz (Anm. 28), S. 377–378, Kat.-Nr. 125.
















![Burgküchen des Mittelalters und der frühen Neuzeit im Königreich Ungarn [Társszerző: Feld István]. In: Küche – Kochen – Ernährung. Hrsg.: Ulrich Klein – Michaela Jansen](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632751d1030a927336036a88/burgkuechen-des-mittelalters-und-der-fruehen-neuzeit-im-koenigreich-ungarn-tarsszerzo.jpg)