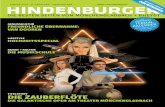Die Klappe fällt
Transcript of Die Klappe fällt
Die Klappe fällt —frühe Belege für lat. cataracta als Bezeichnung einer AugenkrankheitAuthor(s): Klaus-Dietrich FischerSource: Medizinhistorisches Journal, Bd. 35, H. 2 (2000), pp. 127-147Published by: Franz Steiner VerlagStable URL: http://www.jstor.org/stable/25805258 .
Accessed: 04/11/2013 05:38
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp
.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].
.
Franz Steiner Verlag is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access toMedizinhistorisches Journal.
http://www.jstor.org
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Med. hist J. 35(2000) 127-147 ? URBAN & FISCHER VERLAG http://www.urbanfischer.de/journals/medhistj
MEDIZIN HISTORISCHES
JOURNAL
Klaus-Dietrich Fischer
Die Klappe fallt - fruhe Belege fur lat. cataracta als
Bezeichnung einer Augenkrankheit1
Schliisselwbrter: Katarakt, fruheste Belege; Erklarung des zugundeliegenden Bildes
Keywords: Cataract, earliest attestations; explanation of the metaphor
Im ersten Band der in Wien 1788 erschienenen Neubearbeitung von Ste
phan Blancard's arzneiwissenschaftlichem Worterbuch werden wir iiber die
Ableitung des Begriffs cataracta wie folgt unterrichtet:
Die Benennung soil von katarasso, ich verwirre oder verderbe mit Ungestum, abstam
men, weil nemlich diese Krankheit oft gahling entsteht. Andre aber leiten dieselbe von der Aehnlichkeit der Wasserschleussen, welches bewegliche, zur Einhaltung des hefti
gen Reissens des Stroms dienliche Klappen sind, her, weil man nemlich ehedem dieses Uebel als eine Klappe in der wafirigen Feuchtigkeit betrachtete, wodurch das Sehen verhindert wiirde. Allein alle diese Ableitungen stehen auf schliipfrigem Grunde, weil man noch nicht hinlanglich beweisen kan, dafi je ein griechischer Schriftsteller sich die ses Ausdrucks zur Bezeichnung der Krankheit bedient habe. Bei den Griechen komt sie vielmehr unter dem Namen hypochyma vor.2
Das Wort, Katarakt' ist heute, gegebenenfalls in abgeanderter Schreibweise
und Aussprache, in zahlreichen europaischen Sprachen fur den Begriff
,grauer Star' gebrauchlich. Die Geschichte dieses Fachwortes ist vollig
1 Gegeniiber dem Vortrag beim Geburtstagscolloquium der Berliner Gesellschaft fiir Ge
schichte der Medizin fiir Jutta Kollesch am 14. November 1998 veranderte, erweiterte und
erganzte Fassung. Uber die Halfte der unten angefiihrten Belege wurde bereits im April 1996 wahrend des III Seminario Internazionale sulla Letteratura Scientifica e Tecnica Greca
e Latina an der Universita degli Studi di Trieste vorgestellt. Herrn Prof. Dr. med. Dr. phil. Klaus Bergdolt, dem Direktor des Instituts fiir Geschichte und Ethik der Medizin der Uni versitat zu Koln und Facharzt fiir Augenheilkunde, danke ich fiir manche wertvolle Auf
klarung und die Diskussion meiner Darlegungen von 1996, den Leitern der Handschriften
abteilungen der Britischen Bibliothek zu London, der Biblioteca Apostolica Vaticana und
der Burgerbibliothek Bern fiir die Erlaubnis, kurze Stiicke aus den Handschriften Lond. add. 8928, Arundel 166, Vat. Reg. lat. 1143 und Bern 232 wiederzugeben.
2 Stephan Blancard's arzneiwissenschaftliches Worterbuch [...] Nebstdem ist die Ab
stammung urspriinglich griechischer Worter fafilich auseinander gesezt [...] Erster Band,
Wien 1788, 491. Friihere, insbesondere lateinische Auflagen wurden wegen des damit ver
bundenen Aufwandes nicht systematisch iiberpriift.
127 0025-8431/00/35/127-147 $12.00/0
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
anders verlaufen als die der meisten anderen dem Griechischen entstam
menden medizinischen Termini. Denn in der iiberwiegenden Zahl der Falle
wurde ein medizinischer Fachbegriff zunachst auf Griechisch gebildet und
danach in andere Sprachen ubernommen, zuerst ins Lateinische. Auf xa
xaQQaxxng trifft das nicht zu. Denn obgleich dieses Wort im Griechischen
in zahlreichen - darunter auch recht ausgefallenen -
Bedeutungen belegt ist, die ich am Ende dieses Berichts im einzelnen nennen werde, erscheint
es im Griechischen nie als ein medizinischer Terminus, wenigstens im Al
tertum und im Mittelalter nicht. Die Griechen bedienten sich vielmehr, wie
das eingangs zitierte medizinische Worterbuch ganz richtig sagte, fur das
Krankheitsbild des grauen Stars der von dem Verb ujtoxsco ?daruntergie fien" abgeleiteten Substantivbildungen ujtoxuLia und UTto/uotg. Nach die
sen haben dann die Romer ihr am friihesten bei Celsus belegtes Wort suffu sio geschaffen. Trotzdem kommt daneben hypochysis in lateinischen Texten
ab dem 1. nachchristlichen Jahrhundert ebenfalls vor, wohingegen die Be
lege fur hypochyma erst zu einem spateren Zeitpunkt nachweisbar sind.3
Alle angefiihrten Wortbildungen lassen sich deutsch als , darunter gelegener
Ergufi' wiedergeben und von Vorstellung und Bildungsweise her mit unse
rem Wort ,Blutergufic vergleichen.
Das heutzutage auch jedem deutschsprachigen Gebildeten gelaufige Wort
,Katarakt' taucht als Bezeichnung einer Augenkrankheit zuerst im Mittel
alter auf, und zwar gegen Ende des 11. Jahrhunderts. Wir finden es im
Werk des ersten und iiberragenden Ubersetzers arabischer medizinischer
Werke ins Lateinische, Cons tan tinus Africanus.4 Dies zumindest ist die
3 Man vergleiche den Thesaurus linguae Latinae (ThLL) s. w. Hinzuzufiigen ist Plin. nat.
20,43 nach der (sicher auf Diosc. mat. med. 2,151,1 doxo^ievoig imoxeiaftai basierenden) Verbesserung von Jacques Andre, der sich Roderich Konig in seiner Tusculum-Ausgabe, Miinchen 1979, anschloft, eine Stelle, die unverstandlicherweise in der groften Pliniuskon kordanz von Peter Rosumek und Dietmar Najock, Hildesheim usw. 1996, nicht erwahnt wird. 4 Siehe dazu unten S. 141 f. Die mit reichen Anmerkungen versehene Arbeit von Gerhard
Baader, Zur Terminologie des Constantinus Africanus, Medizinhistorisches Journal 2, 1967, 36-53, beschaftigt sich nur mit den Termini fiir die Anatomie des Auges und des
weiblichen Urogenitalapparats. 128
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt
Ansicht aller einschlagigen Autoritaten,5 die immer noch auf den For
schungen Julius Hirschbergs6 fufien.
Seine bis heute in ihrem Materialreichtum nicht ersetzte, zehn Bande um
fassende Geschicbte der Augenheilkunde sowie sein alteres und zu Unrecht
weniger bekanntes Worterbuch der Augenheilkunde (Leipzig 1887), auch
dieses bei aller Ausrichtung auf die augenarztliche Praxis durch die Einbe
ziehung der alteren Literatur in oft langeren Originalzitaten wahrhaftig eine reiche Fundgrube fiir den Historiker, vertreten diese Meinung.
Wenngleich Hirschberg neben seiner Tatigkeit als Augenarzt nicht allein
als Medizinhistoriker, sondern auch im philologischen Bereich ernsthaft
wissenschaftlich gearbeitet hat - am uberraschendsten als Verfasser eines
Hilfswdrterbuchs zum Aristophanes (Leipzig 1898) -, so iibersah er beim
vermeintlich friihesten Auftreten des Begriffes cataracta einen Umstand, der unbedingt nach einer Erklarung verlangt: Warum verwendete Con
stantinus Africanus, dessen Muttersprache bekanntlich das Arabische war
und der aus ihm ins Lateinische iibersetzte, ein Fremdwort, das aus dem
Griechischen7 stammt? Und noch dazu eines, das die erforderliche Bedeu
tung ,grauer Star', soweit es unserem heutigen Wissen entspricht, im
129
5 Zuletzt Enrico Marcovecchio, Dizionario etimologico storico dei termini medici, Fi
renze 1993, 155 f. 6 Zu Julius Hirschberg (18. 9. 1843
- 17. 2. 1925) vgl. den leider nicht befriedigenden Artikel von Wilhelm Katner in der Neuen Deutschen Biographie, Band 9, Berlin 1972, 221. Die
Stelle, auf die ich mich beziehe, ist ? 296 der Geschichte der Augenheilkunde (Geschichte der Augenheilkunde. Zweites Buch. Abt. I. Geschichte der Augenheilkunde bei den Ara
bern, Leipzig 1905 [Handbuch der gesamten Augenheilkunde. XIII. Band], 263-265). Eine neuere Beschaftigung mit dem Thema findet sich bei Martin Wenzel, Warum heifk der
Graue Star ?Star"?, Klinische Monatsblatter fur Augenheilkunde 205, 1995, 167-172, hier
171 (Wenzel hat die Anm. bei Hirschberg offensichtlich iibergangen); zuvor F. Rintelen,
Sprachgeschichtliches zu dem Begriff ,Glaukom' und ,Katarakt', Klinische Monatsblatter
fur Augenheilkunde 170, 1977, 344-349, hier 344. Irrefuhrend die Uberschrift des Artikels
von J. Fronimopoulos und J. Lascaratos, The terms glaucoma and cataract in the an
cient Greek and Byzantine writers, Documenta Ophthalmologica 77, 1991, 369-375, weil
auch sie den Terminus , Katarakt' nicht bei den alt- und mittelgriechischen Autoren belegen konnen.
Karl Gottlob Kiihn hatte sich ebenfalls mit der Etymologie und Bedeutung von cataracta
beschaftigt (Karl Gottlob Kuhn, Censura medicorum lexicorum recentiorum II, in:
ders., Opuscula academica, medica et philologica collecta, aucta et emendata, vol. 2, Lipsi ae 1828, 327-333 [331-333 zu cataracta^. Fur uns ist wichtig, daft er die falschen Ableitun
gen des Terminus in einer Reihe medizinischer Lexika geiftelt und sich dann S. 332 fur die
Herleitung von cataracta in der Bedeutung ,Fallgatter' ausspricht: ,Jam cum cataracta
(nam in suam quoque linguam Romani vocem receperunt) inter alias fores quoque pendu
las, quae nunc demitti, nunc iterum attolli possunt, quibusque aditus ad urbem aut occludi
tur, aut iterum panditur, denotet, poterat haud inepte ex veterum de suffusionis origine sententia ad hoc oculorum vitium significandum adhiberi."
7 Dieses Problem verdiente eine eigene Untersuchung; zu den Augenhauten, wo wir uns die
griechischen Namen durch Vindicianus vermittelt vorstellen konnen, vgl. die oben ange fuhrte Arbeit Gerhard Baaders. Die drei altesten medizinischen Handschriften in Monte
cassino (69, 97 und 225) bringen eine Menge griechischer medizinischer Termini, waren so
mit eine mogliche Quelle fur die Terminologie des Constantinus Africanus gewesen.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Griechischen damals gar nicht besafi? Es hat den Anschein, dafi Hirsch
berg, der zum Zwecke historischer Studien Arabisch gelernt hatte, sich
durch die arabische Wiedergabe von vnoyvoiq bzw. vii6xv\iay nuzul al
ma', mitunter auch nur al-ma',8 irrefiihren liefi.9 Die arabischen Worte be
deuten namlich ,Herabfliefien des Wassers' bzw. nur ,das Wasserc. Nicht
nur fiir Hirschberg und wohl manchen vor ihm, im Mittelalter und spater,
lag es nahe, die arabische Bezeichnung mit ,Wasserfall', was ja eine der
moglichen Bedeutungen des Wortes cataracta ist, in Verbindung zu brin
gen.10 Diese falsche Zuordnung hat dann auch im deutschen Sprachraum das Verstandnis der bei cataracta zugrundeliegenden Metapher unmoglich
gemacht oder zumindest bis heute erschwert.11
Vor diesem Hintergrund verstehen wir nun eher, warum Hirschberg iiber
die Besonderheit, die in der Verwendung eines griechischen Wortes in ei
ner nicht gelaufigen Bedeutung bei der Ubersetzung aus einem arabischen
Text liegt, hinweggehen und gleichzeitig fiir den arabischen Ursprung des
Ausdrucks, natiirlich nicht des Wortes cataracta selbst, eintreten konnte.
So viel zum gegenwartigen Forschungsstand.
Ich mochte im weiteren die Existenz von cataracta als Bezeichnung einer
Augenerkrankung mit Hilfe mehrerer Zeugnisse fiir das halbe Jahrtausend vor Constantinus Africanus nachweisen. Bei diesen Zeugnissen handelt es
sich teilweise um solche, die zu Hirschbergs Zeiten noch nicht im Druck
8 Frau Prof. Dr. Dr. Ursula Weisser hat auf meine Bitte hin die in Frage kommende Stellen bei al-Magusi durchgesehen. In ihrem Brief vom 25. 8. 1996 fiihrt sie aus: In der Vorlage von Constantinus, ?Practica 9,33 (Kamil II 476 f. hier iibrigens Kap. 28): Hier steht durch
gangig nur ,al-ma"." ... ?Theorica 6,4 (Kamil I 221) ist,cataracta' an der ersten Stelle ver
bal umschrieben: wa nazala fiha 1-ma' ,und das Wasser in ihr (sc. der Pupille) herabflieftt', an der zweiten steht in der Tat ,nuzul al-ma'V
9 ?So haben wir also, in der mittelalterlich lateinischen Ubersetzung eines arabischen Werkes aus der Hand eines Arabisten fiir die wichtigste Augenkrankheit die latinisirte Form eines
griechischen Wortes empfangen, das zwar von den griechischen Arzten niemals in diesem Sinne angewendet, aber heutzutage bei den Arzten aller Kultur-Lander allgemein ge brauchlich geworden [ ...]", schreibt Hirschberg im Kapitel Entwicklungs-Geschichte der
augendrztlichen Kunst-Ausdrucke im Register-Band, Berlin 1918, 20, seiner Geschichte der
Augenheilkunde. 10
?Unzweifelhaft ist die erste Bedeutung des Wortes C(ataracta), namlich Wasserfall, auf
das Auge iibertragen worden; es ist dasselbe wie aquae descensus." Julius Hirschberg, Worterbuch der Augenheilkunde, Leipzig 1887, 15. Hirschberg hielt die Deutung ,Fall gatter' fiir cataracta, die haufig vertreten wurde, fiir falsch: Geschichte der Augenheilkun de. Register-Band, Berlin 1918, 20. Ingeborg Pape, die Verfasserin des Artikels catarac
ta, ae f. im Mittellateinischen Worterbuch, Band 2, 3. Lieferung, Miinchen 1970, col. 363 f., schloft sich dieser Auffassung an, da sie ihren Artikel wie folgt gliedert: I de rebus:
A delectus aquae -
Wasserfall, Stromschnelle: 1 proprie: [...]'2 translate i. q. suffusio oculo rum -
grauer Star: [...] 11
Brockhaus-Wahrig, Deutsches Worterbuch, Band 18, K-Oz, Wiesbaden/Stuttgart 1982, setzt z. B. zwei Lemmata ,Katarakt' an, das erste fiir ?m.;[...] Stromschnelle, nied
riger Wasserfall", das zweite ?f.;[...] =
grauer Star [...] [zu Katarakt1, da man friiher an
nahm, eine vom Gehirn heruntergeflossene Fliissigkeit habe die Linsen [!] getriibt]." 130
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt
vorlagen und ihm somit kaum zu Gesicht gekommen sein konnten. Was
den Wissenschaftshistoriker allerdings bei der Uberpriifung dieser Zeug nisse uberrascht und, ich gestehe, beunruhigt, ist der Umstand, dafi bei
den Belegen fur cataracta unsere grofien und mafigebenden Worterbuch
unternehmungen, der Thesaurus linguae Latinae und das Mittellateinische
Worterbuch, das ihnen vorliegende Material nicht befriedigend herangezo gen bzw. ausgewertet haben.12
/. Gregor von Tours
Hirschbergs Zeitgenosse Max Bonnet hatte 1890 in seiner umfassenden
Studie Le latin de Gregoire de Tours bei der Besprechung der griechischen Fremdworter in den Werken Gregors auch cataracta erwahnt, mit der Be
deutung ,cataracte' (d.h. der Augenkrankheit grauer Star) und dem Hin
weis: ?Ce sens n'est signale ni par Georges,13 ni par O. Weise, ni dans les
dictionnaires grecs."14 Wilhelm Elsperger, der Bearbeiter des 1908 erschie
nenen Thesaurusartikels cataracta (ThLL III 595, 52-596, 62), fiihrte die
betreffenden Stellen aus Gregor zwar an, freilich ohne hier eine Augen
erkrankung im eigentlichen Sinn15 zu sehen: ?II variae res a similitudine
saeptorum dictae: [...] E in imagine de palpebris vel oculis [...]".
Es ist deshalb erforderlich, die in Frage kommenden Stellen erneut zu be
trachten, um selbst urteilen zu konnen. Der erste Text zeigt bereits, dafi
Gregor in etwa wufite, wie damals eine Staroperation vor sich ging, denn
mit ihr vergleicht er das Heilungswunder des Hi. Martin:
131
12 Dafi das Worterbuch von Du Cange nicht weiterfuhrt, kann kaum iiberraschen. Die Bele
ge aus der Hagiographie, die es beibringt, erlauben ferner keine Bestimmung der im Ein
zelfall vorliegenden Erkrankung, weshalb ich sie (auch wegen Schwierigkeiten der Datie
rung der Quellen) nicht weiter berucksichtigt habe. ?cataract (the eye-disease)" korrekt
bei A. Souter, A Glossary of Later Latin, Oxford 1949, 42, mit dem allgemeinen Verweis
auf Greg. Tur. und Oribas. 546.13, die Stelle, mit der wir uns unten noch weiter be
schaftigen werden und die auch F. Arnaldi, Latinitatis Italicae medii aevi [...] lexicon
imperfectum, I: A - medicamen, Bruxelles 1939 (Nachdr. Torino 1970), 95 anfuhrt. Der
Beleg aus den Kapitelbeischriften zu Celsus' De medicina, auf den gleich anschlieftend un
ten eingegangen wird, fehlt, soweit ich sehe, uberall und wird auch durch die inzwischen
vorhandene elektronische Fassung von De medicina, aber auch den Wortindex von Willi
am Frank Richardson (A Word Index to Celsus: De Medicina, compiled by W. F. Ri
chardson, Auckland 1982) nicht erschlossen. Wir lernen daraus, dafi die eigene kritische
Lekture auch im elektronischen Zeitalter noch lohnend sein kann. 13 Auch nicht in der letzten (8.) Auflage, obwohl Heinrich Georges in seiner Vorrede (p. Ill)
die Beitrage von ?Herrn Prof. Dr. Bonnet in Montpellier" besonders wiirdigt. 14 Max Bonnet, Le latin de Gregoire de Tours, Paris 1890, 219 Anm. 4. 15 Auch Albert Blaise, Dictionnaire latin-franc,ais des auteurs chretiens, Turnhout 1954, s. v. cataracta, entscheidet sich nicht klar: ?barrage des yeux, cataracte: a decidentibus ca
taractis, Greg.-T. Mart. 2,41, un voil tombe sur ses yeux".
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
1. De Theudomere diacono caeco
[...] Theudomeris diaconus cum prae umore capitis, decedentibus cataractis, oculorum
aditus haberet per quattuor annos graviter obseratos, venit ad cellulam Condatinsim, in qua vir beatus transiit. Prostratusque ad eius lectulum, noctem totam lacrimis et ora
tionibus deductam, immobilis madefecit terram fletibus, tepuitque suspiriis eius vene
rabile lignum cancelli; luciscente autem die, reseratis cataractis luminum, lumen videre
promeruit. Quid umquam tale fecere cum ferramentis medici, cum plus doloris nego tium exserant quam medellae, cum, distentum transfixumque spiculis oculum, prius
mortis tormenta figerant, quam lumen aperiant? In quo si cautela fefellerit, aeternam
misero praeparat caecitatem. Huic autem beato confessori voluntas ferramentum est, et
sola virtus unguentum. Greg. Tur. Mart. 2,19
Bei dem Diakon Theudomeris war aufgrund von Fliissigkeit im Kopf vier Jahre hin durch der Zugang seiner Augen stark versperrt, denn Katarakte stiirzten herab. Er be
gab sich deshalb zur Zelle nach Candes, wo der selige Mann [St. Martin] hingeschieden ist. Er warf sich vor seiner Pritsche auf den Boden, verbrachte die ganze Nacht mit Tra
nen und Gebeten und netzte den Boden, ohne von der Stelle zu weichen, mit seinen
Tranen, warmte mit seinen Seufzern das verehrungswiirdige Holz der Absperrung. Als
aber der Tag anbrach, da wurden die Katarakte seiner Augen entriegelt, und es wurde ihm zuteil, das Licht wahrzunehmen.
Wann haben die Arze je mit ihren Instrumenten etwas ahnliches vollbracht? Ihr Werk zielt eher auf Schmerz, nicht auf Heilung, und wenn sie das Auge aufsperren und mit Sticheln durchbohren, dann bringen sie eher Todesqualen, als daft sie das Augenlicht offnen. Wenn bei dieser Operation das vorsichtige Vorgehen umsonst war, wartet auf
den armen Patienten ewige Blindheit. Fur diesen seligen Martyrer [St. Martin] aber ist sein Wille das Instrument und seine Wunderkraft allein die Salbe.
2. De caeco illuminato
[...] Homo ergo incola territurii Turonici, annorum quasi viginti quinque, cum a febre
lippitudinis gravaretur, decidentibus cataractis, obstrictisque palpebris valde caecatus
est.
Greg. Tur. Mart. 2,41
Ein Mann aus dem Gebiet von Tours, etwa fiinfundzwanzig Jahre alt, litt unter einem Fieber mit Triefaugigkeit, und als die Katarakte herabkamen und die Lider sich ver schlossen, litt er unter grower Blindheit.
3. De Monegunde religiosa
[...] Tune commota Dei famula, luminibus sepultis manus inposuit, statimque reseratis
cataractis, mundum late patentem quae fuerat caeca prospexit. Greg. Tur. vit. patr. 20,3
Dann lieft sich die Magd Gottes erweichen und legte ihre Hande auf die verschlossenen Augen, und sie, die blind gewesen war, sah im gleichen Augenblick die weite Welt vor sich.
4. Leonastis Biturigus archidiaconus, decedentibus cataractis, lumen caruit oculorum.
[...] Adveniente autem festivitate, clarificatis oculis cernere coepit. [...] Decedente
quoque sanguine, rursus in redeviva caecitate redigitur. Greg. Tur. Franc. 5,6
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
Der Archiadiakon Leonastis aus Bourges, bei dem die Katarakte niedergegangen wa
ren, entbehrte des Augenlichts. [...] Als der Festtag des Heiligen gekommen war, wur
den seine Augen klar, und er begann zu sehen. [...] Als ebenfalls das Blut herabstrom
te, wurde er wieder in seine vorherige Blindheit versetzt.
Bei diesen vier Textausschnitten handelt es sich stets um Berichte, in deren
Mittelpunkt die wundersame Wiedererlangung des verlorenen Augenlichts steht. Nach Gregors Vorstellung geht es wohl um eine mechanische Hem
mung16 des Sehakts, die jeweils durch die Gnade des Heiligen schlagartig beseitigt wird. In den Texten 1, 2 und 4 wird der Eintritt des Sehhindernis
ses mit decidentibus cataractis beschrieben. Ob Gregor sich das als ein
recht plotzlich eintretendes Ereignis17 oder als einen allmahlichen Vorgang
vorgestellt hat, ist kaum mit Sicherheit zu entscheiden. Allerdings kann das
Hindernis mit einem Mai wieder beseitigt werden; Gregor driickt das mit
reseratis cataractis (bzw. clarificatis oculis in Text 4) aus.
Welche Augenkrankheit oder Augenkrankheiten, die Blindheit hervorru
fen, hat Gregor im Sinn gehabt? Doch ist es uberhaupt sinnvoll, bei diesen
Wunderberichten nach einer konkreten medizinischen Diagnose zu fra
gen? Gregor war namlich bekanntermafien weder ein Arzt noch medizi
nisch vorgebildet. Er beschreibt Heilwunder, die er wohl in den seltensten
Fallen personlich miterlebt hat; in erster Linie besteht sein Anliegen darin, den Ruhm des Heiligen zu mehren, nicht jedoch, medizinische Falle natur
getreu darzustellen.18 Wir mussen demnach davon ausgehen, dafi Gregor zwar daran lag, von der wundersamen Heilung Blinder zu berichten, dafi
ihn aber die Ursache der Blindheit, die medizinische Diagnose, die Atio
logie und Pathogenese, letztendlich recht wenig kummerten. Daraus folgt, dafi, obwohl Gregor das Wort cataracta im Zusammenhang mit Blindheit
gebraucht, wir trotzdem mit Ausnahme des ersten Textbeispiels aus dem
Kontext nicht zweifelsfrei nachweisen konnen, ob cataracta fur ihn eine
fest umrissene oder blofi eine eher vage medizinische Bedeutung hatte.19
Unstrittig ist allein, dafi bei den angefuhrten Belegen aufgrund des Kontex
tes, d. h. der mit cataractis verbundenen Partizipien, die metaphorische
Verwendung von cataracta als gesichert gelten kann. Die Existenz der
133
16 oculorum aditus [...] per quattuor annos graviter obseratos heiftt es Greg. Tur. Mart.
2,19. oculorum aditus diirfte eher die Pupille meinen denn als Verschluft der Augenlider zu deuten sein.
17 decidere wird zwar auch von immer wieder nachflieftenden Fliissigkeiten gebraucht, z. B.
von Fliissen, so daft dann der durative Aspekt zunachst nicht ausgeschlossen werden
konnte. 18 Auf die wichtige Arbeit von Oronzo Giordano, Sociologia e patologia del miracolo in
Gregorio di Tours, Helikon 18-19, 1978-1979, 161-209, sei dabei verwiesen. 19 Dies wiirde ja auch theoretisches medizinisches Wissen voraussetzen. Bequemste Zusam
menstellung der bei Gregor erwahnten Krankheiten bei Margarete Weidemann, Kul
turgeschichte der Merowingerzeit nach den Werken Gregors von Tours, Teil 2, Mainz
1982, 378-384, dort 195-197 auch iiber die religiosen Krankenheilungen.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Metapher cataracta fur ,grauer Starc als eines wirklichen Terminus mit me
dizinischer Bedeutung ist jedoch allein an der ersten Stelle mit volliger Si
cherheit nachzuweisen.20
Damit ist der Verfasser des Thesaurusartikels freilich noch nicht ganz ent
schuldigt. Denn seine Charakterisierung ?in imagine de palpebris vel ocu
lis" trifft nicht zu: Auf welche Weise der Sehvorgang in Gregors Berichten
behindert wird, wird nicht im einzelnen dargelegt, aber die Augenlider oder die Augen selbst wirken keinesfalls als oder wie ein cataracta.
Aus Text 4 konnen wir eventuell Einzelheiten zu der von Gregor ange nommenen Pathogenese entnehmen. Nach einer wundersamen Heilung tritt bei dem Archidiakon Leonastis erneut Blindheit ein, decedente [...]
sanguine. Das Blut schiefit bzw. fallt also herab (decidere21) und bewirkt
Blindheit, indem es den Sehvorgang22 unmoglich macht. Das entspricht der in der Medizin gelaufigen Vorstellung, die suffusio habe ihren Ur
sprung in einer herabfliefienden Fliissigkeit. Dazu pafit ferner prae umore
capitis in Text 1. Wie vorhin erwahnt, liegt es nahe, auch das arabische
nuzul al-ma' als direkte, wenngleich unbeholfene Wiedergabe des Begriffs
vji6xvoic,/suffusio und der damit verbundenen Vorstellung zu verstehen.
Die humoralpathologische Erklarung, die in der Pantegni des Constanti
nus Africanus sicherlich ihre grofite Wirksamkeit entfaltet hat, erlaubte
dann diejenige Deutung von cataracta, die wir z. B. im Glossar Alphita
(I S. 283, 12) etwa aus dem 13. Jahrhundert antreffen: cataracta, morbus
est oculi et interpretatur fluxus quia fit de fluxu. Ob man Constantinus
selbst dieses Verstandnis des Wortes cataracta unterstellen darf, bleibt min
destens fraglich; die von mir eingesehenen Stellen23 bieten dafiir keinen
Anhaltspunkt.
20 Julius Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde. Register-Band, Berlin 1918, 20,
spricht sich ebenfalls dafur aus. 21 Kaum mit decedere ,weggehen' in Verbindung zu bringen, sondern durch den spatlateini
schen Zusammenfall von i und e bedingte graphische Variante; falsch deshalb die deutsche Ubersetzung ?Als ihm das Blut abgezogen wurde" (Rudolf Buchner, Gregor von
Tours. Zehn Bucher Geschichten. Erster Band: Buch 1-5, Darmstadt 1977, 293). 22 Durch Verlegung des oben in Text 1 genannten aditus oculi (porta visus bei Wilhelm von
Conches); keine Rolle spielt, ob man sich den Sehvorgang durch Empfang des Lichtes von auften oder durch Aussendung des Sehstrahls aus dem Auge vorzustellen hat. K. Bergdolt
machte mich darauf aufmerksam, daft man das erwahnte Blut durchaus im Sinne einer aku ten Netzhautblutung in den Glaskorper deuten konnte, die dann auch von auften sichtbar
ware. 23 Im Druck Lyon 1515; nach neueren Untersuchungen miissen die beiden einzigen Drucke
gegenuber der handschriftlichen Uberlieferung als wenig verlaftlich gelten, doch sind bis jetzt nur ganz wenige Stiicke des Corpus Constantinum kritisch ediert. Vgl. Mark Jor dan, The fortune of Constantine's Pantegni, in: Constantine the African and 'All ibn
al-'Abbas al-Magusi. The Pantegni and Related Texts, ed. Ch. Burnett and Danielle
Jacquart, Leiden 1994 (Studies in Ancient Medicine. 10), 286-302; 286-290 zu den Drucken; Jordan wiirde notfalls den Baseler Druck vorziehen (290). 134
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
II. Die Kapiteltafel zum Celsustext
Wenden wir uns jetzt den Belegen in medizinischen Schriften zu. Ein wei
terer bisher iibersehener Beleg fur cataracta findet sich in den Kapitelbei schriften zu Celsus' De medicina. Sie sind in den Handschriften J und T
uberliefert,24 und zwar teilweise doppelt, namlich sowohl zu Beginn eines
Buches als auch am Rande des jeweiligen Kapitels. Der Starstich wird von
Celsus in Kapitel 7,7,13 abgehandelt; die Uberschrift dazu lautet25 (unter
Vernachlassigung der Zahlung) De cataractis. Die von Marx (S. XXIII)
vorgeschlagene Datierung der Kapiteltafel bzw. -beischriften in das (friihe) 5. Jahrhundert erscheint moglich, ware aber ausfiihrlicher zu begriinden, als es bei Marx geschieht.26 Allerdings sehe ich vorderhand keinen verniinf
tigen Grund, diese Kapitelbeischriften nicht vor Gregor von Tours anzu
setzen. Damit hatten wir dann das (einstweilen) friiheste Zeugnis fur cata
racta als Augenkrankheit vor uns, noch dazu aus der Feder eines Fachman
77/. Die jiingere Oribasiusiibersetzung
Im Gegensatz zu den Belegen bei Gregor von Tours sind an der Gleichset
zung von imoxuoic; und cataracta bei den beiden folgenden Stellen, die die
jiingere Oribasiusiibersetzung bietet, keine Zweifel moglich:
5. Orib. eup. 4,24 (Kapiteliiberschrift) La S. 545, 13 XXIIII. Ad amaurosin et xS' IIqoc; Xeuxcbjiaxa xai
ypocisin, id est cataractas &|iauQ(0aeic; xai dQXOnevnv
nes. 27
imox^oiv ...
6. Orib. eup. 4,24,11 La S. 546, 13
hoc enim caligine abstergit et inchoantes catharactas
repremit
tovto &[j,|3)uja)juac; dvaaxeXXei xai
xdc; aoxofxevac; imoyvozic,
6LaaxL6vr]ol
135
24 S. Salvatore Contino, Auli Corneli Celsi de medicina liber VIII, Bologna 1988 (?Sic vos non vobis". Collana di studi greci e latini. 6), 59. Fried rich Marx, A. Cornelii Celsi
quae supersunt recensuit Fridericus Marx, Lipsiae et Berolini 1915 (Corpus medicorum
Latinorum. I), XXII f. 25 Da mir ein Film von T nicht zuganglich war, stiitzte ich mich auf die Angaben von Dr.
Brigitte Maire, Universite de Lausanne, der ich herzlich danke. Sie wies mich ebenfalls
darauf hin, daft bei J eine Beischrift im Haupttext fehlt. 26 Innocenzo Mazzini plant demnachst, wie er in seiner gerade erschienenen Celsusausgabe A. Cornelio Celso, La chirurgia (Libri VII e VIII del De medicina). Testo, traduzione, commento, Macerata 1999 (Universita degli Studi di Macerata, Facolta di Lettere e Filoso
fia. Testi e Documenti. 5) schreibt (S. 51), eine ausfuhrliche Untersuchung; einstweilen
verlegt er mit aller Vorsicht die Entstehung des Inhaltsverzeichnisses nach Ravenna (S. 26). 27 Die spatere Entwicklung kommt zur Sprache bei Michael McVaugh, Cataracts and
Hernias. Aspects of Surgical Practice in the Fourteenth Century, Medical History 45, 2001 (im Druck). Ihm und David Langslow (Manchester) danke ich fur die Moglichkeit, einige offene Fragen mit ihnen zu besprechen und von ihrem Rat zu profitieren.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Fraglich ist hier allein die Datierung der Zeugnisse. War der Erstherausge ber Molinier fur das 10. Jahrhundert eingetreten
- eine Ansicht, die lange
unwidersprochen blieb -, so setzte sich 1932 Henning Morland mit seiner
These durch, die jiingere Ubersetzung sei nur geringfiigig jiinger als die al tere, gehore also wohl noch dem 6. Jahrhundert und damit der Lebenszeit
des 594 gestorbenen Gregor von Tours an. Bekanntlich liefi sich die Re
daktion des Thesaurus linguae Latinae von Morlands Argumentation
uberzeugen und wertet seitdem die jiingere Ubersetzung ebenfalls aus. Al
lerdings war der Artikel cataracta bereits 1908 erschienen,28 zu friih, als
dafi man bei diesem Wort die jiingere Oribasiusiibersetzung beriicksichtigt hatte.
IV. Der 2. lateinische Kommentar zu den hippokratischen Aphorismen
Der jiingere (und kiirzere) der lateinischen Kommentare zu den hippokra tischen Aphorismen wurde ausfiihrlicher nur von Beccaria untersucht.29
Nach seiner (unwidersprochenen) Meinung stammt er aus der Zeit der ka
rolingischen Renaissance, die wir kurz vor der Wende vom 8. zum 9. Jahr hundert beginnen lassen konnen, und wurde in Frankreich verfafit. Zu
ganglich war bisher aufier dem von Beccaria S. 67f. veroffentlichten Stuck
mit dem Kommentar zu aph. 4,13-14 der Abschnitt aph. 1,1-11 in der Stu
die von J.-H. Kiihn.30 Die von Kiihn eingefiihrte Bezeichnung Lat B emp fiehlt sich, denn beide Kommentare (Kiihn nennt den ersten Lat A) er
scheinen in den Handschriften teils anonym, teils unter wechselnden Au
torennamen und werden in Pearl Kibres Verzeichnis nicht unterschieden.31
Das Wort cataracta findet sich in der Erklarung zum Aphorismus 6,56; ich
gebe den unkorrigierten Text der Handschrift Bern, Burgerbibliothek 232, fol. 34r, aus dem 10. Jahrhundert.32
28 Die zweite Oribasiusstelle findet sich bei Souter und danach bei Arnaldi. 29
Augusto Beccaria, Sulle tracce di un antico canone latino di Ippocrate e di Galeno. II. Gli Aforismi di Ippocrate nella versione e nei commenti del primo medioevo, Italia Me
dioevale e Umanistica 4, 1961, 26-63, hier 63-71. 30
Joseph-Hans Kuhn, Die Diatlehre im fruhmittelalterlichen lateinischen Kommentar zu
den hippokratischen Aphorismen (I 1-11), Neustadt/Weinstr. 1981 (Selbstverlag des Ver fassers), Text auf S. 42-48. Beccaria, Sulle Tracce II, hatte S. 65 bereits aph. 1,1 abge druckt.
31 Pearl Kibre, Hippocrates Latinus. Repertorium of Hippocratic writings in the Latin
Middle Ages, revised ed., New York 1985. 32
Beccaria und Kuhn kannten Lat B nur aus dieser Handschrift; der Kommentar wird aller
dings, wie ich feststellen konnte, auch in Auxerre, Bibliotheque municipale, 22 (s. XII), fol. 70r-116r (die Angabe bei Kibre, a.a.O. 38a, ist entsprechend zu verbessern) und Lon
don, British Library, Royal 12.E.XX (s. XII), fol. lr-32v, iiberliefert. Kibre, 31 Anm. 13, erwahnt beide Handschriften, ohne sie mit Lat B zu verbinden. Ich plane eine ausfuhrliche Studie iiber Lat B, wo weitere Einzelheiten zu finden sein werden. 136
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
7. melancolicis morbis in hoc periculis et decursiones aut apoplexia corporis aut spas mon aut mania aut cecitatem facit
Repletio melancolico humore et ciborum prauitas frequens quia humectare cottidie is
tum humorem faciat necesse est si ex consparsione talis fuerit ubicunque conpulsus fue
rit. si in capite facit mania cecitate oculorum id est cataracta- si in mamillis cancrum- si
in pulmonis et torace apoplexia- si in toto corpore penetrauit spasmus in hac periculose dicit ubi decurrerit aegritudinem facit
Die Formulierung cecitate oculorum id est cataracta- zeigt m. E. zweierlei:
dafi jedenfalls eine mit Blindheit einhergehende Augenerkrankung gemeint ist, und dafi der Autor vom Leser erwartet, dafi er cataracta?3 nicht nur
versteht, sondern sich darunter besser etwas vorstellen kann als unter cae
citas oculorum. Mit anderen Worten, er setzt voraus, dafi cataracta ein gan
giger Terminus war.
Es liegt nahe, nach diesem Befund die griechische Kommentarliteratur zu
diesem Aphorismus zu uberprufen, urn dort vielleicht ein griechisches
Zeugnis fur xataQ(Q)dxxr]5 zu finden. Meine Suche war leider ergebnislos - dafi der gerade erst vorzuglich edierte Kommentar des Stephanus34 un
mittelbar vor unserer Stelle mit aph. 6,55 abbricht, war dabei besonders
frustrierend.35
V. Das Rezeptar im cod. Lond. Arundel 166
Der aus dem Anfang des 9. Jahrhunderts stammende 2. Teil der Hand
schrift British Library Arundel 166 enthalt ein auf fol. 14r beginnendes
umfangreiches Rezeptar (es findet sich grofienteils auch in der Echterna
cher Handschrift Par. lat. 11219), in welchem das Wort cataracta auf fol.
60r erscheint.36
8. Coluria ad cataractas qui ex subito ueniunt: salis amoniacas dr.37 I oppobalsamo dr.
II melle coti[li]la I oleo uetere cotilas VIIII fel de taxone dr. I. conficis et uteris.
137
33 Die Varianten catarapta Lond., cataractas Auxerre sind in unserem Zusammenhang ohne
Belang. 34 Stephanus of Athens, Commentary on Hippocrates' Aphorisms. Text and Translation
by Leendert G. Westerink (fl, Berlin 1985-1995 (Corpus medicorum Graecorum
11,1,3,1-3). 35 Der Druck von Lat A, besorgt von Winter von Andernach, bricht mit aph. 6,31 ab. Eine
Kopie dieses Werkes wurde mir freundlicherweise vom Institut fur Geschichte der Medi
zin der Universitat Hamburg zur Verfugung gestellt (Oribasii medici clarissimi commen
taria in aphorismos Hippocratis hactenus non uisa [...] nunc primum in Medicinas studio
sorum utilitatem edita, Basileae 1535). Eine Uberpriifung des Kommentartextes zu aph.
6,56 in einigen Handschriften erbrachte kein weiteres Zeugnis fur cataracta. 36 In der Pariser Handschrift fol. 154vb, dort Unzen statt Drachmen 37 Das im Druck nicht leicht wiederzugebende Zeichen steht mit ziemlicher Sicherheit fur
drachma.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Genauer gesagt, handelt es sich um ein (fliissiges) Augenmittel (collyrium) fur cataractas qui ex subito ueniunt ,unvermittelt auftretende cataractae'.
Dieser Zusatz und die Bestandteile des folgenden Rezepts machen es
aufierst unwahrscheinlich, dafi an Katarakte im heutigen medizinischen
Sinn gedacht werden darf. Obwohl der Kontext, anders als bei Gregor von
Tours, eindeutig medizinisch ist, leistet das bei der Eingrenzung der Be
deutung keine grofie Hilfe. Wir mussen uns wohl damit bescheiden festzu
stellen, dafi eine empfindliche, Blindheit hervorrufende Sehstorung ge meint ist. Da sie plotzlich auftritt, ist vielleicht an einen akuten Verschlufi
der Zentralarterie der Netzhaut oder an eine Zentralvenenthrombose zu
denken.38 Die Lehre, die wir aus dieser Belegstelle ziehen mussen, ist die, dafi eine sichere medizinische Verwendungsweise eines bestimmten Termi
nus, wie wir sie in der Oribasiusiibersetzung beobachtet haben, bei ande
ren, zeitlich spateren Stellen nicht ohne weitere Uberpriifung vorausge setzt werden darf.
VI. Das Rezeptar im cod. Vat. Reg. lat. 1143
Noch ein weiteres Rezeptar ebenfalls in einer Handschrift des 9. Jahrhun derts iiberliefert (auf fol. 175r"v) ein vom vorangehenden verschiedenes Re
zept, in dem wir die Bezeichnung cataracta erneut antreffen:
9. Medicamentum ad caliginem oculorum uel ad albolam aut cui cataraptas39 incipit di scendere. id est inprimis draganto aloe costo gariofeles tres. piperis grana. XXVII. Om
nia haec tundis diligenter in mortario et mittis in uaso ereo cum uino albo. et feruis su
pra scriptas species usque ad medietatem. Iterum facis puluere de aloe mundo et semo
tis de draganto. uno die mittis puluere de alo<e> puro et sequenti medicamentum quod fersum40 abis Iterum in alio die I aut in tertio mittis puluere in oculos de draganto et
sequenti medicamentum quod supra scriptum est utere haec omnia donee sanetur.
Die cataracta genannte Krankheit wird hier als allmahlich beginnend ge
kennzeichnet; in Verbindung mit den Zeugnissen, die wir zuvor kennenge lernt haben, halten wir fest, daft cataracta sowohl als allmahlich verlaufen
der Prozefi wie auch als plotzlich eintretendes Ereignis geschildert wird.
38 Freundlicher Hinweis von K. Bergdolt. 39 Sicher als Nominativ Singular aufzufassen, nicht als Akkusativ Plural anstelle des Nomi
nativ Plural, -as auch nicht als bewahrte oder restituierte griechische Endung. Ebenfalls -as
im selben, leicht verkiirzten Rezept in der Uberlieferung des Vat. Reg. lat. 1443 (s. XII/
XIII), fol. 66r: Medicamen ad caliginem oculorum uel ad albulas aut cui cataractas incipit descendere [...]
40 Partizip Perfekt Passiv zufervere ,sieden* (trans.); Einflufi von bullire, das intransitiv und
transitiv gebraucht wurde? 138
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt
VII. Die Sapientia artis medicinae
Die Sapientia artis medicinae41 hat im Jahre 1901 als erster der italienische
Bakteriologe und Medizinhistoriker Piero Giacosa nach einer einzigen Handschrift (Biblioteca Angelica di Roma, cod. 1502 [V. 3.9], vermutlich
spates 12.42 Jahrhundert, fol. 1-2) bekannt gemacht. Ein Vierteljahrhun dert danach (1928) lieferte dann ein Schiller Henry E. Sigerists, Momtschil
Wlaschky, unter Heranziehung dreier weiterer Handschriften43 des 9.
Jahrhunderts44 eine Edition auf breiterer Basis.
Diese Sapientia artis medicinae ist als eine kurze, fur Anfanger gedachte
Einfuhrung in die Medizin einzustufen. Es handelt sich um eine eher lok
kere Zusammenstellung kurzer Textstiicke unterschiedlichster Herkunft.
Sie gehoren vermutlich nicht nur verschiedenen Verfassern, sondern eben
so verschiedenen Epochen an. Dafi sie allesamt alter sind als Isidor, also in
die Zeit vor dem friihen 7. Jahrhundert gehoren, kann eigentlich kaum
bezweifelt werden, wenngleich die alteste, aus dem spaten 8. oder friihen
9. Jahrhundert stammende Handschrift der Sapientia artis medicinae eine
Datierung nach Isidor nicht von vornherein auszuschliefien vermag, we
nigstens soweit es den uns hier beschaftigenden Teil 2 betrifft.
In der von Wlaschky veroffentlichten Fassung lassen sich vier Hauptteile unterscheiden:
1. Kleine Texte zur Physiologie (= Wlaschky I); 2. Augenheilkundliches (= Wlaschky II); 3. Bruchstiicke eines Inhaltsverzeichnisses zu einem
nicht vorhandenen Text (= Wlaschky III 1); 4. eine Atiologie der Krank
heiten aufgrund der sie verursachenden Safte (= Wlaschky III 2-17).
Im Mittelalter hat sich diese kleine Textsammlung einiger Beliebtheit er
freut. Das diirfen wir aus der stattlichen Anzahl der Handschriften, die sie
uberliefern, schliefien. Meist finden wir allerdings nur die Abschnitte 1
und 2, und der zweite bricht in einigen Handschriften vor der uns hier in
teressierenden Kataraktoperation (Wlaschky II 2) ab.
139
41 Zu den Drucken vgl. Bibliographic des textes medicaux latins. Antiquite et haut moyen
age, sous la direction de Guy Sabbah, Pierre-Paul Corsetti, Klaus-Dietrich Fi
scher. Preface de Mirko D. Grmek, Saint-Etienne, 1987 [vielmehr 1988] (Memoires du
Centre Jean Palerne. 8) (im folgenden: BTML) Nr. 524-526; umfangreichste Zusammen
stellung von Handschriften bei Pearl Kibre, Hippocrates Latinus, 148. Dazu kommt
Brux. 2419-31 (s. XII), fol. 85r-86r. Nicht alle Handschriften enthalten freilich die uns hier
beschaftigende Kataraktoperation. 42 Wlaschky gibt s. XIII/XIV an, Kibre (s. unten) ?XII Century".
43 Sang. 44, Sang. 751 und Hunter. 96 (T.4.13). 44
Wlaschky datiert den Sang. 44 ins 10. Jh., nach Beccaria handelt es sich um die 2. Halfte des 9. Jahrhunderts. Hunter. 96 (T.4.13)
= CLA 156 wird sogar s. VIII/IX datiert und
ware dann der fruheste Zeuge.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Dieses augenheilkundliche Kapitel ist wissenschaftshistorisch zweifelsohne
das aufregendste:45
10. II 1 Oculus humanus tunicas habet VII. ypocimata autem sunt VII. Omnia autem
eorum nomina hec sunt scripta.46 Platoride. Argorizite. Traide. Mollirides. Marorides.
Platidas. Serotalaxis.
Platoridas paracintidas sexto anno. Argorizitas octauo anno, et in tertio anno paracinti das si annositas hominis fuerit. Traidas paracintidas quarto anno. Platidas paracintidas secundo anno, si quando inueneris mollirides et marorides et serotalaxis iste uero non
curantur.
II 2 Gataractas autem curas mense maio et toto estiuo et autumno. intrante autem hye me suspende curam. Oculi cataractas sic curabis. Primum ad uentrem dabis catarticum
gera et pigra. Post tertium diem fleuothomas eum in uena cefalica. post quartum diem
ligabis illi manus suas ad genuculum suum dextrum- Oculum illius dextrum cum manu
tua sinistra paracintidas caute- ne uisum tangas et oculum amittat. Alter caput illius for
titer teneat- ne conmoueatur aut in periculum cadat. muria salsa munda colata in oculos
ministra- Iterum uitella ouorum cum lana mollissima super oculos inpone. in loco au
tem secreto iaceat per dies nouem- et non sonum audiat- Secunda uice ad diem per cliste
rem uentrem eius curabis.
Cibos ei tales dabis. oua recentia accipiat. Item sucum ptysane accipiat. A uino suspen de et calidam aquam bibat per dies nouem. Decima autem die balneis utatur. et sanus
efficitur.
Das Kapitel lafit sich in zwei Teile gliedern, in deren erstem (Wlaschky II
1) es um die sieben Arten des Stars und den besten Zeitpunkt ihrer chirur
gischen Behandlung geht, sofern sie nicht inoperabel sind. Der zweite Teil
beschreibt eine Staroperation, und zwar mit grofierem Detailreichtum, als
wir es in der vorangehenden medizinischen Literatur - ich denke hier vor
allem an Celsus (7,7,14), der noch am ausfiihrlichsten ist - finden.47 Sieht
man von Antyllos ab, den wir nur aus einer in Rhazes' Continens erhalte nen arabischen Ubersetzung kennen,48 so ist allein Paulos von Aigina 6,21,2 vergleichbar,49 doch sind wir mit ihm bereits im friihen 7. Jahrhun dert angelangt. Die entstellten und augenblicklich kaum entschlusselbaren
45 Der Text hier nach British Library add. 8928 (s. X), fol lv, ohne Anderungen. 46 Lies entweder hie sunt scripta oder hec sunt [scripta]. 47 Die Feststellung Gerhard Baaders in seiner Arbeit zur Terminologie des Constantinus
Africanus, ?die Kenntnis des Starstichs zeigen uns nur Operationsbilder, nicht vor dem
11. Jahrhundert", a.a.O. 37, wird man entsprechend korrigieren. 48 Jiingst nochmals deutsch bei Weisser, 487f., in: Michel Feugere-Ernst Kunzl-Ursula
Weisser: Les aiguilles a cataracte de Montbellet (Saone-et-Loire). Contribution a I3etude
de Vophtalmologie antique et islamique. Die Starnadeln von Montbellet (Saone-et-Loire). Ein Beitrag zur antiken und islamischen Augenheilkunde, Jahrbuch des Romisch-Germa
nischen Zentralmuseums 32, 1985, 436-508. 49 Bei Francis Adams, The seven books of Paulus JEgineta [...] with a commentary embra
cing a complete view of the knowledge possessed by the Greeks, Romans and Arabians on
all subjects connected with medicine and surgery, London 1846, 279-283, findet man eine
(englische) Ubersetzung und ausfuhrliche Diskussion; den Parallelen ist jetzt hinzuzufii gen Chiron 70-76 (deutsche Ubersetzung und Diskussion bei Rudiger Frik [BTML Nr. 414], 12-21, zuvor Wilhelm Rieck, Tier augenheilkunde im Wandel der Zeiten, Cheiron.
Veterinarhistorisches Jahrbuch 8, 1936, 7-79, hier 28 f.). 140
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
griechischen Bezeichnungen der Stararten machen klar, dafi es sich bei dem
in der Sapientia artis medicinae iiberlieferten Text nur urn eine Uberset
zung aus dem Griechischen handeln kann, wobei das Verhaltnis zur Quel le, auf der Paulos von Aigina fufit, im einzelnen zu klaren ware.
In diesen Anweisungen fur die Staroperation heifit der Star cataracta, und
erstaunlicherweise nur so, wahrend bei der vorausgehenden Unterschei
dung der Stararten der Ausdruck hypochymata benutzt worden ist. Die
ausfuhrliche Beschreibung der Operation erlaubt an der Bedeutung ,grauer Star* fur cataracta nicht den geringsten Zweifel. Es ist auch offensichtlich, dafi fur den Ubersetzer, den man sich eigentlich nur als einen Arzt vorstel
len kann, cataracta bereits ein gelaufiges Wort fur Star war. Und genau der
Umstand, dafi cataracta heutzutage fur jeden Arzt ein so gelaufiges Wort
ist, hat wohl verhindert, dafi Wlaschky oder sein Betreuer Sigerist bemerk
ten, welche historische Bedeutung fur die Wortgeschichte von cataracta
diesem Text zukommt.
VIII. Constantinus Africanus
Schlagen wir abschliefiend den Bogen zu Constantinus Africanus. In seiner
Pantegni, die auf dem Werk des Haly Abbas (bzw. al-MagusI) fufit, kommt das Wort cataracta sowohl im theoretischen wie im praktischen Teil vor. Dabei gehen wir - wie das Mittellateinische Wbrterbuch - von
dem bekanntermafien unzuverlassigen Druck in den Opera omnia Ysaac
(Lyon 1515) aus; das bedeutet, dafi unsere Untersuchung in diesem Punkt
nur vorlaufige, nicht abschliefiende Geltung beanspruchen kann und die
Anzahl der Belege moglicherweise durch eine kritische Ausgabe oder we
nigstens Einsicht in mehrere Handschriften modifiziert wiirde.
Der einzige Beleg, den das Mittellateinische Worterbuch aus Constantin zi
tiert, steht in Kap. 4 des 6. Buches des theoretischen Teils der Pantegni, iiberschrieben De morbis separantibus iuncturas, ,Von Krankheiten, die
Verbindungen trennen'. cataracta ist eine von 6, genauer gesagt die 5. Ka
tegorie der Augenkrankheiten:
11. Quintus est catharacta, id est aque fluentia et est officialis attinens oppilationi.
Die Krankheit ist officialis, womit gemeint ist, sie betrifft - und das heifit in diesem Falle: stort - die Funktion eines Organs; attinens oppilationi,
aufgrund50 einer Verstopfung oder Blockade. Damit wird wiederum die
aus dem Altertum gelaufige Atiologie des Stars angesprochen, den man als
Fliissigkeitsansammlung deutete, welche die Pupille verlegt. Es ist wichtig
141 50 Ich verstehe attinere 4- dat. wie attinere ad, ,betreffen, gehoren zu', d. h. oppdatio ist der
Oberbegriff fur diese Funktionsstorung.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
festzuhalten, da6 Constantin das Wort cataracta ohne weiteren Zusatz und
nicht als Synonym gebraucht. Fur ihn mufi dieses Wort also bereits einen
festen Bedeutungsinhalt gehabt haben; anders gesagt, es ist nicht anzuneh
men, dafi Constantin die Metapher, die cataracta zugrunde liegt, aus eige nem Antrieb erneut eingefuhrt hat. Damit spricht alles daftir, dafi cataracta
als Bezeichnung einer mit Blindheit einhergehenden Augenerkrankung seit
der Zeit Gregors von Tours ohne Unterbrechung von Arzten und wohl
auch von medizinischen Laien gebraucht worden ist, somit ein tatsachlich
gangiger Terminus war, wie es die Verwendung in dem zweiten lateini
schen Aphorismenkommentar (Lat B) vermuten lafit.
Eine Eingrenzung der Wortbedeutung auf den grauen Star ist bei Constan
tin nur an denjenigen Stellen zwingend, wo die Operation selbst beschrie
ben wird, in pract. 9,33 ;51 im Liber de oculis lautet die Uberschrift des Ka
pitels 2852 De cataracta et uisus defectione, eine Formulierung, die wir
ebenso in pract. 5,32 De cecitate et cura antreffen.
IX. Der Ursprung der Metapher
Hat sich die neue, metaphorische Bedeutung eines Wortes erst einmal im
allgemeinen Sprachgebrauch gefestigt, kann das Wissen iiber den Ursprung der Metapher, den Vergleichspunkt, auf den es ankam, leicht in Vergessen heit geraten, ja man kann es als Ballast empfinden, der nicht mehr benotigt wird. Ein solcher Fall ware z. B. der des Wasserhahns, dessen Profil in sei
ner alten Form ja durchaus dem eines Hahnes ahnlich sieht; beim Gashahn
ist das schon nicht mehr der Fall, ,Hahn' bedeutet hier ,Absperrvorrich
tung'. Eine nicht geringe Schwierigkeit bei der Klarung der Frage, warum
cataracta fur eine Augenkrankheit verwendet wurde, liegt darin, dafi auch
heute noch Unsicherheiten hinsichtlich der Etymologie von 6 xaxaQ
q&%tt]5 bestehen, vor allem aber darin, dafi eine grofte Anzahl auf den er
sten Blick vollig heterogen wirkender Bedeutungen angeboten wird, die
anscheinend gar nichts miteinander zu tun haben und aus denen sich nun
der Sprachforscher oder der Dozent der medizinischen Terminologie die
richtige aussuchen soil.
Ich mochte sie zunachst noch einmal in einiger Breite zusammenstellen.
W. Papes Handwdrterbuch der Griechischen Sprache verzeichnet
51 Das Mittellateinische Worterbuch zitiert dieses Kapitel, allerdings aus Tract, de chirurg. (besser bekannt als Bamberger Chirurgie) 704; daft beide Kapitel identisch sind, scheint trotz des deutlichen Hinweises bei Sudhoff ubersehen worden zu sein. Jedenfalls kann
man die Stelle nur bedingt als weiteres Zeugnis werten, da sie nicht eigenstandig ist. 52 Hirschberg, Geschichte (wie Anm. 6) 264 gibt Kap. 27 an. 142
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
Wasserfall, Wasserstrudel
Fallthiir, Fallgatter; eine Fall-, Zugbriicke, mit der man auf ein Schiff ge hen kann
ein sich schnell herabstiirzender Wasservogel
Das mafigebende Greek-English Lexicon von Liddell und Scott in der
Neuausgabe von Stuart Jones und MacKenzie bietet an
as Adj., down-rushing; sheer, abrupt as Subst., waterfall, cataract53
portcullis moveable bridge, for boarding ships sluice
a sea-bird54
Damit haben wir die wesentlichen Angaben zusammengestellt. Den Was
servogel55 konnen wir als zu unwahrscheinlich eliminieren, das Fallreep ebenso. Da der Terminus in der Bedeutung , Augenkrankheit* zuerst latei
nisch auftritt, sollten wir jetzt in den lateinisehen Worterbiichern nach
schlagen und priifen, ob sie weitere Wortbedeutungen anfiihren.
Beginnen wir mit dem spatlateinischen Spezialworterbuch von Alexander
Souter:
an imaginary quarter of heaven, which, when opened up, lets torrents of
rain fall on the earth
the stocks56
window
barrier
cataract (the eye-disease)
Das Worterbuch der christlichen Latinitdt von Albert Blaise ergibt zusatz
lich
trou dans le muraille pour la fumee
sorte de fenetre
fenetre grillee (sur des reliques)
143
53 Zu KaTaQQaxrnc; als Namen verschiedener Fliisse und Flufiteile s. RE X, 1919, 2484f. 54 Die Bedeutung ? trap-door" wird im Erganzungsband von 1996 mit Recht gestrichen.
(Man wird sie dann auch in Hjalmar Frisks Griechischem etymologischem Worterbuch,
2. unverand. Aufl. Heidelberg 1973, Bd. 1 801, entfernen). Bei den angefiihrten Stellen aus der griechischen Ubersetzung des Alten Testaments handelt es sich um das, was sonst
im Englischen als ,the flood-gates of heaven4 bezeichnet wird und deutsch ,die Schleusen
des Himmels' heifk. 55 Zur Bestimmung s. Helmut Leitner, Zoologische Terminologie beim Alteren Plinius,
Hildesheim 1972, 73 f. mit der dort angegebenen Literatur. 56 Itala Ier. 20,2-3.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Es zeigt sich erneut, dafi wir zwar einige Bedeutungen als unwahrschein
lich ausschliefien konnen, insgesamt aber immer noch nicht sehen, in wel
cher Richtung die Losung liegen konnte. Wir miissen deshalb zu den vor
hin behandelten Quellen zuriickkehren, um dort im Kontext nach mogli chen Erklarungen zu suchen. Wir beginnen bei Constantinus Africanus als
dem Fixpunkt der bisherigen Forschung und gehen von ihm zu Gregor von Tours, unserem fruhesten Beleg, zuriick.
Bei Constantinus Africanus heilk es catharacta, id est aque fluentia. Das ist
die traditionelle Erklarung mit Nennung des Wassers. Vermutlich wurde
sie durch die arabische Formulierung veranlafit oder zumindest gestiitzt; auf den ersten Blick pafit sie so schon zum Wasserfall, dafi man sie fast stets
als korrekt ansah.
Das Rezeptar im Vat. Reg. lat. 1143 (Text 9) und Orib. eup. 4, 24,11 (Text
6) sprechen von beginnenden Katarakten, wahrend das andere Rezeptar
(Text 8) ein Mittel fur plotzlich auftretende Katarakte bereitstellen will.
Diese Angaben sind zwar fur die Eingrenzung der vorliegenden Stoning
wichtig, ohne Belang aber fur die Deutung der Metapher.
Gregor bietet nicht nur die fruhesten datierbaren Belege fur cataracta -
und zwar im Plural, wobei schwer zu entscheiden ist, ob es sich um ein
plurale tantum handelt oder der Plural durch die beiden mit Blindheit ge
schlagenen Augen bedingt ist -, sondern er verbindet dieses Wort auch mit
den Verben decidere ,herabfallenc und reserare ,6ffnen, aufsperren'. Bei re
serare scheidet der Gedanke daran, dafi fliefiendes oder herabstiirzendes
Wasser gemeint sei, aus. Es mufi folglich eine irgendwie geartete Sperre herabstiirzen oder herabfallen (decidere), die sich dann wiederum offnen
lafit (reserare). Diese Sperre blockiert den Zugang (oculorum aditus [...] obseratos57 heifit es in Text 1, mit einem Verb, das ebenfalls von sera
,Querbalken, Turriegelc abgeleitet ist) und kann (anders als ein Wasserfall)
spater wieder geoffnet werden. Zu dem Begriff der oculorum aditus bei
Gregor pafit der viel spatere Ausdruck porta uisus bei Wilhelm von Conge nies (de Congenis); wir diirfen vermuten, dafi beide von einer ahnlichen
Vorstellung ausgingen.
Womit wird nun der Zugang zum Auge bzw. das Tor des Gesichtssinnes
versperrt? Wenn wir jetzt zur Liste der Bedeutungen, die wir oben zusam
mengestellt haben, zuriickkehren, ist die am nachsten liegende Moglichkeit wohl das an vielen Stadttoren vorhandene Fallgatter.58 Dafiir hatten sich
57 Weitere Belege mit Anwendung auf Teile des Korpers ThLL IX 190,66-73. Die Bedeutung ,Sperre; Verrammelung, Barrikade, Hindernis' hat obiex, das in der Form obex CGL II
343,22 als Erklarung fur cataracta verwendet wird. 58
Vgl. E. Saglio, cataracta, in: Daremberg-Saglio, Dictionnaire des Antiquites Grecques et Romaines. 144
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
bereits Fabricius ab Aquapendente, Boerhaave und Heister ausgepro
chen,59 und obwohl Hirschberg in der Zwischenzeit60 durch Benutzung des Thesaurus linguae Latinae zwei der von mir oben behandelten Gregor stellen kennengelernt hatte und dort ebenfalls an jFallgatter' dachte,61 blieb er bei der Verbindung von cataracta und Wasserfall. Hatte er, wie das jetzt
moglich ist, die Abfolge der Belege kontinuierlich von Gregor bis Con stantinus Africanus uberblicken konnen, hatte er vermutlich anders geur teilt.62
Doch kehren wir zuriick zum Fallgatter. Fiir seine Benennung war aus
schlaggebend gewesen, dafi es blitzschnell heruntergelassen werden konnte
und damit eine wirksame Sperre des Stadttores innerhalb weniger Augen blicke erlaubte. Antike cataractae waren offenbar sehr massiv konstruiert, mit Eisen beschlagen, oft wohl in der Form sich rechtwinklig kreuzender
Planken oder Balken. Fiir die Augenkrankheit kommt es aber nicht so sehr
auf die Geschwindigkeit des Herabfallens an wie auf die Tatsache, dafi
nichts mehr hindurch gelangen kann, also die Tur bzw. das Tor wirklich
fest verrammelt sind. Dieser Gesichtspunkt des Festverschlossenseins war
in der Spatantike auch in der oben angefuhrten Bedeutung ,Gefangnisc fiir
cataracta sowie in dem griechisch nicht belegten Wort cataractarius - zu
deutsch Gefangniswarter63 -
gegenwartig. Ein weiterer, fiir die Bedeutung
jGefangnis* und ,Fenster* wichtiger Aspekt, namlich die Gitterform, kann
bei der Ubertragung auf den grauen Star ebenfalls eine Rolle gespielt ha
ben; in diesem Fall ware dann cataracta zuerst auf die partielle Storung des
Sehakts angewandt worden, die die Entwicklung des Stars und manch an
derer Krankheitsbilder mit sich bringt. Mir jedoch erscheint im Augen blick der zuerst genannte Aspekt der totalen Sperre als Ausgangspunkt die
ser Metapher wahrscheinlicher.
145
59 Diese Angaben nach Julius Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde. Register Band, Berlin 1918, 20. Auch das Shorter Oxford English Dictionary on Historical Prin
ciples s. v. cataract schreibt bei der Augenkrankheit ?App. a fig. use of 3 [d. h. portcullis - K.-D. Fi.f. 60 D. h. nach der Abfassung des 1899 erschienenen Bandes iiber die Antike und vor der Be
arbeitung des 1918 publizierten Registerbandes. 61
?Somit ist schon 500 Jahre vor Constantinus das Wort cataracta, aber im Sinne von Fallgat ter, von einem Bischof fur eine Augenkrankheit angewendet worden, die doch wohl unser
Star gewesen ist." Julius Hirschberg, Geschichte der Augenheilkunde. Register-Band, Berlin 1918, 20 Anm., zu unserem Text 4.
62 Die alteren Ansichten sind mit teilweise wortlichen Zitaten bequem zusammengestellt bei
Hugo Magnus, Geschichte des grauen Staares, Leipzig 1876, 94-98. Zur Kontinuitat des
Wortes im Romanischen vgl. Walther von Wartburg, Franzosisches etymologisches
Worterbuch, tome II 1, Bale 1949, 492 f. 63 Die falsche Darstellung des Wortmaterials im Thesaurus linguae Latinae hat das Verstand
nis der Bedeutungsentwicklung sicher erschwert und ungunstig auf die Gliederung im
Mittellateinischen Worterbuch gewirkt.
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Klaus-Dietrich Fischer
Ungewohnlich bei der Wortgeschichte von cataracta ist noch ein weiterer
Umstand, mit dem ich meine Ausfiihrungen schliefien mochte. Wir haben
hier einen Fall vor uns, in dem ein medizinischer Fachterminus, an dem an
sich nichts auszusetzen ist, verdrangt wurde, und zwar von einem Begriff, dessen sich womoglich zuerst medizinische Laien bedient haben (fur das
nicht sicher datierte Zeugnis aus der Celsusuberlieferung, somit aus medi
zinischem Zusammenhang, s. oben). Fur die medizinischen Laien war der
theoretische Hintergrund, d. h. die pathogenetischen Vorstellungen in den
Bezeichnungen imoyvoic, und suffusio, weniger wichtig als die konkrete
Anschaulichkeit des Begriffs cataracta, den sie an ihre Stelle setzten. Und
das iiberzeugte schliefilich auch die Mediziner, die das Wort iibernahmen.
Spater hat cataracta dann iiberlebt, weil an seiner fachsprachlichen Position
keine Zweifel aufkommen konnten, denn seine Herkunft aus dem Griechi
schen - auch heute noch das bevorzugte Reservoir fur die Bildung medizi
nischer Fachausdrticke - sah man ihm auf den ersten Blick an.
Ubersicht iiber die Bedeutungen
(Untergliederungen auf derselben Ebene, z. B. 2.1, 2.2 usw., implizieren nicht notwendig eine chronologische oder semantische Prioritat; dazu ist
hier keine Aussage beabsichtigt.)
xctxaQQaxxco (katarrhatto) (kraftvoll und schnell) herabfahren, herabstiir zen
6 xaxarj(Q)axxr)g (ho katarrhaktes) ,Herabsttirzer, Herabfaller' cataracta, ae m./f.
I. zur Bezeichnung naturlich vorkommender Dinge und Lebewesen, die
herabstiirzen
1. Lebewesen: bestimmte Art eines Vogels
2. Dinge: reifiendes Wasser
2.1 die Nilkatarakte (Stromschnellen) 2.2 ein Wasserfall
2.3 als Eigenname reifiender Flusse
II. von kiinstlich geschaffenen Dingen, die herabstiirzen oder herabfallen
1. Fallreep
2. Fallgatter (mit Gitter) als Sperre eines Stadttors o. a.
2.1 (kiinstlich angelegte) Sperre in Wasserlaufen = Schleuse, Wehr (und
das dahinter aufgestaute Wasser) 2.1.1 iibertragen auf eine ahnliche, am oder im Himmel gedachte Vorrich
tung, die den Regen zuriickhalt 146
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions
Die Klappe fdllt .
2.1.2 iibertragen auf den Redeflufi
2.1.3 iibertragen auf eine Flut von Geschenken
2.2 (krankhafte) Sperre (fur den Sehstrahl) im Auge, die die Wahrneh
mung behindert oder unmoglich macht
2.3 Gitter
2.3.1 Fenster
2.3.1.1 Fenster an einem Reliquienbehalter 2.3.2 Gefangnis
Anschrift des Verfassers: Prof. Dr. Klaus-Dietrich Fischer, M. A.
Medizinhistorisches Institut der Johannes Gutenberg-Universitdt Am Pulverturm 13 D-55131 Mainz
kdfisch @ mail.uni-mainz.de
This content downloaded from 134.93.178.72 on Mon, 4 Nov 2013 05:38:11 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions