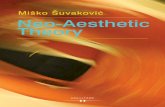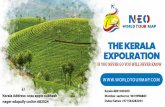Die Akteure des soziologischen Neo-Institutionalismus
-
Upload
uni-bremen -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Die Akteure des soziologischen Neo-Institutionalismus
1
Die Akteure des soziologischen Neo-Institutionalismus
Frank Meier
1. Einleitung
Der soziologische Neo-Institutionalismus interessiere sich nicht für Akteure, so
lautet eine tradierte Einschätzung, die Kritiker in den 1980er Jahren noch mit
einiger Berechtigung vortragen konnten (Perrow 1985; DiMaggio 1988). Was
seitdem ohnehin nur noch begrenzt zutraf, ist für die Gegenwartssituation end-
gültig überholt. Im Gegenteil: Wer sich die aktuelle Forschung vor Augen führt,
mag sogar den Eindruck gewinnen, dass gegenwärtig kaum eine Frage neo-
institutionalistisch inspirierte Autorinnen so sehr bewegt, wie die nach den Ak-
teuren.
Eine allgemein akzeptierte Theorie des Akteurs ist allerdings noch nicht erkenn-
bar,1
1 Dass „die Akteure“ im Titel dieses Beitrags im Plural angesprochen werden, soll vor allem darauf verweisen, wie heterogen nach wie vor die Akteurkonzepte innerhalb des Ansatzes sind.
was wiederum wenig überraschend ist. Hat der soziologische Neo-
Institutionalismus doch bei allen Bemühungen, immer wieder den state of the art
zu dokumentieren (vgl. insbesondere Powell/DiMaggio 1991; Greenwood et al.
2008), bislang zu keinem einheitlichen sozialtheoretischen Rahmen gefunden.
Erscheint in: Nico Lüdtke/Hironori Matsuzaki (Hrsg.): Akteur – Individuum – Subjekt. Fragen zu ‚Personalität‘ und ‚Sozialität‘. Wiesbaden: VS.
2
Eine explizit ausgeführte Handlungstheorie oder eine äquivalente auf anderen
operativen Grundelementen (wie etwa Kommunikation oder Praxis) fußende
allgemeine Sozialtheorie liegt jedenfalls noch nicht vor.2
Aber was lässt sich über die bislang vorliegenden Problematisierungen von Ak-
teuren sagen? Eine generell für den soziologischen Neo-Institutionalismus wich-
tige Unterscheidung kann auch hier helfen, etwas Ordnung in die Vielfalt zu
bekommen – die Unterscheidung von organisationssoziologischem Neo-
Institutionalismus einerseits und World-polity-Forschung andererseits.
Entsprechend hetero-
gen wird die Rolle von Akteuren veranschlagt.
Der World-polity-Ansatz, der in sich weitgehend homogene Beitrag des soziolo-
gischen Neo-Institutionalismus zur Theorie der Weltgesellschaft,3
Ganz anders gestaltet sich die Diskussionslage im recht heterogenen organisati-
onssoziologischen Neo-Institutionalismus. Während hier der World-polity-
Ansatz für bemerkenswert weite Teile der Diskussion kaum eine Rolle spielt,
Akteure also gemeinhin als gegeben vorausgesetzt werden, interessieren sie in
liefert die
radikalste Antwort auf die Frage nach den Akteuren. Er fasst sie als soziale Kon-
struktionen, als die historisch kontingente Plausibilität und Legitimität von Zu-
schreibungen und Zumutungen. Diese Konstruktionen geben, so die Annahme,
regelmäßig keine adäquaten Strukturbeschreibungen ab, sind häufig grundlegend
unrealistisch und ergeben sich jedenfalls nicht aus der „Natur der Sache“. Akteu-
re seien vielmehr ein Mythos der modernen Gesellschaft (Meyer/Boli/Thomas
1994; Meyer/Jepperson 2000).
2 Die bedeutendste Diskussion der handlungstheoretischen Grundlagen des Ansatzes findet sich wohl nach wie vor bei DiMaggio/Powell (1991), siehe aber auch Powell/Colyvas (2008). 3 Der Terminus „world polity“ diente ursprünglich auch zur Vermeidung des als problematisch eingeschätzten Gesellschaftsbegriffs, der allerdings in jüngerer Zeit dann doch Verwendung gefun-den hat (Krücken/Drori 2009). Zu einem alternativen, freilich gerade auf der Makroebene noch wenig ausgearbeiteten institutionalistischen Ansatz mit gesellschaftstheoretischen Ansprüchen siehe Fried-land/Alford (1991).
3
jüngerer Zeit vor allem als isolierbare Triebkräfte von Prozessen institutionellen
Wandels.4
Im Weiteren soll nun der Stand der Diskussion in beiden Strängen etwas aus-
führlicher dargestellt und kritisch gewürdigt werden, um anschließend weitere
Entwicklungsperspektiven anzudeuten. Abschließend sollen dann noch einige
wenige Überlegungen zu der Frage angestellt werden, welches Anregungspoten-
tial für andere Sozialtheorien bereits jetzt in den Akteurkonzepten des soziologi-
schen Neo-Institutionalismus zu finden ist.
Dabei erleben zum Teil – insbesondere unter dem Stichwort
institutional entrepreneur – erstaunlich starke und eher konventionelle
Akteurkonzepte einer Renaissance. Diese bleiben jedoch – aus guten Gründen –
umstritten.
2. Die gesellschaftliche Konstruktion von Akteuren in der world
polity
Der World-polity-Ansatz geht davon aus, dass die soziale Wirklichkeit der Ge-
genwart in hohem Maße durch einen universellen und inzwischen weitgehend
globalisierten kulturellen Rahmen geprägt wird (Meyer/Boli/Thomas 1994;
Meyer/Jepperson 2000). Dieser wird durch den – in loser Anlehnung an Max
Weber unterstellten – Prozess der Rationalisierung vorangetrieben, transformiert
und dabei tendenziell erweitert und konstituiert die kognitiven, normativen und
ontologischen Grundstrukturen der institutionellen Ordnung der Gegenwart.
4 Auch die Rolle von Akteuren bei der Reproduktion von Institutionen wird untersucht (DiMaggio 1988; Lawrence/Suddaby 2006).
4
Die Ontologie der world polity, die für die hier interessierende Frage von beson-
derer Bedeutung ist, stellt institutionalisierte Erwartungen in zwei Hinsichten
bereit. Zum einen bestimmt sie, welche Einheiten plausibel und legitim als Ak-
teure in Erscheinung treten, zum anderen, welche kognitiven und normativen
Erwartungen an diese Einheiten gerichtet werden können.5
In Bezug auf die möglichen Akteurtypen behauptet der World-polity-Ansatz
zwei historische Entwicklungsdynamiken – eine einschränkende und eine aus-
weitende. Eingeschränkt wird demnach der Raum der Akteurtypen (Strandgaard
Pedersen/Dobbin 1997; Meyer/Jepperson 2000). Während frühere Gesellschaften
eine Vielzahl heterogener Akteure gekannt haben, verlieren viele von diesen an
Autorität (so etwa kollektive Handlungsträger wie Familien oder Clans) oder
verschwinden im Zuge der Rationalisierung gar aus der diesseitigen Welt (wie
die Geister der Ahnen aber auch die rationalisierten Götter der monotheistischen
Religionen).
Beide Aspekte wer-
den als historisch wandelbar verstanden. Sie sind jedenfalls nicht: vorinstitutio-
nell gegeben.
6
5 Genau genommen ist die Erwartung, dass es sich bei Akteuren um Einheiten zu handeln habe, bereits Teil der beschriebenen institutionellen Ordnung (s. u.).
Damit verengt sich das Spektrum von Einheiten mit vollwertigem
Akteurstatus deutlich. Nur noch drei Typen kommt letztlich ein solcher zu: Indi-
viduen, Organisationen und Nationalstaaten. Der komplementäre Prozess der
Ausweitung betrifft alle Einheiten, die dieser Dreiheit zugerechnet werden kön-
nen. Der Tendenz nach hat man es mit einer Universalisierung des Akteurstatus
zu tun: Nahezu alle Individuen, Organisationen und Nationalstaaten können nun
als vollwertige Akteure adressiert werden.
6 Natürlich ist der Glaube an die Existenz solcher Entitäten nach wie vor gesellschaftlich hochgradig bedeutsam und durchaus auch hoffähig. Ein handelndes Eingreifen in die Alltagsrealität wird ihnen allerdings, dort wo die Ontologie der Moderne Geltung beanspruchen kann, kaum noch zugestanden. Vgl. jedoch Berger (2005).
5
Bezogen auf Individuen heißt das zum Beispiel, dass alle Menschen als Hand-
lungsträger und Rechtssubjekte angesprochen werden können (Frank/Meyer
2002) und Ausschlüsse aus diesem Status – etwa auf der Grundlage von Ge-
schlecht, Klassenlage, Ethnie, Alter, Gesundheitszustand etc. – nachhaltig an
Legitimität verloren haben, welche Grenzen diesem Prozess auch im Einzelnen
empirisch gezogen sein mögen. Bezogen auf Staaten bedeutet dies vor allem,
dass der souveräne Nationalstaat sich als die unumstrittene Standardform der
Organisation des Politischen global durchgesetzt hat und dadurch nicht selbstän-
dige oder nicht staatsförmige politisch-territoriale Gebilde nur noch als Abwei-
chungen und gescheiterte Staatsbildungen registriert werden können (Meyer et
al. 2005). Für Organisationen zeigt sich ein Wandel von Organisationsmodellen.
Viele Organisationen, die historisch in ganz anderer Weise adressiert wurden,
werden nun als eigenständige Handlungsträger verstanden (Brunsson/Sahlin-
Andersson 2000; Meier 2009).
Mit diesen diagnostischen Befunden ist noch nicht viel darüber gesagt, was denn
Akteure in theoretischer Hinsicht ausmacht. An anderer Stelle (Meier 2009:
77ff.) habe ich eine Konzeption des Akteurs vorgeschlagen, die aus drei Be-
stimmungen besteht. Akteure werden demnach erstens als institutionell abgesi-
cherte, plausible Adressen der kausalen und moralischen Zurechnung von Hand-
lungen und Handlungsfolgen definiert. An solche Akteure werden zweitens eine
Reihe kognitiver und normativer Erwartungen adressiert, die gesellschaftlich
institutionalisierte Konzepte verantwortlicher Handlungsträgerschaft
(„actorhood“) aktualisieren. Akteure bilden drittens solche Konzepte in sich
(also in ihrem Verhalten, in ihren Strukturen) ab.
Was aber ist der Inhalt solcher Konzepte? Worin besteht actorhood? Ein Gutteil
der World-polity-Literatur lässt sich als Versuch lesen, genauer zu bestimmen,
6
welche institutionellen Erwartungen im Einzelnen mit verantwortlichen Hand-
lungsträgern unterschiedlichen Typs verbunden werden und wie sich eine zu-
nehmende Rationalisierung und Ausweitung dieser actorhood im Zeitverlauf auf
globaler Ebene nachzeichnen lässt (siehe nur Krücken/Drori 2009;
Drori/Meyer/Hwang 2009). Wenn man jedoch zu so etwas wie einem definie-
renden Kern, einer typübergreifenden Minimalbestimmung des Akteurs gelangen
will, wird man diese – etwas vereinfacht gesprochen – durch eine mehr oder
weniger konsistente und zeitlich stabile Identität, plausible und legitime Hand-
lungsorientierungen sowie einen hohen Grad an Kontrolle über die eigenen
Handlungen und Handlungsressourcen bestimmt sehen (Meier 2009: 85ff.). Dies
– um es noch einmal deutlich zu sagen – sind keine Strukturbeschreibungen,
sondern Elemente eines institutionalisierten Modells von Handlungsträgerschaft,
dass die Selbst- und Fremdbeschreibung sowie die Selbstinszenierung – und
zum Teil: Selbststeuerung – von Akteuren maßgeblich bestimmt. Trotzdem
bleibt die Frage, was es denn für Einheiten sind, die da als Akteure konstruiert
werden, die sich selbst als Akteure inszenieren und die auf sich selbst einwirken,
um Akteure zu sein. Die vielleicht bekannteste Andeutung zu diesem Problem
findet sich bei Meyer und Jepperson. Die Autoren stellen in einem Instanzenmo-
dell dem agentischen Akteur, also jener Instanz, die durch actorhood definiert
wird, den „raw actor“ gegenüber; über Letzteren heißt es:
„By ‚raw actor‘ we intend to connote an entity pursuing rather unselfcons-ciously its built-in purposes – built in either through socialization or prior to socialization (e.g., by biology). These purposes can be nonlegitimated (e.g., some sexual ones), or legitimated self-interests (e.g., a person wanting a nice car)“ (Meyer/Jepperson 2000: 110).
7
Die Individuen7
“Individuals follow their Id (or Inner Child, or whatever) and sacrifice agen-tic effectiveness, or they build up their agency in cannonical ways, but then lose touch with their self“ (Meyer/Jepperson 2000: 110).
sind nun durch Spannungen zwischen den beiden Instanzen
geprägt, die für die Autoren grundlegende psychologische Dualismen widerspie-
geln:
Diese Spannungen ermöglichen den Autoren zufolge einen Zugang zu theoreti-
schen Problemen der Psychologie wie Willensschwäche, Selbsttäuschungen,
Altruismus oder der Differenz zwischen Einstellungen und Verhalten. Wie ge-
sagt, handelt es sich hier noch keineswegs um eine Theorie, sondern eher um
einige erste Andeutungen. Allerdings veranschaulichen sie bereits grundlegende
Punkte, die ich wie folgt interpretieren würde: Agentische Akteure werden in der
oben beschriebenen Weise sozial konstituiert. Daraus folgt jedoch nicht, dass
Individuen durch die institutionelle Ordnung determiniert sind. Ihr empirisches
Verhalten resultiert vielmehr aus dem spannungsreichen Wechselspiel von raw
actor und agentic actor. Dabei ist auch der raw actor in hohem Maße durch
eingebaute Zwecke programmiert. Das Nicht-Determinierte und das sogar krea-
tive Potential des Individuums basiert so gesehen nicht oder jedenfalls nicht nur
auf einer dem Subjekt innewohnenden basalen Freiheit, sondern auch auf den
unprognostizierbaren Resultaten des Konflikts zwischen internalen und
externalen Programmierungen in einer komplexen Umwelt.8
Wie dem auch sei, für die Weiterentwicklung der World-polity-Perspektive
scheint es unerlässlich zu sein, die sozialtheoretischen Grundlagen des Ansatzes
7 Das Instanzenmodell wird von Meyer und Jepperson ebenso auf Organisationen und Nationalstaa-ten wie auf Individuen bezogen, wobei undeutlicher ist, was den „raw actor“ in diesen Fällen kenn-zeichnet. In gewisser Weise scheint sich hier das funktionalistische Unbewusste des Neo-Institutionalismus zu verbergen. 8 Wobei freilich auch internale Programmierungen in Auseinandersetzung mit der Umwelt entstanden sind.
8
zu klären, woran bislang jedoch kein großes Interesse zu bestehen scheint. Im
nächsten Abschnitt sollen deshalb neuere Entwicklungen innerhalb des organisa-
tionssoziologischen Neo-Institutionalismus in den Blick genommen werden.
Vielleicht finden sich hier vielversprechende Ansatzpunkte für eine sozialtheore-
tische Grundlegung des Neo-Institutionalismus.
3. Die individuellen Akteure des organisationssoziologischen
Neo-Institutionalismus
Der organisationssoziologische Neo-Institutionalismus interessiert sich im Kern
dafür, wie Organisationsstrukturen und organisationales Verhalten durch institu-
tionelle Ordnungen geprägt werden. Ein besonderes Augenmerk gilt typischer-
weise Prozessen des Wandels, etwa der Diffusion bestimmter Strukturelemente
oder der Strukturangleichung in institutionellen Feldern. Akteure wurden zu-
nächst, so jedenfalls eine verbreitete Wahrnehmung, entweder ganz ausgeblendet
oder nur als passive Einheiten behandelt, deren Verhalten sich nicht zuletzt als
Abarbeiten institutioneller Vorgaben darstellt. Bekanntlich betonen die neo-
institutionalistischen Autoren dabei weniger die Verhaltensregulierung durch
internalisierte Normen als durch kognitive Erwartungen in der Form unhinter-
fragt unterstellter Annahmen, sozial geteilter Typisierungen (vgl. Ber-
ger/Luckmann 1969) und handlungsleitender scripts. Hier schlägt sich die Ab-
kehr vom Parsonianischen Strukturfunktionalismus (zum Beispiel Parsons 1951)
im Lichte des cognitive turn in der Psychologie und den Sozialwissenschaften
nieder. Trotzdem traf den Neo-Institutionalismus ebenso wie die strukturfunktio-
nalistische Rollentheorie der Vorwurf, Akteure „übersozialisiert“ zu konzeptuali-
9
sieren oder eben ganz auszublenden. In Reaktion darauf widmete sich die Theo-
rie ab den späten 1980er und insbesondere seit den 1990er Jahren der aktiven
Rolle von Akteuren.
Diese skizzenhafte Rekonstruktion entspricht wohl der konventionellen Lesart
(vgl. etwa Walgenbach/Meyer 2008: 115ff.), sie muss jedoch etwas qualifiziert
werden. Denn bereits Meyer und Rowan (1977) hatten ja in ihrem grundlegen-
den Aufsatz eine Situation beschrieben, in der die Handlungsebene – im Gegen-
satz zur Formalstruktur – gerade nicht durch institutionelle Vorgaben bestimmt
wird. Die Vorstellung, institutionelle Erwartungen würden vor allem symbolisch
beantwortet (auf der Ebene von talk, folgenlosen Entscheidungen oder eben
Formalstrukturen) und die Handlungsebene werde davon nur begrenzt affiziert,
ist zu einer Grundidee des soziologischen Neo-Institutionalismus avanciert (vgl.
vor allem auch Brunsson 1989) und wird zuweilen sogar als dessen Kernthese
missverstanden. Jenseits der nicht ganz unwichtigen Frage, die sich zumindest
Brunsson einhandelt, was denn symbolisches Handeln (talk, Entscheiden) von
eigentlichem Handeln unterscheidbar macht (und was das handlungstheoretisch
zu bedeuten hätte), wird bereits hier deutlich, dass der soziologische Neo-
Institutionalismus keineswegs auf einen institutionellen Determinismus abstellt,
sondern auch die Distanznahme gegenüber Institutionen9
9 Allerdings gibt es den begründeten Einwand, dass von einer (zumindest vollständigen) Institutiona-lisierung im eigentlichen Sinne nur dann die Rede sein könne, wenn die beteiligten Akteure zu den fraglichen Institutionen eben nicht in Distanz treten können (vgl. Tolbert/Zucker 1996). Hier wird deutlich, dass wohl noch terminologische und konzeptuelle Arbeit notwendig ist, um die Heterogeni-tät dessen angemessen abbilden zu können, was in der selbst vielgestaltigen neo-institutionalistischen Forschung als institutionelle Ordnung behandelt wird.
für möglich und sogar
wahrscheinlich hält. Selbst wenn eine soziale Situation in hohem Maße durch
Überzeugungen und Regeln angemessenen Verhaltens geprägt wird, die den
Beteiligten nicht als kontingente Optionen, sondern als verdinglichte Sachverhal-
te gegenübertreten, werden diese das konkrete Handeln nur in Grenzfällen er-
10
schöpfend determinieren. Dies folgt schon aus der einfachen Tatsache, dass insti-
tutionelle Vorgaben, wie bereits frühzeitig herausgearbeitet wurde, zum Teil
miteinander konfligieren oder aber schlicht zu informationsarm sind, um konkre-
tes Handeln anleiten zu können, was insbesondere für hochabstrakte Vorgaben
wie die allgemeinen moralischen Imperative der world polity (Sei rational! Sei
gerecht! Sei fortschrittlich!) gilt. Aber auch sehr viel spezifischere standardisierte
Strukturvorgaben für Organisationen (und auf dieser Ebene befinden wir uns ja
häufig im organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus) können das Ver-
halten einzelner Organisationsmitglieder kaum im Einzelnen festlegen. Selbst
konkrete scripts dürfen als Determinanten des Verhaltens in komplexen sozialen
Situationen nicht überschätzt werden. Um es mit DiMaggio und Powell (1991:
22) zu sagen: „Socially provided and constituted scripts rarely prescribe action in
a way that unambigously establishes correct behavior“.
Offenbar muss man sich ein weites Feld unterschiedlicher Formen der Verhal-
tensprägung durch Institutionen vorstellen: zwischen dem Grenzfall einer nahezu
determinierenden Regulierung einerseits und einem distanzierten und dann wo-
möglich auch aktiven und kreativen Umgang mit institutionellen Vorgaben ande-
rerseits.10
10 Beide Vorstellungen scheinen mir eine deutliche Beziehung zu dem zu haben, was Uwe Schimank in seinem Beitrag in diesem Band als die beiden Seiten seiner minimalen Anthropologie vorgeschla-gen hat: Entlastung von Erwartungsunsicherheit durch Ausschluss von Alternativen einerseits und Kreativität andererseits.
Man mag nun feststellen, dass unterschiedliche Autoren hier unter-
schiedliche Schwerpunkte setzen; allerdings ist anzunehmen, dass empirisches
Verhalten je nach Situation in unterschiedlicher Weise durch (auch unterschied-
lich geartete) Institutionen geprägt wird, weshalb eine allgemeine neo-
institutionalistische Theorie die Möglichkeit einer Mehrzahl von Formen der
Handlungsprägung (und zwar gleichzeitig!) in Rechnung stellen muss. Dabei
können die Beteiligten nicht alle in einer sozialen Situation wirksamen Instituti-
11
onen kontingent setzen. Es sind gerade jene fundamentalen und konstitutiven
Elemente der institutionellen Ordnung, die in aller Regel unhintergehbar bleiben
(Jepperson/Swidler 1994). In keinem Fall kann eine instrumentelle Nutzung von
institutionellen Vorgaben aus einem institutionenfreien Raum heraus stattfinden.
Um es mit einem märchenhaften Bild von Hasse und Krücken (2005: 90) zu
sagen: „Es ist also wie beim Rennen zwischen Hase und Igel: institutionelle
Vorgaben sind immer schon da“.
Über die genaue Ausgestaltung des mit Institutionen umgehenden Verhaltens
erfahren wir indes bei Meyer und Rowan noch wenig und – wie bereits im letz-
ten Abschnitt gesehen – wird es auch im weiteren Schaffen Meyers nicht wirk-
lich ausgearbeitet. Das Moment der aktiven und durchaus auch kreativen Verar-
beitung von institutionellen Vorgaben ist später insbesondere im „skandinavi-
schen“ Institutionalismus weiter betont und analysiert worden. Eine wichtige
Rolle spielt dabei die Vorstellung, dass institutionelle Gehalte im Diffusionspro-
zess immer an lokale Kontexte und spezifische Erfordernisse angepasst werden
müssen und dabei auch jeweils verändert werden. Akteure spielen in diesem
Verständnis eine zentrale Rolle in mehr oder minder absichtsvollen Überset-
zungs-, Editierungs-, und Rekombinationsversuchen (vgl. insbesondere
Czarniawska/Sevón 1996; Sahlin/Wedlin 2008) und werden so in einen Zusam-
menhang mit institutionellem Wandel gebracht, mithin als dessen Bewirker in-
terpretiert. Wir werden sehen, dass dies die typische Rolle ist, in der Akteure
innerhalb des organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus diskutiert
werden.
Wenn nun Akteuren eine aktive Rolle im Umgang mit Institutionen zugestanden
wird, lässt sich auch vorstellen, dass sie dabei eigene Interessen einbringen und
ggf. auch strategisch handeln (zu Letzterem siehe etwa Oliver 1991; Beckert
12
1999).11
Paul DiMaggio hatte bereits 1988 in einem Aufsatz mit dem Titel „Interest and
Agency in Institutional Theory“ Forschungsdesiderate, zentrale Fragen und Ter-
minologien dieser aktuellen Beschäftigungen mit Akteuren formuliert und ist in
diesem Sinne wegweisend. Als Co-Autor eines der, wenn man so sagen darf,
Gründungsdokumente des organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus
(DiMaggio/Powell 1983) wird DiMaggio hier zum Kronzeugen für den aus sei-
ner Sicht unzureichenden Akteurbezug des Ansatzes.
Sie mögen sogar versuchen, gezielt Institutionen zu verändern (oder
stabil zu halten), um ihre Interessen auf diesem Weg zu verfolgen. Vor allem
unter diesem Gesichtspunkt wurden und werden im organisationssoziologischen
Neo-Institutionalismus in jüngerer Zeit Debatten über die Rolle von Akteuren
geführt. Einer besonderen Resonanz erfreuen sich dabei zwei miteinander ver-
wobene aber analytisch gut unterscheidbare Stränge, die sich mit den Begriffen
institutional entrepreneur und institutional work verbinden.
DiMaggios Kritik am soziologischen Neo-Institutionalismus lässt sich unter zwei
Kernvorwürfe subsumieren. Der erste besteht darin, dass der Ansatz interessege-
leitetes Handeln von Individuen ausblende. Zwar sei es gerade die Leistung des
Neo-Institutionalismus gewesen, Mechanismen identifiziert zu haben, die Orga-
nisationswandel in Fällen erklären können, denen keine Interessenmobilisierung
zugrunde liege. Allerdings schränke der Verzicht auf Konzepte wie Interesse und
Agency die Reichweite neo-institutionalistischer Erklärungsansätze stark ein.
Nur unter bestimmten, im Einzelnen benennbaren Bedingungen sei ein solches
Vorgehen möglich: Situationen, in denen Akteure ihre Interessen nicht erkennen
können oder daran gehindert sind, in Hinblick auf ihre Interessen zu handeln
11 Das eher unbewusste Verfolgen innewohnender Zwecke, wie es Meyer und Jepperson dem „raw actor“ zuordnen (s. o.), gehört im Prinzip auch zu diesem interessengeleiteten Umgang mit Institutio-nen, ein strategischer Umgang ist damit freilich nicht impliziert.
13
(z. B. wenn die Situation maßgeblich durch geteilte unhinterfragte Annahmen
bestimmt wird), oder Situationen, in denen Akteure ihre Interessen nicht effektiv
verfolgen können, etwa weil sie zu komplex sind (DiMaggio 1988: 4f.).12
Ein zweiter Vorwurf, den DiMaggio dem soziologischen Neo-Institutionalismus
macht, besteht darin, de facto dann doch Annahmen über Akteure und ihre Inte-
ressen einzuführen, ohne diese jedoch explizit darzulegen oder gar zu theoretisie-
ren. Dem Autor zufolge unterstellen neo-institutionalistische Analysen implizit
insbesondere zwei grundlegende Interessen von Akteuren: dasjenige an Gewiss-
heit und Vorhersagbarkeit einerseits, dasjenige am Überleben andererseits.
13
„‚Institutional myths ‚are highly institutionalized,‘ and some structural ele-ments of organizations are ‚societally legitimated.‘ Another approach, which I suggest is not inconsistent with the fundamental intuitions of insti-tutional theory, would be to ask, ‚Who has institutionalized the myths (and why)?‘ and ‚Who has the power to ‚legitimate‘ a structural element?‘“ (DiMaggio 1988: 10).
Darüber hinaus würden Annahmen über Interessen häufig unsystematisch und
eher in einer Ad-hoc-Manier eingeführt (DiMaggio 1988: 8f.). Diese impliziten
Bezüge werden, so DiMaggios Deutung, durch eine Rhetorik verschleiert, die
sich durch ein „metaphysisches Pathos“ (DiMaggio 1988: 9) auszeichne. Die
fortdauernde Nutzung passivischer sprachlicher Konstrukte diene dazu, die Rolle
menschlicher Handlungsträgerschaft systematisch sprachlich herunterzuspielen
(DiMaggio 1988: 10). Wie DiMaggio beispielhaft ausführt:
Ein Hauptanliegen DiMaggios kann an dieser Stelle nur vollste Unterstützung
erfahren: Dort wo der soziologische Neo-Institutionalismus Akteure einführt und
dabei ihnen und ihrem Verhalten eine eigenständige – auch erklärende – Rolle
zubilligt, muss dies im Rahmen einer expliziten Theorie geschehen, die bislang 12 Schon hier stellt sich die Frage nach nicht-intendierten Folgen intentionalen Handelns (Merton 1936) (s. u.). 13 Vgl. hierzu auch das Konzept der „reflexiven Interessen“ bei Schimank (1992).
14
tatsächlich noch nicht vorliegt. Dazu mag auch gehören, dass die eigene Theorie-
sprache weiter geschärft werden muss. Der Verweis auf das metaphysische Pa-
thos14 lässt sich freilich recht unproblematisch mit dem Gegenvorwurf kontern,
dass die Anrufung der Evidenz des Menschen noch kein Argument dafür liefert,
dass diesem eine zentrale Rolle in der Theorie zukommen müsste. Dass Akteure
sprachlich dezentriert werden, ist ja nicht deswegen sachlich inadäquat, weil in
der Alltagssprache auf Akteure verweisende Aktivformen üblicher sind.15 Dabei
ist DiMaggios Ausgangspunkt ja durchaus hilfreich: Indem er fragt, unter wel-
chen Bedingungen Akteure nicht in Betracht gezogen werden müssen, ermög-
licht er die komplementäre Frage, wann Akteure in welcher Weise behandelt
müssen, um welche spezifischen Theorieprobleme zu lösen. Auch wenn Akteure
im Weiteren – bei DiMaggio selbst wie in den ihm folgenden Debatten – vor
allem dann ins Spiel kommen, wenn es um institutionellen Wandel (und die
Reproduktion von Institutionen) geht, werden diese Fragen meiner Einschätzung
nach zu wenig genutzt, um zu prüfen, wie Akteure im Einzelnen modelliert wer-
den müssen und ob es funktionale Äquivalente zur Figur des Akteurs geben
könnte.16
Nach der Defizitdiagnose folgt DiMaggios – nur knapp skizzierter – Therapie-
vorschlag, der für den weiteren Diskussionsverlauf hochgradig bedeutsam wur-
de. Im Einzelnen schlägt er vor, die institutionelle Reproduktion, die Schaffung
von Institutionen und die De-Institutionalisierung als Prozesse zu begreifen und
zum Gegenstand der Analyse zu machen, die fundamental politisch sind und die
14 Warum sollte sich die Soziologie in ihrer Theoriebildung eigentlich durch die Grenzen der physi-schen Welt binden lassen? 15 Im Übrigen mag man an dieser Stelle auch darüber nachdenken, ob für das Deutsche dasselbe gilt wie für das Englische und was dies gegebenenfalls bedeutet. 16 Gemeint ist damit die Frage, ob sich zur Bearbeitung eines konkreten Theorieproblems, wie zum Beispiel in der Systemtheorie (vgl. Schneider in diesem Band), Lösungen finden, die Akteuren keinen zentralen Stellenwert zuweisen müssen.
15
die relative Macht der Interessen und der zu ihrer Verfolgung mobilisierten Ak-
teure reflektieren (DiMaggio 1988: 13). Dabei verwendet der Autor bereits die
Begriffe institutional entrepreneur17 und institutional work,18
Über institutionelle Unternehmer, die DiMaggio im Hinblick auf die Erschaffung
von Institutionen für bedeutsam hielt (1988: 14, Hervorhebungen im Original),
hatte der Autor gesagt:
die – wie gesagt –
in jüngster Zeit die Debatte über die Rolle von Akteuren prägen.
„Creating new institutions is expensive and requires high levels of both in-terest and resources. New institutions arise when organized actors with suf-ficient resources (institutional entrepreneurs) see in them an opportunity to realize interests that they value highly. The creation of new legitimate orga-nizational forms [...] requires an institutionalization project“.
Mit ein wenig Zeitverzug stieß DiMaggios konzeptioneller Vorschlag vor allem
im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrtausends auf erhebliche Resonanz. Eine große
Zahl von Beiträgen begann sich tatsächlich mit mächtigen Akteuren zu befassen,
die im Rahmen eines Institutionalisierungsprojekts erhebliche Ressourcen (und
andere Akteure) mobilisieren konnten, um Institutionen zu schaffen oder institu-
tionellen Wandel voranzubringen (siehe nur Garud/Hardy/Maguire 2007; Har-
dy/Maguire 2008).19
Ein Teil der Attraktivität des Konzepts liegt wohl in der Figur des Unternehmers
selbst, die bei DiMaggio kaum ausgeführt ist, die aber nicht nur als Einfallstor
für die unterschiedlichsten Vorstellungen des Unternehmerischen dienen kann,
20
17 Er tut dies mit Verweis auf Eisenstadt (1968), der den Begriff mutmaßlich in Anlehnung an Barth (1963) benutzt hatte. Für die spätere Debatte bleibt diese Herleitung jedoch unerheblich.
sondern auch als Projektionsfläche für den manageriellen Glauben an die Mach-
18 Mit einem unklaren Verweis auf Hannan und Freeman (1984). 19 Als Überblick über die Diskussion und zu einer Kritik des Konzepts siehe insbesondere Weik (2010). 20 Zum Beispiel für den Schumpeterschen Unternehmer als schöpferischen Zerstörer (vgl. Beckert 1999).
16
barkeit von Institutionen durch zielgerichtetes unternehmerisches Handeln. Die
Figur des Unternehmers liefert Raum, heroische Einzelpersonen als Kreative, als
Schöpfer und Macher zu verherrlichen. Allerdings untersucht ein Gutteil der
Forschung zum institutionellen Unternehmer – in guter neo-institutionalistischer
Tradition – Feldcharakteristika und stellt die Frage, welche Bedeutung diesen zur
Ermöglichung institutionellen Unternehmertums zukomme (so etwa Batilana
2006; Greenwood/Suddaby 2006).
Dass Akteure über Interessen verfügen und Ressourcen zu deren Verfolgung
mobilisieren, sagt letztlich noch nicht viel darüber aus, wie diese beiden Fakto-
ren denn nun im Einzelnen in die Verhaltensselektion eingehen. Ein eigentlich
handlungstheoretisches Interesse ist in der Debatte ohnehin kaum auszumachen.
Diese Bemerkung bedarf allerdings einer Einschränkung. So findet sich immer
wieder die Diskussion um eine Fragestellung, die zum theoretischen Kernprob-
lem stilisiert wird: das „Paradox“ der „embedded agency“. Dieses lässt sich fol-
gendermaßen formulieren:
„[I]f actors are embedded in an institutional field and subject to regulative, normative and cognitive processes that structure their cognitions, define their interests and produce their identities [...], how are they able to envision new practices then subsequently get others to adopt them?“ (Garud/Hardy/Maguire 2007: 961).
Zu dieser Fragestellung lässt sich Verschiedenes sagen. Zum einen greift sie die
Feststellung auf, dass – wie oben bereits angesprochen wurde – unterschiedliche
Formen der Prägung durch und des Umgangs mit Institutionen vorkommen mö-
gen. Hier stellt sich dies als Kontrast zwischen Determinismus einerseits und
Kreativität („envision new practices“) andererseits dar. Dass diesen wie anderen
17
Autoren eine solche Gegenüberstellung als „paradox“ erscheint,21
Insgesamt scheint schon die Problemstellung holzschnittartig und eher unter-
komplex gebaut zu sein. Das gilt erstens für die Akteure selbst. Erst wird der
Popanz eines volldeterminierten Individuums aufgemacht (mit der Formulierung
Garfinkels (1967) gesprochen eines „cultural dope“), um diesen dann mit einem
unternehmerischen Subjekt zu kontrastieren, der nicht nur kreativ imaginieren,
sondern das Imaginierte sogleich auch durchsetzen und institutionalisieren kann.
ist freilich
bemerkenswert, zumal die „Auflösung“ dann häufig recht zügig – zum Beispiel
mit einem losen Verweis auf die Strukturationstheorie von Anthony Giddens –
bewerkstelligt wird (vgl. hierzu belustigt Weik 2010).
Es gilt zweitens für die beschriebene institutionelle Ordnung, die hier als umfas-
sendes und in sich kohärentes System erscheint – und nur auf dieser Grundlage
kann ja ein cultural dope existieren. Ansatzpunkte für institutionellen Wandel
sind in der neo-institutionalistischen Theorie – wie angedeutet – gerade in der
Widersprüchlichkeit institutionalisierter Erwartungsgehalte, in den Anpassungs-
notwendigkeiten in Konflikten zwischen technologischen und institutionellen
Anforderungen gesehen worden. Eine naheliegende Teil-Antwort auf das Prob-
lem der „embedded agency“ in der oben zitierten Fassung wäre zum Beispiel
darin zu suchen, dass Akteure ja kaum jemals in nur ein institutionelles Feld
eingebettet und so immer auch Irritationen aus anderen Feldern ausgesetzt sind.22
21 Dass der Begriff des Paradoxen auch anderswo regelmäßig in einem sehr unscharfen Sinne ver-wendet wird (häufig einfach nur als Ausdruck einer Erwartungsenttäuschung – wie in „European paradox“), sei nur am Rande erwähnt.
Alles was wir aus der World-polity-Perspektive über die institutionelle Makro-
Ordnung der Gegenwartsgesellschaft wissen (fortlaufende Rationalisierung als
generatives Prinzip, transnationale und sektorübergreifende Diffusion institutio-
22 Man denke hier auch an Simmels klassische Überlegungen zur „Kreuzung sozialer Kreise“ (Sim-mel 1908: 403-453).
18
neller Muster) spricht dafür, dass Spannungen zwischen institutionellen Elemen-
ten eher wahrscheinlicher als unwahrscheinlicher werden (vgl. auch Meyer et al.
2005: 127ff.). Die auf Friedland und Alford (1991) zurückgehende Konzeption
der Gesellschaft als interinstitutionelles System stellt sogar die Konflikte, die
sich aus den Spannungen zwischen unterschiedlichen institutionellen Logiken
ergeben, ins Zentrum ihres Forschungsinteresses (Thornton/Occasio 2008).23
Eine institutionell geschlossene Welt, in die dann erst der Unternehmer das Neue
bringt, wird jedenfalls nicht der Normalfall sein.24
Drittens ist auch der Prozess des institutionellen Wandels unterkomplex ange-
legt. Wenn man sich diesem zum Beispiel mit der Terminologie der Evolutions-
theorie nähert, kann man annehmen, dass Variation, Selektion und
Restabilisierung – um die Terminologie von Luhmann (1997) zu verwenden –
zunächst einmal als distinkte Prozesse verstanden werden müssen.
25
23 Vgl. auch Kraatz und Block (2008) zum institutionellen Pluralismus.
Wenn ein
institutioneller Wandel nicht stattfindet, könnte es nun daran liegen, dass eine
abweichende Variation gar nicht erst hervorgebracht wird, aber auch daran, dass
sie nicht zur Weiterverwendung selektiert wird (also mithin nicht strukturbildend
wirkt), oder dass im Weiteren die Restabilisierung dieser Struktur scheitert. Die-
se Vorstellung von institutionellem Wandel weist darauf hin, dass auch die be-
kannten unhinterfragten Annahmen des Neo-Institutionalismus nicht unbedingt
dazu führen müssen, dass abweichende Variationen ausbleiben, vielleicht wirken
sie erst auf der Ebene der Selektion. Differenzierungen dieser Art könnten hel-
fen, genauer zu beschreiben, an welcher Stelle Institutionen wirksam sind und
24 Selbst der bekannte antike Unternehmer Prometheus hat das Feuer nicht selbst erschaffen, das er den Menschen bringt. 25 Für Luhmann kann nur dann von Evolution die Rede sein, wenn die drei Prozesse tatsächlich voneinander differenziert sind, was an dieser Stelle unerheblich ist. Nicht diskutiert werden kann hier auch die Frage, was es für den Neo-Institutionalismus bedeutete, wenn er – von Luhmann angeregt – die Differenz von Psychischem und Sozialem theoretisieren würde.
19
wie und unter welchen Bedingungen institutioneller Wandel (oder im Gegenteil:
Stabilität) möglich ist. Für die hier vorgetragene Argumentation ist jedoch zu-
nächst ein anderer Aspekt wichtiger: Die Perspektive lässt unplausibel erschei-
nen, sich ausgerechnet auf solche Fälle institutionellen Wandels zu kaprizieren,
in denen alle drei Prozesse von einem einzigen Akteur kontrolliert oder zumin-
dest unter Aufbietung großer Ressourcen maßgeblich beeinflusst werden. Ein
solcher Fall wäre wohl eher als krasse Ausnahme zu werten. Vielmehr scheint es
wahrscheinlich, dass institutioneller Wandel sich in zeitlich, sachlich und sozial
verteilten Prozessen vollzieht.
Mit dem Begriff der institutional work (Lawrence/Suddaby 2006; Lawren-
ce/Suddaby/Leca 2009a; Lawrence/Suddaby/Leca 2011) verbindet sich nun ein
zweiter Strang der an DiMaggio anschließenden Diskussion, der zwar (auch
personell) eng mit der Debatte um institutional entrepreneurs verbunden ist, aber
auf die Vorstellung verzichtet, dass es vor allem machtvolle Einzelfiguren seien,
die absichtsvoll auf Institutionen einwirken und dadurch die institutionelle Ord-
nung beeinflussen. Institutioneller Wandel wird hier deshalb tatsächlich eher als
ein verteilter Prozess begriffen. Institutional work wird allgemein verstanden als
„the purposive action of individuals and organizations aimed at creating, main-
taining and disrupting institutions“ (Lawrence/Suddaby 2006: 215). Entspre-
chend propagieren die Protagonisten der Debatte, in einer nur leicht veränderten
Terminologie DiMaggio folgend,26
26 Dieser hatte von creation of institutions, institutional reproduction und deinstitutionalization gesprochen (DiMaggio 1988: 13-16).
ein Forschungsprogramm, dem es darum zu
tun ist, die aktive Rolle von Akteuren in der intentionalen Erzeugung, Erhaltung
und Zerstörung von Institutionen nachzuzeichnen. Die Perspektive interessiert
sich für institutional work allerdings auch, wenn diese nicht-intendierte Wirkun-
gen zeitigt oder – gemessen an ihren eigenen Intentionen – scheitert.
20
Während der programmatische Anspruch klar ist und auch tatsächlich empirische
Forschung in wachsender Zahl anleitet, ist der eigentliche theoretische Gehalt
weniger deutlich. Hier gilt im Grunde dasselbe wie für die institutional
entrepreneurs: Eine eigentliche Handlungstheorie ist jenseits einiger Bezüge auf
das erwähnte Problem der „embedded agency“ nicht erkennbar oder bleibt jeden-
falls implizit. Gerade in der Einleitung zu ihrem Sammelband erwecken Lawren-
ce, Suddaby und Leca (2009b) den Eindruck, sie wollten sich – etwa in der Fra-
ge, wie Intentionalität zu denken sei – nicht zu sehr festlegen, um für die hetero-
gene neo-institutionalistische Forschungslandschaft (und ihre eigenen Autoren)
anschlussfähig zu bleiben. So gesehen lässt DiMaggios oben beschriebener
Vorwurf in modifizierter Weise auf die beiden aktuellen Debatten (institutional
entrepreneur und institutional work) neu anwenden: Sie benutzen weitgehend
eine implizite Handlungstheorie, in die je nach Bedarf in Ad-hoc-Manier alltags-
plausible – oder gegebenenfalls auch aus anderen Theorieangeboten entlehnte –
Annahmen eingefügt werden können.
Jenseits der Frage, wie viel theoretische Substanz bereits vorhanden ist, kann
man sich jedoch fragen, ob die Grundidee des Ansatzes überhaupt vielverspre-
chend gewählt ist. Ausgangspunkt ist die – deutlich von Giddens inspirierte –
Vorstellung, dass Handeln und Institutionen rekursiv miteinander verbunden sind
(Lawrence/Suddaby/Leca 2009a: 6f.). Während Institutionen einerseits Handeln
prägen, werden Institutionen ihrerseits durch Handeln erzeugt, aufrechterhalten
und zerstört. Bislang habe sich der Neo-Institutionalismus mit der institutionel-
len Prägung des Handelns befasst, jetzt werde – in Liebe zur Symmetrie, ist man
versucht zu sagen – die Gegenrichtung untersucht.27
27 Diese Darstellung verkennt, dass der organisationssoziologische Neo-Institutionalismus zwar – wie gesehen – ganz sicher davon ausgeht, dass Handeln institutionell geprägt wird, dies jedoch in der Regel nicht sein eigentliches Erkenntnisinteresse ist.
Wenn man dieses Wechsel-
21
verhältnis von Handeln und Institutionen grundlegend verstehen möchte, ist aber
unklar, warum dies ausgerechnet dadurch gelingen sollte, dass man sich in seiner
Analyse auf solches Handeln beschränkt, das intentional auf Institutionen bezo-
gen ist. So ist offensichtlich, dass – wie ja gerade der soziologische Neo-
Institutionalismus herausgearbeitet hat – institutionelle Ordnungen häufig (situa-
tiv oder übersituativ) nicht einmal der Reflexion durch die Beteiligten zugäng-
lich sind. Die Institutional-work-Perspektive wird, wenn man sie beim Wort
nimmt, in aller Regel nicht danach fragen können, ob diese Ordnungen durch
intentionales Handeln tangiert werden.28 Zudem kann intentionales Handeln
natürlich Institutionen affizieren, von denen zwar ein Bewusstsein besteht, auf
die es aber nicht intentional bezogen ist. Das Argument lautet also: Die
Institutional-work-Perspektive hat von vorneherein ein zu eingeschränktes Ver-
ständnis von relevanter Transintentionalität.29 Es interessieren nur die oben be-
reits angesprochenen unintendierten Konsequenzen institutioneller Arbeit.30
„In contrast, including intentionality in the definition of institutional work aims may push us toward a more radical shift in our approach to under-standing institutions and organizations“(Lawrence/Suddaby/Leca 2009b: 14).
Dieser Einwand ist den Protagonisten des Ansatzes durchaus bewusst. Ihre we-
nig befriedigende Antwort darauf lautet: Eine Perspektive, die auf die institutio-
nellen Effekte von intentionalem Handeln abstelle, sei konservativer (Lawren-
ce/Suddaby/Leca 2009b: 13).
So ist die Einschränkung auf institutionenbezogenes Handeln vermutlich gar
nicht sachlich begründet, sondern eher forschungsstrategisch: Man besetzt ein 28 Dies wäre nur möglich, wenn es um transintentionale Effekte von Handlungen ginge, die auf andere Institutionen bezogen wären. 29 Allgemein zum Problem der Transintentionalität siehe Greshoff/Kneer/Schimank (2003). 30 Forschungspraktisch kann diese Selbstbeschränkung im Übrigen zu der Fehlleistung führen, über-all dort, wo intentionales Handeln identifiziert wird, institutional work zu gewahren, unabhängig von der Frage, ob sich die Intention auf die institutionelle Ordnung richtet.
22
bestimmtes Feld. Und: Man verdeutlicht, dass man tatsächlich ein
institutionalistisches Programm betreibt, auch wenn eine spezifisch institutiona-
listische Handlungstheorie eigentlich nicht mehr erkennbar ist, die sich von an-
deren – ebenfalls Institutionen prominent in Rechnung stellenden – Theoriean-
geboten unterscheidet.31
4. Schlussfolgerungen
Insgesamt muss man resümieren: Bei allen Einsichten im Detail und bei allem
Wert, den die aus diesen Perspektiven durchgeführten empirischen Studien ha-
ben mögen, der Beitrag zu einer neo-institutionalistischen Sozialtheorie bleibt
zunächst begrenzt. Im Gegenteil: die nicht ausgeführte Handlungstheorie ver-
dunkelt mehr, als sie erhellt. Gleichzeitig führt sie weg von den Kernbeständen
neo-institutionalistischen Denkens: dem Primat der Verhaltensregulierung über
kognitive institutionelle Ordnungen und der Dezentrierung rationaler Interes-
senmobilisierung zugunsten der Interaktion von institutionellen Mustern und
Feldstrukturen.
In diesem Zusammenhang muss man sich jedoch noch einmal deutlich vor Au-
gen halten, dass der organisationssoziologische Neo-Institutionalismus eine Or-
ganisationstheorie ist, der es eben nicht primär darum zu tun ist, menschliches
Verhalten (oder Handeln) zu erklären. Auch kann man kaum sinnvoll von jedem
organisationstheoretischen Angebot erwarten, eine eigene Sozialtheorie anzubie- 31 Gerade aus der Perspektive der deutschsprachigen Theoriediskussion mag man zum Beispiel den Eindruck gewinnen, hier werde versucht, den Ansatz des akteurzentrierten Institutionalismus (Mayntz/Scharpf 1995) im Rahmen des Neo-Institutionalismus neu zu erfinden. Konstruktiver for-muliert: Es wären sicher Lernpotentiale für den Institutional-work-Kontext aus dem akteurzentrierten Institutionalismus zu gewinnen.
23
ten. Allerdings wird sich eine unzureichende sozialtheoretische Basis auf Dauer
als eine schwere Hypothek für die Fortentwicklung der Organisationstheorie
erweisen. Daher nimmt es nicht Wunder, dass Forderungen nach einer „Mikro-
fundierung“ des Ansatzes immer wieder artikuliert wurden (DiMaggio/Powell
1991; Powell/Colyvas 2008).
Die „Lösung“, die sich gegenwärtig abzeichnet, scheint eher in der Integration
von anderen Sozialtheorien in den Neo-Institutionalismus zu liegen, als in einer
eigenständigen neo-institutionalistischen Sozialtheorie, die freilich gerade auch
dadurch entstehen mag. So lehrt ja der Neo-Institutionalismus selbst, welches
Innovationspotential in der Imitation liegen kann (DiMaggio/Powell 1983: 151).
Jedenfalls häufen sich in der Literatur Hinweise, die Theorie könne und solle
sich – jenseits der ohnehin vorhandenen Bezüge – auf etablierte Theorieangebote
beziehen, um bestimmte Leerstellen zu füllen. So wird beispielsweise immer
wieder auf Giddens, Bourdieu aber auch auf den symbolischen Interaktionismus
(Weik 2010) oder Schütz (Meyer 2008) verwiesen. Dies geschieht bislang häufig
noch eher als Benennung eines Forschungsdesiderats. Tatsächlich wäre im Ein-
zelnen genauer zu prüfen, welche Theorieangebote tatsächlich geeignet sind,
welches Problem zu lösen, und dabei mit den basalen theoretischen Einsichten
des Neo-Institutionalismus verknüpft werden können, ohne in reinem Eklekti-
zismus zu enden.
Für die Fortentwicklung der neo-institutionalistischen Theorie, das sollte bei all
dem nicht vergessen werden, finden sich innerhalb des Ansatzes vermutlich
fruchtbarere Anknüpfungspunkte als die der – zuletzt so stark diskutierten und
deshalb auch hier im Mittelpunkt stehenden – DiMaggio-Linie. Um nur zwei
schon beiläufig genannte Beispiele zu nennen: der skandinavische Institutiona-
lismus mit seinem Interesse für Übersetzungs- und Anpassungsprozesse
24
(Czarniawska/Sevón 1996; Sahlin/Wedlin 2008) und die unter dem Stichwort
„institutionelle Logiken“ behandelten Spannungen zwischen und innerhalb insti-
tutioneller Ordnungen (Friedland/Alford 1991; Thornton/Occasio 2008).32 Beide
Ansätze stimmen mit DiMaggio und Nachfolgern dahingehend überein, dass
Konflikt als ein Schlüsselelement institutionalistischer Theoriebildung zu be-
trachten ist – ohne diesen dann freilich wie jene auf Intentionalität, Interessen
und Ressourcenmobilisierung zu verengen. Vielversprechend erscheinen vor
diesem Hintergrund gerade jene Ansätze innerhalb des Neo-Institutionalismus zu
sein, die auch die kognitive Ebene von Konflikten im Blick behalten und Agency
insbesondere unter dem Gesichtspunkt des sensemaking (Weick 1995) und akti-
ver Interpretationsleistungen analysieren.33
In diesem Zusammenhang ist auch ein weiterer Sachverhalt bemerkenswert: Für
die neo-institutionalistische Organisationstheorie spielen die Erkenntnisse des
World-polity-Ansatzes – wie schon erwähnt – eine erstaunlich geringe Rolle.
Gerade die Autoren der DiMaggio-Linie behandeln die Idee, Akteure seien sozi-
al konstituiert, bestenfalls als ein konkurrierendes Theorieangebot, das die Rolle
von Akteuren unterschätzt, und nicht als eine wichtige Inspiration. Umgekehrt
lässt sich der World-polity-Ansatz – wie gesehen – kaum durch das Interesse an
interessegeleiteten Akteuren irritieren, das sich in jüngerer Zeit im organisations-
soziologischen Neo-Institutionalismus findet – oder nur in der Weise, dass die
Konstruiertheit von Akteuren noch einmal deutlich herausgestrichen wird.
32 Wobei der letztgenannte Ansatz gerade auch in Hinblick auf die eigenen makrosoziologischen Ansprüche noch weiter auszubauen wäre. 33 Siehe hierzu beispielhaft die von Zilber (2002) vorgeschlagene Perspektive, die das Zusammen-spiel von Akteuren, Handlungen und Bedeutungen untersucht und dabei die Agency von Akteuren insbesondere in deren aktiven Interpretationsleistungen, also der von ihnen ausgeübten Fähigkeit, Praktiken mit Bedeutungen zu versehen, verortet.
25
Doch kommen wir zurück zu der Frage, was der organisationssoziologische Neo-
Institutionalismus vom World-polity-Ansatz lernen kann. Man kann ja ganz all-
gemein fragen, ob eine Organisationstheorie neben einer „Mikrofundierung“
nicht auch eine „Makrofundierung“ braucht. Zudem wäre zu fragen, welches
Anregungspotential sich aus dem oben dargestellten Konzept des raw actor
ergibt. Schließlich aber, und dies scheint mir sogar zunächst wichtiger, sollte die
Institutionalisierung von actorhood selbst stärkere Berücksichtigung finden
(Hwang/Colyvas 2011).
Was für den organisationssoziologischen Neo-Institutionalismus gilt, gilt erst
recht für andere Sozialtheorien, die Akteuren und deren Handlungen einen zent-
ralen theoretischen Stellenwert einräumen. Und so sei dieser Beitrag mit einem
kleinen Plädoyer dafür beschlossen, auch die akteurzentrierte Handlungstheorie
durch die World-polity-Perspektive bereichern zu lassen. Denn aus meiner Sicht
hängt der Wert der Perspektive und der damit verbundenen empirischen Befunde
einstweilen nicht davon ab, dass man die Einschätzung teilt, die gesellschaftliche
Konstruktion von Individuen, Organisationen und Nationalstaaten als agentische
Akteure sei von Grund auf unrealistisch. Es lassen sich zumindest Gesichtspunk-
te und methodologische Konsequenzen für die akteurzentrierte Handlungstheorie
ableiten.
Für Organisationen und Nationalstaaten ist weithin unstrittig, dass ihr
Akteurstatus a) eine Konstruktion ist, die regelmäßig – um nicht zu sagen: ubi-
quitär – in der sozialen Praxis Verwendung findet, die aber b) nicht einer (voll-
ständig) angemessenen wissenschaftlichen Strukturbeschreibung entspricht.
„Organisationen können eigentlich nicht handeln, das können nur Individuen“,
so die verbreitete Annahme der akteurzentrierten Handlungstheorien. Freilich
beginnt der Dissens, wenn man sich fragt, ob es unter bestimmten angebbaren
26
Umständen hilfreich sein kann, pragmatisch so zu tun, als ob Organisationen
handlungsfähige Einheiten seien, und wie gegebenenfalls ein dennoch sinnvoller
Begriff organisierter Handlungsfähigkeit aussehen kann.34
Für Organisationen (und Nationalstaaten) ist also die Vorstellung, ihr
Akteurstatus sei mehr oder weniger fiktional, nicht so sehr problematisch. An-
ders verhält es sich bekanntlich mit Individuen. Jedoch: Wenn ein
akteurzentrierter Handlungstheoretiker keine Probleme damit haben dürfte, zu
konzedieren, dass es einen Unterschied macht, ob Organisationen im allgemei-
nen oder bestimmten Organisationstypen gesellschaftlich ein Akteurstatus zuge-
schrieben wird oder nicht (vgl. nur Coleman 1979), warum sollte dies im Bezug
auf Individuen anders sein? Ganz unzweifelhaft werden Handlungsressourcen,
namentlich Handlungsrechte, davon abhängen, ob ein Individuum einen vollwer-
tigen Akteurstatus zugeschrieben bekommt. Das Gleiche gilt für den Grad seiner
z. B. strafrechtlichen Verantwortlichkeit.
35
Grundsätzlicher – und potentiell kontroverser – ist ein anderer Punkt: Die
akteurzentrierte Handlungstheorie ist ja gerade nicht in der Lage, die empiri-
schen Motivationslagen einzelner Menschen auszuloten und zur Grundlage des
eigenen Theoretisierens zu machen. Sie ist fundamental darauf angewiesen,
Handeln typisierend zu beobachten. Soweit sie dies jedoch tut, besteht die Ge-
fahr, dass sie mit ihrer spezifischen Weise der Typisierung gesellschaftliche
Mythen reproduziert. Diese im Detail abzubilden, mag auch aus der Perspektive
der akteurzentrierten Handlungstheorie keine geringe Leistung des World-polity-
Ansatzes sein.
34 Den es sogar bei Luhmann (1984: 269-274) gibt. 35 Zur Zuschreibung aus handlungstheoretischer Perspektive siehe auch Schulz-Schaeffer (2007).
27
Literatur
Barth, Fredrik (1963): The Role of the Entrepreneur in Social Change in North-ern Norway. Oslo/Bergen/Tromsø: Universitetsforlaget.
Batilana, Julie (2006): Agency and Institutions. The Enabling Role of Individu-als’ Social Position. In: Organization 13: 653-676).
Beckert, Jens (1999): Agency, Entrepreneus, and Institutional Change. The Role of Strategic Choice and Institutionalized Practices in Organizations. In: Or-ganization Studies 20: 777-799.
Berger, Peter L. (2005) (Hg.): The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington: Ethics and Public Policy Center.
Berger, Peter L./Thomas Luckmann (1969): Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Frankfurt/Main: Fischer.
Brunsson, Nils (1989): The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations. Chichester: Wiley.
Brunsson, Nils/Kerstin Sahlin-Andersson (2000): Constructing Organizations: The Example of Public Sector Reform. In: Organization Studies 21: 721-746.
Coleman, James S. (1979): Macht und Gesellschaftsstruktur. Tübingen: Mohr.
Czarniawska, Barbara/Guje Sevón (Hg.) (1996): Translating Organizational Change. Berlin: de Gruyter.
DiMaggio, Paul J. (1988): Interest and Agency in Institutional Theory. In: Lynne G. Zucker (Hg.): Institutional Patterns and Organizations. Culture and Envi-ronment. Cambridge: Ballinger, S. 3-21.
DiMaggio, Paul J./Walter W. Powell (1983): The Iron Cage Revisited. Institu-tional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. In: American Sociological Review 48: 147-160.
DiMaggio, Paul J./Walter W. Powell (1991): Introduction. In: Walter W. Pow-ell./Paul J. DiMaggio (Hg.): The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press, S. 1-38.
28
Drori, Gili S./John W. Meyer/Hokyu Hwang (2009): Global Organization: Ra-tionalization and Actorhood as Dominant Scripts. In: Institutions and Ideol-ogy. Research in the Sociology of Organizations 27: 17-43.
Eisenstadt, Shmuel N. (1968): Social Institution. In: David L. Sills (Hg.): Inter-national Encyclopaedia of the Social Sciences 14. New York: Macmillan, S. 409-429.
Frank, David/John W. Meyer (2002): The Profusion of Individual Roles and Identities in the Postwar Period. Sociological Theory 20: 86-105.
Friedland, Roger/Robert R. Alford (1991): Bringing Society Back in: Symbols, Practices and Institutional Contradictions. In: Walter W. Powell./Paul J. DiMaggio (Hg.): The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chi-cago: University of Chicago Press, S. 232-263.
Garfinkel, Harold (1967): Studies in Ethnomethodology. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Garud, Raghu/Cynthia Hardy/Steve Maguire (2007): Institutional Entrepreneur-ship as Embedded Agency: An Introduction to The Special Issue. In: Organ-ization Studies 27: 957-969.
Greenwood, Royston/Christine Oliver/Kerstin Sahlin/Roy Suddaby (2008) (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Thousand Oaks: Sage.
Greenwood, Royston/Roy Suddaby (2006): Institutional Entrepreneurship in Mature Fields: The Big Five Accounting Firms. In: Academy of Manage-ment Journal 49: 27-48.
Greshoff, Rainer/Georg Kneer/Uwe Schimank (2003) (Hg.): Die Transintentio-nalität des Sozialen. Eine vergleichende Betrachtung klassischer und mo-derner Sozialtheorien. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag.
Hannan, Michael T./John Freeman (1984): Structural Inertia and Organizational Change. In: American Sociological Review 50: 639-658.
Hardy, Cynthia/Steve Maguire (2008): Institutional Entrepreneuship. In: Royston Greenwood/Christine Oliver/Kerstin Sahlin/Roy Suddaby (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Thousand Oaks: Sage, S. 198-217.
Hasse, Raimund/Georg Krücken (2005): Neo-Institutionalismus. 2. Aufl. Biele-feld: transcript.
29
Hwang, Hokyu/Jeannette A. Colyvas (2011): Problematizing Actors and Institu-tions in Institutional Work. In: Journal of Management Inquiry 21: 62-66.
Jepperson, Ronald L./Ann Swidler (1994): What Properties of Culture Should we Measure? In: Poetics 22: 359-371.
Kraatz, Matthew S./Emily S. Block (2008): Organizational Implications of Insti-tutional Pluralism. In: Royston Greenwood/Christine Oliver/Kerstin Sah-lin/Roy Suddaby (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutional-ism. Thousand Oaks: Sage, S. 243-275.
Krücken, Georg/Gili S. Drori (2009) (Hg.): World Society: The Writings of John W. Meyer. Oxford: Oxford University Press.
Lawrence, Thomas B./Roy Suddaby (2006): Institutions and Institutional Work. In: Stewart Clegg/Cynthia Hardy/Walter R. Nord/Thomas B. Lawrence (Hg.): Handbook of Organization Studies. 2. Aufl. Thousand Oaks: Sage, S. 215-254.
Lawrence, Thomas B./Roy Suddaby/Bernard Leca (2009a) (Hg.): Institutional Work. Actors and Agency in Institutional Studies of Organizations. Cam-bridge: University Press.
Lawrence, Thomas B./Roy Suddaby/Bernard Leca (2009b): Introduction: Theo-rizing and Studying Institutional Work. In: Thomas B. Lawrence/Roy Sud-daby/Bernard Leca (Hg.): Institutional Work. Actors and Agency in Institu-tional Studies of Organizations. Cambridge: University Press, S. 1-27.
Lawrence, Thomas B./Roy Suddaby/Bernard Leca (2011): Institutional Work: Refocusing Institutional Studies of Organization. In: Journal of Manage-ment Inquiry 21: 52-58.
Luhmann, Niklas (1984): Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Luhmann, Niklas (1997): Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
Mayntz, Renate/Fritz W. Scharpf (1995): Der Ansatz des akteurzentrierten Insti-tutionalismus. In: Renate Mayntz/Fritz W. Scharpf (Hg.): Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frankfurt/Main: Campus, S. 39-72.
Meier, Frank (2009): Die Universität als Akteur: zum institutionellen Wandel der Hochschulorganisation. Wiesbaden: VS Verlag.
30
Merton, Robert K. (1936): The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. In: American Sociological Review 1: 894-904.
Meyer, Renate E. (2008): New Sociology of Knowledge: Historical Legacy and Current Strands. In: Royston Greenwood/Christine Oliver/Kerstin Sah-lin/Roy Suddaby (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutional-ism. Thousand Oaks: Sage, S. 517-536.
Meyer, John W./Brian Rowan (1977): Institutionalized Organizations: Formal Structures as Myth and Ceremony. In: American Journal of Sociology 83: 340-363.
Meyer, John W./John Boli/George M. Thomas (1994): Ontology and Rationali-zation in the Western Cultural Account. In: W. Richard Scott, John W. Meyer (Hg.): Institutional Environments and Organizations. Structural Complexity and Indiviudalism. Thousand Oaks: Sage, S. 9-27.
Meyer, John W./John Boli/George M. Thomas/Francisco O. Ramirez (2005): Die Weltgesellschaft und der Nationalstaat. In: John W. Meyer: Weltkultur. Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen. Frankfurt/Main: Suhr-kamp, S. 85-132.
Meyer, John W./Ronald L. Jepperson (2000): The “Actors” of Modern Society: The Cultural Construction of Social Agency. In: Sociological Theory 18: 100-120.
Oliver, Christine (1991): Strategic Responses to Institutional Processes. In: Academy of Management Review 16: 145-179.
Parsons, Talcott (1951): The Social System. New York: Macmillan.
Perrow, Charles (1985): Review Essay: Overboard with Myths and Symbols. Review of John W. Meyer and W. Richard Scott: Organizational Environ-ments – Ritual and Rationality. In: American Journal of Sociology 91: 151-155.
Powell, Walter W./Jeannette A. Colyvas (2008): Microfoundations of Institu-tional Theory. In: Royston Greenwood/Christine Oliver/Kerstin Sahlin/Roy Suddaby (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Thousand Oaks: Sage, S. 276-298.
Powell, Walter W./Paul J. DiMaggio (Hg.) (1991): The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chicago: University of Chicago Press.
31
Sahlin, Kerstin/Linda Wedlin (2008): Circulating Ideas: Imitation, Translation and Editing. In: Royston Greenwood/Christine Oliver/Kerstin Sahlin/Roy Suddaby (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Thousand Oaks: Sage, S. 218-242.
Schimank, Uwe (1992): Spezifische Interessenkonsense trotz generellem Orien-tierungsdissens: Ein Integrationsmechanismus polyzentrischer Gesellschaf-ten. In: Hans-Joachim Giegel (Hg.): Kommunikation und Konsens in mo-dernen Gesellschaften. Frankfurt/Main: Suhrkamp, S. 236-275.
Schulz-Schaeffer, Ingo (2007): Zugeschriebene Handlungen. Ein Beitrag zur Theorie sozialen Handelns. Weilerswist: Velbrück.
Simmel, Georg (1908): Soziologie. Untersuchungen über die Formen der Verge-sellschaftung. Leipzig: Duncker & Humblot.
Strandgaard Pedersen, Jesper/Frank Dobbin (1997): The Social Invention of Actors. On the Rise of the Organization. In: American Behavioral Scien-tist 40: 431-443.
Thornton, Patricia H./William Ocasio (2008): Institutional Logics. In: Royston Greenwood/Christine Oliver/Kerstin Sahlin/Roy Suddaby (Hg.): The Sage Handbook of Organizational Institutionalism. Thousand Oaks, London: Sage, S. 99-129.
Tolbert, Pamela S./Lynne G. Zucker (1996): The Institutionalization of Institu-tional Theory. In: Stewart Clegg/Cynthia Hardy/Walter R. Nord (Hg.): Handbook of Organization Studies. Thousand Oaks: Sage, S. 175-190.
Walgenbach, Peter/Renate Meyer (2008): Neoinstitutionalistische Organisations-theorie. Stuttgart: Kohlhammer.
Weick, Karl E. (1995): Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks: Sage.
Weik, Elke (2010): Is There Such a Thing as an Institutional Entrepreneur? Ma-nuskript. Leicester.
Zilber, Tammar B. (2002): Institutionalization as an Interplay between Actions, Meanings and Actors. The Case of a Rape Crisis Center in Israel. In: Acad-emy of Management Journal 45: 234-254.