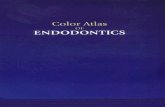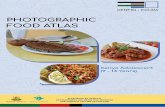Atlas der Weltbilder
-
Upload
dieangewandte -
Category
Documents
-
view
5 -
download
0
Transcript of Atlas der Weltbilder
AT L A S D E R W E LT B I L D E R
Akademie Verlag
Herausgegeben von Christoph Markschies, Ingeborg Reichle,
Jochen Brüning und Peter Deuflhard
ATLAS DER WELTBILDERHerausgegeben vonChristoph Markschies, Ingeborg Reichle, Jochen Brüning und Peter Deuflhard
unter Mitarbeit von Steffen Siegel und Achim Spelten
Akademie Verlag
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-05-004521-4
© Akademie Verlag GmbH, Berlin 2011
Das eingesetzte Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706.
Alle Rechte, insbesondere die der Übersetzung in andere Sprachen, vorbehalten. Kein Teil dieses Buches darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages in irgendeiner Form – durch Fotokopie, Mikroverfilmung oder irgendein anderes Verfahren – reproduziert oder in eine von Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungs-maschinen, verwendbare Sprache übertragen oder übersetzt werden.
Lektorat: Inken Baberg (Hamburg)Bildredaktion: Anna Echterhölter (Berlin), Frank Lange (Berlin) und Margrit Vogt (Berlin)Grafische Gestaltung und Satz: Petra Florath, BerlinDruck und Bindung: DZA Druckerei zu Altenburg GmbH, Altenburg
Printed in Germany
Diese Publikation erscheint mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Berlin und des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg.
Interdisziplinäre ArbeitsgruppenForschungsberichte
Herausgegeben von derBerlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Band 25
VORBEMERKUNG XIII
Henrik Pfeiffer
DIE TRENNUNG VON HIMMEL UND ERDE IM ÄGYPTISCHEN WELTBILD 2
(9. Jh. v. Chr.)
Friedhelm Hartenstein
DIE BABYLONISCHE WELTKARTE 12
(7.– 6. Jh. v. Chr.)
Christoph Markschies
DIE WELT IM KOFFER 22
(6. Jh. n. Chr.)
Bruno Reudenbach
EIN WELTBILD IM DIAGRAMM – EIN DIAGRAMM ALS WELTBILD 32
Das Mikrokosmos-Makrokosmos-Schema des Isidor von Sevilla
(8. Jh. n. Chr.)
Alfred Stückelberger
DER GESTIRNTE HIMMEL: ZUM PTOLEMÄISCHEN WELTBILD 42
(10. Jh. n. Chr.)
INHALTSVERZEICHNIS
VV
Reinhart Staats
REICHSINSIGNIEN UND WELTBILD DER REICHSKRONE 54
(um 962 n. Chr.)
Kurt-Victor Selge
VON DER ZEITLOS-EWIGEN DREIEINIGKEIT GOTTES ZU IHRER STUFENWEISEN ENTHÜLLUNG IN DER GESCHAFFENEN ZEIT 68
(um 1186 n. Chr.)
Arne Effenberger
DIE WELTSCHÖPFUNGSKUPPEL IN DER WESTLICHEN VORHALLE DER MARKUSKIRCHE ZU VENEDIG 78
(um 1220 n. Chr.)
Karl Clausberg
ZUKUNFT VORAUS! HILDEGARDS HEIL(UNG)SGESCHICHTLICHES WELTBILD 90
(um 1230 n. Chr.)
Petra Weigel
DIE ROTA FORTUNAE. VON DER BESTÄNDIGKEIT DES WANDELS UND DER UNSICHERHEIT DES GLÜCKS 102
(um 1230 n. Chr.)
Michael Borgolte
CHRISTLICHE WELT UND MUSLIMISCHE GEMEINDE IN KARTENBILDERN DES MITTELALTERS 118
(um 1262 n. Chr.)
VI
Ute Schneider
WELTDEUTUNGEN IN ZEITSCHICHTEN. DIE EBSTORFER WELTKARTE 132
(um 1300 n. Chr.)
Wilhelm Schmidt-Biggemann
RAIMUNDUS LULLUS: DIE WELT ALS IDEEN-KOMBINATORIK 142
(um 1300 n. Chr.)
Christoph Lüthy
DIE VIER ELEMENTE UND DIE »BESCHAFFUNG DIESER WELT« 154
(1465 n. Chr.)
Frank Fehrenbach
LEONARDO DA VINCI: PROPORTIONSSTUDIE NACH VITRUV 168
(um 1492 n. Chr.)
Johannes Zachhuber
LUCAS CRANACH: GESETZ UND EVANGELIUM 180
(1529 n. Chr.)
Andreas Gormans
DIE KETTE DER WESEN 190
(1579 n. Chr.)
VII
Karl-Heinz Kohl
DIE WELT ALS KLEEBLATT. ALLEGORIEN DER DREI ERDTEILE UND DIE ENTDECKUNG AMERIKAS 198
(1587 n. Chr.)
Aleida Assmann
SCHWELLE ZWISCHEN ALTER UND NEUER WELT: FRANCIS BACONS FRONTISPIZ ZUR INSTAURATIO MAGNA 212
(um 1620 n. Chr.)
Dominik Perler
ROBERT FLUDD: DIE WELT IM KOPF 220
(1619 n. Chr.)
Michael Weichenhan
»OMNIA ENUCLIATIUS EXPONUNTUR IN SCHEMATE«. DAS CUSANISCHE WELTMODELL BEI ATHANASIUS KIRCHER 230
(1653 n. Chr.)
Andreas Fritsch, Walter Sperling
DAS WELTBILD DES J. A. COMENIUS 242
(1658 n. Chr.)
Richard Schröder
KONKURRIERENDE WELTSYSTEME BEI ANDREAS CELLARIUS (1661) 260
(1661 n. Chr.)
VIII
Olaf Breidbach
WAS IST DAS FÜR EINE WELT 268
(um 1650 n. Chr.)
Steffen Siegel
IM WALD DES WISSENS. SICHTBARE ORDNUNGEN DER ENZYKLOPÄDIE AUF DER SCHWELLE ZWISCHEN KULTUR UND NATUR 280
(1769 n. Chr.)
Eberhard Knobloch
ALEXANDER VON HUMBOLDTS NATURGEMÄLDE DER ANDEN 294
(1807 n. Chr.)
Werner Busch
CASPAR DAVID FRIEDRICHS »ZWEI MÄNNER IN BETRACHTUNG DES MONDES« – ÄSTHETISCHE TRANSZENDENZERÖFFNUNG? 306
(1819 n. Chr.)
Ingeborg Reichle
CHARLES DARWINS GEDANKEN ZUR ABSTAMMUNG DES MENSCHEN UND DIE NÜTZLICHKEIT VON WELTBILDERN ZUR ERHALTUNG DER ART 318
(1837 n. Chr.)
Jörn Henrich
DAS WELTBILD DER HIMMELSMECHANIK 334
(1844 n. Chr.)
IX
Hans Gerhard Senger
DER »WANDERER AM WELTENRAND«. EIN ALTER ODER ALTERTÜMELNDER WELTAUFRISS? 342
(1888 n. Chr.)
Isabel Wünsche
KASIMIR MALEWITSCH: »EINE NACKTE, UNGERAHMTE IKONE MEINER ZEIT« 354
(1915 n. Chr.)
Horst Bredekamp
BLUE MARBLE. DER BLAUE PLANET 366
(1972 n. Chr.)
Eva Schürmann
DARSTELLUNG EINER VORSTELLUNG. DAS BILD DER WELT AUF DER PIONEER-PLAKETTE 376
(1972 n. Chr.)
Herfried Münkler
DAS POLITISCHE WELTBILD 386
(1981 n. Chr.)
Erwin Sedlmayr
DIE KOSMISCHE VERTEILUNG DER GALAXIEN 396
(2001 n. Chr.)
Klaus Pinkau
DIE HIMMELSKARTE IM LICHT DER KOSMISCHEN HINTERGRUNDSTRAHLUNG 406
(2001 n. Chr.)
Jochen Brüning
EIN WELTBILD DER NATURWISSENSCHAFT 412
(2006 n. Chr.)
X
Sybille Krämer
DIE WELT AUS DER SATELLITENPERSPEKTIVE: GOOGLE EARTH 422
(2010 n. Chr.)
ANHANG
Autorinnen und Autoren 435Danksagung 445Personenverzeichnis 447Sachregister 451Abbildungsnachweis 459
XI
VORBEMERKUNG
XIII
Zu allen Zeiten haben sich Menschen ein Bild von der Welt gemacht, wie sie sie jeweils verstanden haben – und dies in Bildern festgehalten. In dem hier vorgelegten Atlas treten uns achtunddreißig sorgfältig ausgewählte Weltbilder samt Erläuterungen vor Augen – von einer babylonischen Welt-karte aus grauer Vorzeit bis hin zu den Satellitenbildern von Google Earth aus unseren Tagen. Obwohl Atlanten ursprünglich nur dazu gedacht waren, Phänomene zu charakterisieren und nicht bloß zu inventarisieren, nicht aber sie zu interpretieren1, sind sie natürlich nicht unabhängig von der jeweilig zugrunde liegenden Weltsicht zu verstehen. Deswegen fügen wir hier jedem Bild des Atlas einen erläuternden Text hinzu, der die Bedeutung des Bildes in seiner Zeit und auch die Botschaft für unsere Zeit darstellen soll.
Bereits im 16. Jahrhundert begannen Gelehrte, mit sorgfältig ausgesuchten Bildern die unter-schiedlichsten Phänomene der Natur in reich illustrierten Bildbänden zu veranschaulichen. Der Be-griff »Atlas« wurde 1595 von dem flämischen Kartografen Gerhard Mercator für die Bezeichnung seines geografischen Kartenwerks »Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura« (Atlas oder kosmografische Meditationen über die Schöpfung der Welt und die Form der Schöpfung) eingeführt. Seither ist die Bezeichnung »Atlas« ein feststehender Gattungs-begriff, insbesondere für Kartensammelwerke. In der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der Begriff schließlich auf alle wissenschaftlichen Bildbände ausgeweitet, die zumeist getrennt von den textba-sierten Erläuterungen in großformatigen Supplementen publiziert wurden. Was immer die erklärte Funktion eines Atlas-Textes ist, im Zentrum stehen stets die Illustrationen, die zufällige und kon-tingente visuelle Erfahrung spezifischer Einzelobjekte durch gefilterte Erfahrung ersetzen und das Auge des Betrachters trainieren sollen.2
Aufgrund der Vielzahl von Weltbildern, die seit ihren ersten skizzenhaften Anfängen bis heute entstanden sind, kann sich das Vorhaben eines Atlas der Weltbilder nur exemplarisch an einen idea-len Gesamtatlas aller je entworfenen Weltbilder annähern: Praktiken visueller Welterzeugung in Form von Weltbildern lassen sich bereits in der Antike beobachten und haben sich bis heute als Mittel zur Konstruktion von Ordnungsvorstellungen bewährt. Seit jeher steht der begrifflichen Ordnung der Welt eine modellhaft anschauliche Ordnung gegenüber. Anschaulichkeit als grundlegende Katego-rie für unser Verständnis von Welt ist jedoch mehr als eine bloße Wiederholung des Sehens: Die Bildwelten der Weltbilder geben uns nicht nur ein anschauliches Bild der Welt und des Kosmos. Sie sind zugleich wirkungsmächtige Instrumente zum praktischen und theoretischen Handeln in der Welt und formen auf unterschiedlichste Weise unsere Weltanschauung. Die grundlegenden Fragen, die dabei gestellt werden, sind durch die Jahrhunderte gleich geblieben. Sie betreffen die den Men-schen umfassende Ordnung und seine Stellung innerhalb dieser Ordnung: Welche Gestalt hat die Welt? Welche Kräfte und Ideen wirken in ihr? Woraus besteht sie? Wie ist sie entstanden? Wie sieht ihre Zukunft aus? Bereits frühe Beispiele von Weltbildern machen deutlich, dass die sowohl in Bil-dern als auch in Erzählungen zur Erscheinung gebrachte Wirklichkeit immer eine vom Menschen
hervorgebrachte ist und daher stets interpretierte Wirklichkeit und symbolische Konstruktion be-deutet. Die gesammelten Beispiele repräsentieren zugleich unterschiedliche visuelle Medien, die im Dienst der Konstruktion der Welt als Bild stehen. Damit ist die Geschichte der Weltbilder nicht nur eine Geschichte wechselnder Weltvorstellungen, sondern zugleich auch eine Geschichte wechseln-der Darstellungsmethoden und unterschiedlicher Trägermedien. Dieser Atlas der Weltbilder behan-delt daher ein breites Spektrum von Artefakten und schreitet einen zeitlichen Bogen ab, der mit altorientalischen und altägyptischen Weltkonzeptionen beginnt und mit aktuellen Simulationen der Astrophysik endet.
Der Begriff »Weltbild« ist hier zunächst einmal ganz schlicht verwendet: Aufgenommen wur-den in den Atlas solche Weltbilder, die als Bilder von der Welt angelegt sind. Allerdings ist der Begriff ebenso wie das oft synonym verwendete Wort »Weltanschauung« darüber hinaus ein Karrierebe-griff des 19. Jahrhunderts. Er verdankt seine Popularität in gewisser Weise einem romantischen Affekt, der sich gegen Kants Ansicht richtet, es könne kein Bild von der Welt geben. Mit dem deut-schen Wort »Weltbild«, das in anderen Sprachen kaum ein echtes Äquivalent hat, werden drei unter-schiedliche Sachverhalte bezeichnet: zum einen der Gedanke einer Gesamtvorstellung der Welt, zum anderen der Gedanke der Konstitutionsbedingungen von Weltwahrnehmung überhaupt, und zum Dritten wird durch den Gebrauch einer visuellen Metapher insbesondere der Aspekt des Sehens, der bildlichen Vor- beziehungsweise Darstellung der Welt, zum Ausdruck gebracht. Weltbilder sind also Modellierungen von Überzeugungen, durch die sich Menschen vor aller Erkenntnis und vor jeder Handlung ihrer selbst, ihrer Stellung in der Welt und der Welt als solcher vergewissern. »Weltbild« bezeichnet ein kulturabhängiges (und unter Umständen auch milieuspezifisches) Orientierungs- und Deutungssystem, das sowohl kognitives wie unter anderen politisches, religiöses Handeln und Erleiden bestimmt. Das wird in diesem Atlas beispielsweise an den Differenzen zwischen dem christ-lichen und muslimischen Bild von Welt im Mittelalter deutlich.3 Insofern sind Weltbilder zentral für Weltwahrnehmung und damit für die Lebens- und Handlungsorientierung von Menschen. Man wird durchaus nicht (wie Heidegger) sagen können, dass es »Weltbilder« erst seit demjenigen Jahr-hundert gibt, in dem der deutsche Begriff aufkommt4: Schon die babylonische Weltkarte aus dem 7. oder 6. Jahrhundert vor Christus ist eine »visuelle Darstellung des Weltganzen« (Friedhelm Har-tenstein)5.
Interessant an ihnen ist weniger der gemeinsame Bezug auf eine Wirklichkeit (die »Welt«), son-dern das Spezifische der in ihnen ausgedrückten unterschiedlichen Anschauungen. Daher gab es bereits in vormodernen Zeiten ungeachtet aller Normierungsversuche staatlicher oder religiöser Autoritäten verschiedene »Weltbilder« (wie Kurt-Victor Selge für Joachim Fiore zeigt6) und gibt es sie selbstverständlich unter den Bedingungen der modernen Pluralisierung in besonders großer Vielzahl.
Auch wenn die Begriffsgeschichte zeigt, dass der Ausdruck »Weltbild« von Anfang an mit der Komponente der Anschaulichkeit und der Ordnung eines Ganzen verbunden ist (imago mundi oder orbis pictus), sind die seit dem 19. Jahrhundert als »Weltbilder« bezeichneten Modellierungen von Überzeugungen natürlich nicht im selben Sinn visuell wie die verschiedenen Formen visueller Re-präsentationen von Ausschnitten der Welt, wie Bilder und Modelle.7 Denn anders als der griechische kosmos und der geschaffene mundus des Mittelalters ist die zum Universum gewordene Welt der Neuzeit als solche für lange Zeit als nicht mehr darstellbar empfunden worden. Das galt zunächst im Blick auf ihre Größe: Obwohl bereits in der Antike klar war, dass der Erddurchmesser im Vergleich zu dem der Fixsternsphäre nur die Größe eines Punktes aufweist, haben sich Begriff und Vorstel-lungen von der Ausdehnung des Universums in der Neuzeit tiefgreifend verändert, zunächst im 16. und beginnenden 17. Jahrhundert, bedingt durch die Rezeption der heliozentrischen Lehre, dann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch präzise astrophysikalische Messmethoden. Für die Darstellbarkeit der Welt hieß das: Die Welt, von der man wusste, war zu groß, als dass sie auch nur
XIV
VORBEMERKUNG
vorgestellt werden könnte. Die Darstellung der kosmischen Verteilung der Galaxien zeigt lediglich einen, wenn auch einen »sehr wichtigen Ausschnitt der kosmischen Landkarte«8. Zur räumlichen Entgrenzung der Welt kam der Verlust an wahrnehmbarer Ordnung; die klassischen vormodernen räumlichen Strukturierungen durch Unterscheidungen von Zentrum und Peripherie oder eines Oben von einem Unten waren nicht mehr möglich. In dem von der modernen Kosmologie beschrie-benen Universum nimmt weder die Sonne noch die Milchstraße, in der sie sich befindet, eine privi-legierte Stellung ein. »Weltbilder«, so schien es seit dem 19. Jahrhundert, könnten nicht mehr Visu-alisierungen der Welt von der Art sein, wie sie vormoderne Darstellungen des Kosmos gewesen sind. Charakteristisch für die Verwendung des Differenzausdruckes »Weltbild« wurden daher Kombina-tionen mit einem explikativen Genitiv: das »Weltbild der Physik«, das »Weltbild des mittelalter-lichen Menschen« oder das »Weltbild des Feudalismus«. Solche Ausdrücke weisen auf die Wahrneh-mung insbesondere des 19. Jahrhunderts hin, dass Bilder nur Segmente der stets als komplexer wahrgenommenen Welt zu repräsentieren vermögen.9 Freilich zeigen die Weltbilder des 20. Jahr-hunderts, die in diesem Atlas enthalten sind, »ironischerweise« die Rückkehr klassischer Elemente vormoderner Weltbilder – so Horst Bredekamp für die berühmte Weltaufnahme »Blue Marble« von 1972.10 Umgekehrt zeigt sich schon früh eine Tendenz zur Abstraktion, die die Unähnlichkeit eines Weltbildes inmitten aller Ähnlichkeit zwischen der Welt und ihrer Abbildung zum Ausdruck brin-gen will. Dies wird beispielsweise an einer Darstellung der vier Elemente aus dem späten 15. Jahr-hundert deutlich, die deutlich mehr will, als nur die biblische Schöpfungsdarstellung zu illustrie-ren11, aber auch an einer Darstellung der drei Erdteile als Kleeblatt in einem kolorierten Holzschnitt aus dem Jahr 1581.12 Insofern wäre es dem Reflexionsniveau vormoderner Weltbilder gegenüber inadäquat, ihnen pauschal Naivität zu unterstellen.13 Charakteristisch für den Beginn der Neuzeit, der auch für die Weltbilder eine Epochenschwelle darstellt, ist die Verlagerung des Akzentes vom angeschauten Objekt »Welt« auf die Tätigkeit des Anschauens; diese Akzentverschiebung entspricht der zunehmenden Bedeutung der Erkenntnistheorie in der Philosophie seit Descartes. Die im Atlas präsentierte Darstellung des englischen Philosophen, Naturforschers und Arztes Robert Fludd (1574–1637) dokumentiert, dass als Folge dieser Entwicklung die Welt als ein Objekt von Anschauung und visueller Darstellung allmählich als »Welt im Kopf« des menschlichen Individuums verschwindet, um im 20. Jahrhundert wieder aufzutauchen.14 Gelegentlich realisiert sich die Welt im Kopf als reale Ordnung von Dingen, so vor allem in der barocken Kunstkammer.15 Dabei oszillieren die Darstel-lungen des letzten Jahrhunderts zwischen einer pointierten Abstraktion (wie in dem schwarzen Qua-drat »Quadrilateral«, das Kasimir Malewitsch 1915/1916 in einer Ausstellung in einer Position zeigte, die für die Ikonenecke eines einfachen russischen Hauses charakteristisch ist)16 und einem nur scheinbar traditionellem Realismus. Gelegentlich sind die Abbildungen geradezu Illustrationen des Bewusstseins dieser frühneuzeitlichen Epochenschwelle; Francis Bacon (1561–1626) lässt eines sei-ner Werke mit einer Darstellung des Durchbruchs durch die Schwelle zwischen Alter und Neuer Welt illustrieren.17 Die berühmteste Darstellung des Wanderers am Weltenrand, der die vormo-derne Weltsicht durchbricht, stammt nicht aus dem Mittelalter, sondern aus dem Jahre 1888.18 Inso-fern suggeriert die chronologische Anordnung der Weltbilder in diesem Atlas eine »Logik der Welt-bilder«, die nur sehr eingeschränkt als lineare Entwicklung zu beschreiben ist.19 Auch das Modell von Weltbildkonflikten, die seit der Antike die Entwicklung der Weltbilder vorantreiben, gilt nur eingeschränkt: Wohl kann man das »Koffermodell« der Welt bei dem spätantiken christlichen Theo-logen Kosmas Indikopleustes (»der Indienfahrer«) als Ausdruck eines Konfliktes zwischen paganer Kultur und Christentum deuten, erfasst damit aber nur eine äußerliche Dimension der Darstel-lung20; Gleiches gilt für den wohl prominentesten Fall eines Weltbildkonfliktes in der Moderne, die Auseinandersetzung um den Kopernikanismus. Es lässt sich bekanntlich zeigen, dass auch in der Antike ein heliozentrisches Weltbild entwickelt wurde.21 Im Unterschied zu einer verbreiteten An-nahme wird nämlich kein Weltbild einfach grundsätzlich abgelöst und verschwindet (zum Beispiel
XV
VORBEMERKUNG
ein »mythologisches« durch ein »wissenschaftliches« Weltbild), vielmehr ändert sich nur der Ort und die Funktion des Weltbildes: Auch für Astrophysiker geht die Sonne morgens im Osten auf und abends im Westen unter.
Der Atlas illustriert die These seiner Herausgeber, dass von Anbeginn an bis in die unmittelbare Gegenwart in einem Weltbild Modellierung, Bildlichkeit und Visualisierung keine sekundären Akte sind, die etwas wesentlich Abstraktes veranschaulichen sollen. »Weltbild« ist keine Metapher für eine Reihe von Überzeugungen darüber, wie genau die Welt als Ganze beschaffen ist. Vielmehr gehört von Anfang an die bildliche Dimension von Weltbildern zum Kern dessen, was ein Weltbild ausmacht. Darin sind die hier vorgestellten Weltbilder Exempel für alle »Bilder«, die eine grund-sätzlich orientierende, strukturierende und steuernde Funktion für den Menschen erfüllen.22
Die Herausgeber, Berlin im Januar 2011
1 Siehe Lorraine Daston, Peter Galison: Das Bild der Objektivität. In: Peter Geimer (Hg.): Ord-nungen der Sichtbarkeit. Fotografie in Wissen-schaft, Kunst und Technologie. Frankfurt am Main 2002, S. 34.
2 Ebd.3 Michael Borgolte: Christliche Welt und musli-
mische Gemeinde in Kartenbildern des Mittel-alters, S. 118–131.
4 Zur Kritik siehe Richard Schröder: Konkurrie-rende Weltsysteme bei Andreas Cellarius (1661), S. 260–267.
5 Friedhelm Hartenstein: Die babylonische Welt-karte, S. 12–21.
6 Kurt-Victor Selge: Von der zeitlos-ewigen Drei-einigkeit Gottes zu ihrer stufenweisen Enthül-lung in der geschaffenen Zeit, S. 68–77.
7 Zur Problem- und Begriffsgeschichte siehe Jo-hannes Zachhuber: Weltbild, Weltanschauung, Religion. Ein Paradigma intellektueller Diskurse im 19. Jahrhundert. In: Christoph Markschies, Johannes Zachhuber (Hg.): Die Welt als Bild. Interdisziplinäre Beiträge zur Visualität von Weltbildern, Berlin, New York 2008, S. 171–194; sowie Horst Thomé: Art. Weltbild. In: Histo-risches Wörterbuch der Philosophie, 12. Bd., Basel 2004, Sp. 460–463.
8 Erwin Sedlmayr: Die kosmische Verteilung der Galaxien, S. 396–405.
9 Philosophisch grundlegend dazu: Martin Heideg-ger: Die Zeit des Weltbildes. In: Ders.: Holz-wege. Frankfurt am Main 1950, S. 69–104; siehe auch Reinhard Brandt: D’Artagnan und die Urteilstafel. Über ein Ordnungsprinzip der euro-päischen Kulturgeschichte (1, 2, 3/4). München 21998, S. 235–271.
10 Horst Bredekamp: Blue Marble. Der blaue Planet, S. 366–375.
11 Christoph Lüthy: Die vier Elemente und die »Beschaffung dieser Welt«, S. 154–167.
12 Karl-Heinz Kohl: Die Welt als Kleeblatt. Allego-rien der drei Erdteile und die Entdeckung Ameri-kas, S. 198–211.
13 Christoph Markschies: Weltbildkonflikte in der christlichen Antike. In: Markschies, Zachhuber (wie Anm. 7), S. 50–68.
14 Dominik Perler: Robert Fludd: Die Welt im Kopf, S. 220–229.
15 Olaf Breidbach: Was ist das für eine Welt, S. 268–279.
16 Isabel Wünsche: Kasimir Malewitsch: »Eine nackte, ungerahmte Ikone meiner Zeit«, S. 354–365.
17 Aleida Assmann: Schwelle zwischen Alter und Neuer Welt: Francis Bacons Frontispiz zur Instauratio Magna, S. 212–219.
18 Hans Gerhard Senger: Der »Wanderer am Weltenrand«. Ein alter oder altertümelnder Weltaufriss?, S. 342–353.
19 So aber Günter Dux: Die Logik der Weltbilder. Sinnstrukturen im Wandel der Geschichte. Frankfurt am Main 1982.
20 Christoph Markschies: Die Welt im Koffer, S. 22–31.
21 Alfred Stückelberger: Der gestirnte Himmel: zum ptolemäischen Weltbild, S. 42–53.
22 Das wird vielleicht besonders deutlich bei Herfried Münkler: Das politische Weltbild, S. 386–395.
ANMERKUNGEN
XVI
VORBEMERKUNG