Apokalypse und post-Apokalypse in Filmen der 50er- bis 70er-Jahre
Transcript of Apokalypse und post-Apokalypse in Filmen der 50er- bis 70er-Jahre
195
Jörg Trempler
Apok Alypse und post-Apok Alypse in Filmen der 50er- bis 70er-JAhre
Von der ZeiT nach der ZeiT
In der Offenbarung des Johannes werden nicht allein elementare Naturgewalten beschrieben, sondern das Himmelsgewölbe selbst wird aufgerollt und damit auch das Ende des Kosmos und der irdischen Zeit allgemein beschrieben. Diese Apokalypse ist das Ende. Aber was ist nach dem Ende ? Nichts – oder es ist kein wirk-liches Ende. Doch verbreiten sich seit dem 18. Jahrhundert mehr und mehr Vorstellungen von einer Zeit nach dem Untergang. Der Essay widmet sich zunächst den Anfängen dieser Verzeitlichung im 18. Jahrhundert, um dann in das eigentliche Thema der apoka-lyptischen Technikszenarien zu springen. Erscheint der Untergang der Titanic als eine bedeutende Katastrophe der Technikgeschich-te, ist der Menschheit der nukleare GAU in Form einer zivilen oder militärischen Katastrophe bisher erspart geblieben; gleichwohl hat die Atombombe die Menschheit besonders in den 50er-Jahren zu Vorstellungen und zu Filmen angeregt, wie die Welt nach der nuklearen Katastrophe aussehen könnte. Diese Filme werden als Post-Apokalypse Filme bezeichnet und stehen im Zentrum dieses Essays. Diese Nach-Apokalypse stellt die christliche Vorstellung vom Ende auf den Kopf. Ein bildlich-filmischer Kommentar dazu liefert ein Kinofilm der 70er-Jahre, der im Epilog dieses Essays vorgestellt werden soll. Eingewoben in diese Argumentationslinie sind verschiedene Formen von Gemälden, Fotos oder Filmen. Es ist hier nicht der Ort das komplexe Verhältnis von Kunst und Dokumentation angemes-sen zu beleuchten, doch bleibt in einem mittleren Abschnitt anzudeuten, dass alle bildlichen Repräsentatio-nen unsere Vorstellung von der Apokalypse prägen. 1
PROlOG : WIR sIND AllE scHIFFbRücHIGE DER UNTERGEGANGENEN ANTIKE
claude Joseph Vernet ist berühmt für seine schiffbruchbilder. Eines dieser Gemälde zeigt eine Küste, auf der rechten seite einen von der sonne goldbeschienenen Tempel und darüber einen leuchtturm ( Abb. 1 ). 2 an zentraler stelle auf dem Meer ist ein schiff in seenot wiedergegeben. Im Vordergrund ziehen schiffbrüchige
1. Joseph Vernet, le Fanal exhaussé, 1764, Öl auf lein-wand, 97,5 x 123 cm, Musée d’art et d’histoire Genève
196
ihr Rettungsboot an land. Auf der linken seite sehen wir eine Zweiergruppe, die sich gestikulierend unter-hält. Ihre Aufmerksamkeit gilt aber nicht den schiffbrüchigen, sondern dem Tempel auf der anderen sei-te des bildes. Auch durch die lichtführung sind beide Elemente in der warmen abendlichen sonne mit-einander vereint und unterscheiden sich deutlich von der Architektur des leuchtturms in mattem Grau. Der ufernah gelegene Tempel ist tief in die Erde gesunken. Der Maler hat hier den berühmten römischen Tempel der Minerva Medica zum Vorbild genommen. Er hat das Gebäude aber nicht nur von Rom an die Küste verlegt, sondern auch sehr viel deutlicher und tiefer in die Erde versunken dargestellt, als es auf zeitgenössischen Darstellungen üblich war. Warum versinkt hier aber der berühmte römische bau ? Diese Frage scheinen sich auch die beiden Figuren im bild zu stellen und gleichfalls kann das Gemälde darauf eine Antwort geben. Denn auf einer weiteren stufe der Interpretation kann das Versinken der Architektur mit dem drohenden Versinken des schiffes gleichgesetzt werden. Der Metapher des lebens als schiff-fahrt wird damit eine zeitliche Metapher an die seite gestellt. Die Antike ist ebenfalls Vergangenheit und der versunkene Tempel der Medica Menerva ist im bild ein Zeichen für die untergegangene Antike. An dieser stelle kommt nochmals das Motiv des schiffbruchs ins spiel. Im allgemeinen sinne erscheint die Interpretation nicht überzogen, dass wir alle gewissermaßen schiffbrüchige der untergegangenen Antike sind. so kann das Gemälde als allegorisches Katastrophenbild gelesen werden. Diese beobachtung sei noch durch ein Detail ergänzt: Das dargestellte schiff ist maritim gesprochen in dem sogenannten leger-wall. Damit ist die situation bezeichnet, wenn ein segelschiff bei auflandigem Wind nicht mehr in der lage ist, Manöver zu fahren. Damit ist das schiff noch nicht gesunken, aber bereits verloren, da es untergehen wird. Dies ist ein weiterer Aspekt der Verzeitlichung: so wie die Antike versunken ist, so werden wir auch sinken.
Diese bildformen des 18. Jahrhunderts haben unsere Vorstellungen von der Katastrophe am Vorabend der Französischen Revolution geprägt und geleitet. 3 Diese Annahme bleibt jedoch keinesfalls auf ein Jahr-hundert oder ein bildmedium begrenzt, sondern kann auch für das vor allem durch Film und Fernsehen geprägte 20. Jahrhundert gezeigt werden.
FIlM Vs. DOKUMENTATION
1993 veröffentlichte der Filmkritiker und -historiker Michael Atkinson seinen grundlegenden Artikel » collective Preconscious « , in dem er den Künstler Ken Jacobs wie folgt zitiert: » Wir denken, träumen und phantasieren in der syntax und Ikonographie von Filmen, das Ausgraben › verlorenen ‹ Filmmaterials bedeutet heute also so etwas wie kulturelle Psychoanalyse «. 4 Dass der Film die » chaotische zerstückelte Zeitlichkeit des Traums « beschwört, stellt Hans sedlmayr 1955 bereits fest. 5 bei Atkinson kommt hinzu, dass das Filmmaterial das kollektiv Vorbewusste ausdrückt. Die Gedächtnisforschung der letzten Jahre konnte zeigen, dass spätere bilder ein Ereignis im Gedächtnis nachhaltig verändern können. 6 Wie Harald Welzer in seinem vielbeachteten buch » Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinnerung « ausführt, funktioniert die Erinnerung nicht neutral, sondern Erlebnisse werden immer mit Emotionen verknüpft und so gewertet. 7 bilder neh-men bei Welzers Forschungen einen primären Rang ein, was er pointiert wie folgt zusammenfasst : » Das
197
Gedächtnis braucht die bilder, an die sich die Geschichte als eine erinnerte und erzählte knüpft « . Damit werden bilder für die Geschichte obligatorisch. Es gibt zwar » bilder ohne Geschichte, aber keine Geschichte ohne bilder « . 8
DIE TITANIc ODER DER TRAUM VON DER TEcHNIscHEN bEHERRscHbARKEIT DER NATUR sINKT
In der Nacht vom 14. zum 15. April 1912 stieß der Ozeanriese » Titanic « mit einem Eisberg zusammen. Dieses Unglück, die schwerste schiffskatastrophe, die sich je in Friedenszeiten ereignet hat, geschah auf der Jung-fernfahrt des schnelldampfers und kostete 1 517 Menschen das leben. Die Titanic, die als unsinkbar galt, ist zum symbol der Unbewältigbarkeit der Natur durch den Menschen geworden. Ein schönes beispiel ist der Kommentar des berliner Tageblatts vom 16. April 1912 : » Alle die Armen, die im sausenden sturm der Kraft-fahrt oder im Rausch des Fluges oder in den Prachtsälen eines Wunderschiffes sterben müssen, sind blut-zeugen für die Zukunft, die wir erobern wollen. Noch oft werden wir gelähmt zuschauen müssen, wie die Natur den Menschenstolz auf Menschenwerk grausam niedertritt; trotz alledem aber heißt die losung : weiter ! «
Doch ist das schiffsunglück auch ein Markenstein in der Filmgeschichte, denn es sind noch im selben Jahr zwei Filme fertiggestellt worden, die das Ereignis ins bild setzten. Es entstanden ein britischer Film, der heute nicht mehr erhalten ist und ein deutscher Film, der unter dem Titel » In Nacht und Eis « seit eini-ger Zeit wieder zu sehen ist. Doch zeigt das beispiel auch, dass zu dieser Zeit andere Ansprüche an die Kunst der Historienmalerei und den Film angelegt wurden. Der Kunsthistoriker Erwin Panofsky befasste sich 1947 eingehend mit dem Film und stellt ihn als eine Aneinanderreihung von Fotos dar. » Damit werden zwei grundlegende Tatsachen klar : Erstens : der Ursprung der Freude am Film war nicht ein objektives Interesse an bestimmten Inhalten, viel weniger ein ästhetisches Interesse an der Form der Darstellung von Inhalten, sondern ganz einfach der Freude an etwas, das sich zu bewegen schien, ganz gleich, was es sein mochte. Zweitens: die Filme – zuerst in Kinetoskopen gezeigt, das heißt in kinematographischen Guckkästen, und auf eine leinwand projizierbar frühestens seit 1894 – sind ursprünglich ein Produkt genuiner Volkskunst. Wogegen sonst, einer Regel zufolge, die Volkskunst aus der sogenannten › hohen Kunst ‹ hervorgeht. Ganz am Anfang stehen bloße Aufzeichnungen von bewegungen: galoppierende Pferde, Eisenbahnzüge, Feuer-spritzen, sportliche Ereignisse, straßenszenen. « 9 Egal, ob man heute Panofsky in dieser Herleitung des Films aus der Volkskunst noch folgen mag, er trifft jedenfalls einen Punkt darin, dass diese Art der Darstellung von Inhalten geprägt ist. Wir würden heute sagen : Dokumentation. In einer Untersuchung zu Kriegsfotografie heißt es zu diesem Problem : » Die Idee der Kamera ist inzwischen derart tief in unserer Vorstellung von der Vergangenheit verwurzelt, dass der schnappschuß als Inbegriff des Authentischen gilt, als vollwertiger Ersatz dafür, dass wir selbst dort gewesen wären. Photographien sind die populäre Historiographie unserer Zeit; sie vermitteln nichts Geringeres als die Realität … ; historisches Wissen erweist seinen wahren Wert in seiner Photographierbarkeit. «10
betrachtet man heute den etwas über 30 Minuten langen stummfilm » In Nacht und Eis « , fällt zunächst auf, dass die Ereignisse weniger in einen Film eingebettet sind, als dass vielmehr dokumentarische Züge
198
bewusst inszeniert werden. Die Zwischenstellung vermittelt sich schon in dem Titelblatt : » seedrama. lebens-wahr gestellt nach authentischen berichten « . Dies zeigt sich an den vielen beiläufigkeiten. Vor dem Hinter-grund der relativen Kürze des Films, erstaunt, dass zum beispiel das schließen einer luke gefilmt wurde. Der Grund für diesen Umstand liegt wohl in der Frühform einer heute Dokufiktion genannten Gattung, die von vorne herein darauf angelegt ist, Realität zu suggerieren. Im Fall der Titanic haben wir heute alle ein bild von dem sinkenden schiff, obwohl kein Foto von dem Ereignis existiert. Die Titanic ist daher ein Extrembeispiel, da es streng genommen keine bilder gab, sondern diese bilder unmittelbar nachher geschaffen wurden, um die Geschichte zu erzeugen. Diese bilder sind dann aber keine Abbilder von etwas, sondern sie sind bildak-te, die in der Darstellung das Ereignis wieder erzeugen und nachvollziehbar machen. sie erzeugen in dieser Funktion Geschichte. Aber erzeugen sie auch Zukunft ? Im nächsten Abschnitt wird gezeigt, wie nicht nur unsere Vorstellung von der Vergangenheit, sondern auch der Zukunft durch fiktionale szenarien gesteuert werden können. 11
POsT APOKAlyPsEFIlME DER 50ER-JAHRE ODER DIE NEUE GEsEllscHAFT
Zwei kurz hintereinander erschienene Filme thematisieren die situation nach einem atomaren schlag in Ame-rika. Absurderweise überleben in den Filmen jeweils eine Handvoll Menschen aus nicht sehr gut nachvollzieh-baren Gründen. Gleichzeitig sind beide Filme geprägt von einer liebesgeschichte, da jeweils im Zentrum der Handlung eine Frau steht, die in dem atomaren schlag ihren Mann verloren hat. Der erste Film, der auch die
Gattung des Post-Apokalypse-Films begründet, sei im Folgenden kurz vorgestellt. In » Five « ( Die letzten Fünf, UsA 1951, R: Arch Oboler, 93 min ) ist diese situation insofern zugespitzt, dass sich die fünf Personen aus einer Gruppe mit nur einer Frau und vier Männern zusammensetzt. Es ist dann tatsächlich eine merkwür-dige Geschichte, die wie eine Art Adam und Eva als Urpaar nach dem Atomschlag und dem darauf folgenden Neuanfang wirkt. Durchaus dramatisch ist diese Geschichte dadurch, dass die Frau schwanger ist, ihr Mann allerdings Opfer der Atombombe wurde.
Der Film startet mit der Detonation einer Atombombe mit bekannten bildern von amerikanischen Atomversuchen aus dem Pazifik. 12 Er setzt also den Anfangspunkt mit dem globalen Ende ( Abb. 2 ). Hinzu kommt, dass nach dem Titel » Five « nun auch noch der Untertitel » a story about the day after tomorrow « eingeblendet
wird. Dies wird noch mit einem bibelzitat ( Psalm 103,17 ) unterstrichen : » The deadly wind passeth over it, And it is gone; And the place thereof shall know it no more … « . Da nacheinander verschiedene europäische, amerikanische, arabische und asiatische städte eingeblendet werden, wird vermittelt, dass es sich um das Ende der gesamten Erde handelt. Nach diesem globalen schwenk zoomt die Kamera anschließend von der Vogelperspektive auf eine einsame landschaft ein, wo der betrachter zunächst eine einzelne Person auf
2. Filmstill aus » Five « ( 1951 ), 00:00:19
199
einer straße sieht, die sich taumelnd im Gegenwind fortbewegt. Wir sehen nun eine Frau in einfacher Kleidung, die sich sichtlich angestrengt voranschleppt. Nach einer Weile passiert sie ein Auto und öffnet die Tür in der Hoffnung einen Insassen zu finden, doch es fällt ihr nur ein Arm entgegen. Es ist aber keine leiche, sondern ein skelett. Dadurch, dass es noch mit einem Anzug bekleidet ist, erscheint es als unmittelbare Folge der atomaren Verstrahlung. Die Menschheit ist gewissermaßen vom Fleisch gefallen ( Abb. 3 ). Die nächste Einstellung zeigt die Frau nun in einem Dorf. Zunächst wird sie auf Glockenläuten aufmerksam und glaubt in diesem akustischen signal ein Hoffnungszeichen, doch zerschlägt sich diese Hoffnung gleich wieder, da die Glocke nicht von Menschen-hand sondern alleine durch den Wind angeschlagen wurde.
bis zu diesem Zeitpunkt wird der betrachter auch über die Umstände, die zum globalen Atomschlag geführt haben, im Dunkeln gelassen. Erst jetzt werden kurz Zeitungsanzeigen eingeblendet. Die erste trägt die Headline : » World Organization collapse imminent « . In einer zweiten Einstellung wird nun ein Artikel gezeigt : » World Annihilation feared by scientist. savant warns against new bomb use « Es handelt sich also um eine neue Art der bombe. In der Entstehungzeit des Films 1951 dürfte es sich um die Wasserstoffbombe handeln, die tatsächlich erst 1954 das erste Mal getestet wurde und dann nie wieder, da die Detonation und anschließende Verstrahlung höher war als zuvor angenommen. Der Artikel geht weiter : » New york, Feb. 12 – Prof. Juan Moreless today said that if the new bomb is used, › annihilation of an life on earth ‹ is › within the range of technical posibilities. ‹ It could be done, he said, through › radioactive poisoning of the atmosphere ‹ . « Es ist also kein Krieg als Grund angegeben, sondern wir können – und dies ist im Film nicht weiter themati-siert – von einer Art » friendly fire « ausgehen.
Nach einem langen Irrweg der Protagonistin von land zur stadt und wieder aufs land trifft sie schließlich auf eine kleine Hütte, die sich dezidiert als moderne Architektur zeigt. Es ist Arch Obolers landhaus, das von dem Architekten Frank lloyd Wright entworfen wurde. Als sie das Haus betritt findet sie Feuer im Kamin vor, doch ist die Hütte ansonsten leer. Wenig später kommt ein Mann, Michael, der dort wohnt. Als sie ihn sieht, bricht sie bewußtlos zusammen und braucht erst einige Tage oder Wochen – mit Zeitangaben ist der Film sehr sparsam – um wieder zu bewußtsein zu kommen und nicht mehr vor Michael zu fremdeln. Diese Art der Zeitlosigkeit im Film wird auch dadurch möglich, dass die übrige Welt wie mit einem schalter plötzlich still gestellt wurde, die Dörfer, städte und Metropolen aber noch immer existieren und nur die Menschen umge-kommen sind, nicht aber die Häuser, Güter und lebensmittel. Als die Protagonistin wieder zu Kräften kommt, erfahren wir ihren Namen, Roseanne, und auch, dass sie das Haus bereits kennt. sie berichtet weiter, dass ihr Ehemann Architekt ist oder war ( Roseanne hat die Hoffnung zunächst nicht aufgegeben, dass er noch lebt ) und damit wird wahrscheinlich, dass er das Haus gebaut hat.
Nach und nach kommen noch andere Personen zu der Gemeinschaft hinzu. Zunächst sind es ein alter bankier und ein farbiger bankangestellter, die sich dem Paar anschließen. Der alte Mann wird aber strahlen-krank und äußert in seinem letzten Wunsch, ans Meer zu fahren. Dort angekommen, stirbt er. Aber nahezu
3. Filmstill aus » Five « ( 1951 ), 00:04:27
200
gleichzeitig retten die Hinterbliebenen einen weiteren bewußtlosen Mann aus den Fluten. Dieser erholt sich sehr schnell und kommt wieder zu Kräften, bringt jedoch Unruhe in die kleine Gruppe, da er grundsätzlich anderen Idealen folgt. Während Michael und charles sich in einer Art neuen Urgemeinde daran machen, das land zu bestellen, um eine neue Kultur aufzubauen, will Eric, der Neuankömmling, zurück in die städte, da er nicht einsehen kann, warum die beiden anderen sich körperlich mühen und plagen in der landwirtschaft, wenn doch in den städten alles vorhanden ist. Zwischen diesen beiden Positionen steht Roseanne, die abwech-selnd auf die eine oder andere seite gezogen wird und zudem ihr Kind austrägt, wobei die Ungewißheit über leben oder Tod ihres Mannes ihr zusätzlich zu schaffen macht.
In dieser situation wird eines Abends charles eingeblendet, wie er den Himmel betrachtet und für sich das Gedicht » The creation « von James Weldon Johnson rezitiert. In die letzte Zeile fällt der schrei des Neugeborenen. Mit dem Zuwachs spitzt sich die situation nochmals zu. Eric überzeugt Roseanne schließlich, unter dem Vorwand ihren Mann zu suchen, sich in einer Nacht- und Nebel-Aktion von den anderen davon zu schleichen. Als Eric charles bei der Umsetzung dieses Plans entdeckt, schießt er ihn nieder, ohne dass es die anderen merken. Roseanne, das baby und Eric fahren in die stadt und Michael, nun wieder allein, ent-deckt am nächsten Morgen den Mord und beerdigt charles.
In der stadt wird deutlich, dass die beiden Parteien andere Pläne verfolgen. Während sich Eric Plünderungen hingibt, sucht Roseanne ihren Mann und findet schließlich sein skelett ( Abb. 4 ). Damit ist ihre Mission beendet und sie beschließt wieder zurück-zukehren. In der szene, in der Eric sie daran hindern will, muss er erkennen, dass auch er durch die Radioaktivität kontaminiert ist. Diese Erkenntnis läßt ihn völlig zusammenbrechen und Roseanne tritt nun wie schon zu beginn des Films wiederum ihre Flucht zu Fuß an. Auf diesem Weg stirbt ihr baby und sie irrt völlig verzwei-felt weiter, um schließlich von Michael gefunden zu werden. Dieser nimmt sie wieder auf und bestattet ihr Kind neben dem Grab von
charles. Die schlusseinstellung zeigt, wie er sein Feld bestellt und Roseanne ihm wortlos hilft. Auf diese Geste hin finden beide zueinander, sie umarmen sich und wirken wie ein zukunftsvolles Paar ( Abb. 5 ). Nach diesem Ende wird nochmals folgendes bibelzitat eingeblendet : » And I saw a new heaven and a new earth … And there shall be no more death, no more sorrow … No more tears … behold ! I make all things new ! Revelation
4. Filmstill aus » Five « ( 1951 ), 01:20:43
5. Filmstill aus » Five « ( 1951 ), 01:29:31
6. Filmstill aus » The Day the World ended « ( 1956 ), 00:00:03
201
21 « . In der deutschen Fassung lautet diese stelle mit den Zeilen, die im Film ausgelassen wurden ( Offb 21, 1 – 5 ) : » Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde; denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große stimme von dem Thron her, die sprach: siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen ! Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein; und Gott wird abwi-schen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch leid noch Geschrei noch schmerz wird mehr sein; denn das Erste ist vergangen. Und der auf den Thron saß, sprach: siehe, ich mache alles neu!« stellt man also das gesamte bibelzi-tat in Rechnung, steigert sich nochmals der empathisch positive sinn. Wir sehen den beginn einer neuen, gereinigten Welt.
Resümierend kann man sagen, dass der Film » Five « sehr archaisch das leben nach dem Ende thematisiert. Die religiösen Anklänge sind nicht zu übersehen und werden noch durch die Zitate am Anfang und am Ende unterstrichen. Es ist aber durchaus bemerkenswert, was der Film nicht thematisiert. Es wird – dies ist erstaunlich genug – kein Grund für die globale atomare Vernich-tung genannt. Ganz im Gegenteil wird dies von den überlebenden geradezu in einer Art von notwendigem Fatalismus hingenommen. Dies erinnert an Günther Anders » Thesen zum Atomzeitalter « . Die erste These ist » Hiroshima als Weltzustand « betitelt und lautet: » Mit dem 6. August 1945, dem Hiroshimatage, hat ein neues Zeit-alter begonnen : das Zeitalter, in dem wir in jedem Augenblicke jeden Ort, nein unsere Erde als ganze, in ein Hiroshima verwan-deln können. seit diesem Tage sind wir modo negativo allmächtig geworden; aber da wir in jedem Augenblick ausgelöscht werden können, bedeutet das zugleich: seit diesem Tage sind wir total ohnmächtig. Gleich wie lange, gleich ob es ewig währen wird, die-ses Zeitalter ist das letzte: Denn seine differentia specifica : die Möglichkeit unserer selbstauslöschung, kann niemals enden – es sei denn durch das Ende selbst. «
Die Thesen stammen von 1959. Der Film von 1951. Und es scheint tatsächlich möglich, dass der Philo-soph von dem Film inspiriert wurde. In diesem sinne konnte der Film als bildakt eine Denk- und Realitäts-verhältnis prägen, dass anschließend von Philosophen wie Günther Anders in Worte gefasst wurde. Wichtig
7. Filmstill aus » The Day the World ended « ( 1956 ), 00:00:23
8. Filmstill aus » The Day the World ended « ( 1956 ), 00:00:27
9. Filmstill aus » The Day the World ended « ( 1956 ), 01:11:03
202
erscheint, dass man den Film aber nicht alleine als Fiktion abtun kann, denn er liefert auch in dieser fiktiven Form einen Einfluss auf die Denkwelt der 50er-Jahre.
Einem ganz ähnlichen sujet widmet sich der Film » The Day the World ended « ( » Die letzten sieben « , UsA 1956, Regie Roger corman, 78 min, Abb. 6 – 8 ). Dieser streifen ist ähnlich aufgebaut, hat nur durch die Ausweitung des Personals auf sieben Akteure etwas mehr breite in den charakteren. bemerkenswert ist dieser Film dann noch dadurch, dass die Radioaktivität dazu führt, dass Tiere und Menschen mutieren ( Abb. 9 ). Eine Hauptdarstellerin, die ebenfalls ihren Mann beim Atomschlag verloren hat, wird von einem dieser Mutanten heimgesucht. Am Ende des Films finden sich aber erneut ein Paar zusammen, die hoffnungsvoll in die Fer-ne schreiten und der Film endet schließlich mit dem schriftzug » The beginning « ( Abb. 10 ).
In den 50er-Jahren gibt es dann eine merkwürdige Häufung von Filmen, die einen neuen Gesellschaftsentwurf thematisieren. Ein beispiel mit einer etwas anderen Handlung wäre der Film » When Worlds collide « , der in der deutschen übersetzung » Der Jüngste Tag « heißt ( UsA 1951, Regie Rudolph Mate, 79 min ). Hier wird die Erde durch einen Kometen zerstört. Es gelingt aber einer kleinen Gruppe von ausgewählten Personen auf einen anderen Planeten zu flüchten. 13 Diese neue Gesellschaft zeigt durch ihre Kleidung christliche Anklänge ( Abb. 11 ). Durchaus bemerkenswert ist, dass die meisten dieser Filme eine Zerstörung der gesamten Erde zeigen und auch eine neue Gesellschaftsform thematisieren. In » When Worlds collide « landet die moderne Arche am Ende erfolgreich auf einem neuen Planeten, der jetzt mit Zeichentrickef-fekten dargestellt ist. Die Menschheit betritt diese schöne, bunte Welt und beginnt ein neues Zeitalter ( Abb. 12 ). Das früheste bei-spiel ist dabei das positivste und alle Weiteren werden nicht mehr so stark vom Gedanken an die Neue Welt geprägt. Für diesen bereich bliebe noch zu untersuchen, wie sich diese spezifischen Apokalypsevorstellungen auf die berichtserstattung derselben
Jahre auswirkten. Die Dokumentation der Atomversuche des bikini -Atolls haben in dieser bildgeschich-te längst ikonischen charakter erreicht, nicht erst seit der legen dären schlussszene von stanley Kubricks » Dr. strangelove or : How I learned to stop Worrying and love the bomb « von 1964 ( Abb. 13 – 14 ).
10. Filmstill aus » The Day the World ended « ( 1956 ), 01:18:15
11. Filmstill aus » When Worlds collide « ( 1951 ), 01:12:36
12. Filmstill aus » When Worlds collide « ( 1951 ), 01:18:32
203
EPIlOG : DIE cHRIsTlIcHE WElT sTEHT KOPF
In den 70er-Jahren fehlen diese Katastrophen vom globalen Zuschnitt in den Kinos. stattdessen werden kleinere Geschichten erzählt. Am Ende steht ein beispiel, das sich nochmals dem Thema schiffbruch wid-met und gleichzeitig die religiöse Komponente impliziert themati-siert : » The Poseidon Adventure « von 1972. Das Kreuzfahrtschiff Poseidon befindet sich auf seiner letzten Fahrt von New york nach Griechenland. Während die Gäste im ballsaal des schiffes ausgelassen die silvesternacht feiern, wird das schiff von einer Riesenwelle erfasst, die durch ein seebeben entstanden ist. Die Poseidon kentert und treibt nach einer gewaltigen Explosion kiel-oben auf dem Ozean ( Abb. 15 – 16 ). Der größte Teil der besat-zung, einschließlich des Kapitäns, ertrinkt. Wie durch ein Wunder überleben einige Passagiere im ballsaal des schiffes. Zunächst versucht der, von seiner Kirche strafversetzte, sehr eigensinni-ge Reverend Dr. Frank c. scott die im ballsaal eingeschlos sene Festgesellschaft davon zu überzeugen, den Weg nach oben, also zum schiffsrumpf anzutreten. Die meisten überlebenden vertrau-en jedoch auf den Zahlmeister, der behauptet, nur hier könnten sie von suchtrupps gefunden werden. Allerdings folgt eine klei-ne Gruppe dem Reverend: Polizist Mike Rogo, seine Frau, die ehemalige Prostituierte linda, der Geschäftsmann James Mar-tin, sängerin Nonnie Parry, das alte Ehepaar Manny und belle Rosen, die beiden Geschwister susan und Robin shelby sowie der bordsteward Acres. Auf dem Weg nach draußen verlieren sie zunächst den bordsteward Acres, der während des Ausstiegs durch einen schacht den Halt verliert und in die Tiefe stürzt. Mrs. Rosen erleidet einen Herzinfarkt, nachdem sie dem Reverend bei einer Unterwasserdurchquerung das leben gerettet hat. Zuletzt stürzt im Maschinenraum linda Rogo in die Tiefe und der Reverend opfert sein leben für die anderen und versinkt im Flammenmeer. Die kleine Gruppe erreicht den rettenden schiffsschraubenbereich, wo sie von einer Hubschrauberbesatzung mittels schneid-brenner gerettet wird.
soweit die Zusammenfassung der Handlung. Im Folgenden werde ich einige szenen vorstellen, in denen das Hauptthema des Films – nämlich das Umwenden des gesamten schiffes – in einzelnen Nebenhand-lungen bildlich wieder aufgenommen werden. Es scheint, dass diese verkehrte Welt auch wiederum das staats- und lebensschiff oder konkret sogar das schiff als symbol der Kirche bemüht, da der Hauptdarsteller nicht christliche barmherzigkeit predigt, sondern sich umgekehrt in eine Philosophie der individuellen stärke versteigt, die gewissermaßen die christliche lehre auf den Kopf stellt. Gleich eine ganze Anzahl von einzelnen sequenzen können diese Hypothese unterstreichen: Die erste szene, in welcher er auf der Poseidon noch vor
14. Filmstill aus » Dr. strangelove « ( 1964 ), 01:33:19
13. Filmstill aus » Dr. strangelove « ( 1964 ), 01:33:10
204
dem Unglück eine Predigt hält, vermittelt, wie er von der barmherzigkeit Abstand nimmt. Dies wird zunächst nicht sehr stark bildlich, sondern vor allem sprachlich vermittelt. Doch ist die sequenz eingebettet in einen
schnittwechsel vom Tag zur Nacht. Vor der Predigt sehen wir das schiff am Tag, nach der Predigt gibt es einen cut zur Nacht. Der Reverend ist auch nicht der einzige Geistliche an board. Er wird begleitet von einem älteren Kollegen, der in dieser sequenz auf der rechten seite sitzend dargestellt ist. In der Ansicht vom Publi-kum aus gesehen, trennt beide die aufgeschlagene bibel, also das Wort Gottes, das beide unterschiedlich auslegen.
Die nächste sequenz zeigt nun die Umwendung des gesam-ten schiffes Kiel aufwärts. In dieser szene wendet sich auch der riesige Weihnachtsbaum im ballsaal, der als christliches symbol ebenfalls mit dem schiff auf den Kopf gestellt wird und später noch eine Rolle spielen wird. Nachdem sich in den nächsten Minuten das entstandene chaos einigermaßen beruhigt, entschließt sich der Reverend zum Kiel zu gehen, um sich in sicherheit zu brin-gen. Die nächste szene zeigt, wie der Weihnachtsbaum nun als leiter genutzt wird ( Abb. 17 ), um nach oben zu gelangen. Für diese Umfunktionierung des baums wird das christliche symbol zunächst wieder aufgerichtet. Es dürfte im Kontext des Filmes kein Zufall sein, dass nun die Gruppe um den Reverend ihren Weg in die oberen, also vormals unteren Räume des schiffes ausgerech-net und buchstäblich durch den Weihnachtsbaum nehmen muss ( Abb. 18 ). Die nächste sequenz ist wiederum nicht so stark moti-visch relevant, dafür aber für den Handlungsstrang sehr wichtig, da sich hier die beiden Geistlichen trennen und somit nochmals klar wird, dass es sich bei der Handlung des jungen Reverend um eine Abkehr von den alten Werten handelt. Diese Abkehr wird in der nächsten szene dann massiv bildlich unterstrichen. Kaum ist die Gruppe um den Reverend den baum empor geklettert und hat den oberen Raum erreicht, ereignet sich eine weitere Explosion im schiff, die den bis dahin etwas zur Ruhe gekommenen ballsaal flutet und den sicheren Tod für die zurück gebliebenen Menschen bedeutet.
Wiederum ist der baum ein wichtiges bildelement in dieser szene. Die Zurückgebliebenen stürmen den baum, um sich eben-
falls zu retten, doch gerade als der erste oben angekommen scheint, stürzt der baum um und die Verbindung ist damit gekappt. Der Reverend blickt auf das Grauen, dreht sich um und schließt die Tür hinter sich – ein sehr altes Motiv der Abkehr.
15. Filmstill aus » The Poseidon Adventure « ( 1972 ), 00:29:31
16. Filmstill aus » The Poseidon Adventure « ( 1972 ), 00:30:05
17. Filmstill aus » The Poseidon Adventure « ( 1972 ), 00:37:21
18. Filmstill aus » The Poseidon Adventure « ( 1972 ), 00:46:48
205
Nach einer schier endlosen Anzahl an Prüfungen und Aufgaben, bei der überwindung von Hindernissen sind die wenigen überlebenden jetzt im Maschinenraum des schiffes, also ganz nah am Ziel angekommen. Nun aber ist der Weg versperrt durch ein gebrochenes Rohr, aus dem heißer Wasserdampf tritt. Geschlos-sen werden kann dieses leck nur, indem jemand das Ventil zudreht, das aber wiederum nicht ohne weiteres zu erreichen ist. In dieser situation ereignet sich nun die schlüssel-szene des Films : Der Reverend springt an das Rad, an dem er das Ventil schließen kann und bewegt es langsam mit letzter Kraft. Während er dies tut, spricht er wütend ein Gebet zu Gott, der schon so viele Opfer gefordert hat und nun am Ende auch noch ihn fordert. Mit letzter Kraft dreht er das Ventil zu, lässt dann die Hände los und stürzt in die Tiefe in ein Flammenmeer. Es wäre nun zu diskutieren, in wie weit diese szene tatsächlich interpretatorisch belastbar ist, doch erscheint mir zumindest auffällig, dass der christliche Eiferer am Ende hängt ( Abb. 19 ). Er hängt aber nicht am Kreuz, sondern buchstäblich am Rad. Wollte er nicht mit seinen lehren alles umdrehen ? Und dies genau ist nun seine letzte Handlung, bevor er in den Tod stürzt. Auch hier dürfte kein Zufall sein, dass er ins Feuer ( Fegefeuer ? ) stürzt. Nachdem sich der Reverend geopfert hat, kommen die anderen in den Raum mit dem Wellengang und werden durch ein Rettungsteam, das ein loch in den schiffskiel schweißt, gerettet. Das schiff hat sich zwar zum schluss nicht wieder aufgerichtet, doch scheint trotzdem die Welt wieder vom Kopf auf die Füße gestellt. ( Abb. 20 )
2006 wurde der stoff von Wolfgang Petersen ( Poseidon, 99 min ) neu verfilmt. Die Haupthandlung bleibt gleich. Die Rollen sind ähnlich, nur ist auffällig, dass alle bildlichen und theologischen Anspielungen auf in Inversion der christlichen Werte keinen Ein-gang mehr in das Remake gefunden haben. Die tiefsinnige Meta-ebene fehlt dem blockbuster unserer Tage. Damit kann eine Ten-denz bestätigt werden, die Daria Pezzoli-Olgiati kürzlich in einem Aufsatz ausgeführt hat : Apokalyptische Motive finden sich häufig in spielfilmen, sie verlieren aber ihre eindeutig religiösen bezüge und gewinnen eine größere Vieldeutigkeit hinzu.
19. Filmstill aus » The Poseidon Adventure « ( 1972 ), 01:43:55
20. Filmstill aus » The Poseidon Adventure « ( 1972 ), 01:50:13
206
lITERATUR
Aleida Assmann 1999Assmann, Aleida : Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kultu-rellen Gedächtnisses, München 1999
Jan Assmann 1992 Assmann, Jan : Das kulturelle Gedächtnis. schrift, Erinnerung und politi-sche Identität in frühen Hochkulturen, München 1992
Atkinson 1993Atkinson, Michael : collective Preconscious, in : Film comment, bd. 29, 1993, Nr. 6, s. 78 – 83
brandt 2004brandt, Reinhard: bilderfahrung. Von der Wahrnehmung zum bild, in : christa Maar und Hubert burda ( Hg. ), Iconic Turn. Die neue Macht der bilder, Köln 2004, s. 44 – 54
conisbee 1976conisbee, Philip ( Red. ) : Joseph Vernet 1714 – 1789, Ausstellungskatalog Paris 1976
Dath 2004Dath, Dietmar : Die schlimmsten Filme, die es nicht gibt, in : Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. Juli 2004
Erll 2008Erll, Astrid ( Hg. ) : cultural Memory studies. An international and interdisci-plinary Handbook, berlin u. a. 2008
Haskell 1995Haskell, Francis : Die Geschichte und ihre bilder. Die Kunst und die Deu-tung der Vergangenheit [ 1993 ], München 1995
Horn 2014Horn, Eva : Zukunft der Katastrophe, Frankfurt am Main 2014
Oesterle 2005Oesterle, Günther ( Hg. ) : Erinnerung, Gedächtnis, Wissen. studien zur kul-turwissenschaftlichen Gedächtnisforschung, Göttingen 2005
Panofsky 1993Panofsky, Erwin : stil und Medium im Film [ 1947 ], Frankfurt am Main / New york 1993
Pezzoli-Olgiati 2013Daria Pezzoli-Olgiati, Retterfiguren in Dystopien. Vieldeutigkeit apokalyp-tischer Motive im spielfilm, in : bluhm / schiefer-Ferrari / Wagner / Zuschlag 2013, s. 231 – 251
scholz 2008scholz, Regine ( Hg. ) : schwerpunktthema : Die Vergangenheit in der Ge-genwart. Gedächtnisforschung und psychotherapeutische Praxis, Gießen 2008
sedlmayr 1955sedlmayr, Hans : Das Problem der Zeit. Die wahre und die falsche Ge-genwart [ 1955 ], in : Hans sedlmayr : Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte, Mittenwald 1978, s. 164 – 180
Trachtenberg 1985Trachtenberg, Alan : Album of War. On Reading civil War Photographs, in : Representations, Nr. 9, Winter 1985, s. 1 – 32
Trempler 2012Trempler, Jörg : Katastrophen. Ihre Entstehung aus dem bild, berlin 2012
Trempler 2013Trempler, Jörg : Katastrophen und Apokalypse im Film, in : Wieser 2013, s. 209 – 226
Welzer 1995Welzer, Harald : Das Gedächtnis der bilder. Eine Einleitung, in : Ders. ( Hg. ), Das Gedächtnis der bilder. Ästhetik und Nationalsozialismus, Tübingen 1995
Welzer 2001Welzer, Harald ( Hg. ) : Das soziale Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradition, Hamburg 2001
Welzer 2002Welzer, Harald : Das kommunikative Gedächtnis. Eine Theorie der Erinne-rung, München 2002
207
ANMERKUNGEN
1 Der Essay beruht auf meinem buch Trempler 2012 und übernimmt Teile aus meinem Essay Trempler 2013.
2 Der Originaltitel lautet : le Fanal exhaussé, Öl auf leinwand, 97,5 x 123 cm, signiert und datiert » Joseph Vernet f. 1746 « . Vgl. conisbee 1976, s. 53 f., Nr. 15
3 Vgl. hierzu ausführlich Trempler 2012
4 Zitiert nach Dath 2013; vgl. Atkinson 1993, s. 78
5 Vgl. sedlmayr [ 1955 ] 1978, s. 178 und brandt 2004, s. 47 : » Die Zeit kann gerafft, gedehnt oder in Form von Rückblenden zurückgedreht werden. bildzeit, also die in bildern vorgestellte Zeit, ist eine Exklave der Weltzeit, so wie bildraum, der in bildern vorgestellte Raum, eine Exklave des Weltraums ist. beide existieren nur innerhalb der bilder, nicht jedoch im Kontinuum unserer Erfahrung. «
6 Pioniere mit hoher Ausstrahlungskraft auf diesem Gebiet sind Aleida Assmann ( 1999 ) und Jan Assmann ( 1992 ). Vgl. zum stand der Forschung Oesterle 2005, Erll 2008 und scholz 2008
7 Vgl. Welzer 2002
8 Vgl. Welzer 1995, s. 8 und ders. 2001
9 Panofsky [ 1947 ] 1993, s. 19
10 Haskell 1995, s. 12, mit bezug auf Trachtenberg 1985, s. 1
11 Vgl. dazu auch Horn 2014. Die Autorin geht leider nicht auf die hier genannten Filme ein.
12 Zu bemerken ist, dass die Atomversuche in dem Film nur von den ersten beiden bomben stammen können, da die späteren erst nach dem » Five « gezündet wurden. Daher positioniert sich der Film genau zwischen den beiden frühen Atombomben Able und baker von 1946 sowie der spä-teren Wasserstoffbombe bravo, die 1954 gezündet wurde.
13 Andere 50er-Jahre Filme mit ähnlichem sujet sind : » Der Tag, an dem die Erde stillstand « ( 1951 ) und » Kampf der Welten « ( 1953 ).
14 Vgl. Pezzoli-Olgiati 2013


























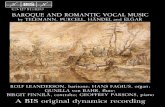




![Bis[(1 S *,2 S *)- trans -1,2-bis(diphenylphosphinoxy)cyclohexane]chloridoruthenium(II) trifluoromethanesulfonate dichloromethane disolvate](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63360a7bcd4bf2402c0b5520/bis1-s-2-s-trans-12-bisdiphenylphosphinoxycyclohexanechloridorutheniumii.jpg)



