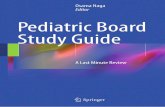Aphakic and pseudophakic glaucoma following pediatric cataract surgery
Transcript of Aphakic and pseudophakic glaucoma following pediatric cataract surgery
Punkte sammeln auf...
CME.springer.deTeilnahmemöglichkeiten- kostenfrei im Rahmen des jeweiligen
Zeitschriftenabonnements- individuelle Teilnahme durch den Erwerb
von CME.Tickets auf CME.springer.de
Zertifizierung Diese Fortbildungseinheit ist mit 3 CME-Punkten zertifiziert von der Landesärzte-kammer Hessen und der Nord rheinischen Akademie für Ärztliche Fort- und Weiter-bildung und damit auch für andere Ärzte-kammern anerkennungsfähig.
Hinweis für Leser aus Österreich und der SchweizGemäß dem Diplom-Fortbildungs-Pro-gramm (DFP) der Österreichischen Ärzte-kammer werden die auf CME.springer.de erworbenen CME-Punkte hierfür 1:1 als fachspezifische Fortbildung anerkannt.Der Ophthalmologe ist zudem durch die Schweizerische Gesellschaft für Ophthalmologie mit 1 Credit pro Modul anerkannt.
Kontakt und weitere InformationenSpringer-Verlag GmbHFachzeitschriften Medizin / PsychologieCME-Helpdesk, Tiergartenstraße 1769121 HeidelbergE-Mail: [email protected]
Ophthalmologe 2012 · 109:83–92DOI 10.1007/s00347-011-2516-5© Springer-Verlag 2012
A.L. Solebo · J. RahiInstitute of Child Health UCL, London
Aphakie- und Pseudophakieglaukom nach Kataraktoperation im Kindesalter
ZusammenfassungDurch moderne Techniken ist die kongenitale Katarakt heute chirurgisch sehr erfolgreich behandelbar. Die am meisten gefürchtete postoperative Komplikation ist die Ausbildung eines Sekundärglaukoms (etwa ein Drittel aller kindlichen Sekundärglaukome). Angaben zur Prävalenz sind aufgrund der limitierten Aussagekraft der Literatur schwierig. Ange-geben wird eine Inzidenz von 10−25% über 10 Jahre postoperativ, die Wahrscheinlichkeit steigt mit zunehmender Nachbeobachtungsdauer. Ein entscheidender Risikofaktor für die Glaukomentstehung ist offensichtlich das Alter bei Operation: je geringer das Lebensalter zum Operationszeitpunkt, desto höher das Risiko für ein Sekundärglaukom. Eine Mikrokornea ist nach multivariater Analyse ein weiterer Risikofaktor. Folgende postoperative Veränderun-gen könnten pathogenetisch relevant sein: periphere anteriore Synechien, hohe Irisinsertion und Membranen über dem Trabekelwerk, ferner die postoperative Entzündung, die Reaktion auf Linsenepithelzellen, das perioperative Barotrauma und die Veränderung der Architektur im Vorderabschnitt nach Kataraktoperation. Zur Evaluation des optimalen Zeitfensters für die Operation einer kongenitalen Katarakt und der Risikofaktoren für die Ausbildung eines Sekundärglaukoms ist eine prospektive Longitudinalstudie erforderlich.
SchlüsselwörterKongenitale Katarakt · Kindliche Kataraktchirurgie · Sekundärglaukom · Aphakieglaukom · Pseudophakieglaukom
CME Weiterbildung Zertifizierte Fortbildung
© K
laus
Rüs
chho
ff, Sp
ringe
r Med
izin
Übersetzt durch F. Grehn, Universitäts-Augenklinik der Julius-Maximilians-Universität, Würzburg
RedaktionF. Grehn, Würzburg
Unter ständiger Mitarbeit von:A. Kampik, München B. Seitz, Homburg/Saar
83Der Ophthalmologe 1 · 2012 |
CME
Aphakic and pseudophakic glaucoma following pediatric cataract surgery
AbstractModern surgical techniques allow congenital cataract surgery to be performed much more successfully. The development of a secondary glaucoma is the most dreaded postoperative complication (one third of all pediatric secondary glaucomas). Due to the limited value of the available literature, data on prevalence are unreliable. A 10-year postoperative incidence of 10-25% is given in the literature for developing secondary glaucoma and the frequency increases with the duration of follow-up. A major risk factor seems to be the age at the time of surgery. The younger the patient is at the time of surgery the higher the risk of secondary glaucoma. A microcornea seems to be another risk factor in multivariate analysis. The following postoperative changes might be involved in the pathogenesis: peripheral anterior synechia, high iris insertion and membranous material over the trabecular meshwork. Additionally postoperative inflammation, reaction to lens epithelial cells, perioperative barotrauma and loss of anterior segment architecture might also be responsible. In order to evaluate the optimal age window for congenital cataract surgery and risk factors for the development of secondary glaucoma, a prospective longitudinal study is mandatory.
KeywordsCongenital cataract · Pediatric cataract surgery · Secondary glaucoma · Aphakic glaucoma · Pseudophakic glaucoma
Nach Lektüre dieses Beitrags
- werden Sie die verfügbare Evidenz zum Thema Sekundärglaukom nach Kataraktchirurgie im Kindesalter kennen.
- werden Sie vertraut sein mit medizinstatistischen Besonderheiten für diesbezügliche ophthalmologische Studien.
- sind Sie in der Lage, die Ergebnisse der − meist retrospektiv angelegten − klinischen Studien kritisch zu rezipieren, insbesondere auch die Problematik, die sich aus − unter statistischen Aspekten − ungünstig zusammengesetzten Kollektiven ergibt.
- werden Sie die Hypothesen zur Pathogenese und die „Risikofaktoren“ für die Entwicklung eines Sekundärglaukoms kennen.
Weltweit ist fast eines von sieben blinden Kindern aufgrund einer Katarakt erblindet [1]. Nur durch Früherkennung und operative Intervention lässt sich eine kataraktbedingte Erblindung verhindern. Doch die Operation selbst birgt das Risiko einer Erblindung, beispielsweise durch ein Sekundärglau-kom. Dank moderner mikrochirurgischer (Vitrektomie-)Techniken, die eine sichere, gründliche Entfernung von Katarakt und vorderem Glaskörper ermöglichen, treten postoperative Winkel-blockglaukome seit den 1980er-Jahren seltener auf [2, 3]. Heute ist die häufigste das Sehvermögen bedrohende Komplikation ein Aphakie- bzw. Pseudophakieglaukom („aphakic or pseudophakic glaucoma“, APG); es macht ein Drittel aller kindlichen Sekundärglaukome in industrialisierten Län-dern aus [4].
Das Management von APG stellt eine Herausforderung dar. Die meisten Kinder müssen wiederholt operiert werden [5, 6, 7], und fast die Hälfte dieser Kinder sind von erheblichen Visuseinschränkungen betroffen [5, 6]. Durch das Sekundärglaukom kann das funktionelle Ergebnis für operierte Kinder sogar schlechter sein als bei einer nichtoperierten Katarakt mit Amblyopie [8].
Nach Kataraktoperation im frühen Kindesalter besteht lebenslang ein erhöhtes Risiko für ein Glaukom [5, 9, 10]. Bei einer zu erwartenden Lebenszeit von etwa 90 Jahren (ein heute operierter Säugling lebt wahrscheinlich bis zum Jahr 2100) sollten deshalb alle pädiatrischen und alle auf Glau-kom spezialisierten Ophthalmologen bestrebt sein, diese Erkrankung zu verstehen. Im Folgenden geben wir einen Überblick über die Literatur zu „Risikofaktoren“, über die möglichen ursächlichen Faktoren und über die (Hypo-)Thesen zur Pathogenese.
Nur Früherkennung und operative Intervention können eine katarakt-bedingte Erblindung verhindern
Postoperative Winkelblockglauko-me treten heute seltener auf
Nach Kataraktoperation im frühen Kindesalter ist das Glaukomrisiko lebenslang erhöht
84 | Der Ophthalmologe 1 · 2012
CME
Glaukom im aphaken/pseudophaken Auge: Evidenz
Es gibt mehrere Veröffentlichungen zu Prävalenz, Zeit bis zum Auftreten, möglichen Einflussfaktoren und zur Pathogenese des APG. Doch ein Vergleich oder eine Metaanalyse dieser Arbeiten ist durch methodische Einschränkungen der publizierten Arbeiten erschwert. Zu diesen zählen FBias durch Fehlklassifikation (unterschiedliche Definitionen), FBias durch Selektion (Heterogenität der Fälle), FConfounding (nicht alle verbundenen Risikofaktoren werden berücksichtigt), Funzureichende statistische Power (die Rolle zufälliger Effekte ist nicht zu ermitteln) undFVerwendung von ungeeigneten statistischen Verfahren.
Bias
Selektionsbias − FehlklassifikationAusgangspunkt für die Erforschung jeder Erkrankung ist die Definition des Phänotyps. Ohne Definition, − aber auch mit widersprüchlichen Definitionen −, kommt es zu Fehlklassifikationen (ein Erkrankter wird für nicht erkrankt gehalten – und umgekehrt). Sie können erheblichen Einfluss auf alle Analysen zu Häufigkeit oder möglichen Einflussfaktoren haben.
Das Glaukom ist als eine Schädigung des Sehnerven und anderer Strukturen in Verbindung mit erhöhtem Intraokulardruck (IOD) definiert. Eine Definition für das Glaukom im Kindesalter könnte also wie folgt lauten:
FKombination von mit hohem IOD (>21 mmHg) zu vereinbarenden klinischen Befunden:1 Papillenexkavation 0,3 oder Papillenasymmetrie 0,2, 1 progrediente Papillenexkavation, 1 Buphthalmus, 1 vergrößerter Hornhautdurchmesser, 1 Hornhautödem, 1 Einrisse in der Descement-Membran/Haab-Leisten, 1 Gesichtsfeldausfälle und 1 progrediente Myopie [4].
Verwendet werden unterschiedliche Definitionen, in einigen Arbeiten wird gar keine Definition angegeben [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33]. In manchen Studien wird Glaukom definiert als erhöhter Druck und klinische Zeichen für diesen erhöhten Druck. Angewandt werden verschiedene IOD-Grenzwerte: 21 mmHg [6, 8, 9, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41] bzw. 25 mmHg [42, 43, 44, 45]; manche Autoren geben gar keinen Wert an [46, 47]. Andere definieren Glaukom lediglich als erhöhten IOD; auch sie gehen dabei von unterschiedlichen Werten aus, 21 [2, 48, 49] bzw. 25 mmHg [3, 5, 10, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57]. Wieder andere Autoren definieren Glaukom als erhöhten IOD oder klinische Zeichen für einen erhöhten IOD; [58, 59, 60]). Nach dieser Definition könnten also auch Kinder mit okularer Hypertension, aber ohne Glaukom in die Studie eingeschlossen worden sein.
Die Fehlklassifikation von APG ist deshalb von besonderer Bedeutung, da die Kornea von Patienten, die in den ersten fünf Lebensjahren an einer Katarakt operiert wurden, dicker ist als die „normaler“ Individuen [61, 62], es kommt also zu falsch-hohen IOD-Messwerten. Dadurch ist es in zahlreichen Untersuchungen zu einer falschen Einordnung des Operationsergebnisses – eine isolierte okulare Hypertension wurde als Glaukom klassifiziert – gekommen und zu Verzerrungen bei der Analyse möglicher APG-Assoziationen.
Selektionsbias – heterogene KollektiveDie bisher publizierten Arbeiten sind bezüglich der Patientenpopulationen sehr heterogen und haben als gemeinsamen Nenner lediglich Kinder mit Katarakt.
Verschiedene Arbeitsgruppen haben ihre Forschung entweder beschränkt auf Kinder mitFisolierter Katarakt, also ohne andere okulare oder systemische Erkrankungen [5, 10, 22, 39, 46,
63],
Fehlklassifikationen können Analysen zu Häufigkeit oder Einflussfaktoren verfälschen
Es bestehen unterschiedliche Definitionen für Glaukom und ver-schiedene IOD-Grenzwerte
Fehlerhafte Zuordnungen haben die Analyse möglicher APG-Assozia-tionen verzerrt
85Der Ophthalmologe 1 · 2012 |
CME
Feiner Katarakt in Verbindung mit Mikrophthalmus, Mikrokornea oder anderen Augenerkran-kungen [14, 34, 54] oder
FKataraktoperation im ersten bzw. ersten oder zweiten Lebensjahr [42, 43, 64, 65, 66].
Andere Autoren schlossen auch Kinder mit traumatischer Katarakt ein [30].Ein- und ausgeschlossene Kinder sind naturgemäß bezüglich einer APG-Entwicklung unter-
schiedlich disponiert, was bei der Analyse nicht immer entsprechend berücksichtigt wird. Diese Vermischung von Fällen wirkt sich ungünstig auf jeden Versuch aus, die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen miteinander zu vergleichen und aus einzelnen Studien allgemein gültige Schlüsse abzuleiten.
In den meisten der zahlreichen retrospektiven APG-Studien gibt es keine Angaben zum Lost-to-Follow-up-Anteil oder zum Case Mix [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46]. Es besteht also das Risiko einer verzerrten Erfassung, eines „ascertainment bias“ (Subtyp des Selektionsbias). Nur in einer retrospektiven Fallserie [47] gibt es explizite Angaben zum Lost-to- Follow-up-Anteil (29%). Zu ermitteln, ob andere Studien ähnliche Verlustquoten haben oder wie deren Berücksichtigung die Ergebnisse beeinflussen würde, ist nicht möglich.
Statistische Power: zufällige und signifikante Assoziationen und EffekteWenn eine Erkrankung oder ein Behandlungsergebnis selten ist, kann ein für die Ermittlung statistisch signifikanter Zusammenhänge hinreichender Stichprobenumfang schwierig zu errei-chen sein. An vielen der veröffentlichten Studien waren weniger als 30 Kinder beteiligt [3, 6, 9, 12, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 48, 49]. Daher ist es wenig wahrscheinlich, dass ihre statistische Power aus-reichte, um (sogar potenziell erhebliche) Effekte statistisch sinnvoll zu überprüfen.
Statistische Verfahren
Confounding (Vermengung), multivariate AnalyseMehrere relevante klinische Variablen, z. B. Alter bei Operation, Achsenlänge und Hornhautdurchmesser, stehen miteinander in Beziehung. Um das Confounding-Risiko zu minimieren, sind die Beziehungen zwischen den unterschiedlichen Variablen einerseits und dem APG-Risiko andererseits zu berücksichtigen. Dafür sind die Variablen präzise zu definieren und alle zugehörigen Informationen systematisch zu erheben. Beispielsweise wird eine Mikrokornea von man-chen Autoren als horizontaler Hornhautdurchmesser („horizontal corneal diameter“, HCD) ≤10 mm definiert, aber für ein Neugeborenes ist ein HCD von 9,5 mm physiologisch. Bei der Bewertung von Angaben zu Kindern vor Kataraktoperation muss also ihr Alter berücksichtigt werden [42].
Die belastbarste Methode zur Ermittlung von möglichen Beziehungen zwischen klinischen Variablen, z. B. Alter, Augenbefunden und Familienanamnese, ist die multivariate Analyse. Damit lässt sich nach Berücksichtigung jeweils anderer Variablen der unabhängige Effekt einer Variable auf das APG-Risiko ermitteln, außerdem Richtung und Ausmaß des Effekts einer Variablen auf eine andere Variable mit einem APG-Risiko. Nur in fünf der o. a. Studien wurde eine multivariate Ana-lyse durchgeführt, um Confounding explizit zu ermitteln und zu quantifizieren [37, 39, 42, 50, 51].
Multilevel-AnalyseBei einer Untersuchung von Risikofaktoren und möglichen Assoziationen ist die Struktur der Rohdaten in Betracht zu ziehen und es sind die ihnen am ehesten angemessenen statistischen Verfahren zu ver-wenden. Andernfalls kommt es zu ungenauen Analysen sowie zu Scheinkorrelationen, oft in Richtung falsch-hoher Einschätzung von Effekten. Die Verankerung in einer Multilevel-Struktur ergibt sich aus der Natur ophthalmologischer Daten. Bei einem Kind mit bilateraler Katarakt korreliert das Behand-lungsergebnis des rechten Auges eher mit demjenigen seines linken Auges als mit dem Behandlungs-ergebnis des rechten oder linken Auges eines anderen Kindes. Bleibt dies unberücksichtigt, kann es zu falschen Aussagen hinsichtlich klinischer Assoziationen kommen, in der Regel in Form kleinerer p-Werte und schmalerer Konfidenzintervalle, wobei Präzision und Signifikanz überschätzt werden.
Nur wenige Autoren haben sich mit intraindividuellen Abhängigkeiten befasst. Beispielsweise untersuchten Kirwan et al. [36] bei Kindern mit bilateraler Katarakt das Behandlungsergebnis von nur einem Auge. Egbert et al. [52] untersuchten Zusammenhänge auf der Ebene einzelner Patienten
Aufgrund der Vermischung von Fällen sind die Ergebnisse verschiedener Studien nicht gut miteinander vergleichbar
Zur Minimierung des Confounding sind die Variablen präzise zu definieren und zugehörige Informa-tionen systematisch zu erheben
Bei der Bewertung von Angaben zu Kindern vor Kataraktoperation ist das Alter zu berücksichtigen
Nur in wenigen Studien wurde zur Ermittlung/Quantifizierung von Confounding eine multivariate Analyse durchgeführt
Wird die Multilevel-Struktur nicht berücksichtigt, können sich falsche Aussagen hinsichtlich klinischer Assoziationen ergeben
86 | Der Ophthalmologe 1 · 2012
CME
statt bezogen auf die Augen, was die ohnehin schon schmale Datenbasis weiter einschränkt. Chak et al. [50], Swamy et al. [37] sowie Rabiah et al. [42] dagegen verwendeten statistische Methoden, um der Multilevel-Struktur Rechnung zu tragen. Auf diese Weise konnten sie Daten beider Augen verwenden und gleichzeitig die intraindividuellen Abhängigkeiten dieser Daten berücksichtigen.
Studiendesign
Für Aussagen zur APG-Prävalenz sind ausreichende Follow-up-Zeiten wichtig, denn ein Glaukom kann viele Jahre postoperativ auftreten. Weil die prospektive Erhebung der Daten von Kindern vor Kataraktoperation kostspielig und arbeitsaufwendig sein kann, sind viele Studien als retrospektive Fallserien angelegt (.Tab. 1). Methodisch hochwertige retrospektive Studien liefern zwar klinisch verwertbare, robuste Evidenz, doch dem retrospektiven Design sind prinzipielle Mängel eigen, u. a. unvollständige oder inkorrekte Datensätze bei nicht systematischer Aufnahme klinischer Daten in Patientenakten sowie durch „ascertainment bias“.
Prospektive Longitudinal- und Querschnittstudien, die eine systematische Datenerhebung mit geringerem Selektions- bzw. Fehlklassifikationsbias und eine Berücksichtigung von Confounding-Variablen ermöglichen, können robustere Informationen zu Häufigkeit und Assoziationen erbringen.
Trotz all dieser Einschränkungen gibt es klinisch relevante Aussagen zur Häufigkeit der Glaukom-entstehung nach Kataraktoperation im Kindesalter und zu möglichen Risikofaktoren.
Sekundärglaukom bei Kindern nach Kataraktoperation
Prävalenz
Nach Kataraktoperation im Kindesalter entwickelt sich in etwa 10–25% der aphaken und pseu-dophaken Augen bis zum zehnten postoperativen Jahr ein Glaukom [13, 20, 35, 42, 50, 52, 57, 64]. Die Studienkollektive bestehen aus Kindern, die zu verschiedenen Zeiten operiert wurden (manche in den ersten sechs Lebensmonaten, andere erst gegen Ende der Kindheit); dies könnte die unter-schiedlichen Angaben zur Prävalenz erklären. Große, populationsbasierte Longitudinalstudien zum Ergebnis nach Operationen bei kongenitaler Katarakt und Katarakt im Kindesalter haben immer wieder gezeigt, dass die Inzidenz mit zunehmender Follow-up-Dauer zunimmt [50, 52]; jährlich entwickeln etwa 5% aller operierten Augen ein Sekundärglaukom [50].
Risikofaktoren
Alter bei Kataraktoperation – entscheidender Faktor?Hohes Lebensalter zum Zeitpunkt der Operation stellt einen protektiven Faktor dar. Ein zehnfach höheres Alter zum Operationszeitpunkt (z. B. 30 statt 3 Tage), geht mit einer 60%igen Reduktion des Risikos für die Entwicklung eines APG einher (.Abb. 1). Werden andere Faktoren mittels multivariater Analyse berücksichtigt, ist das Alter zum Operationszeitpunkt der einzige signifikante bzw. der am stärksten signifikante Risikofaktor [37, 39, 42, 51]. Zwar ergab sich in einer 2009 publizierten Untersuchung [29] keine signifikante Assoziation zwischen Alter bei Operation und
Viele Studien sind als retrospektive Fallserien angelegt
Nach Kataraktoperation im Kindes-alter entwickelt sich in etwa 10–25% der aphaken und pseudo- phaken Augen bis zum 10. post- operativen Jahr ein Glaukom
Nach multivariater Analyse ist das Alter zum Operationszeitpunkt der einzige signifikante bzw. der am stärksten signifikante Risikofaktor
Tab. 1 Arbeiten zum Glaukom im aphaken und pseudophaken Auge
Art Anzahl und Quellenverweise
Populationsbasierte Kohortenstudie 4 [50, 51, 53, 54]
Randomisierte, kontrollierte Studie 1 [55]
Prospektive Kohortenstudie 2 [48, 52]
Querschnittstudie 4 [49, 56, 57, 58]
Fall-Kontroll-Studie 1 [59]
Prospektive Fallserien 2 [47, 60]
Retrospektive Fallserien 47 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 61]
„Expertenmeinung“ 2 [62, 63]
87Der Ophthalmologe 1 · 2012 |
CME
APG-Risiko, doch bei einer Nachbeobachtungszeit von nur zwei bis drei Jahren war die Zahl der Glaukompatienten für eine belastbare multivariate Analyse zu klein.
Zur Ermittlung des individuell „idealen“ Alters für eine Kataraktoperation ist es notwendig, das Amblyopierisiko gegen das Glaukomrisiko abzuwägen. Für ein „Schwellenwertalter“ der Katarakt-operation in der frühen Kindheit gibt es keine ausreichende Evidenz. Es lässt sich also nicht sagen, in welchem Lebensalter das Risiko für die Glaukomentstehung nach Kataraktoperation erheblich abfällt. Nach den bisherigen Studien liegt das „Schwellenwertalter“ weit jenseits des Alters, in dem eine Kataraktoperation gute Ergebnisse für das Sehvermögen erreichen kann: Rabiah et al. [42] sowie Swamy et al. [37, 37] verwendeten einen Ad-hoc-Cut-off-Wert von neun Monaten, ihnen zufolge trägt ein jüngeres Alter bei Operation zu einem erhöhten Sekundärglaukomrisiko bei [n=322, HR 7,0 (KI 3,6–13,7) und n=234, HR 2,9 (KI 1,3–7,7), jeweils multivariate Analyse].
Andere FaktorenMikrophthalmus und Mikrokornea sind nach univariater Analyse als Risikofaktoren anzusehen [54]. Nach multivariater Analyse zeigte sich eine bestehende Mikrokornea als einziger unabhängiger Risikofaktor für ein Glaukom [HR 3,7 (2,0–7,0; [37]) und HR 3,5 (2,5–5,1; [42])]. Persistierende fetale vaskuläre Strukturen („persistent fetal vasculature“; PFV) ließen sich nicht durchweg als signifikanter Risikofaktor identifizieren [35, 37]. Da sowohl PFV wie auch persistierender hyperplastischer primärer Glaskörper (Vitreus; „persistent hyperplastic primary vitreous“, PHPV), als Sammelbe-griffe verwendet werden, mit denen so unterschiedliche Befunde wie kleine Plaques an der hinteren Kapsel oder dichte Vaskularisierung der Kapsel mit verzogenen Ziliarfortsätzen beschrieben werden, können die fehlenden Korrelationen auch durch die Variabilität der Kollektive hervorgerufen sein. Anders als anfänglich gehofft, bieten Intraokularlinsen (IOLs) keinen Schutz vor einem Sekundär-glaukom [50]. Arbeiten, in denen von einer geringeren Glaukomprävalenz nach IOL-Implantation berichtet wird, beruhten auf hoch selektierten Kollektiven bzw. auf Kindern, die relativ spät in ihrem Leben operiert worden waren [4, 30, 40]. Es ist durchaus möglich, dass eine IOL-Implantation bei sehr jungen Kindern mit einem erhöhten Glaukomrisiko einhergeht: Nach ihrer randomisierten Stu-die, in der Kinder mit unilateraler Katarakt vor vollendetem sechsten Lebensmonat mit einer IOL versorgt worden waren, postulieren Lambert et al. [55] ein bei Pseudophakie erhöhtes Risiko für die frühe Entstehung eines Glaukoms.
Pathogenese
Wenn sich nach Operation einer kongenitalen oder infantilen Katarakt ein Offenwinkelglaukom entwickelt hat, sind mehrere anatomische Veränderungen beobachtet worden:F periphere anteriore Synechien [23, 65],F hohe Irisinsertion oder Verschmälerung des Ziliarbandes ([23, 58, 65]). Der Winkel ist in der
Ultraschallbiomikroskopie (UBM) wesentlich weniger geöffnet mit verkürzten Ziliarfortsätzen und Abflachung der Pars plicata [58].
F Membranen über dem Trabekelwerk F verstärkte Kammerwinkelpigmentierung [23, 65].
Gegeneinander abzuwägen sind das Amblyopierisiko und das Glaukomrisiko
Nach multivariater Analyse ist eine Mikrokornea der einzige unabhän-gige Risikofaktor für ein Glaukom
Intraokularlinsen (IOLs) schützen nicht vor einem Sekundärglaukom
Möglicherweise erhöht eine IOL-Implantation bei sehr jungen Kindern das Glaukomrisiko
0,4
0,3
0,2
0,1
00 1 2 3 4 5 6 7
Postoperatives Follow-up (Jahre)
Alter bei Diagnosestellung
2 Wochen
6 Wochen
3 Monate
1 JahrA
ntei
l von
Aug
en m
it G
lauk
om
Abb. 1 9 Entwicklung eines Offen-winkelglaukoms in operierten Augen je nach Alter bei Diagnosestellung (Nelson-Aalen-Kurve). Eine 10-fache Erhöhung des Alters bei Diagnose-stellung (in dieser Gruppe eng verknüpft mit dem Alter bei Ope-ration) ging mit einer 64%igen Ver-ringerung der Hazard Ratio für eine Glaukomentwicklung einher (95%-KI 41–79%; p<0,0001). (Aus [50], mit freundl. Genehmigung)
88 | Der Ophthalmologe 1 · 2012
CME
Daneben haben aphake und pseudophake Kinder mit und ohne Glaukom eine dickere Kornea [1, 2, 25, 49, 59, 1, 2, 25, 49, 59]. Außerdem besteht auch eine Assoziation zwischen Lebens-alter bei Operation und Korneadicke [2, 2]. Das weist darauf hin, dass Struktur wie Funktion des Trabekelwerks und der Kammerwinkel von einer Kataraktoperation ungünstig beeinflusst werden – und zwar während eines für Augenentwicklung und -wachstum kritischen Zeitabschnitts. Zur Entstehung dieser Veränderungen gibt es mehrere Hypothesen:
Intraokulare Entzündung. Die Entwicklung der Kammerwinkelstrukturen wird möglicherweise durch Faktoren vermittelt, die für Trabekelwerk toxisch sind, oder durch eine vom Linsenepithel aus-gehende alterierte Genexpression in Zellen des Trabekelwerks [67].
Chemische Effekte. Die Schädigung des Kammerwinkels wird möglicherweise vermittelt durch für die Trabekel toxische Faktoren aus dem Glaskörper [66] oder durch eine vom Linsenepithel ausgehende alterierte Genexpression in Zellen des Trabekelwerks [67].
Physikalisch-mechanische Effekte. Die perioperative mechanische Druckbelastung oder der durch die Linsenentfernung bedingte Verlust der Architektur können die Entwicklung des Kammerwinkels ungünstig beeinflussen.
Pseudophakes GlaukomDie aktuelle randomisierte, kontrollierte Studie von Lambert et al. [55] zeigte ein erhöhtes Risiko für einen perioperativen Irisprolaps und für einen Zweiteingriff. Beide Komplikationen führen zu weiteren intraokularen entzündlichen Reaktionen und können das Glaukomrisiko erhöhen. Wong et al. [29] beschrieben 2010 ein erhöhtes Glaukomrisiko nach komplizierter IOL-Implantation mit der Notwendigkeit einer Explantation bei Primäroperation.
Ausblick auf die künftige Forschung
Voraussetzung für eine Risikominimierung ist die Identifizierung der Faktoren, die im Rahmen der Kataraktoperation beeinflusst werden können. Die wichtigste Frage ist, ob es für die Kataraktchirurgie ein optimales Zeitfenster gibt, in dem durch Hinausschieben der Operation das Amblyopierisiko durch ein verringertes Risiko für ein Sekundärglaukom ausgeglichen wird. Auch die Auswirkungen einer primären IOL-Implantation müssen erforscht werden, besonders da die IOL Implantation zunehmend bei jüngeren Kindern erfolgt. Um die dafür notwendigen Stichprobenumfänge zu erreichen, ist eine Zusammenarbeit auf nationaler, vielleicht sogar internationaler Ebene notwendig. Der natürliche Verlauf nach Operation einer kindlichen Katarakt sollte mittels Longitudinalstudien (serielle Gonioskopien, IOD, Hornhautdicke, Ultraschallbiomikroskopie des vorderen Augenab-schnitts) erforscht werden. Dadurch lassen sich auch Veränderungen während des Intervalls bis zur Entwicklung eines Glaukoms erforschen oder Erkenntnisse zur „Überlebensrate“ gewinnen.
Die Daten zu den möglichen Risikofaktoren müssen systematisch und standardisiert erhoben werden. Eine genaue Krankheitsdefinition sowie explizite Ein- und Ausschlusskriterien sind nötig, um den Selektionsbias zu minimieren. Zur Vermeidung von anderen Einflussfaktoren sind außerdem multivariate Analysen notwendig. Schließlich sind adäquate Follow-up-Perioden (mindestens zehn Jahre) unbedingt erforderlich.
Von ganz besonderer Bedeutung ist die Berücksichtung epidemiologischer Kausalitätsprinzi-pien: Welche einzelnen Faktoren – bzw. welche Kombinationen von Faktoren – sind hinreichend, welche sind notwendig für die Entwicklung von Aphakie- bzw. Pseudophakieglaukomen?
All dies sollten pädiatrische Ophthalmologen berücksichtigen um sicherzustellen, dass das Kind, das im Jahr 2010 an einer Katarakt operiert wurde, optimale Aussichten darauf hat, auch im Jahr 2100 noch kein Glaukom entwickelt zu haben.
Struktur wie Funktion des Trabekel-werks und der Kammerwinkel wer-den von einer Kataraktoperation ungünstig beeinflusst
Die Effekte einer primären IOL-Implantation sind zu erforschen
Notwendige Stichprobenumfänge erfordern Zusammenarbeit auf (inter)nationaler Ebene Mittels Longitudinalstudien sollte der natürliche Verlauf nach Opera-tion einer kindlichen Katarakt erforscht werden
Genaue Definitionen und explizite Ein-/Ausschlusskriterien minimieren den Selektionsbias
89Der Ophthalmologe 1 · 2012 |
CME
1. Nilforushan N, Falavarjani KG, Razeg-hinejad MR, Bakhtiari P (2007) Cata-ract surgery for congenital cataract: endothelial cell characteristics, cor-neal thickness, and impact on intrao-cular pressure. J AAPOS 11(2):159–161
2. Muir KW, Duncan L, Enyedi LB et al (2007) Central corneal thickness: congenital cataracts and aphakia. Am J Ophthalmol 144(4):502–506
3. Lu Y, JI YH, Luo Y et al (2010) Visu-al results and complications of pri-mary intraocular lens implantati-on in infants aged 6 to 12 months. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 248(5):681–686
4. Astle WF, Alewenah O, Ingram AD, Paszuk A (2009) Surgical outcomes of primary foldable intraocular lens implantation in children: understan-ding posterior opacification and the absence of glaucoma. J Cataract Ref-ract Surg 35(7):1216–1222
5. Magli A, Fimiani F, Passaro V, Iovine A (2009) Simultaneous surgery in bila-teral congenital cataract. Eur J Opht-halmol 19(1):24–27
6. Vasavada VA, Dixit NV, Ravat FA et al (2009) Intraoperative performan-ce and postoperative outcomes of cataract surgery in infant eyes with microphthalmos. J Cataract Refract Surg 35(3):519–528
7. Magli A, Fimiani F, Bruzzese D et al (2008) Congenital cataract extracti-on with primary aphakia and secon-dary intraocular lens implantation in the posterior chamber. Eur J Opht-halmol 18(6):903–909
8. Haargaard B, Boberg-Ans G, la Cour M, Henning V (2009) Outcome after paediatric cataract surgery in other-wise healthy children. Acta Ophthal-mol 2009 87(8):923–925
9. Lundvall A, Zetterstrom C (2006) Pri-mary intraocular lens implantati-on in infants: complications and vi-sual results. J Cataract Refract Surg 32(10):1672–1677
10. Cakmak SS, Caca I, Unlu MK et al (2006) Surgical technique and post-operative complication s in conge-nital cataract surgery. Med Sci Monit 12(1):CR31–CR35
11. Lawrence MG, Kramarevsky NY, Christiansen SP et al (2005) Glau-coma following cataract surgery in children: surgically modifiable risk factors. Trans Am Ophthalmol Soc 103:46–55
12. Petric I, Lacmanovic L (2004) V. Sur-gical technique and postoperative complications in pediatric cataract surgery: retrospective analysis of 21 cases. Croat Med J 45(3):287–291
13. Vishwanath M, Cheong-Leen R, Tay-lor D et al (2004) Is early surge-ry for congenital cataract a risk fac-tor for glaucoma? Br J Ophthalmol 88(7):905–910
14. Lundvall A, Kugelberg U (2002) Out-come after treatment of congenital unilateral cataract. Acta Ophthalmol Scand 80(6):588–592
15. Lundvall A, Kugelberg U (2992) Out-come after treatment of congenital bilateral cataract. Acta Ophthalmol Scand 80(6):593–597
16. Cassidy L, Rahi J, Nischal K et al (2001) Outcome of lens aspiration and intraocular lens implantation in children aged 5 years and under. Br J Ophthalmol 85(5):540–542
17. O’Keefe M, Fenton S, Lanigan B (2001) Visual outcomes and compli-cations of posterior chamber intrao-cular lens implantation in the first year of life. J Cataract Refract Surg 27(12):2006–2011
18. Brady KM, Atkinson CS, Kilty LA, Hiles DA (1997) Glaucoma after cataract extraction and posterior chamber lens implantation in children. J Cata-ract Refract Surg 23 (Suppl 1):669–674
19. Phelps CD, Arafat NI (1997) Open-angle glaucoma following surgery for congenital cataracts. Arch Opht-halmol 95(11):1985
20. Michaelides M, Bunce C, Adams GG (2007) Glaucoma following congeni-tal cataract surgery − the role of ear-ly surgery and posterior capsuloto-my. BMC Ophthalmol 7:13
21. Lundvall A, Zetterstrom C (1999) Complications after early surgery for congenital cataracts. Acta Ophthal-mol Scand 77(6):677–680
22. Nishina S, Noda E, Azuma N (2007) Outcome of early surgery for bila-teral congenital cataracts in eyes with microcornea. Am J Ophthalmol 144(2):276–280
23. Koc F, Kargi S, Biglan AW et al (2006) The aetiology in paediatric aphakic glaucoma. Eye 20(12):1360–1365
24. Kang KD, Yim HB, Biglan AW (2006) Comparison of delayed-onset glau-coma and early-onset glaucoma af-ter infantile cataract surgery. Korean J Ophthalmol 20(1):41–46
25. Biglan AW (2006) Glaucoma in chil-dren: are we making progress? J AA-POS 10(1):7–21
26. Ariturk N, Oge I, Mohajery F et al (1998) Secondary glaucoma af-ter congenital cataract surgery. Int Ophthalmol 22(3):175–80
27. Mori M, Keech RV, Scott WE (1997) Glaucoma and ocular hypertension in pediatric patients with cataracts. J AAPOS 1(2):98–101
28. Wallace DK, Plager DA (1996) Cor-neal diameter in childhood apha-kic glaucoma. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 33(5):230–234
29. Wong IB, Sukthankar VD, Cortina-Borja M, Nischal KK (2009) Incidence of early-onset glaucoma after infant cataract extraction with and without intraocular lens implantation. Br J Ophthalmol 1200–1203
30. Asrani S, Freedman S, Hasselblad V et al (2000) Does primary intraocu-lar lens implantation prevent „apha-kic“ glaucoma in children? J AAPOS 4(1):33–39
31. Miyahara S, Amino K, Tanihara H (2002) Glaucoma secondary to pars plana lensectomy for congenital ca-taract. Graefes Arch Clin Exp Opht-halmol 240(3):176–179
32. Asrani SG, Wilensky JT (1995) Glau-coma after congenital cataract sur-gery. Ophthalmology 102(6):863–867
33. Mills MD, Robb RM (1994) Glaucoma following childhood cataract surge-ry. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 31(6):355–360
34. Kuhli-Hattenbach C, Luchtenberg M, Kohnen T, Hattenbach LO (2008) Risk factors for complications after con-genital cataract surgery without in-traocular lens implantation in the first 18 months of life. Am J Ophthal-mol 146(1):1–7
35. Watts P, Abdolell M, Levin AV (2003) Complications in infants undergoing surgery for congenital cataract in the first 12 weeks of life: is early surgery better? J AAPOS 7(2):81–85
Korrespondenzadresse
Prof. Dr. F. GrehnUniversitäts-Augenklinik der Julius-Maximilians-UniversitätJosef-Schneider-Str. 11, 97080 Wü[email protected]
Interessenkonflikt. Keine Angaben
Literatur
90 | Der Ophthalmologe 1 · 2012
CME
36. Kirwan C, Lanigan B, O’Keefe M (2010) Glaucoma in aphakic and pseudophakic eyes following sur-gery for congenital cataract in the first year of life. Acta Ophthalmol 88(1):53–59
37. Swamy BN, Billson F, Martin F et al (2007) Secondary glaucoma af-ter paediatric cataract surgery. Br J Ophthalmol 91(12):1627–30
38. Bhola R, Keech RV, Olson RJ, Petersen DB (2006) Long-term outcome of pe-diatric aphakic glaucoma. J AAPOS 10(3):243–248
39. Chen TC, Bhatia LS, Halpern EF, Wal-ton DS (2006) Risk factors for the development of aphakic glauco-ma after congenital cataract surge-ry. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 43(5):274–280
40. Trivedi RH, Wilson MEjr, Golub RL (2006) Incidence and risk factors for glaucoma after pediatric cata-ract surgery with and without in-traocular lens implantation. J AAPOS 10(2):117–123
41. Chen TC, Walton DS, Bhatia LS (2004) Aphakic glaucoma after congenital cataract surgery. Arch Ophthalmol 122(12):1819–1825
42. Rabiah PK (2004) Frequency and pre-dictors of glaucoma after pediatric cataract surgery. Am J Ophthalmol 137(1):30–37
43. Johnson CP, Keech RV (1996) Pre-valence of glaucoma after surge-ry for PHPV and infantile cataracts. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 33(1):14−17
44. Parks MM, Johnson DA, Reed GW (1993) Long-term visual results and complications in children with apha-kia. A function of cataract type. Ophthalmology 100(6):826–840
45. Keech RV, Tongue AC, Scott WE (1989) Complications after surgery for congenital and infantile cataracts. Am J Ophthalmol 15;108(2):136–141
46. Al-Dahmash S, Khan AO (2010) Aphakic glaucoma after cataract sur-gery for isolated nontraumatic pe-diatric cataract. Eye Contact Lens 3:000000
47. Kugelberg M, Kugelberg U, Bobrova N et al (2006) Implantation of sing-le-piece foldable acrylic IOLs in small children in the Ukraine. Acta Opht-halmol Scand 84(3):380–383
48. Plager DA, Yang S, Neely D et al (2002) Complications in the first year following cataract surgery with and without IOL in infants and older chil-dren. J AAPOS 6(1):9–14
49. Simon JW, O’Malley MR, Gandham SB et al (2005) Central corneal thick-ness and glaucoma in aphakic and pseudophakic children. J AAPOS 9(4):326–329
50. Chak M, Rahi JS (2008) Incidence of and factors associated with glauco-ma after surgery for congenital cata-ract: findings from the British Conge-nital Cataract Study. Ophthalmology 115(6):1013–1018
51. Haargaard B, Ritz C, Oudin A et al (2008) Risk of glaucoma after pedia-tric cataract surgery. Invest Ophthal-mol Vis Sci 49(5):1791–1796
52. Egbert JE, Christiansen SP, Wright MM et al (2006) The natural history of glaucoma and ocular hypertensi-on after pediatric cataract surgery. J AAPOS 10(1):54–57
53. Papadopoulos M, Cable N, Rahi J, Khaw PT (2007) The British Infanti-le and Childhood Glaucoma (BIG) Eye Study. Invest Ophthalmol Vis Sci 48(9):4100–4106
54. Magnusson G, Abrahamsson M, Sjostrand J (2000) Glaucoma follo-wing congenital cataract surgery: an 18-year longitudinal follow-up. Acta Ophthalmol Scand 78(1):65–70
55. Lambert SR, Buckley EG, Drews-Botsch C et al (2010) A randomi-zed clinical trial comparing contact lens with intraocular lens correcti-on of monocular aphakia during in-fancy: grating acuity and adverse events at age 1 year. Arch Ophthal-mol 128(7):810–818
56. Simon JW, Mehta N, Simmons ST et al (1991) Glaucoma after pediatric lensectomy/vitrectomy. Ophthalmo-logy 98(5):670–674
57. Egbert JE, Wright MM, Dahlhauser KF et al (1995) A prospective study of ocular hypertension and glauco-ma after pediatric cataract surgery. Ophthalmology 102(7):1098–1101
58. Nishijima K, Takahashi K, Yamakawa R (2000) Ultrasound biomicroscopy of the anterior segment after conge-nital cataract surgery. Am J Ophthal-mol 130(4):483–489
59. Simsek T, Mutluay AH, Elgin U et al (2006) Glaucoma and increased cen-tral corneal thickness in aphakic and pseudophakic patients after conge-nital cataract surgery. Br J Ophthal-mol 90(9):1103–1106
60. Birch EE, Cheng C, Stager DR et al (2009) The critical period for surgical treatment of dense congenital bila-teral cataracts. J AAPOS 13(1):67–71
61. Tatham A, Odedra N, Tayebjee S et al (2010) The incidence of glaucoma following paediatric cataract surge-ry: a 20-year retrospective study. Eye (Lond) 24(8):1366–1375
62. Francois J (1979) Late results of con-genital cataract surgery. Ophthalmo-logy 1586–1598
63. Laval J, Silverman S (1965) Complica-tions of congenital cataract surgery. Int Ophthalmol Clin 5:55–79
64. Khan AO, Al-Dahmesh S (2009) Age at the time of cataract surgery and relative risk for aphakic glaucoma in nontraumatic infantile cataract. J AAPOS 13(2):166–169
65. Walton DS (1995) Pediatric apha-kic glaucoma: a study of 65 patients. Trans Am Ophthalmol Soc 93:403–413
66. Chang S (2006) LXII Edward Jack-son lecture: open angle glaucoma after vitrectomy. Am J Ophthalmol 141(6):1033
67. Michael I, Shmoish M, Walton DS, Le-venberg S (2008) Interactions bet-ween trabecular meshwork cells and lens epithelial cells: a possible me-chanism in infantile aphakic glau-coma. Invest Ophthalmol Vis Sci 49(9):3981–3987
91Der Ophthalmologe 1 · 2012 |
?Wie hoch ist die Inzidenz postoperativ über 10 Jahre eines Aphakie-/Pseudo-phakieglaukoms (APG) im Kindesalter?
o 2−5%o10−25% o25−40%o40−60%o>60%
?Wie hoch ist der Anteil des APGs an kind-lichen Sekundärglaukomen in industria-lisierten Ländern?
oetwa 5%oetwa 10%oetwa 20%oetwa 33%oetwa 50%
?Welcher klinische Befund passt nicht zur Definition eines Glaukoms im Kindes-alter?
oprogrediente HyperopieoHaab-LeistenoHornhautödemoBuphthalmusovergrößerter Hornhautdurchmesser
?Wie viele Kinder weltweit erblinden nach einer Operation der kongenitalen Katarakt?
oeines von 50oeines von 25oeines von 15oeines von 7oeines von 3
?Welches ist – nach multivariater Analyse – der einzige unabhängige Risikofaktor für ein APG im Kindesalter?
oPHPV („persistent hyperplastic primary vitreous“)
oAlter bei OperationoMikrokorneaoAchsenlängeoAphakieglaukom am anderen Auge
?Welche Aussage zum kindlichen Pseudo-phakieglaukom trifft nicht zu?
o erhöhtes Glaukomrisiko bei Vorliegen eines PHPV
oerhöhtes Risiko eines Zweiteingriffsoerhöhtes Risiko einer postoperativen
intraokularen Entzündungsreaktionoerhöhtes Glaukomrisiko nach komplizier-
ter IOL-ImplantationoSchutz vor Sekundärglaukom durch
unkomplizierte IOL-Implantation
?Welche Aussage zum Alter bei Katarakt-operationen im Kindesalter trifft zu?
oDas Alter zum Operationszeitpunkt ist der am stärksten signifikante Risikofaktor bezüglich einer Glaukomentwicklung.
oEin 10-fach höheres Alter zum Operations-zeitpunkt geht mit einem 10-fach erhöh-ten APG-Risiko einher.
oDas „Schwellenalter“ für eine Kataraktope-ration liegt bei etwa fünf Jahren.
oEin früher Operationszeitpunkt verstärkt die Amblyopieentwicklung.
oEin niedriges Lebensalter zum Operations-zeitpunkt stellt einen protektiven Faktor bezüglich der Entwicklung eines kindli-chen Glaukoms dar.
?Welches ist/sind keine typische Verände-rung/en nach Operation einer infantilen/kongenitalen Katarakt mit Offenwinkel-glaukom?
operiphere anteriore Synechienohohe IrisinsertionoMembranen über dem Trabekelwerkovermehrte Kammerwinkelpigmentierungoverminderte Hornhautdicke im Vergleich
zum Normalkollektiv
?Welche Aussage zum APG nach Katarakt-operation im Kindesalter trifft nicht zu?
oDie meisten Kinder müssen mehrfach operiert werden.
oFast 50% der Kinder haben eine erhebliche Visuseinschränkung.
oEs besteht ein lebenslang erhöhtes Glaukomrisiko.
oDas funktionelle postoperative Ergebnis kann durch das Sekundärglaukom schlechter sein als bei nicht operierter Katarakt mit Ambylopie.
oModerne mikrochirurgische (Vitrektomie-)Techniken verhindern nicht das Auftreten von Winkelblockglaukomen.
?Welches ist die belastbarste Methode zur Ermittlung von möglichen Beziehungen zwischen klinischen Variablen (Alter, Augenbefund, Familienanamnese) eines APGs?
oeine Multilevel-Analyseomultivariate AnalyseoErmittlung der statistischen AussagekraftoBestimmung der SelektionsbiasoErmittlung der Bias durch
Fehlklassifikation
Diese Fortbildungseinheit ist 12 Monate auf CME.springer.de verfügbar.Den genauen Einsendeschluss erfahren Sie unter CME.springer.de
D Mitmachen, weiterbilden und CME-Punkte sichern durch die Beantwortung der Fragen im Internet unter CME.springer.de
92 | Der Ophthalmologe 1 · 2012
Bitte beachten Sie: F Antwortmöglichkeit nur online unter:
CME.springer.deF Die Frage-Antwort-Kombinationen werden
online individuell zusammengestellt. F Es ist immer nur eine Antwort möglich.
CME-Fragebogen kostenfreie Teilnahme für Abonnenten