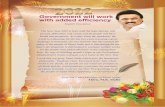Der Sauerstoffverbrauch der Wasserpflanzen bei verschiedenen Sauerstoffspoannungen..
Anschlußverhalten in totalitärer Gesellschaft zwischen Pathos und Ethos: Zur Rezeptionsanalyse der...
Transcript of Anschlußverhalten in totalitärer Gesellschaft zwischen Pathos und Ethos: Zur Rezeptionsanalyse der...
Kirill Postoutenko
Anschlußverhalten in totalitärer Gesellschaft zwischen Pathos und Ethos: Zur
Rezeptionsanalyse der Rede von Joseph Stalin auf dem VIII Sowjetkongress der UdSSR
am 8. November 1936
1.Der verlorene Logos? Die Überredungsmechanismen der phatischen Kommunion
Die Meinung, dass Kommunikation ein System ist, ist in der heutigen Wissenschaft im
Großen und Ganzen stillschweigend akzeptiert. Dass diese Akzeptanz zur Revision der
vorherrschenden Vorstellungen über Interaktion verpflichtet, wird aber selten zur Kenntnis
genommen.1 Wie jede autopoetische Einheit, kümmert sich ein kommunikatives System
hauptsächlich um seine Ganzheit:2 aus diesem Grund kann sie bestimmte soziale Normen, die
im allgemeinen gesellschaftliche Interaktion durchaus bestimmen mögen, im konkreten Fall
übergehen. Die von Paul Grice genannten Maximen, nämlich: „Do not say what you believe
to be false […] Do not say that for which you lack adequate evidence […] Be relevant […]
Be perspicuous […] Avoid obscurity of expression […] Avoid ambiguity […] Be brief […]
Be orderly“3 , dürften vor allem dann nicht recht beherzt werden, wenn dies die Existenz des
kommunikativen Systems selbst gefährden könnte. Anders ausgedrückt: Wenn diese oder
andere ähnliche Normen zu restriktiv sind, um den Bestand des Systems zu garantieren,
erscheinen eine systematische Lüge, ein zweideutiger Ausdruck oder ein
konfliktvermeidender Themenwechsel beiuspielsweise durchaus opportun. Vor allem in der
politischen Kommunikation scheint solch ein Verhalten eher die Regel als die Ausnahme zu
sein. Für die Selbsterhaltung der notorisch instabilen totalitären Gesellschaft schien es, folgt
man Nikita Khrushchovs Erinnerungen, sogar charakteristische, dass Stalin sogar sich selbst
regelmäßig zu täuschen vermochte.4 Ironischerweise argumentieren sogar die Kritiker der
1 Das betrifft sogar die Standardwerke der Kommunikationsgechichte (siehe: Kittler F. Discourse Networks,
1800/1900. Stanford 1990, 53; Giesecke M. Die Entdeckung der kommunikativen Welt. Frankfurt am Main
2007, 142).
2 Bertalanfy L v.. General System Theory: Foundations, Development, Applications. New York 1969, 37-41;
Watzlawick P, Bavelas J. B. &, Jackson D. D. Pragmatics of Human Communication. New York 1967, 121-
122.
3 Grice H. P.. Studies by Way of Words. Cambridge, MA 1989, 27.
4 Tucker R. C. The Soviet Political Mind. Stalinism and Post-Stalin Change. New York 1971, 41-42.
griceschen Normativität normativ und scheinen mit der dadurch entstehenden Paradoxie gut
leben zu können: „[Grice] assumes that the goal of communication is to succeed, solve
problems and communicate effectively, and ignores that sometimes the goal is to
miscommunicate. […] It is basically asocial“5. Unter diesen Umständen wundert es wenig,
dass die öffentliche Nutzung der Sprache in der Nazizeit – ganz nach dem Vorbild von John
Locke und der darauffolgenden Bewegung im Rahmen der Aufklärung – als „Missbrauch der
Sprache“ pauschal abgetan wird.6
Fernerhin dürfte kaum mehr jemand, vor allem kein Vertreter der systemtheoretischen
Kommunikationswissenschaft heute mehr annehemen wollen, dass Kommunikation trotz
ihrer offensichtlichen Irreversibilität einem Fortschritt oder anderer a priori festgestellten
Teleologie des menschlichen Beobachters – zumindest auf Dauer – untergeordnet ist.
Stattdessen wird der historische Determinismus in die Kommunikationsgeschichte durch die
Hintertür – ex negativo – hereingelassen: so verweist z. B. Niklas Luhmann auf einfache,
schriftunkundige Stammesgesellschaften, für die eine funktionelle Ausdifferenzierung der
Gesellschaft im Allgemeinen (Handlung vs. Kommunikation) und der Interaktion im
Besonderen (Mitteilung vs. Information) „noch“ nicht angenommen werden kann:
In schriftlosen tribalen Gesellschaften scheint Kommunikation primär dem laufenden
Solidaritätstest zu dienen, also Zugehörigkeit, guten Willen, Friedfertigkeit zu
dokumentieren. Der Schwerpunkt liegt in der Selbstcharakterisierung des Mitteilenden
(und dies gerade deshalb, weil dies nicht Mitteilungsinhalt, nicht „Text“ wird). Wer
schweigt, macht sich verdächtig, macht einen gefährlichen Eindruck – so als ob er Böses
im Sinn habe, über das er nicht reden wollte.7
5 Ladegaard H. J. Pragmatic Cooperation Revisited: Resistance and Non-Cooperation as a Discursive Strategy in
Asymmetrical Discourses. In: Journal of Pragmatics 42 (2009), 649.
6 Siehe: Bork S. Missbrauch der Sprache: Tendenzen nationalsozialistischer Sprachregelung. Bern 1970. Vgl.
die terminologische Vorgeschichte: „Das Unternehmen der Klärung und Reinigung der Begriffe, das
bekanntlich den Kampf gegen den „Missbrauch der Wörter“ ausdrücklich einschloss, wurde mit großem Elan
[...im 18. Jahrhundert...] begonnen. Von der philosophischen Begriffsform wurde erwartet, dass sie das Wissen
vor Fremdbezügen bewahrt, indem sie es auf jene zweifelsbereinigte Erkenntnis festlegt, die der Begriff
bezeichnet.“ (Konnersmann R. Wörter und Sachen. Zur Deutungsarbeit der Historischen Semantik. In: Müller
E. (Hrsg.): Begriffsgeschichte im Umbruch? Hamburg 2005, 29). Die viel diskutierte Frage, inwiefern es
überhaupt sinnvoll ist, den „absoluten Diskurs“ [Marquard, O. Individuum und Gewalteinteilung:
Philosophische Studien. Stuttgart, 2003, 52] dieser Art zu verwenden, soll hier beiseite gelassen; es geht nur
darum, dass diese Verwendung, berechtigt oder nicht, mit der Vorstellung von Kommunikation als System
wenig zu tun hat.
7 Luhmann N. Die Realität der Massenmedien. Wiesbaden 2009, S. 102.
Diese Projektion der Hegelschen Allegorie des selbst-entfremdeten Geistes auf Georg
Simmels Gesellschaftstheorie setzt offensichtlich voraus, dass die Evolution eines
Kommunikationssystem mit seiner allmählichen und unaufhaltsamen Differenzierung
identisch ist. 8 Dadurch wird jede auf phatische Kommunikation fixierte Gesellschaft
historisch auf die Entwicklungsstufe der „Wilden“ zurückgesetzt, wie es in der von Luhmann
zustimmend erwähnten Bedeutungstheorie von Bronislaw Malinowski geschieht.9 Leider hat
diese Etikette - wie der oben angesprochene angebliche ‚Missbrauch der Sprache‘ - viel mit
der ex-post Rationalisierung der Kommunikationsgeschichte und wenig mit der eigentlichen
Funktionierung des Kommunikationssystems zu tun. Es scheint deswegen angebracht, sich
vom blinden Glauben an den Logos zu verabschieden und eine konsistent systemische
Erklärung der kommunikativen Besonderheit dieser oder jener ‚rückständigen‘
Gesellschaften auch des 20. Jahrhunderts zu erarbeiten.
2. Der Fall Koff: Soziale und kommunikative Entdifferenzierung im privaten Feedback zur
Rede Stalins
Ende Februar 1937 schrieb der „verdiente Künstler der russischen Föderation“ Leonid Koff
an den Vorsitzenden des Zentralen Exekutivkomitees der UdSSR Michail Kalinin. Der Brief,
der sich im Russischen Staatsarchiv der sozialen und politischen Geschichte befindet, wurde
im Sekretariat Kalinins am 8. März registriert.10
Die Sendung enthielt ein Foto (Abb.1) – das
stark retuschierte Selbstbild vom Koff beim konzentrierten und nachdenklichen Lesen eines
Zeitungsberichts über den 8. außerordentlichen Sowjetkongress der UdSSR (25. November –
5. Dezember 1936). Anscheinend ging es um eine Simulation, da das von Koff aufmerksam
8 Siehe: Hegel G. W. F. Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte [1831]. In: Hegel G. W. F. Werke.
Band 12. Frankfurt am Main 1995, 28, 32; Simmel G. Über soziale Differenzierung. In: Simmel G. Aufsätze
1887 bis 1890. Über soziale Differenzierung. Die Probleme der Geschichtsphilosophie. Frankfurt am Main
[1890] 1989, 109-297.
9 Luhmann verweist unter anderem auf Bronislav Malinowski, der den „Wilden“ eine „phatische
Gemeinschaft“zugeschrieben hat (Malinowski B. The Problem of Meaning in Primitive Languages. In: Ogden,
Ch. K & Richards I. A. The Meaning of Meaning. New York, 1923, 315-316). Allerdings räumte der Letzte im
selben Atemzug ein, dass „wir“ uns manchmal genauso wie diese „Wilden“ halten (vgl. die Ironie von Vilém
Flusser über die angeblichen „tribalistischen Kommunikationsformen“: Flusser V. Kommunikologie. Frankfurt
am Main 1998, 35).
10
RGASPI 78.1.588, 9-11.
gelesene Blatt Papier – trotz seiner unmissverständlichen visuellen Ähnlichkeit mit dem
Layout von Pravda und Izvestija – mit keiner konkreten Ausgabe dieser Zeitungen
identifizierbar ist. Diese plumpe Inszenierung - wie kann man sich selbst beim vertieften
Lesen erwischen? - scheint im Kontext des Textteils des Briefes, der sich wieder und wieder
mit der Rezeption der Rede „Über den Entwurf der Verfassung der UdSSR" befasst, die
Joseph Stalin am Kongress gehalten hat, aber zweifellos weniger befremdlich.
Die soziale und darauf folgend auch die kommunikative Entdifferenzierung läßt sich
im Brief auf verschiedenen Ebenen vefolgen. Einerseits vermischt der Verfasser digitale und
analoge Interaktionsmodie, indem er die Herstellung eines Porträts von Joseph Stalin als eine
angemessene Antwort auf dessen Vortrag am 8. Parteikongress betrachtet:
„Lieber Mikhail Iwanowitch, Ich habe die Vortrage vom teueren Führer der Völker, dem
Genosse Stalins, und von Ihnen im Radio gehört. Ich war so bezaubert von den Vortragen, ihrer
Tiefe und Staatsmänischkeit, daß ich sie mehrmals gelesen und wiedergelesen habe, und ich
habe beschlossen, mein Entzücken in meinen schöpferischen, artistischen Werken: ich will die
große Porträts in Lebensgröße, in Öl, malen: [u. A.] Den Portrat vom teueren I. V. Stalin“ 11
Das ist sicher kein übliches kommunikatives Verhalten: bei der Besprechung eines
Vortrags erwartet man meistens Wörter und keine Bilder.12
Nach heutiger Ansicht würde
solcher Art „code-switching“ jedoch kaum den Rahmen strategischer Kommunikation
sprengen;13
und natürlich fand dergleichen breite Verwendung unter „totalitären“
Verhältnissen: In Nazideutschland waren auf jeden Fall die Bitten der Bevölkerung um
Zusendung signierter Hitler-Bilder ein Massenphänomen.14
Auch unter scharfsinnigen
Beobachtern des bolschewistischen Staates blieb dieser Sachverhalt nicht unbemerkt: Im
antisowjetischen Roman von Arthur Koestlers Darkness at Noon sagten dem regimetreuen
11
“Дорогой Михаил Иванович, я слышал по радио доклады на VIII-м чрезвычайном Съезде Советов
дорогого вождя народов И. В. СТАЛИНА и также Вас. Я так зачарован докладами, глубиной их и
государственностью, что много раз читал и перечитывал доклады и решил свой восторг отразить в своих
творческих, художественных работах, - хочу написать большие портреты в натуральную величину,
масляными красками. Портрет дорогого И. В. СТАЛИНА“ (Op. cit., 9-10).
12
Siehe: Argyle M., Furnham A. & Graham J. A. Social Situations. Cambridge 1981, 295.
13
Siehe: Woolard K. A. Codeswitching. In: Alessandro Duranti (Hrsg.) A Companion to Linguistic
Anthropology. Malden, MA 2004, 90; Levinson S C. On the Human “Interaction Engine.” In: Enfield N. G &
Levinson S. C. (Hrsg.): Roots of Human Sociality. Oxford 2006, 41;
14
Siehe: Eberle, H. (Hrsg.). Briefe an Hitler. Bergisch Gladbach, 2007, 160.
Pförtner Vassilij das Bild und die inszenierte Intonationen des verehrten Herrschers mehr zu
als der verbale Inhalt seiner Rede:
Usually Vasily fell asleep in the middle of these speeches, but always woke up when his
daughter came to the final sentences and the applause, solemnly raising her voice. To
every one of the ceremonial endings, ‘Long live the International! Long live the
Revolution! Long live No. 1,’ Vasily added a heartfelt ‘Amen’ under his breath, so that
the daughter should not hear it; then took his jacket off, crossed himself secretly and with
a bad conscience and went to bed. Above his bed also hung a portrait of No. 1.15
Viel auffälliger im Brief Koffs ist die mehrfache Einblendung grundlegender sozialer und
kommunikativer Differenzierungen, z. B. die zwischen biologischer Person und sozialer
Rolle, oder die zwischen Mitteilung und Information.16
Erstens antwortet Koff auf den
öffentlichen Auftritt des höchsten Partei- und Staatsfunktionärs mit der Bitte, die Bilder von
ihm als Privatperson („im familiären Kreis nicht-offizieller Art“) zu erhalten.17
Zweitens hebt
er maßlos die Tatsache seines Empfanges der Mitteilung hervor (gehört... mehrmals gelesen
und wiedergelesen... [+ das Bild]), wobei die eigentliche Reaktion auf die darin enthaltene
Information vergleichsweise bescheiden ausfällt (bezaubert... Tiefe und Staatsmänischkeit...
das Entzücken). Auch in diesen Fällen kommt die oben umrissene soziale und
kommunikative Entdifferenzierung nicht ganz überraschend. Einerseits sind die sowjetischen
Archive voll von Briefen an Joseph Stalin, Michail Kalinin und Vjačeslav Molotov, die ein
tiefes Misstrauen gegen die öffentliche Interaktion zum Ausdruck bringen und einen privaten
Kontakt mit diesem oder jenem Machthaber unter vier Augen suchen.18
Andererseits belegt
das Studium von Richard Wintrobe, dass die geringe Stabilität des sowjetischen
Kommunikationssystems der Stalinzeit zur ungewöhnlichen Intensität und Explizität seiner
basalen Selbstreferenz führte:
15
Koestler, A. Darkness at Noon [1941]. Harmondsworth 1969, 12-13.
16
Die Unterscheidungen beziehen sich auf folgende Taxonomien: Siehe unter anderem Laswell, H. The
Structure and Function of Communication in Society. In: Schramm, W. (Hrsg.): Mass Communications. Urbana,
IL 1960, 119; Luckmann, Th. Persönliche Identität, soziale Rolle und Rollendistanz. In: Marquard, O. &
Stierle, K. (Hrsg.): Identität: Poetik und Hermeneutik. Bd. VIII, München 1979; 293-313; Luhmann, N.. Soziale
Systeme: Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main 1987, 193-195.
17
“Все просимые фотографии желательно, конечно, самые лучшие и самое главное, что бы они были
засняты в семейных обстановках неоффициального характера” (RGASPI 78.1.588, 9-11, 10).
18
Für 1936 alleine siehe z. B. den Brief von A. Kalinovskij an Mikhail Kalinin (10. Januar) und den Brief von
B. Agapov an Sergo Ordzhonikidse (20. April) (Livshin A. Ia, Orlov I. B. & Khlevniuk O. V. Pis’ma vo vlast’.
1928-1939. Moskva 2002, 290, 296).
the dictator and the subjects have a problem of credibly “signaling” support or trust in
one another. […] This is not the content of the message but the number of times it is
repeated (the magnitude of the party’s investments in its promises) that contributes to
reputation and promotes loyalty. Of course, words are cheap – hence why would Pravda
devote two-thirds of its space for nine months to the publication of greetings to Stalin on
the occasion of his seventieth birthday? As in the case of advertising, one cannot discover
the meaning of ideology by looking solely at its content (“Happy Birthday, Stalin!”). One
important aspect of communication is not its content, but the frequency with which the
message is repeated19
Es liegt also die Vermutung nahe, dass Leonid Koff kein „Wilder“ im Sinne von
Malinowski war, sondern seine kommunikative Umwelt mehr oder weniger korrekt rezipiert
und widergespiegelt hat. Für Historiker mag der Grad der Korrektheit dieser Widergabe
weniger bedeutend sein als das spezifische Ergebnis dieser Bittstellung: Offensichtlich
scheiterte die ausgeklügelte Rhetorik des Schreibens daran, dass der Bittsteller zu weit in die
Intimsphäre der bolschewistischen Machthaber vorgedrungen war: Nikolaj Markov, der
Sekretär von Kalinin, rät ihm kühl, sich stattdessen an „Sovfoto” zu wenden, um dort die
offiziellen Fotos der russischen Herrscher zu erwerben.20
Für
Kommunikationswissenschaftler ist hingegen die Frage wichtig, inwieweit das von Koff
demonstrierte (1) code-switching, (2) die soziale und (3) kommunikative Entdifferenzierung
die öffentliche Sphäre des bolschewistischen Staats geprägt haben. Da es für die
Beantwortung der ersten Frage wohl einer groß angelegten empirischen Untersuchung
bedürfte, die den Rahmen dieser kleinen Abhandlung mit Sicherheit sprengen würde, hat sich
der Autor für die Beantwortung der zweiten und dritten Frage entschieden. Denn hier scheint
eine kleine Stichprobe aussagekräftig genug, um die allgemeine Lage grob skizzieren und
einschätzen zu können.
3. Zwischen Ethos und Pathos: Soziale und kommunikative Entdifferenzierung im
privaten Feedback zur Rede Stalins
Als Hintergrund für den Brief von Leonid Koff wurde die Debatte auf dem VIII.
außerordentlichen Sowjetkongress der UdSSR in Moskau ausgewählt, die auch fast
ausschließlich dem Vortrag von Joseph Stalin über die neue sowjetische Verfassung
19
Wintrobe R. The Political Economy of Dictatorship, 39, 67. Über basale (unreflektierte) Selbstfererenz im
Kommunikationssystem siehe: Luhmann N.. Soziale Systeme..., 198-199.
20
RGASPI 78.1.588, 16. Angesichts des erbitterten Wettkampfes der bereits etablierten bildenden Künstler um
Zugang zu Stalin und Voroshilov (siehe: Plamper J. The Stalin Cult: A Study in the Alchemy of Power. New
Haven, CT 2012, 152) wirkte die Bitte von Koff besonders naiv.
gewidmet war. Dieses Feedback (insgesamt 6072 Sätze aus 80 Diskussionsbeiträgen) wurde
nach dem Grad der sozialen und kommunikativen Differenzierung ausgewertet (Tabelle 1):
Die Referenzen zum „geliebten Führer“ oder „comrade Stalin“, die auf die persönlichen,
nicht-übertragbaren Eigenschaften eines privaten Menschen verweisen, standen auf dieser
Skala auf dem untersten Niveau. Man kann normalerweise weder einen anonymen
Amtsinhaber lieben noch einen individuellen Nachnamen mit dem Amt vererben.21
Auf dem
entgegengesetzten Pol der Skala stand die höchstmögliche Ausdifferenzierung des
Feedbacks. Mit der Erwähnung einer „geniale[n] Rede“ hat man einen direkten Bezug zum
Inhalt des Vortrags genommen, indem die darin enthaltene Information irgendwie bewertet
wurde. Dazwischen standen die Referenzen zur sozial-politischen Rolle („Führer“) und zu
entsprechenden Handlungen („unter der Leitung von….“) des sowjetischen Herrschers sowie
die parallelen Verweise auf seine kommunikative Funktion („Redner“) und Tätigkeit
(„geschrieben…“).
Wie kann man die Ergebnisse interpretieren? Vieles deutet darauf hin, dass die intuitive
Haltung des ambitionierten Fotografen dem Niveau der sozialen und kommunikativen
Differenzierung seiner Umwelt angemessen war und entsprach. Zumindest unter den
Delegierten dieses Kongresses scheint die Produktivität der Rückkoplung negativ mit dem
Grad ihrer sozialen und kommunikativen Differenzierung zu korrelieren. In der Tat
verweisen mehr als 40 % aller Referenzen auf Joseph Stalin, seine diversen Ämter und seine
kommunikativen und soziale Handlungen ausschließlich auf ihn als Privatperson. Auf jeder
weiteren Differenzierungsstufe nimmt die Intensität des Feedbacks ab. Weniger als 24 % der
Erwähnungen betreffen seine offiziellen sozialen Rollen und Tätigkeiten, wobei nur knapp
über 22 % der Referenzen mit den kommunikativen Rollen und Handlungen des sowjetischen
Herrschers zu tun haben. Die Hinweise auf die Rede selbst schließen die Tabelle mit 11,3 %
ab. Durch den häufigen, emotionsbeladenen Bezug auf den Herrscher und seine Rede
gewinnen Ethos und Pathos die Oberhand; Logos tritt erwartungsgemäß (siehe 1.) zurück.22
21
Es wäre falsch, daraus zu schließen, dass eine namentliche Erwähnung von Stalin im sowjetischen
öffentlichen Diskurs obligatorisch war. In Nazideutschland hingegen war die Bezeichnung „Führer“ (im
Gegensatz zu „Adolf Hitler“) nicht nur toleriert, sondern deutlich bevorzugt (Kershaw I. The ‘Hitler Myth’.
Image and Reality in the Third Reich. Oxford 1987, 62).
22
Die Trichotomie ethos – logos – pathos, die hier verwendet wird, entspricht der Klassifikation, die
Aristoteles in Poetik und Nichomachischer Ethik ausgearbeitet hat, und weicht von der umfassenderen
Es scheint mir ausgesprochen reizvoll genauer herauszufinden, als wie schädlich – wenn
überhaupt – eine solche informationsarme Einstellung des Kommunikationssystems für die
Stabilität eines politischen Regimes erweisen kann. Bis jetzt liegen uns nur allgemeine
Hypothesen und vereinzelte Fallstudien vor.23
Allem Anschein nach wäre ein Staat im
Zustand der allumfassenden phatischen Gemeinschaft unregierbar, weil jeder effiziente
Informationsaustausch als Bedrohung für die homöostatische Pseudo-Ordnung angesehen
würde. Wie diese Unregierbarkeit in der Praxis aussah, zeigt das erstarrte Schweigen, das
dem Kommunikationsabbruch am VIII. Kongress des Sowjets folgte: trotz der Tatsache, das
Stalins Rede im Kongresssaal wegen einer technischen Störung nicht zu hören war, lief der
Kongress einfach weiter. Es mag aber sein, dass die ungewöhnliche Trajektorie des
Feedbacks für die sowjetische Gesellschaft noch gefährlicher war als ihre niedrige
Informationsqualität:24
Wenn die komplexe Dynamiken der gegenseitige Legitimierung von
Herrscher und Untergebenen zu einem starren Ritual versteinert, scheint die Explosion der
nicht-zirkulierenden Information sowohl „unten“ als auch „oben“ mehr als plausibel. Die
allumfassende Angst vor dieser Explosion erklärt m. E. die verblüffenden Ähnlichkeiten
zwischen dem Brief von Leonid Koff und der Diskussion am VIII. Sowjetkongress, die eine
scharfe Trennung zwischen der privaten und der öffentlichen Kommunikation in Frage
stellen. Leonid Koff teilt zwar mit vielen anderen sowjetischen Bittstellern der 30ger Jahre
das Misstrauen gegenüber der höchstritualisierten politischen Interaktion dieser Zeit;25
trotzdem schlägt er keine Alternative vor und repliziert das, was er tief im Herzen zu
zerstören sucht.
Darstellung der drei Überzeugungsmitteln in Rhetorik ad Alexandrum erheblich ab (siehe z. B.: Aune D. E. The
Westminster Dictionary of New Testament and Early Christian Literature. Louisville, KY 2003, 169).
23
Siehe z. B.: de Sola Pool I.. Communication in Totalitarian Societies. - de Sola Pool I., Frey F. W., Schramm
W., Maccoby N & Parker E. B. (Hrsg.). Handbook of Communication. Chicago, IL 1973, 462-511; Ulonska U.
Ethos und Pathos in Hitlers Rhetorik. In: Jens W. (Hrsg.). Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch. (Band 16.
Rhetorik im Nationalsozialismus). Tübingen 1997, 9-15; Postoutenko K. Prolegomena to the Study of
Totalitarian Communication. In: Postoutenko K (Hrsg.). Totalitarian Communication: Hierarchies, Codes and
Messages. Bielefeld 2010, p. 11-42.
24
Siehe: Deutsch K. W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. New
York, 1966, 99.
25
Siehe Analyse: Livšin A. Ia. Nastroenia i politicheskie emotsii v Sovetskoi Rossii 1917-1932 gg. Moskva,
2010, 78.
Tabelle 1
Zahl der Referenzen:→
Referenzen zu Stalin:↓
3350 (100 %)
3350 (100 %)
Person26
(„lieber Stalin“, „lieber
Stalin“)
1429 (42,7 %)
1429 (42,7 %)
Akteur27
(„teuer Führer“)
520 (15,5 %)
796 (23,7 %) soziale Handlung („Stalin
hat uns zum Sieg geführt“)
276 (8,2 %)
Absender28
( = kommunikativer Akteur)
(„der Vorträger Stalin“,
„der Genosse Stalin hat
gesagt“)
453 (13,5 %)
745 (22,2 %)
Mitteilung29
( = kommunikative Handlung)
(„Ein Vortrag von Stalin“)
292 (8,7 %)
Information
(„ Der geniale Vortrag“)
380 (11, 3 %) 380 (11, 3 %)
26
Die Identität einer ‘Person‘ ist, unter anderem, weder reproduzierbar noch übertragbar: wenn mann ‚our
beloved President‘ sagt, gilt hierdurch ausgedrückte Liebe nur diesem konkreten Amtsinhaber und kann nicht
ohne weiteres dem nächsten übergeben werden.
27
Unter ‚Akteur‘ versteht man hingegen eine übertragbare Identität, die eine relativ stabile Funktion im sozialen
(hier – politischen) System hat und von jeder in dieser Umwelt vollberechtigter Person ausgeübt sein kann: im
Satz ‚великий вождь’ weist das Wort ‚вождь’ auf eine soziale (hier – politische) Rolle, die von der
persöhnlichen Identität des Handelnden weitgehend unabhängig ist.
28
Unter ‘Absender’ versteht man einen ‚kommunikativen Akteur’, also derjenige, der eine Absicht hat und in
derin der Lage ist, die Handlungen vorzunehmen, die von irgendeinem ‚Rezipient‘ als Kommunikation (hier –
verbale Kommunikation) identifiziert sein können.
29
Mitteilung ist eine ganz besondere soziale Handlung, die nur komplett wird, wenn sie ein Feedback des
Objektes einschließt. Entsprechend ist es üblich, diesen Feedback zu liefern und auf die Information, die in der
Mitteilung enthalten wird, gezielt zu reagieren: zumindest in der heutigen Gesellschaft lößt die Mißachtung
dieser Praxis, wie Ethnomethodologie geziegt hat, heftige Reaktionen aus (Garfinkel, H. Studies in
Ethnomethodology. Englewood Cliffs, NJ 1967, 42-43).