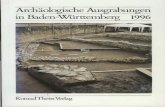Anmerkungen zum Themenkreis "Bedingungsloses Grundeinkommen"
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Anmerkungen zum Themenkreis "Bedingungsloses Grundeinkommen"
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 1 -
BGEVerstreutes und Vermischtes aus dem näheren und
ferneren Umfeld des Themenbereichs
„Bedingungsloses Grundeinkommen“
Raymond Zoller
Inhalt
Versuch, mit BGE-Leuten zu Fragen des Bedingungslosen Grundeinkommens ins Gespräch zu kommen 2
Zurechtdenken eines verbogenen Arbeitsbegriffs und Bedingungsloses Grundeinkommen 3
Arbeit und Tätigsein 4
Zum sogenannten «Sozialen Hauptgesetz» 4
Scheinprojekte und ihre Wurzeln 5
Von offenen Baustellen 6
Von den Funktionierenden 7
Zum Alptraum verkehrter Traum 7
Kulturelle Wurzeln und bedingungsloses Grundeinkommen 8
Gedanken zu einer sinnvollen Verlagstätigkeit 8
Leistung muß sich wieder lohnen 9
Gedanken zu Schreiben, Copyright, Texteklau und damit verbundenes 10
Genealogie des Bildungsphilistertums 11
Phrase Konvention Routine 12
Nachbemerkung 13
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 2 -Versuch, mit BGE-Leuten zu Fragen des Be-dingungslosen Grundeinkommens ins Ge-
spräch zu kommen
Ganz leicht überarbeiteter Vorstellungsbeitrag in einer Xing-Gruppe zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“
Zunächst einmal wurde die Motivationsverwirrung, die sich aus der unreflektiert übernommenen Koppelung von Arbeit und Einkommen ergibt, zum zunehmend bewußteren persön-lichen Problem. Das praktische Studium der aus dieser Ver-wirrung (wieauch aus sonstigen Verwirrungen) resultierenden seelischen Folgen und Festgefahrenheiten (an mir selbst und an meiner Umgebung) bezeichnete und bezeichne ich halb scherz-haft als „Studium der Phänomenologie des geistig-seelischen Erstickens“.
Im Laufe der Zeit wurde mir griffig, daß Arbeit und Einkom-men nicht so selbstverständlich zusammengehören, wie man det in der Schule gelernt hat und wie es einem eingetrichtert wird; und von dieser Einsicht bis zur Idee des bedingungslosen Grundeinkommens war es dann nicht mehr weit.
Im äußeren, praktischen Leben hab ich insofern mit dieser Problematik zu tun, als ich nach Scheitern eines größeren tech-nischen Projektes [kann man bei Bedarf unter http://klamurke.com/Soziales/Leben.htm, Abteilung „Absurde Abenteuer mit Strömungsaggregaten“ nachlesen] durch einen Freund, der fi-nanziell in diese Sache involviert war, „bedingungslos“ unter-stützt werde (der Betreffende bezeichnet mich allerdings als „Sozialpfadfinder“ und auch als „Schriftsteller“ und unterstützt mich als solchen; ohne jedoch die „Effektivität“ meiner Arbeit zu kontrollieren; praktisch also „bedingungslos“). Eine solche Unterstützung wurde auch auf andere Leute ausgedehnt; je-doch - außer in ein paar Fällen dringender medizinischer Hilfe - beschränkt auf Leute, die bereit und fähig sind, selbst sinn-voll ins soziale Geschehen einzugreifen oder in einem schöpfe-rischen Entwicklungsprozeß sind. - Eine Zeitlang beschäftigten wir uns mit der Frage, wie sich im mikrosozialen Bereich eine Oase oder Oasen schaffen ließen mit „halbbedingungslosem“ Grundeinkommen (i.e. für Leute, die man kennt und von denen man weiß, daß sie gewisse Anlagen haben, die sie entwickeln und einbringen wollen); verschiedene Notizen hierzu findet man bei Bedarf an mit obigem Link verbundenen Stellen).
Wie weit im makrosozialen Bereich in einzelnen Ländern die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens möglich wäre – weiß ich nicht; einerseits wäre es die natürliche Lösung, andererseits aber im Kontext der faktischen Zeitbedingungen eine recht problematische Angelegenheit (nicht nur wegen der Widerstände – allein schon die Heere von in den unsinnigen Kontrollmechanismen tätigen Beamten, die ihre Arbeitsplätze bedroht sehen – sondern auch aus einer ganzen Reihe anderer Gründe; ich laß mich aber gern eines anderen belehren)
Ich denke, daß es bei gutem Willen möglich sein könnte, mit gutem Beispiel vorzugehen und kleinere (nicht unbedingt räum-lich bestimmte; mitunter sogar länderübergreifende) Inseln mit bedingungslosem oder halbbedingungslosem Grundeinkom-men zu schaffen. Soviel ich weiß wird das stellenweise auch versucht (Subsidien, Sponsortum usw…; wennauch nicht immer verbunden mit prinzipiellen Überlegungen zum Zusammen-hang zwischen Arbeit und Einkommen; und nicht selten auch rein mechanisches Finanzieren von grobem Unfug)
Abgesehen von den Widerständen, die sich der Sache als Ganzes entgegenstemmen, sehe ich im makrosozialen Bereich das Haupthindernis in der Entfremdung des Einzelnen vom „So-zium“.
In Verbindung mit der Behandlung der Fragen um das „be-dingungslose Grundeinkommen“ scheint es mir wichtig, unter anderem auch die Mechanismen, die zu dieser Entfremdung führen und sie verstärken, gründlicher zu untersuchen. (diese Entfremdung scheint mir nicht naturgegeben, sondern Resul-tat unglücklicher Entwicklungen, die selbst den stärksten und motiviertesten letztendlich in Vereinsamung und Resignation treiben können).
Ein wichtiger und sehr zentraler Mechanismus etwa hat sein Epizentrum im zunehmenden Verfall der Kommunikationskul-tur: man hat einander nichts mehr zu sagen (und weiß nicht einmal mehr was das heißt: einander etwas zu sagen zu haben), hört entsprechend einander auch nicht zu, und könnte, was das Wirtschaften betrifft, auch nicht sagen, warum man sich, wenn man nicht dazu gezwungen wird, für diese gleichgültige Umge-bung abrackern sollte. – Ich mein das ganz ohne jede Sentimen-talität; dieser Verfall und die daraus resultierende Problematik läßt sich unsentimental und mit klaren Begriffen darstellen; soll-te man eigentlich auch; nur nicht in einem Vorstellungsbeitrag)
Ein weiterer Faktor: das in vielen Ländern immer dichter werdende bürokratische Fettnäpfchensystem: Manche trauen sich schon gar nicht mehr, sich zu bewegen, um nicht irgendwo reinzutappen, und lassen resigniert die Arme sinken: ungefähr-licher ist es allemale, stillzusitzen und sich mit Sozialhilfe zu be-gnügen. Und ich denke, daß manche Menschen so von dieser Resignation durchdrungen werden, daß sie auch nach Wegfall dieses widermenschlichen Unsinns Zeit bräuchten, sich wieder aufzurichten (als Beispiel siehe etwa hier http://klamurkisches.blogspot.com/2008/09/auf-und-abschwngliches-auf-der-zdf.html)
Da ich mich in oben erwähnter Gruppe nicht ver-ständlich machen konnte, klinkte ich mich wieder aus. Sehr viel später, nach Korrespondenz mit einem der Moderatoren, versuchte ich es dann noch mal (diesmal kam es sogar zu einem kurzen Aufwallen von interessantem Gespräch, das aber sofort wieder verebbte. Klink mich aber nun nicht mehr aus, da mir dieses Gegruppel inzwischen ziemlich egal ist. Es wurde ein Anlaß geboten, Gedanken auszufor-mulieren, die ich sonst nicht ausformuliert hätte; und das ist zweifellos ganz nett; und veröffentlichen tu ich das nun in freier Wildbahn)
Bin wieder da.
War schon mal hier; da ich den Eindruck hatte, mich nicht ver-ständlich machen zu können, klinkte ich mich – um nicht sinn-los als Fremdkörper herumzuhängen – nach einiger Zeit wieder aus.
Nach Korrespondenz mit A. hab ich mich nun, nach längerer Abwesenheit, entschlossen, es noch mal zu versuchen.
Knapp stichwortartig umrissen mein Zugriff zur BGE-Frage:
Wichtigste Ausgangspunkte, von denen ich herankam, sind
- die aus der unreflektierten Koppelung von Arbeit und Ein-kommen sich ergebenden Motivationsprobleme bei dem Ein-zelnen
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 3 -- auf dieser Koppelung begründete Probleme für schöpferi-
sche Menschen; etwa der Zwang, in Entwicklung begriffene Ge-danken und Ansätze noch vor Ausreifung in gewohnte Schablo-nen zu pressen und ihnen Gewalt anzutun, sie mitunter (da man sich sonst nicht finanzieren kann) durch Zerreden und Verfäl-schen noch vor Ausreifung zu zerstören (Siehe hierzu „Schein-projekte und ihre wurzeln“ S. 5). Wirklich Neues, Schöpferisches ist unter diesen Umständen kaum möglich; und weil so wenig wirklich Neues kommt, stumpft die Masse in ihrem Gewohnten ab und wird auch ausgereifte Schöpfungen kaum erkennen kön-nen; usw…. Nähere Ausführung bei Bedarf möglich.
Das Postulat eines bedingungslosen Grundeinkommens scheint mir die logische Folge einer in der Natur der Sache lie-genden Abkoppelung von Arbeit und Einkommen. Die lebendi-ge Entwicklung und Weiterentwicklung dieser Gedankengänge dürfte nicht minder wichtig sein als das rein programmatische, pragmatische Arbeiten mit diesem Postulat; sogar scheint mir, daß ein rein aktionistisches Herumarbeiten mit Programmen ohne gedankliche „Hintergrundentwicklung“ auf Dauer zur Ste-rilität verurteilt ist.
Bei lebendigem Umgang mit diesen Gedanken lassen sich auch am ehesten Wege schlagen, unter gegebenen, dem BGE-Postulat nicht immer freundlich gesonnenen Bedingungen, sel-bige Gedanken in die äußere Realität zu verkörpern.
Eine lebendige Auseinandersetzung mit diesen Fragen scheint mir auch dort sinnvoll, wo aufgrund politischer Bedingungen an eine Durchsetzung des BGE-Postulats im großen Stil zunächst gar nicht zu denken ist. „Das Wort zerstört Beton“, wie Solsche-nizyn sich irgendwo ausdrückt. Oder, anders ausgedrückt: der Geist weht, wo er will.
4 4 4
Zurechtdenken eines verbogenen Arbeitsbe-griffs und Bedingungsloses Grundeinkom-
men
In einem Forum zum „Bedingungslosen Grundein-kommen“, in dem ich in einem von mir ins Leben gerufenen Gesprächsfaden versucht hatte, mich zum Thema „verbogener Arbeitsbegriff“ verständlich zu machen und aus dem ich nach einigem Bemühen mich kommentarlos wieder zurückzog, da ich kei-ne Chance sah, mich, eben, verständlich zu machen. [zur Vermeidung von Mißverständnissen: ich hab nix gegen die Leute, denen gegenüber ich mich nicht verständlich machen konnte; ich find nur das Thema interessant; und deshalb veröffentliche ich det nun auch anderswo in freier Wildbahn]
Spontan meldete ich mich nach langer Unterbre-chung mit Stellen einer „Preisfrage“ aus dem Um-kreis selbigen Themas.
Erwähnen tat ich in diesem Beitrag einen vor kur-zem erhaltenen Brief, darin jemand mir schrieb: daß er nach einer sinnvollen Arbeit sucht, welche in dem Staat, in dem er lebt, als Arbeit angesehen wird und nicht als Praktikum oder Hobby.
Und weiter:
Preisfrage: was schreibt man da?
[ich meine: ohne Zurechtdenken des verbogenen Arbeitsbe-griffs und sonstiger verbogener Gedankenkonstrukte kann man noch so viel ein BGE propagieren: das greift - meinem beschei-denen Dafürhalten nach - alles nicht]
(nach verständnisloser Antwort seitens einer Teil-nehmerin)
Der Reihe nach:
Ich hab keinen Groll gegen diese Gruppe; schätze auch, daß es bei meinem zweiten Anlauf Ansätze gab zu interessanten Ge-sprächen. Mein Problem ist bloß, daß ich dazu neige, die Dinge in größerem Zusammenhang und in ihrer Wechselbeziehung zu sehen und zu erleben. Funktioniert nicht immer; aber diese Nei-gung ist schon sehr stark.
Über verschiedene Wege persönlicher, gedanklicher Entwick-lung stieß ich auf die Notwendigkeit eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ein solches „Bedingungslose Grundeinkom-men“ als isolierten Götzen zu betrachten und zu handhaben – ist mir aber nicht möglich; ganz egal, wie nett das wäre. Und für Menschen, die von unserem vermurxten mit Einkommen gekoppeltem Arbeitsbegriff durchdrungen sind – ist das fast schon lächerlich, wenn nicht gar obszön. Kann man verstehen.
Mit diesem vermurxten, zu Motivationsverwirrung und schlimmerem führenden Arbeitsbegriff sind wir aufgewachsen; davon sind wir alle mehr oder weniger durchdrungen. Und daß da irgendwas nicht stimmt – merken wir in der Regel nicht am Arbeitsbegriff selbst, sondern zunächst mal an seinen Auswir-kungen. Sich zu orientieren und sich von diesem Wuste frei machen – ist nicht so einfach; Bücher allein – ganz egal, wie gescheit sie sind – sind da auch kein Allheilmittel; besonders für uns Europäer mit unserem Hang zum abstrakten Theoretisie-ren. Mir sind zur Genüge Leute bekannt, die solche Bücher sehr gescheit zu paraphrasieren wissen, wieauch andere Bücher zu Fragen der menschlichen Freiheit, zu freiem Zusammenwir-ken freier Einzelner, und was es sonst noch so an Gescheitem gibt; und wenn man sich die hinter solchen hehren Theorien versteckte faktische Haltung der Betreffenden näher unter die Lupe nimmt, so unterscheidet die sich kaum von Otto Normal Verbrauchers Haltung. Denn der Europäer ist schon sehr pa-pierern (wenn es nicht so papierern klingen würde könnte man sagen: es ist das in seiner Substanz längst in Vergessenheit ge-ratene „faustische Problem“)
So viel zu den Büchern (gegen die ich ansonsten, bei vernünf-tigem Umgang mit selbigen, nichts einzuwenden habe).
Zu einem gesunden Begriff von Arbeit zu kommen und den ganzen Mist, mit dem man aufgewachsen ist, aus sich heraus-zuspülen, ist nicht so einfach und geht nicht von heute auf morgen. Im Grunde ist das ein handfester Mentalitätswandel, der – wenn man es ernsthaft angeht – bei solcher Auseinan-dersetzung vonstattengeht, eine „moralische Revolution“ ge-wissermaßen. Selbst brauchte ich mehrere Jahre, um mich von diesen sublimen inneren Zwängen zu befreien. „Philosophie ist der Weg, auf dem wir die Fehler korrigieren, die bei unserer Erziehung gemacht wurden“ – meint Novalis (oder so ähnlich); heute hat man dafür – da man die eigentlichen Knackpunkte nicht sehen will – Psychologen.
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 4 -Praktische Konsequenz eines „zurechtgedachten“ Arbeits-
begriffs ist ein bedingungsloses Grundeinkommen; das hängt alles miteinander zusammen. Und unabhängig von den Mög-lichkeiten einer praktischen Realisierung eines solchen Grund-einkommens unter gegebenen Umständen ist allein das Durch-denken der Möglichkeiten schon eine Medizin: eben wegen des organischen Zusammenhangs mit einem befreiten „moti-vationsechten“ Arbeitsbegriff; da man ohne Durchdenken die-ser praktischen Möglichkeiten bei dem Versuch, die motivati-onsverwirrende Arbeit-Einkommen-Koppelung aufzulösen vor einer undurchdringlichen Wand steht und sich letztendlich mit dem Status quo als einem nicht zu vermeidenden Übel abfindet.
Ich müßte da noch sehr weit ausholen, um irgendwie zu um-reißen: warum ich keine rechte Lust mehr habe, mich hier zu äußern; das sind alles Feinheiten, die sich in ein paar Sätzen nicht zusammenfassen lassen. Aber das ist sowieso wohl eher mein Problem; ich will damit nichts gegen die Gruppe sagen. Gewisse mir interessant scheinende Ansätze hat es immerhin schon mal gegeben.
Was jenen Brief betrifft: Der hat mit dieser Gruppe und mit den konkreten Bestrebungen Richtung „Bedingungsloses Grundeinkommen“ rein nach außen hin gar nichts zu tun; in-haltlich dafür sehr.
Geschrieben von einem Menschen, der, wenn man genauer hinguckt (oder wie man, bei entsprechender Sensibilisierung, sofort sieht) akut unter den Konsequenzen unseres pervertier-ten Arbeitsbegriffs leidet.
Was darauf zu antworten ist, wußte ich, und hab das dann auch geschrieben. Nämlich habe ich ihn auf, eben, jenen un-sinnigen Arbeitsbegriff hingewiesen, hab ihm den Rat gegeben, sich mit diesen Fragen mal gründlicher auseinanderzusetzen; auch, mehr nebenbei, in Bezug auf die Konsequenz eines „be-dingungslosen Grundeinkommens“. Und außerdem riet ich ihm, so weit er es sich von seiner Lebenssituation her leisten kann, weiterhin genau das zu tun, was er kann und was er als sinnvoll erachtet; ganz egal, ob andere das als „Praktikum“ abtun oder als „Hobby“ oder weiß der Teufel was sonst noch.
Der spontane Einfall, das als „Preisfrage“ in diese Gruppe einzubringen, hatte damit zu tun, daß mir scheint: statt sich in Politisieren und Agitieren zu verheddern, sollten Menschen, die ein „bedingungsloses Grundeinkommen“ vertreten (oder, wei-ter gefaßt: um Wege bemüht sind für ein menschenwürdiges Zusammenspiel von Einzelnem und Gemeinschaft; oder wie im-mer man das nennen mag) sich so weit sensibilisieren, daß sie sehen, wo mit diesem Problemkomplex zusammenhängende Fragesituationen vorliegen.
Bei solcher Sensibilisierung kommen eher Menschengemein-schaften zusammen, die lebendig – und nicht bloß politisierend – in der Gesamtproblematik drinnenstecken und auch eher die Beweglichkeit aufbringen, in kleineren, überschaubaren Zusam-menhängen Lösungsansätze zu schaffen.
Das brachte die Sache dann aber auch nicht weiter, und ich zog mich wieder zurück. Da ich per auto-matisierte E-Mail über weitere Beiträge informiert wurde, bekam ich, mehr am Rande, mit, daß das Gespräch durch eine neue Teilnehmerin nach lan-ger Stagnation kurz wieder in Bewegung gekommen war. Die Betreffende hatte die Hintergründe der „Preisfrage“ verstanden; konnte sich mit ihrem Ver-stehen aber auch nicht durchsetzen. Selbst mischte
ich mich zunächst nicht ein. Als die Sache dann in ein Mißverständnis einmündete, als gehe es darum, daß Aktivisten der BGE-Bewegung sich auch um Heran-ziehen und Betreuung junger Menschen kümmern müssen, äußerte ich mich denn doch noch mal:
Es ging hier nicht darum, „junge Leute“ einzubeziehen, sie für ein Programm zu gewinnen, sondern darum, die Hintergründe einer Frage zu verstehen.
Daß Menschen aufgrund des unhinterfragt übernommenen vermurxten Arbeitsbegriffs in Bezug auf ihre Tätigkeit, ihre Mo-tivation, ihre Absichten Probleme bekommen – ist normal und nicht ans Alter gebunden.
Aufdröseln des mit Einkommen gekoppelten Arbeitsbegriffs führt fast automatisch zu einer Berührung mit der Idee des be-dingungslosen Grundeinkommens.
Grob ausgedrückt: der Mensch von heute lebt mehr oder weniger im Tiefschlaf. Schlafwandelt etwas herum, redet auch im Schlafe (manches klingt sogar im ersten Moment recht ge-scheit); läßt sich auch willig in Programme einbinden, wo er weiterschlafen kann. Alles in allem: der Schlaf bestimmt unsere heutige Realität.
Fragen haben mit einsetzendem Aufwachen zu tun. Es gilt, diese Momente zu erkennen und einzugreifen. Das ist ganz was anderes als via Agitation Anhänger für ein Programm zusam-menzutrommeln. Anhänger stolpern in ihrem Halb- oder Tief-schlaf von einem Programm zum andern; wer sich seiner Fragen bewußt wird und ihnen nachgeht – der weiß, was er tut („Ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewußt“, wie Goethe det ganz richtig gesagt hat).
4 4 4
Arbeit und Tätigsein
Der mit Einkommen gekoppelte Arbeitsbegriff hat nicht au-tomatisch mit Tätigsein zu tun. Mitunter läuft das bloß – wenn grad nichts oder nichts mehr oder sowieso nichts zu tun ist – auf ein Absitzen von Arbeitszeit hinaus; und der brave Bürger, dem dieser merkwürdige Arbeitsbegriff in den Knochen sitzt, findet ganz selbstverständlich, daß der untätig seine Arbeitszeit Absit-zende sein Gehalt redlich verdient.
Bei einem „autonomen“ Arbeitsbegriff geht es eher um Tätig-keit, die man so lange ausübt, als sie benötigt wird; und wenn sie nicht mehr benötigt wird, tut man was anderes. Wenn man nicht darauf angewiesen ist, stur einen Rahmen zu füllen, für den man bezahlt wird, hat man auch eher die Motivation und die Bewegungsfreiheit für die Suche nach neuen Möglichkeiten, sich nützlich zu machen.
4 4 4
Zum sogenannten «Sozialen Hauptgesetz»
Noch ein mir wichtig scheinender Beitrag in dem be-reits erwähnten BGE-Forum, der, außer verstreuten Belanglosigkeiten, keinerlei Fortsetzung fand.
Nachfolgend ein Zitat von einem mir recht interessant schei-nenden österreichischen Denker (R. Steiner), dessen Arbeiten in der Entstehungsgeschichte der BGE-Bewegung vermutlich
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 5 -ihre Spuren hinterlassen haben. Man mag – besehen oder un-besehen – zu diesem Denker stehen wie man will; mag sich von dem positiven Tun seiner heutigen Anhängerschaft eher ange-zogen, von deren mitunter recht abenteuerlichem Hokuspokus eher abgestoßen fühlen – iss egal; manche Dinge aus seiner Fe-der scheinen mir einfach durchdenkenswert.
Jenes Zitat ist unter Insidern bekannt als das sogenannte „so-ziale Hauptgesetz“ und beinhaltet meinem Verständnis nach, unter anderem, auch einen Angelpunkt, von dem aus man sich einen Überblick verschaffen kann über das Verhältnis zwischen Arbeit und Einkommen.
Also:
„Nun, das soziale Hauptgesetz […] ist das folgende: ‚Das Heil einer Gesamtheit von zusammenarbeitenden Men-schen ist um so größer, je weniger der einzelne die Erträg-nisse seiner Leistungen für sich beansprucht, das heißt, je mehr er von diesen Erträgnissen an seine Mitarbeiter abgibt, und je mehr seine eigenen Bedürfnisse nicht aus seinen Leistungen, sondern aus den Leistungen der ande-ren befriedigt werden.’ Alle Einrichtungen innerhalb einer Gesamtheit von Menschen, welche diesem Gesetz wider-sprechen, müssen bei längerer Dauer irgendwo Elend und Not erzeugen - Dieses Hauptgesetz gilt für das soziale Le-ben mit einer solchen Ausschließlichkeit und Notwendig-keit, wie nur irgendein Naturgesetz in bezug auf irgendein gewisses Gebiet von Naturwirkungen gilt. Man darf aber nicht denken, daß es genüge, wenn man dieses Gesetz als ein allgemeines moralisches gelten läßt oder es etwa in die Gesinnung umsetzen wollte, daß ein jeder im Dien-ste seiner Mitmenschen arbeite. Nein, in der Wirklichkeit lebt das Gesetz nur so, wie es leben soll, wenn es einer Ge-samtheit von Menschen gelingt, solche Einrichtungen zu schaffen, daß niemals jemand die Früchte seiner eigenen Arbeit für sich selber in Anspruch nehmen kann, sondern doch diese möglichst ohne Rest der Gesamtheit zugute kommen. Er selbst muß dafür wiederum durch die Arbeit seiner Mitmenschen erhalten werden. Worauf es also an-kommt, das ist, daß für die Mitmenschen arbeiten und ein gewisses Einkommen erzielen zwei voneinander ganz ge-trennte Dinge seien.“
So weit dieses Zitat.
Ich denke, daß da was dran ist; denke aber auch, daß man die Tragweite nur verstehen kann, wenn man sich in Selbstbeob-achtung die Motivationsproblematik vergegenwärtigt, die sich aus der Kopplung von Arbeit und Einkommen ergibt. Und dann wird man auch verstehen, daß es gar nicht möglich ist, auf Kom-mando „altruistisch“ zu werden. Altruistisch kann man nur dann werden, wenn man sich mit dem Umfeld, dem man seine Lei-stung schenkt, ganz ehrlich verbinden kann. Und das ist bei dem heutigen Grad der Entfremdung des Einzelnen von dem sozialen Ganzen schwieriger denn je.
Das Eine ist, daß rein organisatorisch Einrichtungen geschaf-fen werden, in denen Arbeit und Einkommen vollständig ge-trennt sind (dürfte sich bei der heutigen politischen Situation zumindest in den sogenannten „zivilisierten“ Ländern im ma-krosozialen Bereich kaum durchsetzen lassen; höchstens daß man es hinkriegt, gegen alle äußere Widerstände übersichtliche Oasen zu schaffen, in denen man das zu realisieren sucht), sei es, daß man es zweispurig versucht (bedingungsloses Grundein-kommen und darüber hinaus die Möglichkeit, seine Arbeitskraft zu verkaufen).
Das andere ist, daß man – teilweise in Selbstbeobachtung – versucht, sich die Motivationsproblematik, die Entfremdungs-problematik zu vergegenwärtigen. (das Verständnis dieser Problematik scheint mir überhaupt eine Grundbedingung für äußeres Handeln; ohne dies erstarrt alles in programmhaftem Schematismus)
In diesem Zusammenhang besteht noch eine ganz spezifische Schwierigkeit, die ihre Grundlage im allgemeinen kulturellen Verfall hat, im Ersetzen der kulturellen Entwicklungsprozesse durch gedankenloses Reproduzieren irgendwelcher traditio-neller Formen oder genauso gedankenloses effekthaschendes Herumexperimentieren. – Früher war es ja so, daß sogenannte „Kulturschaffende“ in ihren Arbeiten das zum Ausdruck brach-ten, was ihre Zeitgenossen unausgesprochen bewegt. Das ist heute nur noch in Ausnahmefällen so: Geburtshelfer, welche das innere Suchen, die inneren Nöte klar und konsequent auf den Punkt bringen könnten, gibt es kaum (und selbst wenn es sie geben sollte, geht ihre Stimme – so sie sie überhaupt noch erheben – in dem allgemeinen Lärm unter). Und dadurch kommt der Einzelne auch kaum noch dazu, sich einem inneren Suchen, seinen inneren Nöten, der Natur seines Darinnenstehens im so-zialen Ganzen klar und objektiv zu stellen (es sei denn in Form von psychologischen „Motivationstests“ und sonstigem Hokus-pokus; oder auch von wehleidigem Sein-Leid-klagen; all dies ist nicht gemeint).
So weit mal dies
4 4 4
Scheinprojekte und ihre Wurzeln
In einem Forum, wo man eigene und fremde Projekte vorstellen kann, gab es auch eine Ecke für „Schein-projekte“; d.h. wo man sich über Initiativen auslas-sen konnte, die einem als Augenwischerei oder, eben, Scheinprojekte vorkamen. – Mit solchen Scheinpro-jekten kam ich massenweise in Berührung; doch statt ein solches darzustellen und zu besprechen, versuch-te ich stattdessen, den Ackergrund näher in Augen-schein zu nehmen, aus dem solche Scheinprojekte herauswachsen.
Sicher wäre es interessant, einmal den Boden zu untersu-chen, der solche Scheinprojekte hervortreibt.
Die Einwicklung eines echten „Projektes“ ist ja ein sehr kom-plizierter, sehr sublimer Prozeß; und es stellt sehr hohe An-forderungen an Wahrnehmungsvermögen, Denkvermögen, Sprachvermögen, um das, was ist, was möglich ist und wohin man in Wechselwirkung mit den Bedingungen gemeinsam wei-ter will richtig zu erfassen und sachgemäß zu formulieren.
Hier liegt nun das Problem, daß der heutige Mensch am lieb-sten in Schlagworten „denkt“ und häufig auch nur Schlagworte „verstehen“ kann. Und selbst eine Projektgemeinschaft, welche das „dynamische Sein“ ihrer gemeinsamen Tätigkeit (wenn man det mal so nennen darf) sachgemäß erfassen und darstellen kann, steht dann trotzdem vor der Notwendigkeit, irgendwel-che allgemeinverständliche Schlagworte, Schubladen zu schaf-fen: da sie sich sonst nämlich nicht verständlich machen können (auch bei den Schlagworten kann man, streng genommen, nicht vom „Verstehen“ reden; aber immerhin sind das für den Hörer oder Leser vertraute Wortlarven, die er „schwarz auf weiß nach Hause tragen“ kann).
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 6 -So daß allein schon die vertrackte verknöcherte Erkenntnis-
und Sprachsituation selbst die Gutwilligsten, wenn sie sich an die Öffentlichkeit wenden und nach Fördermitteln Ausschau halten, zum Flunkern zwingen.
Solches erzwungene eindrucksschindende Schubladisieren wirkt natürlich zurück auf die Entwicklung des Projekts selbst; kann es aushöhlen und vertrocknen; so weit aushöhlen und vertrocknen, daß zum Schluß nur noch die äußere – vielleicht sogar großzügig finanziell geförderte – Larve übrig bleibt, und darunter: nichts.
Außer den Gutwilligen, die durch den Schubladisierungs-zwang ins Schleudern gebracht werden, gibt es dann noch die weniger gutwilligen, die von vornherein nicht die Absicht haben, sich in unnötigem Tätigsein zu verzetteln. Die erstellen einfach ein mit wohlgesetzten eindrucksvollen Schlagworten gespick-tes Programm, mit dem sie dann die fördermittelvergebenden Instanzen abklappern; und sehr viel leichter haben es diese fundraising-Spezialisten mit ihren Programm-Maskeraden, als die armen Kerle, die versuchen, das Programm als Ausdruck ih-rer tatsächlichen Bestrebungen auszuformulieren. Denn erstere sind in ihrem eigentlichen Element, und kein störender Inhalt ist da, der sie dabei stören könnte, die Schlagworte so zu wäh-len und zu setzen, wie es für die Fördermittelbeschaffung von Nutzen ist.
Solche Projektmasken hab ich in Rußland und auch in Geor-gien auf Distanz wieauch aus der Nähe massenweise erlebt; wie ich auch Menschen erlebt habe, die von solchen Maskeraden sehr gut lebten. Doch warum sollen sie nicht gut leben, wenn die Fördermittelverteiler bereit sind, ihnen ein solches Leben zu erlauben? Und sozial relevant ist ihre Tätigkeit zumindest in-sofern, als sie den Fondsmitarbeitern die Illusion verschaffen, das von ihnen verwaltete Geld sinnvoll einzusetzen oder ihnen zumindest die Möglichkeit geben, es sinnvoll zu verbuchen.
Natürlich habe ich daneben auch Menschen erlebt, die tätig sein wollten und auch über entsprechende Fähigkeiten verfüg-ten und die nix machen konnten, weil sie kein Geld bekamen; aber so ist nun mal das Leben.
Wäre natürlich einer umfassenderen und gründlicheren Un-tersuchung wert; belassen wir es aber mal bei diesen paar An-deutungen.
4 4 4
Von offenen Baustellen
Tbilissi, am 25. März 2010: Als Fortsetzung einfach hereinkopiert ungekürzt und unverändert ein vor ein paar Tagen in einem kurz aufgebrochenen und gleich wieder verebbten Gespräch getätigter Forum-beitrag. Das Forum hatte mit dem „Bedingungslosen Grundeinkommen“ – abgekürzt „BGE“ zu tun (das Epigraph wurde, da es mir spontan als die Sache il-lustrierend einfiel, nachträglich eingefügt)
Soll deinem Wort ich glauben?
Ein Unstern, scheint›s, hat dich bis jetzt verfolgt.
(Richard Wagner)
Festgehalten sei mal die nicht zu übersehende, aber meist verdrängte Tatsache, daß Menschen, die in abgesicherten Ver-hältnissen leben, sich meistens nicht einmal die Mühe machen,
Menschen, die weniger abgesichert sind, zu verstehen1. Und dies gilt, leider, häufig auch für solche abgesicherte Persönlich-keiten, die sich als Vertreter fortschrittlich wirkenden Gedan-kengutes hervortun. Mit diesbezüglichen eigenen Erfahrungen und Erfahrungen aus meiner näheren Umgebung ließen sich Bände füllen.
[um Mißverständnisse zu vermeiden: es geht mir nicht um Einteilung in „Klassen“, sondern um Charakterisierung einer zwar meist unbewußt wirkenden, das soziale Miteinander dafür umso stärker beeinträchtigenden Haltung, mit der die Betroffe-nen im Grunde sogar mehr sich selber im Weg sind als anderen. Der Mensch, so er Wert darauf legt, ist durchaus in der Lage, sich zu ändern; also nix mit „Klassengesellschaft“.]
Ich will nicht polemisieren; aber da das Problem Beachtung und nähere Untersuchung fordert, ein Beispiel:
Eine Korrespondenz mit einem BGE-Aktivisten mündete in die Bemerkung selbigens: Daß ich überall nur Baustellen um mich herum habe; wenn ich mal was auf die Beine stelle, könne man weiter reden. – Was, ganz natürlich, den Abschluß jener Korre-spondenz bedeutete. Er war sichtlich nicht daran interessiert, mit einem solchen Erfolglosen weiter zu korrespondieren; und auch ich wäre selbst im „Erfolgsfalle“ nicht daran interessiert, mit ihm „weiter zu reden“; denn erstens ist alles, was wir tun, „Baustelle“, d.h. Übergang zu Weiterem; und zwotens weiß ich selbst, daß es wünschenswert wäre, die zahlreichen Ansätze, die ich bislang – teilweise nicht ohne einsetzenden Erfolg – ver-folgte, etwas strukturierter durchzuziehen; bloß ging das nicht, weil ich infolge Finanzmangels von einem zum andern getrie-ben wurde (ansonsten hab ich eine Schwäche für gezieltes, kon-sequentes Arbeiten); und daß ein Aktivist der BGE-Bewegung solches nicht sehen und verstehen kann – machte mir die ganze Sache als Programm (jedoch nicht den weiterer Ausarbeitung bedürftigen Hintergrund) zunächst mal suspekt. Obwohl selbi-ges Problem: daß, eben, die „Erfolgreichen“ die „Erfolglosen“ insgeheim verachten, mir bekannt ist.
Das Problem der „Erfolgreichen“ hab ich in einem Blogeintrag anfänglich untersucht; siehe „Von den Funktionierenden“ S. 7
1 In ihren weiteren Ausläufern prägt diese meist unbewußt bleibende Haltung leider auch das Verhältnis der in ihre – noch – funktionierende Strukturen eingebetteten Europäer zu den Menschen etwa in den Ländern der ehemaligen So-wjetunion.
Der Europäer neigt auch hier dazu, alles rein schematisch mit seinen eige-
nen gewohnten Maßstäben zu messen und nimmt sich in der Regel nicht
die Mühe, sich in die Spezifik anderer Kulturkreise mit anderer Geschichte
einzudenken (versteht oft nicht einmal, daß es irgendwas anderes ernstzu-
nehmendes geben könnte); und was mit seinen Maßstäben nicht gemessen
werden kann – ist unseriös. Und da er die spezifischen Schwierigkeiten nicht
sehen will und vermutlich aufgrund seiner Scheuklappen auch gar nicht se-
hen kann, kann er entsprechend – in einer Situation, die er gar nicht versteht
– auch keine Hilfestellung leisten (er versteht ja nicht einmal seine eigene
Situation und kann entsprechend auch sich selbst nicht helfen; trotz allen
Größenwahns) - [Ausnahmen werden selbst verstehen, daß sie nicht ge-
meint sind; und wer nicht zu den Ausnahmen gehört und trotzdem meint, er
sei nicht gemeint, der irrt halt. Unvoreingenommen in sich reingucken; und
schon weiß man in Etwa, wo man steht; iss gar nicht so schwierig, braucht
nur etwas Mut; und wenn man erst mal weiß, wo man steht, kann man auch
weitergehen und darüber vielleicht sogar nach und nach sogar seine Scheu-
klappen ablegen]
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 7 - Ich selbst habe das Glück, daß ich von privater Seite aus
vorübergehend mit „bedingungslosem Grundeinkommen“ versorgt werde. Der Betreffende, ein finanziell gut versorgter Freund, unterstützte ein technisches Projekt, welches ich vor ein paar Jahren in Georgien initiiert hatte (Näheres unter http://klamurke.com/Soziales/Leben.htm; Abteilung „Abenteuer mit Strömungsaggregaten)); und nachdem wir selbiges, trotz guter Perspektiven, aufgrund allgemeinen Desinteresses eingefroren hatten, fuhr er fort, mich selbst – als „Sozialpfadfinder“ und Schriftsteller; doch in erster Linie: bedingungslos – weiter zu finanzieren.
Eben vor kurzem hab ich angefangen, das Problem einer sachgemäßen Finanzierung schreiberischer, publizistischer Tä-tigkeit zu untersuchen; einen Blogeintrag aus diesem Zusam-menhang findet man hier.
Vielleicht können wir das Problem hier oder andernorts oder einfach per Korrespondenz weiterverfolgen.
4 4 4
Von den Funktionierenden
[unter http://klamurkisches.blogspot.com/2011/01/von-den-funktionierenden.html ver-öffentlichter Blogeintrag; bei Bedarf kann man dort auch Kommentare hinterlassen]
Das in Nachfolgendem behandelte Problem wurde an vor-liegendem Orte schon von den verschiedensten Seiten aus betrachtet; und wenn es nun schon wieder behandelt wird, so hat das damit zu tun, daß es dem Herrn Verfasser als gewichtig erscheint.
Also:
Viele Menschen verwechseln das Funktionieren der Struktu-ren, in die sie eingebettet sind, mit ihrem eigenen Funktionie-ren. Über die Natur dieses Funktionierens machen sie sich keine Gedanken und verachten mit selbstverständlicher Verachtung diejenigen, die ihrem Verständnis nach nicht so gut funktionie-ren.
Das geht so lange gut, bis sie aus ihren gewohnten funktio-nierenden Strukturen herausfliegen, oder bis die Strukturen kaputtgehen und sie nicht mehr wie gewohnt tragen können.
Ungeübt im selbständigen Hinterfragen, unfähig, sich in unge-wohnten Situationen zurechtzufinden, werden sie dann umso hilfloser, und ihre frühere unreflektierte Überheblichkeit weicht genau so unreflektiertem Beleidigtsein.
Das Potential für künftige soziale Unruhen liegt eben bei die-sen unreflektiert beleidigten (von denen viele zu dem Moment, da diese Zeilen geschrieben werden, sich noch in ihrer trügeri-schen Sicherheit wiegen und keine Ahnung haben, was auf sie zukommt).
Keinesfalls aber liegt ein solches Unruhepotential bei denjeni-gen, welche die tragenden Strukturen hinterfragen und auf De-fekte aufmerksam machen. Der Denkende wird (wenn er nicht vom Denken in destruktive Programme oder sinnlose Emotio-nalität abschwenkt) immer bemüht sein, die Situation zu verste-hen und nach evolutiven Wegen zu suchen.
Die eigentlich kritische Masse für soziale Unruhen liegt bei der jetzt noch satten und zufriedenen Mehrheit.
4 4 4
Zum Alptraum verkehrter Traum
[Unter http://klamurkisches.blogspot.com/2011/01/von-den-funktionierenden.html ver-öffentlichter Blogeintrag; bei Bedarf kann man dort auch Kommentare hinterlassen]
Seit Jahrzehnten ist Arbeitslosigkeit das große Ideal: Eine lichte Zukunft, in welcher alle Arbeit von Maschinen verrichtet wird, und der Mensch darf herumhocken und konsumieren.
Vor lauter Lust am Konsum äußerer Güter kam man leider nicht dazu, aufmerksamer in sich hineinzuschauen. Sonst hätte man nämlich merken müssen, daß der eingeborenen, anerzo-genen, eingefleischten Gesinnung nach nur derjenige als voll-wertiger Mensch betrachtet wird, der gegen Geld irgendeine wie auch immer geartete Tätigkeit verrichtet oder gegen Bezah-lung zumindest so tut, als verrichte er eine Tätigkeit.
Die faktische Annäherung an das eingangs erwähnte Ideal, die Arbeitslosigkeit also, wird nun mit abwertendem Beigeschmack als Krisensituation betrachtet; und die immer zahlreicher wer-denden Zeitgenossen, die sich keine bezahlte Tätigkeit oder kein bezahltes Vortäuschen von Tätigkeit verschaffen können, werden entsprechend zu „Arbeitslosen“ und in der öffentlichen Meinung zu Menschen zweiter oder noch niederer Sorte.
Laut herrschender Sichtweise ist also als ernstzunehmende Arbeit nur eine solche Tätigkeit oder ein solches Vortäuschen von Tätigkeit zu betrachten, für das man bezahlt wird oder das man auf Befehl tut; alles andere ist Hobby, ehrenamtliches Tun oder sonstwas unseriöses.
Wer kein Einkommen bekommt über solcherart definierte Arbeit und auch über sonst keine Mittel verfügt, der bekommt vom Staat Unterstützung.
Solche Einrichtung schafft Unmengen neuer bezahlter Ar-beitsplätze, die mit der Verteilung dieser Unterstützung zu tun haben und, vor Allem, mit der Kontrolle und dem Gängeln der Unterstützten. Die einen kontrollieren, ob sie, die Arbeitslosen, nicht doch heimlich arbeiten; andere sind damit beschäftigt, ih-nen subalterne Tätigkeiten zu vermitteln und zu kontrollieren, ob sie auch alles tun, was man ihnen sagt; und was es an Kon-troll- und Zwangsfunktionen sonst noch gibt.
Die herrschende Mentalität verkehrt also in der Annäherung an die Erfüllung des erträumten Ideals das Ideal in einen Alp-traum, schafft dafür aber ein Heer gutbezahlter Beamter, denen wir natürlich von Herzen ihren Wohlstand gönnen.
(ob ernstzunehmende Arbeit tatsächlich untrennbar mit Ein-kommen gekoppelt sein muß und ob solche Koppelung bloß ein bei näherer Untersuchung in sich zusammenfallendes Vorurteil ist, und ob, falls das bloß ein Vorurteil ist, es nicht sinnvoller wäre, das kostspielige kontrollintensive Unterstützungssystem durch ein sogenanntes „bedingungsloses Grundeinkommen“ zu ersetzen, wollen wir hier nicht weiter untersuchen, da wir da-durch die Existenzgrundlage jener entstehenden Beamtenhee-re antasten würden)
Eben.
4 4 4
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 8 -Kulturelle Wurzeln und bedingungsloses
Grundeinkommen
[Unter http://klamurkisches.blogspot.com/2010/08/kulturelle-wurzeln-und-bedingungs-loses.html veröffentlichter Blogeintrag, wo man bei Bedarf auch Kommentare hinterlassen kann]
Ursprünglich Beitrag in einem Forum zum Thema „Bedingungsloses Grundeinkommen“, in das ich mich mal eingeklinkt hatte und kurz darauf wieder ausklinkte; Eingehen auf einen Beitrag, darin die Forderung aufgeführt wurde, man müsse sich auf die „kulturellen Wurzeln“ besinnen. Wider Erwarten wurde mein Beitrag nicht verstanden (damals lebte ich noch in dem Vorurteil, klar Formuliertes könne auch klar verstanden werden; inzwischen habe ich solche Erwartungen über Bord geworfen und leb seitdem viel ruhiger)
Wenn man unter „Kultur“ das versteht, was ursprünglich dar-unter verstanden wurde, ist es zweifellos so, daß wir ohne Wie-dergewinnung unserer „kulturellen Wurzeln“ nichts erreichen können und weiter frischfrommfröhlichfrei dem Abgrund ent-gegenschlittern werden.
Wenn man aber unter „Kultur“ das versteht, was man heute gemeinhin mit solchem Worte meint, wird das Beschwören sol-cher „Wurzeln“ uns auch nicht weiterhelfen.
Kultur im ursprünglichen Sinne ist ja nicht das, was wir in Bü-chern lesen, im Theater auf der Bühne sehen oder im Museum uns angucken. Kultur im eigentlichen Sinne ist die Entwicklung unseres lebendigen Verstehens unserer selbst und unserer Um-gebung sowie das durch solches lebendige Verstehen getragene äußere Geschehen. Bei solcher Entwicklung können diese und jene Bücher – so man sie richtig liest – eine Hilfe sein; für sich genommen hat das Lesen von Büchern – und selbst von sol-chen, die im Rufe stehen, ganz besonders gescheite Bücher zu sein – nix zu tun mit eigentlicher Kultur.
Zum Beispiel scheint mir, daß mit der Problematik um das „bedingungslose Grundeinkommen“ eng verknüpft ist die Pro-blematik der Motivation zum Tätigsein; und eben im Bereich der Motivation kommt es durch die gewohnte Koppelung von Arbeit und Einkommen bei mehr zum Aufwachen neigenden Zeitgenossen zu ganz fatalen Knoten und Wirrnissen; hier, zum Beispiel, gäbe es viel zu tun; nicht vermittels Konstruieren ge-scheiter Theorien natürlich, sondern vermittels verstehenden Beobachtens und Aufdröselns. Ganz im Sinne übrigens der eigentlichen „kulturellen“ Wurzeln. Und vieles andere mehr; und ohne bewußte Auseinandersetzung mit der Bewußtsein-sproblematik, mit der „kulturellen“ Problematik bleiben auch die Bestrebungen zum „bedingungslosen Grundeinkommen“ einfach bloß ein politisches Programm neben anderen politi-schen Programmen; zudem ohne große Chancen auf Realisie-rung; während bei stärkerer Berücksichtigung der zugrundelie-genden „kulturellen“ Komponenten selbst bei Nichterreichen des gesteckten Ziels ein „Scheitern“ gar nicht möglich wäre, da der Gewinn an geistiger Beweglichkeit, an „Bewußtsein“ in ver-schiedenster Weise und in verschiedensten Richtungen immer sozial fruchtbar wird: „Der Geist weht, wo er will.“
Das Abdriften der Kultur ins Nachahmen der Kultur, in dem wir heute – meist ohne es zu merken – mitten drin stecken, wur-
de als Tendenz ja schon recht früh bemerkt und geschildert; und mir scheint, daß es nötig wäre, diese Driftbewegung bis zu ih-rem fatalen Endpunkt retrospektiv nachzuverfolgen, damit wir besser verstehen, wo wir jetzt sind.
In diesem Sinne: Unter dem Titel „Genealogie des Bildungs-philistertums“ (S. 11) findet man einen in diesem Zusammen-hang relevanten Zusammenschnitt bezeichnender Aussagen aus einer Arbeit von Nietzsche (ich meine damit nicht Nietzsche als im Panoptikum der „Gebildeten“ herumstehende Wachsfi-gur, sondern als unter jenem Abdriften leidenden und es beob-achtenden lebendigen Menschen)
Und ein unter dem Titel „Phrase, Konvention, Routine“ ver-öffentlichter Auszug aus einem Vortrag zu diesem Thema, der irgendwann um 1920 gehalten wurde auf Seite 12
So viel, möglichst kurz und doch zu lang, über kulturelle Wur-zeln sowie deren Nachahmen im Hinblick auf deren Bedeutung für die Problematik des Bedingungslosen Grundeinkommens.
So isses
4 4 4
Gedanken zu einer sinnvollen Verlagstätig-keit
[Unter http://klamurkisches.blogspot.com/2010/03/gedanken-zu-einer-sinnvollen.html veröffentlichter Blogeintrag, wo man bei Bedarf auch Kommentare hinterlassen kann]
Was heutzutage an Gedrucktem durch die Gegend schwirrt, ist für anspruchsvollere Gemüter nicht immer geeignet und wird nicht selten sogar als Zumutung empfunden. Kommentar eines Zeitgenossen zur deutschen Presse siehe etwa „Das ganz verdammte Mediending“ (http://kaliban.de/2010/03/das-gan-ze-verdammte-mediending/); und was die Ernsthaftigkeit des etablierten deutschsprachigen Literaturbetriebs betrifft, so gab es zum Beispiel – zumindest für den Verfasser vorliegender Zei-len – höchstlich interessante Einblicke anläßlich des Rummels um jenes Fräulein Hegemann.
Das hat vermutlich teilweise mit einer mangelnden Vorbe-reitung der Verantwortlichen zu tun (die ja zum Großteil die jedes Gespür für sprachliche Echtheit und logische Stringenz unterwandernde Bildungsphilister-Ausbildung über sich erge-hen ließen), teilweise auch mit ganz banalen Sachzwängen: In der periodisch erscheinenden Presse etwa hat man zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge Text bereitzu-stellen; und da nimmt man, da einem nix anderes übrig bleibt, das, was da ist: Hauptsache, die Menge stimmt; auch wenn das, was da ist, nicht immer das ist, was gebraucht würde. Und die Schreiber – die zum Teil durch die gleiche unsinnige Ausbildung abgestumpft wurden – schreiben in der Regel nicht, weil sie von sich aus etwas Bestimmtes zum Ausdruck bringen möchten, sondern weil sie, um leben zu können, zu einem bestimmten Termin eine bestimmte Menge Text zusammenschreiben müs-sen. Also schreiben sie zusammen: mit entsprechendem Resul-tat (und dieses Resultat ist, bei einem autoritätshörigen, auf die etablierte Presse ausgerichteten Publikum, mitunter gemeinge-fährlich).
Dann gibt es noch das Internet. Im Internet findet man, ohne viel suchen zu müssen, mitunter gar noch schlimmeren Unsinn als in der Druckwelt; dafür hat man aber die Chance, mit etwas
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 9 -Glück und Ausdauer auch Lesbares zu finden. Denn im Internet gibt es fast alles.
Das Internet hat bloß den Nachteil, daß man das alles ab Computerschirm lesen muß; und ab Computerschirm lesen ist mühsam; bei anspruchsvolleren Texten, wo man sich konzen-trieren muß, verliert man da leicht mal den Faden.
Also ausdrucken. Auch nicht ganz das Wahre. Aber besser als nix.
Oder….
Nachfolgende Gedanken stammen in ihrem Ansatz nicht von mir; ich entdeckte sie im Blog von Erika Reglin (http://bedin-gungslosesgrundeinkommen.wordpress.com/2010/03/21/je-den-tag-ein-ei/#more-657) und entwickle sie nur ein Stückchen weiter.
In meinem Blogeintrag „Gedanken zu Schreiben, Copyright, Texteklau und damit verbundenes“ (Seite 10) spreche ich kurz die Folgen an, die aus der unreflektierten Kopplung von Arbeit und Einkommen für den kulturellen, publizistischen Bereich entstehen; und bedauerte bei der Gelegenheit, daß es nicht möglich ist, zu dieser Thematik mit den Verfechtern eines „Be-dingungslosen Grundeinkommens“ ins Gespräch zu kommen. Die Betreiberin jenes Blogs ist nun genau in jenem Bereich an-gesiedelt. Sehr gut; vielleicht lassen sich diese Gedanken, als Vorbereitung zu äußeren Taten, weiterentwickeln.
Stichwortartig der Weiterentwicklung bedürftige Bezugs-punkte (ansatzweise wurde manches, wie ich weiß, bereits rea-lisiert):
• Die Mitglieder des Redaktionskollegiums einer solchen Zeitung, Zeitschrift oder eines Buchverlags (solche Re-daktionen kann es natürlich beliebig viele geben) suchen das Netz ab nach geeigneten Beiträgen (dabei bilden sich für die einzelnen Redaktionen mit der Zeit ganz selbst-verständlich „Reservoire“ von Stammautoren, auf die man sich konzentriert).
• Das Copyright bleibt hiervon unberührt: Veröffentlichung nur mit Einwilligung des betreffenden Autoren. Höhe ei-ner allfälligen Gewinnbeteiligung müßte – so überhaupt Gewinn anfällt – im Einzelnen abgeklärt werden.
• Es gilt, nach Wegen zu suchen, die verhindern, daß der Autor unter dem Druck finanziellen Bedarfs schreibt (eben dieser Druck führt dazu, daß besonders „profes-sionelle“ Autoren immer weniger professionell werden). Wie sich solches erreichen läßt ist eine andere – wie mir scheint: nicht unlösbare – Frage. Eben hier wäre es in-teressant, die Sache mit – nicht stur nach Verwirklichung irgendwelcher Programme strebenden, sondern gedank-lich beweglichen – Vertretern der Richtung eines „Bedin-gungslosen Grundeinkommens“ durchzusprechen. Eine flächendeckende Realisierung dieses Gedankens scheint mir unwahrscheinlich (teilweise, eben, aufgrund leicht-fertiger von „Brotschreibern“ verfaßter Berichterstat-tung zu diesem Thema in der etablierten Presse); aber vielleicht ließen sich bei entsprechender Beweglichkeit zumindest in kleinerem Rahmen Lösungsansätze schaf-fen (um Mißverständnisse im Keime zu ersticken: ich mei-ne damit nicht so sehr mich selbst; ich selbst habe dank großzügiger Förderung ein bescheidenes „bedingungslo-ses Grundeinkommen“, das es mir erlaubt, in bescheide-nem Rahmen tätig zu sein; es geht mir um Ansätze zu einer allgemeinen Lösung des Problems)
• Man kann die Sache dann in die verschiedensten Rich-tungen hin weiterverfolgen. Zum Beispiel ließen sich Aus-gaben denken, die sich auf Übersetzungen interessanter Texte aus anderen Sprachen spezialisieren; was, beson-ders bei Berichterstattung zu aktuellen Ereignissen, noch den Vorteil hätte, daß sich selbige Ereignisse von den al-lerverschiedensten Seiten her betrachten lassen; Tatsa-chenentstellungen aus Leichtfertigkeit oder mit der Ten-denz bewußter Irreführung blieben da mit der Zeit auf der Strecke. – Hier ließe sich, zum Beispiel, mit Sprachen-schulen zusammenarbeiten, indem Studenten, die in ihrer Muttersprache genügend beweglich sind, übungs-halber Texte aus Sprachen übersetzen, die sie studieren, und dabei ein größeres Publikum an den Resultaten ihrer Übungen teilhaben lassen.
• Da es bei solchem Verfahren auf Dauer eher gelingen könnte, anspruchsvolle Texte zusammenzubekommen, die für längere Zeit aktuell bleiben, könnte man dann auch die periodische, sich auf das Wesentliche beschrän-kende periodische Presse in eine handlichere, sich der Buchform annähernde Erscheinung bringen (natürlich Sache der einzelnen Verlage)
• Wie gesagt: Daß es hierzu bereits Ansätze gibt ist mir bekannt; es geht mir nur um den Versuch, aus diesen verstreuten Ansätzen eine prinzipielle Lösung, oder auch mehrere prinzipielle Lösungen herauszuentwickeln, die den Druckerschwärzemorast in eine fruchtbare Land-schaft verwandeln könnten.
Ausdrücklich möchte ich noch betonen, daß ich diese Denk-ansätze nicht als „Alternative“ zum etablierten Publikationsbe-trieb betrachte. An eine „Alternative“ zu etwas Bestehendem kann ich nur denken, wenn ich dieses Bestehende ernst neh-me; und mit Ernstnehmen habe ich in vorliegendem Fall etwas Mühe. Ganz einfach geht es mir darum: wie man Wege schla-gen kann zu einem sinnvollen, qualitätsvollen Publizieren.
Eben
4 4 4
Leistung muß sich wieder lohnen
[unter http://klamurkisches.blogspot.com/2010/03/leistung-mu-sich-wieder-lohnen.html veröffentlichter Blogeintrag, wo man bei Bedarf auch Kommentare hinterlassen kann]
Aus deutschen Nachrichten erfuhr ich, daß da ein Kabaret-tist namens Lerchenberg bei einem Auftritt anläßlich einer vergnüglichen Veranstaltung den Rahmen des belanglosen Ver-gnüglichen sprengte und zur Sache kam; weswegen er in Zu-kunft bei selbigen vergnüglichen Veranstaltungen nicht mehr auftreten darf.
Einen gewissen Westerwelle hatte er dabei aufs Korn genom-men mit dessen Äußerungen bezüglich sogenannten Hartz-IV-Empfängern, d.h. bezüglich einer in Deutschland ständig wachsenden Menschengruppe, die durch die Umstände zügig ins materielle Elend getrieben wird. Die Sichtweise jenes Herrn Westerwelle hatte er in verschiedenen Andeutungen mit der, natürlich längst überwundenen, Nazi-Ideologie in Verbindung gebracht. Eben weil man fand, daß die Nazi-Ideologie doch längst überwunden ist, daß man sie folglich auch nirgendwo entdecken kann und daß das Inverbindungbringen heutiger
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 10 -hochgeehrter Politiker mit selbiger Ideologie eine Beleidigung ist – darf er bei ebenselbigen vergnüglichen Veranstaltungen nicht mehr auftreten.
Mit der Nazi-Ideologie hat Lerchenberg natürlich Recht; nur Westerwelle tut er Unrecht. Recht hat er insofern, als die Nazi-Ideologie tatsächlich nicht untergegangen ist und in verwan-delter Gestalt ungestört und immer stärker ihr Unwesen treibt; und zwar nicht nur in Deutschland. Diese menschenverachten-de Ideologie ist nämlich, wie mir scheint, nicht an Nationen gebunden; nur daß bei der deutschen Gründlichkeit – welch-selbige Gründlichkeit genausogut sich in menschenfreundliche-ren Richtungen austoben könnte – selbiger Geist oder Ungeist sich auf eine sehr spezifische, sehr gründliche Art zu verkörpern pflegt. Daß beim Umgang der Herrenmenschen mit den ins Elend getriebenen Hartz-IV-Untermenschen genau der gleiche Ungeist im Spiel ist, der sich, in griffigerer Gestalt im Hitlertum austobte (doch auch für die damaligen Zeitgenossen war er, der Ungeist, damals nicht griffig genug; griffig wurde das erst, als al-les vorbei war) – daran kann bei näherem Hinsehen kein Zweifel bestehen.
Und Westerwelle tut er insofern Unrecht, als Westerwelle nur klar auf den Punkt bringt, was sowieso schon in fast aller Köpfen ist. Für sich genommen scheint er harmlos.
Mit Arbeit und Leistung hat dieses Hartz-IV-hafte ins Elend Abgedrängtwerden nichts zu tun. Mir scheint, daß fast jeder mehr oder weniger normale Mensch, wenn er nicht in Resi-gnation oder Zynismus getrieben wird, das ganz natürliche Bedürfnis entwickeln kann, sich durch irgendwelche Arbeit, ir-gendwelche Leistung in seine soziale Umgebung einzubringen. Doch eben dies wird, besonders in der sogenannten zivilisierten Welt, durch bürokratische Schikane zunehmend erschwert. Was immer sich an Leistung und Arbeit außerhalb der ausgelatsch-ten Pfade bewegt, wird durch wirtschaftliche und bürokrati-sche Zwänge weitmöglichst abgewürgt; und innerhalb der aus-gelatschten Pfade breitet sich immer mehr das aus, was man „Arbeitslosigkeit“ nennt. Der Einzelne, der von dieser Elends-welle erfaßt wird, hat da kaum noch eine Chance; ganz egal, wie begabt er ist und wie arbeitswillig, was für Ideen er hat, die er realisieren möchte, ganz egal, wie weit es ihm gelingt, trotz allem sich von Resignation und Zynismus freizuhalten: in der Regel ist er zum Darben und zur Untätigkeit verurteilt. (wenn ein Weiterspinnen des Vergleichs mit jener „Arbeit macht frei“ – Stätte gestattet ist: die dorthin abgeschobenen waren ja in ihrer Mehrheit durchaus arbeitswillig und nicht unbegabt, teil-weise sogar hochbegabt; die meisten hatte man aus konkreten Arbeitszusammenhängen herausgerissen, wo sie sich nützlich machten; Ärzte waren darunter, Universitätsdozenten; und nun mußten sie unter der Aufsicht analphabetischer Aufseher das ausführen, was man an jener Stätte als „Arbeit“ definiert hatte. – Bei den von Lerchenberg angesprochenen Heutigen ist es al-lerdings häufig so, daß sie nicht einmal dazu kamen, ihre Bega-bungen zu entdecken und zu entwickeln. Letzteres übrigens ein noch näherer Untersuchung würdiges eigenes Kapitel unserer zeitgenössischen Kulturgeschichte)
Mir scheint, daß diese unerquickliche Entwicklung in der sogenannten zivilisierten Welt einem gewissen Höhepunkt zustrebt, wo das soziale Geschehen entweder in polizeistaatli-chem Totalitarismus erstarrt oder sich in Chaos auflöst. Die Hi-nentwicklung auf diesen Höhepunkt bietet aber auch gewisse Chancen insofern, als zumindest diejenigen, die dabei ins sozi-ale Untermenschentum hinweggespült werden, die Möglichkeit erhalten, aufzuwachen und sich von dem anerzogenen Idiotis-mus zumindest innerlich zu befreien.
Vielleicht ergeben sich dann aus den anlaufenden Erkenntnis-prozesse sinnvolle Entwicklungen: so es nicht bereits zu spät ist.
So isses.
4 4 4
Gedanken zu Schreiben, Copyright, Texte-klau und damit verbundenes
[unter http://klamurkisches.blogspot.com/2010/02/gedanken-zu-schreiben-copyright.html veröffentlichter Blogeintrag, wo man bei Bedarf auch einen Kommentar hinterlassen kann]
Ausführlicher habe ich mich dazu in meinem „Aktualisie-rungsblog“ geäußert (http://klamurkische-aktualisierungen.blogspot.com/2010/02/warum-ich-meine-deutschen-texte-trotz.html).
In knappem Überblick sei folgendes gesagt:
• Essayistik und Belletristik aus meiner Feder bzw. Tastatur, die mir über die Grenzen der eigenen vier Wände hinaus interessant scheint, veröffentliche ich ohne jede finanzi-elle Erwägungen, damit es jedem, dem das interessant sein könnte, zugänglich ist, und stellenweise veröffentli-che ich es in solcher Form, daß man es bequem an allfäl-lige weitere Interessierte weitergeben kann.
• Mit meiner schreiberischen Tätigkeit strebe ich weder einen Status als „Schriftsteller“ an noch irgendwelchen finanziellen Gewinn.
• Der offizielle Kulturbetrieb mit seinen Schriftstellern, Preisträgern und Preisverteilern interessiert mich höch-stens insofern, als er neben der ins Kraut schießenden belanglosen Spielerei auch noch Ernstzunehmendes bie-ten kann. Die Zielgruppe meiner Schreiberei beschränkt sich auf die Sphäre derjenigen, die etwas damit anfangen können; schriftstellerischen Ruhm im Sinne der heutigen Auffassung strebe ich nicht an, im Gegenteil würde ich ihn sogar als störend empfinden, da solcher Ruhm die Sphäre der ehrlich Interessierten aufsprengen würde in Richtung auf ein Publikum, das sich für nichts interessiert und nur mitreden möchte; wodurch alles verwässert würde.
• Im Hinblick auf diesen Kreis der ehrlich Interessierten be-trachte ich mich als berufsmäßigen Schreiber.
• Mit der Veröffentlichung meiner Arbeiten verbinde ich, wie gesagt, keine finanziellen Interessen und finde es in Ordnung, wenn sie ohne mein Wissen, aber un-ter meinem Namen frei weiterverteilt werden. - Womit ich aber unter keinen Umständen einverstanden wäre: daß irgendwelche Ehrgeizlinge sich mit meinen Texten schmücken, sie als dir ihrigen ausgeben. Diese Texte sind Produkte oder Nebenprodukte eines nicht ganz einfa-chen Entwicklungsweges, abseits allen persönlichen Ehr-geizes; einen solchen Mißbrauch würde ich als Beleidi-gung empfinden, gegen die ich mich gegebenenfalls zur Wehr setzen würde. Ich sehe das Copyright mehr von der Seite des Persönlichkeitsschutzes, weniger von der Seite des Finanziellen (wobei es mich natürlich zusätzlich noch ärgern würde, wenn irgendwelche Texteklauer mit mei-
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 11 -nen Texten verdienen würden, während ich selbst sehen muß, wie ich über die Runden komme).
• In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die alte Frage nach dem Verhältnis zwischen Arbeit und Einkom-men. Bewußte Auseinandersetzung mit den verheeren-den Folgen der Kopplung von Arbeit und Einkommen im Bereich der kulturellen Entwicklung kann man natürlich von den Vertretern des offiziellen Kulturbetriebs nicht erwarten; die sehen det alles in wirrer Vereinfachung und sind sowieso nicht gemeint. Gemeint sein könnten etwa die Vertreter des Postulats eines „Bedingungslosen Grundeinkommens“, da hier eine solche Auseinander-setzung - wie aus den griffigen Konsequenzen ersichtlich - zumindest im Hintergrund stattfindet oder stattfand. Versuche, ins Gespräch zu kommen, brachten allerdings nix; und es ergab sich der fatale Eindruck, daß man da hauptsächlich in Programmen lebt und sich mit deren Modifizierungen oder Durchführungsmöglichkeiten herumschlägt; was als Konsequenz einer gedanklichen Durchdringung natürlich ganz nett wäre, aber angesichts des Bedarfs an weitergehender gedanklicher Durchdrin-gung doch nicht ganz das Wahre und ohne lebendigen gedanklichen Hintergrund möglicherweise zur Unfrucht-barkeit verdammt. Ich selbst seh die Sache nun etwas weiter, hab den Eindruck, daß da auch noch sehr viel gedankliche Feinarbeit geleistet werden muß; natürlich Hand in Hand, so weit das möglich ist, mit Durchführung im äußeren Leben, und ließ, mangels Gesprächspartnern, diese Frage erst mal beiseite (obwohl ich sie nach wie vor als sehr real und sehr dringlich betrachte)
• Es gibt viel zu tun. Packen wir es an.
• Prost.
4 4 4
Genealogie des Bildungsphilistertums
Zusammenschnitt aus Nietzsche:
„David Friedrich Strauss, der Bekenner und Schriftsteller“
(...) Man lebt jedenfalls in dem Glauben, eine echte Kultur zu haben: der ungeheure Kontrast dieses zufriedenen, ja trium-phierenden Glaubens und eines offenkundigen Defektes scheint nur noch den wenigsten und seltensten Überhaupt bemerkbar zu sein. Denn alles, was mit der öffentlichen Meinung meint, hat sich die Augen verbunden und die Ohren verstopft - jener Kontrast soll nun einmal nicht da sein. Wie ist dies möglich? Welche Kraft ist so mächtig, ein solches „soll nicht“ vorzuschrei-ben? Welche Gattung von Menschen muß in Deutschland zur Herrschaft gekommen sein, um so starke und einfache Gefüh-le verbieten oder doch ihren Ausdruck verhindern zu können? Diese Macht, diese Gattung von Menschen will ich bei Namen nennen - es sind die Bildungsphilister.
Das Wort Philister ist bekanntlich dem Studentenleben ent-nommen und bezeichnet in seinem weiteren, doch ganz popu-lären Sinne den Gegensatz des Musensohns, des Künstlers, des echten Kulturmenschen. Der Bildungsphilister aber - dessen Ty-pus zu studieren, dessen Bekenntnisse, wenn er sie macht, an-zuhören Jetzt zur leidigen Pflicht wird - unterscheidet sich von der allgemeinen Idee der Gattung „Philister“ durch einen Aber-glauben: er wähnt, selber Musensohn und Kulturmensch zu
sein; ein unbegreiflicher Wahn, aus dem hervorgeht, daß er gar nicht weiß, was Philister und was sein Gegensatz ist: weshalb wir uns nicht wundern werden, wenn er meistens es feierlich verschwört, Philister zu sein. Er fühlt sich, bei diesem Mangel an Selbsterkenntnis, fest überzeugt, daß seine „Bildung“ gerade der satte Ausdruck der rechten deutschen Kultur sei: und da er Überall Gebildete seiner Art vorfindet und alle öffentlichen In-stitutionen, Schul-, Bildungs- und Kunstanstalten gemäß seiner Gebildetheit und nach seinen Bedürfnissen eingerichtet sind, trägt er auch überallhin das siegreiche Gefühl mit sich herum, der würdige Vertreter der jetzigen deutschen Kultur zu sein, und macht dementsprechend seine Forderungen und Ansprü-che. (...)
Er nimmt um sich herum lauter gleiche Bedürfnisse und ähn-liche Ansichten wahr; wohin er tritt, umfängt ihn auch sofort das Band einer stillschweigenden Konvention über viele Dinge, besonders in betreff der Religions-und Kunstangelegenheiten: diese imponierende Gleichartigkeit, dieses nicht befohlene und doch sofort losbrechende tutti unisono verführt ihn zu dem Glauben, daß hier eine Kultur walten möge.(...)
Er haßt aber keinen mehr als den, der ihn als Philister behan-delt und ihm sagt, was er ist: das Hindernis aller Kräftigen und Schaffenden, das Labyrinth aller Zweifelnden und Verirrten, der Morast aller Ermatteten, die Fußfessel aller nach hohen Zielen laufenden, der giftige Nebel aller frischen Keime, die ausdorren-de Sandwüste des suchenden und nach neuem Leben lechzen-den Deutschen Geistes. Denn er sucht, dieser deutsche Geist! und ihr haßt ihn deshalb, weil er sucht, und weil er euch nicht glauben will, daß ihr schon gefunden habt, wonach er sucht. Wie ist es nur möglich, daß ein solcher Typus, wie der des Bil-dungsphilisters, entstehen und, falls er entstand, zu der Macht eines obersten Richters über alle deutschen Kulturprobleme heranwachsen konnte; wie ist dies möglich, nachdem an uns eine Reihe von großen heroischen Gestalten vorübergegangen ist, die in allen ihren Bewegungen, ihrem ganzen Gesichtsaus-drucke, ihrer fragenden Stimme, ihrem flammenden Auge nur eins verrieten; Daß sie Suchende waren, und daß sie eben das inbrünstig und mit ernster Beharrlichkeit suchten, was der Bil-dungsphilister zu besitzen wähnt (...)
Was urteilt aber unsere Philisterbildung Über diese Suchen-den? Sie nimmt sie einfach als Findende und scheint zu verges-sen, daß Jene sich selbst nur als Suchende fühlten. (...)
Um aber unsere Klassiker so falsch beurteilen und so be-schimpfend ehren zu können, muß man sie gar nicht mehr ken-nen: und dies ist die allgemeine Tatsache. Denn sonst müßte man wissen, daß es nur eine Art gibt, sie zu ehren, nämlich da-durch, daß man fortfährt in ihrem Geiste und mit ihren Mute zu suchen, und .dabei nicht müde wird.(...)
Dieser hat es zwar ganz gern, von Zeit zu Zeit sich den an-mutigen und verwegenen Ausschreitungen der Kunst und einer skeptischen Historiographie zu überlassen, und schätzt den Reiz solcher Zerstreuungs- und Unterhaltungsobjekte nicht gering; aber er trennt streng den „Ernst des Lebens“, soll heißen den Beruf, das Geschäft, samt Weib und Kind, ab von dem Spaß: und zu letzterem gehört ungefähr alles, was die Kultur betrifft. Da-her wehe einer Kunst, die selbst Ernst zu machen anfängt und Forderungen stellt, die seinen Erwerb, sein Geschäft und seine Gewohnheiten, das heißt also seinen Philisterernst antasten (...)
4 4 4
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 12 -Phrase Konvention Routine
(aus einem anno 1922 von dem österreichischen Denker R. Steiner gehaltenen Vortrag)
Nachfolgender Auszug aus einem am 3. Oktober 1922 gehaltenen Vortrag zeigt verschiedene Elemen-te jener fatalen Entwicklung auf, mit deren Folgen wir Heutigen uns, bewußt wie – in der Regel – un-bewußt, herumzuschlagen haben. Der Vortragende selbst, ein 1925 verstorbener österreichischer Denker, bezeichnet jene Entwicklung an anderen Stellen als „Ohnmächtigwerden des Geisteslebens“.
Im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts können Sie durch eine intime geschichtliche Betrachtung Merkwürdiges finden. Wenn wir dasjenige betrachten, was etwa so in jener Li-teratur, in jenem Schrifttum erscheint, das gelesen wird von al-len jenen Leuten, die doch an der Gestaltung des Geisteslebens teilnehmen, so finden wir, daß im letzten Drittel des neunzehn-ten Jahrhunderts, so bis in die Mitte der achtziger, neunziger Jahre hinein, innerhalb des deutschen Sprachgebietes ein ganz anderer Stil in den Journalen, sogar in den Zeitungen geherrscht hat als heute. Damals war ein Stil, der Gedanken ziselierte, Ge-danken ausgestaltete, der etwas darauf gab, gewisse Gedan-kengänge zu verfolgen; der etwas darauf gab, Schönheit in den Gedanken zu haben. Heute ist unser Stil, jener, den man mit so etwas im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts verglei-chen kann, roh und grob geworden. Man braucht nur irgend et-was, was es auch sei, m die Hand zu nehmen aus den sechziger, siebziger Jahren von Menschen, die nicht gelehrt, nicht studiert waren, nur allgemein gebildet waren, und Sie werden diesen großen Unterschied finden. Die Gedankenformen sind andere geworden. Aber das, was heute roh und grob ist, ist doch gerade aus dem hervorgegangen, was fein ziseliert, geistreich, oftmals im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts schon auch innerhalb der gelehrten Bildung üblich war. Aber eines sehen wir gerade damals, und diejenigen, die das noch mitmachten, die, ohne daß sie alt geworden sind, im Sinne unseres heutigen Geisteslebens, zu späteren Jahrgängen gekommen sind, die als solche das von dazumal mitgemacht haben, die haben es auch erlebt: Dasjenige, was dazumal so furchtbar einzog in alles Gei-stesleben, das ist das, was ich, symbolisch charakterisiert, die Phrase nennen möchte.
Und an dieser Phrase entwickelte sich die Gedankenlosigkeit, die Gesinnungslosigkeit und die Willenlosigkeit, die heute auf dem Wege sind, immer größer und größer zu werden. In erster Linie gingen diese Dinge aus der Phrase hervor. Die Phrase hat sich hauptsächlich herausgebildet im letzten Drittel des neun-zehnten Jahrhunderts. Sie können das auch äußerlich verfolgen, meine lieben Freunde. Die Dinge brauchen Ihnen nicht sympa-thisch zu sein, die da und dort in einem Zeitalter auftreten. Aber auch, wenn sie einem nicht sympathisch sind in der einen oder anderen Form, man kann sie in ihrer Bedeutung für den ganzen Menschenzusammenhang beobachten.
Nehmen Sie die innigen wunderbaren Töne, die im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts etwa in der deutschen Romantik anzutreffen waren. Nehmen Sie, ich möchte sagen, das manchmal wie aus frischer, gesunder Waldesluft heraus we-hende Reden über Geistiges bei so jemand wie Jakob Grimm, so werden Sie sich sagen: Da herrscht in Mitteleuropa noch nichts von der Phrase. Die zieht im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts erst in Mitteleuropa ein. Wer dafür eine Empfin-dung hat, der weiß schon, wie allmählich die Zeit heraufgekom-
men ist, wo da eintritt, was gegenüber der Phrase immer ein-treten muß: Wo die Phrase beginnt zu herrschen, da erstirbt die innerlich, seelisch erlebte Wahrheit. Und mit der Phrase geht einher ein Anderes. Das ist, daß der Mensch den Menschen nicht finden kann im sozialen Leben.
Meine lieben Freunde! Wenn der Ton aus dem Munde klingt so, daß er nicht Seele hat — wie es bei der Phrase der Fall ist —, dann gehen wir als Menschen neben dem anderen Menschen hin und können ihn nicht verstehen. Das ist eine Erscheinung, die auch wieder im letzten Drittel des neunzehnten Jahrhun-derts ihre höchste Höhe erlangt hat, nicht in den Seelentiefen drunten, aber im Bewußtsein. Die Menschen wurden wirklich einander fremd und immer fremder. Je mehr der Ruf ertönte nach sozialen Reformen und Impulsen, desto mehr ist dieser Ruf ein Symptom dafür, daß die Menschen unsozial geworden sind. Weil sie nichts mehr vom Sozialen fühlten, drängt es sie, nach dem Sozialen zu schreien. Das Tier, das hungrig ist, schreit nicht nach der Nahrung, weil es die Nahrung im Magen hat, sondern weil es sie nicht hat. Die Seele, die nach dem Sozialen schreit, schreit nicht, weil sie durchdrungen ist vom Sozialen, sondern weil sie diese Empfindung nicht hat. So wurde der Mensch nach und nach zu dem Wesen gemacht, dessen man sich heute nicht bewußt ist, aber das man sieht, im weitesten Umfang zwischen Mensch und Mensch herrschend, man hat gar nicht mehr das Bedürfnis, anderen Menschen seelisch nahezutreten. Die Men-schen gehen alle aneinander vorbei. Das meiste Interesse hat jeder Mensch nur an sich selber.
Was ist denn, im Grunde genommen, ganz besonders üblich geworden heraus aus dem letzten Drittel des neunzehnten Jahr-hunderts, herüber dann als soziale Empfindung von Mensch zu Mensch im zwanzigsten Jahrhundert? Sie hören einen Satz heu-te immer wieder und wieder: Das ist mein Standpunkt. So sagen die Leute: Das ist mein Standpunkt. Jeder hat einen Standpunkt. Als ob es darauf ankäme, was man für einen Standpunkt hat! Der Standpunkt im geistigen Leben ist nämlich ebenso vor-übergehend wie der Standpunkt im physischen Leben. Gestern stand ich in [...], heute stehe ich hier. Das sind zwei verschiede-ne Standpunkte im physischen Leben. Es kommt darauf an, daß man einen gesunden Willen und ein gesundes Herz hat, um die Welt von jedem Standpunkte aus betrachten zu können. Aber die Menschen wollen heute nicht, was sie von den verschiede-nen Standpunkten aus gewinnen, sondern es ist den Menschen wichtiger die egoistische Behauptung ihrer Standpunkte. Dann aber schließt man sich in der rigorosesten Weise von seinen Ne-benmenschen ab. Sagt einer etwas, geht man nicht ein auf das, was er sagt, denn man hat ja seinen Standpunkt. Aber dadurch kommt man sich nicht näher. Näher kommt man sich, wenn man seine verschiedenen Standpunkte weiß in eine gemein-same Welt hineinzustellen. Aber diese gemeinsame Welt fehlt heute ganz. Eine gemeinsame Welt für den Menschen findet sich nur im Geiste. Und der fehlt.
Das ist das Zweite. Und das Dritte ist: Wir sind im Grunde genommen im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts als mit-teleuropäische Menschheit nach und nach doch recht willens-schwach geworden — willensschwach—, in dem Sinne willens-schwach, daß der Gedanke gar nicht mehr die Kraft gewinnt, den Willen zu stählen, so daß der Mensch, der doch ein Gedan-kenwesen ist, aus seinen Gedanken heraus die Welt zu gestal-ten vermag.
Ja, meine lieben Freunde, wenn davon gesprochen wird, daß die Gedanken blaß sind, so sollte man das nicht zu der anderen Behauptung umgestalten, daß man keine Gedanken braucht, um als Mensch zu leben. Die Gedanken sollten nur nicht so schwach sein, daß sie da oben im Kopfe sitzen bleiben. Sie soll-
http://klamurke.com/Downloads.htm
- 13 -ten so stark sein, daß sie durch das Herz und durch den ganzen Menschen bis in die Füße hinunterströmen. Denn es ist wahr-haft besser, wenn statt bloßer roter und weißer Blutkügelchen auch Gedanken unser Blut durchpulsen. Es ist richtig, daß es wertvoll ist, wenn der Mensch auch ein Herz hat und nicht bloß Gedanken. Aber das Wertvollste ist, wenn die Gedanken ein Herz haben. Aber das haben wir ganz verloren. Die Gedanken, die die letzten vier bis fünf Jahrhunderte gebracht haben, kön-nen wir nicht mehr ablegen. Aber diese Gedanken müssen auch ein Herz bekommen.
Und, sehen Sie, jetzt will ich Ihnen ganz äußerlich einmal sa-gen, was in Ihren Seelen lebt. Sie sind herangewachsen, haben die ältere Generation kennengelernt. Diese ältere Generation hat sich in Worten dargestellt. Sie konnten nur Phrasen hören. In dieser älteren Generation stellte sich Ihnen dar ein unsoziales Element. Der eine ging an dem anderen vorbei. In dieser älteren Generation stellt sich Ihnen auch dar die Ohnmacht des Gedan-kens, den Willen, das Herz zu durchpulsen.
Sehen Sie, mit der Phrase, mit dem antisozialen Konventiona-lismus und mit der bloßen Lebensroutine, statt der herzlichen Lebensgemeinschaft konnte man so lange sich halten, als noch die Erbschaft von den vorigen Generationen vorhanden war. Die Erbschaft war ungefähr am Ende des neunzehnten Jahrhun-derts dahin. So sahen Sie etwas, was überhaupt nicht mehr zu der eigenen Seele sprechen konnte. Es war nichts da, was zu der eigenen Seele sprechen konnte. Nun fühlten Sie, daß in den Tiefen da unten, gerade in Mitteleuropa, etwas vorhanden ist, was das tiefste Bedürfnis hat, wiederum das zu finden, was ein-mal gelebt hat jenseits der Phrase, jenseits der Konvention, jen-seits der Routine. Wiederum Wahrheit zu erleben, wiederum
menschliche Gemeinschaft zu erleben, wiederum Herzhaftig-keit des ganzen Geisteslebens zu empfinden. Wo ist denn das? So sagt eine Stimme in Ihrem Innern.
Und oftmals hat man, wenn auch nicht klar und deutlich aus-gesprochen, aber klar und deutlich tatsächlich sehen können, nebeneinander den jungen Menschen und den alten Menschen gerade in der Zeit, als die Morgendämmerung des zwanzigsten Jahrhunderts heraufkam. Den alten Menschen und den jungen Menschen. Der alte Mensch, der sagt: Das ist mein Standpunkt. Ach, die Menschen hatten allmählich, als das neunzehnte Jahr-hundert zu Ende ging, alle, alle ihren Standpunkt. Der eine war Materialist, der andere Idealist, der dritte Realist, der vierte Sensualist usw. Sie hatten alle ihren Standpunkt. Aber allmäh-lich unter der Herrschaft von Phrase, Konvention und Routine war der Standpunkt auf einer Eiskruste angekommen. Die gei-stige Eiszeit war gekommen. Nur daß das Eis dünn war, und da die Standpunkte der Menschen die Empfindung für ihr eigenes Gewicht verloren hatten, so durchbrachen sie nicht die Eiskru-ste. Sie waren außerdem in ihrem Herzen kalt, sie erwärmten die Eiskruste nicht. Die Jüngeren standen neben den Alten, die Jüngeren mit dem warmen Herzen, das noch nicht sprach, aber das warm war. Das durchbrach die Eiskruste. Und der Jüngere fühlte nicht: Das ist mein Standpunkt, sondern der Jüngere fühl-te: Ich verliere den Boden unter den Füßen. Meine eigene Her-zenswärme bricht dieses Eis auf, das sich zusammengezogen hatte aus Phrase, Konvention und Routine. Wenn auch nicht deutlich ausgesprochen — denn heute wird nichts deutlich aus-gesprochen —, eine Erscheinung, die man immer wieder und wiederum finden kann — in Wahrheit war sie seit langem vor-handen und ist auch in der Gegenwart vorhanden.
4 4 4
Nachbemerkung
Von einem BGE-Aktivisten wurde zu den oben zusammengefaßten Ausführungen angemerkt: das sei rein auf akademischem Niveau und für die meisten nicht verständlich. – Da ich kein Akademiker bin werden Akademiker natürlich die Nase rümpfen und sagen, daß das nicht auf akademischem Niveau ist. – Doch auch ich selbst sage: daß es nicht auf akademischem Niveau ist. Ich habe einfach auf meine Weise versucht, Gedankengänge anzudeuten, die mir in Zusammenhang mit dem BGE (wie überhaupt: in Zusammenhang mit einer menschenwürdigen Entwicklung des sozialen Zusammenhangs) wichtig scheinen, und bin der Ansicht: daß man ohne gründliches Bewußtmachen der Hintergründe eines BGE-Postulats, rein mit Programmen auf politisierender Ebene, rein gar nix erreichen kann. Doch möchte ich mich da weiter nicht einmischen….
Übrigens ist das nicht als Vorwurf gemeint gegenüber demjenigen, der diesen Einwand vorbrachte; letztendlich hat er nur das ausgesprochen, was auch mir selbst schon aufgefallen ist: dass nämlich det alles - ob akademisch oder nicht - für die meisten viel zu kompliziert ist oder zumindest zu uninteressant, als daß sie sich damit herumschlagen möchten.
4 4 4
Verfasser und - wo zitieret - Zitierer von all diesem Geschriebenen:
Raymond Zoller
, ,