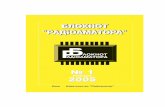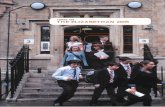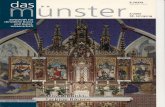2005 - Bilderwelten und Religionswechsel
-
Upload
uni-erfurt -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of 2005 - Bilderwelten und Religionswechsel
JÖRG RÜPKE
Bilderwelten und Religionswechsel
1. EinleitungDer Zugriff dieses Bandes lebt vonÜberraschungen. Der Ausgangspunkt derÜberraschungen ist eine leichtnachzuvollziehende Spannung. Erzählungen einerpolytheistischen Götterwelt, Erzählungen vonStreitigkeiten und Konflikten, Liebschaften undEhen, gezeugter und gewählter Nachkommenschaftstehen einem monotheistischen Glauben gegenüber.Was lässt diese Spannung erwarten? NatürlichKritik, Ablehnung, Spott, Zerstörung gar. DieApologetik des Minderheitsglaubens im drittenJahrhundert beschränkt sich noch auf die zuerstgenannten Umgangsformen: nüchterne undpolemische Kritik, beißender Spott auch: Ist esSterculus, der Gott der Misthaufen, der für dasWeltreich verantwortlich ist, das die Römer denGöttern verdankt glauben?,1 fragt Tertullian. Diedurch nunmehr christliche Obrigkeiten desvierten Jahrhundert gedeckten Radikalen gehenaber noch weiter: Bilder- und Tempelzerstörungwird zu einer Landplage. Das bringt die Städte,deren Kultbauten gerade ihren Ruhm ausmachen undihre Identität als Gemeinwesen gegenElitenflucht, Steuerruin und Barbaren stärken,in noch stärkere Bedrängnis und führt ebensolokal wie reichsweit zu Gegenreaktionen undgesetzlichen Maßnahmen der Provinzleitungen undKaiser.2
1 Tert. nat. 2,17,3.2 H.R. Meier, Alte Tempel - neue Kulte. Zum Schutz
obsoleter Sakralbauten in der Spätantike und zur
2 Jörg Rüpke
Aber nicht erst am Strukturerhalt des ImperiumRomanum findet die christliche Polemik ihreGrenze. Die nähere Beobachtung zeigt vielfachanderes: Benutzungen, Umdeutungen, Aneignung dergriechisch-römischen Mythologie. Und genau dieseüberraschenden Beobachtungen werden in denBeiträgen dieses Bandes vorgestellt.Die vielfachen Grenzüberschreitungen zwischen
Christentum und Paganismus scheinen sich vorallem in zwei Modellen fassen zu lassen. Daserste betont die nur allmähliche Entwicklungeiner christlichen Bildersprache. Zwar bietetsowohl das Judentum eine ausgebaute Ikonographieund eine komplexe, die langsam kanonischwerdenden Texte überschreitende Erzählwelt,3 dochist das auch in neue geographische wie sozialeRäume vorstoßende Christentum noch lange aufnichtchristliche wie nichtjüdische Künstler,Maler, Bildhauer, Mosaikarbeiter angewiesen, dieetwaige Aufträge aus ihrem eigenen Formenkanon,ihrer eigenen Bilderwelt heraus gestalten. Daszweite Modell sieht das Gefälle gerade in derentgegengesetzten Richtung. Unter dem Stichwort„Christentum und antike Bildung“ wird eineallmähliche Inkulturation des Christentums indie Bildungsideale und Kommunikationsstandardsder hellenistisch-römischen Oberschichtbeschrieben. Ein gutes Beispiel dafür liefertdie Bibeldichtung. Im sprachlichen Ausdruckgenügen die frühen lateinischenBibelübersetzungen in Africa und Italien, dieVetus Latina oder Itala, literarischen Ansprüchen
Adaption alter Bauten an den christlichen Kult, in: B.Brenk (Hg.), Innovation in der Spätantike (Wiesbaden1994) 361-376; s. aber auch P. Stewart, The Destructionof Statues in Late Antiquity, in: R. Miles (Hg.),Constructing identities in late antiquity (London 1999)159-189, zu Traditionen der Statuenzerstörung.
3 Dazu bes. E.R. Goodenough, Jewish Symbols in theGreco-Roman Period, hg. von J. von Neusner (Princeton1988); ders., Jewish Symbols in the Greco-Roman Period.13 vols. (Bollingen Series 37) (Princeton 1953-68).
Bilderwelten und Religionswechsel 3
(die den Offenbarungen eines Homer aus Smyrnaoder Vergilius Maro Pari bieten könnten) sowenig, dass sich der spanische Kleriker Iuvencuszu Beginn des vierten Jahrhunderts (wohl um 330)an ein biographisch organisiertes Epos überJesus den Christus macht, das genau dieseKonkurrenz aufnimmt, wie gleich zu sehen seinwird.4
Iuvencus ist nicht repräsentativ. Er entstammteiner der am intensivsten romanisiertenProvinzen des römischen Reiches. Er ist nachHieronymus und unserem Wissen der erstechristliche Epiker. Und: er bleibt zunächstallein. Erst eine Generation später, um dieMitte des vierten Jahrhunderts, lässt sich dasnächste Experiment beobachten, ein nochkühneres: Die Gattin eines Praefectus urbi vonRom, Faltonia Betitia Proba, verfasst eineHeilsgeschichte, die von der Schöpfung bis zurSintflut reicht, in einem Mittelteil vonsechzehn Versen, den Versen 317-332, die weiterealttestamentliche Geschichte summarischabhandelt und daran das Leben Jesu in weiteren355 Versen anschließt. Aber Proba schließt sichnicht nur der epischen Tradition an. Ihr istnicht nur das Versmaß Vergils, sondern auch seinWortlaut heilig: Ihr Gedicht ist ein Cento, einGebilde aus Halbversen Vergils. Und so klingtdas christliche Theologumenon der Inkarnation,die Fleischwerdung Gottes in der Geburt Jesu inVersfragmenten aus dem zweiten bis zwölften Buchder Aeneis und dem ersten Buch des Vergilschen„Landlebens“ (Georgica):
Iamque aderat promissa dies, quo tempore primum extulit os sacrum diuinae stirpis origomissus in imperium, uenitque in corpore uirtus mixta deo: subiit cari genitoris imago.5
4 Hier. vir. ill. 84.5 Proba 346-349; Verg. Aen. 9,107; georg. 1,61; Aen.
8,591; 12,166; 6,812; 5,344; 7,661; 2,560.
4 Jörg Rüpke
„Schon war der versprochene Tag da, an demerstmals das heilige Gesicht heraushob derUrsprung der göttlichen Rasse, geschickt zurHerrschaft; und es kam im Körper die Tugend,vermischt mit dem Gott: Das Bild des lieben Vatersschob sich ihm unter.“
Aber es geht um mehr als um den sprachlichenGlanz einer langen Tradition, wie der Blickzurück auf Iuvencus zeigt. Die Argumentationseiner Praefatio ist vielschichtig:6
„Nichts auf Erden währt ewig, weder die Welt nochirdische Reiche noch das goldene Rom, weder Meernoch Land noch die funkelnden Sterne am Himmel.Denn der Schöpfer dieser Welt hat auch ihrunwiderrufliches Ende bestimmt, da das ganze Allvom glühenden Weltenbrand verzehrt werden wird.Dennoch leben unzählige Menschen lange fort durchihre Heldentaten und das ehrende Andenken an ihreVortrefflichkeit, denn es verkünden ihren Ruhm undPreis die Dichter. Die einen werden gefeiert inden erhabenen Gesängen aus smyrnischem Quell, dieandern durch den süßen Mund des Maro vom FlußMincius. Und nicht geringer ist der sichverbreitende Ruhm der Dichter selbst, dergleichsam ewig ist, zumindest solange die Zeitdauert und die Himmelsbewegung nach vorbestimmtemLauf die Sternenbahnen um Land und Meer lenkt.Wenn aber jene Dichtungen solchen lang andauerndenNachruhm errangen, die mit den Taten der Alten nurLügen verbinden, so wird mir der wahre Glaubeewigen Ruhm verleihen als unsterbliche Zier undals Lohn zuteil werden lassen. Denn ich willChristi Erdenleben besingen, ein göttlichesGeschenk ohne Falsch für die Menschen. Und ichfürchte nicht, daß der Weltenbrand dieses Werkhinwegraffen wird; vielmehr wird es mich dannvielleicht aus dem Feuer erretten, wenn ausflammender Wolke strahlend Christus als Richtererscheint, der hohe Sohn des höchsten Vaters. Auf
6 Übersetzung D. Kartschoke, Bibeldichtung. Studien zurGeschichte der epischen Bibelparaphrase von Juvencus bisOtfried von Weißenburg (München 1975) 57.
Bilderwelten und Religionswechsel 5
denn! möge der Heilige Geist als der eigentlicheAutor des Gedichts mir beistehen und den Geist desSängers mit dem reinen Wasser des süßen Jordanbenetzen, damit ich würdig Christi Taten besinge.“
Trotz der Referenz auf die griechisch-lateinische Dichtungstradition7 lässt Iuvencuskeinen Zweifel an seiner christlichenOrthodoxie, wie sich vielfältig zeigen ließe.Aber es steckt mehr dahinter als die Entdeckungder Dichtung für die christliche Mission. Zwarkritisiert er, dass die alten Dichter es nichtlassen konnten, ihre Gegenstände mit mendacia,Lügen, zu verbinden (pr. 16), aber das ändertnichts an der Parallelisierung von gesta hominum,den Taten der Menschen, und den Christi uitalia gesta,den leiblichen Taten Jesu. Die vier Bücher desWerkes selbst bilden eine Biographie, die sichan der Fassung des Matthäus-Evangeliums (das imUnterschied zu Markus bereits eineKindheitsgeschichte Jesu bietet) orientiert,aber aus Lukas und Johannes ergänzt wird. Undwas ist mit den nichtchristlichen Texten?Streicht man die Lügen ab, bleiben doch die„erhabenen Taten“ (sublimia facta) (pr. 6) und die„Ehre der Tugend“ (uirtutis honos) (pr. 7), denendie dichterische Erinnerung – völlig zu Recht –Verbreitung und Ruhm (famam laudesque) verschafft(pr. 8). Es ist offensichtlich, dass Iuvencusmit dem mehrfachen homines, „Menschen“, einezugespitzt euhemeristische Interpretation derGegenstände epischer Dichtung zugrunde legt: Was
7 Siehe M. Flieger, Interpretationen zum BibeldichterIuvencus (Stuttgart 1993) 216-224; K. Thraede, Epiphanienbei Juvencus. Ausgangstext: Evangeliorum Libri 1,1/26,in: G. Schöllgen/C. Scholten (Hgg.), Stimuli. Exegeseund ihre Hermeneutik in Antike und Christentum.Festschrift für Ernst Dassmann (JbAC. Suppl. 23 (Münster1996) 499-511; J. Rüpke, Religiöse Organisation undText. Problemfälle religiöser Textproduktion in antikenReligionen, in: K.E. Grözinger/J. Rüpke (Hgg.),Literatur als religiöses Handeln (Berlin 2000) 67-96,hier 85-87.
6 Jörg Rüpke
über den menschlichen Charakter derProtagonisten hinausgeht, sind „Lügen“. Aber esbleibt eine heroische Vergangenheit, in die derirdische Christus eingeordnet wird. Nichteinzelne Bilder, sondern Bilderwelten werdenhier übernommen.Das interpretatorische Modell, das oben den
Ausgangspunkt der Überlegungen gebildet hat, dieInkulturation des Christentums, bleibt noch inweiteren Punkten defizitär, die auch diechronologische Frage, die Gefällerichtungbetreffen. Wieder mag ein Beispiel vorangehen:In der Vita des Kaisers Alexander Severus, dervon 222 bis 235 n. Chr. regierte, findet sichfolgende Nachricht:8
„Seine Lebensführung war wie folgt: Zuerst, daßer, wenn die Gelegenheit bestand, das heißt, wenner nicht mit seiner Gattin schlief, einenGottesdienst abhielt in den Morgenstunden inseiner Hauskapelle (lararium), in der er dievergöttlichten Kaiser, und zwar die bestenausgewählt, und heiligere Geister hatte, darunterApollonius (scil. von Tyana) und, soweit einzeitgenössischer Historiker sagt, Christus,Abraham und Orpheus und weitere diesen Typs.“
Die Biographie geht an späterer Stelle sogarnoch weiter und unterstellt dem Kaiser, Christuseinen Tempel gebaut haben zu wollen und ihnunter die Götter aufgenommen haben zu wollen.9 Andieser Stelle wird die Aussage durch dieVerknüpfung mit einem angeblichen ProjektHadrians zur Einführung eines bildlosen Kultesdiskreditiert. Leider lässt sich die angeblichzeitgenössische Quelle nicht eruieren, dieHistorizität der Nachricht bleibt fraglich.Unwahrscheinlich ist ein solcherRezeptionsprozess in einem polytheistischenSystem, ist Christuskult der Nichtchristen
8 Hist.Aug. Alex. 29,2.9 Hist.Aug. Alex. 43,6: Christo templum facere voluit eumque
inter deos recipere.
Bilderwelten und Religionswechsel 7
nicht. Raban von Haehling hat in seinerUntersuchung Julians genau auf solcheRezeptionsprozesse auf der anderen Seitehingewiesen.10 Nicht nur das Christentum wardynamisch, vielmehr ist es Teil einerumfassenden religiösen Dynamik.Ist dann die Rede von wechselseitigen
Einflüssen angemessen? Ist es sinnvoll, vonverschiedenen „Seiten“ zu reden? Einem„Zusammenprall der Kulturen“ in der Antike?Antike Christentümer sind in ihren verschiedenenRäumen kaum Einwandererreligionen – anders wäreihr zahlenmäßiger Erfolg kaum zu erklären; aufdas Judentum, vielfach nur schwer vomChristentum zu trennen und ebenfalls eineWachstumsreligion bis ins vierte Jahrhundert,trifft dasselbe zu. Zuverlässige Statistiken fürdie nominelle Zunahme des Christentums gibt esnicht. Keith Hopkins hat aber – unabhängig vonden genauen Zahlen – auf eine signifikante Folgedes rasanten, eher exponentiellen denn linearenWachstums hingewiesen: Zu jedem beliebigenZeitpunkt bis ins vierte Jahrhundert hinein lagfür die Mehrheit der irgendwo Versammelten dieZuwendung zum Christentum erst wenige Jahrezurück.11 Das schließt frühkindliche christlicheSozialisierung in Familien, die seitGenerationen Christen waren, nicht aus – in denBeteiligten am Dialog Octavius des Minucius Felixwird genau diese Konstellation vorgeführt.12 Daslegt nicht nur eine Sozialisation i n und eineVertrautheit m i t der traditionellen Kulturnahe. Es stellt die Vorstellung zweier striktgetrennter und nur in komplizierten Prozessen
10 R. v. Haehling, Mythos als Mittel derLegitimieruung. Julian, Helios und der Auftrag zurRepaganisierung des römischen Reiches, in: J. Villers(Hg.), Antike und Gegenwart. Festschrift für MatthiasGatzemeier (Würzburg 2003) 95-106.
11 K. Hopkins, Christian number and its implications(Roman empire), JECS 6 (1998) 185-226.
12 Siehe Min.Fel. 5,1.
8 Jörg Rüpke
einander rezipierender Kulturen als solche inFrage. Liegt es nicht näher, die Blickrichtungumzukehren: Von der einen Kultur her zu denkenund nach internen Differenzierungsprozessen zufragen? Genau das soll im Folgenden unternommenund hier zur Diskussion gestellt werden.
2. Bilderwelten und ReligionswechselVor dem konkreten Test an zwei unterschiedlichenGattungen religiöser Bilder bedarf meinGegenmodell noch einiger Explikationen. Vorweg:Es liegt mir ferne, dem Modell einer gemeinsamenKultur die Idee einer Einheitskultur zuunterlegen. Angesichts der intensivenFernbeziehungen im Mittelmeerraum, derMobilität, der ethnischen Diffusionen und derdaraus resultierenden vielfältigen Diasporenwäre eine solche Annahme unsinnig. Gleichwohlberuht die parallele Etablierung und Pflegeverschiedener kultureller Praktiken undVorstellungen auf geteilten Überzeugungen undgemeinsamen rechtlichen Rahmenbedingungen.Diversität ist eingebettet in öffentliche Räume,in denen – mit lokalen Differenzen – vor allemEliten eine bestimmte Ausprägung als dominantsetzen.Sodann: Die römische Spätantike, um deren
Zeichenpraktiken es hier vor allem geht, wareine ausgeprägt visuelle Kultur. Dergleichen zuquantifizieren fällt schwer, doch dürfte dasAusmaß, in dem Statuen, Büsten und Malereienöffentliche Plätze und private Räume prägten,kaum zu überschätzen sein.13 Nicht nur silbernes
13 Vgl. zu Veränderungen in der Nutzung einzelnerFormen B. Borg/C. Witschel, Veränderungen imRepräsentationsverhalten der römischen Eliten währenddes 3. Jh. n. Chr., in: G. Alföldy/S. Panciera (Hgg.),Inschriftliche Denkmäler als Medien derSelbstdarstellung in der römischen Welt (HABES 36)(Stuttgart 2001) 47-120.
Bilderwelten und Religionswechsel 9
Luxusgeschirr, sondern auch irdenesAlltagsgeschirr war, wie die archäologischenFunde belegen, reich mit mythologischenDarstellungen geschmückt. Solche Bilder kann mannicht isoliert betrachten. Sie bedeuten etwasvor dem Hintergrund von Erzählungen oderInszenierungen. Umgekehrt verweisen auch Texteauf diesen Bilderreichtum.Bilder und Erzählungen sind aufeinander
bezogen, aber sie entsprechen jeunterschiedlichen Kommunikationssituationen.Bilder haben ihren Ort, Erzählungen – ob instiller Lektüre, Rezitation oder mündlicherTradierung – ihre Zeit. Den unterschiedlichenOrten und Zeiten wiederum sind auchunterschiedliche Texte, Bilder und Symboleangemessen: Von „Bilderwelten“ sollte immer imPlural gesprochen werden. Der Zeichenvorrat desTheaters unterscheidet sich von dem der Kirche,das Forum vom Speisezimmer, das Schlafzimmer vomUnterrichtsraum.Dieses Bild, präziser: diese Hypothese, möchte
ich nun mit dem Religionswechsel als dynamischemFaktor zusammenbringen. Welche Konsequenzen hatdie Hinzunahme des Christuskultes, imExtremfall: der Religionswechsel, für den Umgangmit den Bilderwelten? Dabei soll wiederum nichtdas Dramatische, sondern das Alltägliche denAusgangspunkt bilden: Ich frage nach Änderungenin den Bildbeständen, nicht nach Konflikt undDestruktion. Was aus einer radikalisiertentheoretisch-theologischen Perspektive alsunvereinbar erscheinen mag, kann in denZeichenpraktiken der Einzelnen in ganzunterschiedlichen Mischungsverhältnissenerscheinen. Die folgenden Beispielebeabsichtigen gerade deutlich zu machen, wie imEinzelfall voneinander abweichende Ergebnisseerzielt werden, wo Selbstverständlichesweitgehend von Veränderungen ausgenommen bleibtund wo neue Akzente zu massiven Umschichtungenim Bildkanon führen können.
10 Jörg Rüpke
3. Der Chronograph von 354Beginnen möchte ich mit einem Prachtband, dender Kalligraph Furius Dionysius Filocalusangefertigt hat, dessen FilocalinischeBuchstaben ein bis zwei Jahrzehnte weiter zumSignet der Märtyrerinschriften des PapstesDamasus werden sollten. Zum Jahr 354 n. Chr.wurde er einem Valentinus – so das Widmungsblatt– zugeeignet. Von diesem Valentinus lässt sichzweierlei sagen. Erstens: Der prosopographischeBefund legt nahe, einen Valentinus des Jahres35414 mit einem Mitglied der Familie der Symmachizu identifizieren: mit einem Onkel, einem Neffenoder – am ehesten – dem Bruder des berühmtenRedners und dezidierten Traditionalisten Q.Aurelius Symmachus.15 Zweitens: Der Inhalt desBuches und die Formulierung des Widmungsblattes,floreat in deo, „möge er in Gott blühen“, lässt einechristliche Orientierung als zwingenderscheinen.16
Der Codex, der in der Forschung seit MommsensEdition unter dem Namen „Chronograph des Jahres354“ bekannt wurde, ist nicht selbst erhalten,lässt sich aber aus einigen Abschriften mithinreichender Sicherheit auch in seinem
14 Das Datum ergibt sich aus internen Kriterien desTextes, insbesondere der Reichweite verschiedenerListen; s. M.R. Salzman, On Roman Time. The Codex-Calendar of 354 and the Rhythms of Urban Life in LateAntiquity. The Transformation of the Classical Heritage17 (Berkeley 1990) 279-282; Salzman nimmt dieArgumentationen auf von H. Stern, Le calendrier de 354:Étude sur son texte et ses illustrations. Institutfrançais d’archéologie de Beyrouth. Bibliothèquearchéologique et historique 55 (Paris 1953), Th.Mommsen, MGH AA 9 und Nicolas-Claude Fabri de Peiresc(1620); dazu J. Rüpke, Rez: M. R. Salzman, On Roman Time(s. o.), Numen 42 (1995) 210-216.
15 Salzman (wie Anm. 15) 201-202.16 Ebd. 199.
Bilderwelten und Religionswechsel 11
Bildbestand rekonstruieren;17 unklar bleibtallein, wann die letzten in den späterenAbschriften erhaltenen Listen in die Sammlungeingedrungen sind. Denn um eine Sammlung vonListen handelt es sich im Wesentlichen.Der Codex beginnt mit dem Dedikationsblatt.
Ihm folgen Darstellungen von vierStadtgottheiten, eine Dedikation an denregierenden Kaiser18 im Namen des EigentümersValentinus und eine kalendarisch geordnete,zweispaltige Liste von Kaisergeburtstagen. Sienennt – unter der Überschrift Natales Caesarum –den Genitiv des Kaisernamens und das Datum. Esfolgen Darstellungen der Planetengötter,geordnet in der Reihenfolge der Wochentage mitSaturn an der Spitze. AstrologischeInformationen werden in Listen mit dem Charakterund der relevanten Gottheit der vierundzwanzigTages- und Nachtstunden des jeweiligenWochentages und einer kurzen allgemeinenBeschreibung geliefert. Ähnliche Informationenzu den zwölf Zodiakalzeichen folgen; sie gebenan, welche Aktivitäten zu bevorzugen sind, wennder Mond im jeweiligen Zeichen steht. Dieentsprechenden Illustrationen sind in derÜberlieferung verloren gegangen. Darauf folgtder eigentliche Kalender. Er besteht aus zwölfDoppelseiten. Auf der linken Seite findet sicheine ganzseitige Darstellung des Monatsvermittels einer Person, die eine jahreszeitlichtypische Handlung ausübt. Rechts steht derKalendertext.19 Eine wirkliche Integration beider
17 Dazu umfassend ebd. 249-268.18 Zur Problematik des für das Jahr 354 unzutreffenden
Plurals Augusti“ s. ebd. 281-282: Er dürfte aus eineretwas älteren Bildtradition (als auch MagnentiusAugustus war) stammen.
19 Dazu J. Rüpke, Kalender und Öffentlichkeit. DieGeschichte der Repräsentation und religiösenQualifikation von Zeit in Rom (RGVV 40) (Berlin 1995)92-94.
12 Jörg Rüpke
Teile vermag ich nicht zu erkennen.20 Bezüge, diedie Darstellung eindeutig als summierende oderakzentuierende Illustration des Kalendertextesauswiesen, fehlen. Mitsamt ihren auf die Monatebezogenen Verslein – Distichen, später noch umTetrastichen erweitert – sind die Monatsporträtsdurchaus selbständig. Es folgen nun, nach Porträts der beiden
Konsuln – wohl des Jahres 354 – eine Liste vonKonsuln für die Zeit seit Gründung der Republik,mit einigen wenigen chronikartigen Notizen, dieauch Ereignisse christlicher Geschichteeinschließen (so das Martyrium von Peter undPaul); eine Darstellung der Osterdaten für 312bis 411 sowie eine Liste der römischenStadtpräfekten für 254 bis 354. Exklusivchristliches Material schließt sich wieder an:eine chronologische Liste der Bestattungsdaten(depositiones) der römischen Bischöfe von 255 bis352 sowie eine kalendarisch geordnete Liste vonMärtyrertagen – ebenfalls depositiones oder diesnatales; die Liste beginnt mit der Geburt Christi,einem der frühesten Zeugnisse für dasWeihnachtsfest überhaupt. Schließlich folgt nocheine chronologische Liste der stadtrömischenBischöfe, beginnend – nach dem Hinweis auf denKreuzestod Jesu unter Tiberius – mit Petrus. DerCodex schloss wahrscheinlich in derursprünglichen Fassung mit einer knappen Chronikder Stadt Rom; im Laufe der Zeit wurde weiteresMaterial in die nützliche Sammlung eingeschoben.Wie steht es um die Illustrationen in einem
Codex, der so dezidiert christliches Materialmit traditionellen Listen kombiniert, der dasfrüheste Zeugnis für den Festkalender derchristlichen Gemeinden in Rom bietet?
20 So schon meine Formulierung ebd. 91, inAuseinandersetzung mit der Interpretation Salzmans (wieAnm. 15) 63-67.
Bilderwelten und Religionswechsel 13
Die Engel auf dem Widmungsblatt waren durch diebulla, die sie um den Hals tragen,21 alsordentliche männliche römische Jugendlicheausgewiesen – dieses Amulett wurde erst mit derÜbergabe der weißen Erwachsenentoga abgelegt.Die Planetengötter der folgenden Abteilung –Saturn mit der Sichel, der Kriegsgott Mars, derGötterbote und Handelsgott Merkur, Sol, die„Sonne“ als weibliche Gestalt – bedürfen kaumeines weiteren Kommentars. Angesichts derPopularität dieser einfachen Divinationsformblieben auch die Einreden mancher Kirchenväterweitgehend ohne Wirkung – langfristig warenAstrologie und Christentum Verbündete, nichtGegner.22 Derselben Kategorie kann man diefolgenden Zodiakalzeichen zuordnen.Die Monatsdarstellungen folgen keiner
einheitlichen Logik. Das dem Kalenderblatt desJanuar gegenüberliegende Bild23 zeigt einen Mann,der im Begriff ist zu opfern: Weihrauch lässtdie Flammen auf dem Altar aus der Kohlenschüsselemporschlagen. Die prachtvolle Kleidung lässt amehesten an einen Konsul denken,24 auch wenn dieKopfbedeckung, die eher dem Apex eines Flamensähnelt, dazu nicht passt. Angespielt werdendürfte in jedem Fall auf Opfer zum Jahresbeginn,etwa das konsularische Opfer an denJanuarkalenden für Iuppiter Optimus Maximus aufdem Kapitol. Im Programm der saisonalen Früchtefür die Tafel wird für den Februar auf die
21 Cod. Vaticanus Romanus 1 ms., Barb. lat 2154, fol.1.
22 Für die Spätantike zeichnet K. v. Stuckrad, DasRingen um die Astrologie. Jüdische und christlicheBeiträge zum antiken Zeitverständnis (RGVV 49) (Berlin2000) die Konflikt- und Gesprächslinien detailliertnach. Frühneuzeitliche astrologische Kalender (wie diedes Ioannes Regiomontanus) pflegen im Vorwort ihrebiblische Grundlage herauszustellen.
23 Cod. Vaticanus Romanus 1 ms., Barb. lat. 2154, fol.16.
24 So Salzman (wie Anm. 15) 81f.
14 Jörg Rüpke
Produkte des Wassers, Muscheln und andereWeichtiere sowie Fische, aber auch Wasservögelhingewiesen, die von einer weiblichen Figurdargeboten werden. Umstritten ist die Deutung der
Märzdarstellung: Die späteren Vierzeiler deutendie Figur als den Gott Mars – der dem Monat demNamen gibt – in der Gestalt eines Hirten mitFrühlingsattributen, Henri Stern wählt darausohne ikonographische Parallele dieFrühlingspersonifikation, Michele Renee Salzman– ich bin versucht zu sagen: mit noch wenigerParallelen – den Gott Mars.25 Die Verbindung derVögel mit dem Frühling leuchtet ein, aber fürdie zentrale Figur kenne ich nur eine, leidernur textlich überlieferte Parallele. Am 7. Märzlag der Stiftungstag des Tempels des GottesVeidiovis auf dem Kapitol, dessen Kultbild Ovidmit den Worten beschreibt:26
„Das ist der junge Iuppiter: Sieh das jugendlicheAntlitz! Dann sieh die Hand: Sie trägt keineBlitze ... Es steht auch eine Ziege bei ihm,Nymphen auf der Insel Kreta sollen sie geweidethaben. Sie gab dem Kinde Iuppiter die Milch.“
Die gegenüberstehende Kalenderseite trägt fürdiesen Tag die Festbezeichnung Iunonalia. Woherdieses Fest kommt, ist unbekannt; möglicherweiseführt es zum einen das alte Iuno-Fest derMatronalia am Monatsersten, das auf derKalenderseite fehlt, und zum zweiten den Gottmit der Ziege zusammen, eines Tieres, dasansonsten der Juno als heilig galt.27 Auch hiermöchte ich es nicht unterlassen daraufhinzuweisen, dass Ziegenfleisch den Römern alsbesonderer Leckerbissen galt.28
25 ebd. 107-111; H. Stern (wie Anm. 15) 239-245.26 Ov. fast. 3,437f. 443f. (Übers. F. Bömer).27 Dazu G. Wissowa, Religion und Kultus der Römer (HdbA
5,4) (München ²1912) 184f.28 Varro rust. 2,3,10; ein Zeugnis vom Ende des 3. Jh.
ist das Diokletianische Höchstpreisedikt (4,3. 48); s.
Bilderwelten und Religionswechsel 15
Trotz der heroischen Nacktheit wage ich diePersonifikation des Oktobers nicht als Verweisauf ein Kultbild zu deuten: Der dort abgebildeteJäger liefert offensichtlich mit einem ganzenInventar an Jagdgeräten Leckerbissen –herausgehoben ist der Hase. Dass schon Varro vonHasenzucht berichtet, um den Tafelbedarf zudecken, muss dieses Jagdbild nicht stören.29 DasNovemberbild stellt einen Isispriester samtvielerlei aus dem Isiskult bekannten Paraphernaliadar, etwa mit einer Büste des hundeköpfigenAnubis auf dem hohen Sockel. Hintergrund isthier die Folge der kalendarisch auf den 28.Oktober bis 3. November fixierten großenIsisfeste, die mit den Hilaria schloss. DasDezemberbild, als letztes, verweist ebenfallsauf ein Fest, in diesem Fall auf die Saturnalia.Der Tisch gehört in einen Bankettzusammenhang,die Würfel, die man aus dem Turm rollen lässt,verweisen auf die heitere Atmosphäre des Festes.Eine nähere Identifizierung des Fackelträges istnicht möglich. Der Fellumhang und derGewandschmuck weisen auf die Januarfigurzurück.30
Ich fasse zusammen: Der Chronograph von 354enthält in einer insgesamt – soweit wir sehenkönnen – innovativen Zusammenstellung von zeit-und geschichtsbezogenen Materialien dezidiertchristliches Material. Sein ikonographischesProgramm muss ebenfalls als innovativ bezeichnetwerden. Gleichwohl findet sich hier keinerleiReflex der – in der Stadt Rom – auch
K. Ruffing, Art. Ziege, DNP 12/2 (2002) 796-800, hier799.
29 Varro rust. 3,3,2; 3,12,1-7; s. Ch. Hünemörder, Art.Hase, DNP 5 (1998) 174-176, hier 175.
30 Diesen ikonographischen Zusammenhang übersiehtSalzman (wie Anm. 15) 75f., die aber zurecht eineInterpretation als Sklave zurückweist: Die literarischauftretende Tradition des Umkehrrituals, das den Sklavenüber den Herren stellt, dürfte der sozialen Realität deskaiserzeitlichen Festes nicht entsprochen haben.
16 Jörg Rüpke
öffentlichen Bedeutung des Christentums. Trotzdes christlichen Ambientes – vermutlich sindEmpfänger wie Produzent Christen – trittChristliches nur in additiver Form auf: ZentraleElemente christlicher Zeitgestaltung undgeschichtlicher Erinnerung werden a n g e f ü g t ,kaum e i n g e f ü g t . Die innovativen Elemente –die Zusammenstellung schon im „paganen“ Teil,die Ikonographie – sind nicht durchChristianisierung innovativ. Zugleich ist zusehen, dass das christliche Material selbst intraditionell-„pagane“ Formen gegossen wird: Dasgilt für die Sukzessionsliste der Bischöfeebenso wie das Feriale der Märtyrer.
4. KatakombenMein erstes Beispiel könnte nahe legen, dass esmir darauf ankäme, den christlichen Einfluss alsminimal herauszustellen – noch in der Mitte desvierten Jahrhunderts, fast ein halbesJahrhundert nach der Zuwendung Konstantins. Ichhoffe, dass mein folgendes Beispiel diesenEindruck widerlegt. Die Massivität derchristlichen Präsenz kehrt nun die Vorzeichen umund legt damit meine Bezugsebene besser frei.Die Katakombe, um die es im Folgenden gehen
wird, ist außergewöhnlich. Sie liegt – wieeinige andere – an der Via Latina, derAusfallstraße nach Südosten, ein wenig nördlichalso von der Via Appia, der nach Südsüdostführenden Straße, die durch die Vielzahl undGröße ihrer unter- wie oberirdischen Grabbautenbekannt ist. Die anonyme Katakombe an der ViaLatina 258 oder via Dino Compagni31 war eine
31 So die Bezeichnung in P. Pergola, Le catacomberomane. Storia e topografia. Catalogo a cura di PalmiraMaria Barbini (Roma ²1999) 171-174 für eine summarischeDarstellung; ausführlich und reich bebildert A. Ferrua,Katakomben: Unbekannte Bilder des frühen Christentumsunter der Via Latina. (Stuttgart 1991).
Bilderwelten und Religionswechsel 17
private Anlage, im Wesentlichen zwischen 320 und360 errichtet und genutzt – von Zeitgenossen desValentinus und Furius Filocalus. Die Nutzerdürften mehreren Familien angehört haben, derRaum ist großzügig gestaltet und nur teilweisemit Bestattungen ausgeschöpft.In jeder Hinsicht exzeptionell ist das
Dekorationsprogramm. Raum für Raum wird durch jeeigene Bildprogramme geprägt. Die Bilder sindvon hoher Qualität und vielfach innovativ.Verschiedentlich begegnen hier Motive, die ausder vorangehenden Katakombenmalerei unbekanntsind. Die biblischen Erzählungen werden in einemunbekannten Maße als Bildthemen entdeckt undumgesetzt.32 Mein Durchgang folgt im Ggroben demAufsbau der Anlage.33
Ich beginne mit einem Blick in die Kammer C.Links in der Nische ist dort die Auferweckungdes Lazarus dargestellt, der gleich in der Türdes Anten-Grabtempels vor etwa achtzig Zeugenerscheinen wird. Auf der Laibung dieser Nischewill Abraham Isaak opfern, unterhalb des Bergeswartet ein Diener in der Tunika mit seinem Esel– in der Malerei ein neues Element.34 In der miteinem Sarkophag genutzten Grabnische steht im
32 Vgl. die Zusammenstellung der Bildthemen in derKatakombe SS Petri e Marcellini: J. Guyon, Le cimitièreaux deux lauriers. Recherches sur les catacombesromaines. Bibliothèque des écoles françaises d’Athènes etde Rome 264/Roma sottoterranea christiana 7 (Paris/Cittàdel Vaticano 1987) 300; s. a. J. Guyon, Lesrepresentations du cimetiere ‘Aux deux lauriers’, in: F.Hinard (Hg.), La mort, les morts et l’au-delà dans lemonde romain. Actes du colloque de Caen 20-22 novembre1985. Caen: Université, 1987. 293-310. Zum (im engerenSinne) theologischen Gehalt solcher Bilder s. P.Prigent, Les premières représentations de Dieu dansl’iconographie chrétienne, in: H. Lichtenberger (Hg.),Geschichte - Tradition – Reflexion. Festschrift fürMartin Hengel zum 70. Geburtstag 3: Frühes Christentum.(Tübingen 1996) 613-629.
33 Ferrua (wie Anm. 32).34 Ebd. 95.
18 Jörg Rüpke
Zentrum ein Pfau. Links des Pfaus derSündenfall, Adam und Eva, rechts eine Orantin,eine Beterin in Dalmatika mit bedecktem Haupt.In der Deckenwölbung lässt sich mittig einjunger, puttenhafter Hirte erkennen, links wirdJonas vom Meeresungeheuer ausgespuckt, rechtsliegt er unter einer Kürbislaube.35
Pfauen erscheinen auch an der Stirnseite derKammer E, darunter, im Mittelfeld desArkosoliums, wohl die Gestalt der Tellus, derErde, mit dem Korb ihrer eigenen Erträge. Obsich rechts von ihr eine Herme befindet, lässtsich nicht entscheiden.36 Größere Rätsel gibt dasin vergleichbarer Position angebrachte Bild inSaal L auf. Geschart um einen Lehrer, lauschendie Schüler dem Anatomievortrag eines derältesten Mitglieder ihres Kreises – dasAnschauungsobjekt liegt vor ihnen auf dem Boden.Wie die neu- und alttestamentlichen Figurenweisen sich alle durch ihre Tuniken mitPurpurstreifen als gute Römer aus.Das kann man von den lebensgroßen Figuren an
den Seitenwänden des Raumes N nicht behaupten:Herkules ist durch seine Keule hinreichendgekennzeichnet. Das Zusammentreffen mit Athena,der er die Hand reicht, und einem Feind, den eran der Hand empor reißt, um gegen ihn die Keulezu richten, fällt sehr unterschiedlich aus.Allein dieser Feind trägt auch keinenHeiligenschein, wie er blau hinter Herkules undAthena hervorschimmert. Auch Tellus war miteinem solchen, wenn auch in anderem Farbton,ausgestattet. Der Raum bietet noch weitereHerkulestaten: In der Lünette des rechtenArkosoliums, führt Herkules Alkestis aus demHades, die sich dorthin als Ersatz für Admetosbegeben hatte. Gerahmt wird das Gganze in derLaibung rechts durch den Raub der Äpfel derHesperiden – die Komposition mit der den Baum
35 Ebd. 97, nach Jonas 2,11 und 4,5-11.36 Ebd. 107.
Bilderwelten und Religionswechsel 19
bewachenden Schlange erinnert an Eva37 – sowielinks durch das Erschlagen der hier zehnköpfigenHydra, Herkules’ zweite Tat.38
Den Eingang zur Kammer O zieren zwei Frauen,wenigstens die linke folgt der Ikonographie derGetreidegöttin Ceres/Demeter mit Ähren undFackel; die Amphoren ergänzen das noch. DerBlick in den Raum selbst zeigt dann ein sehrvielfältiges Programm: Ein Pfau und Viktorienschmücken die Rückwand, in der Laibung desArkosoliums lassen sich aber die drei Jünglingeim Feuerofen erkennen. Rechts erfolgt derDurchzug durch das Rrote Meer: Die persischanmutenden Krieger stellen die verfolgendenÄgypter dar, die durch das von Mose ausgelösteHereinbrechen des Meeres daran gehindert werden,die Israeliten zu erreichen, die sich in derKleidung guter Römer nach rechts retten können.Die Figurentypen werden noch einzeln auf anderenWandteilen wiederholt.Ich breche meinen Durchgang hier ab. Die
Aufnahme von Motiven paganer Mythen istbeachtlich, sie bleiben im Ganzen deutlich inder Minderheit und sind auf einzelne Räumebeschränkt. Wurden hier einzelne nicht zuChristen gewordene Familienmitglieder begraben?Gab es – das würde dann solche Motive in denspätesten Räumen erklären – Rekonversionen unterKaiser Iulian, den die Christen Apostatanannten?39 Ferrua weist mit Recht darauf hin,dass auch diese Räume nicht anders denn als Teileinheitlicher Malprogramme in zusammenhängendenRaumgruppen verstanden werden können.40 Das legteinen engen biographischen Bezug auf eineneinzelnen Verstorbenen nicht nahe:41 Wem welche
37 Ebd. 142.38 Meist wird sie neunköpfig dargestellt, bei Verg.
Aen. 6,576 hat sie fünfzig Köpfe.39 Diese Interpretation führt Pergola (wie Anm. 32) 174
vor.40 Ferrua (wie Anm. 32) 156f.41 So aber ebd. 159.
20 Jörg Rüpke
Nische zukommen würde und welche Überzeugungenihr oder ihm dann wichtig sein würden, war beider Ausmalung kaum abzusehen. Hinweise aufindividuelle nachträgliche Änderungen –Übermalung einer unzumutbaren Diana durch einenLazarus nach Einbringung der Leiche einesKonvertiten – existieren nicht. Es gibt imÜbrigen keinen Grund anzunehmen, dass eineTrennung der Bestattungsorte nachGlaubensgemeinschaften im kaiserzeitlichenMittelmeerraum ein Prinzip war.42
Im Lichte des Chronographen erscheint derBefund weniger überraschend. UnterschiedlicheErzähltraditionen treten additiv nebeneinander.Auf der Suche nach einer Ausweitung desbiblischen Bildkanons – eine Ausweitung, diezunächst innerhalb dieses Bezugsrahmens mitinnovativen Szenen und Kompositionen erfolgt –werden auch andere, pagane, anderenBildtraditionen entstammende Motive eingefügt.Sie erscheinen dabei weniger romanisiert: Jesusund Moses tragen die Tunika, Herkules nicht.Aber, wie der Apfelbaum der Hesperiden gezeigthat, erfahren auch sie im Lichte biblischerBildmotive Modifikationen.
5. ZusammenfassungDie Spätantike ist in vielfacher Hinsicht durchInnovationen geprägt. Die hier betrachtetenInnovationen lassen sich nicht durch dieZugehörigkeit zu spezifisch religiösenOrientierungen erklären, wenn auch dieBeteiligung religiöser Motive wahrscheinlichist. Feld dieser Innovationen ist aber eine
42 É. Rebillard, Groupes religieux et élection desépulture dans l’Antiquité tardive, in: N. Belayche/S.C.Mimouni, (Hgg.), Les communautés religieuses dans lemonde gréco-romain. Essais de définition (Turnhout 2003)259-277, mit der Diskussion der wenigen Belege, die seitCumont zu einer gegenteiligen Annahme geführt hatten.
Bilderwelten und Religionswechsel 21
einheitliche Kultur. Die vorgeführten Beispieleentstammen den Geschenk-, Lektüre-, Bestattungs-und Dekorationspraktiken einergesellschaftlichen Elite.43 Andere Felder,Opferkritik oder solare Ikonographie,44 könnteman als Belege für religionsübergreifendeVeränderungen hinzufügen. Teil der hierbehandelten Innovation ist die Erweiterung vonFormenspektren. Es geht nicht um gegenseitigeBewältigung, Neutralisierung oder Verschmelzung,sondern um Addition.45 Dabei bleibentraditionelle Zusammenhänge von Zeichengruppen –biblische Themen oder pagane Mythologie,römische fasti oder christliches Märtyrerferiale –gewahrt, gewahrt aber als Gruppen von Elementen,die insgesamt in neue semantische Kontexte46
eingebracht werden können. Das Ziel istreicherer Raumschmuck, nicht das Nebeneinandervon Christen und „Heiden“, das Ziel ist einumfassendes Bild von zeitlichem Wandel und
43 Zum Problem, diese Elite soziologisch wirklich zufassen und in ihrer Größenordnung zu bestimmen, s. N.Purcell, The populace of Rome in late antiquity.Problems of classification and historical description,in: W.V. Harris (Hg.), The Transformations of Urbs Romain Late Antiquity. JRA Suppl. 33 (1999) 135-161.
44 S. etwa N. Belayche, Partager la table des dieux.L’empereur Julien et les sacrifices, RHR 218 (2001) 457-486; M. Wallraff, Christus Verus Sol. Sonnenverehrungund Christentum in der Spätantike. JbAC Suppl. 32(Münster 2001).
45 Dem entspricht die - auch zu diesem Zeitpunkt nurteilweise kontrafaktische - Interpretation derreligiösen Situation durch Symmachus (rel. 3,19). S. a.das Rombild der Acta Petri, die nach R. v. Haehling, ZweiFremde in Rom. Das Wunderduell des Petrus mit SimonMagus in den acta Petri, RQA 98 (2003) 47-71, hier 69Rom als einen Ort schildern, „der fremden Kultengegenüber nicht ablehnend eingestellt war, vielmehrreligiöse Freiräume zur Entfaltung bot.“
46 Und ggf. auch Zeichentheorien, s. C. Ando, Signs,Idols, and the Incarnation in Augustinian Metaphysics,in: Representations 73 (2001) 24-53.
22 Jörg Rüpke
Vergangenheit, nicht die Konfrontationunterschiedlicher Zeitsysteme.In dieser Perspektive erscheinen Religionen
nicht als Systeme, die Lebensführung komplettprägen oder umprägen. So erscheinen sievielleicht in den Katakomben in Kirchenbesitzoder auf den Taurobolienaltären paganer Eiferer.In den hier vorgeführten privaten Zeugnissendagegen erscheinen Religionen als Bilderweltenje unterschiedlicher Kommunikationsräume.47 DieVeränderungen in diesen Bilderwelten erscheinenin der Mitte des vierten Jahrhunderts in Romnicht als Austauschoperationen, sondern alsAdditionsvorgänge. Nicht Religionswechselerscheint in diesem Spiegel, sondern Zunahmekultureller Komplexität – eine Situation, dienicht stabil bleiben muss – schon die nächsteZukunft sollte dramatische Veränderungenbringen.48 Im Hinblick auf das spannende Elementdieses Bandes ist das aber zunächst eine Anti-Klimax: Unter den Bedingungen solcherKomplexität werden „Überraschungen“ langweilig.
47 Mit einem solchen - impliziten - Modell hinterfragtA. Cameron, The last pagans of Rome, in: W.V. Harris(Hg.), The Transformations of Urbs Roma in LateAntiquity, JRA Suppl. 33 (1999) 109-121, dastraditionelle Bild des antichristlichen Widerstandes derstadtrömischen paganen Elite des ausgehenden 4. Jh.
48 S. etwa S. Stern, Pagan Images in Late AntiquePalestinian Synagogues, in: S. Mitchell/G. Greatrex(Hgg.), Ethnicity And Culture In Late Antiquity (London2000) 241-252, zu nichtjüdischer Ikonographie inpalästinensischen Synagogen und dem Verschärfen vonBilderkritik nach der Durchsetzung des Christentums.