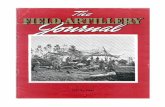"Zaun-Gäste. Die innerdeutsche Grenze als Touristenattraktion" in Grenzziehungen, Grenzerfahrungen,...
Transcript of "Zaun-Gäste. Die innerdeutsche Grenze als Touristenattraktion" in Grenzziehungen, Grenzerfahrungen,...
Grenzziehungen – Grenzerfahrungen – Grenzüberschreitungen
Herausgegeben vonThomas Schwark, Detlef Schmiechen-Ackermann und Carl-Hans Hauptmeyer
in Zusammenarbeit mit Hendrik Bindewald, Christine König, Ines Meyerhoff, Isabell Müller und Anneke de Rudder
01 B 24414-0 Schwark.indd 3 01 B 24414-0 Schwark.indd 3 11.03.2011 8:48:02 Uhr11.03.2011 8:48:02 Uhr
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografi e;detaillierte bibliografi sche Daten sind im Internet überhttp: / / dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung inund Verarbeitung durch elektronische Systeme.
© 2011 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), DarmstadtUmschlaggestaltung: Schreiber VIS, SeeheimBild: Aussichtsplattform bei Tettenborn, 1982. Foto: Jürgen Ritter, Barum Satz: Schreiber VIS, SeeheimDie Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitgliederder WBG ermöglicht.Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem PapierPrinted in Germany
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-534-24414-0
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:eBook (PDF): 978-3-534-70669-3 eBook (epub): 978-3-534-70670-9
01 B 24414-0 Schwark.indd 4 01 B 24414-0 Schwark.indd 4 11.03.2011 8:48:03 Uhr11.03.2011 8:48:03 Uhr
7
Prof. Dr. Johanna Wanka Grußwort der Schirmherrin 10
Thomas Schwark / Detlef Schmiechen-Ackermann / Carl-Hans Hauptmeyer Ein paar Worte zuvor … 11
Detlef Schmiechen-Ackermann Teilung – Gewalt – Durchlässigkeit. Die innerdeutsche Grenze als Thema und Problem der deutschen Zeitgeschichte 16
Thomas Schwark Man sieht nur, was man weiß … Strategien der Vermittlung von „Grenzbildern“ in Geschichtsmuseen 23
Rainer Potratz Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn – Ort der Erinnerung und Begegnung 36
Ines Meyerhoff Blickwechsel – Fotografi en der innerdeutschen Grenze 45
Hedwig Wagner Die gefi lmte innerdeutsche Grenze in Niedersachsen 54
Systematische Einordnungen
Isabell Müller
Grenzziehungen – Grenzerfahrungen – Grenzüberschreitungen 62
Christine König / Ines Meyerhoff / Isabell Müller / Anneke de Rudder / Claudia Viete
Die zentralen Perspektiven der Ausstellung 63
Christian Hellwig / Lars Kelich
GrenzImpressionen 67
Christian-Alexander Wäldner / Christoph Abrolat
Chronologie der deutsch-deutschen Teilung – eine Auswahl wichtiger Ereignisse 73
Thomas Schwark / Ines Meyerhoff
Die Grenzöffnung 1989 83
Gabriele Küster / Matthias Mahlke
Grenze heute 88
Gabriele Küster / Matthias Mahlke
Grenzen weltweit – Mauern um Europa 94
Inhalt
Zur Einführung Die Ausstellung „Grenzziehungen – Grenzerfahrungen – Grenzüberschreitungen“
Die Stationen der AusstellungThomas Schwark
Überblick 99
Christian Hellwig / Matthias Mahlke
1 Friedland Zwischen Ankunft und Aufbruch 100 Gabriele Küster
2 Leinefelde Das Eichsfeld – eine katholische Grenzregion 103
Heike Möller
3 Böseckendorf „Böseckendorf ist abgehauen!“ – Flucht aus der Sperrzone 106
Gabriele Küster
4 Duderstadt Der kleine Grenzverkehr – Duderstadt-Worbis im Eichsfeld 108 Isabel Behnen
5 Walkenried-Ellrich „Schwarz über die grüne Grenze“ 112 Christoph Abrolat
6 Sorge Flüchtende Jugendliche 115
Isabell Müller
7 Schierke „Schießen Sie doch endlich!“ 118
01 B 24414-0 Schwark.indd 7 01 B 24414-0 Schwark.indd 7 11.03.2011 8:48:03 Uhr11.03.2011 8:48:03 Uhr
8
Hendrik Bindewald
8 Brocken Der Kalte Krieg im Äther – Die großen Ohren im Harz 122
Christine König / Ines Meyerhoff
9 Eckertal „Anschauungsunterricht an der Zonengrenze“ 127
Christine König
10 Halberstadt „Vom Sinn des Soldatenseins“ an der innerdeutschen Grenze 132
Detlef Schmiechen-Ackermann
11 Goslar Randlage „in einem toten Winkel“ 141 Felix Weselmann
12 Barby Von Rückwanderern und „Erstzuziehenden“ 146 Monika Rutkowski / Detlef Schmiechen-Ackermann
13 Salzgitter „Buchhaltung des Verbrechens“ – Die Zentrale Erfassungsstelle der Landesjustiz- verwaltungen in Salzgitter 150
Christian Hellwig
14 Offl eben „Wir gehören zusammen“ – Das Kuratorium Unteilbares Deutschland 161 Lars Kelich
15 Neu-Büddenstedt / Harbke Gemeinsam geteilt 164
Claudia Viete
16 Marienborn „Halt! Passkontrolle Marienborn“ 168 Christian Hellwig / Matthias Mahlke
17 Braunschweig „Tod dem Verräter“ – Der Fall Lutz Eigendorf 171
Isabell Müller
18 Hannover „Wie es geduftet hat…“ 174
Wolf-Dieter Mechler
19 Hannover / Berlin Freies Geleit für den Trauerkonvoi 180
Isabel Behnen
20 Böckwitz-Zicherie Von der Theke zum Stacheldraht: Das geteilte Doppeldorf 184
Thomas Schwark
21 Uelzen Grenze unter Schutz 187
Axel Naguschewski
22 Salzwedel Der Fall Hans F. Franck – Die Selbstschussanlage SM-70 190
Detlef Schmiechen-Ackermann
23 Osterburg „Totale Abgrenzung“ 195
Hendrik Bindewald / Christine König / Ines Meyerhoff
24 Dömitz „Und alle brücken treiben pfeilerlos“ – Die Dömitzer Brücken als Symbole der Teilung 204 Hendrik Bindewald / Christine König / Ines Meyerhoff
25 Hitzacker „Mein Schulweg führt an der Zonengrenze entlang“ – Leben am Grenzfl uss Elbe 209
Hendrik Bindewald / Christine König / Ines Meyerhoff
26 Vockfey Zwangsaussiedlungen – „Ja, wir haben Sehnsucht nach der Heimat…“ 215 Anneke de Rudder
Exkurs: Die Grenze an der Ostsee 219
Jason Johnson Zur Konstruktion der Grenze in der Region – Das Beispiel Mödlareuth 224
Daniela Münkel Kontrolle und Überwachung im Grenzraum – Das Beispiel des Kreises Halberstadt 231
Gerhard Sälter Folgsamkeit und Mitwirkung der Grenzpolizisten erzwingen: Diskurse, Praktiken und Narrative zwischen 1952 und 1961 236
Astrid M. Eckert Zaun-Gäste. Die innerdeutsche Grenze als Touristenattraktion 243 Axel Kahrs Grenze und Entgrenzung in der Literatur: Teilung – Mauerfall – Vereinigung 252
Neuere Forschungs ergebnisse zur innerdeutschen Grenze
Anhang Abbildungsnachweis 261
Ausgewählte Literatur 262
Autorenverzeichnis 264
01 B 24414-0 Schwark.indd 8 01 B 24414-0 Schwark.indd 8 11.03.2011 8:48:04 Uhr11.03.2011 8:48:04 Uhr
Zaun-Gäste 243
Irgendwo tief in der Rhön, im Länderdreieck Hessen, Bay-ern und Thüringen, liegt der hessische Ort Ehrenberg. Einen Kilometer in die eine Richtung lag die Grenze zur DDR, ei-nen Kilometer in die andere Richtung die Grenze zu Bayern. Ein verschlafener Winkel, „wo früher kein Mensch freiwillig hingezogen“ wäre. Trotzdem hält sich dort wacker das Hotel Krone, zurzeit auf Wellness, Apfelsherry und „Rhönerlebnis“ getrimmt. Wie hat sich das Hotel in dem Ländereck behaupten können? Der derzeitige Betreiber, Gastronom in vierter Gene-ration, hat vielleicht die Antwort: „Wir hatten auch immer Tourismus,“ sagt er, „allerdings eine ganz besondere Art von Tourismus, den sogenannten ‚Gruseltourismus‘! In Bussen ka-men die Leute aus Holland, aus dem Ruhrgebiet und haben über die deutsch-deutsche Grenze geguckt!“1
Solche „Grenzgucker“ erschienen seit den 1950er Jahren, um jene Linie zu sehen, die in der politischen Rhetorik als „Ei-serner Vorhang“ fi rmierte, auf einer weniger metaphorischen Ebene aber zu einer Touristenattraktion wurde. Dieser Beitrag spürt dem bisher wenig beachteten Phänomen des Grenztou-rismus nach und beschreibt seine Anfänge und Erscheinungs-formen. Die Reisen an die Grenze waren dabei stets von einer Spannung zwischen Information und Sensationslust getragen, die schon den Zeitgenossen bewusst war und für die der oben genannte Gastwirt spontan den Begriff „Gruseltourismus“ ver-wendet. Schließlich nimmt der Beitrag auch die Reaktionen der ostdeutschen Grenzorgane in den Blick, vor deren Nase sich der westliche Grenztourimus entfaltete. Für sie stellten die Besuchertrauben auf der anderen Seite des Zaunes von Be-ginn an eine gezielte „Provokation“ dar.
„Besucherstrom“ an der Grenze
Der Grenztourismus nahm über die Jahre beachtliche Aus-maße an. Präzise Besucherzahlen gibt es nicht, denn schließ-lich musste niemand eine Eintrittskarte lösen, um die inner-deutsche Grenze zu sehen. Allerdings machten es sich etliche Stellen zur Aufgabe, Grenzbesucher zu zählen. Die Beamten des Zollgrenzdienstes und Bundesgrenzschutzes (BGS) zähl-
ten, weil die Sicherheit der Schaulustigen Teil ihrer Aufgabe war. Vertreter der öffentlichen Verwaltung zählten, weil sie die Ausgaben für die Grenzinformationsorte rechtfertigen mussten. Und die ostdeutschen Grenzorgane zählten, weil sie die Sicherung der „Staatsgrenze West“ gewährleisten soll-ten. Nur zwei Zahlen: 1969 besichtigten 1,65 Millionen Men-schen die Grenze, 2 1978 waren es 1,84 Millionen.3 Daneben gibt es etliche anekdotische Hinweise, die auf den Umfang des Besucheraufkommens schließen lassen. So beklagte sich ein Offi zier des British Frontier Service im Juli 1987, dass die Vielzahl der Besucher seine Soldaten bei der Ausübung ihrer Pfl ichten behindere.4 Als Massenphänomen wurde der Grenztourismus allerdings nur selten wahrgenommen, weil die Besucher sich sowohl über die gesamte Länge der Grenze als auch saisonal verteilten. Ost- und westdeutsche Grenzer beobachteten regelmäßig die jahreszeitlichen Fluktuationen des Besucherverkehrs. Witterungsbedingt stiegen die Zahlen in den Sommermonaten an und erfuhren um den 17. Juni zum Tag der Deutschen Einheit einen Höhepunkt, wenn Gedenk- und Sportveranstaltungen Besucher an die Grenze zogen. Der größte Teil der Grenzfahrten fand in Form von Tagesausfl ügen statt. Die Grenze wurde besucht, um sie zu sehen, nicht um sie legal oder illegal zu überqueren. Der Aus-fl ug an die Grenze war also weder eine Geschäfts- noch eine Versorgungsreise, sondern das, was man in der Tourismusfor-schung (und auch in Reisewarnungen) eine „nicht notwendi-ge Reise“ nennt.
Die Anfänge des Grenztourismus liegen noch vor dem Bau der Berliner Mauer, aber nach der Einführung der „besonde-ren Ordnung an der Grenze“ durch das SED-Regime am 26. Mai 1952. Die Genealogie des Phänomens muss sich an den Reak-tionen auf die Touristen orientieren, weil die Grenzbesucher selbst wenige Spuren hinterlassen haben. An diesen Reak-tionen kann man ablesen, dass der Grenztourismus bereits Mitte der 1950er Jahre in vollem Gange war. Der Auftrieb war gerade an Sonntagen so stark, dass der Zoll dem Ansturm der Besucher oft nicht mehr gewachsen war.5 Bei Lübeck erschien die Grenze einem ortsansässigen Kommentator immer mehr
Zaun-GästeDie innerdeutsche Grenze als Touristenattraktion
Astrid M. Eckert
03 24414-0 Schwark.indd 243 03 24414-0 Schwark.indd 243 11.03.2011 10:01:42 Uhr11.03.2011 10:01:42 Uhr
Neuere Forschungs ergebnisse zur innerdeutschen Grenze244
als „Rummelplatz für Reisegesellschaften.“6 Zum Leidwesen des Zollgrenzdienstes verhielten sich Grenzbesucher oft we-der vorsichtig noch näherten sie sich dem deutsch-deutschen Schnitt mit einer gewissen Pietät. Stattdessen lebten einige an der Demarkationslinie die emotionalen Spannungen und die westdeutsche Rhetorik des Kalten Krieges aus. Es galt, der DDR ein Schnippchen zu schlagen und mit ein paar ge-zielten Schritten „schnell mal in der Ostzone“ gewesen zu sein.7 Auch die Grenzpfähle auf DDR-Territorium übten eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Sie wurden oftmals beschädigt – in manchen Fällen als politische Aussagen 8 – oder sollten als Andenken herhalten.9 Die Grenze verführ-te gerade jugendliche Besucher zu Mutproben und, wie es scheint, einer allgemeinen Enthemmung. Eine Gruppe von 30 Teenagern skandierte beispielsweise 1957 am Priwall „Vopos weg“. Die ganz Waghalsigen begaben sich auf die DDR-Sei-te, „rannten wie wild im Kreise herum und gebärdeten sich
affenähnlich mit Armen und Beinen gestikulierend. Unter-malt wurde das wieder von dem ‚Vopo weg!‘ Sprechchor.“10 „Grenzzwischenfälle“ hießen solche Ereignisse dann in den Zoll- und BGS-Berichten, besonders wenn Besucher zu Scha-den gekommen oder von DDR-Grenzsoldaten verhaftet und abtransportiert worden waren.11 Sie waren also nicht immer beliebt bei den Zöllnern, diese „Freizeitdeutschen, Grenzgaffer und Souvenirjäger.“12
Angesichts solcher Vorfälle blieb dem Zollgrenzdienst und den Kommunen nichts anderes übrig, als die Grenzlinie auch von westlicher Seite abzusichern. Rechtzeitig zum Sommer-betrieb zog der Lübecker Zoll im Juni 1956 am stillgelegten Übergang Eichholz einen Drahtzaun, um so den „Besucher-strom“ einzugrenzen. Deutschlandpolitisch war eine solche Maßnahme nicht unumstritten.13 Machte jetzt der Westen die Grenze dicht? Weitere Sperren, wie beispielsweise eine Anker-kette auf dem Priwall an der Ostsee, lösten denn auch mehr Diskussionen innerhalb der Verwaltung aus, als dem Objekt allein angemessen gewesen wäre.14 Auch der Schilderwald ent-lang der Grenze verdichtete sich. Zoll und BGS stellten farbige Pfähle auf – im DDR-Jargon „BGS-Streichhölzer“ genannt –,
Karte mit dem Zonenrandweg Helmstedt. Sammlung Astrid M. Eckert
03 24414-0 Schwark.indd 244 03 24414-0 Schwark.indd 244 11.03.2011 10:01:42 Uhr11.03.2011 10:01:42 Uhr
Zaun-Gäste 245
die den Grenzverlauf markierten.15 Besuchersperren, Warnschil-der und Grenzpfähle säumten die Grenze von Lübeck bis Hof. Diese Objekte veränderten den Anblick der Grenze, der sich dem westlichen Touristen bot und wurden oft in Erinnerungs-fotos einbezogen. Der Ursprung dieses Schilder- und Sperren-dickichts waren aber zu einem nicht geringen Teil die Schau-lustigen selbst. Die Grenzbesucher veränderten also durch ihre Anwesenheit das Aussehen der Sehenswürdigkeit, die sie zu schauen gekommen waren. Mit völlig anderer Intention als das östliche Grenzregime betrieben in diesem Zusammenhang auch die westlichen Grenzkräfte eine Grenzsicherung, machten die Grenzlinie für den Besucher sichtbar, am besten unüberseh-bar, selbst – oder gerade – dort, wo von den eigentlichen DDR-Sperranlagen nicht viel zu sehen war.
Der Grenztourismus nahm über die Jahre verschiedene Formen an. Mitte der 1960er Jahre kam ein Eutiner Schul-direktor auf die Idee, das Wandern entlang der Grenze zu fördern und wollte in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Turnerbund eine Wanderroute von der Ostsee bis nach Hof ausweisen lassen. Die Volkshochschule Helmstedt richtete zur gleichen Zeit einen Zonenrandweg von der Magdebur-ger Warte bis ins Brunnental ein. Beiden Initiativen war ein volkspädagogischer Impetus eigen. Der Schuldirektor wollte die Wanderer in die Grenzgebiete bugsieren, damit die dorti-gen Bewohner kein „Gefühl des Abgeschrieben- und Verlas-senseins“ entwickelten, während der Helmstedter Grenzpfad einen „unmittelbaren Eindruck von den ‚DDR-Grenzbefes-tigungen‘“ bieten sollte.16 Im Harz verloren die Kurorte die Scheu vor der Grenze, die ihnen nach der Grenzschließung 1952 das Geschäft verhagelt hatte.17 Der Kurdirektor von Braunlage förderte den Bau einer Seilbahn auf den Wurm-berg. „Der Berg,“ so die Vorstellung, „könnte so etwas wie ein ‚Aussichtsturm‘ an Deutschlands blutender Grenze wer-den. Ihn zu besuchen, hieße dann, sich die Zerrissenheit unseres Landes im wahrsten Sinne des Wortes vor Augen zu führen.“18 Die Seilbahn wurde 1963 eröffnet. Auch Fahrten an die Grenze wurden in Braunlage zum festen Bestandteil des Veranstaltungskalenders. Zweimal im Monat pendelte ein Bus mit Kurgästen kostenfrei über Bad Sachsa und Hohegeiß durch das Grenzgebiet im Südharz.19 In den 1970er Jahren, nachdem die 1973 eingesetzte Grenzkommission sich der Frage des strittigen Grenzverlaufs auf der Elbe annahm, ka-men zudem Schiffsfahrten auf der Elbe bei Hitzacker auf. Zu Stoßzeiten rollten zehn bis fünfzehn Busse an, die Schiffe fuhren bis zu fünf Touren täglich. „Alle wollten aufs Wasser und die Grenze und Wachboote sehen,“ erinnert sich ein Ka-pitän. „Wenn die vorbei fuhren, standen die Fahrgäste plötz-lich alle auf einer Seite. Da musste man fast aufpassen, dass das Schiff nicht umkippt.“20 Den DDR-Grenztruppen blieb die „große Attraktivität dieser Form der Heranführung an die Grenze“ nicht verborgen.21
Eine Frage der Form
Allerdings löste der Grenztourismus schon bei den Zeitgenos-sen ein gewisses Unbehagen und Befremden aus. An der Gren-ze wurde scharf geschossen. Die Grenzbefestigungen waren in den 1960er Jahren zu lebensgefährlichen Anlagen ausgebaut worden, und bis zum Mauerfall im November 1989 wurden an diesem Ort Menschen bei Fluchtversuchen schwer verletzt oder getötet. Angesichts immer wiederkehrender Tragödien stell-te sich den Zeitgenossen die Geschmacksfrage. Eine Lübecker Zeitung druckte schon 1958 das Bild von einem Familienidyll mit VW-Käfer am Grenzzaun ab und titelte: „Camping vor dem Stacheldraht. Man schaut hinüber und macht es sich im üb-rigen gemütlich, mit Auto, Stühlen, Tischen, mit Kaffee und Kuchen.“ Als ebenso unpassend erschienen dem Blatt zwei Frauen im Petticoat bei einem sonntäglichen Ausfl ug: „Ein Foto fürs Familienalbum. Mutti knipst. Mit Vopo-Wachtturm im Hintergrund ein interessantes Bild. Und wenn es dunkel wird, dann fahren sie alle wieder heim.“22 Entspannung und Lebensfreude erschienen deplatziert an einem Ort, der im öf-fentlichen Diskurs der 1950er Jahre mit Spannung und Tren-nungsschmerz belegt war.
Mit den Schaulustigen kam auch der wohl unvermeidli-che Touristen-Nippes: Postkarten und Souvenirs. Selbst die frühesten Karten aus den 1950er Jahren, die Verbindungen zur innerdeutschen Grenze herstellten oder Abschnitte der-selben abbildeten, folgen den Konventionen der traditionel-len Bildpostkarte und boten einen „Gruß von der Zonengren-ze“ oder einen „Blick in die Zone“.23 Touristen konnten auch
Postkarte der frühen 1960er Jahre: „Blick in die Zone. Blankenstein in Thüringen“.
Sammlung Astrid M. Eckert
03 24414-0 Schwark.indd 245 03 24414-0 Schwark.indd 245 11.03.2011 10:01:44 Uhr11.03.2011 10:01:44 Uhr
Neuere Forschungs ergebnisse zur innerdeutschen Grenze246
Mitbringsel erwerben, beispielsweise einen Aschenbecher oder eine Mokkatasse mit dem Motiv des Grenzüberganges in Helmstedt. Das Zonengrenz-Museum Helmstedt stellt heute zwei dieser Objekte aus, über deren Herkunft und Verbrei-tung allerdings nichts bekannt ist. Je nachdem, wie man zu solchen Objekten steht, handelt es sich dabei um typischen Touristen-Kitsch oder um wertvolle Erinnerungsstücke. Die Tourismusforschung interpretiert den Kauf von Souvenirs und das Verschicken von Postkarten als Signatur des „erfolg-reichen“ Touristen: Der erfolgreiche Tourist hat alle Sehens-würdigkeiten abgehakt, den berühmten Berg bestiegen, die wichtige Ausstellung besucht und stellt nun anderen durch Souvenirs und Postkarten seine Leistung zur Schau.24 Diese Objekte stehen zudem für die Kommerzialisierung einer Se-henswürdigkeit, die, wie andere Waren auch, von Touristen konsumiert werden kann.
Das Befremden über den Grenztourismus und seine Ac-cessoires erhielt weitere Nahrung durch den Umstand, dass die Grenzreisenden Verhaltensweisen an den Tag legten, die den Kommentatoren ‚typisch touristisch‘ vorkamen. „Die rot-weißen Schlagbäume,“ berichtete die Frankfurter Allgemeine Zeitung, „sind verziert mit Initialen und Jahreszahlen, dem Schnitzwerk von Besuchern, die es gern in alle Rinden ein-schnitzen.“25 Die Touristen zückten auch gern die Kamera. Die Grenze war nun einmal „makaber-photogen.“26 Beliebte Foto-Objekte waren die DDR-Grenzsoldaten und -aufklärer, die wiederum Anweisung hatten, sich nicht fotografi eren zu lassen. Für eine Gruppe Frankfurter Schüler war es 1961 eine fast schon sportliche Herausforderung, einen Grenzpolizis-ten zu fotografi eren, denn „das war gar nicht so leicht. Wir mussten uns mit der eingestellten Kamera herumdrehen, und als die Grepos genau auf unsere Höhe kamen, drehten wir uns schnell um und knipsten.“27 Tatsächlich war jedoch an der Grenze die meiste Zeit nicht viel los. Auf weiten Stre-cken im ländlichen Raum gelegen, hatte die innerdeutsche Grenze nur an wenigen Orten so eine Dramatik zu bieten wie die Mauer in Berlin. So mancher Besuch an der Grenze, wie der einer dänischen Schülergruppe 1961, endete deshalb mit einer Enttäuschung, weil die weltpolitische Bedeutung dieser Grenze, die vielzitierte Kollision der Machtblöcke, nicht mit dem tatsächlichen Erleben vor Ort in Einklang zu bringen war. „Keine Schießerei, keine Zwischenfälle – für die [dänischen Besucher] ist das alles sehr langweilig.“28 Ande-re Grenzbesucher wurden selbst aktiv und versuchten durch Steinwürfe den Minen und Selbstschussanlagen nachzuhel-fen, um solche angeblich authentischen Bilder der Grenzsi-tuation dann auf Kamera zu bannen.29 Der eingangs zitierte Gastwirt nannte das Phänomen deshalb „Gruseltourismus“ – es gruselte die Besucher an diesem Ort der Gefahr, und es gruselte offenbar auch die Ortsansässigen angesichts derarti-ger Sensationsgier.
„Richtiges Verhalten an der Zonengrenze“: Grenzbesuche als politische Bildung
Spätestens Ende der fünfziger Jahre war die innerdeutsche Grenze als Sehenswürdigkeit fest etabliert. Allerdings nah-men Landräte, Bürgermeister, Vertreter der Länder und des gesamtdeutschen Ministeriums immer öfter Anstoß am De-korum dieser ungesteuerten Grenzbesuche bzw. dem Mangel eines solchen. Sensationsrummel und „Kaffeefahrten an die Zonengrenze“ waren nicht erwünscht. Die Bundesbahn, die solcherart Grenzfahrten anbot, zog sich den Ärger des Land-rats von Fulda zu.30 Eine einheitliche Linie, wie dem Phänomen des Grenztourismus zu begegnen sei, haben die Kommunen entlang der Grenze nie gesucht. Den einen galt der Standort an der Frontlinie des Kalten Krieges als Verpfl ichtung, Grenz-besucher aus dem In- und Ausland, besonders die politische Prominenz, zu empfangen und zu betreuen. Andere nahmen zwar die Verpfl ichtung an (oder konnten sich ihrer ohnehin nicht erwehren), lehnten aber jede Kommerzialisierung der Grenzlage ab. Der Bürgermeister von Zicherie diktierte Mitte der 1980er Jahre einem Journalisten in den Stenoblock, dass man hier immer Wert darauf gelegt habe, dass „mit der Grenze kein Jahrmarktsgeschäft betrieben wird. […] Das Aufstellen von Ansichtskartenständen und Wurstbuden haben wir verhin-dert. Das wollen wir ebensowenig wie den Verkauf von Stachel-draht.“31 Wieder andere erhofften sich wirtschaftliche Impulse von den Grenztouristen, vor allem im regionalen Fremdenver-kehr. Der Bürgermeister von Bergen-Dumme ging Mitte der 1960er Jahre davon aus, dass „von 100 Besuchern der [Grenz-] Informationsstelle zehn als Urlauber wieder[kommen].“32
Das Kuratorium Unteilbares Deutschland (KUD) reagierte zuerst auf das deutschlandpolitische Potenzial der Grenzbesu-cher und richtete auf Initiative von Ortsgruppen Informations-stellen ein. 1960 eröffnete das Zonenrandhaus in Zicherie, ein Jahr später das Informationszentrum in Offl eben.33 Auch Lo-kalpolitiker in den Grenzlandkreisen, deren Zeitbudget durch Reisegruppen stark strapaziert wurde, begannen für eine ge-zieltere Besucherbetreuung zu plädieren.34 Der Oberkreisdirek-tor von Helmstedt, Hans-Walter Conrady engagierte sich schon früh für eine bessere Organisation von Grenzbesuchen. Seiner Meinung nach sollten Schulklassen nicht nur für Fahrten nach West-Berlin, sondern auch für Besuche an der innerdeutschen Grenze Zuschüsse vom Bund erhalten.35 Aus dem ungeleiteten Grenztourismus sollte politische Bildung werden.
Niedersachsen war das erste Bundesland, das 1964 einen Besucherdienst für seine 544 Kilometer Grenze zur DDR ein-richtete, um die Touristen „über richtiges Verhalten an der Zonengrenze“ zu informieren.36 Im gleichen Jahr legten Nie-dersachsen und Hessen auch eine erste Grenzbroschüre auf, die, einem Reiseführer gleich, die Grenzbesucher an prägnante Punkte leitete, die Sperranlangen erläuterte, auf Informati-
03 24414-0 Schwark.indd 246 03 24414-0 Schwark.indd 246 11.03.2011 10:01:45 Uhr11.03.2011 10:01:45 Uhr
Zaun-Gäste 247
onszentren hinwies und Übernachtungsmöglichkeiten anbot.37 Beim Zollgrenzdienst und dem BGS konnte man Grenzfüh-rungen vorab buchen; die entsprechenden Telefonnummern waren ebenfalls in den Grenzbroschüren angegeben. Das ge-samtdeutsche Ministerium stellte Zuschüsse für Grenzfahrten bereit, sofern diese als Informationsbesuche konzipiert waren. Dem Modell der ersten ehrenamtlichen Grenzinformationsstel-len folgend, entstanden in Rathäusern, Dorfgemeinschafts-häusern, BGS- und Zollbaracken weitere Informationsräume, die von Mitarbeitern des Zolls, der Kommune oder des KUD bestückt und betrieben, in der Regel aber mit öffentlichen Geldern fi nanziert wurden. Bis 1978 hatte Bayern 15, Hessen 14, Schleswig-Holstein 10 und Niedersachsen 27 solcher Grenz-ausstel lun gen.38 Dazu kam eine Vielzahl von Informationsta-feln und Schaukästen im offenen Gelände. Die Ausstellungen zeigten in der Regel einen Nachbau der Grenze im Modell, Uni-formen und Waffen der DDR-Grenztruppen sowie Landkarten, Poster und Fotografi en. Nach Vorstellungen der Planer in Nie-dersachsen sollten die Ausstellungen aber „nicht nur über die reine Stacheldrahtsituation“ informieren, sondern auch über die Auswirkungen der Grenze für das westdeutsche „Zonen-randgebiet“.39 Die Informationsräume waren also zusätzlich Instrumente des Regionalmarketing und sollten rückblickend auch als Selbstbeschreibungen gelesen werden.
Angesichts des wachsenden Engagements staatlicher Stel-len zur Förderung von Grenzbesuchen konnten diese nicht unberührt von politischen Interessen bleiben. Der Sinn und Zweck der staatlich geförderten Reisen an die innerdeutsche Grenze wurde besonders im Zuge der neuen Ostpolitik nach 1969 zum parteipolitischen Streitpunkt zwischen Sozialdemo-kraten und konservativer Opposition. Jede Seite befürchtete, der Grenztourismus würde allein dem politischen Gegner zu-gute kommen. Der Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Innerdeutsche Beziehungen, Olaf von Wrangel (CDU), war beispielsweise 1974 der Meinung, dass die Reisen nach West-Berlin und an die innerdeutsche Grenze dazu benutzt würden, „die Politik der gegenwärtigen Bundesregierung einseitig zu propagieren.“40 Umgekehrt kam der sozialdemokratische Lei-ter der Landeszentrale für Politische Bildung in Hessen 1980 zu dem Schluss, dass die „‚Kaffeefahrten‘ zur Grenze“ nur der CDU-Opposition in Hessen dienlich seien. Es wäre besser, gar keine Grenzinformationen anzubieten, „als CDU-Propaganda zuzulassen.“41 Er befürchtete, dass „die CDU-regierten Länder Niedersachsen und Bayern sehr wohl ihre propagandistische Chance erkannt haben und die Betreuungsmaßnahmen [an der Grenze] sicher nicht die Verdienste der SPD zur Entspannung darstellen werden.“42
Auch die Informationsarbeit des BGS kam in Hessen unter Beschuss. Ob dies allerdings am politischen Klima nach dem Grundlagenvertrag oder an einer Konkurrenzsituation zwi-schen BGS und den hauptamtlichen Betreuungsstellen in den
Grenzlandkreisen lag, muss offenbleiben. Der BGS brauchte jedenfalls aufgrund seiner grenzpolizeilichen Aufgaben seine Existenz nicht über die Besucherbetreuung zu rechtfertigen, während die Mitarbeiter der Deutschlandhäuser und Seminar-zentren ihre Legitimierung aus den Besucher- und Betreu-ungszahlen ziehen mussten. Wo der BGS den Besuchern nach dem Grenzbesuch noch einen Linseneintopf anbot, setzten die Seminarleiter auf „differenzierte Betrachtungsweisen“ der Grenzproblematik und griffen nicht auf die BGS-Beamte als Grenzführer zurück. Denn, so meinten die hauptamtlichen Seminarbetreuer, der BGS „vermittle ein Feindbild, habe die Vorstellungen des kalten Kriegs noch nicht überwunden und informiere überwiegend über vordergründige, technische De-tails der Grenzanlagen, der Ausrüstung der NVA etc.“43
Mit dem Versuch, den ungeleiteten Grenztourismus nach dem Mauerbau mit staatlicher Hilfe in politische Bildung um-zumünzen, verdichtete sich die touristische Infrastruktur ent-lang der innerdeutschen Grenze und wurde langsam instituti-onalisiert und professionalisiert. Diese Verstetigung erfolgte ganz offensichtlich nicht in der Erwartung, dass die Grenze in nächster Zukunft verschwinden würde, sondern spiegelt ganz im Gegenteil die bundesdeutsche Gewöhnung an die Zwei-staatlichkeit wider. Noch in den späten 1980er Jahren wurden Grenzinformationsräume mit öffentlichen Geldern saniert oder erstmals eingerichtet.
Schulklasse in Zicherie mit Blick nach Böckwitz, 1982. Foto: Jürgen Ritter
03 24414-0 Schwark.indd 247 03 24414-0 Schwark.indd 247 11.03.2011 10:01:45 Uhr11.03.2011 10:01:45 Uhr
Neuere Forschungs ergebnisse zur innerdeutschen Grenze248
Der westliche Grenztourismus aus DDR-Sicht
Der Grenztourismus war von Beginn an eine Provokation für das ostdeutsche Grenzregime. Die Besucher sahen, was die DDR-Regierung stets leugnete: Die Sperranlagen waren eben nicht gegen westliche „Faschisten“ und „Imperialisten“ ge-richtet, sondern gegen die eigenen Bürger. Die Legitimations-lüge der DDR ließ sich beim Anblick der Grenze schlecht ver-stecken. Wie reagierten die Verantwortlichen der DDR auf die Menschenansammlungen an Übersichtspunkten und die Ent-wicklung einer touristischen Infrastruktur, die aus den Sperr-anlagen einschließlich der dort patroullierenden Grenztruppen ein sehenswertes Spektakel machte?
Tatsächlich waren die Grenztouristen schon vor dem Mauerbau ein wunder Punkt für die ostdeutsche Grenzpoli-zei. Die Deportationen von politisch angeblich unzuverläs-sigen Bewohnern aus dem Schutzstreifen 1952 hinterließen unbewirtschaftete Häuser und Gehöfte.44 Neue Bewohner anzusiedeln kam in der Regel nicht in Frage, sodass die Ge-bäude verfi elen oder für Baumaterial ausgeweidet wurden. Für die Verantwortlichen der Grenzgemeinden und auch der Grenztruppen wurde dieser Zustand bald untragbar, weil „von westlicher Seite ein starker Besucherstrom festzustellen ist, der sich ansieht, ‚wie es hinter dem Vorhang‘ aussieht.“45 Zum Leidwesen des Grenzregimes organisierten westdeutsche Busunternehmer Ende der 1950er Jahre ganze „Reisegesell-schaften […], welche an die Grenze gefahren werden, und diese Häuser sollen [dann] für die Verhältnisse in der DDR dienen.“46 Die Interpretation dieser Grenzfahrten bei DDR-Verantwortlichen war schon nicht so falsch: Die Besucher kamen, um sich über die Grenze und die DDR zu empören und den daraus resultierenden Schauder in eine Bejahung der westlichen Demokratie und der eigenen Lebensumstän-de umzusetzen. Unterstützt wurden solche Wahrnehmungen durch Publikationen der Bundesregierung, wie zum Beispiel die 1958 erstmals aufgelegte, erfolgreiche Broschüre „Mitten in Deutschland“ des Ministeriums für innerdeutsche Bezie-hungen, die Fotografi en von verlassenen und vernachlässig-ten Gebäuden gezielt einsetzte, um einen Kontrast zwischen westdeutschem Aufbau und ostdeutschem Niedergang zu bilden.47
Die vorhersehbare Reaktion auf DDR-Seite war natürlich, dem westlichen Besucher möglichst keinen Anlass zur Selbst-bestätigung zu bieten. Um sowohl die Verunglimpfungen zu unterbinden als auch die westliche Selbstzufriedenheit zu stören, sollten die Grenzgemeinden 1959 verlassene Gebäude benennen, die in Folge entweder abgerissen oder renoviert wurden. Ausschlaggebendes Kriterium war neben dem Zustand des Gebäudes die Tatsache, dass es von Westen her sichtbar war und der „Anblick sich negativ für das Ansehen der DDR
nach Westdeutschland auswirkt.“48 Bekanntlich verschwan-den entlang der Grenze ganze Dörfer.49 Um dem Problem eines verwahrlosten Eindrucks zu begegnen, zog die Stasi Mitte der 1960er Jahre in Erwägung, „unter den Grenzortschaften ei-nen Wettbewerb um das schönste Dorf an der Grenze zu ent-fachen.“50 Auch die erste Generation von Beobachtungstürmen und Drahtzäunen hatten bald nach dem Mauerbau keine Funk-tion mehr, weil die Sperranlagen laufend modernisiert und weiter ausgebaut wurden. Das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) forderte ihren Abriss, denn: „Ein sauberer Anblick ent-lang der Grenze würde dem Gegner bei seinen Hetzvorträgen gewisse Argumente nehmen.“51
Angesichts stetig steigender Besucherzahlen unterzog das MfS 1964 die „provokatorischen Grenzbesichtigungen“ einer eingehenden Analyse.52 Es versuchte einen Überblick zu ge-winnen, wer Grenzführungen anbot und durchführte, woher Grenzbesucher kamen und wo Besichtigungen am häufi gs-ten auftraten. Das MfS betrachtete den Grenztourismus zu jener Zeit als eine westliche Maßnahme der psychologischen Kriegführung im Wettkampf der Systeme. Allerdings, so die Schlussfolgerung, hatte die DDR diesen Angriffen bisher wenig entgegenzusetzen. Das MfS empfahl deshalb, eine wirksame „Konterpropaganda“ zu entwickeln. An stark frequentierten Orten sollte eine laufend aktualisierte „Sichtagitation“ ent-faltet werden, Propagandatafeln also, „die Auskunft über die Entwicklung der DDR geben und den westdeutschen Menschen unseren Lebensstandard veranschaulichen.“ Außerdem sollten zu Schwerpunktzeiten der Besucheraktivität, vor allem zu den Gedenktagen am 17. Juni und 13. August, Redner und Reise-gruppen an der Grenze durch Lautsprecher gestört werden.53 Mit diesem Vorschlag hinkte die Stasi allerdings einem Befehl des Chefs der Grenztruppen um ein Jahr hinterher, der schon im März 1963 verfügt hatte, „Nebelmittel und Lautsprecher-wagen bereitzustellen,“ um „Fotografen, Aufnahmegruppen des Westfernsehens und westlicher Filmgesellschaften sowie […] Menschenansammlungen im westlichen Grenzgebiet“ zu blenden und mit Marschmusik oder Mitteilungen zu sozialis-tischen Errungenschaften zu enervieren.54 Daneben verlegten sich die Grenztruppen auch auf das Verschießen von Flugblät-tern, die nicht nur an Bewohner des Grenzgebietes auf der Westseite, sondern auch direkt an die Grenztouristen gerichtet waren.55 Seit spätestens 1963 hörte die NVA zudem Gespräche von Grenzbesuchern an Aussichtspunkten mittels Richtmikro-fonen ab.56
Jene Orte, die das Legitimationsdefi zit der DDR vorführten und ausstellten – die Übersichtspunkte und Grenzinformati-onszentren –, wurden bald nach ihrer jeweiligen Einweihung regelmäßig von der Stasi bespitzelt oder, im Stasi-Jargon, „aufgeklärt“. Zuständig für die „Aufklärung des westlichen Vorfeldes“ war die Hauptabteilung I beim Kommando der Grenztruppen (HA I / KGT). Die Stasi interessierte sich für die
03 24414-0 Schwark.indd 248 03 24414-0 Schwark.indd 248 11.03.2011 10:01:45 Uhr11.03.2011 10:01:45 Uhr
Zaun-Gäste 249
oft ehrenamtlichen Mitarbeiter dieser Einrichtungen, dortige Veranstaltungen und den Teilnehmer- und Besucherkreis. Wer sich auf westlicher Seite besonders für Grenzfahrten enga-gierte, wie zum Beispiel der Oberkreisdirektor von Helmstedt oder die Leiterin der Grenzinformationszentrums in Offl eben, tauchte regelmäßig in den Berichten auf.57
Freilich hatte die lückenlose Orientierung der Stasi über die touristische Infrastruktur auf westlicher Seite keine Aus-wirkungen auf die Intensität des dortigen Besucheraufkom-mens; abstellen ließ sich der Grenztourismus ganz offensicht-lich nicht. Vielmehr erhöhte jedes noch so banale Ereignis am Grenzzaun die Attraktivität des Ortes. Ein Radwanderer mokierte sich Mitte der 1980er Jahre über eine Ansammlung von Grenzbesuchern, die von einem Ernteeinsatz jenseits der Werra so fasziniert waren „als sähen sie eines der sieben Welt-wunder.“ Dabei handele es sich doch nur um „ein Schauspiel, das bei westdeutschen Bauern kaum jemanden interessieren würde, da es sich um Genossenschaftsbauern handelt, aber un-geteilte Aufmerksamkeit erweckt.“58 Solche Reaktionen weisen auf den Umstand hin, dass Touristen und Schaulustige gene-rell nun einmal kommen, um etwas zu sehen. Was sie dort sahen – darauf konnte die DDR allerdings Einfl uss nehmen, z. B. im Zuge des steten Ausbaus der Grenzanlagen, in dessen Verlauf sich die Abwehr von Fluchtversuchen immer weiter ins östliche Hinterland verlagerte.
Das vorrangige Ziel des Ausbaus war es, Fluchtwillige gar nicht erst bis zum letzten Zaun und der eigentlichen Grenz-linie vordringen zu lassen. Die Einführung von engmaschi-gen Metallgitter- und Hinterlandzäunen veränderte auch die Patrouillen entlang der Grenze. Auf der östlichen Seite des Zaunes, zum Beispiel auf den Kolonnenwegen, waren regu-läre Grenztruppen eingesetzt. Auf der westlichen Seite, aus DDR-Sicht also „feindwärts“, durften nur noch als politisch zuverlässig geltende Grenzaufklärer, sogenannte GAKs, Streife laufen. Für diese Patrouillen wurde beim Grenzausbau auch an Beobachtungsbunkern nicht gespart.59 Im Ergebnis waren damit die als Fotoobjekte der Grenzbesucher so beliebten DDR-Soldaten dem touristischen Blick entzogen. „Am Sta-cheldraht eine Streife […] zu sehen, ist fast schon Glückssa-che,“ notierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung 1967.60 Wo die Grenzaufklärer doch in den Blick kamen, ließen sie sich aber nicht nur anstarren, sondern starrten zurück: Die GAKs fotografi erten Grenzbesucher sowie deren Autos, Nummern-schilder und andere markante Merkmale, was – so warnten westliche Stellen – Folgen für die Einreise in die DDR haben könnte. Ob diese Informationen tatsächlich an Grenzübergän-gen zum Einsatz kamen, ist bisher nicht belegt, allerdings trugen die Aufklärer mit solchen Aktivitäten unfreiwillig zum besonderen „Kick“ eines Grenzbesuches bei. Oberste Devise der DDR-Seite aber blieb: Langweilig sollte sie werden, die Grenze, eine Selbstverständlichkeit in der Landschaft, deren
Besuch sich nicht lohne. „Wo die Grenze einsehbar ist,“ hieß es im Jahresbericht der Bayerischen Grenzpolizei von 1986 über die Bemühungen der anderen Seite, „soll sich nichts mehr abspielen.“61
Schlussbetrachtungen
Der Grenztourismus schuf entlang der innerdeutschen Grenze eine verschrobene deutsch-deutsche Kommunikation, in der beide Seiten von ihrem Gegenpart jeweils Übles annahmen und ihre Erwartungen und Bilder oft bestätigt fanden. Im Wettstreit um das „bessere Deutschland“ waren Reisen an die Grenze zudem eine ideale Aktivität, die Überlegenheit des kapitalistischen Systems gegenüber dem sozialistischen Modell zu propagieren. Vor allem in den 1950er und 1960er Jahren waren Grenzbesuche in der Regel von deutschland-politischen Motivationen getragen: Man fuhr an die Grenze, um seine Verbundenheit mit den Menschen in der DDR zu demonstrieren; um sich solidarisch mit den Westdeutschen in den plötzlich peripheren „Zonenrandgebieten“ zu zeigen; um – im Falle von DDR-Flüchtlingen und Vertriebenen – der alten Heimat möglichst nahe zu sein; und um für eine Wie-dervereinigung unter westlichen Vorzeichen zu demonst-rieren. Allerdings – und hier teilen derartige Grenzbesuche das Schicksal des Feiertages zum 17. Juni 62 – geronnen die Proklamationen an der Grenze über die Jahre zu Ritualen mit einem gewissen Pathos. Ein Redakteur der Wochenzei-tung „Die Zeit“ mokierte sich 1969 über das Schauspiel an der Grenze, die sich „gut als Reliquie für mystische Insze-nierungen [eignet]. Eine vielseitige Kulisse für Maikundge-bungen, für Sprünge über Mahnfeuer und Stoßseufzer auf Grenzwanderungen.“63 Noch deutlicher drückte es eine Lü-becker Lokal zeitung schon 1958 aus: „Es läßt sich eben gut über Stacheldraht in eine andere Welt blicken, man muß nur auf der richtigen Seite stehen.“64
Das Stichwort von der „anderen Welt“ ist an diesem Satz zentral: Auch wenn die deutschlandpolitischen Mahner Grenzbesucher daran erinnerten, dass „auch drüben Deutsch-land“ sei, so unterstrich der Blick auf die Sperranlagen und über die Grenze eher die wachsenden Andersartigkeit der bei-den deutschen Staaten. Der Grenztourismus, so kann man schließen, war von einer inneren Spannung und Ambivalenz getrieben: Die Prominenz der „Zonengrenze“ im öffentlichen Diskurs der alten Bundesrepublik und ihre ständige Verurtei-lung als unnatürlich, willkürlich und grausam machte den konkreten Ort Grenze als Sehenswürdigkeit für Besucher in-teressant. Hier ließ sich Weltpolitik schauen. Unabhängig davon, ob Besucherinnen und Besucher sich der innerdeut-schen Grenze aus Neugier oder mit Informationsbedürfnis, mit Wehmut, Abscheu oder Trauer näherten, ihre Reisen trugen de facto nicht zur Überwindung der Teilung bei. Die
03 24414-0 Schwark.indd 249 03 24414-0 Schwark.indd 249 11.03.2011 10:01:45 Uhr11.03.2011 10:01:45 Uhr
Neuere Forschungs ergebnisse zur innerdeutschen Grenze250
Grenztouristen waren tatsächlich Zaun-Gäste im ursprüngli-chen Sinne des Wortes. Denn die meisten DDR-Bürger, denen eine deutsch-deutsche Verbundenheit demonstriert werden sollte, konnten die westlichen Besucher ohnehin nicht se-hen, und über das Leben in der DDR war auf den Aussichts-plattformen und Informationszentren an der Grenze wenig zu erfahren. Eine Grenzfahrt führte den Besuchern zwar drastisch die Teilung des Landes vor Augen, aber gerade die Hauptattraktion der Reisen – die über Jahre ausgebauten
Grenzsperren – vermittelten den Eindruck, dass die Grenze für die Ewigkeit gebaut worden sei. Es ist nicht auszuschlie-ßen, dass, anders als von den staatlichen Akteuren inten-diert, der Grenztourismus weniger zur Aufrechterhaltung der Entrüstung beitrug, sondern eher zur Gewöhnung an diese Grenze und mit ihr an die deutsche Teilung. So betrachtet, hatte der Grenztourismus kurioserweise seinen Anteil an der wachsenden Akzeptanz der territorialen und politischen Rea-litäten der Nach kriegszeit.
1 Jürgen H. Krenzer, Esskultur und Agrarkultur – kulinarisches und gastliches Ereignis, in: Berichte zur ländlichen Entwicklung 82 (2004), S. 39 – 44, Zitat S. 39. 2 Besuch der Arbeitsgruppe Zonenrandgebiet der SPD-Bundestagsfraktion am 28. / 29. Mai 1970 im Zonengrenzbezirk Gifhorn-Lüchow Dannenberg, Hessisches Haupt-staatsarchiv Wiesbaden (HHStAW), Abt. 502, Bd. 1080. Klaus Hartwig Stoll, Das war die Grenze, Fulda 1997, S. 117, nennt für den 150 km langen Grenzstreifen bei Fulda 100 000 Besucher für 1964, 233 000 für 1965 und 358 000 für 1966. 3 Verzeichnis der Informationsstellen an der Grenze zur DDR. Stand: Januar 1979, Niedersäch-sisches Landesarchiv – Hauptstaatsarchiv Hannover (NHStA) Nds. 380, Acc. 160 / 95 Nr. 1. Das Verzeichnis wurde jedes Jahr vom Ministerium für innerdeutsche Beziehungen zusammengestellt. Die angegebenen Zahlen sollten auch als Rechtfertigung der Ausgaben für die Informationszentren gelesen werden. 4 „The number of visitors to the Inner German Border (IGB) in the past has tended to divert the British Frontier Service (BFS) from their main task of escorting Border Patrols, VIPs and helicopter fl ights and collecting information on the border area.“ Lt. Col. C. Groves, HQ 1 (BR) Corps G3 (Ops), Reference 482 – 1120 / 1 G3 Ops an HQ, 1st British Corps (Bielefeld), 20. VII. 1987, Folder British Frontier Service, Zonengrenz-Museum Helmstedt. 5 Zwischenfall an der Grenze, in: Lübecker Nachrichten, 22. 7. 1956. 6 Vopo räumte alle Hinternisse ab. Abbau nur an der Lübecker Zonengrenze, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 3. 6. 1959. 7 „Auch von Lübecker Spaziergängern hat man schon oft gehört: ‚Wir waren heute nachmittag schnell mal in der Ostzone!‘ An der Schwedenschanze hatten sie den Landgraben an einer Stelle so schmal gefunden, dass es zum Hinüberspringen lockte.“ Zwischenfall an der Grenze, Lübecker Nachrichten, 22. 7. 1956. 8 Wenn z. B. Grenzsäulen mit Graffi ti wie „Weg mit dem KZ“ versehen wurden. Siehe Dokumentation über provokatorische Handlungen durch Beschmieren und Beschädigung einer Grenzsäule an der Staatsgrenze der DDR durch unbekannte Täter, 22. 7. 1977. Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik (BStU), Ministerium für Staatssicherheit (MfS), HA I Nr. 6. 9 Grenzpfähle als „Andenken“ demontiert, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 19. 2. 1957; Andreas Moser, Die DDR beginnt vor dem Zaun. BGS informiert über genauen Grenzverlauf – Unkenntnis bei Besuchern, in: Lübecker Nachrichten, 5. 7. 1985. Sowohl BGS als auch Zollgrenzdienst brachten Tä-ter wegen Diebstahls oder Sachbeschädigung zur Anzeige; ein deutschlandpolitisch ambivalenter Schritt, der von Befürwortern der Wiedervereinigung kritisiert wurde, weil ihnen unerklärlich war, warum bundesdeutsche Behörden Hoheitszeichen der DDR schützten. Siehe Bundesarchiv (BArch) B106, Bd. 83948: Strafverfolgung bei Be-schädigung oder Entwendung von Emblemschildern und Betongrenzpfählen an der Demarkationslinie, 1967 – 1971. 10 Rowdys an der Grenze, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 16. 6. 1957. 11 Als ein Beispiel unter vielen siehe: DDR-Selbstschussanlage zerfetzte 23jährigem aus Dortmund das Gesicht, in: Hessisch-Niedersächsische Allgemeine, 14. 7. 1976. Die Berichterstattung des Hauptzollamts Kassel an den Oberfi nanzpräsidenten Frankfurt zu diesem Vorfall in: HHStAW, Abt. 531, Bd. 75. 12 Sepp Binder, Die Narbe der Nation. Zwischen Touristen und Tretminen, in: Die Zeit, 13. 6. 1969, S. 8. 13 1,5 Meter Zaun auf 1 Kilometer Grenze. Wege gesperrt – DDR-Gebiet schon diesseits des „Todesstreifens“, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 15. 6. 1956. Kritiker hielten „eine völlige Verdrahtung […] im Zeichen der Wieder-vereinigung [für] unvertretbar.“ Es handelte sich in diesem Fall um neun Meter Zaun. 14 Vorsteher Hauptzollamt Lübeck-West an Bürgermeister Lübeck, 25. 4. 1961, Stadtarchiv der Hansestadt Lübeck, Bestand 04.01-0 Zentralamt, Hauptamt Nr. 154. Der Zollvorsteher sah sich gezwungen zu argumentieren, dass eine „derartige Markie-rung [Ankerkette] keinesfalls als Sperre betrachtet werden [könnte]; sie würde somit auch nicht dem Grundsatz ‚Macht das Tor auf!‘ zuwiderlaufen.“ Siehe auch Karen
03 24414-0 Schwark.indd 250 03 24414-0 Schwark.indd 250 11.03.2011 10:01:45 Uhr11.03.2011 10:01:45 Uhr
Zaun-Gäste 251
Meyer-Rebentisch, Grenzerfahrungen. Dokumentation zum Leben mit der innerdeutschen Grenze bei Lübeck von 1945 bis heute, Lübeck, o. J. [2009], S. 59 – 63. 15 Der Spitzname der Pfähle wird genannt in dem Artikel: Dicke Ankerkette sorgt am Priwall für Sicherheit, in: Lübecker Nachrichten, 21. 5. 1983. 16 Erwin H. Büter, Wandern an der Zonengrenze, in: Lübecker Nachrichten, 1. 11. 1964; Zonenrandweg Helmstedt (ZRW), Informationsblatt, o. D. [1964], Sammlung Eckert. 17 Zu den Konsequenzen der Grenzschließung für die Harz-Kurorte siehe Eckert, „Greetings from the Zonal Border“. Tourism to the Iron Curtain in West Germany, in: Zeithistorische Forschungen / Studies in Contemporary History 8 (2011) 1. 18 Schwebebahn am Eisernen Vorhang. Der Wurmberg soll „Fenster nach drüben“ werden – Baubeginn noch in diesem Jahr, in: Hamburger Echo, 24. 3. 1959. Die Website der Betreibergesellschaft http://www.wurmberg-seilbahn.de / geschichte.php, letzter Abruf 15. 1. 2011, stellt in einem Rückblick auf die Geschichte der Bahn keinen Zusammenhang zur Grenzlage mehr her. 19 Klaus von der Brelie, Tag für Tag rollen die Busse an die deutsch-deutsche Grenze. Informationsdienst erläutert Besuchern das Zonenrandgebiet, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 18. 6. 1984. 20 Kathrin Otto, Butterfahrten zum Todesstreifen. NDR – Land und Leute, 29. Dez. 2009, http://www.ndr.de / land_leute / norddeutsche_geschichte / grenzenlos / begegnungen / grenztourismus112.html, letzter Abruf 15. 1. 2011. 21 Aufklärungssammelbericht über die Handlungen des Gegners an der Staatsgrenze gegenüber dem Grenzkommando Nord, Juli 1987, BArch-Militär-archiv (MA), DVH 48, GT 15760. 22 Zonengrenze 1958, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 16. 7. 1958. 23 Die Bildmotive von Grenzpostkarten analysiert in Eckert, Greetings (wie Anm. 17). Eine Auswahl von Postkarten fi nden sich im Internet unter http://www.grenzerinnerungen.de / ansichtskarten.htm, letzter Abruf 15. 1. 2011. 24 Verena Winiwarter, Buying a Dream Come True, in: Rethinking History 5 (2001) 3, S. 451 – 454; Danielle M. Lasusa, Eiffel Tower Key Chains and Other Pieces of Reality. The Philosophy of Souvenirs, in: Philosophical Forum 38 (2007) 3, S. 271 – 287. Dieses Konsumverhalten erstreckte sich auch auf die Berliner Mauer, be-sonders nach ihrem Fall. Mauerstücke wurden als Souvenirs verkauft. Siehe Frederick Baker, The Berlin Wall: Production, Preservation and Consumption of a 20th Century Monument, in: Antiquity 67 (1993), S. 720 f.; Maren Ullrich, Geteilte Ansichten. Erinnerungslandschaft deutsch-deutsche Grenze, Berlin 2006, S. 291. 25 Dieter Hilde-brandt, Leben am Todesstreifen. Ein Bericht von der Grenze in Deutschland, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 16. 6. 1960, S. 11. Der Autor des Artikels ist nicht iden-tisch mit dem Kabarettisten gleichen Namens. 26 Vopo räumte alle Hindernisse ab. Abbau nur an der Lübecker Zonengrenze, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 3. 6. 1959. 27 Unsere Fahrt an die Zonengrenze (1961), Klassenfahrtbericht der Freiherr-vom-Stein Schule, Frankfurt / M. (im Besitz der Verfasserin). 28 Flaggen zum 1. Mai an der Zonengrenze. Skandinavische Fahnen grüßen jenseits der Schlagbäume. Grenze immer noch „Sehenswürdigkeit“ für Ausländer, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 1. 5. 1961. 29 Binder, Die Narbe der Nation (wie Anm. 12). In diesem Fall handelte es sich um amerikanische Fotojournalisten. Versuche, Minen zur Deto-nation zu bringen, sind vielfach in den Akten des Zollgrenzdienstes überliefert. 30 Mobilisierung der Hilfen für das Zonenrandgebiet. Landrat Stieler fordert Planungen auf längere Sicht, in: Fuldaer Volkszeitung, 15 7. 1964; zur Bundesbahn siehe Stoll, Grenze (wie Anm. 2), S. 120. 31 Klaus von der Brelie, Tag für Tag rollen die Busse an die deutsch-deutsche Grenze. Informationsdienst erläutert Besuchern das Zonenrandgebiet, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 18. 6. 1984. 32 Rolf Brönstrup, Stacheldraht. Notizen und Mosaiken, Leer 1966, S. 57 f. Die Anzahl der Übernachtungen in Bergen stieg von 2500 im Jahre 1955 auf über 10 000 im Jahre 1965. Ob dies allerdings auf das Grenzinformationszentrum zurückzuführen war, ist nicht nachzuweisen. 33 Erstes „Zonenrandhaus“ eingeweiht, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21. 3. 1960; Ullrich, Geteilte Ansichten (wie Anm. 24), S. 59 f. 34 „Veranlassung [für die Errichtung von Informationszentren] waren die Klagen von Landräten, Kreis- und Kommunalverwaltungen würden durch die Betreuung von Besuchergruppen zu sehr belastet.“ Heinz Kreutzmann, Bericht über die Besichtigung von Informationszen-tren entlang der Zonengrenze in Niedersachsen, 6. 8. 1965, HHStAW, Abt. 502, Nr. 11108a. 35 Landkreis Helmstedt, OKD Conrady, an Bundesministerium für gesamt-deutsche Beziehungen, o. D. [Juni 1959], BArch, B137, Bd. 1475. 36 Zitat in: Grenzbesucher werden beraten, in: Lübecker Nachrichten, 21. 8. 1964; siehe auch Kreutzmann, Bericht über die Besichtigung von Informationszentren (wie Anm. 34); sowie Innerdeutsche Informationsarbeit im Grenzbereich und an der Grenze zur DDR im Lande Niedersachsen, o. D. [1974], NHStA, V. V. P. 50 Acc. 86 / 84 Nr. 37 [Handakte Walter Braselau]. 37 Zonengrenze Niedersachsen, hg. vom niedersächsischen Mi-nister für Bundesangelegenheiten, für Vertriebene und Flüchtlinge, 1. Aufl age 1964 (weitere Aufl agen 1966, 1968). Eine Analyse der Grenzbroschüren bei Eckert, Gree-tings (wie Anm. 17). 38 Verzeichnis der Informationsstellen an der Grenze zur DDR. Stand: Januar 1979, NHStA Nds. 380, Acc. 160 / 95 Nr. 1. 39 Zitat in Kreutz-mann, Bericht über die Besichtigung von Informationszentren (wie Anm. 34). 40 Olaf von Wrangel, MdB, an Bay. Ministerpräsidenten Alfons Goppel, 19. 3. 1974, Bayerisches Hauptstaatsarchiv (BayHStA), Bayerische Staatskanzlei, Nr. 19489. 41 Wolfgang Arnold, Hessische Landeszentrale für Politische Bildung (HLZ), an Staats-sekretär Reinhart Bartholomäi, Staatskanzlei, persönlich, 19. 9. 1980, HHStAW, Abt. 502, Nr. 7518. 42 Wolfgang Arnold, HLZ, an den Beauftragten für Angelegenheiten des Grenzgebietes zur DDR, MinDirg Sprenger, 6. 3. 1980, ebenda, Nr. 7527. 43 Landesjugendamt Hessen an Hess. Sozialminister, 9. 5. 1974, ebenda, Nr. 7516b. Siehe auch Alfred Behr, Umstrittene Reisen an die Zonengrenze. Vermittelt der BGS ein „Feindbild“?, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23. 8. 1974. 44 Nach dem Mauerbau 1961 folgte eine weitere Deportationswelle. Siehe Inge Bennewitz / Rainer Potratz, Zwangsaussiedlungen an der innerdeutschen Grenze. Analysen und Dokumente, Berlin 1994; Edith Sheffer, Burned Bridge. How East and West Germans Made the Iron Curtain, Ph. D. Dissertation, Berkeley 2008, S. 218 – 255. 45 Kommando der Deutschen Grenzpolizei (DGP), Operative Abt., Protokoll, gez. Major Klinger, 20. Juni 1959, BArch-MA, Pt 8177. 46 Kommando der DGP, 4. Grenzbrigade, gez. Bär, an Komman-deur der DGP, 17. Juni 1959, ebenda. 47 Eine Analyse der Bildsprache dieser Broschüre in ihren elf Aufl agen bei Ullrich, Geteilte Ansichten (wie Anm. 24), S. 107 – 117. 48 DGP, Dienststelle Schönberg, Kp. Schlagbrügge, Protokoll (Nr. 3) über die Besichtigung und Überprüfung eines in unmittelbarer Grenznähe stehenden, baufälligen Wohngebäudes im Bereich der Dienststelle Schlagbrügge (Grenzbereitschaft Schönberg), 28. 8. 1959, BArch-MA, Pt 8177. 49 Dörfer und Flecken wurden bis in die 1980er Jahre abgerissen. Eine Überblicksdarstellung zu den Wüstungen im Schutzstreifen gibt es nicht. Das Thema wurde aber in der Lokalgeschichte aufgegriffen: Janet Hesse, Befriedet. Vergessene Orte an der innerdeutschen Grenze, Hamburg 2009; Norbert Fuchs, Billmuthausen. Das verurteilte Dorf, Hildburghausen 1991. 50 HA I, Abt. Aufklärung, Kommando der Grenztruppen, 14. 4. 1964, Analyse der provokatorischen Grenzbesichtigungen an der Staatsgrenze West der DDR, BStU, MfS, ZAIG, Nr. 10695, Bl. 204. Die weitere Entwicklung dieses Vorschlages ist nicht bekannt. Wie die amerikanische Anthropologin Daphne Berdahl in einer Studie beschrieben hat, verliehen die Verschönerungsanstrengungen den verbliebenen Ortschaften im Schutzstreifen zum Teil den Charakter Potemkinscher Dörfer. Daphne Berdahl, Where the World Ended. Re-Unifi cation and Identity in the German Borderland, Berkeley 1999, S. 150. 51 HA I, Abt. Aufklärung, Kommando der Grenztruppen, 14. 4. 1964, Analyse der provokatorischen Grenzbesichtigungen an der Staatsgrenze West der DDR, BStU, MfS, ZAIG, Nr. 10695, Bl. 205. 52 HA I, Abt. Aufklärung, Kommando der Grenztruppen, 14. 4. 1964, Analyse der provokatorischen Grenzbesichtigungen an der Staatsgrenze West der DDR, BStU, MfS, ZAIG, Nr. 10695. Die Analyse hat 56 Sei-ten. 53 Ebenda, Bl. 203 f. 54 Befehl des Chefs der Grenztruppen Nr 18 / 63, 28. 3. 1963, gez. Oberst Peter, BArch-MA, DVW 1: Ministerium für nationale Verteidi-gung, Befehle des Ministers für nationale Verteidigung, Jan.-März 1963, Bd. 12914. 55 Das Zonengrenz-Museum Helmstedt stellt ein solches Flugblatt aus: „Ein ‚Grenzlandfahrer‘ hört … salbungsvolle Reden über Menschlichkeit[,] gegenseitige Kontakte[,] Freiheit und Demokratie und handelt richtig … wenn er fordert, daß endlich Verhandlungen zwischen der Bundesregierung und der Regierung der DDR stattfi nden. Nur sie führen zur Verständigung.“ O. D. [ca. 1964], Hervorhebung im Original. 56 Bundesministerium für Finanzen an alle Bundesministerien, einschl. Bundesamt für Verfassungsschutz, Betr. Grenzzwischenfälle und -nachrichten von der Demarkati-onslinie zur SBZ, 29. 7. 1963, Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes (PA AA), B38, Bd. 51. Die Information über die Abhöranlagen stammte von einem gefl üchteten Grenzsoldaten. Ein Beispiel für die Arbeit des „Horchdienstes“ des Grenzkommando Nord von 1979 fi ndet sich in BArch-MA, DVH 48, GT 8429. 57 Gerhard Schätz-lein / Reinhold Albert, Grenzerfahrungen. Bezirk Suhl – Bayern / Hessen zur Zeit der Wende, Hildburghausen 2005, 224 – 253, zitieren ausführlich aus der „Feindobjektakte Thüringenblick“ zum Bayernturm in Zimmerau. Siehe auch die Berichte über den Turm auf dem Ratzenberg bei Lauenstein, Ks. Kronach sowie über das Zonenrandhaus in Zicherie, Ks. Gifhorn, beide Februar 1964, in BStU, MfS, ZAIG Nr. 10708, Bl. 212 – 214 und 217 – 220. 58 Rolf Nobel, Mitten durch Deutschland. Reportage einer Grenz-fahrt, Hamburg 1986, S. 191. 59 In den frühen 1970er Jahren gab es entlang der Grenze fast 1000 Beobachtungsstände und -bunker. Siehe Gert Ritter / Joseph G. Haj-du, Die innerdeutsche Grenze, Köln 1982, S. 43; Peter Joachim Lapp / Jürgen Ritter, Die Grenze. Ein deutsches Bauwerk, Berlin 2007, S. 69, Bilder solcher Anlagen ebenda, S. 59, 81. 60 Stoll, Grenze (wie Anm. 3), S. 128, basierend auf einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 2. 1. 1967. 61 Manfred Präcklein, Der Zaun ist völlig zu. Innerdeutsche Grenzanlagen werden jetzt noch perfekter gesichert, in: Lübecker Nachrichten, 1. 8. 1986. 62 Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der Bun-desrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948 – 1990, Darmstadt 1999. 63 Binder, Die Narbe der Nation (wie Anm. 12) 64 Zonen-grenze 1958, in: Lübecker Freie Presse am Morgen, 16. 7. 1958.
03 24414-0 Schwark.indd 251 03 24414-0 Schwark.indd 251 11.03.2011 10:01:45 Uhr11.03.2011 10:01:45 Uhr