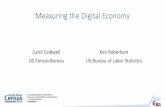William Robertson (1721–1793)
Transcript of William Robertson (1721–1793)
In: Heinz Duchhardt, Małgorzata Morawiec, Wolfgang Schmale, Winfried Schulze (Hg.), Europa-Historiker. Ein biographisches Handbuch, Bd. 2, Göttingen 2007, S. 23–48
Joachim Berger
William Robertson (1721–1793)
»Whoever records the transactions of any of the more considerable Euro-pean states during the two last centuries must write the history of Eu-rope« (HCH V/I, S. 88).*
Der Schotte William Robertson wird in vielen Darstellungen zur britischen Aufklärung(shistorie) in einem Atemzug mit David Hume und Edward Gibbon genannt. Freilich weist sein histori-sches Werk konzeptionelle und inhaltliche Eigenheiten auf: In den vier Hauptschriften überlagern sich ältere Traditionen der schottischen Historiographie und presbyterianische Werthaltun-gen mit kosmopolitischen, probritischen und fortschrittsoptimi-stischen Passagen. Sein in Teilen ›universaleuropäischer‹ Ansatz rechtfertigt es indes, Robertson in eine Auswahl von »Europa-Historikern« aufzunehmen. Als ›europäisches‹ Referenzwerk soll im Folgenden der einführende Band der History of the reign of the emperor Charles V (1769) mit dem Titel A view of the progress of society in Europe im Zentrum stehen.
1. Vita.1 William Robertson wird am 29. September 1721 in Borthwick südlich von Edinburgh geboren. Sein Vater ist dort Pfarrer der Church of Scotland. William besucht die Universität in Edinburgh, wo er sich auf Literatur, Philosophie und Ge-schichte konzentriert. Er erwirbt eine breite Allgemeinbildung in den Geisteswissenschaften, auch in Logik, Natur- und Moralphi-losophie. Schließlich studiert er auch Theologie bei John Goldic und befasst sich ausgiebig mit calvinistischer und arminianischer Literatur. 1744 übernimmt er die Pfarrei im ländlichen 1500-Seelen-Dorf Gladsmuir südlich von Edinburgh. Als beide Eltern 1745 sterben, muss Robertson für seine sieben Geschwister sor-gen, so dass er seine Jugendliebe, seine Kusine Mary Nisbet, erst spät (1755) heiraten kann.
24 Joachim Berger
Schnell steigt Robertson in der Church of Scotland auf. Be-hilflich ist ihm der Konflikt über das Patronat der Kirchen. Er befürwortet die Besetzung der Pfarrstellen durch wohlhabende Landbesitzer, deren Familien Kirchen gestiftet hatten, und stellt sich gegen eine Wahl durch die Pfarrgemeinde, wie sie die strengen Presbyterianer fordern, und wie es seit der Glorious Revolution eigentlich in der Kirk vorgesehen ist. Nach der Nie-derschlagung des Jakobitischen Aufstandes (1746) wird die Kro-ne zum größten Patron in Schottland; sie besitzt nun ein Drittel der Kirchenpatronate. Robertson sieht die Patrone als Obrigkeit, der die Gläubigen nicht rechtmäßig widersprechen können. 1752 setzt er mit einigen Gesinnungsgenossen eine Richtungsände-rung in der Church of Scotland durch: Die Generalversammlung untersagt den Presbyterien, die Patronage anzufechten. Damit etabliert sie sich als höchste schiedsrichtliche Instanz in der Kirk. Die von Robertson angeführte Moderate Party wird von den mächtigen Patronen und dem Patronagebeauftragten der Krone unterstützt. In der Church of Scotland ist die Sehnsucht nach in-nerkirchlicher Ordnung und Disziplin weit verbreitet. Sie trifft sich mit Robertsons Wunsch, der Kirk größtmögliche Unterstüt-zung durch den Staat und der General Assembly höchstmögliche Autorität zu sichern. Abspaltungen nimmt er in Kauf.
1758 erhält Robertson die Edinburgher Pfarrei Lady Yester’s, bald darauf wird er nach Old Greyfriars versetzt. 1759 erscheint sein erstes historiographisches Werk, die History of Scotland during the reigns of Queen Mary and James VI, für das er die hohe Summe von £ 600 erhält und die David Hume ausdrücklich lobt. In London gewinnt er durch Vermittlung Humes die Gunst des Earl of Bute (John Stuart), des Favoriten von Thronfolger George (III.). Bute, ebenfalls Schotte, stellt Robertson eine Sine-kure der Regierung in London in Aussicht, um eine mehrbändige Geschichte Englands zu schreiben. Die episkopale Church of England kommt für den schottischen Presbyterianer jedoch nicht in Frage; zudem will er seine Familie nicht verlassen. Als Bute 1762 Staatsminister wird, verschafft er Robertson die Position des Prinzipals der Universität Edinburgh und den Titel eines kö-niglichen Historiographen für Schottland – eine Ehre, die dem Geistlichen £ 200 im Jahr einbringen wird. Obgleich materiell unabhängig, gibt er seine Pfarrei nicht auf. Robertson bekleidet
William Robertson (1721–1793) 25
<William Robertson (1721–1793). Porträt von Joshua Reynolds (© National Galleries of Scotland)>
26 Joachim Berger
nun eine führende Position in der Kirche und im akademischen Leben Schottlands: Als Prinzipal der Universität Edinburgh (1762–1793) ist er ständiges Mitglied der Generalversammlung der Church of Scotland, in der er zwischen 1762 und 1780 zum Führer der Moderate Party avanciert – eine inoffizielle Position mit beträchtlichen Einflussmöglichkeiten. 1762 wird Robertson zudem Gründungsmitglied des schottisch-patriotischen Poker Club, der sich für eine Bürgermiliz einsetzt, um künftige Invasi-onsversuche abzuwehren und die allgemeinen Bürgertugenden zu stärken.
Trotz seiner Ämter findet er Zeit, um seine historischen Stu-dien weiterzuverfolgen. 1769 erscheint die dreibändige History of the Reign of the Emporor Charles V, 1777 die History of Ame-rica, die sich in zwei Bänden mit der spanisch-portugiesischen Eroberung Lateinamerikas befasst. Danach beginnt Robertson sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen. In den Jahren 1778/1779 streitet die Generalversammlung über die vom Par-lament in Westminster verfügte Lockerung der Restriktionen für Katholiken. Robertson, der den Catholic relief befürwortet, sieht sich Anfeindungen ausgesetzt und legt deshalb 1780 seine kirch-lichen Funktionen nieder. Obgleich zunehmend durch Rheuma und wachsende Taubheit beeinträchtigt, bleibt er Prinzipal der Universität und Pfarrer in Old Greyfriars. 1791 legt er sein letz-tes historisches Werk vor: An Historical Disquisition concerning the Knowledge which the Ancients had of India. Darin stellt er den Austausch zwischen Indien und Europa in der Antike dar. Am 4. Juni 1793 stirbt William Robertson in Edinburgh.
Zeit seines Lebens war Robertson in die gelehrte Gesellschaft Edinburghs eingebunden. So war er 1754 Gründungsmitglied der Select Society of Edinburgh, einer literarischen Sozietät. Seiner Kirk maß er die Aufgabe zu, zur Kultivierung der schottischen Gesellschaft beizutragen, indem sie sich in der ästhetisch-gelehr-ten Bildung engagieren und die Harmonie zwischen den sozialen Schichten der Gesellschaft fördern sollte. In diesem Sinn wider-setzen sich die Moderates um Robertson 1756 erfolgreich der Exkommunikation der religiösen Skeptiker Lord Kames (Henry Home) und David Hume – die Kirche habe sich nicht als inquisi-torisches Tribunal in den privaten Glauben ihrer Mitglieder ein-zumischen, die sich – wie Hume – nicht einmal als solche ver-
William Robertson (1721–1793) 27
standen. Freilich trat er für eine starke Kirche ein. Insofern konn-te er die Unterstützung durch staatliche Kräfte nur so lange gut-heißen, wie sie die Unabhängigkeit der Kirk nicht antastete. Die knapp zwei Jahrzehnte, die Robertson an der Spitze der schotti-schen Kirche stand, fallen mit einer Schwäche der königlich-britischen Administration in Schottland zusammen.
Robertsons ›europäische‹ Erfahrungen waren beschränkt. An-ders als Hume oder Gibbon war er kein aktiver Teil der républi-que des lettres. Zeit seines Lebens kam Robertson kaum aus Edinburgh heraus; die Insel verließ er nie. Die Mitgliedschaft in den Akademien von Madrid, Padua und St. Petersburg nutzte er offensichtlich nicht für gelehrten Austausch. Zudem schrieb er ungern; nur etwa 350 Briefe sind erhalten2. Darin äußert er sich so gut wie nie zum historischen Schreiben, zum Gang der Politik oder zu philosophischen und theologischen Fragen. Für Künste und unterhaltende Geselligkeit interessierte sich der calvinisti-sche Asket kaum; nie ging er ins Theater, nahm weder am Kar-tenspiel noch an Tanzabenden teil3. In dieser Beziehung war Robertson, verglichen mit Vielschreibern wie Johnson, Voltaire oder Wieland, kein typischer Aufklärer – er versuchte nicht, sich selbst als »philosophe« zu inszenieren. In den Briefen ging es ihm, wenn nicht Kirche oder Universität der Anlass waren, mei-stens um Verlag, Absatz und Rezeption seiner Schriften. Robertson konnte gut verhandeln: Für die dreibändige Geschich-te Karls V. erhielt er das für die damalige Zeit unglaubliche Ho-norar von £ 3.500 zuzüglich £ 500 für eine zweite Auflage4. Pu-blizieren war für ihn ein sozialer Akt, Teil der der intellektuellen und materiellen Verbreitung von Ideen. Er investierte viel Zeit in die Vermarktung seiner Bücher5. So kümmerte er sich für die zweite Auflage der Geschichte Karls V. (1771) persönlich um den Kupferstich seines Porträts von Joshua Reynolds (vgl. Ab-bildung)6. Das Ideal des zurückgezogenen Gelehrten war Robertson fremd. Bei aller fachlicher Seriosität wollte er in eine außerfachliche Öffentlichkeit wirken. Er richtete sein Augen-merk auf die europaweite Verbreitung seiner Schriften, wozu er gezielt den Kontakt zu Übersetzern und Verlegern in Frankreich suchte. In diesem Anspruch auf dissemination ließe sich eine spezifische Modernität des Wissenschaftlers Robertson erken-nen.
28 Joachim Berger
2. Œuvre. In Edinburgh studierte Robertson bei Charles Mackie, der dort von 1719 bis 1746 den ersten Lehrstuhl für »Universal History« innehatte. In seinen Vorlesungen verfolgte er die Um-wälzungen seit dem Untergang des römischen Reiches7. Wahr-scheinlich nahm Robertson auch an Adam Smiths öffentlichen Vorlesungen zur Jurisprudenz teil (1748–1750). Darin liefert Smith den Abriß einer »stadial theory of history« – eine Theorie des stufenweisen Fortschritts in der Geschichte: Auf ›barbari-sche‹ Gesellschaften (ohne Privateigentum) folgen nomadische, sodann landwirtschaftliche (»agricultural societies«) und schließ-lich, auf der höchsten Stufe der Kultivierung, »commercial so-cieties«. Smith verfolgt die Ursachen und Folgen von Verände-rungen in der Natur und dem Besitzstand von Eigentum. Diese Stufentheorie, eine besondere Ausprägung der »conjectural hi-story«, lehrte Robertson, Ereignisse in den Kontext der Ge-schichte des Eigentums und der Kultur (»manners«) einer Peri-ode einzuordnen.
In seinem eigenen Œuvre bezog Robertson die Geschichte Eu-ropas auf die der europäischen Expansion. Von den geographi-schen Räumen der vier Hauptwerke ausgehend, lässt sich mit Friedrich Meinecke von einem »Entwicklungsgang seines uni-versalhistorischen Sinnes« sprechen8: Zunächst befasst sich Robertson mit Schottland in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhun-derts, als es als Akteur im europäischen Staatensystem auftritt. Anschließend untersucht er die Entstehung dieses Systems bis zum »universalmonarchischen« Anspruch Karls V. In seinen beiden letzten Werken verfolgt er dann die europäische Expansi-on in der ›Neuen Welt‹ und versucht, deren Rückwirkung »auf das Kräfteverhältnis im europäischen System zu schildern«9.
Die Partien von Robertsons Werk, die der Stufentheorie fol-gen – vor allem der einführende Band der Geschichte Karls V., der vierte und siebte Band der Geschichte Amerikas sowie die Historical Disquisition über Indien –, können als Entwicklungs-geschichte der europäischen Zivilisation gelesen werden. Sie kreist um die Geburt des Staatensystems, das Anwachsen mo-narchischer Macht, die Reformationen und die europäische Ex-pansion, in einem Zeitalter, das durch Handel, Wissenschaft und politeness umgeformt wurde. Robertson sah durchaus, dass im Zuge der Kolonialisierung eingeborene Kulturen und Gesell-
William Robertson (1721–1793) 29
schaften in Amerika und Indien zerstört wurden. Offen verurteil-te er die Brutalität und die Goldgier der spanischen Konquistado-ren. Die amerikanischen Ureinwohner porträtiert er einerseits als Wilde, die auf der niedrigsten Stufe in der Entwicklung der Völ-ker stehen, andererseits betont er ihre Menschlichkeit und ihr unverdientes Leiden durch die Kolonialisten. Die Vorsehung werde dafür sorgen, dass die westliche Expansion den Weg für eine wachsende Einheit der Menschheit den Boden bereite – durch die Entwicklung neuer, friedvollerer Netzwerke durch »commerce« (Handel und Kommunikation).
Der Eindruck liegt nahe, dass Robertson in seinen histori-schen Werken generell einen Fortschritt hin zu einer harmoni-scheren Weltordnung beschreibt. Es ist vermutet worden, dass dieser christlich grundierte Fortschrittsglaube Robertsons per-sönliches Wirken in Kirche und Universität reflektiert, mit denen er das soziale und intellektuelle Klima in Schottland nach den konfessionellen Auseinandersetzungen des 17. und 18. Jahrhun-derts zu entschärfen suchte10. Der Theologe und Kirchenmann scheint jedoch in den ›stadialen‹ Partien seines Werkes nur ver-halten auf. Deutlicher war Robertsons einzige publizierte Predigt The situation of the world at the time of Christ’s appearance, and its connexion with the success of his religion, considered (1755). Darin zeichnet er das Wirken des Christentums als fort-schrittlichster Kraft der Menschheitsgeschichte nach. Im ausge-henden Römischen Reich und nach dessen Untergang hätten die Christen neue Maßstäbe für Moralität und neue Ideale der Frei-heit freigesetzt. So seien in Europa allmählich die Sklaverei ab-geschafft, die kriegerische Disposition der Völker gemildert, Sit-ten und Moral gestärkt, und die Regierungen sensibler für die Bedürfnisse ihrer Völker geworden. Robertsons Predigt verfolgt den Einfluss der Vorsehung auf den Fortschritt in der Welt11 – eine universalhistorische, heilsgeschichtlich fundierte Paralleler-zählung zur Einführung der Geschichte Karls V.
Die »stadial history« forderte grundsätzlich, jede Gesellschaft nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Menschen verschie-dener Epochen wurden nicht nur verschiedene Sitten, Einstellun-gen und Verhaltensweisen zugestanden, sondern auch verschie-dene Persönlichkeitskerne. Für Robertson bestand somit das Problem, diese historischen Unterschiede mit dem unwandelba-
30 Joachim Berger
ren und ewigen Willen Gottes zu vereinen12. Denn ein wesentli-ches Motiv, sich wissenschaftlich mit Geschichte zu beschäfti-gen, fand er in seiner Überzeugung, dass der Mensch den Plan und das Wirken der göttlichen Vorsehung in der »civil history of human beings« erkennen könne (Sermon, S. 3).
Als Historiker versuchte er, christliche und »aufklärerische« Werthaltungen in Einklang zu bringen. Wie Voltaire, Hume und Gibbon interessiert er sich anhaltend für die Ausprägungen und Wirkweisen des Aberglaubens. Im Unterschied zu ihnen ging Robertson von einem festen protestantisch-presbyterianischen Standpunkt aus und glaubte fest an das Fortschreiten des Chri-stentums. Sein Nachdenken über das historische Wirken der Vorsehung war freilich nuanciert und komplex.
Robertson war überzeugt, dass die christliche Religion in der Entwicklung der westlichen Welt seit der Reformation und Ge-genreformation in einem notwendigerweise unfertigen Verständ-nis des göttlichen Wortes stehen geblieben war. Doch er sah im späteren 17. und im 18. Jahrhundert durchaus einen grundlegen-den Fortschritt des Handels und der internationalen Verflechtung der Wirtschaft, welche die Zivilisation weiter voranbringe, und damit auch Möglichkeiten, das Wort Gottes weiter zu verbreiten. Schon im Sermon von 1755 hatte er seine »globalisierte« Über-zeugung formuliert:
»The world may now be considered as one vast society, closely cemented by mutual wants; each parts contributing its share towards the subsi-stence, the pleasure, and improvement of the whole« (Sermon, S. 11).
Skeptisch war er freilich, ob die Welt des 18. Jahrhunderts dar-auf vorbereitet sei, ein tieferes Verständnis des göttlichen Wortes zu erlangen.13
»Conjectural history« reduzierte tendenziell Religion auf Kul-tur und führte Kultur auf die materiellen Grundlagen der Gesell-schaft zurück. Sie galt deshalb einerseits als materialistisch und hob sich andererseits von einer »philosophical history« ab, die sich kritisch gegenüber Aberglauben und Schwärmerei zeigte und dabei auch die institutionalisierten Kirchen ins Visier nahm. Robertson versuchte in einigen Partien seiner historischen Werke beide Richtungen zu versöhnen, ohne sie sich gänzlich zu eigen zu machen. So ist der vierte Band der History of America als
William Robertson (1721–1793) 31
Kommentar zur grundlegenden Überzeugung der »conjectural history« zu lesen, dass die physischen, sozialen, politischen, reli-giösen, militärischen und ästhetisch-künstlerischen Züge einer jeden Gesellschaft von ihren Subsistenzgrundlagen abhingen. Der Willen zur individuellen Unabhängigkeit bei den »Wilden« rühre daher, dass ihre Gesellschaft kein Privateigentum kenne. Denn die christliche Theologie baue auf einer Reihe von abstrak-ten Vorannahmen über die Natur Gottes auf, welche die ameri-kanischen Ureinwohner gar nicht hätten verstehen können; daher sei der Versuch christlicher Missionare, sie zu konvertieren, so grausam wie vergeblich gewesen14.
Dass Robertson ein gläubiger Calvinist war, zeigt sich in sei-nen Hauptinterpretationslinien historischer Zusammenhänge nicht unmittelbar: Die Akteure im Modernisierungsprozess sind für ihn Nationalstaaten, die sich auf die Herrschaft des Rechts gründen. Ihm geht es darum, die historischen Grundlagen Euro-pas vor dem Auftreten von Nationalstaaten zu erforschen. Nicht-christliche und nicht-»zivilisierte« Völker schätzte er grundsätz-lich geringer als christliche Völker. Doch führt keine gerade Li-nie von Robertson zum Eurozentrismus und Kolonialismus des 19. Jahrhunderts, wie es jüngere Stimmen nahe legen15. Auch spielte er selten die Geschichte der »wahren« gegen die der »fal-schen« Religion explizit aus. So vermied er in der History of Scotland alle Kontroversen, die der Stoff nahe gelegt hätte. Die Geschichte ist ihm ein Mittel, um Gräben in der schottischen Gesellschaft zu überbrücken: zwischen Anhängern der Häuser Stuart und Hannover, zwischen Episkopalen, Presbyterianern und altschottischen Whigs. Einerseits verteidigte er die im 16. Jahrhundert entstandene presbyterianische Struktur der Kirk, an-dererseits erkannte er gewisse episkopale Beiträge zu deren Formierung an. Robertson schrieb auch nicht an der britischen Identitätskonstruktion des 18. Jahrhunderts mit, die sich vor al-lem in Abgrenzung von einem imaginierten katholischen, frem-den Anderen vollzog und dadurch massenwirksam wurde. Den Kausalnexus »popery – arbitrary power – slavery – poverty«16, der vor allem in der Geschichte Karls V. nahegelegen hätte, stell-te er nur verhalten her.
In seinem Spätwerk An Historical Disquisition (1791) verlässt Robertson endgültig vorgezogene Linien. In Indien erkennt er
32 Joachim Berger
eine tolerante Welt, in der Polytheismus und Monotheismus ne-beneinander bestehen konnten. Folglich wurde das Buch in Großbritannien kritisiert – es sei nicht geeignet, die Missionie-rung des indischen Subkontinents zu unterstützen. Jüngere For-schungen sehen bei Robertson das Konzept einer neuen Weltre-ligion aufscheinen, die alle Glaubensrichtungen und Konfessio-nen aufnehme. Philipson zieht sogar eine Linie von Marsilio Ficino, Erasmus und Cudworth über radikalere Freidenker wie Toland und Trenchard zu Robertson, dem er Affinitäten zu den Unitariern zuschreibt. Gemeinsam sei ihnen das Interesse an ei-ner Naturgeschichte der Religion, welche die Verbindungen zwi-schen dem Christentum und den anderen Weltreligionen auf-zeigt, sowie die Sensibilität für den Schaden, den der Aberglaube dem Prozess der Zivilisation zugefügt habe17. Wie dem auch sei – in seinem letzten historischen Werk kehrt William Robertson zu den Fragen von Vorsehung und Fortschritt zurück, die er in der publizierten Predigt aus dem Jahr 1755 aufgeworfen hatte. Die Antworten fallen nun jedoch weniger eindeutig aus.
Robertson war im Vergleich zu den französischen philosophes ein »konservativer« Aufklärer18, dessen historiographisches Werk mit Kategorien wie Toleranz und Fortschrittsglauben nicht ein-heitlich zu erfassen ist. Von seinem Wirken als Theologe, Uni-versitäts- und Kirchenpolitiker, der in der Kirk gegen einen allzu exkludierenden, gegenüber der Church of England unversöhnli-chen Presbyterianismus anging, sind keine eindeutigen Rück-schlüsse auf seine historischen Schriften abzuleiten. Betrachtet man das Gesamtwerk, so lässt sich nicht behaupten, dass Robertson generell eine Vision von Großbritannien und seiner politischen Klasse verfolgt habe, welche englische und schotti-sche Literati, die landed Gentry und die Aristokratie verbinden sollte19. Ein großer Teil seines Werkes war keine kosmopoliti-sche, fortschrittsgläubige und tolerante stadial history, sondern eine narrative Geschichtsschreibung nach älteren Mustern und Werthaltungen der schottischen Historiographie: »militant Prote-stantism […], defensive patriotism, martial virtue, and resistance to overbearing authority«20. Robertsons historische Wertungen und Perspektiven weisen eine erhebliche Spannweite auf, je nachdem, auf welche Partien man sich bezieht.
William Robertson (1721–1793) 33
Wenn es im Folgenden um den »europäischen« Ansatz Robertsons gehen soll, den er im einführenden Band der Ge-schichte der Regierungszeit Karls V. praktiziert, dann wird die Perspektive bewusst verengt – auf den Versuch einer »stadial history« Europas von der Antike bis zum Beginn der Neuzeit, der für das Gesamtwerk nicht typisch ist. Nicht zufällig fügte Robertson den einführenden den zwei folgenden Bänden der Ge-schichte Karls V. zuletzt hinzu. Er scheint die Publikation des ganzen Werks um mehrere Jahre verzögert zu haben21.
3. Ein »europäischer Ansatz«. Robertson konnte in den 1760er Jahren auf einem Corpus von historischen Werken zur Entste-hung des modernen Europa aufbauen. Zu nennen sind vor allem Paul de Rapin Thoryas’ vierbändige History of England (über-setzt von Nicholas Tindal, London 1725–1731), die Großbritan-niens Aufstieg zur europäischen Groß- und Weltmacht auf den internationalen Wettbewerb und die britische Invasionsfurcht zurückführt. Thoryas fand ein großes Echo in der britischen Ge-schichtsschreibung, unter anderem in David Humes History of England (1754–1762). Robertson beschränkte sich jedoch nicht auf Sekundärliteratur, sondern konsultierte die seinerzeit verfüg-baren publizierten und teilweise auch ungedruckte Quellen.
A view of the progress of society in Europe, der einführende Band der Geschichte der Regierungszeit Karls V., gliedert sich in drei Abschnitte. Der erste beschreibt den progress of society hinsichtlich der Ordnungsmechanismen, des Rechtswesens und der manners in den europäischen Gesellschaften seit dem Zerfall des Römischen Reichs. Aus dem Chaos der Völkerwanderung entsteht allmählich das Lehnswesen, das sich nachhaltig auf Künste, Literatur und Religion auswirkt. Das »feudal system« Europas entwickelt sich in einem vierstufigen Umformungspro-zess des Grundbesitzes, der sich schnell vom ursprünglichen freien Allodialbesitz wegbewegt. Es konnte sich europaweit etab-lieren, da die europäischen Gesellschaften in »manners« und so-zialen Formen prinzipiell ähnlich gewesen seien, so sehr sie sich in Sprachen und »origin« unterschieden. Die Kreuzzüge waren das erste gemeineuropäische Unternehmen, das – so verwerflich seine ursprünglichen Motive waren – für zwei Jahrhunderte ei-nen engen Austausch zwischen West und Ost herbeiführte und
34 Joachim Berger
wesentlich zur Kultivierung der europäischen Gesellschaften bei-trug. Entscheidende Faktoren, welche die Macht der lokalen Ade-ligen schwächten und den Monarchen ermöglichten, ihre Reiche zu befrieden, waren wachsender Handel und »consumption« – gefördert durch die italienischen Stadtstaaten und die Hanse:
»Commerce tends to wear off those prejudices which maintain distinction and animosity between nations. It softens and polishes the manners of men. It unites them by one of the strongest of all ties, the desire of sup-plying their mutual wants. It disposes them to peace […]« (HCH V/I, S. 81).
Der zweite Abschnitt betrachtet den »progress of society« hin-sichtlich der Fähigkeit der spätmittelalterlichen Staaten, sich ge-genüber den rivalisierenden Mächten zu behaupten. Die Etablie-rung einer geordneten Regierung erscheint als zentraler Faktor in der historischen Entwicklung hin zur modernen Gesellschaft (des 18. Jahrhunderts). Den Maßstab, von dem die Gemeinwesen des späten Mittelalters noch weit entfernt waren, gibt der Zustand ab, »in which extensive monarchies act with the united vigour of the whole community, or carry on great undertakings with perse-verance and success« (HCH V/I, S. 84). Den Historiker der Zeit Karls V. interessieren die Auswirkungen des »feudal system« auf die internationalen Beziehungen; es wundert ihn, dass sich in der »feudal era« kein Netz der internationalen Diplomatie ent-wickelt habe. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts erkennt Robertson in allen Monarchien eine Konzentration der Ressourcen. Er ver-folgt den »Hundertjährigen Krieg« zwischen England und Frank-reich, die Ausstrahlung der französischen »standing armies« un-ter Ludwig XI. nach England und Spanien, die militärische Re-volution (Feuerwaffen) sowie das Tauziehen um das burgundische Erbe und schließlich die Liga von Cambrai (1508). Das europäische Staatensystem mit seinen vielfachen Verflech-tungen und der regulativen Idee der »balance of power« entsteht: »the preservation of a proper distribution of power among all the members of the system into which the states of Europe are formed« (HCH V/I, S. 112). Robertson stuft das 15. Jahrhundert nicht zur Vorgeschichte der Zeit Karls V. herab, sondern sieht in der spätmittelalterlichen Entwicklung »a capital object in the history of Europe« (HCH V/I, S. 91).
William Robertson (1721–1793) 35
Im dritten Abschnitt verlässt Robertson die Ebene der univer-saleuropäischen Strukturelemente. Nun vergleicht er die politi-sche Verfassung der »wichtigsten« (principal) Staaten Europas zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Er will die Ursachen für die Un-terschiede in den politischen Systemen aufzeigen »which have produced such variety in the character and genius of nations« (HCH V/I, S. 123). Dabei konzentriert er sich vor allem auf die Spielräume der Monarchen gegenüber den Adelskorporationen und Ständevertretungen. Er schließt mit einem Abschnitt zum Osmanischen Reich.
Zu den »principal states of Europe« im Mittelalter zählt Robertson das Römisch-deutsche Reich, die Staatswesen der italienischen Halbinsel einschließlich des Kirchenstaats, die Rei-che auf der iberischen Halbinsel sowie Frankreich. Die briti-schen Inseln rechnet er ebenfalls Europa zu – im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen. Dagegen blendet er Skandinavien, Ostmittel- und Südosteuropa ebenso aus wie das Baltikum, die Kiewer Rus oder das Großfürstentum Moskau. Die Begrenzung auf West-, Mittel- und Südeuropa folgt keinem Kanon von Abendland-Vorstellungen. Sie ist allerdings auch nicht willkür-lich: Diese Staaten waren die Hauptakteure in der Epoche Karls V., auf die der erste Band hinführt. Die innere Kohärenz dieses »Kern-Europa« ist für Robertson – bei allen Differenzierungen – beträchtlich. Nicht zufällig spricht er vom »people of Europe« im Singular! (HCH V/I, S. 123). Die Vorstellung von Europa als Wertegemeinschaft scheint hier auf, wird aber nicht weiter aus-geführt, da Robertson das Christentum als konstituierenden Fak-tor des Kontinents weitgehend außen vor lässt.
Das Osmanische Reich sieht er in der Epoche Karls V. eng-stens mit den »großen Nationen Europas« verwoben; es habe sich mit solchem Nachdruck in die Kriege und Verhandlungen der christlichen Fürsten eingeschaltet, dass man seine Regie-rungsformen kennen müsse. Zu Europa zählt Robertson das Os-manische Reich trotz dieser engen Beziehungen nicht, auch wenn er es nicht offen davon abgrenzt. Zum impliziten Aus-schlussmerkmal erhebt er nicht die Religion, sondern den »asia-tischen« »genius of their policy«. Dieser sei im Gegensatz zu den monarchischen und republikanischen Regierungsformen der europäischen Staaten als »despotisch« zu bezeichnen. Die sozia-
36 Joachim Berger
len Beziehungen im Osmanischen Reich charakterisiert er als Verhältnis zwischen Meistern und Sklaven (HCH V/I, S. 187–189). Dies hält Robertson nicht davon ab, einzelne Sultane, vor allem Suleiman II. (1495–1566), als herausragende Herrscherge-stalten darzustellen. Suleiman, den Christen vor allem als Erobe-rer bekannt, werde in den türkischen Annalen als großer Geset-zesgeber gefeiert, der Recht und Ordnung hergestellt habe, und dessen lange Regierung sowohl Autorität als auch Weisheit kennzeichnen. Das Osmanischen Reich habe seine innere Ver-fassung durch eine Reihe fähiger Herrscher bis ins 16. Jahrhun-dert in einem Ausmaß gefestigt, von dem die »great monarchies in Christendom« weit entfernt waren (HCH V/I, S. 192).
Was das semantische Feld von »Europa« und »europäisch« betrifft, so verwendet Robertson in A view das Adjektiv »Euro-pean« nur 18 Mal, und zwar fast ausschließlich in den Zusam-mensetzungen »European nations« oder »European states«. Bei-de Begriffspaare dienen dazu, räsonierende, zusammenfassende Bemerkungen abzuschließen, oder einen neuen Abschnitt pro-grammatisch einzuleiten. So beginnt bereits der erste Satz: »Two great revolutions have happened in the political state, and in the manners of the European nations« – verursacht durch Aufstieg und Untergang des Römischen Reiches (HCH V/I, S. 1). Das »Europäische« wird also als politische Zuordnungseinheit einge-setzt. Dagegen verzichtet Robertson begrifflich auf jede Bin-nendifferenzierung (west-, süd-, osteuropäisch etc.). Gelegent-lich setzt er die Entwicklung in einer bestimmten Gesellschaft gegenüber den restlichen europäischen Nationen ab (ebd., S. 113, 144, 154), ohne diese in sich zu unterscheiden – die »Eu-ropean nations« erscheinen als homogene Gemeinschaft. Das Substantiv »Europe« kommt dagegen auf 184 Seiten in sehr un-terschiedlichen Kontexten vor; es dient kaum zur Inklusion bzw. Abgrenzung einer politischen Gemeinschaft.
Mit dem ersten Band will Robertson in die Geschichte Euro-pas vor der Regierungszeit Karls V. einführen. Es geht ihm darin primär darum, die Entstehung des europäischen Staatensystems aus den mittelalterlichen Monarchien nachzuzeichnen und des-sen »political principles and maxims« zu verstehen. Nur wer mit der Geschichte dieses »general systems« vertraut sei, könne sei-ne Funktionsweisen in der Gegenwart durchschauen, um dadurch
William Robertson (1721–1793) 37
sowohl die Zusammenhänge der großen europäischen »politi-kals« als auch das innere Eigenleben der Nationalstaaten zu be-schreiben. Robertson gilt der Gleichgewichtsgedanke als das große Geheimnis moderner Politik. Das Zeitalter Karls V. mar-kiert das Ende des Ideals der Universalmonarchie und die Ent-stehung eines Systems unabhängiger Staaten in Europa. Das neue System der Diplomatie basiere auf der »balance of power«, die hegemoniale Bestrebungen in Zaum halten sollte. Die Mo-narchen des 16. Jahrhunderts hätten somit die Grundlagen für ein System der internationalen Beziehungen gelegt, das bis ins 18. Jahrhundert fortbestanden habe – Frieden und Wohlstand des modernen Europa seien auf diplomatischen Wege begründet worden22.
Robertson interessiert sich primär für die Entstehung des frühneuzeitlichen Staatensystems, nicht für ökonomische Zu-sammenhänge oder künstlerisch-wissenschaftliche Entwicklun-gen. Gleichwohl beschränkt er sich nicht auf eine politik-, ver-fassungs- und rechtsgeschichtliche Perspektive. Zum einen inte-griert er sozial- und wirtschaftshistorische Phänomene, zum anderen zeigt er ein anthropologisch motiviertes Interesse an den »powers und passions« der Menschen. Die Genese und Entwick-lung des europäischen Staatensystems zu untersuchen, ist für ihn kein Selbstzweck. Sein Stufenmodell sieht einen Zusammenhang zwischen der »Verfeinerung« der Kultur (»refinement of man-ners«) und der Verrechtlichung der innerstaatlichen Regierungs-formen wie auch der zwischenstaatlichen Beziehungen. Der Be-griff der manners, also der ungeschriebenen ethischen und ästhe-tischen Regeln des menschlichen Umgangs, ist eine zentrale, erkenntnisleitende Kategorie in A View of the progress of socie-ty: Das europäische Staatensystem bildet sich nicht zuletzt deshalb heraus, weil die Gesellschaften Europas mit wachsen-dem »refinement« und »intercourse« eine gemeinsame Schnitt-menge von menschlichen Umgangsformen entwickeln. In die-sem Sinn ist Robertsons Ansatz durchaus als »kulturhistorisch« zu betrachten.23
Darstellerisch setzt Robertson in der Einführung Politik und soziale Strukturen über religiöse Bewegungen. Er konzentriert sich auf die gesellschaftlichen und politischen Faktoren, die zu den europäischen Reformationen beitrugen. Doch verfolgt er,
38 Joachim Berger
wie sich die Ausübung der christlichen Religion auf die Gesell-schaften Europas seit dem frühen Mittelalter auswirkte. Die Christianisierung des Kontinents sieht er als langsamen Prozess:
»The barbarous nations, when converted to Christianity, changed the ob-ject, not the spirit, of their religious worship. They endeavoured to con-ciliate the favour of the true God by means not unlike to those which they had employed in order to appease their false deities« (HCH V/I, S. 19).
A view of the progress of society erscheint als Parallelerzählung zu der publizierten Predigt aus dem Jahr 1755: Das Wort Gottes werde sich umso stärker entfalten, je mehr die Gesellschaften materiell voranschritten (Eigentum, Rechtsordnung). Die Aus-prägungen des Christentums vor dem 16. Jahrhundert seien da-her unvollständig und von Aberglauben verdeckt gewesen.
Bis zum Zeitalter der Reformation hätten sich die gesell-schaftlichen Verhältnisse so entwickelt, dass die Menschen eine neue Dimension des göttlichen Wortes empfangen konnten: Ei-nerseits sei die Reformbedürftigkeit einer universalen Kirche überdeutlich geworden, andererseits habe das neue System inter-nationaler Beziehungen die Kommunikation zwischen den euro-päischen Gesellschaften erheblich verbessert. Die Reformation erscheint sowohl als ein von der Vorsehung verordnetes religiö-ses Ereignis, als auch als der Vorbote einer neuen kulturellen Ordnung für ganz Europa samt der katholischen Staaten. Auf die theologischen Anliegen Luthers, Zwinglis und Calvins sowie die lehrmäßige Begründung der sich im 16. Jahrhundert entwickeln-den Bekenntnisse geht der presbyterianische Geistliche nicht ausführlich ein. Indem er die Theologie- von der Profange-schichte abgrenzt, will er bewusst die Historie von der Theologie emanzipieren, »um dadurch sowohl der Gefahr einer Säkularisie-rung der Kirchenhistorie wie auch einer Theologisierung der Profangeschichte zu entgehen«. Damit reproduziert Robertson auch die scharfe Trennung zwischen »ecclesiastical« und »civil« bzw. »universal history« an der Universität Edinburg. Er klam-mert theologische Fragestellungen aus, da er ausdrücklich nicht in eine konfessionell gebundene »Parteigeschichtsschreibung« zurückfallen möchte24. Seine Absicht ist es, die Geistlichkeit als wichtigen, zivilisierenden Faktor in die allgemeine Geschichte einzuschreiben. Außerdem, und das wird abschließend noch
William Robertson (1721–1793) 39
deutlicher werden, zielt er auf die Rezeption eines ›europäi-schen‹ Publikums, das er nicht auf den protestantischen Bereich beschränken wollte. Unnachsichtig ist er gegenüber religiös be-gründeten Unterdrückungen. So geißelt er die »Unterjochung« der Christen durch die Mauren in Spanien deutlich, wobei er sich in ganz Europa des Beifalls sicher sein konnte (HCH V/I, S. 147).
A view of the progress of society in Europe präsentiert eine europäische »Meistererzählung«. In gewisser Hinsicht bildet sie eine antizipierte Fortsetzung von Edward Gibbons The Decline and Fall of the Roman Empire (1776–1788), deren Schlussbände Robertsons Geschichte vom Ausbau und Niedergang der Feu-dalordnung des mittelalterlichen Europas aufnehmen25. In seiner Teleologie, seiner normativen Grundierung und seinem Eurozen-trismus bietet A view der historischen Europaforschung des 21. Jahrhunderts sicherlich keine Orientierung. Bemerkenswert über seine Zeit hinaus bleibt Robertsons Versuch, staatenübergreifen-de Merkmale mit nationalen Eigenheiten zu verbinden und diese in einem Anhang durch Beispiele und Belege zu vertiefen. Als treibende Kräfte für die Herausbildung gesamteuropäischer Strukturen versteht Robertson die Kommunikationsprozesse und die Diffusion von Wissen zwischen und innerhalb von Gesell-schaften – er untersucht also »Kulturtransfer« avant la lettre. Die entscheidenden Kategorien sind »intercourse«, »connection« und »variety« (z. B. HCH V/I, S. 36).
In den ersten beiden Abschnitten konstruiert Robertson einen Gleichschritt der Entwicklung in Europa, eine Art unsichtbare Verbindung, die strukturelle Unterschiede bewusst einebnet. Dies gleicht er durch eine zweite Textschicht aus: Die »proofs and illustrations« sind weit mehr als Quellennachweise, sondern weit reichende Exkurse, welche nationale und auch regionale Besonderheiten darlegen. Somit verbindet Robertson »transkul-turelle« mit vergleichenden Darstellungsformen. Seine Ver-gleichsparameter benennt er klar. Beispielsweise verfolgt er im ersten Abschnitt, wie sich Ansiedlungen im hohen Mittelalter allmählich in politische Gemeinwesen mit eigener Jurisdiktion verwandelten – ein Vorgang »which contributed more, perhaps, than any other cause, to introduce regular government, police, and arts, and to diffuse them over Europe« (HCH V/I, S. 30f.). Vergleichend untersucht er auch die Beteiligung städtischer Räte
40 Joachim Berger
an der Gesetzgebung in nationalen Ständeversammlungen. In-dem sie den »rigor of aristocratical oppression« milderte, habe sie sich wohltuend auf die »liberty in every country of Europe« ausgewirkt (ebd., S. 39).
Obgleich Robertson vor allem im dritten Teil Besonderheiten der einzelnen Staaten herausarbeitet, wirken sie sich nicht auf seine Interpretation des »general progress of society in Europe« aus. Das »Europäische Dilemma« der Historiographie (Theodor Schieder) besteht bei ihm weniger auf der darstellerischen Ebe-ne, sondern im vorwissenschaftlichen Bereich, in den Grundan-nahmen seiner Fortschrittsteleologie. Immerhin unterscheidet Robertson zwischen Intentionen und Wirkungen. Eine ähnliche Ambivalenz wie den Kreuzzügen wohne dem kanonischen Recht inne. Unter politischen Gesichtspunkten betrachtet sei es eine der »most formidable engines ever formed against the happiness of civil society«. Doch wenn man es nur als einen Rechtskodex an-sehe, der die Rechte von Individuen schütze, erscheine es in gün-stigerem Licht (HCH V/I, S. 63). Die Verbreitung des Kanoni-schen wie des Römischen Rechts habe darüber hinaus die euro-päischen Gesellschaften zusammengeführt und einen weit reichenden »change in manners« verursacht (ebd., S. 67). Diese Veränderung (Kultivierung) sei zudem durch den Kodex der Rit-terlichkeit vom 12. bis zum 15. Jahrhundert überall in Europa vorangetrieben worden (ebd., S. 69–71).
Robertsons erster Biograph Dugald Stewart charakterisierte seinen Ansatz als eine Kombination des »Soziologischen« mit dem »Historischen«26. Er führt »Gesellschaft« als analytische Kategorie ein, welche anhand von Vergleichsparametern die na-tionalen Einzelgeschichten in einer »europäischen« Geschichte verbinden soll. A view ist überwiegend strukturgeschichtlich an-geordnet. Dieser Ansatz kontrastiert mit den beiden folgenden, narrativ angelegten Bänden. Die Geschichte der Regierungszeit Karls V. umfasst also die unterschiedlichen, zum Teil wider-sprüchlichen Ansätze in Robertsons Gesamtwerk.
Erst zum Abschluss seines Lebens, als er der Kirchenpolitik längst den Rücken gekehrt hatte, wandte er sich klar von den älteren ›schottischen‹ Traditionen ab, die seine drei ersten histo-riographischen Werke durchziehen. Ein zu Lebzeiten unpubli-zierter Sermon Commemorating the Revolution of 1688 aus dem
William Robertson (1721–1793) 41
Jahr 1788, kurz vor der französischen Revolution, enthält eine Art Vermächtnis: Mit großer Deutlichkeit tritt Robertson für die Freiheit der Meinungsäußerung und des Glaubens ein – für Tole-ranz. Großbritannien sei »the last station among the kingdoms of Europe of a free constitution and equal laws«. Ein vordergründig kosmopolitisches, zutiefst eurozentrisches Ideal siegt über whig-gistisch-schottischen Isolationismus, wenn Robertson die Hoff-nung äußerst, dass die europäischen Nationen eines Tages das britische Modell einer konstitutionellen Monarchie mit »civil and religious liberty« übernehmen werden. Hoffnung geben ihm vor allem das Erstarken der Parlements und der Aristokratie in Frankreich, die in den Jahren 1787 und 1788 eine begrenzte Glau-bensfreiheit für Protestanten sowie Schritte zu einer allgemeinen Meinungsfreiheit durchgesetzt hatten – für Robertson langfristige Folgen der ein Säkulum zurückliegenden »Glorreichen Revoluti-on«. In seiner Vision einer »European community of nations« erscheint 1688 als Wendepunkt des Fortschritts hin zu gegenseiti-gem Austausch und kultureller Integration in Europa:
»All the civilized nations of Europe may be considered as forming one exclusive community. The intercourse among them is great, and every improvement in science, in arts, in commerce, in government introduced into any of them is soon known in the others, and in time is adopted and imitated. Hence arises […] the general resemblance among all the people of Europe, and their great superiority over the rest of mankind«.
Begründet lag diese kosmopolitisch-eurozentrische Hoffnung im Glauben an die Güte und Gerechtigkeit der Vorsehung, »in whose hand it is to lift up nations and to cast them down«27.
4. Rezeption in der europäischen république des lettres. Robert-son publizierte seine Geschichte der Regierungszeit Karls V. wenige Jahre nach dem Siebenjährigen Krieg, der Europa auf dem Höhepunkt des Ringens um das Gleichgewicht seiner Staa-ten gesehen hatte, und der gerade in Großbritannien anfangs als Konfessionskrieg dargestellt worden war. Es verwundert nicht, dass ein Werk, welches das Ende universaler Ordnungen auf staatlicher und kirchlicher Ebene behandelt, auf großes Interesse stieß. Zu Robertsons Lebzeiten erlebte die Geschichte Karls V. im englischen Original sieben Auflagen, zahlreiche weitere im 19. Jahrhundert folgten. Von der hohen Londoner Erstauflage
42 Joachim Berger
von 4.000 Exemplaren verkauften sich in den ersten vier Mona-ten bereits 3.000. Robertsons Verleger Strahan machte mit den fünf von ihm publizierten Auflagen etwa £ 15.000 Gewinn! Zu-dem erschienen in Dublin zwischen 1769 und 1771 fünf kosten-günstige, unautorisierte Nachdrucke für den britischen Markt28.
Auch inhaltlich wurde das Werk in Großbritannien intensiv rezipiert und blieb nicht ohne Widerspruch. Immerhin führte die Geschichte Karls V. das systemische Denken in die britische Geschichtsanschauung ein und verband die britischen Inseln konzeptionell mit dem ›europäischen‹ System. Der Rezensent des Annual Register, der sich auf die Umbruchsphase der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts konzentrierte, verstand Großbritan-nien zwar in Robertsons Sinne als Teil des »system of Europe«. Mit antischottischem Unterton übte er freilich Kritik:
»[…] he has not allowed to England that due share in the continental transactions of Europe, and that great weight and influence in the general political system, which she undoubtedly held«29.
Der Rezensent des London Magazine griff Robertsons Schilde-rung der Entstehung stehender Armeen in Europa heraus. Dieser müsse besonders aufschlussreich sein für einen Engländer »who loves to examine the progress of despotism in other countries, to guard against the fatal effects of it in his own«30.
Robertson war um die Rezeption seines Werks außerhalb Großbritanniens bemüht. David Hume nutzte seinen eigenen Ruf in der intellektuellen Elite von Paris, um für seinen schottischen »Kollegen« zu werben. Sein Freund Baron d’Holbach vermittelte einen Übersetzer für die Geschichte Karls V.: Jean-Baptiste-Antoine Suard (1734–1817) hatte bereits Hume und Samuel Richardson übersetzt. Hume sandte aus der Londoner Presse Bo-gen für Bogen der Geschichte Karls V. an Suard. Als die franzö-sische Übersetzung 1771 erschien, war Paris bereits darauf ein-gestimmt: Die Correspondance littéraire schätzte die Geschichte Karls V. als »un des meilleurs ouvrages qu’on nous ait donnés depuis longtemps« ein31, und verglich sie mit Montesquieu und Voltaire. Damit war eine positive Rezeption nicht nur in der Pa-riser Gesellschaft, sondern auch an den Höfen des Reiches vor-bereitet. Auch Kaiserin Katharina II. von Russland, ebenfalls Empfängerin der Correspondance, nahm das Werk zur Kennt-
William Robertson (1721–1793) 43
nis. In St. Petersburg erschien 1775 bis 1778 sogar eine russische Übersetzung der französischen Ausgabe32.
Die französischen »philosophes« nahmen Robertson als einen der ihren auf. Vermutlich schätzten sie besonders seine Kritik des Aberglaubens in der mittelalterlichen Kirche und projizierten auf ihn ihr Loblied auf die Werte von Toleranz und Fortschritt. Ein Grund für die positive Aufnahme in Frankreich war sicher-lich der pragmatisch-didaktische Ansatz Robertsons, der Ge-schichte als »a pleasurable instrument of useful instruction« ver-stand.33 Der Schotte, der sich in der Einleitung ausdrücklich von Voltaire absetzte, wurde so der »philosophical history« zuge-schlagen. Man schätzte sein Bemühen um historische Genauig-keit; sein Anliegen, Kausalitäten und menschliche Handlungs-möglichkeiten zu zeigen; sowie die Sprache, der Suards Überset-zung ›philosophische‹ Gravität verliehen hatte.
Doch anders als Voltaire war der Kirchenmann Robertson natürlich nicht grundsätzlich kirchenkritisch, geschweige denn antichristlich. Dem radikalen Flügel der »philosophes« war er keinesfalls zuzurechnen. »Toleranz« als regulative Idee zu pro-pagieren, hieß für ihn nicht, den eigenen konfessionellen Stand-punkt aufzugeben. Von »europäischer« Tragweite war die Frage, wie Robertson den Zustand der Kirche und des Christentums insgesamt zu Beginn der Regierung Karls V. darstellte. In den Abschnitten zu Martin Luther im zweiten Band der Geschichte Karls V. hatte Robertson den verderbten Zustand der römischen Kirche und deren Verfolgung religiöser Reformer benannt; den Erfolg der Reformation führte er auf die Vorsehung zurück (HCH V/2, S. 78, 120). Obwohl er sich sehr um Ausgewogenheit bemühte und dafür von Protestanten auch kritisiert wurde, war er sich bewusst, daß seine Einschätzung der Reformation in Frank-reich nicht unproblematisch war. Folglich warb Suard – nach Aufforderung des Autors! – in einem Avertissement du traducteur um Verständnis für den Standpunkt des Verfassers als eines protestantischen Geistlichen, der die Unwissenheit und den Aberglauben, der in der katholischen Kirche vorgeherrscht habe, zu Recht kritisiere. Gegenüber der Religion insgesamt habe er jedoch hohen Respekt. Damit hob Suard Robertsons Kirchenkri-tik auf einen allgemein aufklärerisch-rationalistischen Stand-punkt, dem sich auch die katholischen Abbés unter den französi-
44 Joachim Berger
schen »philosophes« anschließen konnten. Diesen fiel die An-nahme des Werkes umso leichter, als Robertson in der Einleitung den Adel und die französischen Parlement zu Bollwerken gegen monarchischen Despotismus seit dem Spätmittelalter erhebt. Ge-schrieben hatte Robertson dies vor dem Hintergrund der in den 1760er Jahren massiv zunehmenden Ansprüche der Parlements, vor allem desjenigen von Paris, als Wächter der Rechte der Nati-on aufzutreten. In der aufgeladenen Atmosphäre des Paris der frühen 1770er Jahre wurde Robertsons mittelalterliche Geschich-te zu einem antiabsolutistischem Referenzwerk34.
In Deutschland, insbesondere an der Universität Göttingen, wurde das englische Original der Geschichte Karls V. schnell rezipiert. Rasch folgte eine deutsche Übersetzung durch den Braunschweiger Konsistorialrat Matthias Theodor Christoph Mittelstedt (1712–1777), der bereits die Geschichte Schottlands übersetzt hatte. Nach Mittelstedts Tod gab Julius August Remer (1738–1803) die Übersetzung in überarbeiteter Form heraus. Wie das Original an einen deutschen Erwartungshorizont ange-passt, und wie diese Übertragung rezipiert wurde, kann hier nicht ausgeführt werden35. Es ist jedoch nachvollziehbar, dass eine Erfolgsgeschichte der »Verfeinerung der Sitten und Gebräuche« in Europa, die zugleich das Ende der monarchia universalis im 16. Jahrhundert markierte, im späten Alten Reich auf nachhalti-ges Interesse stieß. Auch in Italien erschien schon 1774 eine Übersetzung. Die italienische Ausgabe basierte auf der französi-schen und enthielt sogar das Avvertimento Suards. Um bei katho-lischen Lesern um Nachsicht zu werben, versah der italienische Herausgeber besonders die Passagen zur Reformation mit relati-vierenden Anmerkungen. Besonders Robertsons Kritik an der (1773 aufgehobenen!) Gesellschaft Jesu wollte er widerlegen. 1781 gab Guiseppe Maria Galanti in Neapel den Prospetto de’ progressi nella societa in Europa separat heraus, zwischen 1787 und 1789 dann eine neue Übersetzung aller drei Bände. Auch er rückte in Anmerkungen antikatholische Wertungen Robertsons zurecht36. Schließlich sei wenigstens erwähnt, dass zwischen 1800 und 1804 sogar eine schwedische Ausgabe folgte, obgleich Robertson Nordeuropa in seiner Darstellung weitgehend ausge-blendet hatte.
William Robertson (1721–1793) 45
Als William Robertson den View of the progress of Society in Europe als Einführung der Geschichte Karls V. verfasst hatte, war er sich bewusst gewesen, dass das Werk in Kontinentaleuro-pa eine ähnlich gegenwartsbezogene Relevanz gewinnen konnte als auf den britischen Inseln. Während er sich mit Rücksicht auf englische Leser dezidiert schottischer und presbyterianischer Werturteile enthielt, richtete er die Darstellung der französischen Parlements, des »Germanic Body« und der »petty states« Itali-ens auf ein Publikum auf ›dem Kontinent‹ aus. Sein Kalkül ging auf: Ihre europaweite Verbreitung im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts macht Robertsons Geschichte Karls V. im doppel-ten Sinn zu einem ›europäischen‹ Werk.
Bibliographische Hinweise
I. Hauptwerke (Erstausgaben). Alle Erstausgaben zitiert nach der digitalen Reproduktion in: Eighteenth Century Collections Onli-ne <http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO> (letzter Zugriff am 14.07.2006). The situation of the world at the time of Christ’s appearance, and its connexion with the success of his religion, considered […], Edinburgh 1755 [Sermon]; The history of Scot-land, during the reigns of Queen Mary and of King James VI. till his accession to the crown of England […], London 1759; The history of the reign of the emperor Charles V. With a view of the progress of society in Europe, from the subversion of the Roman Empire to the beginning of the 16th century, 3 Bde., London 1769 [HCH V]; The history of America, containing the history of Virginia to the year 1688 and the history of New England to the year 1652, 2 Bde., London 1777; An historical disquisition con-cerning the knowledge which the Ancients had of India and the progresss of trade with that country prior to the discovery of the passage to it by the Cape of Good Hope […], London 1791.
II. Zeitgenössische Übersetzungen der Geschichte Karls V. L’histoire du regne de l’empereur Charles-quint, précédée d’un tableau des progrès de la Société en Europe, depuis la destructi-on de l’Empire romain jusq’au commencement du seizieme siè-
46 Joachim Berger
cle, 6 Bde., Maastricht 1775 (12°); dass., 6 Bde., Amsterdam-Paris [u.a.] 1775 (8º); Histoire du regne de l’empereur Charles-Quint, d’après Robertson: Ouvrage revu par une société d’ecclesiastique, Tours 1783 (8˚); L’histoire du regne de l’empereur Charles-Quint, 6 Bde., Amsterdam 1788 (8°); La storia del regno dell’imperatore Carlo-Quinto preceduta da una descrizione de’ progressi della societa in Europa dalla distruzi-one dell’imperio romano sino al principio del secolo decimo-sesto, 6 Bde., Colonia (i. e. Venedig) [1774, 2. Aufl. ibid. 1788] (12°); Prospetto de’ progressi nella societa in Europa dalla ca-duta dell’Impero romano fino al principio del 16. secolo, 2 Bde., Napoli 1781 (8°); Storia del Regno dell’Imperator Carlo-Quinto […]. Preceduta da un Prospetto de’ progressi della società in Europa, dalla distruzione dell’imperio romano, sino al principio del secolo XVI, 6 Bde., Neapel 1787–1789; Geschichte der Re-gierung Kaiser Karls V.: nebst einem Abrisse des Wachsthums und Fortgangs des gesellschaftlichen Lebens in Europa, bis auf den Anfang des sechszehenten Jahrhunderts. Aus dem Engli-schen übersetzt von M. T. Chr. Mittelstedt. 2. Aufl., von neuem durchgesehen u. mit Anmerkungen begleitet von Julius August Remer., 2 Bde., Braunschweig 1778–1779; Geschichte der Re-gierung Kaiser Carls des V. aus dem Englischen übersetzt. Nebst einem Abriß des Wachsthums und Fortgangs des gesellschaftli-chen Lebens in Europa bis auf den Anfang des sechszehenten Jahrhunderts. Von neuem durchgesehen u. mit den Remerischen u. andern Anmerkungen begleitet [von Joseph Martin von Abe-le], 3 Bde., Kempten 1781–1783; Willhelm Robertsons Historia om kejsar Carl Vs regering. Öfversatt af Elis Schröderheim [Bd. 3 u. 4 von Conrad Leonhard Eckerbom], Stockholm 1800–1804.
III. Literatur (Auswahl). Stewart J. Brown (Hrsg.), William Ro-bertson and the expansion of Empire, Cambridge u. a. 1997; Al-exander Sigismund Marais Du Toit, Patriotism, Presbyterianism, liberty and empire: an alternative view of the historical writing of William Robertson, PhD-thesis University of London [masch.] 2000; Felix Gilbert, Editor’s introduction, in: William Robertson, The Progress of society in Europe. A historical out-line from the subversion of the roman empire to the beginning of the sixteenth century, hrsg. von Felix Gilbert, Chicago 1972, S. XI–XXIV; László Kontler, William Robertson’s History of
William Robertson (1721–1793) 47
Manners in German, 1770–1795, in: Journal of the History of Ideas 58 (1997), S. 125–144; ders., William Robertson and his German audience on European and non-European civilisations, in: Scottish Historical Review 80 (2001), S. 63–8; J. G. A. Po-cock, William Robertson and the History of Europe, in: ders., Barbarism and Religion, Bd. 2: Narratives of civil government, Cambridge 1999, S. 258–305; Manfred Schlenke, William Ro-bertson als Geschichtsschreiber des europäischen Staatensy-stems, Diss. Univ. Marburg [masch.] 1953; ders., Kulturge-schichte oder politische Geschichte in der Geschichtsschreibung des 18. Jahrhunderts: William Robertson als Historiker des eu-ropäischen Staatensystems, in: Archiv für Kulturgeschichte 37 (1955), S. 60–97; Richard B. Sher, Church and University in the Scottish Enlightenment: The Moderate Literati of Edinburgh, Princeton 1985; Gianfranco Tarabuzzi, Le traduzioni italiane settecentesche delle opere di William Robertson, in: Rivista Storica Italiana 91 (1979), S. 486–509.
Anmerkungen
* Für Anregungen und Kritik danke ich besonders Irene Dingel (Mainz). 1 Zur Vita vgl. v.a. Stewart J. Brown, in: ders. 1997, S. 7–35. 2 Jeffrey Smitten, in: Brown 1997, S. 36–54. 3 DuToit 2000, S. 55. 4 Dies entsprach 1997 ca. $ 300.000. Richard B. Sher, in: Brown 1997, S. 165. 5 Smitten 1997, S. 39f. 6 Sher 1997, S. 177. 7 Nicholas Philipson, in: Brown 1997, S. 57. 8 Friedrich Meinecke, Die Entstehung des Historismus, München 2. Aufl. 1946, S. 242, zit. n. Schlenke 1953, S. 124. 9 Schlenke 1953, S. 124. 10 So Brown, Introduction, in: Brown 1997, S. 2. 11 Brown 1997, S. 16f. 12 Zum folgenden Philipson 1997, S. 59, 68f. 13 Philipson 1997, S. 71. 14 Ebenda, S. 56f., 64, 66. 15 So z. B. Kimihiro Koyanagi, Civilization and history in Lord Kames and William Robertson, in: Tatsuya Sakamoto/Hideo Tanaka (Hg.), The rise of political economy in the Scottish enlightenment, London-New York 2003, S. 150–162, hier S. 156. 16 Linda Colley, Britons: Forging the Nation 1707–1837, 2. Aufl. London 1994. 17 Philipson 1997, S. 73. 18 Vgl. Kontler 2001, S. 64f.
48 Joachim Berger
19 So Karen O’Brien, in: Brown 1997, S. 82. Revisionistische Lesart: DuToit 2000. 20 DuToit 2000, S. I. 21 Sher 1997, S. 168. 22 Vgl. Schlenke 1953, S. 80; Philipson 1997, S. 61. 23 Vgl. Kontler 1997, S. 131f. Gegen die kulturhistorische Deutung (und von einem engeren Verständnis von ›Kulturgeschichte‹ ausgehend) Schlenke 1953, S. 41–88. 24 Schlenke 1953, S. 112 (dt. Zitate); Gilbert 1972, S. XX. 25 O’Brien 1997, S. 77f., 90. 26 Koyanagi 2003, S. 150, nach Stewart 1858: X, S. 168. 27 William Robertson, Ungedruckte Predigt (1788), Robertson-McDonald Papers, National Library of Scotland, MS 3979, fol. 11–21. Zit. n. Richard B. Sher, 1688 and 1788: William Robertson on Revolution in Britain and France, in: Paul Du-kes/John Dunkley (Hrsg.), Culture and Revolution, London-New York 1990, S. 98–109, Zitate S. 102, 108. 28 Sher 1997, S. 175f., 178, 180. 29 Ungen., Rezension zu William Robertson, The history of the reign of the emper-or Charles V, in: The annual register […] for the year 1769, London 1770, S. 254–272, Zitate S. 254, 256 (kursiv J. B.) [Eighteenth Century Collections Online <http://galenet.galegroup.com/servlet/ECCO>. Gale Document Number: CW 3326019140 (Zugriff am 14.06.2006)]. 30 [Gilbert Stuart,] Rezension zu William Robertson, The history of the reign of the emperor Charles V, in: The London magazine 38 (1769), S. 156–159, 209–213, Zitat S. 156. [ebenda, CW3308721386 (Zugriff am 14.06.2006)]. 31 Correspondance Littéraire, Bd. 19 (April 1771), S. 291f. Zit. n. John Renwick, in: Brown 1997, S. 152. 32 Sher in: Brown, S. 181. 33 Renwick in: Brown, S. 157. 34 Sher 1997, S. 182–184. 35 Kontler 1997; Kontler 2001, bes. S. 66f. 36 Tarabuzzi 1979, S. 493–501.