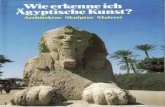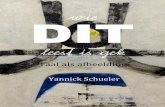Wie das Klima in die Politik kam
Transcript of Wie das Klima in die Politik kam
Abschlussarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts (M.A.)
im Studiengang Sozialwissenschaften
Wie das Klima in die Politik kamDie kommunikative Karriere des Klimawandels
als politisches Problem
The Rise of Climate PoliticsTracing the Transformation of Climate Change
into a Political Issue
Vorgelegt von: Daniela Ruß Erstgutachter: Prof. Dr. Klaus EderEmser Str. 15 Zweitgutachter: Prof. Dr. Friedbert Rüb12051 Berlin
Matrikelnr.: 519569 Berlin, den 27. November 2013
Eidesstattliche Erklärung
Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keineanderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, dass alle Stellender Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, alssolche kenntlich gemacht sind und dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form nochkeiner Prüfungsbehörde vorgelegt wurde.
Berlin, den 27. November 2013
Tabellenverzeichnis1 Kodierung der Aussagen zum Klimawandel nach Kausalmustern und Di-
mensionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512 Untersuchte Fälle 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 Untersuchte Fälle 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 Suchstrings nach Sprachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Abbildungsverzeichnis1 Karriere des Klimawandels als Thema politischer Kommunikation . . . . 452 Karriere der Umwelt als Thema politischer Kommunikation . . . . . . . . 463 Karriere des Klimawandels über Länder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 Dichteverteilung der Maßnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 Dichteverteilung der Akteure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566 Häufigkeit der Kausalmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Dichteverteilung der Kausalmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 3
1 Einleitung 6
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 102.1 Das Problem: Komplexität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.2 Die Entscheidung: Risiko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152.3 Die Anpassung: Verletzlichkeit und Resilienz . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3 Das politische System in einer komplexen Welt 203.1 Politische Planung und Wicked Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203.2 Komplexe Entscheidungssituationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 304.1 Klimapolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314.2 Parteien in Umwelt- und Klimapolitik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 385.1 Daten und Fallauswahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395.2 Wahlprogramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.3 Methode: Das Klima zählen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6 Wann das Klima in die Politik kam 45
7 Wie das Klima in die Politik kam 497.1 Sachlich: Ursachen und Folgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527.2 Sozial: Entscheider und Betroffene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557.3 Zeitlich: Eile und Weile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567.4 Kausalmuster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
8 Zusammenfassung 62
1 Einleitung 6
»Könnte man die Sprünge der Aufmerksamkeit messen, die Leistungen derAugenmuskeln, die Pendelbewegungen der Seele und alle die Anstrengungen, dieein Mensch vollbringen muss, um sich im Fluß einer Straße aufrecht zu halten, es
käme vermutlich – so hatte er gedacht und spielend das Unmögliche zuberechnen versucht – eine Größe heraus, mit der verglichen die Kraft, die Atlasbraucht, um die Welt zu stemmen, gering ist, und man könnte ermessen, welche
ungeheure Leistung heute schon ein Mensch vollbringt, der gar nichts tut.«(Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften)
1 EinleitungGlaubt man ihren Selbstbeschreibungen, so ist die moderne Gesellschaft gefährdeter,riskanter und verletzlicher als jemals zuvor. Vor einem Jahrhundert hat sie die Fähigkeitentwickelt, sich selbst durch Einsatz einer Bombe zu vernichten. Heute weiß sie, dass siesich auch viel weniger spektakulär, nahezu beiläufig zerstören könnte – allein durch denAusstoß bestimmter Gase. Der Klimawandel oder die globale Erwärmung ist eine derprominentesten Selbstbeschreibungen einer gefährdeten modernen Gesellschaft. Sie ist,wie die Atombombe, eine apokalyptische Erzählung: Die Menschen sind nicht unschuldigan ihrem Schicksal, sondern haben die Katastrophe selbst, wenn auch unwissend, ver-ursacht. Dass diese Geschichte global bekannt ist, bedeutet nicht, dass sie unumstrittenwäre. Vielmehr ist es Teil der Selbstbedrohung, dass man zankt, leugnet und sich nichteinig wird, worin das Problem und seine Lösung bestehen.Ob die Welt ›faktisch‹ bedrohter ist als zu einem beliebigen anderen historischen Zeit-
punkt, bleibt fraglich. Sicher ist jedoch, dass die Gesellschaft zunehmend dazu neigt, sichals verletzlich zu beschreiben: Probleme hat es selbstverständlich immer schon gegeben,die Probleme der modernen Gesellschaft sind jedoch irgendwie anders, irgendwie ver-zwickter. Es geschieht einfach mehr, so scheint es, gleichzeitig und schneller hintereinan-der. Ereignisse ziehen weitere Kreise und man erwartet, dass wer immer Entscheidungentrifft, dies auch berücksichtigt. Gefahren gab es zwar schon immer, doch nun hat manes mit Risiken zu tun. Man weiß, dass das eigene Handeln einen selbst gefährdet undkann die Probleme doch nur durch weiteres Handeln bearbeiten.In diesem Dilemma befindet sich vor allem die Politik, denn von ihr wird die Lösung
gesellschaftlicher Probleme erwartet. Nicht, dass die Politik jemals anders als unter Un-sicherheit entschieden hätte (wozu sonst entscheiden?). Nicht, dass man es jemals mitunkomplizierten Problemen zu tun gehabt hätte (wozu noch von Problemen sprechen?).Die Geschichte einer komplexer werdenden Welt mit komplexer werdenden Problemenist im besten Fall einseitig. Oder anders ausgedrückt: Es sagt etwas über die Gesell-
1 Einleitung 7
schaft selbst aus, wenn sie Schwierigkeiten hat, eindeutige Problembeschreibungen zuentwickeln (Luhmann 1971). Es handelt sich um keine Fähigkeit, die man durch höhereLeistungsfähigkeit entwickeln, kein Mangel, der sich durch intensivere Forschung aus-gleichen ließe. Ich gehe davon aus, dass die schiere Verzwicktheit von Problemen einefunktional nützliche Selbstbeschreibung einer Gesellschaft ist, die sich bewusst ist (odersich zumindest nicht mehr darüber täuschen kann), dass jede Problemformulierung kon-tingent ist.1
Doch der Eindruck einer überforderten Politik lässt sich nicht einfach so wegargu-mentieren. Er entsteht auch dadurch, dass wir heute mehr über die Folgen von Ent-scheidungen wissen und dass dieses Wissen um die Folgen (und das Nicht-Wissen umandere Folgen) in der Politik berücksichtigt wird. Komplexität hängt auch mit der An-zahl und Abhängigkeit der Gesichtspunkte zusammen, unter denen eine Entscheidungverhandelt und getroffen wird. Systemtheoretisch gesprochen stellt sich dann die Frage,wie viel Komplexität in der Politik selbst zugelassen wird oder werden kann, um zuEntscheidungen zu gelangen. Von einer neuen Komplexität kann also gesprochen wer-den; jedoch nur in einem Sinne, der das Verhältnis von System und Umwelt angemessenberücksichtigt. So richtig es auch ist, politikwissenschaftlich auf die schwierige Lage vonEntscheidern hinsichtlich einer komplexen Welt hinzuweisen – es fehlt dabei häufig derHinweis, dass es sich bei der komplexen Welt um nichts Natürliches handelt, sondern umeine Form, in der die moderne Gesellschaft heute sich selbst erscheint. Jede gewählteStrategie ist stets Komplexitätsreduktion und -steigerung zugleich.2
Der Klimawandel gilt gemeinhin als Paradebeispiel für diese ›neue‹ Komplexität unddie Herausforderung, vor die sie politisches Handeln stellt. Nirgendwo sonst bestehe »eineso komplexe Verwicklung sozialer, moralischer, ökonomischer und politischer Herausfor-derungen einerseits und solch gravierender epistemischer Unsicherheiten andererseits«(Leuschner 2012, 6). Die epistemischen Unsicherheiten bezogen sich zunächst auf dieanthropogene Verursachung des Klimawandels. Mit der kausalen Verbindung mensch-lichen Handelns und atmosphärischer Veränderung durch die Wissenschaft wurde derKlimawandel zu einem politischen Problem. Wie der Klimawandel in die öffentliche undpolitische Debatte kam ist hinsichtlich der wissenschaftlichen Voraussetzungen mittler-weile gut untersucht (Engels & Weingart 1997, Weingart et al. 2008). Lange Zeit wurde
1 »Wie einst die Zwecke haben jetzt sogar die Probleme ihre Natur verloren. Sie hängen von einer ›Pro-blemstellung‹ ab, und die Problemstellung kann man im Modus der Beobachtung zweiter Ordnungbeobachten (Frage: wer hat sie nötig, und warum?).« (Luhmann 1999, 18f)
2 Gemeint ist dies in dem Sinne, in dem Elena Esposito über die Folgen von Prognosen und Wahr-scheinlichkeitsrechnungen schreibt (Esposito 2007).
1 Einleitung 8
jedoch behauptet, die Sozialwissenschaften hätten den Klimawandel verschlafen undvernachlässigt (noch heute konstatiert das nahezu jeder Text, der darüber geschriebenwird). Was auch immer man davon halten mag: Heute ist der Klimawandel zu einemprominenten Forschungsgegenstand avanciert, der ganz oben auf jeder Liste der soge-nannten Jahrhundertherausforderungen. Er ist das Paradebeispiel einer grand challen-ge.3 Vor allem in den letzten zehn Jahren sind einige sozialwissenschaftliche Monografienund Sammelwerke prominenter Wissenschaftler entstanden, die sich ausschließlich demKlimawandel widmen (Giddens 2011, Urry 2011, Welzer et al. 2010). Die Literatur, diesich darüber hinaus bestimmten lokalen, theorie- und disziplinabhängigen Aspekten desKlimawandels widmet, ist kaum mehr zu überblicken. Mittlerweile wurden sogar Zei-schriften gegründet, die sich unter anderem der sozialwissenschaftlichen Untersuchungdes Klimawandels widmen (darunter das American Journal of Climate Change, ClimateScience and Policy und Weather, Climate & Society). In diesem vielstimmigen Gewirrgreift auch meine Arbeit nur einen Aspekt heraus, in dem die Kommunikation über denKlimawandel für Sozialwissenschaftlerinnen interessant wird.Im Unterschied zu Engels und Weingart bezeichnet »Wie das Klima in die Politik
kam« in meiner Arbeit nicht die Voraussetzung für politische Thematisierung, sonderndas, was dann, gleichsam an der Innengrenze des politischen Systems, geschieht. Ichmöchte im Folgenden darstellen, wann und wie sich das politische Problem des Klima-wandels im politischen System entwickelt hat. Es geht also um die semantische Vermes-sung der politischen Resonanz auf eine ökologische Gefährdung (Luhmann 2008, KapXIII). Zwischen den theoretischen Überlegungen zu Komplexität bzw. der Form, diediese häufig in der Politikwissenschaft gewinnen, der Überforderung der Politik, undder konkreten Forschung zu Klimawandelpolitiken findet bisher kaum Austausch statt.Diese Arbeit versucht den tiefen Graben zwischen Theorie und Empirie zu überwinden.Aus diesem Grund wird der Theorieteil für eine empirische Arbeit sehr umfangreich, füreine theoretische Arbeit die Empirie sehr detailliert sein.
3 Es ist nicht ganz klar, wo diese Vorliebe für Listen von großen Herausforderungen ihren Ursprunghat. Manche mutmaßen, es stamme aus der Mathematik, in der David Hilbert Anfang des 20. Jahr-hunderts eine Liste der größten ungelösten mathematischen Probleme präsentierte (Omenn 2006,1696). Auch in Flechtheims Futorologie (1972) findet sich eine solche Liste, die in einigen (aussage-kräftigen) Punkten von den heutigen abweicht (vgl. die Liste der societal challenges der EU unterhttp://ec.europa.eu/research/horizon2020/index/_en.cfm?pg=better-society). So nennt FlechtheimKrieg, Überbevölkerung, Folter, ökologische Probleme, und: die psychische Deformation des Men-schen aufgrund von Langeweile (Flechtheim 1972, 193ff).
1 Einleitung 9
Die gesamte Arbeit wird von zwei Fragen geleitet:
• Was bedeutet es, wenn wir von einem komplexen politischen Problem sprechen?
• Welche Form gewinnt der Klimawandel als politisches Problem und inwiefern han-delt es sich dabei um ein komplexes Problem?
Die Arbeit gliedert sich in acht Teile. Zunächst möchte ich einige der Ansätze, in denender Klimawandel sozialwissenschaftlich beobachtet wird, vergleichen, zueinander positio-nieren und systematisch an die Komplexitätstheorie rückbinden. Insbesondere soll einBeitrag zu theoretischen Klärung der grand challenges oder wicked problems geleistetwerden, die momentan in aller Munde sind. Aus diesen theoretischen Überlegungen wirdsich eine Beantwortung der ersten Frage und ein Verständnis von komplexen Entschei-dungssituationen ergeben, das empirische Forschung anleiten kann (siehe Kapitel 2 und3). Im Anschluss daran lässt sich die zweite Frage genauer formulieren (Kapitel 4 und5). In Kapitel 6 und Kapitel 7 wird dann die semantische Entwicklung des Klimawan-delproblems im politischen System, und genauer: in den Wahlprogrammen europäischerParteien, untersucht. Dabei möchte ich sowohl die Karriere (Kapitel 6) als auch dieinhaltliche Entwicklung (Kapitel 7) des Klimawandels im politischen System nachvoll-ziehen. Im abschließenden Teil der Arbeit möchte ich dann diskutieren, inwiefern man aufGrundlage meiner Ergebnisse davon sprechen kann, dass es sich beim Klimawandel umein komplexes politisches Problem handelt und welche theoretischen Schlussfolgerungensich ziehen lassen (Kapitel 8).
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 10
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko undVerletzlichkeit
Die Gesellschaft hat verschiedene Begriffe hervorgebracht, um über sich selbst in dieserunsicheren und unübersichtlichen Lage der Selbstbedrohung zu sprechen: Komplexität,Risiko und Verletzlichkeit sind nur einige von ihnen.4 Sie entstammen unterschiedlichenTheorierichtungen, werden nicht ganz einheitlich gebraucht, unterscheiden sich hinsicht-lich ihrer Reichweite und Anwendung, sie bezeichnen Folgen oder Eigenschaften, Bere-chenbares oder Wahrnehmbares. Ihnen allen ist jedoch gemeinsam, dass sie immer einevermeintlich neue und komplizierte Lage konstatieren, in der sich die Gesellschaft be-findet. Sie scheinen alle etwas Ähnliches auf eine andere Weise zu beschreiben. MeinesWissens existiert bisher kein Versuch, die Begriffe systematisch zueinander zu positio-nieren.Der gemeinsame Kern der aktuellen, gesellschaftlichen Problembeschreibungen liegt
meines Erachtens in der Komplexitätstheorie. Entscheidungs- und Risikotheorien (dar-unter die wicked problems) und Verletzlichkeit oder Resilienz bauen alle auf gewissenAnnahmen der Komplexitätstheorie auf. Ich werde im nächsten Kapitel zeigen, dass dieKomplexitätstheorie grundsätzlich zirkulär angelegt ist: Komplexität von System undUmwelt bedingen und steigern sich gegenseitig. Die genannten Ansätze durchbrechendiese Zirkularität und formulieren sie für zwei unterschiedliche Richtungen aus. Damitmachen sie die Komplexitätstheorie für die Sozialwissenschaften konkret (und kausal)nutzbar: Auf der einen Seite stehen die menschlichen Entscheidungen unter Komplexi-tätsbedingungen (Risiko-, Spiel- und Entscheidungstheorie), auf der anderen Seite diegesellschaftlichen Reaktionen auf die Folgen dieser Entscheidungen (Resilienz und Ver-letzlichkeit). Auf beiden Seiten wird die Komplexität zu einem gewissen Grad naturali-siert und kausal (statt zirkulär) ausformuliert. Wer sich damit beschäftigt, wie komple-xe Probleme bearbeitet werden können, der fragt nicht danach, weshalb dieses Problemüberhaupt komplex erscheint. Auch die Policy-Forschung, die zwar nicht entscheiden,
4 Nicht berücksichtigt werden die Flüchtigkeit Zygmunt Baumans (Bauman 2003) und die Beschleu-nigung Hartmut Rosas (Rosa 2008, Rosa 2012), obwohl sie meiner Ansicht nach auch zu dieser ArtSelbstbeschreibungen gehören. Bei ihnen handelt es sich um eine Ausarbeitung der zeitlichen Dimen-sion der Komplexität, die sicherlich auch für die Beschreibung der Dramatik des Klimawandels eineRolle spielt. Aus Platzgründen, und wohl auch, da sachlicher und sozialer Dimension in den meistenTexten über den Klimawandel und in den Wahlprogrammen selbst eine größere Bedeutung zukommt,habe ich mich gegen eine Darstellung der zeitlichen Dimension entschieden. Selbstverständlich istdie Zahl der Gesellschaftsbeschreibungen, die von einer neuen Komplexität sprechen, auch damitnoch nicht erschöpft. Zu nennen wären auch Nico Stehr (2000) und Bruno Latour (2010a, 2010b).
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 11
aber sehr wohl Entscheidungen beschreiben muss, erdet ihre Analysen angesichts (odergerade nicht) der zirkulären Entstehung von Komplexität in einer Klassifikation von Pro-blemen. Die Kausalrichtung geht hier vom System zur Umwelt: Entscheider wollen einenbestimmten Zustand ihrer Umwelt erreichen, sind sich jedoch bewusst, dass die Folgennur teilweise kontrollierbar sind. Im Gegensatz dazu blicken Vulnerabilitäts- und Resi-lienzforschung auf die Ursachen in einer komplexen Umwelt und die Folgen im System.Auch hier werden die Ursachen fixiert und als bestimmte Bedingungen angenommen, andie sich die Gesellschaften anpassen muss. Obwohl man sich hier, viel mehr noch als inder Entscheidungsforschung, bewusst ist, dass auch die Ursachen wiederum als Folgenmenschlichen (Anpassungs-)Handelns beschrieben werden können und damit kontingentsind.Selbstverständlich bleibt das Bild, das hier von den Entscheidungs- und Risikotheo-
rien und der Verletzlichkeitstheorie5 gezeichnet wird vereinfachend und unvollständig.Übrigens betrifft das in ähnlichem Maße auch die Komplexitätstheorie selbst, die alseinheitliche Theorie gar nicht existiert. Ich glaube jedoch, dass das wesentliche Unter-scheidungsmerkmal (die Verortung der Ursachen bzw. Folgen in System bzw. Umwelt)und die Erdung in der Komplexitätstheorie auch über die hier herausgestellten Beispieleals solches funktioniert.
2.1 Das Problem: Komplexität
Komplexität ist kein soziologischer, nicht einmal ein genuin moderner Begriff (Luhmann1975). Seine steilste Karriere erlebte er jedoch in der Moderne, ausgehend von den Na-turwissenschaften und Kreise ziehend in ganz verschiedenen Disziplinen.6 In den Natur-wissenschaften verlor die Komplexität ihr Gegenteil, das Einfache.7 Letztendlich konnten
5 Gerade bei den Theorien der Anpassung, die hier unter »Verletzlichkeitstheorie« zusammengefasstwerden, stellt sich die Frage der Bezeichnung umso mehr, als sie innerhalb der (deutschsprachigen)Wissenschaft nicht unter dem etwas linkischen Begriff der »Verletzlichkeitstheorie« behandelt wer-den. Meines Wissens existiert noch kein allgemein geteilter Begriff, der bezeichnen würde, was ichmeine – am nächsten kommt noch der Begriff der »Anpassungstheorien«.
6 Urry (2005) datiert den complexity turn auf die 90er Jahre. Das scheint mir reichlich spät, vor allemda die Blütezeit der Kybernetik zu dieser Zeit schon längst überschritten war. Urry identifiziert wohleher einen zweiten Höhepunkt, der als Folge der Netzwerktheorien auftritt.
7 Interessanterweise setzt sich diese Unterscheidung jedoch noch in den Naturwissenschaften fort, undzwar als Unterscheidung von linearen (einfachen) und nicht linearen (komplexen) Differentialglei-chungen. Studierenden der Naturwissenschaften widerfährt die Komplexität zunächst in der Formlösbarer und nicht lösbarer mathematischer Gleichungen. Komplexität ist hier nicht das Merkmalder Gleichungen selbst, sondern der dahinterstehenden Phänomene, also der Unterscheidung ein-deutig beschreibbarer und nicht eindeutig beschreibbarer Vorgänge. Dabei geht es nicht um einefaktisch perfekte Beschreibung, sondern um die theoretische Möglichkeit unter bestimmten Bedin-
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 12
selbst die kleinen Dinge, die lange Zeit für einfach gehalten wurden, ins Komplexe aufge-löst werden (Nicolis & Prigogine 1987, Prigogine 1997). Komplex oder einfach erschiennun als eine bloße Frage der Auflösung. In den Naturwissenschaften ist der Begriff ver-bunden mit der Untersuchung von Systemverhalten, der Kybernetik (Heinz von Foers-ter), der Erforschung und Beschreibung nichtlinearer System und dissipativer Struktu-ren (Prigogine). Biologische Systeme wurden schon lange als komplex betrachtet, alsevolvierende Systeme, die sich entwickeln (Nicolis & Prigogine 1987, Prigogine 1979).Entwicklung bedeutet, dass sie nicht neutral gegenüber Zeitumkehr sind, komplexeSysteme sind irreversibel und damit gewissermaßen ›historisch‹. Physikalische Phä-nomene, die sich so verhalten, etwa Diffusions- oder Reibungsvorgänge, wurden lan-ge Zeit als noch unerklärte Ausnahme vom Normalverhalten8 verstanden (Nicolis &Prigogine 1987, Prigogine 1979, Prigogine 1997). Während bestimmte physikalische Phä-nomene durch Kenntnis von Rand- und Anfangsbedingungen mathematisch vollständigbeschrieben und vorhergesagt werden können, bleibt bei komplexen Phänomenen immerein Rest an Unsicherheit. Es gibt mehrere mögliche Trajektorien eines Systems und wel-che eingeschlagen wird, hängt teilweise von winzigen Änderungen der Randbedingungen,von Zufall oder dem bekannten Schmetterlingsschlag ab.Komplexe Systeme sind offen, sie passen sich an Veränderungen ihrer Umwelt an und
tauschen Energie und Information mit ihr aus. Prigogine & Stengers (1990) nennen dastreffend »Dialog mit der Natur«. Unter bestimmten Umständen kommt es zu Rück-kopplungen und Resonanzen. Es existieren spezielle Punkte oder Werte, auf die sich dasSystem einpendelt (Attraktoren, Eigenwerte) oder bei denen sich das Systemverhaltenirreversibel ändert (Schwellenwerte, tipping points).Dies alles ist naturwissenschaftlicher Konsens und klingt sozialwissenschaftlich kaum
befremdlich. Nowotny (2005) und Urry (2003, 2005) nennen die Komplexitätstheorieeine der wenigen transdisziplinären Theorien der Wissenschaft. Die Begrifflichkeitensind hinreichend abstrakt, um auf vieles anwendbar zu sein. Es gibt eine Reihe sozi-alwissenschaftlicher Konzepte, die sich letztlich aus der naturwissenschaftlichen Theorieüber das Verhalten komplexer Systeme entwickelt haben. Wir kennen tipping pointsund Attraktoren (Mackenzie 2005), Pfadabhängigkeiten9 (Arthur 1994) und Resonanz
gungen genau eine Lösung zu erhalten. Der Rest ist Fehlerrechnung. Viele nicht lineare Gleichungensind jedoch per se unbestimmt, das heißt sie führen immer zu mehreren Lösungen.
8 Und das heißt: Eine Ausnahme die durch die klassische Newtonsche Mechanik nicht beschriebenwerden kann.
9 Was nichts anderes ist als die Trajektorie eines Systems, also die graphische Abbildung von System-verhalten und der Hinweis auf die ›Historizität‹: auf bestimmte Ereignisse, die einen Unterschied imSystemverhalten ausgelöst haben.
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 13
(Luhmann 2008). Schon Nicolis & Prigogine (1987, 316ff) spielen mit dem Gedanken,dass auch menschliche Gesellschaften als komplexe Systeme beschreibbar sind. Ihr Mo-dell ist sehr volkswirtschaftlich geprägt und beschreibt nicht gerade die soziologisch in-teressantesten Phänomene menschlicher Gesellschaften. Dennoch zeigt es eine einfacheArt wirtschaftlicher Selbstorganisation.Die soziologische Theorie, die sich am stärksten am Modell der allgemeinen Sys-
temtheorie orientiert und für die Sozialwissenschaften am genauesten ausgearbeitet wur-de ist Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme. Luhmann ist geprägt von früheren so-ziologischen (Parsons) und biologischen (Maturana/Varela) Systemtheorien, der Kyber-netik Heinz von Foersters und des Kalküls Spencer Browns. Komplexität ist ein zentralerBegriff der Theorie, der insbesondere in zwei Aspekten dem naturwissenschaftlichen Be-griff ähnelt: Zunächst in der Verbindung mit einer Systemtheorie. Die Unterscheidungenvon Element und Relation sowie von System und Umwelt fallen nicht zusammen, wer-den aber beide gebraucht (siehe Baraldi 1998, 93ff). Zweitens wird Komplexität in derFolge in beiden Fällen ausdrücklich mit Geschichtlichkeit und Irreversibiliät verbunden(Luhmann 1990, 66).Dennoch bestehen auch Unterschiede. Aus der Tatsache, dass die Komplexität ihr
Gegenteil verloren hat, entwickelt Luhmann Komplexität als Differenz von vollständi-ger und selektiver Verknüpfbarkeit der Elemente (Luhmann 1990). Komplexität ist dasVerhältnis von Struktur und Größe eines Systems.10 Also das Verhältnis von realisiertenBeziehungen zwischen Elementen (Selektivität) zur Menge der Elemente eines Systems.Mit Selektivität ist gemeint, dass Elementbeziehungen, die realisiert werden, auf be-stimmte Weise aus allen möglichen Kombinationen ausgewählt werden. Je schärfer dieSelektion, desto spezifischer und unwahrscheinlicher sind die Bedingungen der Realisie-rung. Komplexität kann durch Zunahme der Elemente oder der Selektivität gesteigertwerden. Wenn mehr möglich ist, nimmt die Kontingenz und Nichtbeliebigkeit der Struk-turwahl zu, so Luhmanns These (Luhmann 1975, 207, Luhmann 1990) . Steigende Kom-plexität führt zu Abhängigkeit von der eigenen Geschichte (Luhmann 1975, 207), Folgenund Nebenfolgen sowie Konsistenz und Koordination von Handeln wird zum Problem.Zwischen System und Umwelt besteht stets eine Asymmetrie in Form eines Kom-
plexitätsgefälles – zumindest aus Sicht des Systems (Luhmann 1975). Die Umwelt desSystems ist komplexer, umfasst mehr Elemente mit »schärferer Selektion dessen, was alsUmwelt-des-Systems strukturell relevant ist.« (Luhmann 1975, 210) Interne Relationen
10 Luhmann nennt dies »die Relation zwischen positiver Bestimmung der Größe und negativer Bestim-mung des Ausscheidungseffekts der Struktur.« (Luhmann 1975, 207)
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 14
werden an externen ausgerichtet, Systeme können ihre Umwelt, wenn auch nicht belie-big, selegieren und diejenigen Bedingungen herstellen, an die sie sich anpassen können(Luhmann 1975, 210). Je komplexer das System selbst wird, desto mehr Umweltkomple-xität kann zugelassen werden. »Die Umwelt komplexerer Systeme expandiert sozusagenin die Tiefe der Welt.« (Luhmann 1975, 211)11
Geht man von dieser Fassung des Komplexitätsbegriffes aus, verschieben sich die Pro-bleme. Es existiert kein optimales Komplexitätsverhältnis. Die Entwicklung der Gesell-schaft ist keine lineare hin zu mehr Komplexität. Komplexitätsunterschiede zwischenSystem und Umwelt sind kein lösbares und zu lösendes Problem, sondern das Bestands-problem eines Systems selbst: Ohne Komplexitätsgefälle würde es gar nicht existieren– das Aufrechterhalten des Komplexitätsunterschieds ist das System. Die Aussage, dieWelt werde komplexer, macht vor diesem Hintergrund nur noch Sinn, wenn sie in Aussa-gen über System- und Umweltkomplexität überführt wird. Komplexität setzt die Unter-scheidung von System und Umwelt voraus. Die Umwelt ist nur im Verhältnis zu einembestimmten System komplex. Wenn ein System mehr Elemente der Umwelt erkenntoder Informationen schärfer selegiert, ist die Umwelt komplexer. Bei dieser Tautologie(etwas ist komplex, wenn es als komplex beobachtet wird) muss man jedoch nicht stehenbleiben. Das Problem der Komplexität verschiebt sich von der Bearbeitung gegebenerKomplexität zu der Frage, wie viel Umweltkomplexität ein System zulässt und wie diesesich zur Systemkomplexität verhält. Damit ist nur eine Beschreibung und kein Ratschlagimpliziert, etwa, dass sich ein System einfach nur zur unterkomplexen Beobachtung dereigenen Umwelt entschließen müsste. Es gibt immer mehr oder weniger befriedigen-de Lösungen dieses Selektionsproblems: Welche Strukturen werden aus dem Raum allermöglichen Elementbeziehungen realisiert und mit welchen Folgen und Nebenfolgen? Wiewird Komplexität bestimmbar?Man muss eine Arbeit über die politische Kommunikation über den Klimawandel
nicht notwendig auf dieser Abstraktionsebene beginnen. Ich glaube dennoch, dass diesnützlich ist – und zwar aus drei Gründen: Erstens nutzen die sogenannten Theorien»mittlerer Reichweite« (Merton12), mit denen die Sozialwissenschaften den Klimawan-del zu beschreiben pflegen, häufig den Begriff der Komplexität, ohne ihn ausreichendzu definieren. Komplexität scheint ein Synonym für ›schwierig‹ zu sein, angereichertmit etwas Chaos und Rückkopplung. Zweitens führt die unklare Definition dazu, dass
11 Oder, mit einer ähnlichen schönen, wenn auch den Weltbegriff dehnenden Formulierung: Der »Einbaueiner bekannten in eine unbekannte Welt«(Luhmann 2002, 266).
12 Siehe zu der Frage, ob es sich dabei nicht eigentlich um ein Fehlinterpretation Mertons handelt, diesich verselbstständigt hat Karafillidis (2010, 350-353).
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 15
einige der Theorien letztendlich hinter die Aussagen der Komplexitätstheorie zurückfal-len. Drittens, und dies ist der wichtigste Grund, stellen die genannten Theorien meinerAnsicht nach eine Linearisierung und Kausalisierung der Komplexitätstheorie dar, eine(mögliche) Entfaltung des Zirkels für bestimmte Bereiche der Sozialwissenschaften. Die-sen letzten Punkt möchte ich zunächst an der Entscheidungs- und Risikotheorie zeigen.
2.2 Die Entscheidung: Risiko
Der Aufstieg des ›Risikos‹ zeigte sich nicht in der Ausrufung eines sogenannten risk turn -wie es bei vielen anderen soziologischen Moden geschah – sondern in der Feststellung, wirlebten in einer »Risikogesellschaft«. Seither ist wohl kein Soziologe in der deutschsprachi-gen Soziologie so eng mit dem Begriff verbunden wie Ulrich Beck (Beck 1986, Beck 2008).Beck hatte in Die Risikogesellschaft von 1986 vor allem technologische Risiken (wie dieAtomkraft) im Sinn, in der Weltrisikogesellschaft (2007) fügt sich dann auch der Kli-mawandel in das Bild einer sich ständig selbst gefährdenden Gesellschaft. Im Kern gehtes um nicht intendierte Folgen gesellschaftlicher Entscheidungen. Diese Folgen oder ihreAntezipierung (Beck selbst macht dazwischen keinen konsequenten Unterschied) nenntBeck Risiken, seien es ökologische (Naturkatastrophen) oder soziale (Arbeitslosigkeit).In der reflexiven Moderne gibt es mehr Risiken, die sich global und weniger schich-tenabhängig verteilen.13 Becks Risikogesellschaft war ein überwältigender Erfolg, auchaußerhalb der Sozialwissenschaften. Es enthält jedoch kaum analytisches Potential, ent-wickelt keine brauchbare (und vor allem systematische) Sprache, wie diese Gesellschaftzu beschreiben und beforschen sei. Selbst der Risikobegriff bleibt unklar und verliert inder Weltrisikogesellschaft dann jegliche Kontur. Beweis für die Risikogesellschaft kannalles sein, Terrorismus wie der Klimawandel. Es bleibt in erster Linie Selbstalarmierungder Gesellschaft (Luhmann 2008, 9, Luhmann 1991, 13).Tatsache ist jedoch, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der jeden Tag Risiko
kalkuliert wird. Doch welches Problem löst die Risikokalkulation eigentlich für die Kal-kulierenden? Letztendlich geht es darum, rationales Handeln in einer unsicheren undkomplexen Umwelt zu ermöglichen. Es geht »um Entscheidungen (...), mit denen manZeit bindet, obwohl man die Zukunft nicht hinreichend kennen kann; und zwar nichteinmal die Zukunft, die man durch die eigene Entscheidung erzeugt.«(Luhmann 1991,21 – Hervorhebung im Original) Risikoberechnungen garantieren zwar keine sicherenEntscheidungen, sie erweitern aber den Bereich, in dem kontrolliert rational gehandelt
13 Der letzte Punkt wurde in der Weltrisikogesellschaft abgeschwächt.
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 16
werden kann (Luhmann 1991, 22). Beim Risiko – als Beobachtung erster Ordnung –handelt es sich also gerade um eine Form der Beobachtung, die in der Auseinanderset-zung mit steigender Umweltkomplexität entwickelt wurde. Es ist eine Übersetzung desProblems, »wie trotz Ausnutzung von Rationalitätschancen Schaden möglichst vermie-den werden könne, in Kalkulationsdirektiven.« (Luhmann 1991, 27) Anders könnte mansagen: Risikokalkulation leistet den Aufbau bestimmbarer Umweltkomplexität.Worum geht es nun in einer Gesellschaft, in der ›Risiko‹ zu einem zentralen Begriff
geworden ist? Diese Gesellschaft beobachtet sich selbst in der Kategorie von ›Entschei-dern‹ und ›Betroffenen‹ (Luhmann 1991, 115). Es handelt sich hier um die Beobachtung(zweiter Ordnung), dass zunehmend Risiko kalkuliert wird und riskante Entscheidungengetroffen werden. Daraus ergibt sich eine Trennung der an einer Entscheidung Beteiligtenund der von einer Entscheidung Betroffenen. Je abhängiger die Gesellschaft von einmalgetroffenen Entscheidungen wird (und das wird sie umso mehr, je mehr Entscheidungengetroffen werden), desto bedeutender wird der Unterschied zwischen Entscheidern undBetroffenen. Für Entscheider sind die nicht intendierten Folgen ihrer Entscheidung einRisiko, für Betroffene sind sie eine Gefahr. Risiko und Gefahr unterscheiden sich alsohinsichtlich der Frage, worauf zugerechnet wird: auf eigene oder fremde Entscheidung.Die Unterscheidung von Entscheidern und Betroffenen kann sich, in Vergangenheit
und Zukunft projiziert, vielfach potenzieren.14 Dabei kann es gleichermaßen problema-tisch sein, wenn Entscheider auch gleichzeitig Betroffene (und damit parteiisch, nichtsachorientiert) sind, oder wenn die Gruppen auseinander fallen (was Probleme der Ent-scheidungsbindung aufwirft). Vor allem unter dem Schirm der Spieltheorie wurden zahl-reiche Arbeiten zu Entscheidungsdilemmata und Allgemeingütern veröffentlicht (Hardin1968, Ostrom 1990).Komplexität ist in der Risiko- und Entscheidungstheorie immer schon als Bedin-
gung gegeben. Entscheidungen sind riskant, weil die Folgen nicht kontrolliert werdenkönnen. Gewöhnlich fokussieren sich Risiko- und Entscheidungstheorien auf die Frage,welche Entscheidung in einer Situation gegebener Komplexität getroffen wird (genauerwird diese Seite noch in Kapitel 3.1 verhandelt). Entscheidungstheorien betrachten Sys-temursachen und Umweltfolgen. Die Rückwirkung der Entscheidungsprämissen selbst
14 Etwa, wenn historische Verursacherländer des Klimawandels und Entwicklungsländer unterschiedenwerden, wie im Kyoto-Protokoll geschehen. Oder, wenn heute lebende Generationen den zukünftigenGenerationen gegenübergestellt werden. Im einen Fall muss die Entscheidung, im anderen die Betrof-fenheit in der gegenwärtigen Vergangenheit bzw. Zukunft (Koselleck) konstruiert werden; in beidenFällen ist nur eine Seite der Unterscheidung empirisch zu beobachten. Gerade die Gegenüberstellungvon heutigen und zukünftigen Generationen spielt in der ökonomischen Verhandlung des Themas –beispielsweise in der Wahl einer bestimmten Diskontrate (vgl. Gronemann & Döring 2001).
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 17
auf die Komplexität der Entscheidungssituation werden nur selten einbezogen. Einegewisse Ausnahme ist die Gemeingüter- und Spieltheorie, die sich insofern davon un-terscheidet, als sich die Komplexität hier erst in einer Situation doppelter Kontingenzentwickelt. Komplexität wird als variabel, als im System selbst produziert begriffen undauf die soziale Dimension der Situation zugerechnet. Damit ist die Spiel- und Gemeingü-tertheorie eine der wenigen Entscheidungstheorien, die hyperkomplex (Baraldi 1998, 95)beobachtet und ihre eigenen Folgen in den Blick bekommt.15 Für die wicked problems,mit denen ich mich später (Abschnitt 3.1) noch genauer auseinandersetzen werde, giltjedoch, dass Komplexität sich zwar in sozialer und sachlicher Heterogenität zeigt, die-se Heterogenität aber nicht in der Situation selbst entsteht, sondern immer schon alsHintergrund gegeben ist.
2.3 Die Anpassung: Verletzlichkeit und Resilienz
Der Begriff der Verletzlichkeit (vulnerability) stammt ursprünglich aus den Geo- und Um-weltwissenschaften, das heißt aus der Erforschung des Verhaltens von Ökosystemen un-ter bestimmten externen Einflussfaktoren. Unter den sozialwissenschaftlichen Beschrei-bungen des Klimawandels ist er einer der jüngsten. Füssel (2007) datiert seine erstenSpuren in die frühen 1980er Jahre. Bohle & Glade (2008) weisen darauf hin, dass essich zwar um ein transdisziplinäres Konzepte handele, natur- und sozialwissenschaftli-che Ansätze sich aber bisweilen stark unterscheiden. Anders als Komplexität oder Risikoverweist Verletzlichkeit – zumindest in den sozialwissenschaftlichen Fassungen (Bohle &Glade 2008, 108) auf die Möglichkeit und Notwendigkeit gesellschaftlicher Anpassung.Die naturwissenschaftliche Verletzlichkeitsforschung konzentriert sich dagegen stärkerauf eine quantitative Vermessung des Risikos (hier nicht im Luhmannschen Sinne ver-standen) eines Schadenseintrittes. Innerhalb dieser Forschungsrichtung gibt es also eineArt Arbeitsteilung: Die Naturwissenschaften richten den Blick eher auf die Ursache inder außergesellschaftlichen Umwelt, die Sozialwissenschaften auf die Folgen im System.In den letzten 15 Jahren ist es jedoch auch verstärkt zu Weiterentwicklungen gekommen,die eine Kombination leisten wollen.Verletzlichkeit und Resilienz können als zwei Pole eines Kontinuums verstanden wer-
den. Denn bei Verletzlichkeit handelt es sich immer schon um eine graduelle Variable:»Vulnerability is the degree to which a system, subsystem, or system component is likely
15 Mittlerweile existieren auch spieltheoretische Studien über die Performativität der Spieltheorie, d.h.über die Tatsache, dass Personen, die sich in ihrer Ausbildung mit Spieltheorie beschäftigen, inexperimentellen Situationen dann auch entsprechend der Spieltheorie verhalten.
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 18
to experience harm due to exposure to a hazard, either a perturbation or stress/stressor.«(Turner et al. 2003, 8074) Wenn es bei der Verletzlichkeitsforschung darum geht, die Be-dingungen zu untersuchen, unter denen Menschen und Gesellschaften besonders anfälligsind, dann geht es bei der Resilienzforschung darum, die Bedingungen aufzuzeigen, dieMenschen, Gesellschaften oder Organisationen (für letztere, siehe Weick & Sutcliffe 2001)besonders widerstandsfähig machen. Resilienz bedeutet die Fähigkeit, Gefahren zu trot-zen. Resilienzforschung fokussiert noch stärker auf das System als Verletzlichkeitsfor-schung (Bohle & Glade 2008, 99). Dieses komplementäre Verhältnis von Resilienz undVerletzlichkeit bedeutet auch, dass sie jeweils gegenseitig Bestandteil ihrer Messung seinkönnen (Bohle & Glade 2008, 110). Verletzlichkeit ist da, wo wenig Widerstandsfähigkeitist – und umgekehrt.Wisner et al. (2004) haben mit At Risk eine erste große Monographie über Verletzlich-
keit veröffentlicht. Schon der Titel zeigt an, dass sie Verletzlichkeit mit Risiko verbinden.Der Risikobegriff wird hier ungefähr im Sinne von Luhmanns Gefahrenbegriff verwen-det. Verletzlich ist, wer dem Risiko ausgesetzt ist, wer betroffen ist, ohne entscheidenzu können. Das Konzept setzt also auf der Seite der Betroffenen an und beobachtet dieBedingungen, unter denen sie betroffen werden. Verletzlichkeit ist eine Eigenschaft vonMenschen, einer bestimmten Bevölkerungsgruppen, ganzen Staaten oder Gesellschaften.
»What we are arguing is that risk of disaster is a compound function ofthe natural hazard and the number of people, characterised by their varyingdegrees of vulnerability to that specific hazard, who occupy the space andtime of exposure to the hazard event. There are three elements here: risk(disaster), vulnerability, and hazard, whose relations we find it convenient toschematise in a pseudo-equation: R=HxV.«(Wisner et al. 2004, 45)
Das Risiko ist also ein Produkt der Katastrophe und der spezifischen Verletzlichkeitgegenüber dieser. Wisner et al. (2004) sprechen zwar von Risiko, implizieren aber keineEntscheidung (höchstens die Entscheidung, Anpassungsarbeit zu leisten) die man so oderanders treffen könnte, um dieses Risiko zu verändern. Die soziale Dimension (also dieFrage, ob es sich um Betroffene handelt, die unter ihren eigenen Entscheidungen leiden)wird im Grunde offen gelassen.Die Berechnung von Risiko hat eine jahrhundertelange Tradition in Versicherungen,
die Verletzlichkeitsindizes wie der GAIN-Index16 oder der Klima-Risiko-Index17 sind da-
16 http://index.gain.org/ – berechnet im Übrigen ziemlich genau nach Wisners (Pseudo-)Gleichung.17 www.germanwatch.com.
2 Der Wald vor lauter Bäumen: Komplexität, Risiko und Verletzlichkeit 19
gegen erst in den letzten zwanzig Jahren entstanden. Mit der Nähe zur Risikoforschungging die Quantifizierung der Verletzlichkeit einher, ein Aspekt, der sicher nicht unbe-deutend für die transdisziplinäre Anschlussfähigkeit und Karriere des Konzepts war.18
Verletzlichkeitsforschungen werden heute in den Umweltwissenschaften, der Humangeo-grafie, den Sozialwissenschaften oder der Volkswirtschaft durchgeführt. Neben dieserAnschlussfähigkeit in quantitativen Forschungbereichen wirft diese ForschungsrichtungGerechtigkeitsfragen auf. Besonders augenfällig ist dies in den Weltkarten, auf denenVerursacher und Leidtragende des Klimawandels unterschiedlich eingefärbt sind – undkaum Überlappung zu sehen ist.Der Schwerpunkt liegt bei Resilienz- und Verletzlichkeitsforschung auf Umweltursachen
und Systemfolgen. An Komplexität schließt dieses Konzept insofern an, als die Ansätzedavon ausgehen, dass Systeme keine 1:1-Zustände für alle möglichen Umweltbedingungenentwickeln können. Der Zustand der Umwelt ist fast grenzenlos wandelbar und ungewiss.Es liegt an dem jeweiligen System, Strukturen zu entwickeln, die ausreichend flexibelund generalisiert sind. Es handelt sich also auch hier um eine Durchbrechung des Zirkelsdurch Formulierung einer Theorie, die eine Seite der Komplexität ausformuliert – undzwar diejenige, in der die komplexe Welt auf das System zurückschlägt und als Gefahrerlebt wird. Während die Risiko- und Entscheidungstheorie sich mit der Gestaltbarkeiteiner zunehmend gestaltlos wirkenden Umwelt herumschlagen, untersuchen Risiko- undVerletzlichkeitsforschung, wie die Gesellschaft letztlich mit einer Umwelt klar kommenkann, die mit geschlossenen Augen gestaltet wird.Interessant ist, dass sich die Unterscheidung von Risiko und Gefahr hier auch auf einer
Theorieebene wiederholt. Die Entscheidungstheorie beschreibt ihren Gegenstand und ihrProblem als Risiko, die Verletzlichkeitsforschung als Gefahr.
18 Vgl. für die integrative Wirkung der Mathematisierung Stichweh (1979, 93f).
3 Das politische System in einer komplexen Welt 20
3 Das politische System in einer komplexen WeltDie Leitfrage des theoretischen Teils meines Arbeit lautete: Was bedeutet es, wenn wirvon einem komplexen politischen Problem sprechen? Die Frage ist vor allem im Hinblickauf eine bestimmte Form gestellt, die das ›komplexe politische Problem‹ seit den 1970erJahren gewann, die des wicked problems oder der grand challenge.19 Das wicked problemund seine Vorläufer spezifizieren nicht zufällig dieselbe Seite der Komplexitätstheorie wiedie Entscheidungstheorie. Der Begriff ist immer schon auf Entscheidende und Planendehin entworfen und beschreibt, wie diese bestimmte Probleme erleben: als wicked.
3.1 Politische Planung und Wicked Problems
Die ersten Vorläufer des Begriffes wie ill defined (Reitman 1964) oder ill structured pro-blems (Simon 1973) entwickelten sich in der Informatik und der Forschung zu KünstlicherIntelligenz. Man stellte sich die Frage, welche Arten von Problemen durch Computerlösbar sind. Dass im Jahr 2009 ein neuer Überblicksartikel über dieses Feld entstand(Aleven et al. 2006), spricht für eine erneute Beschäftigung mit ähnlichen Fragen. DerBegriff wicked problem stammt ursprünglich von (suchen!) und wurde einige Jahre spä-ter von Rittel/Webber (1973) genauer ausgearbeitet. Der Vorschlag Rittels und Webbersunterscheidet sich jedoch deutlich von denen der Informatiker. Wicked problems werdennicht länger als Pol eines Kontinuums begriffen (zumindest nicht explizit), sondern zumqualitativen Unterschied zwischen Disziplinen stilisiert.20 Trotz diverser theoretischerMängel gelang es ihnen, einen schicken Begriff zu prägen, der offenbar einen Nerv traf.Das wicked problem fand – mehr als Metapher, denn als einheitliches Konzept oderTheorie – seinen Weg in die Policy-Literatur. Rittel und Webber schrieben ihrerzeit ge-gen einen vermeintlichen Konsens in den Planungswissenschaften an21, der besagte, dass
19 Zweifellos besteht in Anwendung und Geschichte dieser zwei Begriffe eine starke Ähnlichkeit. Beidegehen auf Diskurse der Informatik und Künstlichen Intelligenz zurück. Grand challenges fokussierenjedoch stärker das Verhältnis von Wissenschaft und Politik, während wicked problems ganz allgemeindie Schwierigkeit bezeichnen, soziale Probleme zu definieren und zu lösen. Ein Unterschied zwischenden beiden begriffen besteht darin, dass grand challenges gerade davon ausgehen, dass das Problemals solches nicht mehr umstritten sondern allgemein akzeptiert ist. Allein die Bearbeitung ist nochumstritten und kompliziert genug. Die Definition eines wicked problems ist aber ja gerade, dassdie Problemdefinition als solche umstritten ist (Roberts 2000). Unabhängig von diesem Unterschiedwäre eine vergleichende Untersuchung der Entwicklung und Wirkung dieser zwei Begriffe jedoch sehrinteressant.
20 Wohingegen Simon erkennt, dass bereits ein Schachspiel, als ganzes Spiel betrachtet, als ill structuredbegriffen werden muss, da es sich um eine Entscheidungskette und eine ständige Neudefinition desProblems handelt (Simon 1973, 185f).
21 Etwa im Sinne der Technocracy Inc., die Mitte der 1930er Jahre von Howard Scott gegründet wurde.
3 Das politische System in einer komplexen Welt 21
jedes Problem durch bessere Planung, durch detaillierteres Wissen und zuverlässigereTechnik gelöst werden könne.22
Der Text bleibt in mehr als einer Hinsicht unklar und sogar widersprüchlich. Die Ei-genschaften, die sogenannte wicked problems aufweisen und die sie von tame problemsunterscheiden, stehen unsystematisch nebeneinander und lassen sich quasi beliebig er-weitern oder kondensieren (vgl. Hartmann 2012). Man kann sich fragen, ob hier nichteinfach Problematisches von Unproblematischem unterschieden wird – dann wäre jedesProblem ein wicked problem. Rittel und Webber versuchen sich aber lieber an der Unter-scheidung von unproblematischen und problematischen Problemen. Das Konzept weisteinige theoretische Unschärfen auf. Einerseits behaupten Rittel und Webber, dass es eineZeit der tame problems gegeben habe (Rittel & Webber 1973, 156), andererseits, dassPlanungsprobleme immer wicked seien (Rittel & Webber 1973, 160); dieselben Infra-strukturprojekte sind einmal einfach (Rittel & Webber 1973, 156), einmal wicked (Rittel& Webber 1973, 163). Sie sprechen sowohl von einer anderen »Natur« der Probleme(Rittel & Webber 1973, 155), als auch davon, »that they appeared to be definable, un-derstandable, consensual.« (Rittel & Webber 1973, 156) Rittel und Webber rechnen dasProblematische der wicked problems zuweilen auf das Problem selbst (die Umwelt), zu-weilen auf den Beobachter (das System) zu. Sie vermuten zwar einen gesellschaftsstruk-turellen Ursprung (Konsensprobleme durch Zunahme gesellschaftlicher Heterogenität)(Rittel & Webber 1973, 167f), halten diesen aber in ihrem eigenen Text nicht durch.Die Unstimmigkeiten in Rittel und Webbers Text sind meiner Meinung nach eben-
falls mit dem Zirkel der Komplexitätstheorie verbunden, der in den widersprüchlichenBeschreibungen durchscheint, jedoch nie vollständig ausformuliert wird. Auch die zahl-reichen Weiterentwicklungen jüngeren Datums ziehen die zirkuläre Produktion von Kom-plexität nicht in Erwägung (darunter beispielsweise Hartmann 2012, Levin et al. 2010,Levin et al. 2012, Roberts 2000, Verweij 2006).23 Die Fragen bleiben ontologisch: was ist
22 Interessanterweise – insbesondere da Rittel und Webber sich ja gerade von den Naturwissenschaftenabzugrenzen versuchen – erfolgt die Beschreibung des Bruchs mit der Tradition ganz ähnlich wiein Prigogines Argumentation für den Begriff der Komplexität in den Naturwissenschaften: die Weltzeigt sich uns eben nicht wohldefiniert und linear beschreibbar, sondern komplex.
23 Der Begriff des wicked problems entstand noch bevor der Klimawandel in den Sozialwissenschaftenpopulär wurde. In den letzten Jahren wurde das wicked problem jedoch neu entdeckt und weiter-entwickelt, unter anderem als super wicked problem. Ein Begriff, der für den Klimawandel reserviertbleiben sollte (wozu man dann überhaupt einen Begriff bildet, bleibt unklar). Das super wickedproblem soll bedeuten, dass es sich hier um ein noch etwas verzwickteres Problem handelt, da dieZeit drängt, keine zentrale Autorität für die Lösung zuständig ist, Problemlöser und -verursachersich überlagern und alle Beteiligten Vorteile davon haben, potentielle Schäden in die Zukunft zuverlagern (Levin et al. 2010).
3 Das politische System in einer komplexen Welt 22
ein wicked problem und wie lassen sie sich bearbeiten?24
Aber damit kommt man an dieser Stelle nicht weiter. Ich glaube, dass die Beobach-tertheorie – die Form, die Luhmanns Theorie gegen Ende seines Schaffens angenommenhat – dabei helfen kann, das Konzept zu entwirren. Zwei Fragen stehen dabei im Vor-dergrund: Was sieht ein Beobachter, der ein wicked problem konstatiert? Und: Was siehtein Beobachter, der beobachtet, wie ein wicked problem konstatiert wird? Dies wird unsvon der Frage, was ein wicked problem nun wirklich sei, zu der Frage führen, wozu manes so beschreiben sollte.Wer ein wicked problem konstatiert sieht wohl in erster Linie: Kontingenz. Die Pro-
blembeschreibung ist nicht notwendig, sie könnte auch anders sein. Andere Beobachterbeschreiben das Problem anders (es handelt sich also immer schon um eine Beobachtungzweiter Ordnung oder um Selbstreflexion). Das Problem (und das heißt: Problemdefini-tion und Problemlösung) ist sozial, sachlich und zeitlich kontingent.Nun handelt es sich bei einem Großteil der Texte über wicked problems um Texte aus
der Policy-Forschung; Texte, die von sich selbst immer auch erwarten, Handlungsemp-
24 Die Frage nach dem Unterschied von naturwissenschaftlichen und sozialwissenschaftlichen Problemenist zwar ein Nebenschauplatz, jedoch nicht unabhängig von der Frage nach der ›Natur‹ der Proble-me. Es mag sich nur um ein Strohmannargument handeln, um die wickedness der Planungsproblemeumso deutlicher hervortreten zu lassen. Dennoch: Was Rittel und Webber als naturwissenschaftlichesProblemlösen darstellen (das Lösen von Gleichungen), ist wohl kaum eine adäquate Beschreibungnaturwissenschaftlicher Praxis. Stellen wir uns vor, ein physikalisches Experiment produziert uner-klärliche Ergebnisse (Teilchen, die schneller als mit Lichtgeschwindigkeit fliegen). Welche sachlicheErklärung gibt es dafür? Die Strategien der PhysikerInnen werden sein, zunächst alle bekanntenengen Kopplungszusammenhänge zu überprüfen (Fehler im Aufbau, Messfehler, Instrumentenfehleretc. – d.h. bekannte Kausalitäten prüfen). Danach würden einige beginnen, über kuriosere Fehler-quellen zu spekulieren (schon das Vorbeifahren an einem Berg (d.h. einer großen Masse) kann die feintarierten Instrumente im Vorhinein ›verstimmen‹) oder einfach ihrer Intuition zu folgen (Weizsäckerschildert die lakonische Reaktion Heisenbergs auf die scheinbare Widerlegung des Energieerhaltungs-satzes durch einen renommierten Physiker: »Der hat falsch gemessen.« (Weizsäcker 1981)). Schondiese Spekulationen sind aber nicht mehr sachlich zu überprüfen – es ist nicht klar, was das Problemist (handelt es sich um einen Messfehler oder um eine Widerlegung bekannter Gesetze?) und wieman es lösen könnte (man könnte es unter denselben Bedingungen noch einmal durchführen, aberda bräuchte man schon eine Ahnung davon, welche Bedingungen bedeutsam sind). Vermutlich wirdsich nach einiger Zeit eine mehr oder weniger geteilte Sichtweise herausbilden (das CERN widerruftdie Überschreitung der Lichtgeschwindigkeit, der renommierte Physiker gesteht die Einhaltung desEnergieerhaltungssatzes ein), aber das ändert nichts daran, dass das Problem für einen Momentwicked zu sein schien (auch wenn manche Beobachter, wie Heisenberg, sich weigerten, dies so zusehen). Selbst, wenn Rittel und Webber eine richtige Tendenz formulierten, wäre es unklug, dar-aus einen wesenhaften Unterschied zu konstruieren. Vielmehr wäre es zum Beispiel denkbar, dasssich während einer Periode der Normalwissenschaft (Kuhn) tatsächlich nur tame problems stellen.Genausogut kann man aber eben annehmen, dass es auch Phasen gibt, in denen sich auch relativunstrittige, soziale Probleme stellen lassen – verkleinert man nur den zeitlichen und sozialen Rah-men. Beide Fälle werden aber eben nur dann sichtbar, wenn sie sich vergleichen lassen – also in einergemeinsamen Beschreibungssprache formuliert werden.
3 Das politische System in einer komplexen Welt 23
fehlungen geben zu können. Stets schwingen mehr oder weniger deutlich die Vorteile mit,die Planende von einer neuen Problembeschreibung erwarten können. Ein Planer, derwicked problems beschreibt, sieht zwar vor allem seine eigene, kontingente Position, aberdurch eben diese Selbstirritation könne er letztendlich bessere Entscheidungen treffen.Es geht also um Effizienzgewinn durch Anwendung eines neuen Problemschemas, dasnicht mehr auf Effizienz baut, aber gerade darum so wirksam sein soll. Eine ähnlicheArgumentation findet man bei den Texten, die wicked problems und Cultural Theoryverbinden (vgl. Hartmann 2012, Verweij 2006): Am Ende steht immer eine Empfehlung,wie die soziale Komplexität der Situation reduziert werden könnte. Aus dieser Richtunggingen dann auch zahlreiche Lehrbücher hervor, die Entscheidern den richtigen Umgangmit wicked problems ermöglichen sollen. Auch Levin et al. (2010) versuchen, ausgerech-net aus der Komplexitätstheorie politisches Entscheidungswissen zu gewinnen. Das istmindestens theoretisch paradox, aber durchaus ernst gemeint.25
In der Beobachtung zweiter Ordnung sieht man genau dieses Dilemma, in dem sichBeobachter von wicked problems befinden, insbesondere, wenn sie entscheiden müssen.Die Beschreibung als wicked problem ist nicht notwendig – es könnte auch tame sein. Jegenauer die wickedness – und das bedeutet das sozial, sachlich und zeitlich Umstrittene– ausgelotet wird, desto schwieriger (und nicht einfacher!) wird eine Problembearbei-tung. Oder in anderen Worten: Je stärker die Selbstreflexion bereits in den Prozess derProblemdefinition eingebaut wird, desto verzwickter stellt sich die Welt dar. Die Beob-achtung von wicked problems selbst scheint zu komplexeren Problemen zu führen – dieseProbleme wiederum sollen durch die Beobachtung von wicked problems durch PlanerIn-nen besser bearbeitet werden können. Es ist nicht unplausibel, dass die Wirklichkeit sofunktioniert. Angesichts dieser Paradoxie sollte man aber weder in den Versuch einererneuten Naturalisierung, noch in Lethargie verfallen.Man kann nicht behaupten, dass die Definition eines wicked problems durch die Wei-
terentwicklungen an theoretischer Schärfe gewonnen hätte. Das wicked problem mag alsMetapher nützlich sein, als Theorie und Anleitung zur Forschung bleibt es fragwürdig.Es ist auffällig, dass das wicked problem gut als Auslöser von Kommunikation funktio-niert. Neben der spezifischen Mängel dieses Konzepts, die in diesem Kapitel herausgear-beitet wurden, hat meiner Ansicht nach jede Begrifflichkeit, die auf Probleme abstellt,bestimmte Schwächen zu tragen – insbesondere, wenn sie Aussagen über Komplexität
25 Zur Wirkung und Selbstsabotage von »gegenwärtigen Zukünften«, siehe Esposito (2007) kleinesBuch »Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität«.
3 Das politische System in einer komplexen Welt 24
machen will.26 Gerade, wenn Kontingenzen, zeitliche Entwicklungen und Rückkopplun-gen gemeint sind, stellt sich die Frage, warum man gerade diesen Problembegriff wei-terführen sollte. Die theoretischen Unschärfen der wicked problems zeigen zu genüge,das es schwerfällt, die Komplexität in einen solchen Problembegriff hineinzudenken unddurchzuhalten. Man könnte auch sagen: er verleitet zum schlampigen Denken.Erstens fixiert der Begriff des Problems einen Gegenstand, ohne einen Hinweis auf
seine zirkuläre Entstehung mitzutragen. Im Hinblick auf den zirkulären Charakter derKomplexitätstheorie sollte diese einfache Art der Vergegenständlichung vermieden wer-den. Beispiele für sozialwissenschaftliche Begriffe, die zirkulär angelegt sind, sind Latoursimmutable mobiles, aber auch die Koproduktion oder, in Ansätzen, Bourdieus Habitus.Anders ausgedrückt: Der Problembegriff legt es nahe, von einem konstanten Problemauszugehen (so sehr man das Dynamische auch betont).Dies wäre – zweitens – unproblematisch, sofern die Systemreferenz geklärt wäre. Dass
man von einem Problem sprechen kann, ohne den Problemsteller zu erwähnen, machtviele Texte über den Klimawandel so unbefriedigend. Klimawandel erscheint als gesell-schaftliches, politisches, wissenschaftliches oder wirtschaftliches Problem, als Problemfür den IPCC, die amerikanische Regierung oder Inselstaaten. Aber was uns genau dazuberechtigt, in all diesen Situationen von demselben Problem auszugehen, bleibt unklar.Es würde helfen, das Problem in eine Unterscheidung aufzulösen und die Unterscheidungals Beobachtungsinstrument zu verstehen:
»Wie einst die Zwecke haben jetzt sogar die Probleme ihre Natur verloren. Siehängen von einer ›Problemstellung‹ ab, und die Problemstellung kann manim Modus der Beobachtung zweiter Ordnung beobachten (Frage: wer hatsie nötig, und warum?). Damit wird die Unterscheidung von Problem undProblemlösung zu einem spezifischen Beobachtungsinstrument.«(Luhmann1999, 18f)
Drittens bleibt nach wie vor ungeklärt, ob sich das Problem auf eine semantische Ebene(eine Problemformulierung) oder die strukturelle Ebene bezieht. Man müsste das nichtein für alle Mal festlegen, es genügte, wenn man zumindest im einzelnen Fall wüsste,worüber man spricht. Das politische Problem des Klimawandels ist nicht das Problemdes Klimawandels und – annähernd eine Sabotage meiner eigenen Arbeit – auch die (par-tei)politische Kommunikation über den Klimawandel ist nicht das Entscheidungsproblem
26 Siehe auch: »Richtigkeitsurteile beziehen sich auf die Entscheidung, Komplexitätsurteile auf dieEntscheidungssituation. Das Untersuchungsfeld bleibt dasselbe; aber es ändert sich das Substrat desLeitbegriffs, von dem aus man Fragen stellt und die Theorie entwickelt.« (Luhmann 2009, 6)
3 Das politische System in einer komplexen Welt 25
des Klimawandels. Begriffe man Probleme als Problemformulierungen bestimmter Be-obachter, die sich zeitlich und systemreferentiell verorten lassen, hätte man bereits vielgewonnen.27
Wie kann man aber dann die Situationen beschreiben, die wir meinen, Situationen,in denen es Entscheidenden schwer fällt, Entscheidungen zu treffen? Anstatt den Pro-blembegriff mit Dynamik anzureichern, wie auch immer das im einzelnen aussehen mag,möchte ich etwas anderes vorschlagen. Weniger schick aber ungleich systematischer könn-te man anstatt vom Problem von der Situation ausgehen und von Entscheidungen un-ter Komplexitätsbedingungen sprechen. Ich möchte im Folgenden, ausgehend von einerTheorieskizze Luhmanns, eine adäquatere Vorstellung eben dieser komplexen Entschei-dungssituationen entwickeln.
3.2 Komplexe Entscheidungssituationen
Erst im Jahr 2009 erschien in der Zeitschrift Soziale Systeme ein Text aus LuhmannsNachlass mit dem Titel »Zur Komplexität von Entscheidungssituationen«. Das Manu-skript stammt aus dem Jahr 1973, interessanterweise aus dem selben Jahr wie Rittelund Webbers Aufsatz über wicked problems. Der Text hat nur wenig Resonanz ausgelöstund die Diskussion in Soziale Systeme legt nahe, dass er als veraltet und unvollständigbetrachtet wird – weit entfernt von der elaborierten Entscheidungstheorie, wie sie Luh-mann in Organisation und Entscheidung vorgelegt hat. Für meine Arbeit ist es nichtwichtig, ob die Verschiebung von Entscheidung hin zur Entscheidungssituation und dieKonzentration auf komplexe Situationen einer generellen Theorie von Entscheidungenangemessen ist (dies ist der Hauptvorwurf von Ortmann 2009). Erstens leistet der Texteine direkte Anknüpfung an wicked problems und zweitens ist er für einen Text Luh-manns ungewöhnlich empiriebewusst. Mit einem Auge ist er immer schon daraufhinentworfen, wie sich die vorgeschlagenen Begriffe für empirische Forschung operationali-sieren ließen. Bei dem Text handelt es sich tatsächlich eher um eine Skizze, als um eineausgearbeitete Theorie von Entscheidungen unter Komplexitätsbedingungen. Schimank(2005) hat eine solche dann versucht, der Inhalt legt jedoch nicht unbedingt nahe, dass erLuhmanns Manuskript damals schon kannte. Doch bereits diese Skizze enthält viel Auf-schlussreiches. Die Grundidee ist, Komplexität über wirkliche und mögliche Struktureiner Entscheidungssituation zu entwickeln. Was im vorherigen Kapitel dem Problem
27 Nicht zuletzt könnte man dann auch fragen: Wer formuliert eigentlich Jahrhundertprobleme – undwarum?
3 Das politische System in einer komplexen Welt 26
zugerechnet wurde, erscheint jetzt als Aufbau bestimmter Umweltkomplexität in einerEntscheidungssituation.Da es sich um einen frühen Text Luhmanns handelt, wird die Entscheidung noch
über den Handlungsbegriff hergeleitet: Handlung ist Zurechnung einer Selektion aufdas System, in der Entscheidung wird das Merkmal der Kontingenz, das jede Selektionbegleitet, verstärkt. »Von Entscheiden kann man immer dann sinnvoll sprechen, wenndie Kontingenz des Handelns in der Form einer Relation in den Sinn des Handelnseingeht (...). Entscheiden ist demnach Relationierung des Handelns.« (Luhmann 2009, 4)Handeln wird dann zum Entscheiden, wenn Verhältnissetzungen in seinen Sinn eingehen,etwa das Verhältnis eines Problems zu seiner Lösung oder die Vorzüge einer Alternativeüber andere.Luhmann stellt sich die Frage, wie Komplexität sich empirisch beobachten lässt. Es
handelt sich dabei immer um ein mehrdimensionales Konzept auf mehreren Ebenen, soseine Antwort, das sich letztendlich nicht auf ein Kontinuum bringen und damit auchnicht einfach vergleichen lässt. Einfache ›je, desto‹ Aussagen sind also kaum möglich.Luhmann unterscheidet Dimensionen und Ebenen28 der Komplexität. Bei den Dimen-sionen handelt es sich zunächst um die bekannten drei Sinndimension: zeitlich, sachlich,sozial. Er arbeitet die Operationalisierung nur für die Sachdimension aus29 und unter-scheidet Anzahl, Verschiedenartigkeit und Interdependenz der Alternativen. Eine Ent-scheidungssituation wird umso komplexer, je mehr Alternativen zur Verfügung stehen,je stärker diese sich voneinander unterscheiden und voneinander abhängen (beispielswei-se in dem Sinne, dass mit der Wahl einer Alternative die spätere Wahl einer anderen
28 Ein Hinweis zu den Ebenen, obwohl sie in meiner Untersuchung kaum berücksichtigt werden: »Dassdiese Mehrdimensionalität zugleich auf mehreren Ebenen zu berücksichtigen ist, wird noch kaumgesehen. (...) Im Unterschied zu Dimensionen der Komplexität wollen wir von mehreren Ebenenimmer dann sprechen, wenn Sinnfestlegungen generalisiert werden (...). Im Kern ist GeneralisierungPossibilisierung – das heißt Übergang vom Wirklichen zum bloß Möglichen. Je nachdem, von welchenBedingungen der Möglichkeit man Generalisierung abhängig macht, je nach dem also, ob man logischMögliches, technisch Mögliches, politisch Mögliches usw. meint, ergeben sich auf der Ebene desMöglichen andere Schranken. Die ›Modalisierung‹ des Wirklichen durch eine generalisierte Ebenedes Möglichen hat jedoch nur Sinn und geschieht nur, wenn dadurch die Komplexität erhöht wird,also mehr Möglichkeiten erscheinen, als Wirklichkeit sein können. Dadurch wird die Selektivitätdes Wirklichen konstituiert; es erscheint damit im Lichte anderer Möglichkeiten.« (Luhmann 2009,8ff) In politischen Entscheidungssituationen über den Klimawandel spielt die »Modalisierung desWirklichen durch eine Ebene des Möglichen« insbesondere in Form von Szenarien und Simulationeneine Rolle. Fast alle politische relevanten Berichte (IPCC, Stern etc.) arbeiten mit Szenarien undformulieren stets mehr gegenwärtige Zukünfte, als zukünftige Gegenwart werden können.
29 Luhmann ist sich unsicher, ob Komplexität darüber hinaus in der Zeitdimension gemessen werdenmüsste. Vorstellbar wäre die Situationsveränderung je Zeiteinheit (Luhmann 2009, 22), wobei sichdies dann indirekt in einer ›Ableitung‹ der anderen beiden Dimensionen zeigen würde. Überhauptscheint die Zeitdimension am ehesten mit den anderen beiden zusammenzufallen.
3 Das politische System in einer komplexen Welt 27
ausgeschlossen ist). Meines Wissens wurde dieser Ansatz bisher von niemandem um dieSozialdimension erweitert.Soziale Komplexität lässt sich analog dazu begreifen. Zunächst einmal spielt die An-
zahl der Beteiligten eine Rolle. Der Vorteil an einem mehrdimensionalen Begriff ist, dassdies nicht bedeuten muss, dass alle eine andere Meinung haben. Die Anzahl der Beteilig-ten kann, muss jedoch nicht mit der Anzahl der Alternativen zusammenfallen. Die Spiel-und Gemeingütertheorie lehrt uns darüber hinaus, dass es rollenmäßig verschiedene Be-teiligte geben kann. Hier stoßen wir auch wieder auf die Unterscheidung der Risikotheo-rie: Es gibt Entscheider und von der Entscheidung Betroffene. Außerdem ist eine dritteRolle vorstellbar, die in der politischen Bearbeitung des Klimawandels eine zentrale Be-deutung hat: die Verursacher. Je nach Konstellation scheint die Entscheidungssituationkomplexer zu werden.30 Auch hier geht es also um die Verschiedenartigkeit der Rollen,wobei die Rollen nicht auf Entscheider, Betroffene und Verursacher beschränkt bleibenmüssen – jede Entscheidungssituation wird ihre eigenen Rollen hervorbringen.31
Am wichtigsten erscheint mir jedoch die Interdependenz der Rollen. Dies war ja ein Er-gebnis der spieltheoretischen Experimente und die Aussage der Tragedy of the Commons(Hardin 1968). Menschen treffen ihre Entscheidungen im Hinblick auf anderer MenschenEntscheidungen. Es kann profitabel sein, gegen einmal getroffene Entscheidungen zuwi-derzuhandeln, gerade weil man sie gemeinsam getroffen hat (Esposito 2007).32 Auch ausdiesem Grund kann man skeptisch gegenüber der Haltung sein, soziale Komplexität ließesich bändigen durch »planning as an argumentative process in the course of which animage of the problem and the solution emerges gradually among the participants«(Rittel& Webber 1973, 162). Die Frage ist, ob Interaktion tatsächlich ein Mittel gegen soziale
30 Es scheint mir nicht plausibel zu sein, dass eine Situation super wicked wird, wenn die Entschei-der gleichzeitig die Verursacher sind, wie Levin et al. (2010) behaupten. Fallen Entscheider undVerursacher (aber auch: Betroffene) auseinander stellen sich ganz andere Probleme der Entschei-dungsbindung. Es gibt keinen Grund zu glauben, dass es sich um eine einfachere Situation handelnwürde.
31 Des Weiteren könnte man sich fragen, ob Rollen Bedeutung erlangen können, die nicht gleichzeitigEntscheider sind (aber beispielswiese Betroffene). Handelt es sich bei der häufig zitierten Genera-tionengerechtigkeit nicht um den Versuch, zukünftige Generationen eine Rolle in Entscheidung zuverschaffen? Spielt nicht auch das politische Publikum eine Rolle in den Erwägungen, allein schon,weil Entscheidungsbindung ein Problem ist?
32 An diesem Punkt sind wir bei der Frage der Entscheidungsbindung angelangt. Luhmann behandeltdies unter der Fragestellung, ob Entscheidungsbindung (»Grad und (...) Relevanz der Identifikationmit der gewählten Alternative« (Luhmann 2009, 17)) durch komplexe Entscheidungssituationen eherzu- oder abnimmt. Die Antwort ist uneindeutig und bringt weitere Variablen ins Spiel (Isolation derEntscheidungssituation etc.). Diese Ausführung sind interessant, für den Zweck dieser Untersuchungjedoch nicht besonders relevant. Es geht ja bei Wahlprogrammen im Grunde immer um die Vorbe-reitung einer Entscheidung und somit um die Beschreibung der Situation vor der Entscheidung.
3 Das politische System in einer komplexen Welt 28
Kontingenz ist, oder ob sie nicht gerade eine solche sichtbar macht.33
Für den Aufbau einer komplexen Entscheidungssituation ist die Überführung von un-bestimmter in bestimmbare und letztlich bestimmte Umweltkomplexität zentral. »Unbe-stimmt ist die Komplexität von Entscheidungssituationen, soweit sie nicht auf Alternati-ven, das heißt auf Möglichkeiten gebracht werden kann, die sich als Wirklichkeiten wech-selseitig ausschließen würden.« (Luhmann 2009) Im Falle der sozialen Komplexität hießedas beispielsweise: Rollen, die sich überlappen. Unbestimmte Komplexität an sich ist fürLuhmann Welt, Rauschen, der ›Realitätsunterbau‹ der Gesellschaft (Kaldewey 2008).Jede Entscheidungssituation impliziert jedoch bereits eine erste Selektion: »Das denSituationsbegriff definierende Merkmal ist die Selektion von Relevanzen unter dem Ge-sichtspunkt einer zu treffenden Entscheidung.« (Luhmann 2009, 7) Auch, dass es sich umeine Entscheidungssituation handelt, ist Selektion. Bereits das Reden über Klimawandelin Wahlprogrammen ist Selektion, Parteien könnten auch über etwas Anderes sprechen.Die Komplexitätstheorie hat gezeigt, dass System- und Umweltkomplexität nicht ge-
trennt voneinander betrachtet werden können. Luhmann nennt eine Reihe von Mecha-nismen, die »eine Erhöhung interner Komplexität mit einer Erhöhung der bestimmba-ren Umweltkomplexität verbinden können.« (Luhmann 1975, 211), darunter Generalisie-rung, Zentralisierung, Differenzierung, Lernfähigkeit und reflexive Leistungsverstärkung.Wenn Luhmann schreibt, die Umwelt des Systems expandiere in die Tiefe der Welt(Luhmann 1975, 211), ist damit genau diese Umwandlung unbestimmter in bestimmteKomplexität gemeint. Wicked problems bezeichnen dann Probleme, die in Situationenhochbestimmter Komplexität (und das wiederum heißt: mit vielen Alternativen, Rollenund Interdependenzen) gestellt werden.Aus dem Text spricht, wie gesagt, nicht die aktuellste Entscheidungstheorie Luh-
manns. Gerade der Entscheidungsbegriff wurde mehrmals umgearbeitet, um sich in diejeweilige Theoriearchitektur zu fügen (Ortmann 2009). Da es hier aber weniger um Ent-scheidungssituationen generell, sondern um eine operationalisierungsfähige Beschreibung
33 Zwar nicht als empirisches Beispiel, wohl aber als literarische Illustration eines solchen Versuchs,›soziale Wollungen‹ (Karl Mannheim) zu bündeln und zu einer gemeinsamen Problemdefinition zufinden, kann die Geschichte der »Parallelaktion« in Musils »Mann ohne Eigenschaften« verstandenwerden: Eine Gruppe von Intellektuellen, höheren Beamten und Adligen möchte Österreich verän-dern. Jeder hat so seine Ahnung, worin das Problem besteht, ob es eigentlich national, geistig odergar militärisch sei, doch was sie eint ist weniger die Sicht auf das Problem, als der Drang, etwasBedeutendes zu tun. »›Wir müssen und wollen eine ganz große Idee verwirklichen. Wir haben dieGelegenheit und dürfen uns ihr nicht entziehen!‹ Ulrich fragte naiv: ›Denken Sie an etwas Bestimm-tes?‹« Die Suche nach dem bestimmten Problem bleibt erfolglos. Tausend Seiten lang baut sich dieunerträgliche Spannung einer potentiellen, ziellosen Handlungsenergie auf – und dann kommt dererste Weltkrieg.
3 Das politische System in einer komplexen Welt 29
von komplexen Entscheidungen geht, eignet sich Luhmanns Theorieskizze als Anleitung.Es geht nicht darum, ob Entscheidungen generell über den Begriff der Komplexitätadäquat begriffen werden können, sondern ganz konkret: ob es sich bei politischen Ent-scheidungen über den Klimawandel um Entscheidungen handelt, die unter Komplexi-tätsbedingungen getroffen werden und wie sich dies in der politischen Kommunikationzeigt. Der Satz, der für meine Untersuchungen zentral ist, lautet: »Entscheidungssitua-tionen sind nicht mit bestimmten Qualitäten immer schon da, sie bauen sich in Ent-scheidungsprozessen auf – und ab.«(Luhmann 2009, 23) Entscheidungssituationen sindnicht einfach komplex – oder auch nicht. Sie entwickeln sich zu komplexen Situationen,indem sich Rollen, die teilnehmen, und Alternativen, die berücksichtigt werden, ausdif-ferenzieren. In diesem Prozess verändert sich auch die Problembeschreibung selbst. DerRückgriff auf die Entscheidungssituation und ihre Entwicklung vermeidet eine erneute›Naturalisierung‹ des Problems. Es genügt nicht, ein wicked problem zu konstatieren,untersucht werden muss immer der Prozess der Problemformulierung und der Aufbauvon Komplexität in einer spezifischen Entscheidungssituation.
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 30
4 Umwelt und Klima als politisches ProblemDie Geschichte der Umwelt ist zugleich älter und jünger als die der Umweltpolitik. DieNeologismen »environment« oder »Umwelt«34 entwickelten sich erst im 19. Jahrhundertund noch heute gibt es Sprachen, wie die slawischen, die über keinen entsprechendenBegriff verfügen (wohl aber für »Natur«) (Luhmann 1999, 12). Umweltgeschichte kannjedoch in vielen Hinsichten erzählt werden: als Sozialgeschichte, als Geschichte der Ka-tastrophen, als Globalisierungsgeschichte oder als Geschichte internationaler Umwelt-Regime. Eingriffe in die Natur, über die gemeinschaftlich entschieden wurde, gab essicher zu jeder Zeit. Auch Umweltschäden durch menschliches Verhalten sind historischgesehen nichts Neues. Versteht man Umweltpolitik in diesem Sinne, ist sie älter als derBegriff der Umwelt selbst. Neu ist jedoch die Dimension der Schäden (Radkau 2000) undeine relativ »koordinierte« und »bewusste« Umweltpolitik (McNeill 2005, 269). Nicht zu-fällig fallen Beginn der Umweltgeschichte und Hochzeit der Industrialisierung bei einigenBeobachtern zusammen (Costain & Lester 1995). Umweltpolitik wird dann als Reaktionauf die Schäden verstanden, die durch die Industrialisierung entstanden sind (Harringtonet al. 2004, Jänicke et al. 1997, Weidner et al. 2002). McNeill datiert den Beginn der be-wussten Umweltpolitik dagegen auf die 1960er Jahre und unterscheidet zwei Phasen: Inder ersten Phase entstanden Umweltschutzbewegungen und politische Parteien, die aller-dings auf die reichen Ländern beschränkt blieben (McNeill 2005, 370). Dies wird häufigmit einem spezifischen Wertewandel begründet, der sich nur unter Wohlstandsbedingun-gen entwickeln könne. Diese (im Übrigen nicht unumstrittene35) These ist vor allem mitInglehart (1995, 1997) und der Unterscheidung materieller und nicht-materieller Werteverbunden. Die Themen dieser ersten Umweltbewegungen waren vor allem Umweltver-schmutzung (McNeill 2005, 370) und die Erschöpfung der Allmendegüter (Radkau 2000,285). In der zweiten Phase ab 1980 begannen auch die ärmeren Länder Umweltpolitikzu betreiben (McNeill 2005, 370). Ihre Themen betrafen jedoch traditionellere Umwelt-probleme wie Entwaldung, Versalzung und sinkende Bodenfruchtbarkeit (Radkau 2000,285). Umweltprobleme stellten sich ärmeren und reicheren Ländern, wenn auch in unter-schiedlicher Form. Oft genug waren die Anreize, umweltpolitisch zu handeln, ökonomischoder machtpolitischer Art: »Selbst im Zeitalter expliziter Umweltpolitik entsprang die
34 »Aber welcher Abgrund von Differenz im Bedeutungsgewicht,« so Blumenberg, »wenn statt derschlichten ›Umgebung‹ (environment) das Element ›Welt‹ auf den Plan tritt, zentriert um den, dersich die Welt als sein Drumherum zu denken vermag.« (Blumenberg 2000, 439)
35 So wurden die Ergebnisse der 1992 durchgeführten »Health of the Planet«-Studie als Widerlegungvon s These verstanden. Für eine ausführlichere Kritik siehe Hajer (1995, 75ff). Dass Sorge um dieUmwelt ein weltweit vorkommendes Phänomen ist zeigt auch Engels (2003, 13).
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 31
wirkliche Umweltpolitik fast immer anderen Interessen, und die traditionelle Politik hat-te nach wie vor den stärksten Einfluss auf die Umweltgeschichte.«(McNeill 2005, 375)Umweltpolitik ist eines der Felder, in dem sich die These Meyers, die Nationalstaaten
würden sich institutionell zunehmend ähnlicher (Meyer et al. 1997, Meyer 2005), zubestätigen scheint. Es wird gemeinhin als eines der internationalisiertesten Politikfelderverstanden. Kommunikation über Umwelt ist in der Politik mittlerweile so gängig, dasseinige Beobachter (in Anlehnung an den Wohlfahrtsstaat) bereits von der Entwicklungdes Umweltstaats sprechen (Eckersley 2004, Barry & Eckersley 2005, Goldman 2001).Tatsächlich scheint politisch immer mehr über Umwelt gesprochen zu werden und dieAnzahl der umweltpolitischen Gesetze steigt seit mehreren Jahrzehnten in fast allenLändern (Muno 2010, Holzinger & Knill 2005, Holzinger et al. 2008). Obwohl dies nichtautomatisch zu einer Angleichung der Umweltpolitik führen muss, gibt es auch dafürHinweise (Holzinger & Knill 2005, Holzinger et al. 2008, Knill et al. 2010, Albrecht &Arts 2005). Eine mögliche Erklärung für dieses Phänomen liegt in der Umweltpolitikselbst: Da viele Umweltprobleme nicht an Landesgrenzen halt machen, verlangen siesupra-nationale Lösungen und Institutionen, die dann wieder auf nationale Politikenund Institutionen rückwirken. Diese Erklärung ist für einige Bereiche der Umweltpolitikumstritten, scheint mir aber gerade für die Klimapolitik sehr plausibel zu sein.
4.1 Klimapolitik
Die internationale Klimapolitik hat ihre Wurzeln in der ersten Weltklimakonferenz 1979,bei der es sich in Wirklichkeit um eine wissenschaftliche, keine politische Konferenz han-delte. Hier wurde zum ersten Mal ein wissenschaftlicher Konsens darüber erreicht, dassdie Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre langfristige Folgen hat (Davenport2008, 48). Zu einem explizit politischen Thema wurde der Klimawandel auf dem Bellagio-Workshop 1987 in Italien, da hier »the possible need for a convention to combat climatechange was first voiced.« (Davenport 2008, 49) In der Klimapolitik wird über die Atmo-sphäre verhandelt, bzw. das Recht, Treibhausgase in die Atmosphäre auszustoßen. DieTatsache, dass die Atmosphäre global zugänglich ist und der genaue Ort der Emissionenfür ihre Wirkung unerheblich ist, ist ein wesentliches Merkmal des Klimaproblems imVergleich zu anderen, eher lokalen Umweltproblemen. Es verwundert darum nicht, dassman zunächst versuchte, ein Law of the Atmosphere nach dem Vorbild der UN Konven-tion über das Law of the Sea zu entwickeln. Der globale Charakter des Problems prägteschon früh die Verhandlungen und potentiellen Lösungen und wird allgemein als we-sentliches problematisches Merkmal verstanden. Dabei wird jedoch oft übersehen, dass
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 32
damit auch neue Möglichkeiten der Problembearbeitung einhergehen, wie der Handelmit Emissionszertifikaten. Auch das Beispiel der erfolgreichen internationalen Ozonpo-litik zeigt, dass die Bearbeitung nicht allein dadurch kompliziert wird, dass es sich umdie Regulierung eines globalen Gemeingutes handelt. Das Montreal-Protokoll über dasVerbot von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FCKW), unterschrieben 1987, ist der selteneFall einer erfolgreichen internationalen politischen Problemlösung (und nicht nur: Bear-beitung) (Bolin 2007, 46). Die internationale Ozonpolitik wurde, stärker noch als dasLaw of the Sea, zum Ausgangspunkt für die spätere internationale Klimapolitik (Daven-port 2008, 49, Bolin 2007, 46). Zwischen den beiden Fällen existieren jedoch zahlreicheUnterschiede. Die internationale Entscheidungsfindung stellte sich unter anderem da-durch einfacher dar, dass die USA dem Montreal Protokoll – ganz im Gegensatz zumKyoto Protokoll – positiv gegenüber standen (Andresen & Agrawala 2002). Im Falleder FCKWs existierten jedoch relativ kostenarme Alternativen (von denen, Ironie derGeschichte, einige übrigens Treibhausgase sind). Außerdem war der Einsatz der FCKWsstets auf relativ spezielle Gebiete begrenzt, während Treibhausgase so zentrale Bereichewie Energie, Verkehr und Landwirtschaft betreffen. »Cooperation on the climate changeissue,« so Paterson & Grubb (1992, 294), »is particularly difficult because serious re-sponses could reach into the heart of countries’ political and economic structure.«Vermutlich hat keine andere Institution die internationale und nationalen Klimapoli-
tiken so stark beeinflusst wie das International Panel of Climate Change (IPCC), das imJahr 1988 gegründet wurde und eine wissenschaftliche Grundlage für politisches Han-deln liefern sollte. Zunächst waren es nur 28 Länder, darunter 11 Entwicklungsländer,die die Gründung vorantrieben (Bolin 2007, 49). Die Organisation sollte aus drei Ar-beitsgruppen bestehen, die den wissenschaftlichen Stand zu unterschiedlichen Gebietenzusammenfassen: Die Grundlage von Klimaänderungen; Auswirkungen, Anpassungenund Verletzlichkeiten (adaptation) sowie die Verminderung des Klimawandels (mitiga-tion). Der Klimawandel wurde in Zukunft tatsächlich vor allem hinsichtlich dieser dreiFragen diskutiert: Findet er als Folge menschlichen Verhaltens statt, was können wirdagegen tun und wie können wir uns anpassen? Seit seiner Gründung hat der IPCCfünf Sachstandsberichte veröffentlicht und die Wahrscheinlichkeit für eine anthropogeneVerursachung stets nach oben korrigiert. Spätestens mit dem IPCC-Bericht aus demJahr 2007 wird kein wissenschaftlicher Zweifel daran gelassen, dass anthropogener Kli-mawandel geschieht.36 Die Struktur des IPCC und die Prominenz des Problems, dem
36 Der aktuellste IPCC-Bericht wurde während des Schreibens meiner Arbeit veröffentlicht (September2013). Auch er bestätigt noch einmal die extrem wahrscheinliche Verursachung durch menschliches
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 33
es sich widmet, haben eine Vielzahl sozialwissenschaftlicher Forschungen ausgelöst.37
Insbesondere für die Untersuchung der Beziehung von Wissenschaft und Politik (alsSchnittstelle, boundary, intermediate oder hybrid organization) ist das IPCC ein belieb-tes Untersuchungsobjekt. Das internationale Klimaschutzregime gilt jedoch generell alseines der am besten erforschten Beispiele internationaler Verhandlungen (Engels 2003).Schon zu einem frühen Zeitpunkt zeigte sich eine bestimmte Struktur der sozialen Di-
mension der Verhandlungen. Paterson & Grubb (1992) nennen drei Konfliktlinien, die inden Verhandlungen des International Negotiating Committee on Climate Change (INC)deutlich wurden: Länder des globalen Nordens vertreten tendenziell eine andere Positionals die des Südens, ölproduziernde und -exportierende eine andere als importabhängigeund von den Folgen des Klimawandels betroffene38 haben andere Interessen als rela-tiv unbetroffene (Paterson & Grubb 1992, 295ff). Darüber hinaus weisen sie auf einenUnterschied in der politischen Kultur hin, der sich in einer unterschiedlichen Gewich-tung der epistemischen Unsicherheiten zeige (Paterson & Grubb 1992, 296f). Patersonund Grubbs Text ist die erste systematische Untersuchung der sozialen Dimension despolitischen Konflikts um Klimapolitik, wie sie sich zu Beginn der internationalen Ver-handlungen darstellte.39 Um die Vertiefung der sozialen Konfliktlinien zu verhindern,schlagen sie vor, aktiv nach »non-traditional allies across the North-South divide« zusuchen (Paterson & Grubb 1992, 307). Folgt man der theoretischen Beschreibung vonEntscheidungssituationen und der Konzeptualisierung von Komplexität, wie ich sie inKapitel 3.2 entwickelt habe, so handelt es sich bei diesem Vorschlag um eine Erhöhungder Komplexität: Die drei bisher dominierenden sozialen Konfliktlinien sollen um einedritte erweitert werden, die quer zu ihnen liegt.Im Jahr 1992 wurde auf der Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und
Entwicklung die UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) verab-schiedet. Die Konvention blieb vage, steckte jedoch die Begriffe und den Rahmen fürdie weitere Diskussion ab. Insbesondere die Unterscheidung von Industrieländern (»An-
Handeln und erhöht die Wahrscheinlichkeit auf 95% im Vergleich zu 90% im Jahr 2007.37 Um nur einige zu nennen: Beck (2009b), Beck (2009a), Poloni (2009), Conrad (2010).38 Vor diesem Hintergrund bildeten sich auch Interessensvetretungen, wie beispielsweise die Association
of Small Island States (AOSIS), die 1990 gründet wurde.39 Ein weiterer Versuch, die soziale Komplexität des Klimawandels zu fassen ist Verweji et al. (2006).
Ihr Zugang ist jedoch eher ein theoretischer: Ausgehend von den vier Organisationsformen der Cul-tural Theory begreifen sie den Konflikt um den Klimawandel als Konflikt zwischen vier universellenOrganisationsformen. Das Scheitern des Kyoto-Protokolls erklären sie sich durch das einseitige ›hier-archische‹ Ordnungsprinzip, das sich darin zeige (im Übrigen ein Ordnungsprinzip, das stark an dentechnokratischen Diskurs erinnert, wie Hajer (1995) ihn herausarbeitet, siehe unten). Impliziert ist:Eine Art Kompriss oder doch jedenfalls die Kombination der Prinzipien könnte den Konflikt lösen.
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 34
nex I countries«) und Entwicklungsländern ist bis heute zentral in der Klimapolitik.40
Auch der Querschnittscharakter, die »common but differentiated responsibilites«, Emis-sionsreduktionen und die Kopplung von Klima- und Entwicklungspolitik wurden in derKonvention das erste Mal genannt und anerkannt (Davenport 2008, 51). Während derVorbereitungen des Kyoto-Protokolls schlug Deutschland vor, man solle anstelle derstrikten Grenze zwischen Industrieländern, die zu Zugeständnissen verpflichtet wurden,und Entwicklungsländern, die davon befreit waren, die Verpflichtungen an den Grad derEntwicklung koppeln (Davenport 2008, 53). Dies war nicht zuletzt der Versuch, zwi-schen den USA und den Entwicklungsländern zu vermitteln. Die USA hatten in denVerhandlungen stets die Position vertreten, dass auch Entwicklungsländer, allen vorandie BRIC-Staaten, zu Emissionsreduktion verpflichtet werden müssten. Später koppelteder US Senat jede Unterschrift und Ratifikation von Protokollen an diese Bedingung.Die USA forderten nicht nur Zugeständnisse von Entwicklungsländern sondern sprachensich auch für flexiblere Instrumente der Klimapolitik, wie die Anrechnung von Kohlen-dioxidspeichern und Emissionshandelsysteme aus (Davenport 2008, 53).Das letztlich beschlossene Protokoll blieb in vielerlei Hinsicht mangelhaft. Die Selbst-
verpflichtungen der Länder waren niedriger, als im ersten IPCC-Bericht gefordert. Esgab keine allgemeine Berechnungsgrundlage, die Länder wählten für sich selbst, ob undum wie viel sie ihre Treibhausgasemissionen reduzieren wollten (Davenport 2008, 54).Sämtliche »flexibility mechanisms«, die von der USA gefordert worden waren, waren imProtokoll enthalten. Neben dem globalen Emissionshandel bedeutete dies beispielsweiseauch die Möglichkeit, Kohlendioxidsenken (wie Wälder) gegenzurechnen. Entwicklungs-länder, die signifikant zum weltweiten Kohlendioxidausstoß beitrugen, wie China undIndien, wurden zu keinen Reduktionen verpflichtet (Davenport 2008, 55). Am 16. Fe-bruar 2005 trat das Kyoto-Protokoll in Kraft, mit der Unterschrift Russlands aber ohnedie der USA. Doch im Rückblick sollte sich das das Kyoto-Protokoll trotz seiner Schwä-chen schon als Höhepunkt des internationalen Klimaregimes herausstellen. Auf keineranderen Weltklimakonferenz – die momentan in Warschau stattfindende eingeschlossen– wurden ähnlich viele Instrumente entwickelt und Verpflichtungen eingegangen.Neben den IPCC-Berichten spielte vor allem der Stern-Report aus dem Jahr 2006 eine
Rolle für internationale, europäische und nationale Klimaschutzpolitiken. Der Bericht
40 Angesichts der weitreichenden Folgen dieser Entscheidung (und angesichts der strikten Gren-ze, die sie auf einem Kontinuum zieht) ist es kaum vorstellbar, dass die Zuordnung zu ei-ner der beiden Gruppen im Einzelfall unumstritten war. Meines Wissens existiert jedoch kei-ne wissenschaftliche Untersuchung dieses Zuordnungsprozesses. Die Kriterien finden sich hier:http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/10/anexo01i.pdf.
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 35
enthielt eine volkswirtschaftliche Berechnung der Kosten des Klimawandels und wardadurch insbesondere für die Wirtschaftspolitik anschlussfähig, obwohl er im Grundenur wiederholte, was in anderen Berichten bereits gesagt wurde. »Extolling the economicbenefits of early mitigation, Stern effectively reiterated the message of the RCEP [RoyalCommission on Environmental Pollution - DR] (2000) and Intergovernmental Panel onClimate Change (IPCC 2007) in language that captured the attention of aware andconcerned public and business sectors worldwide.« (Davenport 2008, 111, unter Zitierungvon Jordan & Lorenzoni 2007)Parallel zur Untersuchung umweltpolitischer Institutionen lag ein Schwerpunkt sozi-
alwissenschaftlicher Forschung stets auf der Untersuchung umweltpolitischer Diskurse(vgl. Hajer 1995, Dryzek 1997, Dryzek & Schlosberg 2003). Es handelt sich dabei stetsum Erzählungen, die bestimmte Handlungen und Folgen zurechnen und Informationenin eine bestimmten, sinnvollen Zusammenhang stellen (Dryzek 1997, 8). Bei DeborahStone (1989) ist die Auseinandersetzung über Kausalzurechnungen, beispielsweise übermenschliche oder natürliche Ursachen, wesentlich für den politischen Streit als solchen(ihre Kausalschemata werden im empirischen Teil dieser Arbeit eine Rolle spielen, sieheKapitel 7). Besonders zentral wird die kommunikative Unterscheidung von Risiko undGefahr aber immer wieder in Umwelt- und Technikkonflikten.41
Für Hajer (1995) spielen internationale Organisationen nicht nur institutionell, son-dern auch diskursiv eine bedeutende Rolle. Insbesondere die zahlreichen Berichte derOECD und UNO trieben die Entwicklung und Durchsetzung eines relativ dominantenUmweltdiskurses voran, der »ecological modernization«. Deren Wurzeln liegen nach Ha-jer in zwei einflussreichen Texten der 1970er Jahre, dem »Blueprint for Survival« (Golds-mith) und »Limits to Growth« (Club of Rome), die beide 1972 veröffentlicht wurden. Bei-de Texte thematisieren die ökologischen Herausforderungen der Gesellschaft, entwickelneine ähnliche – wenngleich unterschiedlich radikale – Problembeschreibung (wirtschaft-liches Wachstum unter endlichen Ressourcen), schlagen jedoch verschiedene Lösungenvor. Während »Limits to Growth« von einer zentralen, technokratischen Lösbarkeit desUmweltproblems ausgeht42, schlägt »Blueprint for Survival« eine Dezentralisierung derGesellschaft und radikale Umgestaltung des Produktionsprozesses vor (Hajer 1995, 84f).Im Konflikt über die Atomenergie gerieten die beiden Strömungen des Umweltdiskur-
41 Siehe auch Feindt & Saretzki (2010). Nicht selten wird daraus auch eine moralische Frage. Es kannnicht nur unmoralisch sein, riskante Entscheidungen zu treffen, sondern auch riskant, moralisch zuentscheiden (Luhmann 1993).
42 Im deutschen Klimawandel-Diskurs spielt die Denkschrift der Deutschen Physikalischen Gesellschaft(DPG) und der Deutschen Metereologischen Gesellschaft von 1987 eine ähnliche Rolle.
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 36
ses in die stärkste Antagonie: Während die Atomenergie in technokratischen Zirkelnals offensichtliche Lösung gesehen wurde, war sie für die radikale Umweltbewegung einAusdruck all dessen, was in der Gesellschaft schief lief: Zentralisierung, Technokratie,Expertentum (Hajer 1995, 91f). Verbinden konnten sich die beiden Diskurse als »Öko-logische Modernisierung« erst mit der Deradikalisierung der Umweltbewegungen in den1980er Jahren und den Entwicklungen innerhalb der neu gegründeten internationalenOrganisationen, in denen man sich immer stärker bewusst wurde, dass Umweltpolitiknur unter wirtschaftlichen und ökologischen Gesichtspunkten möglich ist. Die Erzählungder Möglichkeit »ökologischer Modernisierung« wurde schnell zum dominanten Diskurs:
»As we have seen (...), ecological modernization is essentially an efficiency-oriented approach to the environment. This is what made it possible forecological modernization to become the dominent discourse within the en-vironmental domain. The positive-sum game format took away many of theobjections governments might have had to a new approach of environmentalregulation.« (Hajer 1995, 101)
In diesem Sinne kann »ökologische Modernisierung« als Ausdruck des Gedankens vonMcNeill (2005, 375) verstanden werden, dass Umweltpolitik meistens in Kombinationmit weiteren Interessen auftritt. Als das Klima in die Politik kam, war die Erzählungder »ökologischen Modernisierung« schon in der Politik angekommen und an anderenUmweltproblemen erprobt. Doch auch, wenn der Diskurs in internationalen Organisa-tionen dominant wurde, zeigt er sich, wie wir sehen werden, erst in Ansätzen in denWahlprogrammen der Parteien.
4.2 Parteien in Umwelt- und Klimapolitik
Obwohl Umweltschutz seit der Industrialisierung immer wieder politisches Thema war,gelang es den grünen Parteien Umweltpolitik als eigenständiges Thema und Wahlalter-native zu anderen Parteien zu etablieren. Die ersten grünen Abgeordneten wurden 1979in den Schweizer Nationalrat gewählt, Ende der 90er Jahre waren sie bereits in fastallen westeuropäischen Parlamenten vertreten. Doch auch, wenn grüne Parteien sichmittlerweile zu einer grünen Fraktion im Europaparlament zusammengeschlossen ha-ben, bleiben starke Unterschiede zwischen den einzelnen grünen Strömungen bestehen.Die Forschung unterscheidet Wassermelonen und Gurken – je nachdem, ob es sich umecosocialist oder ›rein‹ grüne Parteien handelt (O’Neill 2012, 175ff). Die Gründung und
4 Umwelt und Klima als politisches Problem 37
Etablierung grüner Parteien hat generell einen günstigen Einfluss auf die Umweltpoli-tik (Muno 2010). Ist eine grüne Partei im Parteiensystem etabliert, so müssen auch dieanderen Parteien eher eine Position zu Umweltfragen entwickeln.Eine weitere parteienspezifische Unterscheidung ist die so klassische wie umstrittene
Kategorisierung in linke und rechte Parteien. Obwohl die Rechts-Links-Position immerwieder als erklärende Variable für politisches Handeln von Parteien herangezogen wird43
hat sie in der Umweltpolitik weniger Aussagekraft: »Environmental issues cut acrossthe left-right dimension when looking at specific party families« (Knill et al. 2010).44
In der Parteienforschung ist jedoch unklar, inwiefern dies bedeutet, dass Umweltschutzzu den ›valence issues‹ gehört, also zu denjenigen Themen, über die Parteien eher garnicht als negativ sprechen (Clarke et al. 2011, Green 2007). Auch im CMP existierenzwar negative Kategorien für einige Policy-Bereiche, nicht jedoch für die Umweltpolitik.In jüngster Zeit wurde diese These des ›valence issues‹ durch Gemenis et al. (2012)für rechte und nationalistische Parteien relativiert (etwas, das sich tendenziell auch inmeiner Untersuchung zeigt). Sie weisen darauf hin, dass Einstellungen zur Umwelt eherim bevorzugten trade-off von Umweltschutz und Wirtschaftswachstum oder Steuerer-höhungen erkennbar werden. Eine Erkenntnis, die sich freilich nur schwer in einen Codeübersetzen lässt und somit eine Grenze inhaltsanalytischer Untersuchung von Partei-positionen markiert. Ein eigene Untersuchung an den Euromanifesto-Daten (in deneneine negative Umweltkategorie existiert) bestätigt aber zumindest, dass explizit negativeAussagen über Umweltschutz extrem selten sind. Es ist wahrscheinlich, dass Parteien erstdann in ihren Wahlprogrammen über den Klimawandel schreiben, wenn sie ihn als Folgemenschlichen Handelns und als politisches Problem anerkennen. Es wäre also durchausmöglich, dass sich eine grundsätzliche Umstrittenheit nicht explizit äußert, sondern nurindirekt in der Ignoranz des Themas. Diese These bestätigt sich in meiner Untersuchungtendenziell für rechtspopulistische Parteien.
43 Und das, obwohl sie ja gerade aus ›aggregiertem‹ politischen Handeln konstruiert wird. Man musshier also aufpassen, dass man nicht im Zirkel erklärt. (In meinem Fall ist das unproblematisch: DieUmweltpolitik ist kein Bestandteil des RILEs – d.h. derjenigen Kategorien des CMP, die für dieRechts-Links-Positionsbestimmung herangezogen werden.)
44 Beispiele dafür finden sich bei Mair & Mudde (1998), Neumayer (2003, 2004) und Nawrotzki (2012).
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 38
5 Forschungsfrage, Daten und FallauswahlIrgendwie hat der Klimawandel in den letzten dreißig Jahren den Weg in die Politik undin die Wahlprogramme der Parteien gefunden. Man kann das erstaunlich finden, weiles sich, wie wir gesehen haben, um ein Problem handelt, dass sich in naher Zukunftnicht lösen lässt – was können Parteien dabei also gewinnen? Im Allgemeinen bleibt diepolitische Resonanz des Themas erklärungsbedürftig (Wiesenthal 2010). Andererseits:»Gelöste Probleme sind keine. Für eine Reproduktion eines sozialen Systems brauchtman aber den Kommunikationsanreiz der Probleme. Deshalb muß es auch hinreichendviele reproduzierbare Probleme geben.« (Luhmann 1999, 18f) Die Politik hätte demnachauch ein Faible für komplexe Entscheidungssituationen.Die allgemeine Beschwörung des Klimawandels als Jahrhundertproblem verführt da-
zu, die Komplexität im (globalen, naturwissenschaftlich komplexen, etc.) Wesen desProblems zu suchen. Ich möchte für diese Untersuchung einen andere Herangehensweisewählen. Mit Luhmann möchte ich den Weg von der Entscheidung zur Entscheidungs-situationen bzw. vom Problem zur Situation der Problemformulierung gehen. Situationsoll dabei nicht bedeuten, dass nur ein einmaliger Zeitpunkt untersucht wird. Ich gehevielmehr davon aus, dass es sich um einen ständigen Aktualisierungsprozess handelt,um eine Neuformulierung und Neusondierung des Problems, freilich mit Rücksicht aufdie Geschichte der Problemformulierungen. Entscheidungssituationen sind nicht immerschon komplex, sie bauen sich durch allmähliche Bestimmung von sachlicher, sozialerund zeitlicher Umweltkomplexität auf.Dies bedeutet, alle Aussagen über das Wesen des Problems konsequent auf die Situa-
tion zu beziehen. Die vermeintlich problematische ›Globalität‹ des Klimawandels zeigtsich dann beispielsweise in der Anzahl der zu berücksichtigenden Rollen, in der schierenMasse und Vielfalt der ›Anrainer-Staaten‹ der Atmosphäre. Die häufig betonte »wis-senschaftliche Komplexität«45 zeigt sich in der sachlichen Dimension als widerstreitendeVerhältnisse von Problem und Lösung. Dies alles ist nicht neu und bloße Reformulie-rung. Wesentlich ist jedoch, dass es sich vor diesem Hintergrund auch bei der jeweilsvorgeschlagenen »Lösung« (alle Staaten an einen Tisch, neue Koalitionsbildung, mehrKlimaforschung) um Aufbau von Komplexität handelt. Eine Reduktion der Komplexität,eine Vereinfachung des Problems ist nicht in Sicht – und wäre wohl auch keine Lösung.
45 Vgl. für einen relativ direkt behaupteten Zusammenhang von nicht-linearem Klimasystem und po-litischer Bearbeitung Dryzek (1997, 8).
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 39
Konkreter formuliert lautet also meine Forschungsfrage: Inwiefern zeigt sich in denWahlprogrammen europäischer Parteien die Entwicklung einer komplexen Problemfor-mulierung bzw. einer komplexen Entscheidungssituation, verstanden als zunehmende Be-stimmung sachlicher und sozialer Komplexität?Der Forschungsgegenstand ist die Entwicklung der politischen Kommunikation über
Klimawandel und genauer: der Kommunikation über Klimawandel in den Wahlprogram-men 14 europäischer Parteien. Meine Analyse gliedert sich in zwei Teile. Zunächst möch-te ich die quantitative Dimension der Kommunikation über Klimawandel vermessen. Ineinem zweiten Schritt werde ich den Inhalt der Aussagen aus den Wahlprogrammenfür einige Länder genauer hinsichtlich der Frage untersuchen, welche Rollen (Entschei-der und Betroffene) und Alternativen genannt und welche Kausalkonstruktion gewähltwird.
5.1 Daten und Fallauswahl
Meine Datengrundlage ist die Sammlung von Wahlprogrammen des Comparative Mani-festos Projects (CMP) am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.46 Das CMPstellt einen Datensatz für eine Vielzahl von Ländern zur Verfügung, der die codiertenParteiprogramme in Form von 56 Policy-Positionen enthält (Volkens et al. 2013). DiePolicy-Positionen eignen sich jedoch nicht für Analysen zu sehr spezifische Themen wiedas des Klimawandels. Zwar gibt es Daten darüber, wie häufig Parteien positiv überUmwelt sprechen – in diese Kategorie fallen jedoch Aussagen über den Wald genausogut wie Aussagen über das Klima. Darüber hinaus wird nicht jede Aussage über denKlimawandel als Aussage über Umweltpolitik gecodet, sondern nur dann, wenn Umwelt-bzw. Klimaschutz der Zweck dieser Handlung ist. Gerade aktuelle klimapolitische Posi-tionen beziehen sich jedoch auch auf (wirtschaftliche, technologische) Chancen, die derKlimawandel hervorbringt. Aus diesem Grund werde ich mit den ›rohen‹ Wahlprogram-men arbeiten und CMP-Daten nur als unabhängige Kontrollvariablen in die Analyseaufnehmen.Es wurden alle Parteien berücksichtigt, die in zwei Wahlen hintereinander in das Par-
lament einzogen (siehe Anhang). Grüne Parteien wurden auch in die Analyse aufgenom-
46 Die Originaltexte wurden in elektronischer Form durch eine Kooperation des Zentralarchiv für Em-pirische Sozialforschung (ZA, GESIS), des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialfoschung (AndreaVolkens, Hans-Dieter Klingemann, WZB), die Vrije Universiteit Amsterdam (Paul Pennings andHans Kema, VU) und das Comparative Manifestos Project (Ian Budge, CMP) zugänglich gemacht.Teilweise finanziert durch die Netherlands Organization for Scientific Research (NWO project 480-42-005).
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 40
men, wenn sie nicht ins Parlament einzogen. Der Grund für diese Entscheidung ist, dassgrüne Parteien häufig die ersten sind, die über den Klimawandel sprechen und dies Ein-fluss auf die anderen Parteien haben kann (Muno 2010), auch wenn der Stimmenanteilder Grünen gering ist. Pro Wahl decken die untersuchten Parteien mit einer Ausnahme(Niederlande 2002) immer über 80% der Stimmen ab. Die Fallauswahl wurde jedochetwas lockerer gehandhabt, wenn eine Partei dadurch länger über die Zeit beobachtetwerden konnte.
5.2 Wahlprogramme
Wahlprogramme haben keinen besonders guten Ruf. Nichts entscheidet sich in Wahl-programmen, die Kommunikation bleibt (scheinbar) folgenlos, geschwätzig und verlogen(Kavanagh 1981).47 Ich möchte dennoch dafür argumentieren, Wahlprogramme ernstzu nehmen. Wahlprogramme sind eine spezifische Kommunikation spezifischer politi-scher Organisationen: Parteien. Diese fungieren als Issue-Zulieferdienste für das politi-sche Zentrum: Sie greifen Themen auf und entwickeln Positionen. Wahlprogramme selbstdienen als »unverbindliche Vorbereitung politischer Entscheidungen« (Luhmann 2002,seite). Sie strukturieren die Entscheidungssituation vor. Interessanterweise taucht diesesemantische Funktion in der klassischen politikwissenschaftlichen Literatur über Wahl-programme nicht explizit auf. Wahlprogramme werden nach ihren Zielen (wenig um-stritten sind office, vote, policy und democracy), Funktionen (eine Konkretisierung, wiedie Ziele erreicht werden sollen) und Adressaten (intern, extern) unterschieden (Merz &Regel 2013, 214). Die semantische Vorstrukturierung einer politischen Entscheidungssi-tuation lässt sich am ehesten noch unter policy fassen: Hier geht es um die Entwicklungeines parteispezifischen Profils (Kaack 1971, 318ff) und damit einer Abgrenzung zu ande-ren Parteien. Kavanagh (1981, 10f) und Schönbohm (1974, 19f) betonen darüber hinausdie Möglichkeit, Neues in den politischen Prozess einzubringen. Es ist an dieser Stellenicht der nötige Platz dafür, aber dieses Fehlen der semantischen Funktion könnte dar-auf hinweisen, dass Wahlprogramme bisher vor allem hinsichtlich der möglichst genauenFilterung der Parteipositionen untersucht wurden.48 Eine Untersuchung des gesamten
47 Luhmann (1977) findet Parteiprogramme so langweilig und gleichförmig, dass sie schon wieder span-nend sind. Seine Erklärung ist die Konzentration auf Werte (=unlösbare Probleme), die von allengeteilt und von niemandem bestritten werden. Ein solches Programm erfüllt seine internen undexternen Funktionen allerdings nur leidlich gut.
48 Es existiert eine unglaubliche Menge an Literatur zu der Frage, wie sich Parteipositionen möglichstexakt aus dem Text destillieren lassen – als handele es sich nicht nur um ein wissenschaftlichesSurrogat, das als solches funktioniert, gerade weil es nicht exakt wiederholt, was Parteien sagen.
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 41
semantischen Feldes, das in einer Wahl durch Parteien aufgebaut wird und sich nicht aufeinzelne Positionen reduzieren lässt, findet jedoch kaum statt. Wir werden sehen, dasseiner solchen Untersuchung gerade beim Klimawandel Bedeutung zukommt, da es ineinigen der untersuchten Länder gerade keine distinkten Parteipositionen zu entdeckengibt.Meiner Ansicht nach gibt es, gerade für Vergleiche über einen langen Zeitraum hinweg,
keine besseren Quellen für politische Kommunikation im Allgemeinen und Parteipositio-nen im Speziellen. Im Gegensatz zu anderen politischen Kommunikationsformen entste-hen Wahlprogramme (innerhalb eines Landes) nahezu synchron und sind in den meistenFällen in irgendeiner Art von der Partei legitimiert. Grundsatzprogramme, Interviewsoder Blogs sind dagegen zeitlich und inhaltlich nicht wirklich vergleichbar.Eine andere Frage ist der Zusammenhang von Programm und faktischer Politik. In
meiner Arbeit werde ich nur Aussagen über den Klimawandel in Wahlprogrammen unter-suchen, nicht die tatsächliche Klimapolitik der Regierungen. Wahlprogramme sind zwarhochverdichtete Kommunikation, allerdings nicht in erster Linie auf Entscheidungsfähig-keit hin, sondern eher auf Wahlgewinn (Luhmann 2002). Dennoch sind Wahlprogrammenicht vollkommen unabhängig von den später getroffenen Entscheidungen der regieren-den Parteien: »Die politischen Parteien dürfen die Kluft zwischen Vorschlag und Durch-führbarkeit nicht zu groß werden lassen; zumindest dann nicht, wenn sie an der Regie-rung beteiligt sind.« (Luhmann 2002, 259) Mehrere Studien unterstützen die Ansicht,dass es zwischen Wahlprogramm und späterer politischer Entscheidung einen deutli-chen Zusammenhang gibt (Budge & Laver 1993, Klingemann et al. 1994, McDonald &Budge 2005, Strom 1990). Damit soll jedoch nicht gesagt sein, dass sich die Bedeutungvon Wahlprogrammen in erster Linie aus ihrer späteren Umsetzung ergibt. Wahlpro-gramme bestehen aus Aussagen, die von einer bestimmten Partei zu einem bestimmtenZeitpunkt in Abgrenzung zu anderen Parteien und in Anbetracht des politischen Publi-kums bewusst getroffen werden. Somit geben sie auch Aufschluss über Selbstverständnisund Position von Parteien, über eine nach außen benutzbare Sprache (Luhmann 2002,267) sowie die semantische Struktur des politischen Feldes zu einem bestimmten Zeit-punkt. Sie werden hier als eine bestimmte Form politischer Kommunikation verstanden,
Qualitätskriterien sind dann die gegenseitigen Vergleiche von Expertenmeinungen und aus Textgewonnenen Positionen. Ehrlicher ist da schon der Wahl-O-Mat, der Parteien im Vorhinein nur nachspeziellen Positionen fragt und diese dann 1:1 wiedergeben kann. Man könnte Parteien beispielsweiseeinfach 100% auf die 56 CMP-Kategorien aufteilen lassen und hätte denselben Effekt. Möglicherweiseliegt die Verwirrung in dem Begriff der »Position«, der sich sowohl an ein innerwissenschaftliches, alsauch an das politische Publikum wenden kann, in beiden Anwendungen aber nicht zusammenfällt.
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 42
die politische Entscheidungssituationen semantisch vorstrukturieren: »Als ›Politik‹ kannman jede Kommunikation bezeichnen, die dazu dient, kollektiv bindende Entscheidun-gen durch Testen und Verdichten ihrer Konsenschancen vorzubereiten.« (Luhmann 2002,254) Man muss allerdings davon ausgehen, dass jede tatsächliche Entscheidungssituation(etwa internationale klimapolitische Verhandlungen) noch von vielen weiteren Faktorenbestimmt ist, die die konkrete Interaktion betreffen. Es kann hier also nicht so sehr umdie korrekte Abbildung einer konkreten politischen Entscheidungssituation, sondern eherum die Frage gehen, wie sich die Entwicklung der Komplexität schon in semantischenVorarbeiten zeigt.
5.3 Methode: Das Klima zählen
Auch in den Sozialwissenschaften werden mittlerweile raffinierte inhaltsanalytische Ver-fahren angewandt. Ein Beispiel dafür sind topic models oder lernende Algorithmen. Al-lerdings ist nicht jedes Verfahren für jeden Text, jedes Thema und jede Forschungsfragegleich geeignet. Laver et al. (2003) zeigen in einer Studie zu Parteipositionen, dass einfa-che Modelle wie bag of words (=relative Häufigkeiten von Wörtern) oft ähnlich gute Er-gebnisse hervorbringen. Im Falle der politischen Kommunikation über den Klimawandelerscheint mir die einfache Methode des Wörterzählens angemessen. Topic Models werdenhäufig in Gebieten angewendet, über die sozialwissenschaftlich nur sehr wenig über The-menstrukturen bekannt ist oder in denen große Mengen an Text grob klassifiziert werdenmuss. Darüber hinaus haben einfachere und raffiniertere Methoden dieselben Schwächenzu tragen. Inhaltsanalyse bedeutet immer, mit einem Algorithmus an Text heranzuge-hen und damit Sinn stets auf eine konstante und plumpe Art und Weise abzubilden.Eine gewisse Ausnahme – und darum auch die große Hoffnung – sind lernende Algo-rithmen. Im Falle des Klimawandels sind die verwendeten Begriffe jedoch größtenteilsbekannt und über die untersuchten Länder und die Zeit hinweg relativ homogen. Diesbedeutet, dass häufig in denselben Wörtern (mit lateinischen bzw. griechischen Wurzeln)oder direkten Übersetzungen über Klimapolitik gesprochen wird. Angesichts der starkenInternationalisierung dieses Gebiets mag das nicht verwundern.Die Suchstrings für die einzelnen Sprachen wurden in Rücksprache mit Muttersprach-
lerInnen entwickelt (für eine Übersicht siehe 8). Darüber hinaus handelt es sich nur umSprachen, bei denen ich zumindest eine Sprache derselben Sprachfamilie gut spreche– damit fallen die baltischen Staaten, Finnland, Ungarn und Griechenland bereits ausforschungspraktischen Erwägungen heraus. Die Wahlprogramme wurden digitalisiert,
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 43
vorbereitet49 und automatisiert nach den Begriffen durchsucht. Relativiert wurde dieAnzahl an der Gesamtzahl von Wörtern. Es handelt sich bei der abhängigen Variablealso um den Anteil der klimabezogenen Wörtern zur Gesamtzahl der Wörter.Selbstverständlich gibt es Mängel dieses Verfahrens, die in der Arbeit an meiner Ana-
lyse immer wieder sichtbar wurden. Die größte Herausforderung war das Herausfilternderjenigen Aussagen, die die Wörter des Suchstrings in einem anderen Kontext ver-wenden. Besonders schön war die Entdeckung, dass Österreich in den 1990ern einenBundeskanzler namens Viktor Klima hatte, der in vielen Wahlprogrammen auftauchte.Zahlenmäßig verfälschten die Aussagen über Wirtschafts- und Investitionsklima meineDaten am stärksten, am kompliziertesten gestaltete sich das Herausfiltern der Aussagenüber Schadstoffemissionen, die keine Treibhausemissionen sind: Klimapolitik knüpft beiden Parteien häufig nahtlos und teilweise zweideutig an Luftreinhaltepolitik an. Darüberhinaus gab es, gerade bei Ländern, in denen Tourismus eine gewissen Rolle spielt, eineReihe von Aussagen zur Erhaltung der vorteilhaften klimatischen Bedingungen, womitnicht unbedingt auf Klimaschutz referiert wurde.Technisch wurden diese Problem dadurch gelöst, dass Wortkombinationen und keine
einzelnen Wörter betrachtet wurden. Verdächtige Kombinationen konnten so heraus-gefiltert werden. Ein gewisser Fehler ist bei dieser Herangehensweise jedoch immer zuerwarten. Generell gilt, dass die Verwendung der Wörter in anderen Kontexten relativzum Klimakontext über die Zeit abnimmt. Das heißt, je jünger die Wahlprogramme,desto zuverlässiger sind die Daten. Darüber hinaus ist der zweite Teil der Analyse vondiesen Fehlern nicht betroffen, da hier für einen Teil der Länder jede einzelne Aussageüber Klimapolitik betrachtet und codiert wurde.Ein weiteres Problem, dessen Reichweite ich kaum einschätzen kann, ist der Einfluss
unterschiedlicher linguistischer Strukturen auf meine Ergebnisse. Denkbar ist vor allemein Einfluss über die Worthäufigkeit innerhalb einer Aussage, beispielsweise »Treibhaus-gasemissionen« (ein Match) oder »Emissionen von Treibhausgasen« (zwei matches).Aufgrund dieser methodischen Mängel muss die Aussagekraft der Studie eingeschränkt
werden. Generell sind Aussagen über die konkrete Anzahl von Wörtern problematisch,angemessener ist dagegen der relative Vergleich. Als unproblematisch schätze ich denrelativen Vergleich innerhalb eines Landes ein, aber auch zwischen verschiedenen Län-dern ist er durchaus möglich. Hier sollten jedoch eher Muster der Aufmerksamkeit undkeine absoluten Zahlen verglichen werden. Alles in allem sind die Unterschiede zwischen
49 Was in der computergestützten Inhaltsanalyse bedeutet, die häufig in einer Sprache vorkommendenWörter (»stopwords«), sowie Zahlen, Satzzeichen und Großschreibung zu entfernen.
5 Forschungsfrage, Daten und Fallauswahl 44
den Ländern häufig so deutlich ausgefallen, dass sie nicht nur auf falsche Messung zu-rückzuführen sind. Schon während der Analyse habe ich versucht, immer wieder in dieOriginaltexte zu schauen und Fehlerquellen aufzuspüren. Aus diesem Grund sind dieInhaltsanalysen derjenigen Länder, die in der zweiten Analyse untersucht wurde, mitSicherheit valider, als die jener Länder, die nur quantitativ untersucht wurden.
6 Wann das Klima in die Politik kam 45
6 Wann das Klima in die Politik kamZunächst einmal ist die Ausgangssituation und quantitative Dimension zu klären. Wanngenau beginnen Parteien überhaupt über den Klimawandel zu sprechen? Wann tauchtdas Thema das erste Mal auf und welchen Anteil nehmen diese Aussagen im Verhältnis zuanderen ein? Umweltpolitik blieb, wie oben angedeutet, immer erklärungsbedürftig. Esist anzunehmen, dass über gelöste Probleme irgendwann einfach nicht mehr gesprochenwird (dies ist beispielsweise beim Ozonloch der Fall) – eine stetige Thematisierung odergar eine Zunahme würde dann tendenziell dafür sprechen, dass es sich weiterhin um einProblem handelt, über das es sich zu sprechen lohnt, weil noch nicht alles entschiedenist.50
Abbildung 1: Karriere des Klimawandels als Thema politischer Kommunikation
0.000
0.002
0.004
0.006
1980 1990 2000 2010
Jahr
Ant
eil d
er A
ussa
gen
über
den
Klim
awan
del
Abbildung 1 und 2 zeigen die durchschnittlichen klima- bzw. umweltpolitischen Aussa-gen über alle Länder pro Jahr. Die Linie markiert einen Durchschnitt über Zeit, um dieAusreißer, die durch einzelne Wahlen in klimapolitisch aktiven Ländern zustande kom-
50 Eine Untersuchung des deutschen Konflikts über die Atomkraft scheint das zu bestätigen (Roose2010).
6 Wann das Klima in die Politik kam 46
Abbildung 2: Karriere der Umwelt als Thema politischer Kommunikation
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
1980 1990 2000 2010
Jahr
Ant
eil d
er A
ussa
gen
über
Um
wel
t
men, auszugleichen. Die absolute Anzahl der Aussagen lässt sich zwar nicht miteinandervergleichen, da die Daten einmal auf Wortebene (Klima) und einmal auf Satzebene (Um-welt) erhoben wurden. Ein Vergleich der Muster ist jedoch vielsagend. In der Kommuni-kation über Klima (Abbildung 1) und über Umwelt (Abbildung 2) zeigen sich deutlichandere Entwicklungen. Während umweltpolitische Aussagen nach den 1990ern abnehmenund dieses Niveau danach nicht wieder erreichen, liegt der Höhepunkt klimapolitischerKommunikation zwischen 2005 und 2010. Nach 2010, und vermutlich verbunden mit derFinanz- und Wirtschaftskrise, ist das Thema deutlich seltener in Wahlprogrammen zufinden. Der Klimapolitik-Höhepunkt fällt also nicht mit dem Umweltpolitik-Höhepunktzusammen. Oder, anders gesagt: Der Klimadiskurs verläuft nicht parallel zum Umwelt-diskurs und lässt sich damit nicht allein über die Dynamik umweltpolitischer Aussagenerklären.Im Vergleich der Länder untereinander zeigen sich deutliche Unterschiede. Generell
lassen sie sich dahingehend unterscheiden, ob es zu einem Anstieg klimapolitischer Aus-sagen kommt und wie stark sich die Parteien unterscheiden. Deutliche Steigerungenzeigen sich in den skandinavischen Ländern, mittlere in Deutschland, der Schweiz und
6 Wann das Klima in die Politik kam 47
Großbritannien, geringe in den Niederlanden, Frankreich, Irland und Österreich und äu-ßerst geringe bis gar keine in Spanien, Italien, Kroatien und Polen. Interessanterweiseweisen gerade die Länder mit vielen klimapolitischen Aussagen eine starke Differenz zwi-schen den einzelnen Parteien auf (siehe die skandinavischen Länder).51Es handelt sichim übrigen um keinen linearen Prozess: Länder, in denen der Klimawandel bereits in den1980er Jahren eine Rolle spielt (Deutschland, Österreich, Norwegen und die Schweiz), ge-hören im Jahre 2010 eher zur Mittelgruppe. Gerade in Schweden und Dänemark kommtes Anfang der 2000er zu einem sehr starken Anstieg.
51 Eine Erklärung für dieses Phänomen wäre umso interessanter, als gerade diese Ländern häufigKoalitions- und Minderheitenregierungen aufweisen und die Parteienkooperation relativ hoch ist.
6 Wann das Klima in die Politik kam 48
Abbildung 3: Karriere des Klimawandels über Länder
Dänemark Deutschland
Frankreich Großbritannien
Irland Italien
Kroatien Niederlande
Norwegen Österreich
Polen Schweden
Schweiz Spanien
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
1980 1990 2000 2010 1980 1990 2000 2010
Jahr
Ant
eil d
er A
ussa
gen
über
den
Klim
awan
del
7 Wie das Klima in die Politik kam 49
7 Wie das Klima in die Politik kamDiese erste Untersuchung hat uns nur einen groben Hinweis darauf gegeben wie derKlimawandel sich als Thema in der Politik entwickelte. Dies sagt jedoch noch nichtsüber die Problemformulierungen als solche aus. Die Komplexität von Entscheidungssi-tuationen wird durch sachliche, zeitlich und soziale Faktoren bestimmt. In Kapitel 3.2wurde bereits eine Operationalisierung komplexer Entscheidungssituationen entwickelt.Sie zeichnen sich demnach durch Anzahl, Verschiedenartigkeit und Interdependenz derAlternativen und Rollen aus. Dies ist eine mehrdimensionale Operationalisierung undschränkt die möglichen Vergleiche auf die einer Entscheidungssituation zu unterschied-lichen Zeitpunkten ein. Nur bei einer solchen Untersuchung kann gezeigt werden, dassAlternativen zunehmen und plötzlich andere Personen berücksichtigt werden. Meine An-nahme war, dass sich diese Struktur der Entscheidungssituation auch in der semantischenStruktur des Themas zeigt, die in den Wahlprogrammen der Parteien sichtbar wird.Für sechs Länder (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Kroatien, Österreich und
die Schweiz) werde ich die Aussagen über den Klimawandel in einer zweiten Analyse hin-sichtlich ihrer Sachdimension (welche Politikgebiete werden als Ursache oder Instrumentgenannt, in welche Bereiche fallen die Konsequenzen?), ihrer Sozialdimension (welcheEntscheider, Verursacher und Betroffene werden genannt?) und Zeitdimension unter-suchen. Ich möchte diesem Ansatz mit Deborah Stone noch eine weitere Dimensionhinzufügen: die Kausalmuster, die sich in den jeweiligen Aussagen zeigen (Stone 1989).Beziehungen zwischen Ursachen und Wirkungen sind nicht objektiv, sondern werdenkommunikativ konstruiert (Luhmann 1995). Ich gehe davon aus, dass sich die sachlicheund soziale Komplexität des Klimawandels auch in der Entwicklung unterschiedlichercausal stories zeigen würde. Für Stone ist der Streit über Kausalitäten wesentlich fürdie politische Auseinandersetzung al solche:
»(A)ctors seeking to define a problem attempt to push the interpretation ofa bad condition out of the realm of accident and into the realm of humancontrol. [. . . ] People blamed for a problem and saddled with the burden ofreform will resist the new causal theory [. . . ] by portraying the conditionas accidental, as caused by someone else, or as one of the indirect form ofcausation.« (Stone 1989, 299)
Sie unterscheidet vier Kausalmuster, deren sich politische Akteure bedienen: Mechanis-mus, Unfall, Absicht und Versehen. Mit dieser vierfachen Unterscheidung können sowohl
7 Wie das Klima in die Politik kam 50
Aussagen darüber gefasst werden, ob es sich beim Klimawandel überhaupt um ein poli-tisches Problem handelt (oder die Problemdefinition als solche umstritten ist), als auchdarüber, wie vermittelt es politischem Handeln zugänglich ist (Mechanismus oder Ab-sicht?). Darüber hinaus wird sichtbar, in welchen Politik- oder GesellschaftsbereichenParteien Ursachen, Folgen und Alternativen (sachlich) oder Entscheider, Verursacherund Betroffene (sozial) des Klimawandels verorten. In einer komplexen Entscheidungssi-tuation, so die Annahme, würden sich über die Zeit sehr unterschiedliche Kausalmusterherausbilden, Rollen, Ursachen, Folgen und Alternativen pluralisieren und differenzierensich aus.Ich gehe von vier Hypothesen aus:
1. Da es sich um Wahlprogramme handelt wird erwartet, dass Parteien sich selbst(und andere politische Organisationen) als bewusste Akteure mit intendiertenHandlungszielen beschreiben (Dies entspricht Stones intentional cause oder Luh-manns Definition von Handeln (Luhmann 1981)).
2. Parteien unterschiedlicher Ideologien wählen unterschiedliche Beschreibungen desProblems, d.h. die Akteure, Ursachen und Folgen, sowie Kausalmuster unterschei-den sich.
3. Es wird erwartet, dass sich die Akteure und Folgen über die Zeit vervielfältigen,d.h. dass die Entwicklung einer komplexen Entscheidungssituation mit kausalenAnknüpfung an immer mehr gesellschaftliche Bereiche einhergeht. Klimawandel istdann nicht mehr nur ein wissenschafts- oder umweltpolitisches Anliegen, sondernauch ein wirtschaftliches, politisches und sogar rechtliches Problem.
4. Die Entwicklung einer komplexen Entscheidungssituation bedeutet auch eine Flex-bilisierung der Kausalrichtung: Der Klimawandel selbst kann mittlerweile als Ur-sache für wünschenswerte Entwicklungen verstanden werden, Klimawandel kannnützlich sein um gewisse Ziele zu erreichen. Es findet eine Pluralisierung der Kau-salbeziehungen statt.
Jede Aussage über den Klimawandel, die in den Wahlprogrammen der genannten Länderzwischen 1980 und 2013 auftaucht, wurde untersucht und nach politischer/nicht poli-tischer Akteur/Bereich, Kausalmuster, Mittel und politische/nicht politische Folge ko-diert. Die Entwicklung des Codes geschah in Auseinandersetzung mit den Daten und dentheoretischen Vorannahmen. Theoretisch hätte der Code beliebig erweitert und beliebig
7 Wie das Klima in die Politik kam 51
spezifisch werden können und damit eine noch weitergehende Differenzierung sichtbargemacht.52 Es gibt keinen theoretischen Grund dafür, die Maßnahme ›Emissionshandel‹zu kodieren, nicht aber die ›Gebäudesanierung‹. Aus praktischen Gründen konnte dieAusdifferenzierung nicht bis in die feinsten Alternativen hinein verfolgt werden. Aller-dings geht es an dieser Stelle ja auch nicht um eine möglichst detailliert Abbildung,sondern um das Nachvollziehen der semantischen Ausdifferenzierung eines Themas.
Tabelle 1: Kodierung der Aussagen zum Klimawandel nach Kausalmustern und Di-mensionen
Entscheider & Betroffene Ursachen & Folgen Eile & Weile
Absicht Internationale Partner, Ent-wicklungsländer
Maßnahmen, Instrumenteund politisches Handeln
Zeitpunkte, Deadlines, Pha-sen
Katastrophe Betroffene, Hilfsbedürftige Bedrohung, Anpassung Hysterie, Alarmierung
Versehen Andere Parteien, Industrie,Bevölkerung
Wirtschaft, Konsum Zeitvergeudung, überstürz-tes Handeln, Prioritätenset-zung
Mechanismus Nutzbarer Klimawandel,Klimawandel als Täu-schungsmanöver
Da es mir nicht in erster Linie um nationale Eigenheiten des Diskurses, sondern umeine Entwicklung des semantischen Feldes geht, ist das Kapitel nicht nach Ländern,sondern nach Dimensionen der Entscheidungssituation (sachlich, sozial und zeitlich) undden dazu querstehenden Kausalmustern strukturiert. An dieser Stelle ist auch noch einHinweis zu den Vor- und Nachteilen der Dichtegrafiken (›density plots‹) angebracht,die zur Darstellung der Ergebnisse genutzt werden. Dichtegrafiken sagen nichts über dieHäufigkeiten, sondern über die Verteilung von Merkmalen aus. Insofern eignen sie sichgut, um die Entwicklung von Verteilungen über die Zeit – und damit das Hauptanliegendieses Kapitels: die Ausdifferenzierung eines Themas – darzustellen. Ein unmittelbarerNachteil ist jedoch, dass die Daten modelliert werden und die Grafiken keine direktenAussagen mehr darüber zulassen, wie viele Fälle überhaupt zu Grunde liegen. Gerade inden 1980er Jahren sind die untersuchten Aussagen jedoch so gering (siehe Abbildung 3),dass auf eine Darstellung für die einzelnen Länder verzichtet werden muss. Sofern sichBesonderheiten zwischen Parteien und Ländern zeigen, werden diese im Text genannt.
52 Auch hier zeigt sich das Auflösungsproblem der Komplexitätstheorie, siehe Kapitel 8.
7 Wie das Klima in die Politik kam 52
7.1 Sachlich: Ursachen und Folgen
Allgemein gilt: Der anthropogene Klimawandel war und ist in den Wahlprogrammen53
der sechs Länder nicht umstritten. Eine grundlegende Problembeschreibung, die Ge-schichte des Treibhauseffektes, zieht sich durch alle Wahlprogramme.54 Dass Klimawan-del als Folge des Ausstoßes von Treibhausgasen geschieht, ist nicht umstritten. Damit istnicht nur das Problem grob definiert, sondern auch eine Lösung benannt: die Reduktiondieser Gase. Beim Klimawandel handelt es sich damit in erster Linie – und zumindestnoch auf dieser grundlegenden Ebene, aber auch das wird viel zu selten erwähnt – umdas seltene Phänomen einer geteilten Problembeschreibung. Es darf bezweifelt werden,ob Parteien unterschiedlicher Länder sich beispielsweise über Definition, Ursache undBekämpfung von Armut annähernd einig sein würden. Damit ist nicht behauptet, dassder Klimawandel sich einfach lösen ließe, sondern im Gegenteil, dass er auf dem Wegist, ein »per se unlösbares Problem« zu werden: ein Wert, zu dem sich alle bekennen(Luhmann 1999, 19).55
Diese geteilte sachliche Problembeschreibung hängt sicherlich zum Teil damit zusam-men, dass sie wissenschaftliche legitimiert ist. Aber auch in den 1980er Jahren, vor derGründung des IPCC und des überwältigenden wissenschaftlichen Konsens, gab es kaumzweifelnde Aussagen. Die zurückhaltendste Aussage über die möglichen Ursachen desKlimawandels findet man im Wahlprogramm der deutschen FDP 1980: »Die Verbren-nung von Erdöl, Erdgas und Kohle, der Gebrauch von Fluor-Chlor-Kohlenwasserstoffen,z. B. in Spraydosen oder das Abholzen großer Waldgebiete inner- und außerhalb Europaskönnen zu unübersehbaren Gefahren der Klimaveränderung bis hin zur Veränderung un-serer Atmosphäre führen.« (Hervorhebung D.R.) Und: »Wir fordern die Untersuchungder Auswirkungen dieser Gefahren und die Erarbeitung notwendiger Gegenmaßnahmen,
53 Die Betonung liegt hier tatsächlich darauf, dass nur die Kommunikation in den Wahlprogrammen un-tersucht wurde. Bei SVP, FPÖ und Front National (Jean Marie Le Pen:»Pendant que les réchauffistess’agitent, il fait -35◦C à Moscou«) gibt es Hinweise darauf, dass sie teilweise den anthropogenen Kli-mawandel leugnen. Interessanterweise zeigt sich das nicht explizit in ihren Wahlprogrammen. Mehrdazu in Abschnitt 7.4.
54 Damit handelt es sich nach Roberts (2010) schon nicht mehr um ein wicked problem.55 Das, wozu sich alle bekennen, ist die Jahrhundertherausforderung Klimawandel: »Catastrophic cli-
mate change is the greatest man-made threat to the planet (...).« (LibDem 2005); »Klimatske promje-ne problem su hrvatskog druztva koliko i cijeloga sveta [Der Klimawandel ist das Problem Kroatiensgenauso wie der ganzen Welt.]«(81711 2011), »Dans le même temps, le changement climatique lanceà notre planète un défi sans précédent.«(31626 2007), »Lutter contre le changement climatique, prio-rité des priorités.« (31626 2007), »Weil die drohende Klimakatastrophe zum dringendsten Problemder nächsten Jahre werden wird, sind folgende Maßnahmen unverzichtbar (...).« (Die Grünen 1990).Dies nur eine kleine Auswahl aus sehr vielen Aussagen.
7 Wie das Klima in die Politik kam 53
die weltweit getroffen werden müssen.« Diese beiden Aussagen aus demselben Wahl-programm sind die einzigen, aus denen sich eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich derUrsachen und Folgen des Klimawandels herauslesen lässt. Es gab also einen kurzenMoment in den 1980er Jahren, als die sachlichen Zusammenhänge zumindest für ei-ne Partei noch unsicher und erforschungsbedürftig waren. Zum Vergleich steht für dieCVP (1990) fest: »Die bedenkenlose Nutzung von fossilen Brennstoffen führt zu Klima-veränderungen unabsehbaren Ausmaßes (Treibhauseffekt).«. Freilich könnte dies auchbedeuten, dass nur die deutsche FDP in ihrem Wahlprogramm Platz für etwas opfer-te, das noch nicht einmal wissenschaftlich gesichert erschien. Aussagen aus den 1980erJahren machen nur einen winzigen Teil meiner Analyse aus. In diesen frühen Aussagenfinden sich oft noch Erklärungen der wissenschaftlichen Zusammenhänge: Was bedeu-tet »the so-called ›green-house effect‹« (Conservatives 1987)? Warum kann man CO2
nicht herausfiltern? Die wissenschaftliche Begründung selbst wird erst in den 2000ernzu einem Thema und zu einem Anlass, sich politisch zu positionieren – unabhängig da-von, ob im eigenen Land ein parteiübergreifender Konsens herrscht: »WE OPPOSE:Ignoring climate change«(LibDems 2005), »We are convinced of the science of globalwarming.«(Labour 2001); »We will continue to lead internationally on climate change,and to strive for wider acceptance of the science and the steps needed to combat theproblem.«(Labour 2005).Neben dieser geteilten Grundlage der Problembeschreibung wird eine sehr starke Aus-
differenzierung der sachlichen Bereiche deutlich, die von Klimapolitik betroffen sind.56
Dies zeigt sich, mit gewissen zeitlichen Verschiebungen, in allen Ländern. Zu Beginn sindes vor allem unspezifische Willensäußerungen57 oder Aufzählungen von Umweltproble-men, die generell bearbeitet werden müssen58. Als eine der ersten Maßnahmen werdenSteuern genannt, in Großbritannien schon in den 90ern das Emissionshandelssystem59.Generell ist es vor allem die Energiegewinnung, später auch Landwirtschaft, Verkehr,
56 Abbildung 4 ist so zu lesen, dass sich die Flächenveränderung einer Maßnahme nicht absolut, sondernnur relativ mit anderen Maßnahmen vergleichen lässt. Allgemeine Aussagen zum Klimawandel (hierdunkelbraun) sind über die Zeit relativ gleich verteilt, während Aussagen über Wissenschaft undTechnologie eher zu Anfang des Diskurses auftraten. Noch einmal: Es handelt sich hier nicht umHäufigkeiten. Aussagen über allgemeine Maßnahmen treten generell am häufigsten auf.
57 Für Frankreich durchaus am Beginn der klimapolitischen Debatte: »Pollutions maritimes, sonores,chimiques, agricoles, dégradations de l’espace naturel de paysages, effets de serre seront combattus,leurs auteurs pénalisés et punis.«(Parti Socialiste 2002)
58 »L’écologie n’est pas un luxe. La qualité de l’eau, de l’air, de l’alimentation, la lutte contre le bruit,contre l’effet de serre, pour des villes humaines: toutes ces questions sont vitales.«(Les Verts 2002)
59 »We wish to see a world market in tradable emission licences for carbon dioxide and other pollu-tants.«(LibDems 1992)
7 Wie das Klima in die Politik kam 54
Gebäude und allgemeine Konsumgüterproduktion, bis hin zu Kulturwirtschaft, Kücheund Sport60 in denen Maßnahmen empfohlen werden.
Abbildung 4: Dichteverteilung der Maßnahmen
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Jahr
Dic
hte
der
Aus
sage
n
Maßnahmen
Anpassung
Emissionshandel
Technologie/Wissenschaft
Gerechtigkeit
Mobilität/Verkehr
Landwirtschaft
Energie
wirtschaftlich
rechtlich
allgemein
Es zeigen sich keine klaren parteifamilienspezifischen Unterschiede. Bei grünen und lin-ken Parteien wird Gerechtigkeit tendenziell nicht nur als Ziel, sondern auch als Maßnah-me verstanden, das Klima zu schützen.61 Wirtschaftsliberale Parteien wie die deutsche
60 Letztere sind nur einige Beispiele für das Klima-Mainstreaming, wie es insbesondere von den deut-schen Grünen betrieben wird: »Wir stärken deshalb die regionale und saisonale Küche. Das schmecktnicht nur gut, sondern ist auch besser für Umwelt und Klima.«, »Potentiale des Sports für Umwelt-und Klimaschutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt gilt es stärker zu nutzen.«, »Deshalbsetzen wir uns für eine Initiative ›Klimaneutrale Rechenzentren für Deutschland‹ ein.« und »Wirunterstützen die Ökologisierung der Kulturwirtschaft, von der klimaschonenden Produktion überCO2-neutrale Transporte, giftfreie und wiederverwendbaren Werkstoffe bis hin zu nachhaltigem Ca-tering.« (alles Bündnis 90/Die Grünen 2013)
61 Klimaschutz in einem größeren Zusammenhang globaler Gerechtigkeit: »Le projet écologiste réaf-firme une vision mondiale de la question liée aux déséquilibres économiques mondiaux et déjà auxchangements climatiques et prône une politique d’immigration ouverte et humaniste permettant uneautre approche des rapports Nord-Sud que la guerre aux migrants que mène actuellement l’Unioneuropéenne.«(Les Verts 2012), »Klimaschutz ist ein Schlüssel für mehr Gerechtigkeit, global undlokal.« (B90/Die Grünen 2009)
7 Wie das Klima in die Politik kam 55
FDP sprechen dagegen häufiger über neue Technologien und marktwirtschaftliche In-strumente wie den Emissionshandel. Deutlicher als parteifamilienspezifische Klimaprofi-le zeigt sich jedoch eher ein Unterschied zwischen Parteien, die häufig und differenziertüber den Klimawandel schreiben, und Parteien, die nur wenig und allgemeine Aussagentreffen.
7.2 Sozial: Entscheider und Betroffene
Im Klimadiskurs werden nicht nur verursachende und betroffene Politikbereiche, son-dern auch Akteure und Betroffene identifiziert. Die Akteure werden in erster Linie inder Politik lokalisiert – meistens national, zunehmend aber auch international und seitneuestem (vor allem in Deutschland und Großbritannien) auch kommunal (siehe Abbil-dung 5). Die Entscheidungssituation, die relevanten Akteure, Verursacher und Betroffenewaren lange Zeit national bestimmt, mittlerweile scheint es tendenziell eine Entwicklungzu internationalen Aussagen über alle Parteien und Länder hinweg zu geben.Auch nicht politische Akteure, insbesondere die Wirtschaft als Verursacher, wurde
genannt. Während Aussagen über die Energiewirtschaft eher in den frühen Jahren desDiskurses auftreten, treten Aussagen über Landwirtschaft und Verkehr verstärkt in denletzten zehn Jahren auf. Im Fall der Wirtschaft kann man nicht davon sprechen, dass eseine eindeutige Spezifizierung der Aussagen gegeben habe. Die Energiewirtschaft wurdevon Anfang an als Akteur genannt, neben sie traten lediglich weitere hinzu. Ähnlicheszeigt sich auch bei der Nennung der eigenen Bevölkerung bzw. der Weltbevölkerung alsVerursacher des Klimawandels. Auch hier gehen die Aussagen nicht von der Welt- zurnationalen Bevölkerung, sondern setzen bereits bei der eigenen Bevölkerung an. Andersstellt es sich dar, wenn die Betroffenheit des Klimawandels verhandelt wird. Hier trittdie Möglichkeit einer eigenen Betroffenheit erst relativ spät auf.Betroffenheitsaussagen sind zu einem großen Teil Gerechtigkeitsaussagen. Es gibt zwei
verschiedene Anwendungen der Unterscheidung von Verursachern und Betroffenen. Ei-ne folgt dem Kyoto-Frame von Verursacherländern (»Annex-I-Staaten«) und Entwick-lungsländern, wobei sich letztere noch einmal in verursachende Entwicklungsländer undbetroffene Entwicklungsländer unterteilen lassen. Eine zweite Anwendung der Unter-scheidung Verursacher/Betroffene zielt auf die nationale Bevölkerung und unterscheidetVerursacher des Klimawandels und Betroffene des Klimaschutzes innerhalb der eigenenNationalstaatsgrenzen (so beispielsweise die Idee eines »Klimawohngeldes« für Betroffe-ne der hohen Strompreise und Sanierungskosten). Aussagen über die Betroffenheit dernationalen Bevölkerung sind zwar gestiegen, gleichzeitig aber auch Aussagen über die
7 Wie das Klima in die Politik kam 56
Abbildung 5: Dichteverteilung der Akteure
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Jahr
Dic
hte
der
Aus
sage
n
Akteure
Klima
Mobilität/Verkehr
Wirtschaft: Landwirtschaft
Wirtschaft: Energie
Wirtschaft: allgemein
Bevölkerung: national
Bevölkerung: Welt
Politik: international
Politik: national
Politik: kommunal
Betroffenheit von Menschen anderer Staaten. Die beiden betroffenen Gruppen werdenalso nicht gegeneinander ausgespielt, sondern sind Teil derselben Erzählung über Klima-gerechtigkeit und -anpassung. Klimagerechtigkeit ist ein Thema, das deutlich mehr vongrünen und linken Parteien aufgegriffen wird.Das Klima selbst tritt meistens als Objekt (hier: Betroffener) auf. Abbildung 5 zeigt
jedoch, dass auch die Beschreibung des Klimawandels als Akteur zunimmt. Zum Teilsind dies Aussagen über die katastrophalen Folgen des Klimawandels für die Umwelt. Einzweiter Teil betrifft die Nutzbarmachung des Klimawandels und wird unter Abschnitt7.4 beschrieben.
7.3 Zeitlich: Eile und Weile
Aussagen über Zeitverhältnisse spielen eine wichtige Rolle in der Klimadebatte. Sie lassensich jedoch nicht so einfach ›kodieren‹, wie genannte Alternativen oder Rollen. Parteienreferieren jedoch regelmäßig auf Ereignisse und Zeitpunkte, insbesondere auf interna-tionale Konferenzen oder auf Daten, die ein bestimmtes Emissionsreduktionsziel mar-
7 Wie das Klima in die Politik kam 57
kieren. Das, was politisch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt nötig und möglich ist,erscheint häufig international synchronisiert. Das 2◦C-Ziel, diese magische Grenze, diedas IPCC aus einer Masse von Modellen und Simulationen herausdestilliert und gesetzthat, fungiert häufig als Referenzpunkt. Allerdings nicht immer in dem Sinne, dass esfür politisches Handeln danach »zu spät« wäre. Gerade in den neueren Wahlprogram-men seit 2009 geht es auch um eine Anpassung an die globale Erwärmung: »Doch auchwenn dies gelingt [das 2◦C-Ziel zu erreichen — D.R.], werden erhebliche Maßnahmenzur Anpassung an die Klimaveränderungen nötig sein, erst recht, wenn wir die 2 Gradüberschreiten.« (Bündnis 90/Die Grünen 2013)Zeit ist in einem zweiten Sinne bedeutsam: Die meisten Aussagen über den Klima-
wandel implizieren eine gewisse Eile, mit der die Entscheidungen getroffen werden sollen.Schließlich verstehen alle Parteien den Klimawandel auch als potentielle Katastrophe.Deutlich wird dies an der Forderung, bestimmte Maßnahmen ›jetzt‹ oder ›sofort‹ um-zusetzen (»Klimaschutz-Offensive jetzt umsetzen«, SPÖ 2002). In der Regel möchtenalle Parteien so schnell wie möglich handeln, alles andere würde vermutlich auch Zweifeldaran wecken, ob überhaupt gehandelt werden soll. Aus diesem Grund sind Aussagen,die zu einer langsamen Klimapolitik aufrufen, sehr selten. Zuweilen behaupten Partei-en einen Zeitunterschied zu anderen Parteien. Wenn beispielsweise andere Parteien als›hysterisch‹ oder die eigenen Anstrengungen als ausreichend bezeichnet werden (beidesSVP 2011 und 2007). Diese Aussagen kommen einer Forderung nach ›Verlangsamung‹am nächsten. Umgekehrt weist die Opposition gerne darauf hin, dass in den Jahren unterder jeweiligen Regierung zu wenig für den Klimaschutz getan worden sei: »Beim Klima-schutz darf nicht länger Zeit durch Untätigkeit verloren werden.« (SPÖ 2002 – ein Bei-spiel unter vielen anderen) Es dominiert also eine Sprache, die auf die Dringlichkeit desProblems hinweist; wobei man sich gerne gegenseitig unterstellt, der Dringlichkeit nichtgerecht zu werden. All dies ist jedoch eher mit der Logik des politischen Wettbewerbsverbunden und verdichtet sich nicht zu einer Eigenschaft dieses spezifischen, verzwick-ten Problems Klimawandel. In der zeitlichen Komponente zeichnen sich – wiederum mitAusnahme der SVP – keine Unterschiede zwischen den Parteien ab. Sie referieren aufdieselben zeitlichen Orientierungspunkte oder sind sich zumindest einig darin, dass dieZeit drängt.
7.4 Kausalmuster
Wenig überraschen ist das mit Abstand häufigste Kausalmuster das intendierte politi-sche Handeln, mit oder ohne Nennung einer spezifischen Maßnahme, wie sie unter der
7 Wie das Klima in die Politik kam 58
sachlichen Dimension dargestellt wurde. Es handelt sich außerdem um ein Muster, dasüber die Zeit zunimmt (siehe Abbildung 7). Den Klimawandel als unintendierte Folgemenschlichen Handelns zu beschreiben (Versehen), ist dagegen eher selten und zeitlichgesehen eine frühe Form der Kommunikation über Klimawandel. Es zeigt sich in all denAussagen, die einen ersten, vorsichtigen Zusammenhang zwischen menschlichem Handelnund Klimaveränderung konstatieren.
Abbildung 6: Häufigkeit der Kausalmuster
1_Mechanismus 2_Katastrophe
3_Absicht 4_Versehen
0
100
200
300
400
0
100
200
300
400
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Jahr
Anz
ahl d
er A
ussa
gen Kausalmuster
Mechanismus
Katastrophe
Absicht
Versehen
Das zweithäufigste Kausalmusters ist das des Unfalls oder der Katastrophe. Es ist einMuster, das die Kommunikation über Klimawandel von je her begleitet. Im Gegensatz zuStones Annahme wird die Katastrophenhaftigkeit des Klimawandels nicht als Gegensatzzu einer menschlichen Verantwortung gesehen, beide Kausalmuster tauchen gemeinsamauf. Die Folgen des Klimawandels sind unvorhersehbar und katastrophal — die Vermei-dung des Klimawandels ist aber immer noch eine politische Möglichkeit. Meistens han-delt es sich beim Klimawandel als Katastrophe um generelle Aussagen der Bedrohungdurch globale Erwärmung. Nur selten wird der Klimawandel als Bedrohung für einenbestimmten Gesellschaftsbereich wie Wirtschaft, Energiesektor oder Landwirtschaft be-
7 Wie das Klima in die Politik kam 59
griffen. In den letzten zehn Jahren rückten auch verstärkt Gruppen in den Fokus, diebesonders vom Klimawandel betroffen sind. Ähnlich wie der Gerechtigkeitsdiskurs han-delt es sich auch hier um Aussagen, die verstärkt von grünen und linken Parteien getätigtwerden. Sie wählen drastischere Begriffe und zeichnen katastrophalerer Folgen.62 In die-sem Rahmen tauchte auch ein ganz neuer Aspekt auf: Neben dem Ziel der Vermeidungwird zunehmend auch von einer Anpassung an den Klimawandel gesprochen. Es verstehtsich von selbst, dass eine solche Anpassung eigentlich ein neues Bezugsproblem ist, dasandere Maßnahmen verlangt. Bisher sind die Aussagen über Anpassungsmaßnahmen inder Minderheit, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sie in Zukunft wichtiger werden.Die Dichteverteilung (siehe Abbildung 7) lässt wie gesagt keine Aussage über die Häu-figkeit der Kausalmuster zu, sondern über deren Verteilung über die Zeit. Während›Versehen‹ relativ gleich über die Zeit verteilt sind, zeigt sich bei ›Katastrophe‹ und›Absicht‹ eine mittlere, beim ›Mechanismus‹ eine starke Ungleichverteilung.Insbesondere beim ›Mechanismus‹ handelt es sich um ein Kausalmuster, das sich erst En-de der 1990er Jahre im politischen Klimawandeldiskurs entwickelt. Dieses Kausalmustertritt in drei Varianten auf:
• Die SVP spekuliert, dass es sich beim Klimaschutz um sozialistische Tarnung han-dele: »Unter dem Deckmantel des Umwelt- und Klimaschutzes droht die grössteUmverteilung von Wohlstand in der Geschichte der Menschheit – und eine neueWeltordnung, die die Freiheit des Einzelnen nach den Prinzipien des Sozialismusmassiv beschränken will.« (SVP 2011) Hier wird unterstellt, dass Klimaschutznicht das Ziel, sondern ein Mittel zur Durchsetzung einer anderen Weltordnungsei.
• Am anderen Rand des politischen Spektrums begreifen linke und sozialistischeParteien den Klimawandel teilweise als nahezu zwangsläufige Folge eines kapita-listischen Wirtschaftssystems.63
62 Siehe beispielsweise »Investitionen in Umwelt belohnen – ökologische Finanzrefor statt Klimakiller-Subventionen« (Bündnis 90/Die Grünen 2009), »Zu viel Chemie, zu viele Abgase, die unsere Luftverpesten, und dazu die globale Bedrohung durch den Treibhauseffekt. Wer davor die Augen ver-schließt, verspielt die Zukunft.« (Bündnis 90/Die Grünen 1997) »Die auffällige Häufungen klima-bedingter Katastrophen wie tropische Wirbelstürme, langanhaltende Dürren, u.a.m. können wirallabendlich in den Fernsehnachrichte verfolgen.« (Die Grünen 1995)
63 Obwohl die Übergänge vom ›Versehen‹ zum ›Mechanismus‹ oder der ›Absicht‹ hier schwer zu ziehensind: »Or le réchauffement climatique, la destruction de la biodiversité, l’épuisement rapide desressources naturelles ne sont pas des catastrophes d’origine naturelle, mais le résultat des logiquescapitalistes du profit maximal à court terme.« (Front de Gauche 2012), »Der Kapitalismus ist nichtnur sozial ungerecht und ein Motor der Klimakatastrophe.«(Die Linke 2009)
7 Wie das Klima in die Politik kam 60
Abbildung 7: Dichteverteilung der Kausalmuster
1_Mechanismus 2_Katastrophe
3_Absicht 4_Versehen
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010Jahr
Dic
hte
der
Aus
sage
n Kausalmuster
Mechanismus
Katastrophe
Absicht
Versehen
• Noch eindeutiger an einer mechanistischen Kausalkopplung ist die »ökologischeModernisierung«, wie sie in fast allen deutschen und britischen Wahlprogrammenseit 2005 Jahre auftaucht: Der Klimawandel kann nutzbar gemacht werden undeine Chance für die Wirtschaft sein.64 Diese Variante des mechanischen Kausal-musters ist mit Abstand am häufigsten. Die Einschätzung dieses Diskurses fälltinteressanterweise sehr unterschiedlich aus. Einerseits argumentieren Lorenzoni etal. (2008), die britische Klimapolitik habe auch darum so wenige zufriedenstellendeErgebnisse produziert, da »ecological modernization (...) undermines the politicalwill for radical thinking and action.« (Lorenzoni et al. 2008, 113) Im deutschenDiskurs wird jedoch gerade hervorgehoben, dass die deutsche »Vorreiterrolle« (was
64 Zum Konzept der ›ökologischen Modernisierung‹ allgemein: Hajer (1995), vgl. für Deutschland Weid-ner (2008, 11ff) und für Großbritannien Lorenzoni et al. (2008, 113ff), sowie Barry & Paterson (2003).Als Beispiel für viele weitere Aussagen seien hier zwei genannt: »Our response to climate changewill give the British people more secure energy supplies, reduce air pollution and related healthcosts and create thousands of new jobs.«(LibDem 2010), »Die FDP sieht Klimaschutzpolitik alsWettbewerbsmotor.«(dt. FDP 2009)
7 Wie das Klima in die Politik kam 61
auch immer man davon halten mag) mit der Durchsetzung dieses Diskurses überalle Parteien hinweg verbunden sei (Weidner 2008).
Es fällt auf, dass Länder, die relativ spät in den klimapolitischen Diskurs eingestiegensind, wie Kroatien, aber ansatzweise auch Frankreich, zwar ›zeitgemäße‹65 Aussagentreffen, aber keine ausdifferenzierte Kommunikation über Klimawandel aufweisen. DieAussagen bleiben dann häufig allgemein und falls spezifisch – passiv.Festzuhalten bleibt, dass sich die Unterschiede zwischen Ländern und Parteien größ-
tenteils im Detail zeigen. Der Klimawandeldiskurs ist in den von mir untersuchten Län-dern nicht von deutlichen, klar geschiedenen Konfliktlinien geprägt. Dies könnte dafürsprechen, dass die bedeutenden sozialen Konfliktlinien nicht national, sondern interna-tional verlaufen. Die Wahlprogramme beziehen sich jedoch auf eine nationale Entschei-dungssituation. Mit Blick auf den theoretischen Hintergrund dieser Arbeit könnte manauch argumentieren, dass es gerade ein Merkmal komplexer Entscheidungssituationenist, dass sich der ›Teufel im Detail‹ zeigt. Je detaillierter, desto bestimmter die Komple-xität einer Entscheidungssituation und desto selektiver die getroffene Entscheidung.Drei Parteien fallen aus der relativ differenzierten, einheitlichen Beschreibung des
Klimwandels heraus: SVP, FPÖ und Front National. In meiner Arbeit zeigt sich also,was Gemenis et al. (2012) für viele Parteien des rechten Randes gezeigt haben: Sie neigenzum ›anti-environmentalism‹. Deutlich wird dies jedoch weniger in explizit negativenÄußerungen66. Für Front National (keine Aussage) und FPÖ (eine Aussage67) ist derKlimawandel kein Thema; die SVP äußert sich skeptisch bis beschwichtigend. Sie lehntsowohl Steuern als auch Emissionshandel ab und lässt nur Atomkraft (2011) bzw. dieAnrechnung der Schweizer Wälder (2003) als klimapolitische Maßnahme gelten.
65 Etwa, wenn die HSS (Kroatische Bauernpartei) 2011 bescheiden fordert: »Republika Hrvatska moraspremno docekati uspostavu medunarodnog sustava trgovanja emisijama.[Kroatien muss bereit seinfür die internationale Einführung eines Emissionshandelssystems.]«.
66 Zumindest nicht in Wahlprogrammen, schon eher im Fernsehen und Zeitungen.67 Oder doch eher beiläufige Erwähnungn: »Die forcierte Erzeugung von Energie aus Biomasse bringt
beschäftigungspolitische Effekte mit sich, schont die Ressourcen, ermöglicht der Landwirtschaftzusätzliches Einkommen und leistet einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Klimastrate-gie.«(FPÖ 2002)
8 Zusammenfassung 62
8 ZusammenfassungDiese Arbeit hatte zwei Anliegen. Zunächst wurde theoretisch diskutiert, was es bedeu-ten kann, wenn von einem komplexen politischen Problem gesprochen wird. Im Rückgriffauf eine zirkulär formulierte Komplexitätstheorie wurde deutlich, dass Entscheidungs-und Verletzlichkeitstheorie als Linearisierung und Kausalisierung der Komplexitätstheo-rie verstanden werden können. Entscheidungstheorien betrachten Systemursachen undUmweltfolgen, Verletzlichkeitstheorien dagegen Umweltursachen und Systemfolgen. Inbeiden Fällen spielt Komplexität, jedoch vor allem verstanden als Umweltkomplexität,eine zentrale Rolle, ohne dass die gegenseitige Steigerung von Umwelt- und Systemkom-plexität ausformuliert würde. Vor diesem Hintergrund erscheint das changierende Kon-zept der wicked problems als Symptom, an dem die Grenzen dieser Linearisierung undKausalisierung sichtbar werden. Für bestimmte Fragen der Verletzlichkeitsforschung, fürdie Betrachtung einiger Entscheidungsprozesse mag es nützlich und angebracht sein, Ur-sachen bzw. Folgen in System bzw. Umwelt konstant zu halten. Geht es aber um dieFrage, wie Entscheidung oder Problembearbeitung in einer neuen (gesellschaftlichen!)Komplexitätslage überhaupt noch möglich ist, führt ein Problembegriff ohne Systemre-ferenz in die Irre.Stattdessen wurde – in Anlehnung an Luhmann – vorgeschlagen, von komplexen Ent-
scheidungssituationen zu sprechen, die Entwicklung einer solchen Situation und den Auf-bau von Komplexität zum Gegenstand der Forschung zu machen. Es geht mit anderenWorten darum, zu beobachten, wann wicked problems formuliert werden. Dieser Wech-sel der theoretischen Perspektive geht nicht zwangsläufig mit einer Relativierung oderTautologisierung in dem Sinne einher, dass komplex nun eben das ist, was als komplexbeschrieben wird. Das Erleben komplexer Probleme (und auch: zunehmend komplexerProbleme) wird nicht bestritten, sondern kann nun präziser reformuliert werden als Be-stimmung von Komplexität. Damit wird zunächst ein ambivalentes Verhältnis zur Rollevon Wissen in Entscheidungssituationen deutlich. Nicht Nichtwissen, sondern Wissen(um Alternativen, Kausalitäten, Rollen – und nicht zuletzt um Nichtwissen) macht eineEntscheidungssituation komplexer. Komplexität wird als Anzahl, Verschiedenartigkeitund Interdependenz von Elementen operationalisiert, die im Entscheidungsprozess inBetracht gezogen werden. Auch hiermit ist eine interessante Abweichung von gängigenBeschreibungen impliziert: Viele Vorschläge, die zur Bearbeitung oder Entscheidungsfin-dung des Klimawandels vorgebracht wurden, bedeuten eine Steigerung der Komplexität(so beispielsweise der Vorschlag von Paterson und Grubb (1992), nach unorthodoxen Ko-
8 Zusammenfassung 63
alitionen in der Klimapolitik zu suchen). Es scheint, Probleme werden zunächst durchAufbau von Komplexität bearbeitet und Entscheidungssituationen (nicht: Entscheidun-gen) zeichnen sich nicht in erster Linie durch Reduktion, sondern durch Steigerung derKomplexität aus.Anhand einer Untersuchung der politischen Kommunikation über Klimawandel in den
Wahlprogrammen europäischer Parteien wurde diese Steigerung der Komplexität nach-gezeichnet. Zwar handelt es sich bei Wahlprogrammen nicht um unmittelbare Kommu-nikation in Entscheidungssituationen, sie kann jedoch als eine Vorstrukturierung politi-scher Entscheidungssituation verstanden werden. Während die Aussagen über Umwelt-politik seit den 1980er Jahren kaum gestiegen sind, haben Aussagen über den Klimawan-del stark zugenommen. Es wurde deutlich, dass die (partei)politische Kommunikationüber den Klimawandel sich durch eine Ausdifferenzierung der Alternativen, Rollen undKausalmuster auszeichnet. Die Geschichte der politischen Beschreibung des Klimawan-dels lässt sich als eine Pluralisierung und Differenzierung sachlicher Alternativen, be-rücksichtigter Rollen und konstruierter Kausalmuster erzählen. Diese Entwicklung selbstist jedoch nicht parteigebunden, sondern findet, abgesehen von wenigen parteispezifi-schen Unterschieden, über alle Parteien hinweg statt. Als Ausnahmen traten rechtspo-pulistische Parteien hervor, die schon früher in den Fokus umweltpolitischer Forschunggerückt waren. In meiner Untersuchung haben diese Parteien sich entweder gar nichtgeäußert, oder eine skeptische Alternativerzählung entwickelt, die sich deutlich von an-deren Parteien unterscheidet. Darüber hinaus zeigen sich nur leichte Unterschiede in derSchwerpunktsetzung zwischen linken und rechten Parteien. Dies lässt darauf schließen,dass grundsätzliche Umstrittenheit kein zentraler Faktor in komplexen Entscheidungs-situationen ist. Die Umstrittenheit im Fall des Klimawandels zeigt sich größtenteils imDetail. Oder anders ausgedrückt: Es mag Einigkeit darüber bestehen, wann das Problemgelöst (sic!) wäre (radikale Reduktion der Emissionen), ohne dass es seine Bearbeitungeinfacher machte.Länder und Parteien lassen sich am deutlichsten danach unterscheiden, wie stark
ausdifferenziert die Kommunikation über den Klimawandel ist. Unter den hier unter-suchten Fällen stechen vor allem Deutschland und Großbritannien hervor. In diesenbeiden Ländern hat sich sowohl eine parteiübergreifende Beschreibung (im Unterschiedzu Österreich), als auch eine sehr detaillierte Kommunikation über den Klimawandel(im Unterschied zu Frankreich) entwickelt. Der Klimawandel spielt in mehr unterschied-lichen Bereichen eine Rolle, es werden mehr unterschiedliche Maßnahmen genannt undein neues Kausalmuster, das der Nutzbarmachung des Klimawandels, wurde entwickelt.
8 Zusammenfassung 64
In der Untersuchung wurden jedoch auch die Grenzen des Materials und der Metho-de deutlich. Vom mehrdimensionalen Konzept der Komplexität konnte vor allem diequantitative Seite, also die Anzahl der eingebrachten Alternativen und Rollen, beobach-tet werden. Schwieriger ist es schon bei der Verschiedenartigkeit und Interdependenz.Wie verhalten sich rechtliche und politische Maßnahmen zu Emissionshandel und demErneuerbare-Energien-Gesetz? Handelt es sich um eine Spezifizierung und sind die kon-kreteren Maßnahmen letztlich auch verschiedener? Viele parteipolitischen Unterschiedeliegen in feinen Details, aber spricht dies eigentlich für eine höhere Komplexität? Die-se Fragen verweisen auf deutliche Grenzen von Wahlprogrammen als Material für dieRekonstruktion eines politischen Diskurses und erst recht einer Entscheidungssituation.In Wahlprogrammen findet eher eine Auflistung der präferierten Alternativen statt, Ab-wägungen und Zusammenhänge lassen sich nicht herauslesen, sofern sie nicht explizitgemacht werden (und dies würde heißen: es müsste in der Adressierung des Publikumeine Bedeutung haben, es zu explizieren.68)Inwiefern kann man nun sagen, dass es sich beim Klimawandel um ein komplexes
politisches Problem handelt? Erinnern wir uns an Nicolis & Prigogine (1987), die Kom-plexität als eine Frage der Auflösung reformulierten. Meiner Ansicht nach gilt dies imdoppelten Sinne: In der Entscheidungssituation selbst erscheint die Frage der Auflösungals Grenze der Bestimmung unbestimmter Umweltkomplexität. Wie genau sollen Kostenund Risiko berechnet werden? Was gilt als Alternative und wie verschieden müssen diesesein, um einen Unterschied zu machen? Von welchen zeitlichem Horizont will man aus-gehen? Hier spielt eine Rolle, was Luhmann Ebenen genannt hat: Der Horizont, in demetwas überhaupt als Möglichkeit erscheint. Diese Fragen werden häufig schon durch dieWahl von Entscheidungsprämissen beantwortet. Auf dieser Beobachtungsebene (erster,bzw. zweiter Ordnung) scheint mir die Unterscheidung von einfachen und komplexenProblemen nutzlos zu sein. Diese Entscheidungssituationen zeichnen sich – zumindest,sofern sie zustande kommen, also überhaupt entschieden werden soll69 – immer durchAufbau von Komplexität aus, die getroffene Entscheidung wird erst durch kontingenteSelektion einer Alternative als Entscheidung sichtbar. Der Begriff der Entscheidung trägt
68 Ein Beispiel für die Entwicklung einer solchen Sichtbarmachung einer neuen Differenz zeigen meineDaten: Die explizite Äußerung, dass man den wissenschaftlichen Grundlagen Glaube schenkt (siehedie sachliche Dimension in Kapitel 7).
69 Auch darum muss die grundsätzliche Umstrittenheit (Roberts 2000) als Merkmal eines komple-xen Problems zurückgewiesen werden. Richtig ist, dass eine Entscheidung unter diesen Umständenschwieriger zu erreichen ist, weil die Situation gar nicht als Entscheidungssituation ausgeflaggt ist.Wenn es sich dabei um ein Problem handelt, dann jedoch eher um eines der Unterbestimmtheit vonKomplexität.
8 Zusammenfassung 65
Komplexität gleichsam in sich. Komplexität ist kein qualitatives, sondern ein quantita-tives Merkmal. Die Frage ist nicht ob eine Situation komplex ist, sondern wie sehr. Diepolitische Kommunikation über Klimawandel fügt sich nahtlos in diese Beschreibung:Dass Parteien beginnen, darüber zu sprechen, kommt der ersten, testweisen Definitioneiner Entscheidungssituation gleich. Das Wissen um Ursachen und Folgen des Klima-wandels nimmt zu, die Aussagen über Maßnahmen werden spezifischer. Damit ist jedochnoch nicht gesagt, dass es sich hierbei um ein Problem handelt, dass sich von anderenin der Politik formulierten unterschiede.Will man die Unterscheidung einfacher und komplexer Probleme bzw. Entscheidungs-
situationen gebrauchen, so muss dies auf einer anderen Beobachtungsebene, beispiels-weise der wissenschaftlichen Beschreibung von Entscheidungssituationen, geschehen.70
Doch auch hier stehen wir vor einem Auflösungsproblem: Wann beginnt eine Entschei-dungssituation und in welcher Zeiteinheit wollen wir sie denken? Von welchen sozialen(Individuen, Gruppen, Akteuren?) und sachlichen (Alternativen – aber wann unter-scheiden sie sich stark genug, um eine weitere Alternative zu sein?) Einheiten wollenwir ausgehen? Und inwiefern beschreiben wir damit mehr, oder wenigstens anders, alsdie Entscheidenden selbst? Und wenn es sich, wie wir oben gesehen haben, um eingraduelles, quantitatives Merkmal handelt, wie ließe sich daraus wissenschaftlich einqualitativer Unterschied gewinnen? Meiner Ansicht nach gibt es dafür bisher keinenplausiblen Ausgangspunkt. Rittel & Webber (1973) hatten sich ihre plakative Unter-scheidung von naturwissenschaftlichen tame und sozialplanerischen wicked problems miteiner niedrigen Auflösung der einen und einer höheren Auflösung der anderen erkauft.71
Genau darum kann für (Simon 1973) ein Schachspiel, verstanden als Abfolge von Ent-scheidungssituationen, komplex sein. Eine höhere Auflösung der zeitlichen Dimensionlässt mehr distinkte Zeitpunkte erscheinen, die voneinander abhängen. Luhmann gingdavon aus, dass ökologische Probleme sich dadurch auszeichnen, dass sie quer zur funk-tionalen Differenzierung liegen (Luhmann 2008). Auch dies scheint mir nicht überzeu-gend zu sein. Welches politische Problem beträfe nicht mehrere Funktionssysteme? Undist dieser wesenhafte Unterschied nicht wieder nur eine Frage der Auflösung? Ließe sichüberhaupt irgendeine Entscheidungssituation als einfach beschreiben (ohne rückblickendund von ihrem Ergebnis auszugehen)? Das Postulieren besonders komplexer Probleme
70 Oder, wie es ja tatsächlich bei den »grand challenges« stattfindet, als wissenschaftspolitische Mar-kierung gesellschaftlich relevanter Fragestellungen, von der man sich erhofft, dass sie – versüßt mitfinanziellen Mitteln und Prestige — zu einer erhöhten Resonanz in anderen Systemen führt.
71 Und das, obwohl sie das Auflösungsproblem selbst als Fehlen einer »stopping rule« (Rittel & Webber1973) beschrieben haben.
8 Zusammenfassung 66
bleibt möglich, setzt sich aber immer dem Vergleich und dem Anders-Sein-Können aus.Wir sind an dieser Stelle wieder am Anfang angekommen, denn auch hier handelt essich letztendlich um eine Reformulierung der Zirkularität der Komplexität. Und aucham Ende dieser Arbeit ist kein fester Stand in Sicht.Auch wenn das Klima so schnell nicht aus der Politik verschwindet: Seinen Höhepunkt
hat es möglicherweise schon überschritten. Und dies wirft ganz andere Fragen auf: Kanneinmal aufgebaute Komplexität wieder reduziert werden, und zwar nicht durch Entschei-dung, sondern gleichsam semantisch, durch ein Aussterben oder Vergessen der Alterna-tiven und Rollen? Kann die bekannte Welt, die man um sich herum in die unbekanntehinein zimmerte, wieder zu bloßer Welt werden, unbestimmt und rauschend?
Literatur 67
LiteraturAlbrecht, J. & Arts, B. (2005), ‘Climate Policy Convergence in Europe: An Assessment
Based on National Communications to the UNFCCC’, Journal of European PublicPolicy 12(5), 885–902.
Aleven, V., Ashley, K., Lynch, C. & Pinkwart, N. (2006), ‘Intelligent Tutoring Systemsfor Ill-Defined Domains’. Held during the 8th International Conference on IntelligentTutoring Systems Tuesday, June 27 Jhongli, Taiwan.
Andresen, S. & Agrawala, S. (2002), ‘Leaders, Pushers and Laggards in the Making ofthe Climate Regime’, Global Environmental Change 12(1), 41–51.
Arthur, W. B. (1994), Increasing Returns and Path Dependence in the Economy, Uni-versity of Michigan Press, Ann Arbor.
Baraldi, C. (1998), Komplexität, in C. Baraldi, G. Corsi & E. Esposito, eds, ‘GLU’,Suhrkamp, Frankfurt am Main, pp. 93–97.
Barry, J. & Eckersley, R. (2005), The State and the Global Ecological Crisis, MIT Press,Cambridge.
Barry, J. & Paterson, M. (2003), ‘The British State and the Environment: New La-bour’s Ecological Modernisation Strategy’, International Journal of Environmentand Sustainable Development 2(3), 237–249.
Bauman, Z. (2003), Flüchtige Moderne: Umrisse einer neuen Gesellschaftskritik, Suhr-kamp, Frankfurt am Main.
Beck, S. (2009a), Das Klimaexperiment und der IPCC: Schnittstellen zwischen Wissen-schaft und Politik in den internationalen Beziehungen, Metropolis, Marburg.
Beck, S. (2009b), Von der Beratung zur Verhandlung - Der Fall IPCC, in J. Halfmann& F. Schützenmeister, eds, ‘Organisationen der Forschung’, VS Verlag für Sozial-wissenschaften, Wiesbaden, pp. 120–144.
Beck, U. (1986), Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne, Suhrkamp,Frankfurt am Main.
Beck, U. (2008), Weltrisikogesellschaft: Auf der Suche nach der verlorenen Sicherheit,Suhrkamp, Frankfurt.
Literatur 68
Blumenberg, H. (2000), Die Vollzähligkeit der Sterne, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Bohle, H.-G. & Glade, T. (2008), Vulnerabilitätskonzepte in Sozial- und Naturwissen-schaften, in C. Felgentreff & T. Glade, eds, ‘Naturrisiken und Sozialkatastrophen’,Spektrum Akademischer Verlag, Berlin, pp. 99–120.
Bolin, B. (2007), A History of the Science and Politics of Climate Change: The roleof the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press,Cambridge.
Budge, I. & Laver, M. (1993), ‘The Policy Basis of Government Coalitions: A Compa-rative Investigation’, British Journal of Political Science 23(4), 499–519.
Clarke, H. D., Kornberg, A., Scotto, T. J., Reifler, J., Sanders, D., Stewart, M. C. &Whiteley, P. (2011), ‘Yes we can! Valence Politics and Electoral Choice in America2008’, Electoral Studies 30(3), 450–461.
Conrad, J. (2010), Sozialwissenschaftliche Analyse von Klimaforschung, -diskurs und -politik am Beispiel des IPCC, in M. Voss, ed., ‘Der Klimawandel’, VS Verlag fürSozialwissenschaften, pp. 101–115.
Costain, W. D. & Lester, J. P. (1995), The Evolution of Environmentalism, in J. P.Lester, ed., ‘Environmental Politics and Policy’, Duke University Press, Durham,pp. 15–38.
Davenport, D. (2008), The International Dimension of Climate Policy, in I. Bailey &H. Compston, eds, ‘Turning Down the Heat’, Palgrave Macmillan, Basingstoke,pp. 48–62.
Dryzek, J. S. (1997), The Politics of the Earth: Environmental Discourses, Oxford Uni-versity Press, Oxford.
Dryzek, J. S. & Schlosberg, D., eds (2003), Debating the Earth: The EnvironmentalPolitics Reader, Oxford University Press, Oxford.
Eckersley, R. (2004), The Green State: Rethinking Democracy and Sovereignty, MITPress, Cambridge.
Engels, A. (2003), Die geteilte Umwelt: Ungleichheit, Konflikt und ökologische Selbst-gefährdung in der Weltgesellschaft: mit einer Fallstudie zu Senegal, 1. aufl edn,Velbrück, Weilerswist.
Literatur 69
Engels, A. & Weingart, P. (1997), Die Politisierung des Klimas. Zur Entstehungvon anthropogenem Klimawandel als politischem Handlungsfeld, in P. Hiller &G. Krücken, eds, ‘Risiko und Regulierung’, Suhrkamp, Frankfurt am Main, pp. 90–115.
Esposito, E. (2007), Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität, Suhrkamp, Frankfurt amMain.
Feindt, P. H. & Saretzki, T., eds (2010), Umwelt- und Technikkonflikte, VS Verlag fürSozialwissenschaften, Wiesbaden.
Flechtheim, O. K. (1972), Futurologie: Der Kampf um die Zukunft, Fischer, Frankfurtam Main.
Füssel, H.-M. (2007), ‘Vulnerability: A Generally Applicable Conceptual Framework forClimate Change Research’, Global Environmental Change 17(2), 155–167.
Gemenis, K., Katsanidou, A. & Vasilopoulou, S. (2012), ‘The Politics of Anti-Environmentalism: Positional Issue Framing by the European Radical Right’. Paperprepared for the MPSA Annual Conference, 12–15 April 2012, Chicago, IL.
Giddens, A. (2011), The Politics of Climate Change, Polity Press, Cambridge.
Goldman, M. (2001), ‘Constructing an Environmental State: Eco-governmentalityand other Transnational Practices of a ’Green’ World Bank’, Social Problems48(4), 499–523.
Green, J. (2007), ‘When Voters and Parties Agree: Valence Issues and Party Competi-tion’, Political Studies 55(3), 629–655.
Gronemann, S. & Döring, R. (2001), ‘Nachhaltigkeit und Diskontierung’, Zeitschrift fürWirtschafts-und Unternehmensethik 2(2), 233–256.
Hajer, M. A. (1995), The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernizationand the Policy Process, Oxford University Press, Oxford.
Hardin, G. (1968), ‘The Tragedy of the Commons’, Science 162, 1243–1248.
Harrington, W., Morgenstern, R. D. & Sterner, T., eds (2004), Choosing EnvironmentalPolicy: Comparing instruments and outcomes in the United States and Europe,Resources for the Future, Washington DC.
Literatur 70
Hartmann, T. (2012), ‘Wicked Problems and Clumsy Solutions: Planning as ExpectationManagement’, Planning Theory 11(3), 242–256.
Holzinger, K. & Knill, C. (2005), ‘Causes and Conditions of Cross-National Policy Con-vergence’, Journal of European Public Policy 12(5), 775–796.
Holzinger, K., Knill, C. & Sommerer, T. (2008), ‘Environmental Policy Convergence:The Impact of International Harmonization, Transnational Communication, andRegulatory Competition’, International Organization 62(04), 553–587.
Inglehart, R. (1995), ‘Public Support for Environmental Protection: Objective Problemsand Subjective Values in 43 Societies’, Political Science and Politics 28(1), 57–72.
Inglehart, R. (1997), Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, andPolitical Change in 43 Societies, Princeton University Press, Princeton.
Jänicke, M., Weidner, H. & Jörgens, H. (1997), National Environmental Policies: A Com-parative Study of Capacity-Building: With a Data Appendix, International Profilesof Changes Since 1970, Springer, Berlin.
Kaack, H. (1971), Geschichte und Struktur des deutschen Parteiensystems, Westdeut-scher Verlag, Opladen.
Kaldewey, D. (2008), Eine systemtheoretische Rekonzeptualisierung der Unterscheidungvon Natur und Gesellschaft., in K.-S. Rehberg, ed., ‘Die Natur der Gesellschaft. Ver-handlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel2006.’, Campus, Frankfurt am Main, pp. 2826–2836.
Karafillidis, A. (2010), Soziale Formen: Fortführung eines soziologischen Programms,Transcript, Bielefeld.
Kavanagh, D. (1981), ‘The Politics of Manifestos’, Parliamentary Affairs XXXIV(1), 7–27.
Klingemann, H.-D., Hofferbert, R. I. & Budge, I., eds (1994), Parties, Policies, andDemocracy, Theoretical lenses on public policy, Westview Press, Boulder.
Knill, C., Debus, M. & Heichel, S. (2010), ‘Do Parties Matter in Internationalised PolicyAreas? The Impact of Political Parties on Environmental Policy Outputs in 18OECD Countries, 1970-2000’, European Journal of Political Research 49(3), 301–336.
Literatur 71
Latour, B. (2010a), Das Parlament der Dinge: Für eine politische Ökologie, Suhrkamp,Frankfurt am Main.
Latour, B. (2010b), Eine neue Soziologie für eine neue Gesellschaft: Einführung in dieAkteur-Netzwerk-Theorie, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Laver, M., Benoit, K. & Garry, J. (2003), ‘Extracting Policy Positions from PoliticalTexts Using Words as Data’, American Political Science Review 97(2), 311–331.
Leuschner, A. (2012), Die Glaubwürdigkeit der Wissenschaft: eine wissenschafts-und er-kenntnistheoretische Analyse am Beispiel der Klimaforschung, Transcript, Bielefeld.
Levin, K., Cashore, B., Bernstein, S. & Auld, G. (2012), ‘Overcoming the Tragedyof Super Wicked Problems: Constraining our Future Selves to Ameliorate GlobalClimate Change’, Policy Sciences 45(2), 123–152.
Levin, K., Cashore, B., Bernstein, S. & Graeme, A. (2010), ‘Playing it Forward: PathDependency, Progressive Incrementalism, and the “Super Wicked” Problem of Glo-bal Climate Change’. A previous version of this paper was presented to the ClimateChange: Global Risks, Challenges and Decisions Congress, 10 - 12 March 2009,Copenhagen, Denmark.
Lorenzoni, I., O’Riordan, T. & Pidgeon, N. (2008), Hot Air and Cold Feet: The UKResponse to Climate Change, in I. Bailey & H. Compston, eds, ‘Turning Down theHeat’, Palgrave Macmillan, Basingstoke, pp. 104–124.
Luhmann, N. (1971), ‘Die Weltgesellschaft’, Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie57(1), 1–35.
Luhmann, N. (1975), Komplexität, in ‘Soziologische Aufklärung 2’, Westdeutscher Ver-lag, Opladen.
Luhmann, N. (1977), Probleme eines Parteiprogramms, in H. Baier, ed., ‘Freiheit undSachzwang’, Opladen, Opladen, pp. 167–181.
Luhmann, N. (1981), Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Orga-nisation, Westdeutscher Verlag, Opladen.
Luhmann, N. (1990), Soziologische Aufklärung 5, 3. aufl edn, VS Verlag für Sozialwis-senschaften, Wiesbaden.
Literatur 72
Luhmann, N. (1991), Soziologie des Risikos, W. de Gruyter, Berlin.
Luhmann, N. (1993), Die Moral des Risikos und das Risiko der Moral, in G. Bechmann,ed., ‘Risiko und Gesellschaft’, Westdeutscher Verlag, Opladen, pp. 327–338.
Luhmann, N. (1995), Soziologische Aufklärung 6, Westdeutscher Verlag, Opladen.
Luhmann, N. (1999), Gesellschaftsstruktur und Semantik: Studien zur Wissenssoziologieder modernen Gesellschaft, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Luhmann, N. (2002), Die Politik der Gesellschaft, Vol. 1582, Suhrkamp, Frankfurt amMain.
Luhmann, N. (2008), Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sichauf ökologische Gefährdungen einstellen?, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wies-baden.
Luhmann, N. (2009), ‘Zur Komplexität von Entscheidungssituationen’, Soziale Systeme15(1), 3–35.
Mackenzie, A. (2005), ‘The Problem of the Attractor: A Singular Generality betweenSciences and Social Theory’, Theory, Culture & Society 22(5), 45–65.
Mair, P. & Mudde, C. (1998), ‘The Party Family and Its Study’, Annual Review ofPolitical Science 1(1), 211–229.
McDonald, M. D. & Budge, I. (2005), Elections, Parties, Democracy: Conferring theMedian Mandate, Oxford University Press, Oxford.
McNeill, J. R. (2005), Blue Planet: Die Geschichte der Umwelt im 20. Jahrhundert,Bundeszentrale f. politische Bildung, Bonn.
Merz, N. & Regel, S. (2013), Die Programmatik der Parteien, in O. Niedermayer, ed.,‘Handbuch Parteienforschung’, Springer, pp. 211–238.
Meyer, J. W. (2005), Weltkultur: Wie die westlichen Prinzipien die Welt durchdringen,Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Meyer, O. W., Boli, J., Thomas, G. M. & Ramirez, F. O. (1997), ‘World Society andthe Nation-State’, American Journal of Sociology 103(1), 144–181.
Literatur 73
Muno, W. (2010), Umweltpolitik, in H.-J. Lauth, ed., ‘Vergleichende Regierungslehre’,VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, pp. 349–372.
Nawrotzki, R. J. (2012), ‘The Politics of Environmental Concern: A Cross-NationalAnalysis’, Organization & Environment 25(3), 286–307.
Neumayer, E. (2003), ‘Are Left-Wing Party Strength and Corporatism Good for theEnvironment? Evidence from Panel Analysis of Air Pollution in OECD Countries’,Ecological Economics 45(2), 203–220.
Neumayer, E. (2004), ‘The Environment, Left-Wing Political Orientation and EcologicalEconomics’, Ecological Economics 51(3–4), 167–175.
Nicolis, G. & Prigogine, I. (1987), Die Erforschung des Komplexen: Auf dem Weg zueinem neuen Verständnis der Naturwissenschaften, Piper, München.
Nowotny, H. (2005), ‘The Increase of Complexity and its Reduction: Emergent Interfacesbetween the Natural Sciences, Humanities and Social Sciences’, Theory, Culture &Society 22(5), 15–31.
Omenn, G. S. (2006), ‘Grand Challenges and Great Opportunities in Science, Techno-logy, and Public Policy’, Science and Public Policy 314(5806), 1696–1704.
O’Neill, M. (2012), Political Parties and the "Meaning of Greening" in European Politics,in P. F. Steinberg & S. D. VanDeveer, eds, ‘Comparative Environmental Politics’,MIT Press, Cambridge, pp. 171–195.
Ortmann, G. (2009), ‘Luhmanns entscheidungstheoretische Erwägungen’, Soziale Syste-me 15(1), 36–45.
Ostrom, E. (1990), Governing the Commons: The Evolution of Institutions for CollectiveAction, Cambridge University Press, Cambridge.
Paterson, M. & Grubb, M. (1992), ‘The International Politics of Climate Change’, In-ternational Affairs 68(2), 293–310.
Poloni, V. (2009), Das Intergovernmental Panel on Climate Change als boundary organi-zation, in J. Halfmann & F. Schützenmeister, eds, ‘Organisationen der Forschung’,VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, pp. 250–271.
Literatur 74
Prigogine, I. (1979), Vom Sein zum Werden: Zeit und Komplexität in den Naturwissen-schaften, Piper, München.
Prigogine, I. (1997), The End of Certainty: Time, Chaos, and the New Laws of Nature,Free Press, New York.
Prigogine, I. & Stengers, I. (1990), Dialog mit der Natur: Neue Wege naturwissenschaft-lichen Denkens, Piper, München.
Radkau, J. (2000), Natur und Macht: Eine Weltgeschichte der Umwelt, Beck, München.
Reitman, W. R. (1964), Heuristic Decision Procedures Open Constraints and the Struc-ture of Ill-Defined Problems, John Wiley & Sons Inc, New York.
Rittel, H. W. & Webber, M. M. (1973), ‘Dilemmas in a General Theory of Planning’,Policy Sciences 4, 155–169.
Roberts, N. (2000), ‘Wicked Problems and Network Approaches to Resolution’, Inter-national Public Management Review 1(1).
Roose, J. (2010), Der endlose Streit um die Atomenergie. Konfliktsoziologische Unter-suchung einer dauerhaften Auseinandersetzung, in P. H. Feindt & T. Saretzki, eds,‘Umwelt- und Technikkonflikte’, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden,pp. 79–103.
Rosa, H. (2008), Beschleunigung: Die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne,Suhrkamp, Frankfurt am Main.
Rosa, H. (2012), Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung: Umrisse einer neuenGesellschaftskritik, Suhrkamp, Berlin.
Schimank, U. (2005), Die Entscheidungsgesellschaft: Komplexität und Rationalität derModerne, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Schönbohm, W. (1974), ‘Funktion, Entstehung und Sprache von Parteiprogrammen’,Aus Politik und Zeitgeschichte 34-35, 17–37.
Simon, H. A. (1973), ‘The Structure of Ill Structured Problems’, Artificial Intelligence4(3-4), 181–201.
Stehr, N. (2000), Die Zerbrechlichkeit moderner Gesellschaften, Velbrück, Weilerswist.
Literatur 75
Stichweh, R. (1979), ‘Differenzierung der Wissenschaft’, Zeitschrift für Soziologie8(1), 82–101.
Stone, D. A. (1989), ‘Causal Stories and the Formation of Policy Agendas’, PoliticalScience Quarterly 104(2), 281–300.
Strom, K. (1990), ‘A Behavioral Theory of Competitive Political Parties’, AmericanJournal of Political Science 34(2), 565–598.
Turner, B. L., Kasperson, R. E., Matson, P. A., McCarthy, J. J., Corell, R. W., Christen-sen, L., Eckley, N., Kasperson, J. X., Luers, A., Martello, M. L., Polsky, C., Pulsi-pher, A. & Schiller, A. (2003), ‘A Framework for Vulnerability Analysis in Sustaina-bility Science’, Proceedings of the National Academy of Sciences 100(14), 8074–8079.
Urry, J. (2003), Global Complexity, Polity, Malden and MA.
Urry, J. (2005), ‘The Complexity Turn’, Theory, Culture & Society 22(5), 1–14.
Urry, J. (2011), Climate Change and Society, Polity Press, Cambridge.
Verweij, M. (2006), ‘Clumsy Solutions for a Complex World: The Case of ClimateChange’, Public Administration 84(4), 817–843.
Volkens, A., Lehmann, P., Merz, N., Regel, S. & Werner, A. (2013), The ManifestoData Collection. Manifesto Project (MRG/CMP/MARPOR): Version 2013a, Wis-senschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
Weick, K. E. & Sutcliffe, K. M. (2001), Managing the Unexpected: Assuring High Per-formance in an Age of Complexity, Jossey-Bass, San Francisco.
Weidner, H. (2008), ‘Klimaschutzpolitik: Warum ist Deutschland ein Vorreiter im inter-nationalen Vergleich? Zur Rolle von Handlungskapazitäten und Pfadabhängigkeit’.
Weidner, H., Jänicke, M. & Jörgens, H. (2002), Capacity Building in National Environ-mental Policy: A Comparative Study of 17 Countries, Springer, Berlin.
Weingart, P., Engels, A. & Pansegrau, P. (2008), Von der Hypothese zur Katastrophe: Deranthropogene Klimawandel im Diskurs zwischen Wissenschaft, Politik und Massen-medien, Budrich, Opladen.
Literatur 76
Weizsäcker, C. F. (1981), Die Einheit Der Natur, Hanser, München.
Welzer, H., Soeffner, H.-G. & Giesecke, D., eds (2010), KlimaKulturen: Soziale Wirk-lichkeiten im Klimawandel, Campus, Frankfurt am Main.
Wiesenthal, H. (2010), Klimawandel der Umweltpolitik? Oder: Energiekonzepte als Iden-titätskrücke, in C. Büscher & K. P. Japp, eds, ‘Ökologische Aufklärung. 25 Jahre“Ökologische Kommunikation”’, VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden,pp. 173–202.
Wisner, B., Blaikie, P. & Cannon, T. (2004), At Risk: Natural Hazards, People’s Vulne-rability and Disasters, Routledge, London.
Anhang
Untersuchte Fälle
Tabelle 2: Untersuchte Fälle 1
Länder Zeitraum WahlenParteien Analyse 1 Parteien Analyse 2
Dänemark 1981-2011 10 NY (2007-2011), VS, DKP(1981-1984), EL (1994-2011), SF, SD, RV, V, KF(1981-2011), CD, FP (1981-1998), KrF (1981-2005),DF (1998-2011)
Deutschland 1980-2013 9 CDU, FDP, SPD (1980-2013), Bündnis 90/DieGrünen (1987-2013), Lin-ke/PDS (1990-2013)
CDU, FDP, SPD (1980-2013), Bündnis 90/DieGrünen (1987-2013), Lin-ke/PDS (1990-2013)
Frankreich 1981-2012 8 Les Verts (1993-2012),FDG (2012), PC (1981-2007), PS, RPF/RPR,UDF (1981-2012), UMP(2002-2012)
Les Verts (1993-2012),FDG (2012), PC (1981-2007), PS, RPF/RPR,UDF (1981-2012), UMP(2002-2012)
Großbritannien 1983-2010 7 Labour, Liberal Democrats,Conservatives (1983-2013)
Labour, Liberal Democrats,Conservatives (1983-2013)
Italien 1983-2013 8 FDV (1987-2006), DP(1983-1987), PRC (1994-2001), PCI (1983-2001),LN (1994-2006), PSDI(1983-1991), PRI, PLI(1983-1991), PSI-NPSI(1983-2006)
Irland 1981-2011 9 Greens (1992-2011), WP-DLP (1981-2011), PD(1987-2007), Labour, FG,FF (1981-2011), SF (2007-2011)
Tabelle 3: Untersuchte Fälle 2
Länder Zeitraum WahlenParteien Analyse 1 Parteien Analyse 2
Kroatien 1990-2011 7 HSS, HNS (1992-2011),HDZ, SKH/SDP (1990-2011), HSLS (1992-2003)
HSS, HNS (1992-2011),HDZ, SKH/SDP (1990-2011), HSLS (1992-2003)
Niederlande 1982-2010 10 GL (1989-2010), SP (1998-2010), PPR (1982-1986),PA, VVD (1982-2012),D66 (1986-2006), CDA(1982-2010), CU (2002-2006), PVV (2006-2012),PvD (2006-2010), SGP(2006-2012)
Norwegen 1981-2009 8 NKP, DnA, V, KrF, H, BP,AP (1981-2009)
Österreich 1983-2013 9 Die Grünen (1986-2013),SPÖ, ÖVP (1983-2013),FPÖ (1983-2008)
Die Grünen (1986-2013),SPÖ, ÖVP (1983-2013),FPÖ (1983-2008)
Polen 1991-2011 7 SLD, PSL, MN (1991-2011),PO, PiS (2001-2011)
Schweden 1982-2010 9 MP (1988-2010), SKP, SAP,FP, HP, SD (1982-2010),KDS (1991-2010)
Schweiz 1983-2011 8 Grüne (1987-2011), FDP,SPS, CVP, SVP (1983-2011)
Grüne (1987-2011), FDP,SPS, CVP, SVP (1983-2011)
Spanien 1982-2011 8 PC (1982-2011), PSOE(1982-2011), UPD (2008-2011), CDS (1982-1993),AP/PP (1981-2011),CiU/FAC (1982-2011),PNB (1996-2011)
Suchstrings
Tabelle 4: Suchstrings nach Sprachen
Sprache Suchstring
Dänisch klima|opvarmning|drivhus|emission
Deutsch klima|erwärmung|erwarmung|treibhaus|emission
Englisch clima|warming|greenhouse|emission
Französisch clima|réchauffement|rechauffement|serre|emission|émission
Italienisch clima|riscaldamento|serra|emissione
Kroatisch klima|zagrijavan|staklen|emisij
Niederländisch klima|opwarm|broeikas|uitstoot
Norwegisch klima|oppvarming|drivhus|utslipp
Polnisch klimat|ociepleni|cieplarnian|emis
Schwedisch klimat|utsläpp|växthus|uppvärmning
Spanisch clima|calentamiento|invernadero|emision