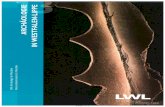Wasser ist nicht gleich Wasser. Zur Kompilation der Sintflutgeschichte, in: Thomas Wagner / Jonathan...
-
Upload
uni-wuppertal -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Wasser ist nicht gleich Wasser. Zur Kompilation der Sintflutgeschichte, in: Thomas Wagner / Jonathan...
Text – Textgeschichte – Textwirkung
Festschrift zum 65. Geburtstag von Siegfried Kreuzer
Herausgegeben von Jonathan M. Robker, Frank Ueberschaer
und Thomas Wagner
Alter Orient und Altes Testament Veröffentlichungen zur Kultur und Geschichte des Alten Orients und des Alten Testaments
begründet von Manfried Dietrich und Oswald Loretz†
Band 419
Herausgeber
Manfried Dietrich • Ingo Kottsieper • Hans Neumann
Lektoren
Kai A. Metzler • Ellen Rehm
Beratergremium
Rainer Albertz • Joachim Bretschneider • Stefan Maul Udo Rüterswörden • Walther Sallaberger • Gebhard Selz
Michael P. Streck • Wolfgang Zwickel
Text – Textgeschichte – Textwirkung
Festschrift zum 65. Geburtstag von Siegfried Kreuzer
Herausgegeben von Jonathan M. Robker, Frank Ueberschaer
und Thomas Wagner
2014 Ugarit-Verlag
Münster
Text – Textgeschichte – Textwirkung Festschrift zum 65. Geburtstag von Siegfried Kreuzer
Herausgegeben von Jonathan M. Robker, Frank Ueberschaer und Thomas Wagner
Alter Orient und Altes Testament, Band 419
© 2014 Ugarit-Verlag, Münster www.ugarit-verlag.com All rights preserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photo-copying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. Printed in Germany
ISBN: 978-3-86835-132-3
Printed on acid-free paper
Wasser ist nicht gleich Wasser
Zur Kompilation der Sintfluterzählung
Thomas Wagner, Wuppertal
I Zwei Erzählungen von der Flut?
Die Trennung der Sintflutgeschichte (Gen 6,5–9,17) in zwei ursprünglich eigen-ständige Erzählungen, die ein Redaktor zusammenfügte und um verbindende Glossen erweiterte, war in der alttestamentlichen Forschung jenseits der Hypo-thesenbildungen über die Entstehung des Pentateuch lange Zeit common sense. Die im Text auftretenden Spannungen, Doppelungen und Widersprüche ließen keinen anderen Schluss als den einer Kompilation von Texten unterschiedlicher Herkunft zu einer neuen Erzählung zu. In der frühen Pentateuchforschung seit der Mitte des 18. Jh.s n.Chr. wurden zwei Erzählfäden extrahiert. Dabei wird der P-Anteil bis heute weitgehend gleichbleibend mit Gen 6,9–22; 7,6.(7–9)11.13–16a.(17a)18–21.24; 8,1.2a.3b–5.7.13a.14–19; 9,1–17.(18f.)28f. angegeben.1 Die weiteren Bestandteile der Sintfluterzählung werden als der nicht-priesterschrift-liche Anteil bezeichnet, wobei dieser sowohl eine weitere Quelle als auch späte-re redaktionelle Zufügungen umfasst. Die Zuweisung zu den einzelnen Textstra-ta (J und RP) variieren in den einzelnen Darstellungen.
Im Stile der im 19. Jh. n.Chr. vorgelegten quellenkritischen Analysen, die die Sintflutgeschichte als redaktionelle Kompilation zweier zuvor eigenständig exis-tierender Erzählungen verstand,2 wies Martin Noth der nicht-priesterschriftlich-en Quelle (beim ihm J) die Abschnitte Gen 6,5–8; 7,1f.3b–5.7.10.12.16b.17b.
1 Vgl. M. Noth, Überlieferungsgeschichte des Pentateuch, Stuttgart 1948, 17; C. Westermann, Genesis (BK.AT I/1), Neukirchen-Vluyn 1974, 532f.; T. Pola, Die ursprüngliche Priester-schrift. Beobachtungen zur Literarkritik und Traditionsgeschichte von PG (WMANT 70), Neukirchen-Vluyn 1995, 343 A144; M. Witte, Die biblische Urgeschichte. Redaktions- und theologiegeschichtliche Beobachtungen zu Genesis 1,1–11,26 (BZAW 265), Berlin / New York 1998, 146; R.G. Kratz, Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments (UTB 2157), Göttingen 2000, 236; M. Arneth, Durch Adams Fall ist ganz verderbt … Studien zur Entstehung der alttestamentlichen Urgeschichte (FRLANT 217), Göttingen 2007, 44. Mit Abweichungen in Gen 8 (V. 1–2 P, V. 3–5 nP, V. 6–7 P, V. 19 nP) auch A. Schüle, Der Pro-log der hebräischen Bibel. Der literar- und theologiegeschichtliche Diskurs der Urgeschichte (Genesis 1–11) (AThANT 86), Zürich 2006, 247–254. 2 Dargelegt von H. Hupfeld, Die Quellen der Genesis und die Art ihrer Zusammensetzung, Berlin 1853; E. Schrader, Studien zur Kritik und Erklärung der Biblischen Urgeschichte (Gen. Cap. I–XI), Zürich 1863; T. Nöldeke, Untersuchungen zur Kritik des Alten Testaments, 1869; K. Budde, Die Biblische Urgeschichte (Gen 1–12,5), Gießen 1883; H. Gunkel, Genesis, Göt-tingen 31910.
4 T. Wagner
22.23aαb; 8,2b.3a.6.8–12.13b.20–22; 9,18–27 zu.3 Einen vergleichbaren Um-fang der zweiten, nicht-priesterschriftlichen Quelle führen in der neueren For-schung mit geringfügigen Variationen Ruppert, Levin, Carr, Harland, Seebass, Soggin, Westermann,4 Witte5 und Baumgart an. Mit geringfügigen Abwei-chungen stimmen sie mit der früheren Forschung darin überein, dass der nP-An-teil sich zu einer eigenständigen Quelle fügen lässt.
Der Bestand ursprünglich eigenständiger Quellen wird in der derzeitigen Forschung von zwei Standpunkten aus bestritten. Einen ersten derartigen Ansatz bezogen auf die Urgeschichte bietet Erhard Blum, der in Anlehnung an die und Abgrenzung von den Beobachtungen von Cross, Van Seters und Rendtorff, die P durchgängig als Redaktionsschicht beschreiben,6 P als literarische Reaktion auf die ihr vorgegebenen Schriften versteht. Die zu P gehörigen Anteile des Pen-tateuch setzen „nicht nur nachweislich die Kenntnis der älteren Texte voraus, sondern erklären sich teilweise in ihren Einzelzügen geradezu als ‚Korrekturen‘, ‚Gegendarstellungen‘, die bewußt neben die anders ausgerichtete Überlieferung gestellt wurden“7. Dabei griff bereits der P-Kompositor auf priesterliche Quellen zurück, die er in das Gesamtwerk integrierte. Als Grundlage diente die ספר -die die Zeitabläufe vorgibt. Dies expliziert Blum an dem in literarkri ,התולדתtischen Untersuchungen wiederholt der Redaktion zugewiesenen Vers Gen 7,6 im Bezug zu V. 11. „Die priesterliche Komposition verschränkt an dieser Stelle die verschiedenen von ihr berücksichtigten Überlieferungen miteinander: eine außer-priesterliche Erzählung von der Flut, die Angaben des ספר התולדת und eine eigene priesterliche Flutüberlieferung.“8 Maßgeblich für das Verständnis von Blums Ansatz ist demnach, dass die priester(schrift)liche Komposition des Pen-tateuch einzelne priesterliche Texte voraussetzt, die bei der Komposition mit den weiteren vorliegenden Texten verschränkt wurden.
Der zweite Ansatz, die Annahme der Bildung der Urgeschichte aus zuvor ei-genständigen Quellenschriften kritisch zu hinterfragen, geht von P als der Grundschicht aus, die punktuell redaktionell ergänzt wurde. Bezogen auf die
3 Siehe Noth, Überlieferungsgeschichte, 29. 4 Vgl. der die Sintfluterzählung jedoch mit Gen 9,17 enden lässt. 5 Vgl. Westermann, Genesis, 532f.; L. Ruppert, Genesis. Ein kritischer und theologischer Kommentar, 1. Bd.: Gen 1,1–11,26 (fzb 70), Würzburg 1992, 285ff.527ff.; C. Levin, Der Jah-wist (FRLANT 157), Göttingen 1993, 48, 53f.117; D.M. Carr, Reading the Fractures of Ge-nesis. Historical and Literary Approaches, Louisville 1996; P.J. Harland, The Value of Hu-man Life. A Study of the Story of the Flood (Genesis 6–9) (VT.S 64), Leiden / Boston 1996, 6ff.; H. Seebass, Genesis I. Urgeschichte (1,1–11,26), Neukirchen-Vluyn 1996, 199ff.; J.A. Soggin, Das Buch Genesis. Kommentar, Darmstadt 1997, 125ff.; Witte, Urgeschichte, 174. 6 Vgl. F.M. Cross, Canaanite Myth and Hebrew Epic: Essays in the History of the Religion of Israel, Cambridge 1997, 293–325; J. Van Seters, Abraham in History and Tradition, New Ha-ven / London 1975, 279–295; R. Rendtorff, Das überlieferungsgeschichtliche Problem des Pentateuch (BZAW 147), Berlin / New York 1977, bes. 141f. 7 E. Blum, Studien zur Komposition des Pentateuch (BZAW 189), Berlin / New York 1990, 230. 8 Blum, Komposition, 282.
Wasser ist nicht gleich Wasser 5
Sintfluterzählung weist Reinhard Georg Kratz, der die nP-Anteile von Gen 6,5–9,17 für nachjahwistische Ergänzungen hält, die zwischen Gen 2–4 + 6,14aβb und 9,19 + 10–11 eingefügt wurden,9 eine wichtige Beobachtung auf. „Er [der Bericht über die Sintflut TW] ist nicht, wie man oft liest, vollständig, sondern nur bruchstückhaft erhalten. Es fehlen eine Ankündigung der Flut, der Befehl zum Bau der Arche und der Bericht, wie Noach und die Seinen in die Arche hin-ein- und wie sie wieder herausgehen (vgl. 9,18 nach 8,20–21).“10 Die redaktio-nellen Ergänzungen zu priesterschriftlichen Erzählung sind s.E. auf einer späten Stufe der Pentateuchentstehung anzusiedeln. Diese Annahme einer Ergänzung der priesterschriftlichen Erzählung um spätere Anteile treffen auch Erich Boss-hard-Nepustil und Andreas Schüle, die jedoch unterschiedliche redaktionsge-schichtliche Modelle vorstellen. Bosshard-Nepustil weist in seinem Beitrag auf, dass Gen 6,5–8; 7,1–5.7–9; 7,20–8,14; 8,20–2211 auf bereits vorliegende P-An-teile bezogen sind und bezeichnet die genannten Stellen als „redaktionelle ad hoc-Ergänzungen“12. Dabei kann er allerdings nur für Gen 7,1–5 syntaktische Übereinstimmungen zum P-Kontext aufzeigen, die darauf hindeuten können, dass der Text nach einer Vorlage geformt ist.13 Alle anderen angenommenen Er-weiterungen werden als inhaltliche Fortschreibungen gedeutet, die nach dem Muster Innenperspektive (nP) – Außenperspektive (P) verfasst sind. Allerdings wendet er selber ein, dass durch den nachgewiesenen redaktionellen Charakter die Annahme der Aufnahme älterer Stücke nicht ausgeschlossen ist.14 Da er zwar Gen 7,7-9; 8,1b als spätere redaktionelle Ergänzungen erkennt, die er aber nicht als weitere nP-Redaktionsschicht deutet, verbleibt Bosshard-Nepustil bei einem einschichtigen Redaktionsmodell, indem der die nP-Anteile als Erweiter-ungen der P-Sintflut versteht.
Zu einer anderen literarischen Schichtung kommt Schüle, der zwei unter-schiedlichen Bearbeitungsschichten ausgeht. Die erste Schicht versteht er als in-nerbiblische Auslegungen, in denen die vier Aspekte „1. die Bewertung der Flut als Strafhandeln Gottes; 2. das Noahbild; 3. die Rolle des Opfers und 4. die Be-deutung von Reinheit“15 behandelt werden. Zur zweiten Bearbeitungsschicht 9 Die Feststellung, dass die Sintfluterzählung sekundär in die nP-Urgeschichte eingesetzt wur-de, hebt bereits J. Wellhausen, Die Composition des Hexateuchs und der historischen Bücher des Alten Testaments, Berlin 1899, 7–12, hervor. Er weist den Vorgang einer jahwistischen Redaktion zu. Aufgenommen und weiter expliziert wird diese These bei Levin, Jahwist, 103–117, bes. 109f. 10 Kratz, Komposition, 259. Im selben Sinne auch E. Bosshard-Nepustil, Vor uns die Sintflut. Studien zu Text, Kontexten und Rezeption der Fluterzählung Genesis 6–9 (BWANT 165), Stuttgart 2005, 55–57. Eine weitere Lücke zeigt Schüle, Prolog, 271, auf: „Die neuralgische Stelle ist 8,1–2 als Klimax und Wendepunkt der Erzählung insgesamt: Gottes Beschluss, die Sintflut zu beenden und die Wasser von der Erde zurückzudrängen.“ 11 Gen 7,7–9 und 8,1b deutet er als spätere redaktionelle Zufügung. 12 Bosshard-Nepustil, 72. 13 Vgl. Bosshard-Nepustil, 62–66. 14 Vgl. Bosshard-Nepustil, 77f. 15 Schüle, Prolog, 273f.
6 T. Wagner
rechnet Schüle Erweiterungen, die P sprachlich und inhaltlich nahe stehen, die aber „doch eine Reihe kleinerer Abweichungen von der Priesterschrift wie auch von deren Kommentierungen enthalten“16. Zu diesen zählt er die erneute Bestä-tigungsanzeige in Gen 7,8f., einzelne Korrekturen an der Schöpfungsordnung in Gen 7,13-17a sowie die Erwähnung des göttlichen Geistes als Lebensatem in Gen 7,21f.
Eine vermittelnde Position vertritt schließlich Martin Arneth in seiner Unter-suchung der Urgeschichte. Er weist enge Parallelen bei der Ausbildung der nP-Anteile zu Jer 18,12–17 nach. Dieser Text weist über analoge Sachgehalte auch eine hohe Anzahl an Lexementsprechungen auf, die darauf hindeuten, dass die beiden Texte miteinander in enger Korrespondenz stehen. „Sowohl göttliche Unheils- als auch Heilszusagen mit Bezug auf die Völkerwelt – also mit univer-saler Tendenz – werden im Horizont der dem menschlichen Verhalten korres-pondierenden Willensdisposition Jahwes reflektiert.“17 Ebenso stehen die nP-Anteile in engem Bezug zu Ex 32–34 und Num 13f., also post-priesterschriftli-chen Texten, die in ihren Grundbeständen RP sowie weiteren Redaktionen zuzu-ordnen sind.18 Die engen Bezüge zu diesen späten Texten deuten s.E. darauf hin, dass die nP-Anteile der Sintfluterzählung erst in einem späten Stadium der Lite-raturgeschichte des Alten Testaments entstanden sind. Gegen die Annahme ei-ner literarischen Abhängigkeit der nP-Anteile von der priesterschriftlichen Dar-stellung hält er hingegen fest: „Es ist natürlich abwegig, behaupten zu wollen, daß die nichtspriesterschriftliche Textschicht rein als Bearbeitung von P entstan-den ist. Vielmehr kann es aufgrund der einschlägigen Parallelen in den mesopo-tamischen Sintflutüberlieferungen nicht strittig sein, daß bereits literarisch vor-liegende Stoffe rezipiert wurden – dafür spricht bekanntermaßen die Übernahme der Vogelperikope sowie des Opfers nach der Flut und auch die Siebenerstruktur im Flutablauf hat bereits im mesopotamischen Kontext seinen Ort, auch wenn es sich gut in die alttestamentliche Sabbatstruktur einfügt. Nicht rekonstruierbar ist indes aus der nichtpriesterschriftlichen Textschicht eine von P unabhängige Quelle.“19
Die verschiedenen Ansätze zur Erklärung der Genese der Sintflutgeschichte im Rahmen der Urgeschichte weisen unterschiedliche Probleme auf, aufgrund derer der jeweilige Ansatz kritisch zu hinterfragen ist. Die Vertreter der neueren Urkundenhypothese stehen vor dem Problem, die Brüche in der jeweiligen Er-zählung zu erklären. Am deutlichsten wird dieses an der Einleitung der Sint-fluterzählung in Gen 6,9–11, in der die Sündenverfallenheit der Menschen er-wähnt wird, ohne dass P eine begründende Erzählung enthält (V. 11). Die Ver-
16 Schüle, Prolog, 292. 17 Arneth, Adams Fall, 172. 18 Vgl. dazu E. Otto, Die nachpriesterschriftliche Pentateuchredaktion im Buche Exodus, in: M. Vervenne (Hg.), Studies in the Book of Exodus, Redaction – Reception – Interpretation (BEThL 126), Leuven 1996, 61–111. 19 Arneth, Adams Fall, 199.
Wasser ist nicht gleich Wasser 7
treter der These, die nicht-priesterschriftlichen Anteile der Sintflutgeschichte seien sekundär geschaffen und in die Erzählung eingewoben worden, können zwar aufweisen, dass in der nP-Darstellung der Sintfluterzählung einzelne As-pekte nicht erwähnt werden – in den von ihnen als nP identifizierten Texten feh-len die Ankündigung der Flut, der Befehl zur Bau der Arche sowie eine Notiz über den Gang auf und von der Arche –, die in der priesterschriftlichen Darstel-lung enthalten sind. Sie können mit der Annahme einer späteren Ergänzung je-doch die Beobachtungen Blums nicht widerlegen, der zeigt, dass die bei der Komposition des Pentateuch von den P-Autoren gebildeten redaktionellen Über-gänge sowohl auf die priesterlichen als auch auf die nicht-priesterschriftlichen Vorlagen bezogen sind.
An dieser Stelle ist die Frage nach dem Zusammenwachsen der Sintflutge-schichte erneut zu stellen. Da die Argumente für und gegen die Annahme von vorausgehenden Quellen, literarischen Fragmenten und redaktionellen Fügungen in der Forschung weitgehend ausgetauscht sind, ist m.E. die Konzentration auf die markanten Unterschiede der priesterschriftlichen und nicht-priesterschrift-lichen Erzählanteilen zu legen, um nach den Auswirkungen ihrer Zusammen-stellung zu fragen.
II P – Die Reduktion des Schöpfungsraumes
Die literarkritischen Untersuchungen der Urgeschichte weisen die priester-schriftliche Sintfluterzählung durchgängig als geschlossene Erzählung aus. Sie umfasst Gen 6,9–22; 7,6.7–9.11.13–16a.17a.18–21.24; 8,1.2a.3b–5.7.13a.14–19; 9,1–17. Folgt man dem Spannungsbogen der Erzählung, so endet diese mit dem Bundeszeichen in Gen 9,17. Gen 9,18f.28f. dienen der Rahmung der Er-zählung der Verfluchung Kanaans und gehören dementsprechend nicht mehr zur Sintflutgeschichte hinzu. Die zwischen Gen 7,6.7–9.11 bestehende Spannung konnte bereits Blum als gewollte literarische Fügung erläutern, in dem er auf-weist, dass Gen 7,6 als Prolepse dient und eine Funktion für die Erzählung be-sitzt. Ob diese aus der Kompilation zweier priesterlicher Texte herrührt, ist für die Analyse der Kompilation von P- und nP-Anteilen zunächst unerheblich.20
Die literar- und tendenzkritisch erhobene priesterschriftliche Sintfluterzähl-ung stellt eine kohärente Erzählung mit Schwerpunktsetzungen dar. Eingeleitet wird die priesterschriftliche Sintfluterzählung in Gen 6,9–14 mit der Gegenüber-stellung Noahs als gerechtem Menschen (V. 9), der drei Söhne zeugte (V. 10), 20 Vgl. Zu Gen 7,6 auch die Ausführung von Witte, Urgeschichte, 135: „Insgesamt bildet der Vers eine Überschrift zur folgenden Darstellung des Flutverlaufs. Übersetzt man 7,6 ‚Noah war 600 Jahre, als die Flut auf der Erde war‘, besteht kein Widerspruch zur Chronologie in 7,11 und 8,13 [...], wie der Flutbeginn auf das 600. Lebensjahr und das Ende der Flut auf das 601. Lebensjahr Noahs datiert wird.“ Weiter dazu vgl. die von Arneth, Adams Fall, 60–62, aufgezeigte chiastische Komposition des gesamten Abschnitts Gen 7,6–9.11.13–16a. Aller-dings muss dieser einräumen, dass Gen 7,8 nicht ursprünglich P zugehört, sondern erst vom Quellenkompilator eingefügt wurde (vgl. Arneth, Adams Fall, 64).
8 T. Wagner
und der Verderbtheit von Erde und allem Fleisch, das auf ihr lebt (V. 11f.).21 Diese Gegenüberstellung mündet in der Ankündigung des göttlichen Strafhan-delns (V. 13) und dem Auftrag zum Bau der Arche (V. 14). An diese kurze Ein-leitung werden ausführliche Anleitungen angeschlossen, in denen Maße und Bauweise der Arche (V. 15f.), die Form des Strafhandelns (V. 16), das Verhält-nis von Gott zu Noah (Bundesverheißung V. 18) sowie die Besetzung der Arche (V. 19–21) erläutert werden. Im zweiten Abschnitt ab Gen 7,6 wird das Be-ziehen der Arche beschrieben. Die genannten Lebewesen, die im Inneren des Bauwerks Schutz vor den Wassern finden, entsprechen denjenigen, die nach Gen 6,19-21 auf der Arche Platz finden sollen. Dieser Vorgang findet im Laufe des 600. Lebensjahres Noahs statt, bevor am siebzehnten Tag des zweiten Mo-nats die Sintflut durch das Hervorquellen aus den Brunnen der Tiefe und das Öffnen der Schleusen des Himmels hereinbricht. Gen 7,13f. schließen mit einer erneuten Aufzählung der die Arche bevölkernden Menschen und Tiere an. Diese wird mit בעצם םהיו הזה („an eben diesem Tag“) mit dem Vorausgehenden ver-bunden. Diese in der Kürze des Berichts auffällige dreifache Aufzählung der Ar-cheinsassen ist offenbar eine bewusste Schwerpunktsetzung des Verfassers. An-schließend wird die Flutkatastrophe geschildert, in der alles Leben außerhalb der Arche stirbt. Sie dauert 150 Tage an, bis Gott den Archeinsassen gedenkt (זכר) und Brunnen und Himmelsfenster wieder verschließt. Nach Ablauf der 150 Tage landet die Arche auf dem Berg Ararat an (Gen 8,4). Von dort kann Noah be-obachten, wie der Rabe über der Erde kreist, bis er schließlich am ersten des Tag des 601. Lebensjahres Noahs auf der weitgehend abgetrockneten Erdoberfläche wieder landen kann. Entsprechend dem göttlichen Befehl zum Bezug der Arche, werden in Gen 8,15–17 die Anweisung zum Verlassen der Arche gegeben sowie die Ausführungsnotiz in den V. 18f. angefügt. Hier erscheint die Auflistung aller Archeinsassen sowohl in der Rede als auch in der Ausführungsnotiz, so dass der Leser zwei weitere Male, hier also zum vierten und zum fünften Mal erfährt, wer vor der Sintflut gerettet wird. In Gen 9,1–17 wird die Erzählung schließlich mit dem Segen abgeschlossen, der mit dem Mehrungsauftrag an die Menschen (V. 1, wiederholt in V. 7), ihrer Herrschaft über die Tiere, die den Menschen mit Einschränkungen zur Nahrung dienen sollen (V. 2–4), und dem Verbot der Men-schentötung (V. 6f.) verbunden wird. Neben den Segen tritt die Aufrichtung des Bundes (V. 9–11), die mit dem Zeichen und der Verheißung des dauerhaften Bestandes des Bundes abgeschlossen wird (V. 12–17).
Die textliche Gestalt der priesterschriftlichen Sintfluterzählung zeigt, dass der eigentliche Bericht über die Flutkatastrophe gegenüber den göttlichen An-weisungen und den Ausführungsnotizen der Anweisungen in den Hintergrund tritt. Die die Erzählung abschließende Gottesrede umfasst ca. 30% des Gesamt-
21 Witte, Urgeschichte, 131, weist auf die Verbindungen durch das Gegensatzpaar zur Schöp-fungsgeschichte hin: „Die Wendung תמלא הארץ חמס (V. 11b) bildet das negative Gegenstück zum Mehrungsauftrag מלאו את־הארץ. Der Terminus חמס (V. 11b.13aβ) steht antithetisch zu der Andeutung des urzeitlichen Tierfriedens (1,28–29).“
Wasser ist nicht gleich Wasser 9
textes; die fünffache Wiederholung aller Archeinsassen ist als Schwerpunkt-setzung zu identifizieren. Der Spannungsbogen läuft auf die abschließende Got-tesrede zu. Es stellt sich dem Leser nie die Fragen, ob Noah, sein Haus und die Tiere die Katastrophe überleben werden oder ob die Sintflut zeitlich unbegrenzt bleibt.
Durch die Zuspitzung auf die Weltordnung, die in Gen 9,1–17 dargeboten wird, ist die Sintfluterzählung direkt mit der Schöpfungserzählung Gen 1,1–2,4a verbunden. Gen 9,1–17 stellen eine Fortentwicklung des Segens Gen 1,28–31 dar. In diesem wird die vegetabile Ernähung für alle נפש חיה eingeführt (vgl. Gen 1,20). Herrschaft über die Tiere der Erde, wie sie den Menschen nach V. 28 zu-gesprochen wird, umfasst also die Tötung und den Verzehr von Tieren noch nicht. Dieses ändert sich mit der Novelle der Ordnung in Gen 9,2–4.
Ist damit der direkte erzählerische Bezug zur Schöpfungserzählung herge-stellt, werden die Schwerpunktsetzung der priesterschriftlichen Sintfluterzähl-ung und damit ihr besonderes Profil aufgrund von Parallelen und Aufnahmen von Motiven aus weiteren priesterschriftlichen Erzählungen deutlich. Neben der Veränderung der Ernähungsgewohnheiten und damit des Herrschaftsauftrages beinhaltet die Sintfluterzählung einen weiteren Aspekt, der sie direkt mit der Schöpfungserzählung verbindet. Um die Sintflut über die Erde kommen zu las-sen, öffnet Gott die Brunnen der Tiefe sowie die Fenster des Himmels. Durch diese dringt Wasser (המים) auf die Erde ein. Gen 1,10 differenziert zwischen dem aus dem Bereich zwischen Erde und Feste verdrängten Urmeer resp. Cha-oswasser (מים) und dem Meer- und Grundwasser (םימי). Diese Unterscheidung behält die Sintflutgeschichte bei, in dem in Gen 7,17b-20.24 darauf verwiesen wird, dass המים die Erde überflutet. M.a.W. die Sintflutkatastrophe besteht aus einer Flutung des Raumes zwischen Erdoberfläche und Feste, die die höchsten Berge übersteigt und dazu führt, dass auch die Vögel nicht überleben können. Die Sintflut führt die Erde also in einen Zustand, der der Zeit vor der Schöpfung ähnelt, da die Chaoswasser die Erde überfluten, ihr aber nicht gleicht, da die Feste im Himmel weiterhin existiert und damit das Zurückdrängen der Flut möglich ist.22 Die Erzählung ist also nicht auf eine Neuschöpfung hin angelegt, sondern allein auf die Reinigung der Erde, um einen Neuanfang für diejenigen, die in der Schöpfungserzählung als נפש חיה bezeichnet werden, zu ermöglichen.
22 Vgl. Witte, Urgeschichte, 136. Weiter siehe M. Bauks, ‚Chaos‘ als Metapher für die Ge-fährdung der Weltordnung, in: B. Janowski / B. Ego (Hg.), Das biblische Weltbid und seine altorientalischen Kontexte (FAT 32), Tübingen 2001, 431–464, hier 433: „Der von Clines ge-nannte Dreischritt darf also nicht in Analogie zur Ordnung aus dem Chaos (Gen 1,2ff.) – Rückfall in das Chaos (Gen 7,11b) – Neuordnung des Chaos (Gen 8,1f.) gesetzt werden, da ein solches Verständnis die Textaussagen weit überträfe. Eher könnte man sagen, daß die Fluterzählung eine Version darstellt, die Rücknahme der Schöpfungsordnung zum Ausdruck zu bringen. Von einem Rückfall in ein primordiales Chaos kann hingegen keine Rede sein.“
10 T. Wagner
Die Arche ist nach Gen 6,15 quaderförmig und umfasst einen Raum von 300 x 50 x 30 Ellen.23 Dieses Maß ist innerhalb des Alten Testaments einmalig; al-lerdings wird auch die Stiftshütte, deren Bau in Ex 25–31 angewiesen und in Ex 35–40 geschildert wird, als ein Gebäude mit einer länglichen Gestalt dargestellt. Eine bewusste priesterschriftliche Parallelisierung der beiden Konstrukte wird erst durch weitere Indizien sichtbar. Sowohl in Gen 6,13f. als auch in Ex 25,1.8 redet Gott und weist auf ähnliche Weise an, das von ihm Gebotene zu erbauen. Gen 6,14 weist die Arche Noah zu (עשה לך), wie Ex 25,8 das Zeltheiligtum Gott zueignet (ועשו לי). Zudem ist der Neujahrstag in beiden Erzählungen von beson-derer Bedeutung, da an ihnen der Raum für die erneuerte Gemeinschaft geschaf-fen wird. Nach Gen 8,13 ist dies der Tag, an dem die Flut vertrocknet und damit die Erde wieder zum Lebensraum wird; nach Ex 40,17 wird an diesem Tag das Heiligtum als Wohnstätte Gottes errichtet. Die Parallelisierung zwischen Arche und Stiftshütte geht graduell soweit, dass der Leser der Priesterschrift zwar die gleichartige Darstellung wahrnimmt, sie geht aber nicht soweit, dass er in der Arche eine Frühform der Stiftshütte wahrnehmen kann. Dies wäre nur der Fall, würden die Maße wirklich übereinstimmen. Die Parallelisierung und die enge Verbindung der Fluterzählung mit der Schöpfungsgeschichte innerhalb der Prie-sterschrift muss demnach eine andere Funktion besitzen.
Diese erschließt sich über eine Schwerpunktsetzung innerhalb der Erzählung. Die Aufzählung der Archeinsassen wird im Lauf der Geschichte insgesamt fünf-mal wiederholt. Damit betont der Erzähler die besondere Bedeutung der Gruppe, die auf der Arche das Hereinbrechen der Chaoswasser und die von Gott ange-kündigte Verderbung der Erde überleben wird. Die Gruppe der Überlebenden besteht aus dem Haus des als צדיק („gerecht“) eingeführten Noah sowie zwei Drittel der Tierarten, die in Gen 1,20 genannt werden. Die im Wasser lebenden Fische (שרץ) sind von der Flutkatastrophe nicht betroffen, wohl aber diejenigen, die als נפש חיה bezeichnet werden, als auch die fliegenden Vögel (עוף יעופף). Von den betroffen Tierarten werden jeweils ein Pärchen auf der Arche untergebracht (Gen 6,19). Verbunden mit dem Motiv der hereinbrechenden Chaoswasser, die durch die Brunnen der Tiefe und die Fenster des Himmels in den von Erdboden und Feste gebildeten Raum hineinlaufen, wird eine Reduktion des bei der Schöpfung gebildeten Raumes vorgenommen, in dem Mensch und Tiere leben. „Zwar bewirkt die Flut nicht die Rückkehr in das totale Chaos, wie dies in Gen 1,2 charakterisiert war, doch ist es die große Urflut von Gen 1,2, die auf die Er-de einstürzt und sukzessiv das ‚Lebenshaus‘ von Gen 1 in ein ‚Todeshaus‘ ver-wandelt – über dem freilich das ‚Lebenshaus‘ der Arche schwimmt.“24 In der
23 Parallelen zu den Maßen des Jerusalemer Tempels, wie sie in 1Kön 6,2 genannt werden (60 x 20 x 30 Ellen) sind m.E. nicht zu erkennen. Zwar ähnelt sich die Formulierung, in der Län-ge, Breite und Höhe angegeben werden, doch besitzt die Arche andere Proportionen, als dies beim Tempel oder auch bei der Stiftshütte (Ex 26,2f.) der Fall ist. 24 E. Zenger, Gottes Bogen in den Wolken. Untersuchungen zu Komposition und Theologie der priesterschriftlichen Urgeschichte (SBS 112), Stuttgart 1983, 114.
Wasser ist nicht gleich Wasser 11
Sintfluterzählung wird die Schöpfung in zweifacher Weise reduziert: Zum einen wird der Raum, der den Lebewesen von Gott geschaffen wird, auf die Arche be-schränkt, zum anderen wird die Gruppe derer, die nach der Flutkatastrophe wei-terleben, auf das Haus des gerechten Noah und jeweils ein Paar aller von Gott geschaffenen Land- und Lufttiere reduziert.25
Diese Beschränkung ist bereits zu Beginn der Erzählung absehbar. In Gen 6,9-12 wird ein Gegensatzpaar eingeführt, das die Geschichte prägt. Noah wird תמלא הארץ) und voller Übel ist (שחת) genannt, während die Erde verderbt צדיק-Dieses in der Einleitung auftretende Gegensatzpaar ruft beim Leser die Er .(חמסwartung nach einer Auflösung bis zum Ende der Geschichte hervor und dient zugleich als Basisopposition des Textes. Der Schluss überrascht den Leser je-doch. Durch die Flutkatastrophe wird eine Reinigung der Erde herbeigeführt, die die Reduktion des menschlichen Geschlechts auf das Haus des gerechten Noah hervorruft. Es wäre also zu erwarten, dass nach der Flut keine חמס mehr existiert und צדק („Gerechtigkeit“) von nun an die Intention allen menschlichen Handelns und Voraussetzung der Gemeinschaft von Gott und Mensch sein wird. Diese Le-sererwartung wird durch das Ende der Geschichte durchbrochen, indem nicht der Wandel der Schöpfung durch die Reinigung, sondern eine Veränderung in der Beurteilung der Schöpfung durch Gott eintritt.26 Die Bundesverheißung in Gen 9,11 geht implizit davon aus, dass das Verderben allen Fleisches wieder einsetzen, dass sich aber keine vergleichbare Strafaktion mehr ereignen wird. Noah und sein Haus werden zu den Bundespartnern Gottes, durch die die ge-samte Menschheit vor einer weiteren Strafaktion geschützt bleibt. Die Basisop-position des Textes ist, anders als es der Anfang der Erzählung vermuten lässt, die Wendung von einem strafenden zu einem bewahrenden Handeln Gottes. Der Sinneswandel geht nach der Darstellung der Priesterschrift von Gott aus und kann vom Menschen nicht beeinflusst werden. Das kultische Handeln, das in P erst nach der Erstellung der Stiftshütte einsetzt, kann dieses Verhältnis nicht ver-ändern. Der Bund ist vom Kult unabhängig.
25 Auch der Bundesschluss enthält eine kosmische Dimension, wie Witte, Urgeschichte, 145, zeigt: „Der zweite Unterabschnitt (9,12–15[16]) verknüpft die Ankündigung der ברית mit der Zusicherung des Zeichens des Regenbogens und des ewigen Gedächtnisses Gottes an die No-ah, seinen Nachkommen und dem gesamten Kosmos gegebene ‚Zusage‘, keine Vernichtungs-flut mehr zu senden. Diese Verse beschreiben somit die zeitliche und räumliche Dimension der angekündigten ברית.“ 26 J.C. Gertz, Noah und die Propheten. Rezeption und Reformulierung eines altorienatlischen Mythos, Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 81 (2007), 503–522, hier 517, geht bei seiner Beschreibung der Basisopposition und ihrer Auflö-sung am Ende der Erzählung über diesen Aspekt hinaus: „Bedenkt man nun, dass der Epilog explizit festhält, dass sich das menschliche Tun und seine Bewertung durch Gott nicht geän-dert haben, wohl aber die Reaktion Gottes auf dieses Tun, dann besteht das Erzählziel des Sintflutmythos in seiner biblischen Fassung in einer Transformation der Gotteskonzeption.“
12 T. Wagner
Zwischenfazit 1: Die priesterschriftliche Sintfluterzählung besitzt damit einen besonderen literarischen Charakter. Sie schließt die kosmogonische Erzählung ab, die in Gen 1,1–2,4a einsetzt. In der Sintfluterzählung wird die Überwindung der Bedrohung der Menschheit durch das außerhalb der Schöpfung existierende Chaoswasser geschildert. Gott wird als Herr über die Chaoswasser dargestellt, der diese bei Bedarf in den von ihm geschaffenen Schöpfungsraum eindringen lassen kann. Die Basisopposition des Textes deutet darauf hin, dass das Ziel der Erzählung die Errichtung des Noah-Bundes ist, der die Menschheit vor einem erneuten Hereinbrechen der Chaoswasser schützt. Damit wird die der Schöpf-ungsgeschichte implizite Fragilität in der Herrschaftsausübung Gottes sichtbar: Er selber verpflichtet sich, die Menschheit vor den kosmischen Chaoskräften zu bewahren. Die fünfmalige Aufzählung der Archeinsassen rückt sie als Ursprung allen nachsintflutlichen irdischen Lebens und als Bundespartner Gottes in den Fokus der Erzählung. Gottes Herrschaft wird zur Schutzherrschaft über Schöp-fungsraum und Lebewesen erhoben. Zugleich werden Menschen und נפש חיה differenziert, indem die Tiere den Menschen von nun als Nahrung dienen wer-den.
III Die nicht-priesterschriftlichen Anteile – der große Regen
a. Die literarische Gestalt der nP-Anteile: Die literarische Gestalt der Ursprünge der nicht-priesterschriftlichen Anteile der Sintflutgeschichte ist nicht eindeutig bestimmbar. Der in der frühen Literarkritik aufgezeigte Erzählfaden beinhaltet zwei Aspekte, die die Annahme einer ursprünglichen Eigenständigkeit fraglich erscheinen lassen.
Nach der einleitenden Beschreibung der Verderbnis der Menschen, die JHWH zum großen Gerichtsschlag ausholen lässt, schließt Gen 7,1 mit der Auf-forderung JHWHs an Noah an, mit seinem ganzen Haus in die Arche zu gehen, ohne dass zuvor ein Auftrag zum Bau einer solchen erfolgte. Zwei Aspekte spre-chen nun dafür, dass dieser Textanteil sich zwingend auf eine Erzählung bezie-hen muss, in der ihr Bau geschildert wird. Erstens wird תבה in Gen 7,1 determi-niert (אל־התבה), was darauf hindeutet, dass die Arche bereits in der Erzählung eingeführt ist, zum anderen beinhalten alle altorientalischen Flutgeschichten die Aufforderung zum Bau eines Schiffes / Kasten, in dem der jeweils vor der Flut zu schützende Mensch während der Katastrophe verweilen soll, sofern der je-weilige Abschnitt erhalten ist. Zweitens fällt auf, dass Gen 7,16b das Besteigen der Arche abschließt. In den V. 10.12 wird allerdings schon der Einbruch der Flut beschrieben. Würde man V. 16b in den üblichen Erzählablauf einordnen, müsste dieser Halbvers in Anschluss an V. 5 stehen. V. 16b schließt in seiner heutigen Stellung an V. 16a an und damit den Einzug in die Arche, wie ihn P beschreibt, ab. Hier verbleiben letztlich zwei Möglichkeiten, den Ursprung des Halbverses zu erklären: Entweder wurde er aus seiner ursprünglichen Position verschoben und hinter V. 16a positioniert, oder er wurde von einem Redaktor
Wasser ist nicht gleich Wasser 13
eingesetzt, der den in der Kompilation entstehenden Wechsel von Gottesnamen und Gottesbezeichnung bewusst aufnahm. Im Blick auf die Kohärenz der nP-Anteile der Sintfluterzählung erscheinen beide Möglichkeiten plausibel zu sein, da die Notiz des Verschlusses der Arche nach dem Einzug für die Erzählung nicht zwingend konstitutiv ist. Sie bleibt auch ohne diese Anmerkung verständ-lich.27
Während diese beiden Aspekte die Annahme einer nP-Sintfluterzählung fraglich erscheinen lassen, stellt sich bei der Betrachtung der weiteren nP-Antei-le die Frage, warum sie eine so hohe Kohärenz besitzen. Es ergibt sich ein durchlaufender Erzählfaden, dessen einzelne Aspekte sich grundlegend von der priesterschriftlichen Darstellung unterscheiden: Während P eine 150-tägige Flut-dauer beschreibt, dauert sie in der nP-Tradition nur 40 Tage und 40 Nächte. Außerdem weicht die Form der Flut ab. P stellt das Eindringen des Chaoswas-sers in den Kosmos da, wohingegen nP die Überschwemmung des Landes auf einen anhaltenden Regen zurückführt. Zudem trennt nP die Besatzung der Arche in reine und nicht reine Tiere und lässt Noah von den reinen jeweils sieben, von den nicht reinen nur ein Paar mitnehmen. P führt diese Unterscheidung nicht durch und beschränkt die Besatzung der Arche auf jeweils ein Paar. Das Zurück-gehen der Flut wird in P mittels eines Raben getestet, der bis zu seiner Landung am Himmel kreist.28 Anders lässt der nP-Erzähler Noah eine Taube aussenden, die zweimal zur Arche zurückkehrt, bis sie schließlich Land vorfindet. Diese Abweichung weist auf eine weitere hin. Während P beschreibt, die Arche sei auf einem Gebirge gelandet und damit bereits auf dem Trockenen, bevor die Wasser die ganze Erde verließen, stellt nP ein Stranden in der Ebene dar, das erst mög-lich wird, als das gesamte Wasser verlaufen ist und auch die Taube mit einem Blatt vom Ölbaum im Schnabel zur Arche zurückkehrt. Die nP-Anteile lassen zudem einen Wochenabstand zwischen dem Bezug der Arche und dem Beginn
27 Narratologisch betrachtet ist die von Schüle, Prolog, 271, angeführte Inkohärenz in Gen 8,1f. unproblematisch, aus der er die Existenz einer zweiten Quelle anzweifelt: „An entschei-dender Stelle lässt sich das Postulat einer zweiten Quelle aber gerade nicht halten. Die neural-gische Stelle ist 8,1–2 als Klimax und Wendepunkt der Erzählung insgesamt: Gottes Be-schluss, die Sintflut zu beenden und die Wasser von der Erde zurückzudrängen. Davon wird nur einmal erzählt.“ Gegen diese Annahme spricht jedoch, dass es innerhalb der nicht-pries-terschriftlichen Darstellung gar nicht zu einer solchen Veränderung kommen muss, da bereits in Gen 7,4 ein 40-tägiger Regen dargestellt wird, der nach genau dieser Dauer aufhört, so dass die Wasser verlaufen (besser wohl versickern) können (Gen 8,3). Das Ziel, das verderbte Le-ben auszurotten, ist nach Gen 7,22 erreicht (vgl. die Ankündigung in Gen 6,7), so das seine Verhaltensänderung Gottes nicht einsetzen muss. Der Gedanke, Gott habe Noah und seines Hauses gedacht (זכר), die Öffnungen des Kosmos verschlossen und den Wind zum Verdrän-gen des Wassers gesendet, ist eine priesterschriftliche Deutung der Wende zugunsten des Überlebens der Gerechten. 28 Siehe Hupfeld, Quellen, 11: „Und es läßt sich […] aus dem den Worten beigefügten Ter-min (‚er flog hin und her bis die Wasser von der Erde vertrocknet waren‘) abnehmen daß er durch sein Hinundherfliegen den in der Arche eingeschloßenen ein Zeichen sein sollte daß die Erde noch nicht getrocknet war.“
14 T. Wagner
des Regens (Gen 7,5) sowie zwischen dem Zeichen des Ölbaumblattes und dem Auszug (Gen 8,12). Schließlich münden die nP-Teile der Erzählung in der Op-ferdarbringung (Gen 8,20f.), die in P nicht erwähnt wird.
Außerdem zeichnen sich die nP-Anteile durch eine divergierende Terminolo-gie aus. Die Öffnung in der Arche wird חלון (Gen 8,6) und nicht צהר (Gen 6,16) genannt; zur Bezeichnung des Geschlechterdifferenzen wird in P נקבה / זכר ver-wendet, während die nP-Anteile אמה / איש bieten. Schließlich unterscheiden sich auch die Bezeichnungen für den Erdboden (P: ארץ / nP: אדמה).
Diese signifikanten Unterschiede führen dazu, dass neben der P-Erzählung auch die nP-Anteile trotz der eingangs erwähnten Mängel als kohärente Darstel-lung erscheinen. Die sprachliche Ausgestaltung des Textes, die konsequente Beibehaltung des Rein-Unrein-Konzeptes sowie die unbegründete Variation von Form und Dauer der Sintflut fördern den Eindruck hoher Kohärenz innerhalb der nP-Anteile. Gerade die letztgenannten Aspekte Form und Dauer der Flut sind als Korrekturen der P-Erzählung kaum erklärbar. b. Ein Vergleichsfall? Die Frage nach einer vormaligen Existenz einer nP-Sint-fluterzählung ist aufgrund des Textbestandes im Endtext Gen 6-9 weder positiv noch negativ zu beantworten. Einerseits können redaktionsgeschichtliche An-sätze, die nicht von einer Quellenkompilation ausgehen, nicht alle Unterschiede als Korrekturen der jeweils anderen Erzählung sowie die hohe Kohärenz inner-halb der beiden Erzählanteile erklären. Andererseits ist die Annahme von zwei ursprünglich getrennt voneinander abgefassten Quellen aufgrund der genannten Inkohärenz in den nP-Anteilen auf Bestand des alttestamentlichen Textes kaum haltbar. Die Annahme, bei der Kompilation der Quellen seien Teile des nP-Textes ausgefallen, ist allein aufgrund des Textbestandes in Gen 6-9 nicht nachweisbar.29 So ist an dieser Stelle nach Vergleichen innerhalb der altorien-talischen Sintflutüberlieferung zu suchen.
Aus der Überlieferung und Fortschreibung der assyrischen Königanalen ist bekannt, dass ältere Quellen in jüngeren Texten aufgenommen werden, dort aber nicht mehr in vollem Umfang wiedergegeben werden. An ihnen erkennt man, dass die Integration von älterem Traditionsmaterial in spätere Texte in der alt-orientalischen Literatur durchaus gebräuchlich ist.30 Bezogen auf die Sintfluter-zählung ist ein solcher Vorgang im sog. Gilgamesch-Epos zu entdecken. Diesem Epos liegen verschiedene Lokaltraditionen und Ausformungen zugrunde. Erst in einem späteren Überlieferungsstadium wurden diese zu einem 12-Tafel-Epos vereint, der seinerseits in verschiedenen Varianten überliefert ist. Die breiteste Textbasis des Epos bietet die sog. ninivitische Version, die aus der Bibliothek Assurbanipals aus Ninive stammt. Auf Tafel XI des 12-Tafel-Epos’ wird von 29 Vgl. Schüle, Prolog, 260: „Was das literargeschichtliche Werden der alttestamentlichen Sintfluterzählung angeht, gab es keine anderen Texte als die, die sich jetzt auch in Gen 6-9 finden.“ 30 Vgl. dazu H.J. Tertel, Text and Transmission. An Empirical Model for the Literary De-velopment of Old Testament Narratives (BZAW 221), Berlin / New York 1994, 232f.
Wasser ist nicht gleich Wasser 15
einer Unterredung zwischen Gilgamesch und Utnapischtim berichtet, in der der von Ea vor der Sintflut gewarnte (Gilgm. XI,20–25) und nach der Flut von Enlil zum Gott erhobene (Gilgm. XI,193f.) Utnapischtim von einem Geheimnis der Götter berichtet (Gilgm. XI,9f.). Inhalt der Erzählung ist eine Sintflutgeschichte, die in Form des Berichtes Utnapischtims in die Gilgamesch-Erzählung integriert ist. Ein älterer Sintflutbericht, der ein Zeuge des mesopotamischen Traditions-prozesses dieses Erzählstoffes ist, liegt mit dem altbabylonischen Atramchasis-Epos vor. Dieser weist seinerseits eine ältere Form der Sintfluterzählung auf. Der Flutbericht des 12-Tafel-Epos’ ist eine produktive Neuerzählung des dem Verfasser wohl bekannten Atramchasis-Epos’.31 Dies wird nicht nur an der Auf-nahme von Thematik und Motivik deutlich, sondern auch am Beinamen Atram-chasis, den Utnapischtim trägt (Gilgm. XI,49). Unter den vielfältigen Unter-
31 Später als in der altbabylonischen Überlieferung in Atr. IIf. ist das Motiv der Flut in der su-merischen Literatur belegt (zur literaturgeschichtlichen Einordnung vgl. Gertz, Noah und die Propheten, 507f.). Auch in ihr ist die Flut in den Kontext von Menschenschöpfung und Streit zwischen den Gottheiten integriert. In dem Mythos wird von König Ziusudra (zi.u4.sud4.ra2 oder zi.ud.su3.ra2) berichtet, der von Enki vor der Flut gewarnt wird, sich ein Schiff bauen kann und in diesem die Zerstörung des Menschengeschlechts überlebt (Übersetzung von H.P. Römer, in: K. Hecker (u.a. Hg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments III. Mythen und Epen I (TUAT III/1), Gütersloh 1993, 448–458; zur Nähe der nP-Anteile von der sumerischen Fluterzählung vgl. J. Wöhrle, Der eine Gott und die gefährdete Schöpfung, in: C. Schwöbel, Gott – Götter – Götzen. XIV. Europäischer Kongress für Theologie (11.-15. September 2011 in Zürich) (VWGTh 38), Leipzig 2013, 320-326, bes. 330f.). Auf ihn bezieht sich in helleni-stischer Zeit der Historiograph Berossos. Die Wiedergabe seiner Darstellung durch Syncellus in Ecloga Chronographica 53-56 (in G.P. Verbrugghe / J.M. Wickersham, Berossos and Manetho: Introduced and Translated. Native Traditions in Ancient Mesopotamia and Egypt, Ann Arbor 1996, 49-51) nennt Χίσουθρος als denjenigen, der vor der Flut gerettet wird. Χίσουθρος ist die Übertragung des sumerischen zi.u4.sud4.ra. Dieser wird in einer Version der sumerischen Königsliste als Herrscher von Schuruppak genannt, der wiederum mit Atramcha-sis identifiziert wird. In einer späteren Textversion des Atramchasis-Epos’ aus dem zwölften Regierungsjahr des Königs Ammi-saduqa (ca. 1635 v.Chr.) wird zi.ud.su3.ra2 als derjenige genannt, der die Menschheit vor der Vernichtung bewahren konnte (CBS 10673). Die spätere Tradition führt also die beiden Gestalten, die die Flut überlebten, zusammen. In der etwa zeitgleich mit der ersten Fassung des Atramchasis-Epos’ entstandenen sumerischen Königsli-ste wird die Sintflut zur markanten Trennlinie zwischen den Herrschern der Vorzeit und denjenigen des historischen Königtums. Dass Berossos neben der sumerischen Tradition auch Atr. IIf. sowie Gilg. XI kannte, ist aus seiner Darstellung nicht zwingend zu entnehmen. Eine Beobachtung weist jedoch darauf hin, dass zumindest Gilgm. XI als Vorlage seiner Darstel-lung diente. Berossos erwähnt in seiner Fluterzählung die Aussendung von mehreren Vögeln, wie sie nur in Gilgm. XI,129-155 erzählt wird. Der Text der Ziusudra-Erzählung erwähnt kein Vogelzeichen. Ob das Atramchasis-Epos eine Vogelflugszene beinhaltete, ist unklar, da der Text an der möglichen Stelle nicht mehr rekonstruierbar ist. W. von Soden in K. Hecker u.a. (Hg.), Texte aus der Umwelt des Alten Testaments III. Mythen und Epen II (TUAT III/2), Gütersloh 1993, 642 weist in seiner Übersetzung des Atramchasis-Epos’ darauf hin, dass nach „den ganz geringen Zeilenresten [...] hier der alte Text weithin anders gelautet haben“ muss. Wenn diese Beobachtung stimmt, dann muss Berossos nicht nur die sumerische Ziusudra-Erzählung und das Atramchasis-Epos, sondern auch den 12-Tafel-Epos als Vorlage verwen-det haben.
16 T. Wagner
schieden zwischen den beiden Erzählungen ist ein Aspekt für die Annahme ei-ner Quellenkompilation in Gen 6–9 von besonderer Bedeutung.
Im Atramchasis-Epos ist die Sintflut eine von drei Plagen, mittels derer die Menschheit ausgerottet werden sollen. Enlil, den der Lärm der Menschen stört, fordert die Wettergottheit Adad auf, eine Trockenzeit über das Land kommen zu lassen, die zu Missernten und zu einer Hungersnot führen wird: „Seine Regen-wolken wische Adad weg; gut (wirkend) komme kein Hochwasser aus der Was-sertiefe! Der Wind fahre daher, entblöße das Land, die Wolken mögen sich prall füllen, und doch tropfe das Naß nicht herab. Es vermindere das Feld seinen Er-trag, Nisaba verriegele ihre Brust“ (Atr. II,2:12–15).32 Diese erste Hungersnot durch das Ausbleiben des Regens kann auf einen Ratschlag Enkis abgewendet werden (Atr. II,2:34). Eine zweite Hungersnot bricht über die Menschen hinein, als im Folgenden die Fruchtbarkeit der Felder zurückgeht, da das Grundwasser versiegt (Atr. II,4:2f.) und die Felder versalzen (Atr. II,4:7f.). Dieses Strafhan-deln geht offenbar von Enlil selber aus, der sich in Atr. II,5:17 die untere Welt als seine Machtsphäre beschreibt. Offenbar gegen seinen Willen schenkt Enki den Menschen das Lebensnötige (Atr. II,5:20), so dass das auch diese Maßnah-me Enlils weitgehend erfolglos bleibt. Im Rat der Götter erwirkt Enlil schließ-lich eine dritte Plage gegen die Menschen. Nach der Verkarstung des Landes setzen Regengüsse ein, so dass es zu einer Überschwemmung des Landes kommt (Atr. II,6:10–12 mit Textlücken, offenbar als Sintflut gedacht; vgl. die Reaktion Enkis in Atr. II,6:44).33 Eine Versorgung der Menschen während der Flut wird den Göttern untersagt. Mit Atramchasis kann schließlich der eine von Enki vorgewarnte Mensch die Sintflut und damit die aus drei Plagen bestehende Katastrophe überleben.
In der Sintflutgeschichte des 12-Tafel-Epos’ einzig die Überflutung des Lan-des durch Regenfälle dargestellt. Gilgm. XI,94–112 schildern den Beginn der Regenfälle, Gilgm. XI,130f. dann ihr Aufhören und damit auch den Zeitpunkt, an dem die Sintflut ihr Ende findet.34 Diese Reduktion des Erzählstoffes erfolgt aufgrund der Funktion, die die Sintfluterzählung innerhalb des 12-Tafel-Epos’ besitzt. Während die Erklärung für die Fortexistenz der Menschheit trotz des Zornes Enlils das Erzählziel des Atramchasis-Epos’ darstellt, dient die Erzäh-lung über die Errettung Utnapischtims der Begründung, warum dieser zum Gott werden konnte (Gilgm. XI,193f.). Von einem zunehmend eskalierenden Streit der Götter, in dem Enki versucht, den Menschen zu beschützen, wird im 12-Tafel-Epos nichts berichtet. In ihm wird alleine das Überleben eines einzelnen
32 TUAT III/2, 629. 33 Atr. II 2:30–34 zeigt, dass die Bewirtschaftung der Felder sich durch morgendlichen Tau und nicht durch Regenfälle am ertragreichsten gestaltet. 34 Dies gilt nicht nur für den 12-Tafel-Epos, sondern auch für die ugaritische Atramchasis-Er-zählung (RS 22.421). In ihr wird nur die Flut beschrieben, die Kosmogenese sowie die wiete-ren Plagen werden nicht erwähnt. Vgl. dazu W.G. Lambert / A.R. Millard, Atra-hasis: The Babylonian Story of the Flood, Oxford 1969, 6.131–133.
Wasser ist nicht gleich Wasser 17
Menschen bzw. seines Hauses dargestellt, das sich bereits im Atramchasis-Epos auf die Flutkatastrophe beschränkt. So ist es verständlich, warum eine derartige Auswahl und Konzentration des Erzählstoffes erfolgte.
Der Vergleich der beiden mesopotamischen Überlieferungen der Sintflut zeigt, dass der ursprüngliche Umfang der Erzählung im Atramchasis-Epos bei der Integration in das 12-Tafel-Epos aufgrund der Funktion der Erzählung für den Epos nachgebildet, verändert und gekürzt wurde, so dass Teile des Gesamt-zusammenhanges verloren gingen. Bezogen auf die nP-Anteile der alttestament-lichen Sintflutgeschichte bedeutet dies, dass ein Wegfall von Erzählanteilen bei einer möglichen Quellenkompilation nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden kann, zumal dann nicht, wenn die Kompilation als Einbau einer Quelle zur Er-gänzung einer anderen Quellen unter einem leitenden Kriterium vorgenommen wurde. Zwischenfazit 2: Die Kohärenz der nP-Anteile der alttestamentlichen Sintflut-geschichte ist, will man diese vor der redaktionellen Verbindung mit der pries-terschriftlichen Darstellung als eigenständige Sintflutgeschichte deuten, durch zwei Aspekte gestört. Zum einen fehlen eine Aufforderung zum Bau der Arche sowie ein entsprechender Baubericht, wie sie sowohl in P als auch in der Ziu-sudra-Erzählung, im Atramchasis- und im 12-Tafel-Epos sowie in der Fluter-zählung Berossos’ beinhaltet sind. Zum anderen wirkt Gen 7,16b in seiner Stel-lung innerhalb des Textes deplaziert und müsste, damit der Erzählablauf ge-wahrt ist, an Gen 7,5 und nicht an V. 12 anschließen. Beide Beobachtungen sprechen dafür, dass die nP-Anteile keine eigenständige Erzählung bildeten. Dem widerspricht jedoch die hohe Kohärenz der literarkritisch ausgesonderten nP-Anteile, die neben einer durchgehenden und im weiteren Verlauf stimmigen Erzählung auffällige, in der Erzählung unbegründete Unterschiede zur priester-schriftlichen Darstellung aufweisen.
Der nach der Problemanzeige erfolgte Vergleich von Atr. IIf. und Gilgm. XI zeigt, dass auch bei der Übernahme der Sintfluttradition in den 12-Tafel-Epos Teile der älteren Überlieferung unberücksichtigt blieben, die für die neu entste-hende Erzählung und deren Funktion im Epos nicht relevant sind. Der Ver-gleichsfall zeigt, dass es also allein aufgrund des Quellenbestands in Gen 6–9 nicht eindeutig zu klären ist, ob weitere nP-Anteile einer möglichen Quelle weg-fielen oder ob diese nie existierten, da die nP-Anteile zu keiner Zeit eine eigen-ständige Quelle bildeten. Redaktionsgeschichtlich betrachtet stellt sich nun die Frage, ob in Gen 6–9 ein Aspekt erkennbar wird, der für die Redaktoren bei der Zusammenstellung der Quellen leitend war und der zu einer Textauswahl führte.
IV Wasser ist nicht gleich Wasser – zur Redaktion der Sintflut- erzählung
a. Das Zeitschema: Im Vergleich mit den weiteren altorientalischen Sintfluter-zählungen weist die priesterschriftliche eine Eigenheit auf, die in der vorausge-
18 T. Wagner
henden Darstellung bereits mehrfach anklingt und die als Ausgangspunkt für die Analyse der Redaktionsgeschichte von Gen 6–9 dient. In der P-Erzählung wird als Ursprung der Flut kein starker Regenfall genannt, sondern als Flut sammeln sich die bei der Schöpfung des Kosmos durch den Bau der Himmelsfeste nach außen gedrängten Chaoswasser im Schöpfungsraum. Dieses wird in Gen 6,17 mit einer Erklärung der Flut eingeführt: ואני הנני מביא את־המבול מים על־הארץ לשחת .Siehe, ich werde die Flut kommen lassen„) כל־בשר אשר־בו רוח חיים מתחת השמיםWasser wird auf / über dem Land sein, um alles Fleisch, in dem sich Lebens-geist befindet, unterhalb des Himmels zu verderben“). Mit מים על־הארץ wird die genaue Form der Sintflut genannt. In Gen 7,6 wird die Formulierung wiederholt: und die Sintflut geschah, Wasser war auf / über dem„) והמבול היה מים על־הארץLand“). Auf die Ankündigung und ihre Erfüllung beziehen sich im Folgenden Gen 7,17b.18.19.20.24; 8,5.13a. An diesen Stellen wird מים determiniert. Der Ursprung des Wassers wird in nach der Erfüllungsansage in Gen 7,6 dargelegt. Es dringt nach Gen 7,11 durch מעינת תהום רבה („Brunnen großer Tiefe“) und -in den Schöpfungsraum ein. Diese An (“Fenster des Himmels„) בתאר השמיםgaben verdeutlichen, dass es sich bei den über die Erde ausbreitenden Wassern nicht um diejenigen handelt, die von Gott an die Ränder des Landes verdrängt wurden (Gen 1,9f.). Die Wasser werden erst durch das Eingreifen Gottes, der die Öffnungen des Schöpfungsraumes verschließt und einen Wind auf die Erde sendet, von der Erde verdrängt.35 In Gen 9,11 wird schließlich deutlich, dass mit dem zuvor Geschilderten ein einzigartiger Vorgang dargestellt wird. Das Auftre-ten einer weiteren Sintflut wird ausgeschlossen. Die Verwendung des undeter-minierten מבול in Zusammenhang mit der in Gen 6,17 erfolgten Erläuterung der Form der Flut deutet darauf hin, dass eine Sintflut auch in anderer Form über das Land hereinbrechen könnte. Die Zusage in Gen 9,11 lässt also keine Form einer מבול mehr zu. Dies wird in V. 15b deutlich, wenn der priesterschriftliche Autor die Anwesenheit von Wasser zum Zwecke einer Sintflut ausschließt: und es wird kein Chaoswasser mehr als„) ולא־יהיה עוד המים למבול לשחת כל־בשרSintflut sein, um alles Fleisch zu verderben“). Die Sintflut als kosmische Katas-trophe und als Reduktion des Schöpfungsraumes ist folglich ein einmaliges Er-eignis, dessen Wiederholung durch den Noahbund ausgeschlossen wird.
In den nP-Anteilen von Gen 6–9 wird die Überflutung des Landes mittels heftiger Regengüsse herbeigeführt, was der Darstellung in Atr. III und Gilgm. XI entspricht. Dabei erscheinen unterschiedliche Ausdrücke, die die Flut be-zeichnen. In Gen 7,10 wird mit מי המבול („Wasser der Sintflut“) vorausgesetzt, dass die Flut bereits bekannt ist, da מבול an dieser Stelle determiniert erscheint. Dieses setzt sich in Gen 7,17 fort, auch hier wird מבול determiniert. In den nP-Anteilen in Gen 8,3.7.11 wird mit המים („die Wasser“) das Wasser bezeichnet, das durch die Regenfälle auf Erden kam und das an deren Ende vom Erdboden abläuft. In Gen 8,9 wird im Zusammenhang mit der Rückkehr der Taube zur Ar- 35 Zum priesterschriftlichen Zusammenhang von der Wendung in Gottes „Gedenken“, dem Verdrängen der Wasser und dem Bundesschluss, vgl. Witte, Urgeschichte, 139.
Wasser ist nicht gleich Wasser 19
che מים nicht determiniert. Innerhalb der Erzählung hängt dies damit zusammen, dass nicht zwischen den Wassern der Regenflut und den sich in Flüssen, Seen und Meeren sammelnden Wassern unterschieden wird (כי־מים על־פני כל־הארץ „denn noch waren Wasser auf der gesamten Erde“).36
Verbunden erscheinen die beiden Überflutungsformen mit unterschiedlichen Zeitschemata. Die Regengüsse werden in Gen 7,4 mit einer Dauer der Flut von insgesamt 54 Tagen verbunden. Nach der Aufforderung JHWHs an Noah, die Arche zu beziehen, dauert es sieben Tage, bis die Regenfälle einsetzen. An-schließend regnet es vierzig Tage und Nächte, ehe der Regen aufhört und sich das Wasser verläuft. Anders wird die Katastrophe in der priesterschriftlichen Sintfluterzählung terminiert. Sie beginnt am 17. Tag des zweiten Monats im 600. Lebensjahr Noahs mit dem Öffnen der Brunnen der Tiefe und der Fenster des Himmels (Gen 7,11), der Wasserzulauf dauert 150 Tage an, bis die Arche zehn Tage später auf dem Plateau des Gebirges auf Grund läuft. Erst zu Beginn des 601. Lebensjahres Noahs ist das Chaoswasser, das in den Schöpfungsraum eindrang, verlaufen (Gen 8,13a), bis die Erde weitere 57 Tage später vollständig abgetrocknet ist (Gen 8,14). Erst zu diesem Zeitpunkt wird Noah von Gott auf-gefordert, die Arche wieder zu verlassen.
Miteinander verbunden werden die beiden Schemata durch die Integration der Regenflut in das Eindringen der Chaoswasser. Nachdem JHWH in Gen 7,4 den 40-tätigen Regen ankündigte, wird in Gen 7,6 das Alter Noahs zu Beginn der Flut mit 600 Jahren angegeben. Spezifiziert wird diese Angabe dann in Gen 7,11, in dem der genaue Tag genannt wird. An diesem öffnen sich die Brunnen der Tiefe und die Fenster des Himmels. Dieses wird mit dem Einsetzen des Re-gens in der Form verbunden, als dass die geschlossene Einheit נבקעו כל־מעינת es brachen alle Brunnen der große Tiefe auf und„) תהים רבה וארבת השמים נפתחוdie Fenster des Himmels öffneten sich“) mit ויהי הגשם על־הארץ („und es ereignete sich der Regen auf der Erde“) fortgesetzt wird. Der Regen wird als zeitgleicher, aber gesonderter Vorgang verstanden und besitzt eine eigenständige Funktion.37 Gen 7,21f. zeigen, dass innerhalb der 40-tägigen Regenperiode alle Lebewesen des Erdbodens und der Luft sterben.38 Allein Noah und die weiteren Archeinsas-sen überleben die Regenzeit. Nach den 40 Tagen wachsen die Wasser weiter an, bis die mit der Überschwemmung des Schöpfungsraumes verbundene 150-Tage-Grenze erreicht ist (Gen 7,24). Erst danach kommt es zu einer Wendung in Got-
36 Zur Kompilation vgl. Witte, Urgeschichte, 136: „Zwar könnte inhaltlich das Bild vom Sturzregen als eine literarisch ursprüngliche Explikation des Bildes vom Bersten der Him-melsöffnungen verstanden werden. Die Nähe von V. 12 zu V. 4 spricht aber dafür, V. 12a mit dem Vorstellungshorizont von 7,4 (מטר [Hif.]) in Verbindung zu bringen und auf den Verfas-ser von 7,1a.2.4 zurückzuführen.“ Damit wird deutlich, dass es sich um zwei getrennte Erzäh-lungen und damit zwei unterschiedliche Ursprünge der Flut handelt, die miteinander verbun-den wurden. 37 Vgl. hierzu schon Schrader, Studien, 153, der darauf hinweist, dass in der Kompilation גשם und מבול miteinander identifiziert werden. 38 Zum weiteren Zeitschema des nP-Berichtes vgl. Schrader, Studien, 153f.
20 T. Wagner
tes Wahrnehmung, da er dann der Archeinsassen gedenkt. Durch die Zusam-menstellung der beiden Zeitabläufe kommt es zu einer Differenzierung im Handlungsablauf. Wird in der priesterschriftlichen Sintfluterzählung noch ein Strafhandeln Gottes an den Lebewesen von 150 Tagen berichtet, das nach ihrem Untergang durch sein Gedenken an Noahs Haus ein Ende findet, wird die Zeit der Sintflut in der redaktionellen Kompilation in Abschnitte getrennt. In den ers-ten 40 Tagen erfolgt die Ausrottung der Lebewesen, in den folgenden 90 Tagen wird die Flut fortgesetzt, da Gott der Archeinsassen noch nicht gedachte. Sie sind zwar nicht das Ziel seiner Strafe, vielmehr werden sie vor diesem ge-schützt, doch müssen sie mit den Folgen von Gottes Gericht leben und dement-sprechend ausharren, bis Gott ihrer wieder gedenkt. b. Israel in der Nachfolge Noahs: Literaturgeschichtlich betrachtet stellt die In-tegration der nP-Anteile in die priesterschriftliche Flutgeschichte eine Form der Rezeption dieser Erzählung durch die alttestamentlichen Autoren dar, die im Kontext der weiteren Aufnahme und Deutung der Fluterzählung in diesen Schriften zu betrachten ist. Doch anders als in der mesopotamischen Literatur, in der die Fluttradition und -metaphorik außerhalb der Fluterzählungen und den Königslisten in weiteren Epen mit anderer Thematik, in Fluchandrohungen von Vertrags- und Rechtstexten sowie in Königsinschriften zur Beschreibung militä-rischer Erfolge verwendet wird, bietet das Alte Testament nur wenige Anspie-lungen auf die Fluterzählung. Einige finden sich im priesterschriftlichen Antei-len des Pentateuch, die meisten jedoch in prophetischen Texten, die späterer Zeit entstammen.
Die für den Bestand und die Ausbreitung aller Lebewesen charakteristischen Formel פרו ורבו („seid fruchtbar und mehret euch“), die sowohl in Gen 1,22.28 als auch in Gen 8,17; 9,1.17 jeweils in den P-Anteilen nach der Schöpfung und nach der Flut erscheint, wird innerhalb des Altes Testaments nur noch in Jer 23,3 und in variierter Reihenfolge in Ez 36,11 aufgenommen. Beide Texte sind Heilsweissagungen an das exilierte Israel, in denen jeweils auf die Zeit nach der Verbannung vorausgeblickt wird.
Jer 23,1-8 ist als Heilsweissagung post iudicium formuliert, mit der ein neuer David für die Zeit nach der Sammlung aller Verstoßenen verheißen wird. Moti-visch und perspektivisch beleuchtet Jer 23,3 in seinem Kontext die Erneuerung des Gottesvolkes,39 das nach seiner Wiedervereinigung „fruchtbar sein und sich mehren“ (פרו ורבו) soll. Mit der Formulierung nimmt Jer 23,3 explizit Bezug auf den Auftrag an die Menschheit, die Erde zu besiedeln. Dabei wird der Auftrag jedoch allein auf das sich in nachexilischer Zeit sammelnde Israel bezogen, das wieder zu einem großen Volk wachsen soll. Rückblickend wird dieses dann in Jer 3,16f. dargeboten. In dieser Verheißung eines neuen Hirten für Israel werden
39 Zur Datierung des Textes vgl. W.H. Schmidt, Das Buch Jeremia. Die Kapitel 21–52 (ATD 21), Göttingen 2013, 26: „Hier vollzieht sich eine Auslegung seiner Botschaft nach der Katas-trophe durch die (jerdtr) Redaktion.“
Wasser ist nicht gleich Wasser 21
Fruchtbarkeit und Mehrung als Zeichen des Wohlwollen Gottes gedeutet, der auf Zion seinen Sitz, den er zuvor auf der Lade besaß, einnehmen wird. Hier wird die eschatologische Entstockung aller Völker geschehen, so dass der Be-stand der Erde nicht mehr durch göttliches Gericht gefährdet sein wird. Deutlich wird auch hier, dass sich die nachsintflutliche Verheißung von Fruchtbarkeit und Vermehrung auf Israel beschränkt, während die Völker nur durch die Anerken-nung des auf dem Zion thronenden Königsgottes JHWH dauerhaft bestehen werden.
Das Buch Ezechiel weist ebenfalls die Ansage der Erneuerung des davidisch-en Königtums und die Mehrung der nach Israel Zurückehrenden auf, auch wenn dieses nicht innerhalb eines Textes erfolgt. Ez 34 bietet die Erneuerung der davi-dischen Herrschaft durch einen von Gott eingesetzten Hirten, Ez 36 behandelt die Wiederbesiedlung des Landes. Unterbrochen wird der Zusammenhang nur durch die Unheilsansage über Edom in Ez 35. Für die Rezeption der Sintfluter-zählung ist vor allem die Mehrungsansage in Ez 36,11 von Interesse. Diese ist ebenfalls rein auf Israel bezogen. Ez 36 beschreibt den Untergang Israels als umfassendes göttliches Gericht, durch das die gesamte Bevölkerung getötet oder deportiert wird. Israel verbleibt als von Mensch und Tier unbewohntes Land, das nach dem Vollzug der göttlichen Strafe wieder neu besiedelt und kultiviert wer-den muss. Die Rückkehr der Bewohner wird in V. 11 mit רבו ופרו beschrieben.40 Damit greift der Redaktor, der die Glosse רבו ופרו einsetzte, auf den bereits zu-vor bestehenden engen Bezug zwischen der priesterschriftlichen Urgeschichte und der Heilsweissagung in Ez 36 zurück, in dem er auf die ursprüngliche Heils-zeit zurückblickt und eine zukünftige ansagt. In Ez 36 bleibt der Anfang der neuen Heilszeit jedoch auf Israel beschränkt, die anderen Völker, die nach Gen 6-9 auch im Fokus der Verheißung stehen müssten, werden nicht berücksichtigt.
Ähnlich wird das Motiv auch in Lev 26 rezipiert. In diesem das Heiligkeits-gesetz mit der Verheißung von Segen und der Androhung von Fluch abschlie-ßenden Kapitel wird die Bundeszusage an Israel in V. 9 erneuert. Auch hier liegt die Perspektive auf der Zeit nach dem göttlichen Gericht, da Gott neben der Zu-wendung das Fruchtbarmachen und das Mehren (הפריתי אתכם ביתיוהר אתכם „ich werde euch fruchtbar machen und ich werde euch mehren lassen“) zusagt. Die am Ende der Sintflut auf den Gesamtbestand des Lebens auf Erden bezogene Zusage wird in Lev 26 auf Israel konzentriert. Der Prozess nach dem Gericht wird dem nach der Flut entsprechen, allerdings auf das Gottesvolk beschränkt bleiben.
Ein weiterer Aspekt zeigt, dass die inneralttestamentliche Rezeption der Sint-flutgeschichte das Verhältnis zwischen Gott und Noah auf das Verhältnis Gott – Israel überträgt. Zum priesterschriftlichen Anteil der Erzählung gehört die Zusa-
40 Die Umstellung der Formel פרו ורבו, wie sie in der biblischen Urgeschichte mehrfach er-scheint, ist vom Kontext bedingt, da sie an das voranstehende רבה hi anschließen müssen. Vgl. T. Wagner, ‚Ungeklärte Verhältnisse‘. Die priesterliche Urgeschichte und das Buch Ezechiel, KuD 59 (2013), 207–229, 224f.
22 T. Wagner
ge Gottes, des Bundes, den er nach der Sintflut mit Noah für alle Lebewesen schließt, zu gedenken (Gen 9,15).41 In der Rezeption wird das Gedenken an den Bund, das in den priesterschriftlichen Genesistexten allein mit dem Noahbund verbunden ist, auf den Abrahambund übertragen (Lev 26,43).42 Dieses Geden-ken wird dazu führen, dass Gott Israel auch dann nicht verwirft, wenn er es be-straft und das Abraham verheißene Land von Feinden beherrscht wird. Die Übertragung des Motivs wird auch in Ez 16,59–63 sichtbar. In der Erweiterung des Gerichtswortes gegen Jerusalem Ez 16 nimmt der Redaktor in den V. 59-63 mit der Formulierung זכר ברית (V. 60) auf das Gedenken Gottes an den Bund Bezug, in dem Gott dem Volk verheißt, es trotz seiner Fehlverhalten nicht dau-erhaft zu verwerfen, sondern nur vorübergehend zu strafen. Weitere Strafen sol-len ausbleiben, da der Bund zum unverbrüchlichen (ברית םעול) wird. Als solcher aber ist der Bund mit Abraham von Anfang an gestaltet (Gen 17,7), in Gen 17 jedoch mit dem Ziel, die Verehrung Gottes durch die Nachkommen Abrahams zu sichern. Das Scheitern dieses Vorhabens führt nach Lev 26 und Ez 16 zum Gericht, dem die Veränderung des Bundes im Sinne des Noahbundes (kein Ge-richt trotz Fehlverhalten Israels) folgt.
Erneut auf den Noahbund spielt Jes 54,9f. an. Jes 54 stellt eine spätere Er-weiterung des dtjes Grundbestandes dar und blickt auf die Heilszeit, die Juda nach der Rückkehr JHWHs zum Zion in Jerusalem erleben wird, voraus. In der Heilsansage wird in Jes 54,7f. auf das Exil als der kurzen Zeit, in der Gott sein Volk verließ, zurückgeblickt. Dieser Zeit wird eine lang andauernde Gnadenzeit folgen (ובחסד עולם רחמתיך „und in ewiger Gnade erbarme ich mich deiner“). Die-ser Umschwung am Ende des Exils wird mit der Zeit Noahs verglichen, indem der mit Noah geschlossene Bund, die Wasser nicht mehr über die Erde kommen zu lassen, mit der Verheißung von Jes 54,1–10 gleichgesetzt wird (V. 9). Dieses unbedingte Versprechen bezeichnet der Autor in V. 10 als ברית שלום („ewiger Bund“), der dauerhaften Bestand haben wird. Anders als in allen weiteren Tex-ten, die Motive aus der Sintfluterzählung aufnehmen, geht Jes 54,1–10 nicht auf das Verhältnis des Gottesvolkes zu den anderen Völkern ein.
Im Kontext des Jesajabuches wird dieses in Jes 24–27 thematisiert.43 In die-sem Abschnitt des Buches befinden sich mit Jes 24,1–20 und Jes 26,7–21 zwei Texte, die Motive aus der Sintfluterzählung aufnehmen. Jes 24,1–20 stellt als
41 Vgl. dazu N.C. Baumgart, Art. Sintflut, www.wibilex.de, 2005: „Der erste Bund zeichnet vor, was sich im zweiten Bund ereignen wird: Im Zentrum der Erzählung ‚gedachte’ Gott der-er, die während der Katastrophe in der Arche, in der Kleinausgabe der Welt waren, und leitet so das Abnehmen der Flut ein (Gen 8,1), um das anvisierte Überleben zu ermöglichen. Ent-sprechend verdeutlicht Gott beim zweiten Bund mit der gesamten Welt, dass er – bei Gefahr – dieses Bundes ‚gedenken‘ wird (Gen 9,14f.16), was zugleich das Weiterleben ermöglicht.“ 42 Zur Abfassungszeit von Lev 26 in nachexilischer Zeit vgl. C. Nihan, The Priestly Cove-nant, Its Reinterpretations, and the Composition of ‚P‘, in: S. Shectman / J.S. Baden (Hg.), The Strata of the Priestly Writings. Contemporary Debate and Future Directions (AThANT 95), Zürich 2009, 87–134, bes. 107–109. 43 Vgl. zur Aufnahme der Sintfluttradition in Jes 24–27 Bosshard-Nepustil, Sintflut, 248–259.
Wasser ist nicht gleich Wasser 23
Abschluss der Fremdvölkersprüche das Gericht Gottes an allen Völkern der Er-de dar. In den V. 1–5 wird die Verwüstung der Erde und die Zerstörung allen Lebens ohne wörtliche Übereinstimmung mit der Sintflutgeschichte angesagt. Die Zerstörung wird damit begründet, dass die Bewohner der Erde den ewigen Bund (ברית עולם) brechen. Mit der Gerichtsansage wird die Verheißung, die JHWH allen Menschen im Noahbund am Ende der Sintfluterzählung gibt, auf-gehoben.44 Der Bund und das gesamte Leben auf Erden werden also nicht beste-hen bleiben. Das Gericht an den Völkern wird in Jes 26,7–21 erneut mit einem Bezug zur Sintflutgeschichte behandelt. In diesem Text wird die Machtlosigkeit Judas gegenüber dem göttlichen Gericht betont, da sie nicht in der Lage sind, den Bestand von Land und Erdbewohnern wahren und vermehren zu können (V. 18). Dafür werden die Toten des Volkes nach dem göttlichen Gericht aufer-stehen (V. 19). Den noch Lebenden rät der Verfasser, sich vor dem göttlichen Zorn zu verbergen (V. 20). Schließlich nennt V. 21 den Grund für die Vernich-tung der Menschen: Die Erde wird das vergossene (Menschen-) Blut (דם) offen-baren. Damit zeigt sie an, dass das von Gott an Noah übermittelte Tötungsverbot übertreten wurde und das Versprechen Gottes des dauerhaften Bestandes hinfäl-lig wird.
Schließlich wird das Gericht Gottes an den Völkern mit einer Anspielung auf die Sintfluterzählung auch in dem späten prophetischen Text Joel 4 beschrieben. In V. 13 wird Schlag gegen die Völker mit כי רבה רעתם („denn groß ist ihre Bos-heit“) begründet. Diese Aussage findet sich nahezu gleichlautend am Anfang der kompilierten Sintfluterzählung in Gen 6,5 (כי רבה רעת האדם „denn groß ist die Bosheit des Menschen“). Mit der Anspielung werden zugleich die Folgen ver-bunden. So, wie der göttliche Gerichtsschlag während der Sintflut die gesamten Menschheit traf, so wird der zukünftige die Völker treffen, die sich gegen das göttliche Gebot, Menschenblut zu vergießen, verstießen (V. 19f.). Damit gilt der einst mit Noah geschlossene Bund für sie nicht mehr.
Der Überblick über die Texte des Alten Testaments, in denen einzelne As-pekte der Sintfluterzählung rezipiert werden, führt zu einem in zweierlei Hin-sicht überraschenden Ergebnis. Zum einen fällt auf, dass mit Ausnahme von Joel 4 kein anderer Text die Kompilation der Sintfluterzählung voraussetzt. Joel 4 beinhaltet mit der wörtlichen Anspielung auf Gen 6,5 und der Begründung für das Gericht, die Völker hätten Menschenblut vergossen und damit gegen das göttliche Gebot verstoßen, zwei Aspekte, die erst nach der redaktionellen Bear-beitung der Sintfluterzählung vereint sind. Alle anderen Texte, die auf die Sint-fluterzählung anspielen, beziehen sich auf Aspekte, die den priesterschriftlichen
44 Vgl. Bosshard-Nepustil, Sintflut, 252f.: „Allerdings ist das Verhältnis zwischen Blutschuld und Bund in Jes 24,5 anders gefasst als in Gen 9,1–17. Dort ist die Eingrenzung von Gewalt-tat, die sogenannten noachitischen Gebote, als Voraussetzung für Gott verstanden, dass er überhaupt den Bund schließen und eine künftige Flut ausschliessen kann. In Jes 24,5 hinge-gen haben Weisungen und Satzungen offensichtlich die Funktion eines Bundeskriteriums für den Menschen: Wenn er die Gebote bricht, bricht er den Bund.“
24 T. Wagner
Anteilen entstammen. Dies bedeutet im Blick auf die literaturgeschichtlichen Prozesse, dass Gen 6-9 durchaus erst in einem späteren Stadium der Entstehung alttestamentlicher Schriften redaktionell bearbeitet worden sein kann. Zum an-deren wird trotz der Universalität der göttlichen Bundesverheißung in Gen 9,15 die Partikularität von Heil und Gericht betont. Jer 23,1–8 und Ez 36,11 verste-hen die Wiederbesiedlung Judas in nachexilischer Zeit als Wachstumsprozess, der der Vermehrung von Mensch und Tier nach der Sintflut gleicht. Lev 26,43 und Ez 16,59-63 verbinden den Abraham- mit dem Noahbund, so dass die unbe-dingte Heilsverheißung allen Nachkommen Abrahams gilt. Die späten prophe-tischen Gerichtstexte Jes 26,7–21 und Joel 4 lösen den Noahbund in eine andere Richtung auf. Sie heben die Verfehlung der Völker gegen das Verbot des Blut-vergießens hervor. Dieser Verstoß führt zu einem unfassenden göttlichen Ge-richt, vor dem Israel jedoch gewarnt wird, so dass es sich – wie Noah in der Ar-che – vor dem Schlag Gottes retten kann.
Im Vergleich mit der weiteren Rezeption ist nun zu fragen, welche Position die Redaktion der Sintflutgeschichte ihrerseits einnimmt. Diese wird durch eine durch die Kompilation entstehende Fügung deutlich. Die nP-Anteile von Gen 6-9 schließen die Sintflut mit einem Opfer Noahs ab, durch das Gott den Errette-ten und allen nachfolgenden Generationen gegenüber wohlgefällig werden soll. „YHWH lässt sich gnädig stimmen durch das Opfer Noahs. Dessen angenehmer Geruch steht in direktem Zusammenhang mit der Ankündigung, dass die Rhyth-men der Schöpfung – Saat und Ernte, Sommer und Winter, Tag und Nacht – für immer bestehen bleiben.“45 Damit wird das Opfer für alle Menschen zur „ele-mentare[n] Form des Lebens vor Gott“46. Durch die Kompilation wird diese Form des Lebens zum Bestandteil des Bundes zwischen Gott und Mensch. Wäh-rend der priesterschriftliche Bund zunächst unkonditioniert bleibt und vom Ver-halten des Menschen unabhängig ist, wird durch das Gott wohlgefällig stimmen-de Opfer eine Voraussetzung für den Bund genannt. Im Endtext der Sintflut-erzählung ergibt sich auf diese Weise eine kausal begründete Kontinuität der Bundesthematik. Während sich die Verheißung des Bundes nur an Noah und sein Haus richtet (Gen 6,18), wird dieser, nachdem Gott durch das Opfer umge-stimmt wurde,47 eine Verheißung an alle die Erde bewohnenden Lebewesen. Durch die Kompilation entsteht so ein doppelter Bezug: Noah und sein Haus werden als Bundespartner Gottes bei der Flut der verderbten Menschheit (Gen 6,5-8) gegenübergestellt. Der Bund mit Noah wird anschließend auf die nach der Sintflut die Erde bevölkernden Lebewesen trotz ihrer fortwährenden Verfehlun-gen ausgeweitet, was aber erst durch Noahs Opfer bewirkt wird. Die Rettung al-ler zukünftiger (und wohl sündhafter) Menschen ist daher von seinem Opfer ab-hängig. Für die weitere Rezeption bedeutet dies, dass Israel als das Volk, das
45 Schüle, Prolog, 287. 46 Schüle, Prolog, 289. 47 Witte, Urgeschichte, 183, zeigt auf, dass die Opferszene in einer „chiastischen Korrespon-denz“ zu Gen 6,5–8 steht. Dieses weist auf die eigenständige Komposition der nP-Anteile hin.
Wasser ist nicht gleich Wasser 25
JHWH verehrt, ihn mit seinem Opfer beruhigen und gegenüber der Völkerwelt wohlgefällig stimmen kann. Auf diese Weise rekurriert der Kompilator auf die Verheißung Gottes an das Volk Israel in Ex 19. In V. 5f. wird Israel die Existenz als Bundesvolk zugesagt, in der es ein „Königreich von Priestern und ein heili-ges Volk“ (ממלכת כהנים וגוי קדוש) sein wird. Dafür sondert Gott Israel von allen Völkern aus (והייתם לי סגלה מכל־העמים „und ihr werdet für mich ein ausgesonder-tes von all den Völkern sein“). Die in Ex 19 genannte Bedingung ist das Einhal-ten des Bundes, die Gen 9 nicht kennt. Jes 61,6 nimmt die besondere Stellung Israels wieder auf, wenn sie als כהני יהוה („Priester JHWHs“) bezeichnet wer-den.48 Die Einbindung der Opferszene in die kompilierte Sintfluterzählung greift offenbar auf die Tradition des Priesterdienstes Israels zurück und zeigt, dass schon Noah diese Funktion für alle Lebewesen erfüllte.
Die Aufnahme der Opferszene in die Sintfluterzählung bedingt zugleich die Beibehaltung der Unterscheidung in reine und nicht reine Tiere sowie die Aus-weitung der Anzahl reiner Tiere auf sieben Paare.49 P differenziert die Tierwelt nicht, da eine derartige Unterscheidung vor der Gabe der Kultgesetze am Sinai erzähltechnisch nicht nötig ist.50 Anders verhält sich dies in den nP-Anteilen, da ohne die Ausweitung der Fortbestand der Tierarten nach dem Opfer nicht ge-währleistet wäre. Mit der Einführung der Differenzierung rein – nicht rein
48 Zu diesem Verständnis von Ex 19,5f. vgl. W. Oswald, Israel am Gottesberg. Eine Untersu-chung zur Literaturgeschichte der vorderen Sinaiperikope Ex 19-24 und deren historischem Hintergrund (OBO 159), Fribourg / Göttingen 1998, 32: „Alle Israeliten üben als Priester die Herrschaft aus. Dieses Verständnis findet sich in ähnlicher Weise in Jes 61,6 und impliziert, dass der vorliegende Abschnitt einen egalitär-utopischen Charakter hat.“ Vgl. auch O. Kaiser, Das Buch des Propheten Jesaja. Kapitel 1–12 (ATD 17), Göttingen 51981, 65, der den Pries-terdienst Israels an den Völkern als Bezugspunkt für die Integration der Völkerwelt in die Je-rusalemer JHWH-Verehrung, wie sie in Jes 2,2f. ausgedrückt wird. Weiterhin siehe I. Fischer, Tora für Israel – Tora für die Völker. Das Konzept des Jesajabuches (SBS 164), Stuttgart 1995, 35. 49 Zu den sich durch die Kompilation ergebenden literarischen Fügung vgl. Bosshard-Nepus-til, Sintflut, 63f.: „Nun stehen diese beiden Aussagen aber nicht in ungelöster Spannung ne-beneinander, sondern sie sich v.a. durch unterschiedliche Zweckbestimmungen in ein Ergän-zungsverhältnisse gebracht: 6,19f mit der kleineren Anzahl Tiere zielt auf das Überleben der Flut in der Arche: להחית אתך (um sie am Leben zu erhalten bei dir, 6,19 afin) bzw. להחיות (6,20fin). 7,2f mit der grösseren Anzahl hingegen hat bereits die Zeit nach der Flut im Blick: -um Nachkommenschaft leben zu lassen auf der Oberfläche der gan‚) לחיות ירע על פני כל הארץzen Erde‘, 7,3b).“ Deutlich wird, dass die Fluterzählungen andere Schwerpunktsetzungen be-inhalten, die, wie schon beim Zeitschema zu beobachten, durch die Kompilation in ein funk-tionales Entsprechungsverhältnis gebracht wurden. 50 Vgl. Schüle, Prolog, 291; Arneth, Adams Fall, 183-185, wiederum zeigt auf, dass die in Gen 7,2.4 und Gen 8,20f. genannten Differenzierungen den Maßgaben des Heiligkeitsgeset-zes entsprechen (vgl. Lev 20,22–26). Auf diese Weise sind in Bezug auf die P-Anteile der Sintfluterzählung keine Widersprüche entstanden. Ob Lev 20,22–26 als literarische Vorlage für Gen 8,20-22 diente und die Verse dementsprechend RP zuzuweisen sind, ist allein durch diesen Bezug nicht zu klären. Immerhin ist die Opferszene literarisch durch die mesopotami-schen Fluterzählungen vorgegeben, an denen die nP-Anteile Anleihe nehmen.
26 T. Wagner
scheint auch die Aussendung des Vogels verbunden. Während der Rabe nicht mehr zur Arche zurückkehrt, zeigt die Taube bei ihrer zweiten Rückkehr an, dass die Flut nun vorüber ist.51 Während in P nach der Landung auf dem Ge-birgsplateau das Abtrocknen der Erde dadurch kenntlich wird, dass der Rabe nicht mehr am Himmel kreist, sondern verschwindet und offenbar im Tal landen konnte, ist in der nP-Darstellung die Rückkehr der Taube nötig, da Noah vom Dach der Arche nicht ersehen konnte, ob das Land abgetrocknet ist und er sei-nen Schutzraum verlassen kann. Da nP keine Aufforderung zum Verlassen der Arche enthält, ist Noah auf dieses Gewissheit schaffende Zeichen angewiesen. Erst in der Kompilation werden der nicht reine Rabe und die reine Taube neben-einander gestellt und so ihre unterschiedlichen Verhaltensweisen hervorgeho-ben. Im redaktionellen Endtext erscheint der Rabe als Tier, das sich nicht weiter um das Wohlergehen des Menschen, der ihn rettete, kümmert. Die Unreinheit des Tieres wird auf diese Weise zu einer Verhältnisbestimmung des Tieres zum Menschen.
V Fazit
Die redaktionsgeschichtliche Analyse der Sintfluterzählung Gen 6–9 zeigt, dass in die priesterschriftliche Darstellung nP-Anteile integriert wurden, die aufgrund ihrer Kohärenz mit hoher Wahrscheinlichkeit einmal einer älteren Quelle ange-hörten. Die in Gen 6–9 überlieferten nP-Anteile der Sintfluterzählung sind eng mit den mesopotamischen Flutgeschichten verwandt (Hervorrufen der Flut durch Regenfälle, Opfergabe an die Gottheit am Ende der Flut etc.). Aus der nP-Erzählung wurden Anteile übernommen, um die Intention der priester-schriftlichen Darstellung zu verändern. Anders als die nP-Anteile und die me-sopotamischen Sintfluterzählungen versteht P die Flut als kosmisch Katastrophe, während der der in der Schöpfung geschaffene Lebensraum von Mensch und Tier auf die Arche reduziert wird. Wie bei der Aufnahme der Fluttradition im Atramchasis- und im 12-Tafel-Epos werden die traditionellen Anteile auf das Ziel der neu entstehenden Erzählung ausgerichtet. Anders als in der mesopota-mischen Literaturgeschichte wird die alttestamentliche Sintfluterzählung nicht durch Neuerzählung, sondern durch Quellenkompilation gebildet. Mittels der Kompilation wird die P-Darstellung durch die Redaktion um drei Aspekte er-weitert: Zum einen wird mit das Gegensatzpaar ‚Noah – verderbte Welt‘ inte-griert, zu dem die Einleitung in Gen 6,5–8, die Erwähnung des Untergangs aller Lebewesen durch den 40 Tage und Nächte andauernden Regen (Gen 7,17.21f.) sowie das Opfer Noahs (Gen 8,20–22) gehören. Redaktionell wird dieser Anteil mit der P-Darstellung so verschränkt, dass die Flut durch Regenfälle, durch die
51 Der Rabe gilt nach Lev 11,5; Dtn 14,14 als unreines Tier. Wie O. Keel, Vögel als Boten. Studien zu Ps 68,12–14; Gen 8,6–12; Koh 10,20 und dem Aussenden von Botenvögel in Ägypten (OBO 14), Fribourg / Göttingen 1977, 79–92, zeigt, wird der Rabe altorientalisch als Lotsenvogel verstanden, der Menschen einen Weg weisen kann.
Wasser ist nicht gleich Wasser 27
alle Lebewesen sterben müssen, zu einem Teil der gesamten Flut wird. In P und damit im Endtext beendet erst das Gedenken Gottes an die Archeinsassen das Anwachsen der Wasser (Gen 8,1). Hier wird der Wendepunkt in der Darstellung erreicht. Schließlich wird die Trennung rein – nicht-rein sowie die Ausweitung des Bestandes an reinen Tieren auf der Arche aus den nP-Anteilen übernommen, da diese für die Opferszene konstitutiv sind. Diese wird zwischen das Verlassen der Arche und dem Bundesschluss integriert. In der Erzählfolge ist diese Stel-lung zwingend, da Gen 8,21 die Wendung in Gottes Herzen hin zur Bewahrung der Schöpfung an den lieblichen Geruch des Opfers bindet. Die redaktionelle Gestaltung zielt also auf die Integration des Opfers in die Bundesverheißung. Als leitendes redaktionelles Kriterium lässt sich dementsprechend die Vor-rangsstellung Israels vor den Völkern, die mit der Abhängigkeit der Fortexistenz der Menschheit vom Opfer Noahs begründet wird, aufzeigen. Noah tritt am Ende der Sintflut als Priester auf, der Gott durch sein Opfer so beeinflusst, dass er mit allen nachsintflutlichen Lebewesen einen dauerhaften Bund schließt. Mit diesem verpflichtet sich Gott selber, das Leben auf Erden nicht mehr durch eine Sintflut zu gefährden, auch wenn die Erde weiterhin voller Übel sein wird. Da-mit übernimmt Noah die Priesterrolle, die nach Ex 19,5f.; Jes 61,6 Israel zufal-len wird. Die inneralttestamentlich Rezeption der Sintfluterzählung zeigt zudem, dass der mit der gesamten Schöpfung verbundene Auftrag zu Fruchtbarkeit und Mehrung allein auf Israel bezogen wird, das nach dem Ende des Exils das von Gott verheißene Land wieder besiedeln wird (Jer 23,3; Ez 36,11). Die damit aus-gedrückte besondere Stellung des nachexilischen Israels inmitten der Völkerwelt hatte der Redaktor der Sintflutgeschichte wohl im Blick, als er die P-Erzählung um den Aspekt des Priesterdienstes Noahs für alle Lebewesen erweiterte.