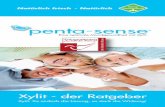Warum ist Gettiers Herausforderung so einflussreich und zugleich problematisch?
Transcript of Warum ist Gettiers Herausforderung so einflussreich und zugleich problematisch?
Erscheint in: Ernst, Gerhard und Lisa Marani (Hg.), 2013, DasGettierproblem – Eine Bilanz nach 50 Jahren, Münster: Mentis.
Warum ist Gettiers Herausforderung soeinflussreich und zugleich problematisch?
Dirk Koppelberg, Freie Universität Berlin
Abstract. Die gegenwärtige Erkenntnistheorie ist durch den vor fünfzig Jahren erschienenen Aufsatz „Is Justified True Belief Knowledge?“ von Edmund Gettier maßgeblich und nachhaltig beeinflusst worden. In diesem Beitrag wird die Frage untersucht, worin dieser Einfluss besteht und wie er zu bewerten ist. Es wird gezeigt, dass sich durch Gettiers Herausforderung an die Analyse propositionalen Wissens eine bestimmte Auffassung von Erkenntnistheorie herausgebildet hat, die sowohl extrem einflussreich als auch zutiefst problematischist. Dies geschieht in vier Schritten. In einem ersten Schritt werden Ziel, Voraussetzungen und Struktur von Gettiers Herausforderung explizit gemacht. In einem zweiten Schritt werden wichtige konservative Reaktionen auf diese Herausforderung vorgestellt und diskutiert. In einem dritten Schritt werden radikale Reaktionen und insbesondere die tiefgreifende Reaktion der Tugenderkenntnistheorie erörtert. Und im vierten Schritt werden sowohl die fragwürdigen wie auch die wünschenswerten Konsequenzen aus Gettiers Herausforderung
1
für die gegenwärtige Erkenntnistheorie herausgearbeitet. Dazu wird ein Vorschlag zur Neuorientierung der Erkenntnistheorie unterbreitet, der sowohl inhaltliche als auch methodische Lehren aus der fünfzigjährigen Beschäftigung mit Gettiers Aufsatz zieht. Plädiert wird für den Übergang von einer wissenszentrierten zu einer wertbasierten Erkenntnistheorie sowie für eine Ersetzung der intuitionszentrierten durch eine evidenzbasierte Methodologie.
Keine Arbeit hat die Erkenntnistheorie in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts mehr geprägt als der vor fünfzig Jahren erschienene knapp dreiseitige Aufsatz „Is Justified TrueBelief Knowledge?“ von Edmund Gettier. Den Fragen, warum das soist, wie es dazu kommen konnte und welche Konsequenzen aus seinem Einfluss zu ziehen sind, möchte ich in meinem Beitrag nachgehen. Zeigen möchte ich, dass sich durch Gettiers Herausforderung an die Analyse von propositionalem Wissen eine bestimmte Auffassung von Erkenntnistheorie und ihrem vermeintlich zentralen Projekt entwickelt und etabliert hat, die sowohl extrem einflussreich als auch zutiefst problematischist. Um diese Einschätzung zu begründen, gehe ich in vier Schritten vor. In einem ersten Schritt beleuchte ich das Ziel, die Voraussetzungen und die Struktur von Gettiers Herausforderung. In einem zweiten Schritt stelle ich wichtige eher konservative Reaktionen auf diese Herausforderung vor und diskutiere sie. In einem dritten Schritt gehe ich auf radikale Reaktionen und unter diesen insbesondere auf die von mir favorisierte Reaktion der Tugenderkenntnistheorie ein. Und in einem vierten Schritt komme ich schließlich sowohl auf die fragwürdigen wie auch auf die wünschenswerten Konsequenzen aus Gettiers Herausforderung für die gegenwärtige Erkenntnistheoriezu sprechen. Dazu unterbreite ich einen Vorschlag zur Neuorientierung der Erkenntnistheorie, der sowohl inhaltliche als auch methodische Lehren aus der fünfzigjährigen Beschäftigung mit Gettiers Aufsatz zieht. Ich plädiere für einen Übergang von einer wissenszentrierten zu einer
2
wertbasierten Erkenntnistheorie sowie für eine Ersetzung der intuitionszentrierten durch eine evidenzbasierte Methodologie.
1. Ziel, Voraussetzungen und Struktur von Gettiers Herausforderung
Wenn sich eine philosophische Herausforderung oder ein philosophisches Problem über längere Zeit hartnäckig einer allgemein akzeptierten Lösung entzogen hat, ist es oft hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und genauer zu untersuchen, worin die entsprechende Herausforderung oder das vermeintliche Problem überhaupt besteht. Ich denke, dass Gettiers Herausforderung bzw. Gettiers Problem ein guter Kandidat für ein solches Vorgehen ist.1 Warum?
Fünfzig Jahre nach ihrem Erscheinen gibt es zu Gettiers Herausforderung eine nahezu unübersehbare Anzahl von Reaktionenund Lösungsvorschlägen, die ihrerseits vielfach und gründlich kritisiert worden sind, so dass sich die Stimmen mehren, die entweder behaupten, dass Gettierprobleme prinzipiell unlösbar seien oder den Verdacht nähren, dass grundsätzlich etwas mit dieser Art Probleme nicht stimme oder schließlich gar bezweifeln, dass wir es bei Gettierfällen überhaupt mit einem Problem zu tun haben.2 Wo gut informierte und kompetente Erkenntnistheoretiker zu solch verschiedenen Einschätzungen einer Herausforderung in ihrer Disziplin gelangen, lohnt es sich, diese Herausforderung genauer zu betrachten und zu fragen, worin ihr Ziel, ihre Voraussetzungen und ihre Struktur
1 Ich rede im Folgenden häufiger und lieber von Gettiers Herausforderung als von Gettiers Problem oder Gettierproblemen, weil manche Autoren bezweifeln, dass es überhaupt ein Gettierproblem gibt. Wo nichts an dieser Unterscheidung hängt, vernachlässige ich sie.
2 Vgl. für die erste Option etwa Craig 1990, Zagzebski 1994 und Floridi 2011, für die zweite Option, für die Lycan 2006 die Bezeichnung des „Gettier Problem problem“ eingeführt hat, Kirkham 1984, Kaplan 1985, Williamson 2000 sowie die Einstellung der experimentellen Philosophie und für die dritte Option vor allem Hetherington, 2001, 2011.
3
bestehen. Auf diese drei Punkte gehe ich im Folgenden der Reihenach ein.
Was ist Gettiers Ziel? Er möchte mithilfe von zwei Beispielen zeigen, dass die von ihm – nicht zuletzt unter Hinweis auf Platons Theatetet und Menon – als weitverbreitet bezeichnete Definition propositionalen Wissens als gerechtfertigte, wahre Überzeugung falsch ist, da die in ihr angeführten notwendigen Bedingungen zusammen nicht hinreichend sind. Hat Gettier diesesZiel erreicht? Eine überwältigende Mehrheit von Erkenntnistheoretikern bejaht diese Frage. Bis heute verfolgt sie mit nicht nachlassendem Scharfsinn das Projekt, die von Gettier als Ausgangspunkt ausgewählte Definition so zu modifizieren und zu verbessern, dass wir zu einer adäquaten Begriffsanalyse von Wissen gelangen. Es dürfte nicht übertrieben sein, dieses Projekt als das zentrale Anliegen der Erkenntnistheorie der letzten fünfzig Jahre zu bezeichnen, auchwenn die Skepsis ihm gegenüber bei manchen Philosophen deutlichzugenommen hat.
Um die Optionen von Optimisten und Skeptikern besser einschätzen zu können, empfiehlt es sich, Gettiers Voraussetzungen und Vorgehen näher unter die Lupe zu nehmen. Was setzt Gettier voraus? Zwei grundlegende Annahmen und zwei für sie zentrale epistemische Prinzipien sind explizit zu machen. Erstens wird vorausgesetzt, dass eine erfolgreiche Klärung des Wissensbegriffs in einer reduktiven Analyse aus einzeln notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen besteht. Zweitens wird eine inhaltlich spezifizierte Form einersolchen Wissensanalyse angegeben, die als traditionell und weitverbreitet charakterisiert wird, ohne dass offensichtlich ist, ob und wo vor Gettiers Veröffentlichung eine solche Bestimmung von Wissen zu finden ist.3 Nicht zu Unrecht bemerkt 3 So schreibt etwa Bernecker: „Die Standardanalyse von Wissen [gemeint ist hier: Wissen als gerechtfertigte, wahre Überzeugung; D.K.] wurde spätestens seit Platon und bis weit in das 20. Jahrhundert hinein von nahezu allen Philosophen akzeptiert.“ (Bernecker Ms., 1) Schaut man sich hingegen die Textstellen von Gettiers Verweis auf Platon genauer an und betrachtet seine beiden Veranschaulichungen durch Ayer und Chisholm, ist alles andere als offensichtlich, ob wir es bei ihnen mit einschlägigen
4
Alvin Plantinga: „[…] there is an interesting historical irony here: it isn’t easy to find many really explicit statements of a JTB [justified true belief; D.K.] analysis of knowledge priorto Gettier. It is almost as if a distinguished critic created atradition in the very act of destroying it.” (Plantinga 1993, 6f.) Nicht nur von einem historischen Gesichtspunkt aus, sondern auch unter systematischer Betrachtung scheint es mir nicht unerheblich zu sein, ob die sogenannte traditionelle Wissensanalyse in der Tradition der Erkenntnistheorie eine Rolle gespielt hat, die ihrer vermeintlichen oder tatsächlichenWiderlegung zurecht die überwältigende Aufmerksamkeit beschert,die sie in den letzten fünfzig Jahren erfahren hat. Ich kann diesen Punkt hier jedoch nicht weiterverfolgen.
Vergegenwärtigen wir uns stattdessen noch einmal Gettiers Formulierung der seines Erachtens traditionellen Wissensanalyse, die GWÜ-Konzeption von Wissen (im Englischen: JTB account): S weiß, dass p gdw. (i) p wahr ist, (ii) S glaubt, dass p, und (iii) S darin gerechtfertigt ist zu glauben, dass p. (vgl. Gettier 1963, 121) Bis heute sind sich fast alle Erkenntnistheoretiker darin einig, dass sowohl die Überzeugungsbedingung wie auch die Wahrheitsbedingung notwendigfür Wissen sind.4 Umstritten ist hingegen die Rechtfertigungsbedingung, die in Gettiers Herausforderung die entscheidende Rolle spielt. Bestritten wird nicht nur mit Gettier, dass epistemische Rechtfertigung hinreichend für Wissen sei; verneint wird von einer wachsenden Anzahl von Erkenntnistheoretikern inzwischen auch gegen Gettier, dass sie überhaupt notwendig ist.5 Die zur Formulierung von Gettiers Herausforderung unverzichtbare Annahme, dass eine notwendige begriffliche Verbindung zwischen Rechtfertigung und Wissen besteht, ist demnach alles andere als offensichtlich. Auf die
Fällen von Wissen als gerechtfertigter, wahrer Überzeugung zu tun haben.4 Eine Minorität glaubt, dass diese beiden Bedingungen für Wissen oder zumindest für eine bestimmte Art von Wissen auch hinreichend sind; vgl. dazu Sartwell 1991, 1992, Goldman 1999, 2002 und Ernst 2002.5 Vgl. Sosa 1988 sowie insbesondere Foley 2004 und 2012, Sutton 2007, Kornblith 2008 und Littlejohn 2012.
5
tiefreichenden Zweifel gegenüber dieser grundlegenden Annahme werde ich am Ende dieses Abschnitts zurückkommen.
Zuvor empfiehlt es sich jedoch deutlich zu machen, welche Form und welche Funktion von Rechtfertigung Gettier für seinen Angriff voraussetzt. Drei Formen epistemischer Rechtfertigung werden in der Literatur gemeinhin unterschieden. Erstens findenwir die oben von Gettier bei seiner Vorstellung der GWÜ-Konzeption in Anspruch genommene personale Rechtfertigung, nach der ein epistemisches Subjekt S darin gerechtfertigt ist, eine Proposition p zu glauben. Sie dreht sich also um die Frage, ob der Überzeugungsträger, gerechtfertigt ist etwas zu glauben. Zweitens gibt es doxastische Rechtfertigung, nach der Ss Überzeugung, dass p, gerechtfertigt ist bzw. S gerechtfertigterWeise glaubt, dass p. Hier geht es also um die Frage, ob die entsprechende Überzeugung tatsächlich gerechtfertigt ist. Und drittens gibt es propositionale Rechtfertigung, bei der in Frage steht, ob es eine hinreichende Rechtfertigung für die Propositiongibt, so dass man berechtigt ist, sie zu glauben. Welche Beziehungen zwischen diesen drei Arten von Rechtfertigung bestehen, ist in der Erkenntnistheorie umstritten. Verbreitet ist die Haltung, personale und doxastische Rechtfertigung für wechselseitig austauschbar zu halten, obwohl dies ein Fehler ist, der – wie ich schon früher gezeigt habe – beträchtliche Konfusionen und Missverständnisse nach sich zieht.6
Catherine Lowy ist meines Wissens nach die erste Philosophin, die nicht nur auf die Bedeutung des Unterschieds zwischen personaler und doxastischer Rechtfertigung aufmerksam gemacht hat, sondern diesen Unterschied zudem für die Klärung von Gettiers Verständnis epistemischer Rechtfertigung in Anspruch nimmt.7 Wie schon Gettiers Formulierung bestätigt, geht er bei seiner Herausforderung an die GWÜ-Konzeption von Wissen nicht von einer gerechtfertigten Überzeugung aus, sondern von einer Person, die darin gerechtfertigt ist, eine Proposition zu glauben.6 Vgl. dazu meine Diskussion in Koppelberg 1999 sowie die daran anschließende kleine Fallstudie in Koppelberg 2012, 310-314.7 Vgl. Lowy 1978 wie auch die Diskussion in Littlejohn 2012, 6-11.
6
To get at Gettier’s notion of justification, we might thenask, when is a person justified in believing something in such a way that Gettier‘s points about justification apply? A person is justified in believing a proposition when no more can reasonably expected of him with respect to finding out whether that proposition is true. Clearly, Gettier’s points about justification hold here: there can be cases where no more can reasonably be expected of a person as a truth-seeker with respect to some proposition,and yet the proposition be false. (Lowy 1978, 106)
Wenn also die personale Rechtfertigung eines Wahrheitssuchers darin besteht, all das getan zu haben, was man von ihm vernünftigerweise erwarten kann – und das heißt hier nichts anderes als das, was man von ihm epistemisch verantwortlicherweise erwarten kann, um die Wahrheit einer bestimmten Proposition sicherzustellen und sich diese dennoch als falsch herausstellen kann -, haben wir damit Gettiers leitende Überlegung für die Formulierung seines ersten epistemischen Prinzips gefunden, demzufolge personale Rechtfertigung nicht faktiv, sondern stets fallibel ist. Wie wir sehen werden, spielt die prinzipielle Möglichkeit gerechtfertigter falscher Überzeugungen für Gettiers Herausforderung die entscheidende Rolle.8
Das zweite für Gettiers Herausforderung unverzichtbare epistemische Prinzip ist das der Abgeschlossenheit epistemischer Rechtfertigung gegenüber logischer Implikation, das von ihm wie folgt formuliert wird: Ist S darin gerechtfertigt, p zu glauben, und folgt q aus p, und schließt Svon p auf q, und glaubt S q aufgrund dieses Schlusses, dann istS gerechtfertigt zu glauben, dass q. In dieser Form ist das Abgeschlossenheitsprinzip natürlich falsch, da S q auf fehlerhafte Weise aus p geschlussfolgert haben mag. Es ist alsozu betonen, dass sein entsprechender Schluss korrekt sein muss,
8 Hier stimme ich mit Dretske 2013 überein, dessen Arbeit mir erst bekannt wurde, als ich den vorliegenden Aufsatz weitgehend fertiggestellt hatte.
7
um das Abgeschlossenheitsprinzip angemessen zu plausibilisieren.
Wie geht Gettier weiter vor, um sein Ziel zu erreichen? Er nutzt dazu die sogenannte Definitionsvorschlag-und-Gegenbeispiel-Methode, die nicht nur in der Erkenntnistheorie weite Verbreitung findet. Die jeweiligen Gegenbeispiele beruhenihrerseits auf Mini-Geschichten bzw. Szenarien, in denen die beiden soeben genannten Prinzipien epistemischer Rechtfertigungunverzichtbar sind. Wie das im Einzelnen aussieht, lässt sich anhand Gettiers bekanntem ersten Beispiel veranschaulichen (vgl. Gettier 1963, 121).
Smith und Jones haben sich um dieselbe Stelle beworben. Auf derGrundlage einschlägiger Belege glaubt Smith, dass nicht er, sondern sein Konkurrent Jones die Stelle erhalten wird. Der Chef des Unternehmens hat ihm nämlich mitgeteilt, man würde sich letztlich für Jones entscheiden. Zudem hat Smith soeben gesehen, wie Jones zehn Münzen in seine Hosentasche gesteckt hat. Wir können über Smith also sagen, dass er darin gerechtfertigt ist, die folgende Proposition zu glauben: (a) Jones wird die Stelle bekommen und Jones hat zehn Münzen in seiner Hosentasche. Aus dieser Überzeugung zieht Smith den folgenden korrekten Schluss: (b) Derjenige, der die Stelle bekommen wird, hat zehn Münzen in seiner Hosentasche.
Da Smith darin gerechtfertigt ist, (a) zu glauben und er (b) aus (a) korrekt schließt, ist er aufgrund des Abgeschlossenheitsprinzips auch darin gerechtfertigt, (b) zu glauben. Allerdings nimmt die Geschichte nun einen unvorhersehbaren Verlauf. Wider Erwarten erhält Smith nämlich doch die Stelle. Und ein weiterer Zufall kommt ins Spiel. Ohne es zu wissen, hat auch Smith genau zehn Münzen in seiner Hosentasche. Obwohl sich also Smiths Überzeugung (a) als falschherausgestellt hat, ist seine Überzeugung (b) aufgrund der beiden geschilderten glücklichen Zufälle wahr. Und zudem gilt: Smith glaubt, dass (b) und er ist darin gerechtfertigt, (b) zu glauben. Damit sind alle drei notwendigen Bedingungen der GWÜ-
8
Analyse von Wissen erfüllt, doch ist es für Gettier offensichtlich, dass Smith nicht weiß, dass (b). Warum?
In Gettiers Beispiel ist es der Fall, dass Smith gerechtfertigtist, (a) zu glauben und auch gerechtfertigt ist, (b) zu glauben, weil er (a) glaubt. Dann stellt sich (a) jedoch als falsch heraus (Jones bekommt den Job nicht) und (b) ist nur aufgrund von zwei Zufällen wahr (Smith bekommt den Job und hat auch zufällig zehn Münzen in der Hosentasche), die nichts mit Smiths Rechtfertigung für (b) zu tun haben. Gettier scheint also der Auffassung zu sein, dass Smith deshalb nicht weiß, dass (b), weil zwischen dessen Rechtfertigung für (b) und der Wahrheit von (b) keine im weitesten Sinne theoretisch befriedigende Beziehung besteht.
Unter Rückgriff auf die beiden von Gettier explizit befürworteten epistemischen Prinzipien hat Richard Feldman das folgende Rezept zur Erstellung von Gettierfällen gegeben (vgl. Feldman 2003, 28): Man beginne mit einer gerechtfertigten falschen Überzeugung, was dadurch möglich ist, dass gemäß des ersten epistemischen Prinzips Rechtfertigung nicht faktiv ist. Dann lasse man das entsprechende epistemische Subjekt S aus seiner gerechtfertigten Überzeugung, dass p die wahre Schlussfolgerung q ableiten und S q auf der Grundlage dieser Folgerung glauben. Mithilfe des zweiten epistemischen Prinzipsder Abgeschlossenheit gegenüber logischer Implikation ist S sodann gerechtfertigt zu glauben, dass q. Das Endresultat besteht in einer gerechtfertigten, wahren Überzeugung, dass q ohne dass S weiß, dass q.
Bei Linda Zagzebski sieht das einschlägige Rezept ein wenig anders aus (vgl. Zagzebski 1994, 207 f.): Man beginne mit einerfür die Rechtfertigungsbedingung von Wissen hinreichend stark gerechtfertigten Überzeugung. Dann füge man das Quantum unglücklichen Zufalls hinzu, das verhindert, dass die gerechtfertigte Überzeugung wahr ist. Schließlich reichere man alles mit einer kräftigen Dosis glücklichen Zufalls an, so dassdie fragliche Überzeugung als wahr herauskomme. Wie schon oben im Gettierbeispiel gesehen, stellt sich die Rechtfertigung der
9
gerechtfertigten, wahren Überzeugung als mit ihrer Wahrheit systematisch unverbunden heraus, was nahelegt, hier nicht von Wissen zu sprechen.
Nicht zuletzt aus Zagzebskis Rezeptur zur Erstellung von Gettierfällen lässt sich eine Einsicht in die Struktur einschlägiger Beispiele gewinnen. Sie gewinnen ihre Überzeugungskraft – wenn sie denn über eine solche verfügen – aus dem geschickten Einsatz von doppeltem Zufall, von Glück im Unglück, wie wir im Deutschen so treffend sagen.
Ich hoffe, mit dieser Exposition sind Ziel, Voraussetzungen undStruktur von Gettiers Herausforderung zumindest soweit deutlichgeworden, dass wir uns jetzt der Frage zuwenden können, welche Möglichkeiten es gibt, ihr erfolgreich zu begegnen. Erkenntnistheoretiker unterscheiden sich in ihren Reaktionen grundsätzlich dadurch, ob sie Gettiers Herausforderung als ein genuines Problem ansehen, das mit der jeweils von ihnen favorisierten Strategie zu lösen ist oder aber, ob sie sie als ein Scheinproblem betrachten, das mithilfe einer einschlägigen Diagnose aufzulösen ist. Auf die wichtigsten Auflösungsstrategien – Hetheringtons ‚glückliches‘ Wissen, Williamsons ‚Wissen zuerst‘ und das Forschungsprogramm der experimentellen Erkenntnistheorie - kann ich leider im Rahmen dieses Beitrags nicht eingehen; ich werde mich hier auf die zentralen Lösungsstrategien beschränken. Ich setze diese Priorität deshalb so, weil ich der Überzeugung bin, dass Möglichkeiten einer Auflösungsstrategie erst dann näher in Betracht gezogen werden sollten, wenn wir gute Gründe für die Annahme haben, dass Lösungsstrategien nicht zum Erfolg führen und solche guten Gründe haben wir meines Erachtens trotz manch entgegengesetzter Verlautbarung nicht.
In meiner Exposition habe ich herausgestellt, dass für GettiersHerausforderung eine notwendige begriffliche Verbindung zwischen Wissen und Rechtfertigung konstitutiv ist und Rechtfertigung dabei in einer personalen internalistischen Formverstanden wird, bei der die entsprechende Verantwortlichkeit und Tadellosigkeit des epistemischen Subjekts ausschlaggebend
10
sind. Grundsätzlich zu unterscheiden sind demnach die meisten frühen, eher konservativen Reaktionen, die diese Voraussetzung akzeptierten und denen gemäß Wissen zumindest gerechtfertigte, wahre Überzeugung ist von den eher späteren, meist radikaleren Reaktionen, für die Wissen nicht einmal gerechtfertigte, wahre Überzeugung ist. Aus diesen unterschiedlichen Reaktionen ergeben sich zwei verschiedene Wege zur Lösung von Gettierproblemen, die ich einerseits als Ergänzungsstrategie, andererseits als Ersetzungsstrategie bezeichnen möchte. Die Ergänzungsstrategie der sogenannten Vierten-Bedingungs-Theoretiker sieht die herkömmliche Wissensanalyse grundsätzlichauf dem richtigen Weg, fordert allerdings – wie ihre Bezeichnung schon nahelegt – eine Ergänzung durch eine einschlägige vierte Bedingung. Für die Ersetzungsstrategie hingegen ist die herkömmliche Wissensanalyse auf dem Holzweg; sie fordert deshalb, auf die Rechtfertigungsbedingung ganz zu verzichten und sie durch eine oder mehrere andere Bedingungen zu ersetzen.9
Leider kann ich es bei dieser einfachen Gegenüberstellung von zwei Strategien nicht belassen, weil die seit längerem intensivgeführte Debatte über Internalismus und Externalismus in der Theorie epistemischer Rechtfertigung auf einer weiteren Vorgehensweise beruht, die ich aus Gründen, die hoffentlich bald deutlich werden, als Reformulierungsstrategie bezeichnen möchte.10
Ein kurzer und summarischer Blick auf die Anfänge dieser Debatte mag verständlich machen, wie es zu einer solchen
9 Wie radikal ein solches Vorgehen ist, wird an folgender Einschätzung Kims deutlich: „If justification drops out of epistemology, knowledge itself drops out of epistemology. For our concept of knowledge is inseparably tied to that of justification.“ (Kim 1988, 389) Dass eine solche Einschätzung keineswegs allgemein akzeptiert wird, zeige ich weiter unten. Zudem gibt es noch die Strategie Sartwells, bei der Wissensanalyse auf die Rechtfertigungsbedingung zu verzichten, ohne sie durch irgendeine andere Bedingung zu ersetzen, Wissen also als bloß wahre Überzeugung zu definieren, was ich nicht für aussichtsreich halte. Vgl. Sartwell 1991, 1992; vgl. zur Kritik Koppelberg, 2014a.10 Für die folgenden Überlegungen bin ich Kornblith 2008, 6f. verpflichtet.
11
Reformulierungsstrategie gekommen ist. Die ausschlaggebende Figur ist dabei Alvin Goldman. Hinlänglich bekannt sind seine frühen Versuche, Gettierprobleme mithilfe seiner kausalen Theorie des Wissen (Goldman 1967) und seiner Diskriminationstheorie relevanter Alternativen (Goldman 1976) zu lösen. Während Goldman in dem ersten Aufsatz Wissen, dass p durch die wahre Überzeugung, die durch die Tatsache, dass p, verursacht wird, zu bestimmen versucht, wird in der zweiten Arbeit eine wahre Überzeugung, die durch die Ausübung gewisser Unterscheidungsfähigkeiten spezifiziert wird, als vielversprechender Kandidat für Wissen betrachtet. Was die beiden Ansätze trotz wichtiger Unterschiede verbindet, ist Goldmans expliziter Verzicht auf eine Rechtfertigungsbedingung für Wissen.
Bemerkenswert ist nun, dass Goldman mit seinem klassischen Aufsatz „What Is Justified Belief?“ (Goldman 1979) seine bis dahin verfolgte Ersetzungsstrategie aufgibt und die Bedingung epistemischer Rechtfertigung so zu reformulieren versucht, dassdadurch Gettiers Ausgangsposition von Wissen als gerechtfertigter, wahrer Überzeugung erhalten bleibt. Die Erläuterung, warum er das tut, fällt kurz aus: „In previous papers on knowledge, I have denied that justification is necessary for knowing, but there I had in mind ‚Cartesian‘ accounts of justification. On the account of justified belief here, it is necessary for knowing and closely related to it.” (Goldman 1979, 105) Hilary Kornblith hat für dieses Vorgehen Goldmans zwei mögliche Motive angegeben: einerseits die Einsicht, dass es sich bei epistemischer Rechtfertigung um einen legitimen und wichtigen erkenntnistheoretischen Untersuchungsgegenstand handle, andererseits Erwägungen theoretischer Einfachheit, die es nahelegen, der Wichtigkeit dieses Untersuchungsgegenstands am besten durch seine Integration als notwendige Bedingung in der Analyse von Wissen Rechnung zu tragen (vgl. Kornblith 2008, 7). Ob das Junktim dieser beiden Motive tatsächlich theoretisch befriedigend oder gar zwingend ist, bezweifle ich und werde darauf am Schluss meines Beitrags zurückkommen.
12
Entscheidend und beachtenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch zuerst einmal, dass Goldman die von Gettier in Anspruch genommene Voraussetzung personaler Rechtfertigung durch doxastische Rechtfertigung ersetzt, worin ihm alle Externalisten folgen. Elke Brendel macht dies explizit: „Eine Aussage der Form ‚S weiß, dass p‘ ist genau dann wahr, wenn diefolgenden drei Bedingungen (i) – (iii) erfüllt sind: (i) S ist davon überzeugt, dass p. (ii) p ist wahr. (iii) Ss Überzeugung,dass p, ist epistemisch gerechtfertigt.“ (Brendel 2013a, 28) Vergleicht man Brendels ganz im Sinne Goldmans abgefasste Formulierung der GWÜ-Konzeption von Wissen mit derjenigen Gettiers, so fällt auf, dass dessen dritte Bedingung, in der von personaler Rechtfertigung die Rede ist, durch eine Bedingung ersetzt worden ist, in der es um doxastische Rechtfertigung geht. Gettiers zentrale Bedingung ist demnach auf eine Weise reformuliert worden, die allzu leicht darüber hinwegtäuscht, dass an die Stelle von Gettiers Voraussetzung internalistischer personaler Rechtfertigung eine Bedingung doxastischer Rechtfertigung getreten ist, die sowohl internalistisch als auch externalistisch ausbuchstabiert werdenmag. Goldman hat also den Begriff epistemischer Rechtfertigung nur dadurch aufrechterhalten, indem er gegenüber Gettiers Formulierung seine Art verändert. Bei der Diskussion von RobertFogelins Lösungsvorschlag zum Gettierproblem im nächsten Teil des Aufsatzes werde ich auf beide Formen epistemischer Rechtfertigung zurückkommen.
2. Konservative Reaktionen auf Gettiers Herausforderung
Worin bestanden die unmittelbaren Wirkungen von Gettiers Herausforderung? Sie beziehen sich sowohl auf methodische wie auf inhaltliche Aspekte, wobei beide Gesichtspunkte in der Welle der ersten Reaktionen eng miteinander verknüpft wurden. Viele Erkenntnistheoretiker akzeptierten das von Gettier vorausgesetzte Anliegen, mithilfe einer reduktiven Begriffsanalyse von einzeln notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen die Natur von Wissen zu bestimmen.
13
Die meisten von ihnen schienen in dieser Phase davon auszugehen, dass Wissen zumindest gerechtfertigte, wahre Überzeugung sei und das Gettierproblem durch eine vierte, die Rechtfertigungsbedingung ergänzende oder modifizierende Bedingung gelöst werden könne. Eine solche Einstellung mag als Standardansicht sowohl von Begriffsanalyse als auch der Wissenskonzeption bezeichnet werden. Weitgehende Einigkeit schien darüber zu bestehen, dass lediglich die Rechtfertigungsbedingung in geeigneter Weise zu ergänzen sei, um Gettiers Problem Herr zu werden; die Uneinigkeit bestand darin, wie und wodurch dies erreicht werden könne. Auf jeden Fall war die Zuversicht groß, mithilfe einer rechtfertigungsergänzenden Strategie zum Erfolg zu kommen. Solche Strategien gibt es in ganz unterschiedlicher Ausprägung.Die beiden bekanntesten sollen hier nur recht kurz behandelt werden, bevor ich auf eine besonders interessante dritte Strategie etwas näher eingehe und mit ihr noch einmal auf die unterschiedlichen Formen epistemischer Rechtfertigung zurückkomme.
Da in Gettiers oben vorgestelltem Beispiel (und auch in seinem zweiten Beispiel, das weiter unten noch zur Sprache kommen wird) die gerechtfertigte, wahre Überzeugung, der der Wissensstatus abgesprochen wird – die Überzeugung, dass jemand mit zehn Münzen in der Hosentasche die Stelle bekommen wird -, auf einer falschen Proposition beruht - dass Jones die Stelle bekommt -, ist es naheliegend, die GWÜ-Analyse von Wissen durcheine vierte Bedingung zu ergänzen, die fordert, dass sich keinefalschen Propositionen unter den Gründen für Ss Überzeugung, dass p, befinden dürfen. Genau das ist der Grundgedanke von Clarks Kein-falsches-Lemma-Vorschlag (vgl. Clark 1963). Leider ist er mit einer Vielzahl von Gegenbeispielen konfrontiert worden, die zeigen, dass er als eine vierte Bedingung weder notwendig noch hinreichend für den Ausschluss von Gettierfällenist.11
11 Vgl. für eine Übersicht und Diskussion vieler einschlägiger Beispiele Lycan 2006, 154-158.
14
Dass der Kein-falsches-Lemma-Vorschlag nicht hinreichend für den Ausschluss von Gettierfällen ist, kann leicht mithilfe des bekannten Beispiels der stehengebliebenen Uhr von Bertrand Russell und Israel Scheffler gezeigt werden (vgl. Russell 1948,170 f. und Scheffler 1965, 112), in dem S die korrekte Uhrzeit von einer stehengebliebenen Uhr abliest, weil er durch Zufall gerade zum richtigen Zeitpunkt auf sie schaut. Unterstellen wirzudem, dass S allen Grund hat zu glauben, dass die Uhr intakt ist, liegt in diesem Beispiel eine gerechtfertigte, wahre Überzeugung vor, die kein Wissen darstellt – und zugleich ohne einen inferentiellen Zwischenschritt über ein falsches Lemma zustande gekommen ist.
Clarks Diagnose stimmt hier also nicht und sein darauf beruhender Vorschlag stellt keine befriedigende Lösung des Gettierproblems dar. Lässt er sich vielleicht verbessern? Dieser Auffassung ist William Lycan, der den Ausschluss einer stillschweigenden oder impliziten falschen Annahme als vierte Bedingung vorschlägt (vgl. Lycan 2006: 156 f.). Damit kann dem Beispiel der stehengebliebenen Uhr erfolgreich Rechnung getragen werden, da dieses ja darauf beruht, dass S implizit annimmt, dass die Uhr funktionsfähig ist - in diesem Fall eine falsche Annahme.
Leider vermag jedoch auch diese verbesserte Bedingung nicht davon zu überzeugen, dass sie notwendig für Wissen ist. Das zeigt etwa Roozebooms Beispiel der ‚Zusammenschmidts‘ (vgl. Rozeboom 1967). S weiß, dass ihre Nachbarn, die gesamte FamilieZusammenschmidt, an jedem Sonntagnachmittag in ihrem Auto einenAusflug macht. Auch an diesem Sonntag sieht sie deren Auto wieder davonfahren. Und weil S annimmt, dass wie gewöhnlich dieganze Familie in dem Wagen sitzt, schlussfolgert sie, dass FrauZusammenschmidt nicht zu Hause ist und hat auch Recht damit. Falsch ist hingegen, dass alle Familienmitglieder sich in dem Wagen befinden; eines der Kinder ist nicht dabei, weil es an einer Geburtstagsfeier teilnimmt. Ss implizite Annahme, dass sich alle Zusammenschmidts im Auto befinden, ist zwar falsch, doch ist die Tatsache, dass ein Kind nicht dabei ist, nicht
15
wesentlich für Ss induktiv gerechtfertigte Überzeugung, dass sich Frau Zusammenschmidt in dem Wagen befindet. Lycan glaubt nun, auch die Notwendigkeit seiner Bedingung dadurch zu erfüllen, dass die einschlägige Rechtfertigung nicht wesentlich auf einer falschen impliziten Annahme beruhen darf.
Allerdings gibt es weitere Beispiele, die dagegen zu sprechen scheinen, dass Lycans Bedingung, dass die einschlägige Rechtfertigung nicht wesentlich auf einer falschen impliziten Annahme beruhen darf, tatsächlich hinreichend für Wissen ist. Von Gilbert Harmans klassischen Beispielen nicht zur Verfügungstehender Anfechtungsgründe (unpossessed defeaters) sei hier der Fall des politischen Attentats (vgl. Harman 1973: 143 f.) kurzrekapituliert, der uns dann zur Diskussion des zweiten einflussreichen Vorschlags zur Lösung des Gettierproblems aus der Familie rechtfertigungsverstärkender Strategien führen wird, der Anfechtbarkeitstheorie (defeasibility theory).
Jill hat aufgrund eines wahren Zeitungsberichts durch einen verlässlichen Reporter, der selbst Augenzeuge war, von der Ermordung eines hochrangigen Politikers erfahren. Einflussreiche Parteigenossen, die politische Unruhen verhindern wollen, lassen indessen über das Fernsehen verbreiten, dass der Mordanschlag nicht erfolgreich war und derPolitiker lebt. Beinah jedermann sieht diese Fernsehbotschaft und glaubt sie. Durch Zufall verpasst Jill die Fernsehmeldung und glaubt weiterhin, dass das Opfer tot ist. Nach Harman hat Jill zwar eine gerechtfertigte, wahre Überzeugung, doch wisse sie nicht, dass der Politiker ermordet worden ist, weil es in hohem Maße unplausibel sei, dass Jill dies nur deshalb wisse, weil ihr Belege bzw. Anfechtungsgründe fehlten, die ansonsten jedermann besitze. Einschlägig in diesem Beispiel ist also nicht der Ausschluss einer wesentlich falschen impliziten Annahme für die Zusprechung von Wissen, sondern die angemesseneBerücksichtigung von Anfechtungsgründen.12
12 Eine Verbindung zwischen diesen beiden rechtfertigungsergänzenden Strategien zur Lösung des Gettierproblems ließe sich vielleicht dadurch herstellen, dass der im ersten Ansatz zentrale Begriff der impliziten Annahme, die für die Rechtfertigung wesentlich ist, durch den Bezug auf
16
a ist ein Anfechtungsgrund hinsichtlich des Belegs b für p dannund nur dann, wenn b ein Beleg dafür ist, p zu glauben, die Konjunktion (b&a) jedoch kein Beleg dafür ist, p zu glauben. (vgl. Pollock 1986: 38 f. und Steup 1998: 13) Ss Rechtfertigung, eine Proposition p zu glauben, wird angefochten, wenn S Belege für eine andere Proposition q hat, die Ss Belege für p anfechten. Da dies auf zweierlei Weise geschehen kann, ergibt sich eine erste wichtige Unterscheidung zwischen widerlegenden und untergrabenden Anfechtungsgründen: im ersten Fall hat S Belege, die ihn rechtfertigen zu glauben, dass p falsch ist; im zweiten Fall hat S Belege, die seine Rechtfertigung für den Glauben, dass p wahr ist, unterminieren.
Eine zweite wichtige Unterscheidung zwischen evidentiellen und tatsächlichen Anfechtungsgründen ist für den Lösungsvorschlag dieses Ansatzes zum Gettierproblem von ausschlaggebender Bedeutung (vgl. Steup 1998: 14 f.). Im ersten Fall ficht a evidentiell Ss Rechtfertigung zu glauben, dass p, dann und nur dann an, wenn (i) S Belege b dafür hat, p zu glauben und (ii) Szudem Belege b‘ für die Proposition a hat, die b als Belege fürp anficht. Im zweiten Fall ficht a tatsächlich Ss Rechtfertigung zu glauben, dass p, dann und nur dann an, wenn (i) S Belege b dafür hat, p zu glauben und (ii) es eine Proposition a gibt, von der gilt, dass a wahr ist; S keine Belege für a hat und a die Belege b für p anficht.
Thomas Grundmann hat geltend zu machen versucht, dass es gar keine tatsächlichen Anfechtungsgründe gibt, weil Anfechtungsgründe dadurch charakterisiert seien, dass sie einenihnen zeitlich vorausliegenden epistemischen Zustand von S aufheben oder neutralisieren. Eine solche diachrone Bedingung sei aber im Fall tatsächlicher Anfechtungsgründe nicht erfüllt (vgl. Grundmann 2011: 157). Ich sehe indessen keinen Grund für die Forderung, Anfechtungsgründe durch temporale Bedingungen zubestimmen. Zu ihrer Charakterisierung habe ich oben allein von logischen und epistemischen Bedingungen Gebrauch gemacht und diese scheinen mir auch hinreichend für ihre Bestimmung zu
einen spezifischen Anfechtungsgrund zu explizieren wäre.17
sein. Grundmann behauptet, dass Anfechtungsgründe unmittelbar nur die Rechtfertigung betreffen; wissenserzeugende Berechtigung (warrant) sei von ihr nur indirekt und nur dann betroffen, wenn Berechtigung Rechtfertigung einschließe.
Demgegenüber glaube ich – wie Steup -, dass es uns die wichtigeUnterscheidung zwischen evidentiellen und tatsächlichen Anfechtungsgründen ermöglicht, zwischen wissenserzeugender und nichtwissenserzeugender (im zweiten Fall: personaler) Rechtfertigungzu unterscheiden und damit einen weiteren vielversprechenden Schritt auf dem Weg zur Lösung des Gettierproblems zu tun. Wissenserzeugende Rechtfertigung ist demnach sowohl evidentiellals auch tatsächlich unangefochten; die Abwesenheit beider Arten von Anfechtungsgründen ist es, die wahre Überzeugungen zuWissen macht. Nichtwissenserzeugende Rechtfertigung - personaleRechtfertigung, wie wir sie bei Gettier finden – ist zwar auch evidentiell unangefochten, doch tatsächliche Anfechtungsgründe sprechen gegen sie. Angefochten ist sie durch Tatsachen, die jenseits von Ss Perspektive oder Zugänglichkeit liegen und gerade dadurch wird verhindert, dass dessen wahre Überzeugung zu Wissen wird.
Eine im Sinne dieses Ansatzes formulierte vierte Bedingung zur Lösung des Gettierproblems fordert also den Ausschluss sowohl evidentieller als auch tatsächlicher Anfechtungsgründe. Die Konzentration allein auf evidentielle Anfechtungsgründe reicht nicht aus, weil diese stets wahr oder falsch sein können. In Harmans Beispiel, von dem ich ausgegangen bin, spielen falsche,also irreführende Anfechtungsgründe die entscheidende Rolle. Obaber irreführende Anfechtungsgründe tatsächlich hinreichend sind, Jill im Attentatsbeispiel Wissen abzusprechen, scheint mir entgegen Harmans Auffassung alles andere als erwiesen zu sein.13 Meine Intuition spricht dagegen.
13 Ein zufriedenstellender Ausschluss von irreführenden Anfechtungsgründen für eine adäquate Lösung des Gettierproblems hat sich innerhalb der Anfechtsbarkeitstheorie als schwierig erwiesen und zu äußerstkomplizierten Vorschlägen geführt, deren ad hoc-Charakter oft ins Auge springt; vgl. etwa Swain 1974.
18
Schließlich möchte ich noch – wie bereits angekündigt – etwas näher auf Robert Fogelins Diagnose und Lösungsversuch der Gettierprobleme eingehen, da dabei zwei Formen epistemischer Rechtfertigung thematisiert werden, deren Verschiedenheit ich im Laufe dieses Beitrags schon mehrfach in Anspruch genommen habe. Ich halte Fogelins Überlegungen auch deshalb für besonders aufschlussreich, weil sie eine Art Synthese aus Ergänzungs- und Reformulierungsstrategien darstellen und deshalb das grundsätzliche Problem dieser beiden Vorgehensweisen deutlich herauszuarbeiten erlauben.
Die Pointe von Fogelins Lösungsversuch besteht in seiner Diagnose, dass sich hinter der für Wissen notwendigen Bedingungepistemischer Rechtfertigung zwei unterschiedliche Rechtfertigungsanforderungen verbergen, die zusammengenommen hinreichend sein sollen. Dabei ist die erste Art von Rechtfertigung, die Fogelin anhand des oben ausführlich vorgestellten ersten Gettierfalles einführt und kommentiert, die der (von ihm übrigens nicht so genannten) personalen Rechtfertigung, die sich auf das untadelige und verantwortlicheVorgehen von Smith bezieht, aufgrund dessen er zu der wahren Überzeugung gelangt, dass der Mann, der die Stelle bekommen wird, zehn Münzen in seiner Hosentasche hat. Als die erste dritte notwendige Bedingung für Wissen, mit der das epistemischverantwortliche Verhalten Ss bei der Bildung der einschlägigen Überzeugung p gewürdigt wird, formuliert Fogelin (iiiᵖ): S kam gerechtfertigter Weise dazu zu glauben, dass p (vgl. Fogelin 1994, 18).
Allerdings ist das nach Fogelins Auffassung nicht die einzige Lesart der Rechtfertigungsbedingung, die wir für die Lösung vonGettierproblemen berücksichtigen müssen (vgl. Fogelin 1994: 18-21). Bei der zweiten Art von Rechtfertigung geht es nicht um die Einschätzung des epistemischen Vorgehens von S zur Erlangung seiner Überzeugung, sondern um die Bewertung der Angemessenheit von Ss Gründen zur Festlegung der Wahrheit der einschlägigen Überzeugung. Als zweite dritte (kein Druckfehler!) notwendige Bedingung für Wissen formuliert
19
Fogelin dementsprechend (iiiᵍ): Ss Gründe legen die Wahrheit von p fest.
Die traditionelle Rechtfertigungsbedingung ist also nach Fogelin in zwei Teilbedingungen aufzuspalten, die beide benötigt werden, um eine zufriedenstellende Lösung der Gettierprobleme zu erreichen. Seines Erachtens finden wir bei allen Gettierproblemen eine Situation vor, in denen zwar die Bedingung (iiiᵖ), nicht aber die Bedingung (iiiᵍ) erfüllt ist. „The first fact inclines us to say that S is justified in his belief, the second leads us to deny him knowledge even though his belief was justifiably arrived at and true.” (Fogelin 1994,21) Erst, wenn auch (iiiᵍ) erfüllt ist, wenn also Ss Gründe dieWahrheit der entsprechenden Überzeugung festlegen, sind Gettierfälle ausgeschlossen und wir haben es mit Wissen zu tun.
Um Fogelins Doppelten-Rechtfertigungs-Vorschlag – wie ich ihn hier nennen möchte – angemessen würdigen zu können, ist es entscheidend, sich darüber Klarheit zu verschaffen, was Fogelinunter der einschlägigen „Festlegung“ (establishing) der Wahrheit in (iiiᵍ) versteht. Leider erhalten wir von ihm darüber wenig Aufschluss. Lediglich in einer Fußnote (vgl. Fogelin 1994, 29, Fn. 7) erfahren wir, dass Fred Dretske in seinem Aufsatz „Conclusive Reasons“ von 1971 und Wittgenstein in Über Gewißheit ganz ähnliche Positionen vertreten. Da zwingende Gründe für eine Überzeugung deren Wahrheit zweifellos garantieren, der Preis jedoch in einem Infallibilismus besteht, der einen weitgehenden Skeptizismus gegenüber vielen Wissensansprüchen nach sich zieht, empfiehlt es sich, einen Blick auf die Bemerkung Wittgensteins zu werfen, die Fogelin zitiert: „‘Ich weiß…‘ sagt man, wenn man bereit ist, zwingende Gründe zu geben. ‚Ich weiß‘ bezieht sich auf eine Möglichkeit des Dartunsder Wahrheit.“ (Wittgenstein, ÜG 243) Für Fogelin wird aus dem Kontext dieser Bemerkung klar, dass Wittgenstein hier keinen deduktiven Beweis im Sinn hat. Was immer Wittgenstein im Sinn haben mag – aufschlussreich ist für uns, dass zumindest Fogelinan einer Festlegung von Wahrheit interessiert ist, die nicht damit zusammenfällt, dass die einschlägigen Gründe für eine
20
Überzeugung deren Wahrheit implizieren. Doch welche Chancen gibt es für ein solches Vorhaben?
Um einschätzen zu können, wie tragfähig Fogelins Doppelter-Rechtfertigungs-Vorschlag letztlich ist, ist das Problem einer tragfähigen Koordination von Rechtfertigung und Wahrheit hinsichtlich einer bestimmten Überzeugung zu lösen. Genauer: Gibt es eine das Gettierproblem lösende Beziehung zwischen dem Sachverhalt, auf den sich die rechtfertigenden Gründe beziehen,und dem Sachverhalt, der die Überzeugung wahr macht? Vielversprechend erscheint mir in diesem Zusammenhang Adrian Heathcotes Wahrmacher-Vorschlag, der bislang nur wenig diskutiert worden ist.14
Heathcote geht davon aus, dass bei normaler Überzeugungsbildung, der Sachverhalt der eine Überzeugung wahr macht, d.h. ihr Wahrmacher, derselbe Sachverhalt ist, auf den sich auch ihre Rechtfertigung bezieht (vgl. Heathcote 2006: 162f.). Genau dies trifft aber bei einem Gettierfall nicht zu. Erinnern wir uns an Gettiers erstes Beispiel, in dem Smith glaubt, dass der Mann, der die Stelle bekommt, zehn Münzen in der Tasche hat. Hier ist der Wahrmacher der einschlägigen Proposition, Smith, (mereologisch) unverbunden mit dem Sachverhalt, auf den sich die Rechtfertigung der Proposition bezieht, nämlich, dass Jones die Stelle bekommt. Und diese Divergenz der Sachverhalte ist nach Heathcote charakteristisch für alle Gettierfälle.
Aus dieser Diagnose ergibt sich unmittelbar der entsprechende Lösungsvorschlag: Die Identität der beiden Sachverhalte, die unterschiedliche Rollen als rechtfertigende Gründe und Wahrmacher spielen, ist zu gewährleisten. Dazu können die ersten drei Bedingungen von Gettiers Wissensanalyse beibehaltenwerden; durch die folgende Bedingung (iv) sind sie zu ergänzen,die dann zusammen mit den drei anderen hinreichend für Wissen
14 Vgl. Heathcote 2006. Aufgegriffen und modifiziert wird Heathcotes Vorschlag u.a. von Bernecker Ms., worauf ich weiter unten eingehen werde. Die weitverzweigte Diskussion von Wahrmacher-Theorien kann ich hier nicht behandeln; für eine Übersicht vgl. Armstrong 2004.
21
ist: Der Sachverhalt, auf den sich die rechtfertigenden Gründe von p beziehen, ist identisch mit dem Sachverhalt, der p wahr macht.
Doch haben wir damit wirklich eine befriedigende Lösung des Gettierproblems erreicht? Erinnern wir uns daran, dass wir Heathcotes Wahrmacher-Vorschlag deshalb ins Auge gefasst haben,weil er eine Möglichkeit zu eröffnen schien, die bei Fogelin ungeklärte Art der Festlegung der Wahrheit, die nicht in einer Implikationsbeziehung bestehen sollte, auf erhellende Art auszubuchstabieren. Auch wenn letzteres erreicht werden konnte, stellt sich immer noch die Frage, ob mit der Ansetzung einer Identitätsbeziehung ein Fortschritt gegenüber der Implikationsbeziehung erzielt worden ist. Auch hier dürften Infallibilismus und Skeptizismus unvermeidliche Konsequenzen dieses Vorschlags sein.
Um solche Konsequenzen auszuschließen, hat Sven Bernecker vorgeschlagen, die Identitätsbeziehung zwischen dem Sachverhalt, auf den sich die rechtfertigenden Gründe beziehen,und dem Sachverhalt, der die entsprechende Proposition wahr macht, durch die Beziehung eines kausalen Zusammenhangs zwischen den beiden Sachverhalten zu ersetzen. Natürlich ist ihm klar, dass sich dann das vieldiskutierte Problem abweichender Kausalketten stellt, dass er anhand des von ihm erheblich erweiterten und veränderten zweiten Beispiels von Gettier darstellt (vgl. Gettier 1963, 122 und Bernecker Ms., 11).
Smith und Nogot sind Arbeitskollegen. Seit einiger Zeit kommt Nogot mit einem Golf zur Arbeit, den er wie seinen eigenen Wagen behandelt. Für Smith sind das hinreichende Gründe, um diefolgende Proposition zu glauben: (a) Nogot besitzt einen Golf. Smith hat zudem einen Bekannten namens Brown, von dem er nicht weiß, wo er sich gegenwärtig aufhält. Aus purer Spielerei denkter sich einen Ort aus, an dem Brown sein könnte und wählt dazu Barcelona. Da Smith mit den Grundregeln logischen Schließens vertraut ist, folgert er aus (a) die folgende Proposition (b): Nogot besitzt einen Golf oder Brown ist in Barcelona. Per
22
Zufall ist Brown tatsächlich in Barcelona. Smiths Überzeugung (b) ist also sowohl gerechtfertigt als auch wahr und stellt dennoch nach allgemeiner Auffassung kein Wissen dar.
An dieser Stelle führt Bernecker die für ihn maßgebliche Erweiterung und Veränderung des Beispiels ein. Im Gegensatz zu dem bisher geschilderten Fall gibt es nämlich jetzt einen kausalen Zusammenhang zwischen Smiths Überzeugung, dass Nogot einen Golf besitzt, und Browns Aufenthalt in Barcelona. Nogot und Brown sind Freunde, wovon Smith nichts weiß. „Nogot möchte gerne seinen Freund Brown in Barcelona besuchen, hat aber kein Geld. Er gibt vor einen Golf zu besitzen, damit ihn seine Arbeitskollegen für kreditwürdig halten und ihm das Geld für die Reise nach Barcelona leihen. Wäre Brown nicht in Barcelona,würde Nogot keinen Golf fahren und Smith würde folglich auch nicht glauben, dass Nogot einen Golf besitzt oder Brown sich inBarcelona aufhält.“ (Bernecker, Ms., 11)
Was will Bernecker mit diesem Beispiel zeigen? Wenn ich recht sehe, zumindest dreierlei: Gemäß der von ihm beabsichtigen und erforderlichen Abschwächung der Identitätsbedingung zwischen rechtfertigendem und wahrmachendem Sachverhalt veranschaulicht er erstens den Fall eines kausalen Zusammenhangs zwischen den beiden Sachverhalten. Zweitens soll der Fall einer abweichendenKausalkette vorgeführt werden. Und drittens behauptet Bernecker, dass trotz solch einer abweichenden Kausalkette Wissen vorliegt.
Meine Bedenken richten sich gegen den zweiten Punkt, wovon dannauch der dritte abhängt. Mein Verdacht besteht darin, dass Bernecker an entscheidender Stelle eine abweichende Kausalkettemit einer dem epistemischen Subjekt nicht zugänglichen Kausalkette verwechselt. Sein Beispiel belegt, dass Browns Aufenthalt in Barcelona kausal hinreichend dafür ist, dass Nogot einen Golf fährt. Das gilt in einem spezifischen Sinn: Aufgrund seines Wunsches, seinen Freund Brown in Barcelona zu besuchen, verfolgt Nogot mit dem Fahren des Wagens die Absicht,seine Arbeitskollegen zu täuschen und sich dadurch von ihnen den für die Reise benötigten Kredit zu verschaffen. Und weil
23
uns – nicht aber Smith selbst – aus einer durch die einschlägigen Informationen angereicherten Beobachterperspektive dieser spezifische Kausalzusammenhang zugänglich ist, sind wir vielleicht bereit, Smith Wissen zuzusprechen. Bernecker erwägt übrigens seinerseits, ob nicht Smiths Einsicht in diesen für ihn alles andere als abweichenden, sondern einschlägigen Kausalzusammenhang notwendig für dessen Wissen wäre, lehnt dies aber unter Berufung auf den von ihm vertretenen Externalismus ab. Wieso aber sollte in seinem Beispiel überhaupt eine abweichende, statt einer für das entsprechende epistemische Subjekt unzugängliche Kausalkette vorliegen?
Akzeptieren wir Berneckers Mini-Geschichte bis zur Freundschaftvon Nogot und Brown und der Tatsache, dass Smith nichts davon weiß. Ergänzen wir jedoch dann, dass Nogot auch mit Browns Fraubefreundet ist. Aufgrund von Browns längerem Arbeitsaufenthalt in Barcelona fährt Frau Brown den Wagen ihres Mannes und überlässt freundlicherweise ihren Golf Nogot, der selbst über keinen eigenen Wagen verfügt und deshalb froh und stolz ist, mit ihm zur Arbeit fahren zu können. Erneut bildet sich Smith daraufhin die Überzeugung, dass Nogot einen Golf besitzt oder Brown sich in Barcelona aufhält. In diesem Fall besteht nun tatsächlich ein abweichender Kausalzusammenhang zwischen rechtfertigungsverleihendem und wahrmachendem Sachverhalt der einschlägigen Überzeugung. Allerdings wird hier auch kaum jemand Smith Wissen zusprechen. Daraus schließe ich, dass ein abweichender kausaler Zusammenhang zwischen rechtfertigendem und wahrmachendem Sachverhalt nicht hinreichend für Wissen ist.Damit aber haben sich alle hier untersuchten konservativen rechtfertigungsergänzenden Strategien zur Lösung des Gettierproblems als unzulänglich herausgestellt.
3. Radikale Reaktionen auf Gettiers Herausforderung
Worin bestehen die längerfristigen und bis in unsere heutige Diskussion anhaltenden Wirkungen von Gettiers Herausforderung?
24
Auch bei deren Durchsicht treffen wir erneut auf methodische und inhaltliche Aspekte. All ihren Varianten ist eine Skepsis gegenüber den soeben diskutierten Standardansichten sowohl von Begriffsanalyse als auch der Wissenskonzeption gemein. Was heißt das jeweils? Eine Nicht-Standardansicht von Begriffsanalyse verabschiedet das Monopol ihrer reduktiven Version und zieht stattdessen etwa eine konnektive Form à la Strawson, eine theoretische Explíkation à la Carnap und Quine, eine praktische Explikation à la Craig, eine Standardismusmethode à la Rescher, eine Familienähnlichkeitsdiagnose à la Wittgenstein oder eine von vielen möglichen Formen des Überlegungsgleichgewichts in Betracht.15 Eine Nicht-Standardansicht von Wissen gibt die lange vorherrschende Auffassung auf, Wissen sei zumindest gerechtfertigte, wahre Überzeugung, die durch eine (oder vielleicht auch mehrere) Bedingung(en) so zu ergänzen ist, dasswir dadurch zu einem befriedigenden Wissensbegriff gelangen. Ich werde nun vorerst die verschiedenen methodischen Reaktionenaußer Acht lassen (am Schluss jedoch noch einmal kurz auf sie zurückkommen) und mich den inhaltlichen Aspekten der Nicht-Standardansicht von Wissen zuwenden.
In einer Reihe neuerer Veröffentlichungen hat Duncan Pritchard dafür argumentiert, zwei von ihm sogenannte Meisterintuitionen (master intuitions) als grundlegende und unverzichtbare Adäquatheitsbedingungen für jede erfolgreiche Theorie des Wissens anzuerkennen und ihnen entsprechend Rechnung zu tragen;diese beiden Intuitionen nennt er die Fähigkeitsintuition einerseits und die Antizufallsintuition andererseits.16
In den letzten Jahrzehnten haben sich zwei umfangreiche Forschungsprogramme in der Erkenntnistheorie herausgebildet, die nicht nur jeweils eine dieser beiden Intuitionen zu ihrer Leitidee erkoren haben, sondern zudem in ihrer jeweiligen charakteristischen Auswicklung einer dieser beiden Intuitionen 15 Diese Aufzählung verschiedener Formen von Begriffsanalyse ist mitnichten erschöpfend. Vgl. für eine Vorstellung wichtiger weiterer Arten McGinn 2012, 93-106.16 Vgl. etwa Pritchard 2012a, 2012b und 2012c.
25
auch die Lösung des Gettierproblems sehen. Ich meine hier natürlich die verschiedenen Versionen modaler Erkenntnistheorieauf der einen Seite und die unterschiedlichen Varianten der Tugenderkenntnistheorie auf der anderen Seite.17 Pritchard meint, dass seine Antizufallstugenderkenntnistheorie, die die wechselseitige Unabhängigkeit der beiden Meisterintuitionen betont, eine gelungene Synthese dieser beiden Forschungsprogramme darstellt. Ich selbst bin aus verschiedenenGründen an der Ausarbeitung einer robusten Tugenderkenntnistheorie interessiert und versuche dabei auch herauszufinden, inwieweit diese gute Aussichten zur Lösung des Gettierproblems bietet. Ich denke, dass ihre Chancen deshalb nicht schlecht stehen, weil ich die beiden von Pritchard angeführten Meisterintuitionen nicht für theoretisch gleichwertig halte und die Aufgabe für eine überzeugende Erkenntnistheorie darin sehe, die Antizufallsintuition mithilfevon Elementen zu erklären, die sich aus der Fähigkeitsintuitiongewinnen lassen.18
Warum sind die beiden einschlägigen Intuitionen nicht gleichwertig? Im Anschluss an Pritchards Untersuchungen zu epistemischem Zufall sind viele Erkenntnistheoretiker der Ansicht, dass Wissen nicht grundsätzlich mit jeder Art von epistemischem Zufall unvereinbar ist.19 Strittig ist vielmehr, welche Art von Zufall Wissen ausschließt. Evidentieller Zufall,demgemäß es zufällig ist, dass ein epistemisches Subjekt die Belege erwirbt, die es für seine Überzeugung hat, wird gemeinhin als mit Wissen vereinbar betrachtet (vgl. Pritchard 17 Unter modale Erkenntnistheorien sind meines Erachtens auch die meistenFormen des Reliabilismus zu subsumieren. Das scheint mir dem Anliegen des Reliabilismus eher gerecht zu werden als ihn auf Theorie externalistischer Rechtfertigung zu verpflichten, die nur schwer mit unseren intensionalen Intuitionen über den Begriff der Rechtfertigung in Einklang zu bringen ist.18 Diese Auffassung teile ich mit Stefan Tolksdorf (vgl. Tolksdorf 2012),auch wenn wir sie unterschiedlich begründen und unterschiedliche Konsequenzen aus ihr ziehen.19 In Pritchard 2005 werden sechs verschiedene Formen epistemischen Zufalls unterschieden, von denen vier nach Pritchards Ansicht mit Wissen vereinbar sind, wohingegen zwei weitere dieses unmöglich machen. Ich beschränke meine Diskussion im Folgenden auf die beiden von Pritchard so genannten Arten evidentiellen Zufalls und veridischen Zufalls.
26
2005, 136). Veridischer Zufall, demgemäß es zufällig ist, dass bei den dem epistemschen Subjekt zur Verfügung stehenden Belegen für seine Überzeugung diese wahr ist, wird hingegen alsunvereinbar mit Wissen angesehen.20 In einer informativen Analyse von Wissen geht es meines Erachtens nicht nur darum, dass veridischer Zufall ausgeschlossen wird, sondern vor allem sollte es darum gehen, dass er auf eine Weise ausgeschlossen wird, die uns eine gute Erklärung dafür liefert, warum wir gerade durch eine bestimmte Art des Ausschlusses gewährleisten können, dass Wissen vorliegt. Und der aussichtsreichste Kandidat für solch eine gute Erklärung scheint mir derjenige zusein, der die kognitiven Fähigkeiten oder Leistungen eines epistemischen Subjekts für den Ausschluss veridischen Zufalls verantwortlich macht. Eine solche Überlegung dürfte die zentrale Motivation für alle Tugenderkenntnistheoretiker sein.
Worin besteht die tugendtheoretische Grundidee zur Lösung des Gettierproblems? Tugenderkenntnistheoretiker sind sich darin einig, dass eine wahre Überzeugung dann Wissen darstellt, wenndie Wahrheit der Überzeugung durch eine kognitive Fähigkeit oder Leistung des epistemischen Subjekts zustande kommt, wofür ihm Anerkennung gebührt.21 Da in Gettierfällen die Wahrheit derjeweiligen Überzeugung auf eine veridisch zufällige Weise zustande kommt, die eine Anerkennung für das epistemische Subjekt ausschließt, haben wir somit eine Erklärung, warum keinWissen vorliegt.
Diese tugenderkenntnistheoretische Grundidee ist auf unterschiedliche Weise ausgewickelt und weiterverfolgt worden. Dabei spielt häufig ein erklärender ‚weil‘- bzw. ‚aufgrund‘-Satzteil (because of) eine wichtige Rolle. Für Linda Zagzebski
20 Ich habe hier veridischen Zufall aus zwei Gründen anders eingeführt als Pritchard 2005, 146 das tut. Erstens macht Pritchard von modalen Überlegungen in nahen möglichen Welten Gebrauch, die ich nicht voraussetzenmöchte. Zweitens habe ich in meiner Formulierung der Grundeinsicht der Kritik Hetheringtons 2011, 90-94 an Pritchard Rechnung zu tragen versucht, der den für Gettierfälle einschlägigen Zufall als kombinatorischen Zufall bestimmt.21 Eine solche Auffassung findet sich bei Greco 2003, Sosa 2003, Riggs 2007 und Zagzebski 2009.
27
verlangt Wissen, dass ein epistemisches Subjekt die Wahrheit einer Überzeugung aufgrund intellektueller Tugenden glaubt. FürJohn Greco verlangt Wissen, dass ein epistemisches Subjekt die Wahrheit einer Überzeugung aufgrund einer zuverlässigen kognitiven Fähigkeit glaubt. Und für Ernest Sosa liegt dann Wissen vor, wenn eine Überzeugung wahr ist, weil sie intellektuell kompetent ist.22
Die Herausforderung für eine Tugenderkenntnistheorie besteht darin, die einschlägige Beziehung zwischen intellektuellen Fähigkeiten, Tugenden oder Kompetenzen und ihrem Ergebnis, Wissen, so zu spezifizieren, dass wir dadurch eine befriedigende Erklärung unseres Analysandums erhalten. Dazu hatSosa ein allgemeines Bild von Performanzen (performances) als Aktivitäten mit einer bestimmten Prozess-Produkt-Struktur entworfen, das auch auf die Beurteilung von Überzeugungen zutrifft; auch Überzeugungen fallen unter die von Sosa so genannte AAA-Struktur (vgl. Sosa 2007, 22-24).
Diese Struktur besagt, dass wir Performanzen aller Art nach ihrer Akkuratesse (accuracy), Adäquatheit (adroitness; wörtlich: Geschicklichkeit) und Angemessenheit (aptness) beurteilen können. Akkurate Prozesse erreichen ihr Ziel, d.h. sie sind erfolgreich. Adäquate Prozesse manifestieren Kompetenz. Und angemessene Prozesse sind akkurat weil adäquat. Im Hinblick aufÜberzeugungen identifiziert Sosa ihre Akkuratesse mit ihrer Wahrheit, ihre Adäquatheit mit ihrer Manifestation intellektueller Tugend bzw. Kompetenz, und ihre Angemessenheit mit ihrer Eigenschaft wahr weil kompetent zu sein.
John Turri hat nun darauf aufmerksam gemacht, dass Sosas Angemessenheitsbedingung für Überzeugungen nicht hinreichend für eine Lösung des Gettierproblems ist und auch Sosa selbst
22 Sosa hat hier nur sein sogenanntes tierisches Wissen (animal knowledge) im Sinn. Ich gehe hier nicht auf die Unterschiede zwischen intellektuellen Tugenden, kognitiven Fähigkeiten und Kompetenzen bei Zagzebski, Greco und Sosa ein, weil es mir an dieser Stelle nur um ihre Gemeinsamkeiten, nicht aber um die wichtigen Unterschiede zwischen ihren jeweiligen Analysen geht.Für Einzelheiten vgl. Zagzebski 1996, 2009, Greco 2003, 2010 sowie Sosa 2007, 2011.
28
scheint bei seiner Analyse von Wissen Wert darauf zu legen, dass der jeweilige kognitive Erfolg einer Performanz durch die Ausübung einer Kompetenz erzielt wird (vgl. Sosa 2007: 36 und Turri 2011: 136-138). Ausschlaggebend ist hier eine wichtige Unterscheidung zwischen einem Ergebnis, das eine Disposition manifestiert, und einen Ergebnis, das bloß aufgrund einer Disposition eintrifft. Turri veranschaulicht den relevanten Unterschied anhand der beiden folgenden Beispiele:
(BOIL) You place a cup of water in the microwave and pressstart. The magnetron generates microwaves that travel into the central compartment, penetrate the water, and excite its molecules. Soon the water boils.
(FIRE) You place a cup of water in the microwave and pressstart. The magnetron generates microwaves that cause an insufficiently insulated wire in the control circuit to catch fire, which fire deactivates the magnetron and spreads to the central compartment. Soon the water boils. (Turri 2011: 137)
Nach Turri veranschaulichen diese beiden Beispiele den wichtigen Unterschied zwischen einem Resultat, das im ersten Fall durch die Manifestation einer Disposition, im zweiten Fallbloß aufgrund einer Disposition eintrifft. Wird dieses Ergebnisnun auf den epistemischen Bereich angewendet, lässt sich festhalten, dass ein epistemisches Subjekt dann weiß, dass p, wenn seine wahre Überzeugung, dass p, seine kognitive Kompetenzmanifestiert. Wird eine solche kognitive Kompetenz im erfolgreichen Prozess des Erwerbs einer wahren Überzeugung nicht manifestiert, haben wir es mit einem Gettierfall zu tun. Gettierfälle sind also Manifestationsfehlschläge, die dadurch an Zagzebskis Diagnose des doppelten Zufalls, bzw. des Glücks im Unglück erinnern, was sich anhand von Turris zweitem Beispiel noch einmal verdeutlichen lässt. Die Mikrowelle initiiert einen Prozess, dessen Ergebnis normalerweise in dem kochenden Wasser bestehen würde. Doch ein unglücklicher Zufall tritt ein; das Magnetron ist defekt, was normalerweise dazu führen würde, dass das Wasser nicht zum Kochen gebracht wird. Hier kommt der glückliche Zufall zur Hilfe. Ein Kurzschluss
29
löst ein begrenztes Feuer aus, das das Wasser kochen lässt. Unddiese abweichende Kausalkette ist dafür verantwortlich, dass das Ergebnis die Kochkapazität der Mikrowelle nicht manifestiert. Ich überlasse es hier dem Leser, dieses Beispiel auf die bislang diskutierten Gettierfälle zu übertragen und dieStärke des tugendtheoretischen Erklärungsansatzes zu beurteilen.
Sowohl Sosa wie auch Turri behandeln „Manifestation“ als einen metaphysisch primitiven Begriff, den sie allein durch Beispieleerläutern und nicht näher analysieren. Ich glaube, dass es gerade von einer genauen Analyse und damit von einem detaillierteren Verständnis dieses Begriffs abhängen wird, wie erfolgreich eine tugendtheoretische Analyse von Wissen und wie überzeugend ihre Lösung des Gettierproblems sein wird.
Von entscheidender Bedeutung für die tugendtheoretische Wissensanalyse ist die Beurteilung der gegen sie vorgebrachten Kritik, dass ihre Bedingungen weder notwendig noch hinreichend für Wissen sind. Dass ihre Bedingungen nicht hinreichend sind, wird meist anhand des von Ginet und Goldman eingeführten Scheunenattrappenbeispiels (fake barns) zu zeigen versucht (vgl. Goldman 1976, 86). Anders als im ursprünglichen Beispiel und vermutlich zur leichten Identifizierung ist sein Protagonist inzwischen als Barney bekannt. Barney macht mit seinem Wagen einen Ausflug durch eine ihm bislang unbekannte ländliche Gegend, in der in einiger Entfernung von der Straße eine Reihe von Scheunen zu stehen scheint. Was Barney nicht weiß, ist, dass sich dort nur eine originale Scheune befindet, der Rest sind von der Straße aus ununterscheidbare Scheunenattrappen, die in dem Gelände für Filmdreharbeiten aufgestellt worden sind. Durch Zufall fokussiert Barney nun die originale Scheune und betrachtet sie sorgfältig. Ist ihm das Wissen zuzusprechen,dass sich dort eine Scheune befindet?
Nach tugendtheoretischer Sicht sind alle einschlägigen perzeptuellen Kompetenzen in einem erfolgreichen Prozess des Erwerbs einer wahren Überzeugung manifestiert, so dass nichts dagegen zu sprechen scheint, Barney tatsächlich Wissen
30
zuzuerkennen. Eine Reihe von Erkenntnistheoretikern vertritt demgegenüber die Ansicht, unsere Intuitionen sprächen eindeutigdafür, dass Barney unter den gegebenen Umständen über kein Wissen verfügt, da er nur zufällig richtig liegt. Welche Diagnose lässt sich stellen und wie ist der Streit zu entscheiden?
Den in Barneys Situation anzutreffenden Zufall hat Pritchard umgebungsbedingten (environmental) Zufall genannt und ihn von derArt intervenierenden Zufalls unterschieden, der uns von Gettierfällen vertraut ist (vgl. Pritchard 2010, 36). Nichtsdestotrotz behauptet er: „… the epistemically inhospitable nature of the environment ensures that his [Barney’s; D.K.] belief is nevertheless only true as a matter of luck such that he lacks knowledge.” (Pritchard 2010, 36)
Gerade dies scheint mir nicht richtig zu sein. Pritchard kommt zu diesem Ergebnis, weil für ihn sowohl umgebungsbedingter Zufall als auch der Gettierfälle auszeichnende intervenierende Zufall unter die allgemeine Kategorie des veridischen Zufalls zu subsumieren sind (vgl. Pritchard 2010, 36, Fn. 10). Meines Erachtens ist das falsch. Umgebungsbedingter Zufall fällt gerade nicht unter veridischen Zufall, wie ich ihn oben eingeführt habe, sondern es liegt nahe, ihn vielmehr als eine Form evidentiellen Zufalls zu betrachten, also der Form des Zufalls, die sich auf den glücklichen Erwerb einschlägiger Belege bezieht und der nach Pritchards eigener Auffassung mit Wissen vereinbar ist.
Entgegen Pritchards Sicht der Dinge und in Übereinstimmung mit einer tugendtheoretischen Analyse weiß Barney also, dass dort eine Scheune steht, auch wenn er sich dessen nicht sicher sein kann, doch Sicherheit stellt keine Bedingung für Wissen dar (vgl. Heathcote 2006, 166) Man kann angesichts des Beispiels natürlich sagen, dass Barney beinahe nicht gewusst hätte, dass sich dort eine Scheune befindet, doch daraus folgt natürlich nicht, dass er es tatsächlich nicht weiß (vgl. Lycan 2006, 163).
31
Dass im Zusammenhang mit dem Scheunenattrappen manche Erkenntnistheoretiker dafür eintreten, Barney Wissen abzusprechen, scheint mir maßgeblich an einem theoretischen Vorurteil bzw. an den durch ihre theoretische Position bedingten Intuitionen zu liegen. Die Wissensverneiner sind nämlich in der Regel Vertreter einer sicherheitsbasierten Erkenntnistheorie, deren Position sich dadurch auszeichnet, dass dann kein Wissen vorliegt, wenn eine wahre Überzeugung in einer nahen möglichen Welt leicht hätte falsch sein können. Undweil Barneys Überzeugung in einer nahen möglichen Welt tatsächlich falsch gewesen wäre, sprechen sie ihm Wissen ab. Die Kritik beruht auf einer petitio principii und vermag somit nicht zu überzeugen.
Für die These, dass die Bedingungen einer tugendtheoretischen Wissensanalyse nicht einmal notwendig seien, wird hauptsächlichdas folgende Beispiel von Jennifer Lackey in Anspruch genommen,in dem der ortsfremde Morris in Chicago eintrifft.
Morris has just arrived at the train station in Chicago and wishes to obtain directions to the Sears Towers. He approaches the first adult passerby and asks him for direction to the Sears Towers. The passerby happens to be a Chicago resident who knows the city very well. He directs Morris to the Sears Towers by telling him that it is located two blocks east of the train station. (Lackey 2007, 352)
Das Beispiel legt nahe und wird von Lackey auch so interpretiert, dass Morris zwar Wissen darüber erwirbt, wie er zu den Sears Towers gelangt, dieses Wissen aber ausschließlichetwas mit den kognitiven Leistungen des ortskundigen Einheimischen und (beinahe) nichts mit den intellektuellen Fähigkeiten von Morris zu tun hat, weswegen letzterem auch keinerlei Anerkennung gebührt. Eine solche Sicht scheint mir eine unzulässige Vereinfachung der Situation und letztlich unhaltbar zu sein.
32
Theorien über das Wissen durch Zeugnis anderer werden häufig dadurch unterschieden, ob die tatsächliche Zuverlässigkeit der Quelle des Zeugnisses oder aber die gerechtfertigte Überzeugungdes epistemischen Subjekts über die Zuverlässigkeit der Quelle ausschlaggebend ist. Eine solche Unterscheidung nimmt auch Brendel vor, subsumiert die tugendtheoretische Analyse unter die zweite Option und votiert dann dafür, dass die tatsächlicheZuverlässigkeit in Form einer sicherheitsbasierten Methode für Zeugniswissen entscheidend sei (vgl. Brendel 2013 b, 238).
Demgegenüber möchte ich im Anschluss an Greco darauf hinweisen,dass aus tugendtheoretischer Perspektive eine dritte Option vonentscheidender Bedeutung ist, in der kognitive Leistungen des Zeugnisempfangenden zur Beurteilung des Zeugnisgebenden eine nicht zu unterschlagenden Rolle spielen (vgl. Greco 2010, 81).
Wie unterschiedlich diese Rolle ausfallen kann, mag man sehen, wenn man drei Varianten des ursprünglichen Beispiels in Betracht zieht. In der ersten Version trifft Morris auf eine durch ihre äußere Erscheinung eher zweifelhafte Gestalt, über deren Vertrauenswürdigkeit er sich ein Bild durch ein Gespräch macht, nach dessen Abschluss er seine Wegauskunft zu Recht akzeptiert. In der zweiten Version trifft Morris auf einen weiteren Touristen, der im Gegensatz zu ihm einen Stadtplan dabei hat und nach dessen gemeinsamer Konsultation er den richtigen Weg zu den Sears Towers einschlägt. Und in der dritten Version entschließt sich Morris lieber niemanden um eine Auskunft zu bitten – er hat in letzter Zeit diesbezüglich in fremden großen Städten schlechte Erfahrungen gemacht -, sondern sich einen Stadtplan zu kaufen und mit dessen Hilfe sein Ziel zu finden, was ihm auch gelingt. Ohne diese Beispielehier im Einzelnen detailliert kommentieren und auswerten zu wollen, belegen sie für den Fall des Wissens durch das Zeugnisanderer sowohl den unverzichtbaren wie auch graduell unterschiedlichen Anteil der kognitiven Leistungen des Zeugnisempfängers, weswegen keine Rede davon sein kann, dass
33
dessen zum Ergebnis beitragende Leistungen nicht notwendig seien.23
Für Kritiker robuster tugendtheoretischer Wissensanalysen wie Pritchard und Brendel (vgl. Brendel 2013b, 241) zeigen die beiden diskutierten Beispiele die Unhaltbarkeit einer Tugenderkenntnistheorie. Gegen ihre Einschätzung, dass die Situation Barneys zeige, hier liege eine kognitive Leistung ohne Wissen vor, habe ich die These verteidigt, dass Barney unter den gegebenen Bedingungen sehr wohl Wissen zuzusprechen ist. Und gegen die Auffassung, dass das Morris-Beispiel einen Fall von Wissen ohne kognitive Leistungen darstelle, habe ich durch eine dreifache Veränderung des Beispiels die Idee zu plausibilisieren versucht, dass in Szenarien von Zeugniswissen die kognitive Leistung des epistemischen Subjekts in unterschiedlichem Ausmaß bzw. in verschiedenen Graden beteiligtund entsprechend anzuerkennen ist.
In diesem Teil über radikale Reaktionen auf Gettiers Herausforderung habe ich deutlich zu machen versucht, warum ichdas tugenderkenntnistheoretische Forschungsprogramm für erfolgversprechend halte und dazu seine Lösungsstrategie in ihren Grundzügen skizziert. In gebotener Kürze habe ich dargestellt, warum ich die Kritik für verfehlt halte, dass die Bedingungen einer tugendtheoretischen Wissensanalyse weder notwendig noch hinreichend für Wissen seien. Eine gründliche Verteidigung der Tugenderkenntnistheorie und ihres Lösungsvorschlags zum Gettierproblem kommt natürlich nicht umhin, sich mit ihren Hauptkonkurrenten, meines Erachtens insbesondere modalen Erkenntnistheorien sicherheitsbasierter Provenienz und Pritchards Antizufallstugenderkenntnistheorie, detailliert auseinanderzusetzen. Diese Aufgabe muss an anderer Stelle in Angriff genommen werden.
23 Mir ist klar, dass ich hier nicht viel mehr getan habe, als mit der Diskussion von Lackeys Beispiel zu beginnen, doch müssen mir hier diese wenigen Hinweise genügen, um dem Vorwurf zu begegnen, eine tugendtheoretische Wissensanalyse sei nicht notwendig.
34
4. Konsequenzen für die gegenwärtige Erkenntnistheorie
Zu Beginn meines Beitrags habe ich behauptet, dass sich durch Gettiers Herausforderung an die Analyse von propositionalem Wissen eine bestimmte Auffassung von Erkenntnistheorie und ihrem vermeintlich zentralen Projekt entwickelt und etabliert hat, die sowohl extrem einflussreich als auch zutiefst problematisch ist. Was ich damit meine, ist nicht nur, dass großer Einfluss und fragwürdige Konsequenzen zwei feststellbareFolgen von Gettiers Aufsatz sind, sondern vielmehr, dass sich durch dessen bedeutenden Einfluss problematische Konsequenzen für das Selbstverständnis und die Aufgabenstellung der Erkenntnistheorie ergeben haben. Unbeschadet ihrer unbestreitbaren Verdienste für ein genaueres und tieferes Verständnis propositionalen Wissens hat Gettiers Herausforderung dazu geführt, dass die Erkenntnistheorie der letzten fünfzig Jahre drei bemerkenswerte Einseitigkeiten und dadurch auch schwerwiegende Defizite aufweist. Erstens hat sie sich zu ausschließlich mit der Natur propositionalen Wissens beschäftigt. Zweitens hat sie sich zu ausschließlich mit der Natur propositionalen Wissens beschäftigt. Und drittens hat sie sich überhaupt zu sehr mit Wissen beschäftigt. Natürlich sind dies drei Behauptungen, deren eingehende Begründung ich am Schluss dieses Beitrags nicht mehr leisten kann. Ich muss mich hier darauf beschränken, sie etwas näher zu erläutern und einige Vorschläge zu machen, welch wünschenswerte Konsequenzen aus ihnen für eine Neuorientierung der Erkenntnistheorie zu ziehen sind. Dabei werde ich auch noch ganz kurz auf die Methodologie der Erkenntnistheorie zu sprechen kommen.24
Bis vor gut fünfzehn Jahren hat sich die Erkenntnistheorie nachGettiers Herausforderung beinahe ausschließlich mit der Natur propositionalen Wissens und den vermeintlich dazu notwendigen konkurrierenden Theorien epistemischer Rechtfertigung beschäftigt, ohne der Frage nach dem genuin epistemischen Wert von Wissen Beachtung zu schenken (vgl. dazu Koppelberg 2005: 46
24 Näher und detaillierter gehe ich auf die Probleme der Methodologie derErkenntnistheorie in Koppelberg 2014a, 2014b, Ms. a und Ms. b ein.
35
sowie Koppelberg 2009). Eine solche Vernachlässigung ist sowohlaus systematischen wie auch aus historischen Gründen verwunderlich und schädlich.
Aus historischen Gründen ist diese Vernachlässigung verwunderlich, weil die Frage nach dem Wert von Wissen bereits in Platons Dialog Menon aufgeworfen worden ist und dort zu interessanten Überlegungen Anlass gegeben hat, die bis heute nichts von ihrer systematischen Aktualität eingebüßt haben, weil Wissen in diesem Dialog durch das Merkmal der Stabilität ausgezeichnet wird, das gegenwärtig insbesondere in modalen Erkenntnistheorien eine Rolle spielt.
Aus systematischen Gründen ist die Vernachlässigung des Werts von Wissen schädlich, weil ohne eine zufriedenstellende Antwortauf die Frage nach dem Wert von Wissen nicht einzusehen ist, warum wir solch große Anstrengungen unternehmen sollten, dessenNatur zu klären. Es ist somit naheliegend, von einer befriedigenden Wissenstheorie zu fordern, dass sie Wert und Natur von Wissen in ihren Untersuchungen gleichermaßen berücksichtigt und ihrer wechselseitigen Abhängigkeit angemessen Rechnung trägt.
Von Platons einschlägigen Dialogen bis in die Gegenwart ist dieGeschichte der Erkenntnistheorie zu großen Teilen eine Geschichte der philosophischen Untersuchung propositionalen Wissens. Warum eigentlich? Eine oft implizite Vermutung könnte darin bestehen, dass sich in der Erkenntnistheorie fast alles um propositionales Wissen dreht, weil alle anderen Wissensformen auf sie zurückgeführt werden können. Dies ist allerdings eine kühne Vermutung, die insbesondere seit ca. zehnJahren heftig bestritten wird.
Im Zentrum gegenwärtiger Debatten über verschiedene Wissensformen steht die Auseinandersetzung um die Beziehung zwischen Wissen, dass und Wissen, wie, wozu sehr unterschiedliche Positionen vertreten werden, auf die ich hier
36
nicht mehr im Einzelnen eingehen kann.25 Einschlägig sind dieseDebatten auch für die Beurteilung des tugenderkenntnistheoretischen Forschungsprogramms, da die dort zentralen Begriffe kognitiver Fähigkeit, intellektueller Tugendund anerkennenswerter epistemischer Leistung in einer systematischen Nähe zum Begriff des Wissens, wie stehen. Vor einem solchen Hintergrund scheint es alles andere als ausgemacht zu sein, propositionales Wissen als den Dreh- und Angelpunkt der Erkenntnistheorie zu betrachten. Andere Wissensformen könnten sich gegebenenfalls als fundamentaler oder doch zumindest als eigenständig erweisen und interessante erklärende Beziehungen zu weiteren epistemischen Werten eröffnen.
Bei der Diskussion von Goldmans Reformulierungsstrategie zur Lösung des Gettierproblems habe ich mich auf zwei mögliche Motive für dessen Vorgehen bezogen: einerseits auf die Einsicht, dass epistemische Rechtfertigung ein wichtiger erkenntnistheoretischer Untersuchungsgegenstand ist, andererseits auf die Forderung, dieser Einsicht durch die Integration der Rechtfertigung als einer notwendigen Bedingung von Wissen in einer entsprechenden Analyse Rechnung zu tragen. Wie fragwürdig und letztlich unhaltbar das zweite Motiv tatsächlich ist, dürfte mein kritischer Durchgang durch die rechtfertigungsergänzenden Strategien zur Lösung des Gettierproblems gezeigt haben. Wenn meine Kritik stichhaltig ist, dann ist Wissen nicht einmal gerechtfertigte, wahre Überzeugung und die von Gettier angesetzte notwendige begriffliche Verbindung zwischen (personaler) Rechtfertigung und Wissen erweist sich als zentral für die vermeintliche Unlösbarkeit seines Problems.
Schon seit längerem hat Richard Foley dafür argumentiert, eine Theorie gerechtfertigter Überzeugung, die er als Theorie epistemische Rationalität konzipiert, nicht begrifflich an eineTheorie des Wissens anzubinden, weil dies mit fragwürdigen
25 Vgl. Bengson and Moffett 2011, Hetherington 2011, Jung 2012, Newen, Bartels und Jung 2011 sowie Stanley 2011.
37
Auflagen für beide Projekte verbunden ist (vgl. Foley 2004 und 2012). Die Frage, was Wissen ist, ist eine andere als die, was wir glauben sollten, wenn es uns darum geht, interessante wahreÜberzeugungen zu erwerben und falsche Überzeugungen möglichst zu vermeiden.
Unser intellektuelles Leben ist reichhaltiger als eine wissenszentrierte Erkenntnistheorie nahelegt. Bei der Diskussion radikaler Reaktionen auf Gettiers Herausforderung und meiner Skizze tugendtheoretischer Lösungsversuche hat sich die zentrale Bedeutung von kognitiven Fähigkeiten, intellektuellen Tugenden und anerkennenswerten epistemischen Leistungen herausgestellt. Und auch weitere wichtige kognitive Werte wie Verstehen und Weisheit, die in diesem Beitrag keine Rolle spielten, scheinen mir für ein adäquates Bild unseres intellektuellen Lebens unverzichtbar zu sein. Deshalb plädiere ich für den Übergang von einer wissenszentrierten zu einer wertbasierten Erkenntnistheorie in dem Sinne, dass in ihr alle kognitiven Werte die ihnen gebührende Berücksichtigung und Behandlung finden.
Wie diese kognitiven Werte die ihnen gebührende Behandlung finden, ist eine Frage der Methodologie der Erkenntnistheorie. Bei der Auswertung von Gettiers Beispielen fällt auf, dass Gettier sich an keiner Stelle explizit auf Intuitionen beruft, um mit ihrer Hilfe das Erreichen seines Beweisziels zu begründen. Im Laufe dieses Beitrags dürfte aber deutlich geworden sein, welche bedeutende Rolle nicht zuletzt theoretisch motivierte Intuitionen bei der Beurteilung des Gettierproblems spielen. Pritchard hat darauf hingewiesen, dasseine ganze Reihe von verschiedenen und oftmals miteinander konfligierenden Intuitionen in der Erkenntnistheorie zum Tragenkommt und es darüber hinaus nicht ratsam sei, unsere Belegbasisallein auf Intuitionen zu beschränken.26 Ich selbst favorisieredie Methode eines weiten, empirisch angereicherten Überlegungsgleichgewichts, das gegenüber einer reduktiven
26 Pritchard Ms. unterscheidet extensionale, intensionale, allgemeine, sprachliche und tugendhafte Intuitionen.
38
Begriffsanalyse in Form von einzeln notwendigen und zusammen hinreichenden Bedingungen neben verschiedenen Intuitionen auch explikative Anforderungen und empirische Auflagen berücksichtigt.27 Auf jeden Fall glaube ich, dass eine epistemisch privilegierte Funktion einer bestimmten Teilklasse von Intuitionen innerhalb einer reduktiven Begriffsanalyse dem breiten Spektrum der Aufgaben und Herausforderungen gegenwärtiger Erkenntnistheorie nicht gerecht wird.
Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass meine Schlussüberlegungen dafür zu sprechen scheinen, von einer wissenszentrierten zu einer wertbasierten Erkenntnistheorie überzugehen und eine intuitionszentrierte Methodologie zugunsten einer umfangreicheren evidenz- bzw. belegbasierten Methodologie aufzugeben. Eine explizite Verteidigung dieser beiden Forderungen kann nur im Rahmen eines größeren Projekts geleistet werden, das sich detailliert der Beantwortung der beiden zusammenhängenden Fragen widmet, wozu und wie Erkenntnistheorie zu betreiben ist.28
Literatur
Armstrong, David M. (2004): Truth and Truthmakers, Cambridge.
Bengson, John and Marc A. Moffett (eds.) Knowing How: Essays on Knowledge, Mind, and Action, Oxford.
Bernecker, Sven (Ms.): “Eine identifikationistische Lösung des Gettier Problems”, erscheint in: Koppelberg, Dirk & Stefan Tolksdorf (Hg.), Erkenntnistheorie – wie und wozu?, Münster.
Brendel, Elke (2013a): Wissen, Berlin, Boston.
___ (2013b): “Knowledge – Safe or Virtuous?”, in: Henning, Tim and David P. Schweikard (eds.), Knowledge, Virtue, and Action: Essays on Putting Epistemic Virtues to Work, New York and London, 227-244.
27 Vgl. dazu Koppelberg 2000, 2001 und 2007.28 Vgl. dazu die unterschiedlichen Beiträge in Koppelberg & Tolksdorf 2014 sowie auch einzelne Beiträge in Haug 2014.
39
Clark, Michael (1963): “Knowledge and Grounds: A Comment on Mr.Gettier’s Paper”, Analysis 24, 46-48.
Craig, Edward (1990): Knowledge and the State of Nature: An Essay in Conceptual Synthesis, Oxford.
Dretske, Fred (1971): “Conclusive Reasons”, Australasian Journal of Philosophy 49, 1-22.
___ (2013): „Gettier and Justified True Belief: Fifty Years On“, The Philosophers’ Magazine 61.
Ernst, Gerhard (2002): Das Problem des Wissens, Paderborn.
Feldman, Richard (2003): Epistemology, Upper Saddle River.
Floridi, Luciano (2011): The Philosophy of Information, Oxford.
Fogelin, Robert J. (1994): Pyrrhonian Reflections on Knowledge and Justification, New York and London.
Foley, Richard (2004): “A Trial Separation between the Theory of Knoledge and the Theory of Justified Belief”, in: Greco, John (ed.), Ernest Sosa and His Critics, Malden, 59-71
___ (2012): When Is True Belief Knowledge?, Princeton.
Gettier, Edmund (1963): “Is Justified True Belief Knowledge?”, Analysis 23, 121-123.
Goldman, Alvin (1967): “A Causal Theory of Knowing”, in: Liaisions: Philosophy Meets the Cognitive and the Social Sciences, Cambridge, Mass., 69-83.
___ (1976): “Discrimination and Perceptual Knowledge”, in: Liaisions: Philosophy Meets the Cognitive and the Social Sciences, Cambridge, Mass., 85-103.
___ (1979): “What Is Justified Belief?”, in: Liaisions: Philosophy Meets the Cognitive and the Social Sciences, Cambridge, Mass., 105-126.
___ (1999): Knowledge in a Social World, Oxford.
40
___ (2002): “What Is Social Epistemology? A Smorgasbord of Projects”, in: Pathways to Knowledge: Private and Public, Oxford, 182-204.
Greco, John (2003): “Knowledge as Credit for True Belief”, in: DePaul, Michael and Linda Zagzebski (eds.), Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford, 111-134.
___ (2010): Achieving Knowledge: A Virtue-Theoretic Account of Epistemic Normativity, Cambridge.
Grundmann, Thomas (2011): “Defeasibility Theory”, in: Bernecker, Sven and Duncan Pritchard (eds.), The Routledge Companion to Epistemology, London and New York, 156-166.
Haug, Matthew C. (ed.) (2014): Philosophical Methodology: The Armchair or the Laboratory?, London and New York.
Heathcote, Adrian (2006): “Truthmaking and the Gettier Problem”, in: Hetherington, Stephen (ed.), Aspects of Knowing: Epistemological Essays, Amsterdam, 151-167.
Henderson, David and Terence Horgan (2011): The Epistemological Spectrum: At the Interface of Cognitive Science and Conceptual Analysis, Oxford.
Hetherington, Stephen (2001): Good Knowledge, Bad Knowledge: On Two Dogmas of Epistemology, Oxford.
___ (2011a): “The Gettier Problem”, in: Bernecker, Sven and Duncan Pritchard (eds.), The Routledge Companion to Epistemology, London and New York, 119-130.
___ (2011b): How to Know: A Practicalist Conception of Knowledge, Chichester.
___ (2012): “Knowledge and Knowing: Ability and Manifestation”,in: Tolksdorf, Stefan (ed.), Conceptions of Knowledge, Berlin and Boston, 73-99.
Jung, Eva-Maria (2012): Gewusst wie? – Eine Analyse praktischen Wissens, Berlin, Boston.
41
Kaplan, Mark (1985): „It Is Not what You Know that Counts“, TheJournal of Philosophy 82, 350-363.
Kim, Jaegwon (1988): „What Is ‚Naturalized Epistemology?“, Philosophical Perspectives 2, 381-405.
Kirkham, Richard L. (1984): “Does the Gettier Problem Rest on aMistake?”, Mind 93, 501-513.
Koppelberg, Dirk (1999): „Justification and Causation“, Erkenntnis 50, 447-462.
___ (2000): „Was ist Naturalismus in der gegenwärtigen Philosophie?“, in: Keil, Geert & Herbert Schnädelbach (Hg.), Naturalismus: Philosophische Beiträge, Frankfurt am Main.
___ (2001): „Zur Verteidigung des Psychologismus in der Erkenntnistheorie“, in: Grundmann, Thomas (Hg.), Erkenntnistheorie – Positionen zwischen Tradition und Gegenwart, Paderborn, 328-353.
___ (2004): “On the Prospects for Virtue Contextualism: Comments on Greco”, Erkenntnis 61, 401-413.
___ (2005): “Zum Wert des Wissens: Das Menon-Problem”, in: Meixner, Uwe und Albert Newen (Hg.), Philosophiegeschichte und logische Analyse – Schwerpunkt: Geschichte der Erkenntnistheorie, Paderborn, 46-56.
___ (2007): „Normative versus naturalistische Erkenntnistheorie – ein unüberbrückbarer Gegensatz?“, in: Sukopp, Thomas und Gerhard Vollmer (Hg.), Naturalismus: Positionen, Perspektiven, Probleme, Tübingen, 49-64.
___ (2009): „Nichts als die Wahrheit? – Zur Analyse epistemischen Werts“, in: Schönrich, Gerhard (Hg.), Wissen und Werte, Paderborn, 119-151.
___ (2012): „The Significance of Disagreement in Epistemology“,in: Jäger, Christoph and Winfried Löffler (eds.), Epistemology: Contexts, Values, Disagreement, Frankfurt, 305-317.
42
___ (2014 a): „Brauchen wir eine neue Agenda für die Erkenntnistheorie?“, erscheint in: Koppelberg, Dirk und Stefan Tolksdorf (Hg.), Erkenntnistheorie – wie und wozu?, Münster.
__ (2014 b): „Begriffsanalyse, Explikation und Überlegungsgleichgewicht in der Erkenntnistheorie“, erscheint in: Koppelberg, Dirk und Stefan Tolksdorf (Hg.), Erkenntnstheorie –wie und wozu?, Münster.
___ (Ms. a): „Der förderliche und fragwürdige Einfluss von Gettiers Herausforderung auf die Erkenntnistheorie”
___ (Ms. b): „Wie sollen wir Wissen verstehen?“
Koppelberg, Dirk und Stefan Tolksdorf (Hg.) (2014): Erkenntnistheorie – wie und wozu?, Münster.
Kornblith, Hilary (2008): “Knowledge Needs No Justification”, in: Smith, Quentin (ed.), Epistemology: New Essays, Oxford, 5-23.
Lackey, Jennifer (2007): “Why We Don’t Deserve Credit for Everything We Know”, Synthese 158, 345-361.
Littlejohn, Clayton (2012): Justification and the Truth-Connection, Cambridge: Cambridge UP.
Lowy, Catherine (1978): “Gettier’s Notion of Justification”, Mind 87, 105-108.
Lycan, William (2006): “On the Gettier Problem Problem”, in: Hetherington, Stephen (ed.), Epistemology Futures, Oxford, 148-168.
McGinn, Colin (2012): Truth by Analysis: Games, Names, and Philosophy, Oxford.
Newen, Albert; Bartels, Andreas and Eva-Maria Jung (eds.) (2011): Knowledge and Representation, Stanford, Paderborn.
Plantinga, Alvin (1993): Warrant: The Current Debate, New York, Oxford.
Pollock, John L. (1986): Contemporary Theories of Knowledge, London.
Pritchard, Duncan (2005): Epistemic Luck, Oxford. 43
___ (2010): “Knowledge and Understanding”, in: Pritchard, Duncan; Millar, Alan and Adrian Haddock, The Nature and Value of Knowledge, Oxford, 3-88.
___ (2012a): “Anti-Luck Virtue Epistemology”, The Journal of Philosophy 109, 247-279.
___ (2012b): “The Genealogy of the Concept of Knowledge and Anti-Luck Virtue Epistemology”, in: Tolksdorf, Stefan (ed, Conceptions of Knowledge, Berlin, Boston: de Gruyter, 159-177.
___ (2012c): “In Defense of Modest Anti-Luck Epistemology”, in:Becker, Kelly & Tim Black (eds.), The Sensitivity Principle in Epistemology, Cambridge, 173-192.
___ (Ms.): “Die Methodologie der Erkenntnistheorie”, in: Koppelberg, Dirk & Stefan Tolksdorf (Hg.), Erkenntnistheorie – wie und wozu?, Münster.
Rescher, Nicholas (1994): Philosophical Standardism: An Empiricist Approach to Philosophical Methodology, Pittsburgh.
Riggs, Wayne (2007): “Why Epistemologists Are So Down on Their Luck”, in: Greco, John and John Turri (eds.), 2012, Virtue Epistemology: Contemporary Readings, Cambridge, Mass., 285-305.
Rozeboom, W.W. (1967): “Why I Know So Much More than You Do”, American Philosophical Quarterly 4, 281-290.
Russell, Bertrand (1948): Human Knowledge: Its Scope and Limits, London 1992.
Sartwell, Crispin (1991): “Knowledge Is Merely True Belief”, American Philosophical Quarterly 28, 157-165.
___ (1992): “Why Knowledge Is Merely True Belief?”, The Journal of Philosophy 89, 167-180.
Scheffler, Israel (1965): Conditions of Knowledge, Chicago.
Shope, Robert K. (1983): The Analysis of Knowing: A Decade of Research, Princeton, NJ.
44
Sosa, Ernest (1988): “Methodology and Apt Belief”, in: Sosa, Ernest (1991), Knowledge in Perspective: Selected Essays in Epistemology, Cambridge.
___ (2003): “The Place of Truth in Epistemology”, in: DePaul, Michael and Linda Zagzebski (eds.), Intellectual Virtue: Perspectives from Ethics and Epistemology, Oxford; 155-179.
___ (2007): A Virtue Epistemology: Apt Belief and Reflective Knowledge, Vol. I, Oxford.
___ (2011): Knowing Full Well, Princeton.
Stanley, Jason (2011): Know How, Oxford.
Steup, Matthias (1998): An Introduction to Contemporary Epistemology, Upper Saddle River.
Sutton, Jonathan (2007): Without Justification, Cambridge, Mass. and London.
Swain, Michael (1974): “Epistemic Defeasibility”, American Philosophical Quarterly 11, 15-25.
Tolksdorf, Stefan (2012): “Knowledge, Abilities, and Epistemic Luck: What Is Anti-Luck Virtue Epistemology and What Can It Do?”, in: Tolksdorf, Stefan (ed.), Conceptions of Knowledge, Berlin, Boston, 179-214.
Turri, John (2011): „Manifest Failure: The Gettier Problem Solved”, in: Greco, John and John Turri (eds.), 2012, Virtue Epistemology: Contemporary Readings, Cambridge, Mass., 131-147.
___ (2012): „In Gettier’s Wake“, in: Hetherington, Stephen (ed.), Epistemology: The Key Thinkers, London, 214-229.
Williamson, Timothy (2000): Knowledge and Its Limits, Oxford.
Wittgenstein, Ludwig (1969): Über Gewißheit, Frankfurt am Main.
Zagzebski, Linda (1994): “The Inescapability of Gettier Problems”, in: Sosa, Ernest; Kim, Jaegwon; Fantl, Jeremy and
45
Matthew McGrath (eds.), 2008, Epistemology: An Anthology, Malden, 207-212.
___ (1996): Virtues of the Mind: An Inquiry into the Nature of Virtue and the Ethical Foundations of Knowledge, Cambridge.
___ (1999): “What Is Knowledge?, in: Greco, John and Ernest Sosa (eds.), The Blackwell Guide to Epistemology, 92-116.
___ (2009): On Epistemology, Belmont.
46