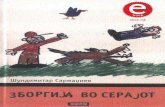VO 5 – Einführung in die Philosophie des Geistes
Transcript of VO 5 – Einführung in die Philosophie des Geistes
Universität Wien WS 2014
Michael Schmitz
Einführung in die Philosophie des Geistes
VO 5 04.11.2014
Materialismus – Iden@tätstheorie, Funk@onalismus
3
Philosophie des Geistes
MIND • Inten@onalität: Searle, Kapitel 6
BODY • Das Problem der mentalen Verursachung: Schmitz; Searle, Kapitel 7
• Materialismus – von der Iden@tätstheorie zum Funk@onalismus: J.J.C. Smart; Searle, Kapitel 2
• Können Computer denken? Searle: Minds, Brains and Programs; Fodor vs. Searle
THOUGHT • Internalismus vs. Externalismus: Kripke & Putnam
PERCEPTION • Wahrnehmung: Searle, Kap. 10
• „Was glauben wir, was will IBM?“ Kollek@ve Inten@onalität: von geteilter Aufmerksamkeit zu Kollek@vsubjekten
CONSCIOUSNESS • Das Bewusstsein ein Rätsel? T. Nagel • Was ist Bewusstsein eigentlich überhaupt? Searle, Kapitel 5 • Das Bewusstsein erklären: D. Chalmers • Der Hintergrund des Bewusstseinsrätsels: J. Locke • Was ist das Unbewusste (wenn es etwas ist)? Schmitz; Searle, Kapitel 9
• Selbst & Selbstbewusstsein: Schmitz; Searle, Kapitel 11
Der Elimina@vismus ist unverständlich
• Es muss im Bewusstsein oder außerhalb etwas von den abstrakten, ‘farblosen’ En@täten der Physik Verschiedenes geben (oder in beiden!)
• Aber wie steht es mit der Iden@tätstheorie?
4
Iden@tätstheorie als Lösung?
• Vor diesem Hintergrund erscheint die Iden@tätstheorie umso agrak@ver:
• Wir eliminieren das Bewusstsein nicht, sondern iden@fizieren es z.B. mit Gehirnzuständen wie etwa dem Feuern bes@mmter Neuronenverbände.
• Wir lösen damit gleichzei@g das Problem der mentalen Verursachung.
5
Iden@tätstheorie als Lösung?
• Die defini@onale, a priori Reduk@on des Bewusstseins durch den logischen Behaviorismus ist unplausibel.
• Die Idee, dass wir die Iden@tät von Bewusstseinszuständen mit Gehirnzuständen empirisch, a posteriori, feststellen können, ist plausibler und verspricht …
• das ,Bewusstseinsrätsel‘ zu lösen!
6
Probleme der Iden@tätstheorie
• Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Elimina@on und Iden@fika@on?
• Der Elimina@vist und der Iden@tätstheore@ker sagen beide, dass die Welt nur aus physikalischen Gegebenheiten besteht – sind ihre Posi@onen also wirklich ontologisch substanziell verschieden?
7
Probleme der Iden@tätstheorie
„Beiläufig gesprochen: Von zwei Dingen zu sagen, sie seien iden@sch, ist ein Unsinn, und von Einem zu sagen, es sei iden@sch mit sich selbst, sagt gar nichts.“
– Wiggenstein, Tractatus logico-‐philosophicus, 5.5303
8
Probleme der Iden@tätstheorie
• Wie kann eine Iden@tätsaussage tatsächlich empirisch informa@v und das Ergebnis einer wissenschanlichen Entdeckung sein?
• Es scheint, wir deuten nur zweimal auf dasselbe, sagen aber darüber nichts Informa@ves aus!
9
• Freges Sinnbegriff verspricht diese Schwierigkeiten zu lösen!
• Sinn = Art des Gegebenseins eines Gegenstands
10
Sinnbegriff und Iden@tät
Sinnbegriff und Iden@tät
• Frege: Es gibt Unterschiede in der Art des Gegebenseins bei Iden@tät des gemeinten Objekts, die …
• kogni@v signifikant
• aber nicht mit Unterschieden des Bezeichneten verknüpn sind.
11
Sinnbegriff und Iden@tät
• „Sab=Scb“: derselbe Punkt kann durch die Eigenschan, Schnigpunkt der Geraden a und b zu sein herausgegriffen werden, aber auch durch die Eigenschan, Schnigpunkt der Geraden b und c zu sein. Er ist uns auf zweierlei Weise gegeben.
12
a b
Sab
b
cScb
a b
cSab=Sbc
Sinnbegriff und Iden@tät
• Kann der Sinnbegriff die Informa@vität der wissenschanlichen Erkenntnisse zu neuronalen Korrelaten des Bewusstseins damit vereinbaren, dass Iden@tät vorliegt?
• Einwand: Kann der Sinn nicht nur deshalb auf kogni@v signifikante Weise verschieden sein, weil auf verschiedene Eigenschanen Bezug genommen wird?
13
Sinnbegriff und Iden@tät
• Schnigpunkt der Geraden a und b zu sein, ist eine andere Eigenschan als Schnigpunkt der Geraden b und c zu sein.
• Das heißt, die Iden@tätsaussage ist nur deshalb informa@v, weil sie ein und demselben Punkt zwei verschiedene Eigenschanen zuschreibt!
14
Sinnbegriff und Iden@tät
• Gilt dies nicht auch für den Fall von Bewusstsein-‐Gehirn-‐Iden@tätsaussagen wie:„Bewusstsein = neuronale Ak@vität im Gamma-‐Bereich“?
• Auch bevor wir neuronale Korrelate des Bewusstseins gefunden haben, waren uns doch Bewusstseinsereignisse und -‐zustände ,gegeben‘!
15
Sinnbegriff und Iden@tät
• D.h. Bewusstseinsereignisse waren uns durch Bezug auf Bewusstseinseigenschanen gegeben.
• Also können wir bestenfalls einen Dualismus von Zuständen oder Ereignissen durch einen von Eigenschanen ersetzen (argumen@erten Verteidiger des Eigenschansdualismus wie z.B. Stevenson und Max Black)!
16
Sinnbegriff und Iden@tät
• Replik der Materialisten (z.B. Smart):Mentale Ereignisse werden durch ein ,gegenstandsneutrales‘ (topic-‐neutral) Vokabular herausgegriffen.
• Der Text von Smart bietet viel Anschauungsmaterial für einige angesprochene Tendenzen in der Leib/Seele-‐Debage, vor allem für die Tendenz zu denken, man müsse zwischen Dualismus und materialis@schem Monismus wählen!
17
Sensa@ons and Brain Processes
• Ausgangspunkt: der logische Behaviorismus, (den Smart tenta@v Wiggenstein zuschreibt):Der verbale Ausdruck von Schmerz mag zwar mehr tun als bloß Schmerzverhalten ersetzen; er mag etwas berichten, aber dies ist rein behavioris@sch zu verstehen (,agita@on condi@on’).
18
Sensa@ons and Brain Processes
• Smart argumen@ert gegen die Idee, dass Sätze wie „Ich habe Schmerzen“ genuine Berichte von irreduziblen psychischen Ereignissen sind.
• Dabei unterstellt er, dass Reduk@on nicht bloß „Erklärbarkeit durch die Physiologie/Physik“ oder ähnliches heißt, sondern Iden@fika@on impliziert!
• Warum?
19
Warum Iden@tätstheorie?
• Der Fortschrig der Wissenschanen führt immer mehr zu einem Verständnis von Organismen als physikalisch-‐chemischen En@täten:„There does seem to be, as far as science is concerned, nothing in the world but increasingly complex arrangements of physical cons@tuents. All except for one place: in consciousness!“ (S. 142)
20
Warum Iden@tätstheorie?
• (Dies ist genau die in der letzten VO beschriebene Grundannahme: die ontologische Reduk@on/Elimina@on/Iden@fika@on von Bäumen, Bergen, Farben, Geräuschen usw. ist schon beschlossene Sache – es bleibt nur, das Bewusstsein gleichermaßen zu behandeln – oder der Dualismus!)
21
Warum Iden@tätstheorie?
• Nicht bloß Korrela@on – korrelierte En@täten sind doch verschieden (,over and above’).
• Mit physikalischen Gegebenheiten bloß korrelierte Empfindungen wären „nomologische Anhängsel“ (nomological danglers).
• Es ist nicht glaubwürdig, dass fundamentale Naturgesetze Empfindungen mit Konfigura@onen von Neuronen verbinden!
22
Warum Iden@tätstheorie?
• „Such ul@mate laws would be like nothing so far known in science“ (S. 143)
• Smart hat sicher recht, dass es unplausibel ist, dass solche Korrela@onsgesetze fundamentale Naturgesetze sind, aber das ändert nichts daran, dass es sie geben muss (was soll sonst die ID-‐T stützen?) und dass man sie nicht unbedingt im Sinne der ID-‐T deuten muss!
23
Warum Iden@tätstheorie?
• Smart setzt einen ontologischen Fundamentalismus voraus:
• Für Smart müssen Empfindungen und die sie involvierenden Gesetze entweder fundamental, oder mit fundamentalen En@täten iden@sch sein.
• Deshalb meint er, aus der Unplausibilität des Bewusstseinsfundamentalismus die Rich@gkeit der ID-‐T ableiten zu können.
24
Welche Iden@tätstheorie?
• ID-‐T behauptet keine Übersetzbarkeit der Empfindungssprache in die physiologische und keine logische/begriffliche Äquivalenz (Analogie zum Verhältnis von Bürgern/Na@on)
• ID-‐T meint mehr als bloße zeitliche und räumliche Kon@nuität (wie etwa zwischen Bürgern und Na@on): strikte Iden@tät!
25
1. Einwand
• Wie können wir mit „Nachbildern“ Gehirnzustände meinen, wenn doch auch Menschen diese Ausdrücke verwenden können, die gar nichts vom Gehirn wissen?
• Replik: Wir können uns auch auf Blitze beziehen, ohne etwas von elektrischen Entladungen zu wissen, aber auch hier haben wir es nicht mit zwei Dingen zu tun: letztere sind die ,wahre Natur‘ von Blitzen!
26
1. Einwand
• Smart ist hier schon sehr nahe daran zu sagen, dass Empfindungen/Blitze in Wirklichkeit Gehirnzustände/elektrische Ladungen sind
→ Elimina@vismus
• Smarts typischer Gegner: der Dualist, der die Iden@fika@on für Blitze/Wasser usw. akzep@ert, aber für das Bewusstsein ablehnt.
• (Ich dagegen meine, dass sie in allen Fällen falsch ist!)
27
2. Einwand
• Die Verbindung zwischen Empfindungen und Gehirnzuständen ist kon@ngent und deshalb berichten wir keinen Gehirnzustand, wenn wir eine Empfindung berichten!
• Replik: Dies zeigt wieder nur, dass keine Bedeutungsäquivalenz vorliegt und beruht auf einer unzureichenden „Fido“-‐Fido Theorie der Bedeutung. Die Ausdrücke haben verschiedene Bedeutung und beziehen sich dennoch auf de facto Iden@sches!
28
Bedeutungswahrheiten vs. Tatsachenwahrheiten
• A priori
• Analy@sch
• Nicht empirisch
• Notwendig
• Begriffsanalyse
29
• A posteriori
• Synthe@sch
• Empirisch
• Kon@ngent
• Empirische Wissenschan
3. Einwand
• Dies ist der Max Black-‐Einwand:
• Ist die ID-‐T nicht doch auf irreduzibel verschiedene Eigenschanen festgelegt, migels derer dieselbe En@tät verschieden herausgegriffen wird?
• Replik 1: Sekundäre Eigenschanen bestehen in der Disposi@on, im Betrachter bes@mmte Empfindungen zu verursachen.
30
3. Einwand
• Replik 2: Dass ich ein Nachbild sehe (habe), heißt soviel wie: „Es geht etwas vor, das so ist, wie das, das vorgeht, wenn ich meine Augen au|abe, wach bin… d.h. wenn ich wirklich eine Orange sehe.“ (S. 149)
• Die kursivierten Ausdrücke sind „quasi-‐logisch“ oder „gegenstandsneutral“ wie auch ein Ausdruck wie „jemand“ und deshalb kann der Bericht des Bauern zwischen dualis@scher und materialis@scher Metaphysik neutral sein!
31
3. Einwand
• Ist es aber plausibel, dass „Empfindung“ oder „Nachbild“ quasi-‐logische Ausdrücke sind?
• Es ist plausibel, dass die Sprache des Bauern zwischen Materialismus und Dualismus neutral ist, aber nicht, dass sie zwischen Bewusstsein und Gehirnzuständen neutral ist!
• Grundproblem: Smart meint, dass die bloße Unterscheidung zwischen B und Gehirnzuständen uns schon auf eine dualis@sche Metaphysik festlegt!
32
Von Smart zum Funk@onalismus
• Smarts Vorschlag, ein Nachbild zu sehen (haben), heiße soviel wie: „Es geht etwas vor, das so ist, wie das, das vorgeht, wenn …“ war eine Inspira@on für die bis heute einflussreiche funk@onalis@sche Analyse des mentalis@schen Vokabulars.
• Smart ersetzte hier mentalis@sche Ausdrücke durch Be-‐ oder Umschreibungen; der Funk@onalist will generell diese Ausdrücke durch Beschreibungen der kausalen Rollen von mentalen Zuständen ersetzen.
33
Der Funk@onalismus
• Der Funk@onalismus versteht mentale Zustände über ihre kausale Rolle bei der Vermiglung zwischen ,Inputs‘ und ,Outputs’.
• Mentale Ausdrücke sind Beschreibungen solcher kausalen Rollen äquivalent.
• Bsp.: „Ich habe Schmerzen“ bedeutet soviel wie „Ich bin in einem Zustand, der von bes@mmten S@muli verursacht wird, und der zu bes@mmtem Verhalten führt“ (Dies nur ein schema@scher Platzhalter für eine tatsächliche Analyse.)
34
Der Funk@onalismus
• Soweit ist der Funk@onalismus a priori: es handelt sich um eine Bedeutungsanalyse des mentalis@schen Vokabulars.
• Empirisch kann man dann aber herausfinden, wer der Träger (Realisierer) der kausalen Rollen ist: Gehirnzustände, aber vielleicht auch z.B. Maschinenzustände (Computerfunk@onalismus; mul@ple Realisierbarkeit).
35
Probleme des Funk@onalismus
• Viele werden das Gefühl haben, dass „Schmerz“ nicht bloß soviel bedeutet wie:„Es gibt da etwas – was immer es auch sei – das eine bes@mmte kausale Rolle einnimmt“.
• Sie werden meinen, dass wir eine substanziellere Vorstellung vom Träger der Rolle haben und dieser Träger ein Bewusstseinszustand ist und kein Gehirnzustand!
36
Wo stehen wir?
• Die Iden@tätstheorie war angetreten, eine empirisch begründete Alterna@ve zu der behavioris@schen begrifflichen Reduk@on mentaler Zustände zu liefern.
• In Reak@on auf den Max Black-‐Einwand (Nr. 3) sieht Smart sich aber gezwungen, selbst eine begriffliche Analyse unseres mentalis@schen Vokabulars vorzuschlagen!
37
Wo stehen wir?
• Diese Analyse ist aber entweder:
• witzlos, wenn Bewusstseinszustände Träger der Rollen sein sollen,
• oder genauso elimina@vis@sch wie der Behaviorismus!
• Die Iden@tätstheorie kippt also letztlich doch in den Elimina@vismus ab!
• Aber können wir das Problem der mentalen Verursachung ohne die Iden@tätstheorie lösen?
38