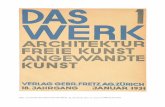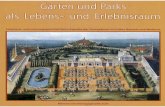”Macht der Banken". Analytisches Konzept oder politischer Topos?
Verwaltung politischer Devianz
-
Upload
uni-leipzig -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of Verwaltung politischer Devianz
Verwaltung politischer Devianz 191
Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij Verwaltung politischer Devianz Das Problem des Wissens Verwaltung politischer Devianz
Die AutorInnen untersuchen »Rechtsextremismus« als soziales Phänomen, das diskursiv hergestellt wird. In einer Fallanalyse rekonstruieren sie, wie Medien, Politik und zivilgesellschaftliche Initiativen die »Hetzjagd von Mügeln« im Sommer 2007 ausgedeutet haben, wie Vermutungen zu Gewissheiten wurden und wie schließlich der Rechtsextremismus als Erklärungsnarrativ hegemonial, weil politisch anschlussfähig, wurde. In solchen Fällen werden Wissensbestände über die Rechtsextremen als »die Anderen« (re)produziert, die möglicherweise staat-liche Interventionsprogramme, aus denen zivilgesellschaftliche Initiativen geför-dert werden, auf spezifische Weise präformieren.
Die Spaltung des Politischen Die öffentliche Verwaltung (im weiteren Sinne) westeuropäischer Staaten hat nicht nur den Auftrag, fremdenfeindliche Übergriffe zu ahnden, sondern sieht es als ihre Aufgabe an, die Bildung von Gruppen zu verhindern, deren Ziele frem-denfeindliche Übergriffe mit einschließen. Da Meinungsbildungsprozesse Er-wachsener in Demokratien administrativ nicht systematisch beeinflusst werden können – es ist schlichtweg nicht Teil des Staatsauftrags, Erwachsene zu erzie-hen –, bleiben Schulen als primärer Interventionsort für die Toleranzerziehung. Und damit sind Schulen auch eine wesentliche Instanz, um »verfassungsfeindli-che« Gruppenbildungen zu unterbinden. In einem Forschungsprojekt haben wir solche Interventionen komparativ in Schweden, in der Bundesrepublik und – allerdings eher kursorisch – in Ungarn untersucht. In allen drei Staaten gibt es ähnliche Definitionen von politischem Extremismus, aber der Eingriff in die politischen Meinungsbildungsprozesse wird jeweils unterschiedlich legitimiert.
192 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
Wir wollen zunächst kurz skizzieren, wie sich Staatsverständnisse und In-terventionen in extremistische Ordnungen gegenseitig bedingen.1 Dann werden wir den größeren Rahmen unserer Untersuchung umreißen, um schließlich an einem Fallbeispiel zu rekonstruieren, welche kategorialen Bestimmungen des/der Anderen, welche Wissensbestände über Phänomene extremistischer Gewalt politischen Interventions- und damit Ordnungsbemühungen zugrunde liegen können.
Mit Chantal Mouffe (1994: 109) lässt sich argumentieren, dass Ordnungen als »extremistisch« erscheinen, wenn sie sich jenseits der Regeln der Politik zu etablieren suchen. Denn die Politik sei ein organisierter Versuch, das Politische zu bändigen. Das Politische sei, argumentiert sie mit Carl Schmitt, überall aufzu-finden, wo es Antagonismen solcher Art gibt, dass Menschen sich in Gruppen wiederfinden, die durch ein Freund-Feind Schema geprägt sind: »Every religi-ous, moral, economic, ethical or other antithesis transforms into a political one if it is sufficiently strong to group human beings effectively according to friend and enemy« (Carl Schmitt, zitiert in Mouffe 1994: 107). Nun zeichnen sich Demo-kratien dadurch aus, dass sie die Antagonismen des Politischen in politische Prozesse oder – wie es bei Mouffe heißt – Agonismen aufzulösen versuchen. Das wird aber nur funktionieren, wenn sich die Politik auf die antagonistischen Pro-zesse des Politischen einlässt, weil nur dann sich die Bürger in ihren divergie-renden Haltungen aufgehoben fühlen. In jenen Demokratien, die sich seit 1989 nicht mehr in Rechts-Links-Parteien organisieren, habe es laut Mouffe einen bemerkenswerten Zuwachs an rechtsextremistischen Parteien gegeben – und zwar genau deswegen, weil es keine andere für die Bürger klar sichtbare Opposi-tion gebe: Wer sich »vom System« benachteiligt fühlt oder aus anderen Gründen eine fundamentaloppositionelle Haltung einnehmen möchte, werde keine Partei-en innerhalb des demokratischen Spektrums finden, argumentiert sie, und greife deshalb nolens volens auf die rechtsextremen Organisationen zurück. Diese Par-teien und Gruppierungen spielten aber nicht unbedingt nach den Regeln der (demokratischen) Politik und müssten deswegen dort nicht toleriert werden. Im Politischen aber würden Extremisten immer anzutreffen sein, denn feindliche Opposition mache diesen Bereich ja aus.
Nun versucht also die Politik (im Mouffe’schen Sinn), das Politische in Be-zug auf dieses Feindschema einzudämmen, indem sie beispielsweise erziehungs-
1 Zum Verständnis: Unser Interesse richtet sich nicht auf (Rechts-)Extremismus als politisches oder soziales Phänomen, d.h. wir machen keine Aussagen darüber, was »rechtsextremes Gedankengut« oder was eine »extremistische Ordnung« ist. Im Fokus unserer Forschungen stehen die Logiken der Wahrnehmung des »Rechtsextremismus« durch staatliche, halbstaatliche, private oder zivilgesell-schaftliche Akteure. Wir sind, mit anderen Worten, keine Rechtsextremismus-Experten.
Verwaltung politischer Devianz 193
beauftragte Institutionen ermächtigt, gemeinsam mit zivilgesellschaftlichen Akt-euren über rechtsextremistische Musik und entsprechende jugendliche Subkultu-ren als »Einstiegsdrogen« aufzuklären, sowie vor ganz bestimmten Personen als »Verführer der Jugend« zu warnen (um nur zwei Inhalte solcher Schulungen herauszugreifen). Das Ziel ist es, im Politischen zu intervenieren und rechtsext-remistische Gruppenbildungen zu verhindern. Das ist, für sich genommen, nicht weiter problematisch. Schaut man sich aber die konkreten Praktiken, die wir untersucht haben, an, besteht der Verdacht, dass sie geeignet sind, neue Antago-nismen zu produzieren, und zwar selbst dort, wo möglicherweise nicht einmal Agonismen vorliegen, sondern nur Annahmen über »junge Männer« in »Ost-deutschland« oder ähnliches. Oder sie proliferieren bestimmte Antagonismen, indem sie beispielsweise latent antagonistische Einstellungen (Rassismus) zu »Extremismen« stilisieren.
Das Politische im Mouffe’schen Sinn wird dann durch institutionelle und mediale Diskurse gespalten: in die internen Anderen (»ostdeutsche Rechtsextre-me«) und die externen Anderen (»Ausländer«). Wenn diese Anderen als feind-schaftliche Gruppen betrachtet werden, wird dadurch nicht nur ein »Wir« produ-ziert, das sie von vornherein ausschließt, sondern ihnen bleibt nichts anders üb-rig, als das Freund-Feind-Schema zu übernehmen – und damit, unter Umständen, eine rechtsextreme Disposition erst zu entwickeln.
Programmsteuerung Dieser Studie liegt ein kooperatives Forschungsprojekt zugrunde, das Teams am Institut für Politikwissenschaft der Universität Leipzig und am IMER der Uni-versität Malmö in Zusammenarbeit mit dem Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V. (ADB) durchgeführt haben. Ausgangspunkt war, staatliche Interventions-praktiken im Osten der Bundesrepublik und in Süd-Schweden komparativ zu untersuchen, die das Ziel haben, rechtsextreme, fremdenfeindliche und antide-mokratische Einstellungen einzudämmen beziehungsweise zu stoppen.
Dabei orientierten wir uns methodologisch an der Grounded Theory: Wir gingen also nicht davon aus, dass die üblichen objektivierbaren sozialen oder psychologischen Determinanten für Rechtsextremismus plausibel, noch dass sie mit Modernisierungs- und Ansteckungsmetaphern erklärbar sein müssen (vgl. etwa Rydgren 2005: 421-437). Es gibt mindestens zwei Sets an Hypothesen über objektive Gründe für Einzelne, rechtsextrem zu werden: Erstens gehen viele Erklärungen davon aus, dass Rechtsextremismus eine Reaktion auf Deprivati-onserfahrungen sei – dass Einzelne also auf ökonomische, soziale oder psycho-logische Entbehrungen reagieren, indem sie eine Ursache für diese Übel suchen,
194 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
und diese unter »Ausländern«, »Asylanten« oder »Einwanderern« zu finden meinen. So erklärte z.B. Heitmeyer schon früh, dass zunehmende Arbeitslosig-keit zu einer steigenden Zahl an Rechtsextremen führe (Heitmeyer 1992: 232-241). Daraus folgt die Annahme: Je stärker die Deprivationserfahrung, desto vehementer die rechtsextreme Einstellung und Handlung. Aber »objective and subjective grievances are a necessary but insufficient single condition for ex-treme-right emergence« (Koopmans et al. 2005). Andere Erklärungen gehen davon aus, dass Rechtsextremismus eine Reaktion auf gegebene politische Kons-tellationen sei, weil etwa keine systemkritische Opposition in den gemäßigteren Parteien zu finden ist (z.B. Tilly 1978, Koopmans et al 2005, Mouffe 2005). Dies ist auch als die »Rattenfänger-Hypothese« bekannt.
Eine unserer grundlegenden Annahmen war, dass soziale Räume bestimmte Einstellungen möglich machen und befördern. Wenn also untersucht werden soll, wie es dazu kommt, dass bestimmte Räume mit gewissen Denkweisen korrelie-ren, gilt es, die Interaktionen zwischen Jugendlichen und ihrem Umfeld zu unter-suchen. Soziale Räume für Jugendliche werden von drei wesentlichen Faktoren bestimmt: (1) Ihr eigenes soziales Umfeld, das aus der Peer Group (Mitschülern, den Kumpels an der Bushaltestelle, Feuerwehr- und Fußballvereinsmitgliedern, Eltern, Nachbarn, Geschwistern, Freundinnen usw.) besteht; (2) institutionelle Diskurse (Jugendliche werden auf Vertreter dieser Diskurse in Schule, Polizei, Ordnungsamt, Gerichten, Sozialbehörden etc. treffen); und (3) öffentliche Dis-kurse, welche insbesondere durch Medien (Fernsehen, Radio, Internet, Massen-SMS, Musik-CDs etc.) verbreitet und proliferiert werden.
In Deutschland werden Interventionen gegen mutmaßlich rechtsextremis-tisch motivierte Jugendgewalt sowie demokratiefeindliche Einstellungen wei-testgehend im zivilgesellschaftlichen Sektor organisiert und von (Quasi-)Nicht-Regierungsorganisationen durchgeführt. Das Vorgehen gegen »ordnungsgefähr-dende Tendenzen« wird über staatliche Programme finanziert und von unter-schiedlichen Bildungsträgern, Organisationen und Vereinen praktisch umgesetzt. Diese Organisationen vermitteln hier die beabsichtigte Einflussnahme des Staa-tes auf die Jugendlichen. Meist gehen sogenannte Teamer und Teamerinnen (auch: Trainer/Trainerinnen) in Schulen, wo sie im Rahmen von Projekttagen ein- bis zweitägige Schulungen anbieten. Die Konzepte sind sehr unterschiedlich und können beispielsweise frontale Aufklärung, Geschichtsunterricht, Rollen- und Positionierungsspiele kombinieren.
Diese Schulungen sind allerdings – soweit wir sie beobachtet haben – häu-fig durch den Widerstand der so Beschulten geprägt: Letztere unterlaufen recht effektiv die Bemühungen der Trainerinnen und Trainer, ihnen die »richtigen« politischen, moralischen, anthropologischen und epistemologischen Einstellun-gen beizubringen. Dies liegt zum einen daran, wie Pates in diesem Band zeigt,
Verwaltung politischer Devianz 195
dass es immer auch um grundlegende Auseinandersetzungen um unterschiedli-che Moralvorstellungen der Teilnehmenden und ihres Umfelds geht. Dies provo-ziert die an den Schulungen teilnehmenden Jugendlichen oft dazu, sich über herabwürdigende Aspekte der Workshops zu äußern und im Folgenden die Sit-zungen zu sabotieren.
Andererseits liegt unseres Erachtens das Problem dieser Interaktionen nicht zuletzt daran, dass das punktuelle, durch Wissensvermittlung dominierte Treiben der Trainerinnen und Trainer erstens nicht die sozialen Räume der Teilnehme-rinnen und Teilnehmer beeinflussen kann; und zweitens, dass sie diese sozialen Räume gar nicht verstehen, sich also immer wieder durch Äußerungen der per-sönlichen Brüskierung durch die Teilnehmenden überrascht fühlen.
Weshalb aber wird staatlicherseits auf diese Weise der befristeten Pro-grammsteuerung interveniert, Demokratieerziehung quasi als Projekt betrieben?2 Dazu gäbe es mehrere Hypothesen: 1) Zunächst entspringt diese Art der Regulie-rung der Logik des New Public Management (NPM), also einer Auslagerung staatlicher Aufgaben an private oder zivilgesellschaftliche Akteure unter Siche-rung des Rücknahmevorbehalts. 2) Vielleicht sind die vorhandenen Ressourcen im Bildungsbereich tatsächlich nicht hinreichend, um im Rahmen der grundstän-digen staatlichen Schulerziehung solche Aufgaben mit abzudecken: Staatsbür-gerliche Erziehung fristet in den meisten Bundesländern ein Schattendasein – sowohl in Bezug auf die Stundenzahl als auch auf die Schuljahre; Pädagogen sind unzureichend darauf vorbereitet oder unmotiviert usw. 3) Was der Rationa-lität des NPM widerspricht, aber politisch wieder Sinn ergibt: Die Erfolge oder Misserfolge solcher Projekte sind schwer oder nicht messbar. Man kann schlicht nicht feststellen, ob das ganze Geld gut investiert ist oder nicht, weil man noch nicht einmal weiß, was ein positiver Effekt wäre. Weniger Gewalttaten gegen Migranten, geringere Wahlerfolge rechter Parteien, weniger antisemitische Statements bei Umfragen? 4) Tatsächlich haben diese Programme – auf der bun-des- und landespolitischen Ebene eine Alibi- und eine Selbstvergewisserungs-funktion. Während Jugendgewalt, Körperverletzung und Totschlag strafrechtlich zu ahnden sind, erscheint »Rechtsextremismus« als ein politisch-administrativ zu
2 Das erste Aktionsprogramm »Jugend für Toleranz und Demokratie - gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus« wurde 2001 aufgelegt und bestand aus drei Teilen: »XENOS – Leben und Arbeiten in Vielfalt«, »ENTIMON – Gemeinsam gegen Gewalt und Rechts-extremismus« und »CIVITAS – initiativ gegen Rechtsextremismus in den neuen Bundesländern«. Nach der ersten Förderperiode wurden nicht alle Bestandteile in der bis dahin bestehenden Förder-form weitergeführt. Im Jahr 2007 startete das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ein neues Programm: »Vielfalt tut gut – Jugend für Vielfalt, Toleranz und Demokratie«.
196 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
lösendes Problem. Diese Programme dienen auch der Selbstvergewisserung der demokratischen Eliten: Man tut doch etwas im Kampf gegen Rechts!3
Das aber, was die »rechtsextreme Gefahr« (für die politische und die Rechtsordnung) ausmacht und wie man sie erkennt, das wird diskursiv ausge-handelt. Wie dabei das Wissen um diese »Gefahr« strukturiert wird, das wollen wir im Folgenden an unserem Fallbeispiel näher zeigen.
Eventualismus, Verräumlichung, Moral Panics – Ein Fallbeispiel
Frage: »Sind die Ereignisse von Mügeln ostdeutsche Normalität?«
Antwort: »Natürlich. Das gilt für Sachsen, für Sachsen-Anhalt. Man muss sich nur die Statistiken ansehen. Solche Übergriffe werden immer häufiger. Insofern ist es Normalität. Wir haben derzeit das zweifelhafte Glück, dass es wieder einen medien-relevanten Fall gibt.«
»Hilft das in der Arbeit gegen Rechtsextremismus, wenn diesen Dingen ein größeres Interesse der Medien zuteil wird?«
»Es hilft enorm, vor allem den Leuten vor Ort. Wir haben dann mehr Aufmerksam-keit, mehr Sensibilität, die Initiativen kriegen häufig einen ziemlichen Auftrieb, manchmal auch Hilfe von staatlicher Seite.«
In diesem Interviewfragment überschneiden sich eine Reihe von Aspekten, die das ambivalente Verhältnis von Medienöffentlichkeiten, zivilgesellschaftlichem Engagement gegen rechtsextrem motivierte Gewalt, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus sowie dem staatlichen und politischen Reagieren auf einzelne »Vorfälle« oder Ereignisse betreffen. Die Befragte, Anetta Kahane, arbeitet als Journalistin und ist, als Vorstandsvorsitzende der Amadeu-Antonio-Stiftung, eine der prominentesten und profiliertesten Personen auf dem Feld der zivilge-sellschaftlichen Organisationen. Das Interview erschien drei Tage nach der von einigen Medien so genannten »Hetzjagd von Mügeln« (taz.de 2007a).
3 Und neuerdings auch gegen Linksextremismus sowie islamistischen Extremismus. Mitte 2010 hat die Bundesregierung ein zusätzliches Programm mit dem Titel »Demokratie stärken« initiiert, aus dem Projekte gefördert werden sollten, die sich gegen linksextremistische und islamistische Tenden-zen engagieren. Nach dem Auslaufen von »Vielfalt tut gut« sind seit Anfang 2011 alle Fördermög-lichkeiten des Bundes unter dem Dach »Toleranz fördern – Kompetenz stärken« gebündelt. (www.toleranz-foerdern-kompetenz-staerken.de)
Verwaltung politischer Devianz 197
Kahane verweist erstens auf eine spezifisch ostdeutsche (oder sächsisch-sachsen-anhaltische) »Normalität«; Übergriffe gegen Ausländer seien »normal« geworden in dem Sinne, dass sie häufig und regelmäßig vorfallen würden. Das aber könne man inzwischen nur aus Statistiken ablesen. Implizit ist damit ge-meint, dass nicht jeder Fall öffentliche Aufmerksamkeit bekomme. Andererseits gebe es zweitens mit »Mügeln« wieder mal einen »medienrelevanten Fall«, das heißt gelegentlich werde das Alltägliche, das Normale in der Medienöffentlich-keit zum Besonderen, Außeralltäglichen. Kahanes »Wir« meint eben jene zivil-gesellschaftlichen Organisationen oder allgemein jene Menschen, die sich aktiv gegen rechte Gewalt einsetzen. Diese Initiativen, das ist der dritte Aspekt, leben von dieser Aufmerksamkeit, denn dadurch können sie nicht nur ihre Anliegen und Problematisierungen lancieren, sondern auch – eventuell – auf staatliche Unterstützung hoffen: Geld, das unerlässlich ist, um die Medien-, Bildungs-, Aufklärungsarbeit und Opferhilfe der zumeist als Eingetragene Vereine instituti-onalisierten Gruppen zu betreiben. Paradoxer- oder vielleicht auch konsequen-terweise ist die Bekämpfung xenophober Einstellungen und rechtsextrem moti-vierter Gewalt davon abhängig, dass gelegentlich aufsehenerregende Gewalttaten verübt werden – oder einzelne komplexe Ereignisse zu solchen erklärt und in einer medialen Inszenierung aufbereitet werden. Auf diese Weise erscheint Rechtsextremismus als ein Phänomen, das die gesellschaftliche Ordnung und Sicherheit bedroht und also politisches Handeln erforderlich zu machen scheint. »Rechtsextremismus« ist in unserer Perspektive also eine spezifische diskursive Formation, ein politisch-öffentliches Wahrnehmungsmuster, das staatliche Inter-ventionslogiken präformiert.
Das Problem, das eben mit den Stichworten Fremdenfeindlichkeit, Rassis-mus, Antisemitismus, Verklärung oder Verherrlichung des Nationalsozialismus, Gewalt bis zum Mord gegen Menschen, die als Angehörige einer irgendwie unerwünschten Gruppe klassifiziert werden, umrissen werden kann – dieses Problem oder vielmehr dieses Bündel an konsistenten gesellschaftlichen Phäno-menen wird öffentlich-politisch in der Regel eventualistisch (das meint: die Perzeption beschränkt sich auf singuläre, dramatische Ereignisse4) wahrgenom-men, und die Problemlösung wird an eine staatlich alimentierte »Zivilgesell-schaft« ausgelagert.
Wir vermuten, dass die Bedingungen für dieses Outsourcing nicht unwe-sentlich von der Struktur der eventualistischen Problemwahrnehmung gerahmt werden. Und es erscheint uns nicht ganz unplausibel, dass sich diese öffentliche Problemwahrnehmung von jener der lokal organisierten Initiativen unterscheidet. Letztere müssen aber – da hat Kahane kein Hehl draus gemacht – die öffentli- 4 Von lat. eventum – Ereignis. Und nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Kunstrichtung.
198 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
chen Problematisierungen antizipieren und mitunter, als Expertinnen und Exper-ten in Interviews, proliferieren, um weiter »im Wahren« bleiben und das Spiel mitspielen zu können.
Der Fall Mügeln Der unseres Erachtens aufsehenerregendste Fall, also eines jener Ereignisse, die nach der Auffassung Anetta Kahanes »Normalität« sind, aber dennoch außerge-wöhnlich, weil sie eine prominente Beobachtung in den Medien erfahren, hat in den Tagen und Wochen ab dem 18. August 2007 in der sächsischen Kleinstadt Mügeln stattgefunden sowie eben in den Redaktionen wohl aller deutschen und einer Reihe von ausländischen Tages- und Wochenmedien.5 Nach der »Hetzjagd auf Inder« (sueddeutsche.de 2007a) wurde der 5000-Einwohner-Ort schlagartig in der gesamten Bundesrepublik bekannt, er wurde zu einem Symbol und Fanal nicht nur für exzessive Gewalt gegen Ausländer im deutschen Osten, sondern auch für den Mangel an Zivilcourage einer »schweigenden Mehrheit«.
Die Printausgabe der Leipziger Volkszeitung berichtete zwei Tage später: »Dutzende Jugendliche schlagen auf Inder ein 14 Verletzte beim Stadtfest in Mügeln / Bürgermeister geht von fremdenfeindlichem Hintergrund aus Mügeln. Schwerer Zwischenfall beim Altstadtfest in Mügeln (Kreis Torgau-Oschatz): In der Nacht zu gestern kam es auf dem Festgelände zu einer Auseinan-dersetzung zwischen einer Gruppe von rund 50 Deutschen und acht Indern. Die Po-lizei rückte mit einem Großaufgebot von 69 Einsatzkräften an. Bei den Auseinan-dersetzungen wurden 14 Personen verletzt, ein Inder schwer. Auch zwei Beamte der Bereitschaftspolizei erlitten Verletzungen. ›Ein fremdenfeindliches Motiv wird nicht ausgeschlossen‹, sagte der designierte sächsische Polizeipräsident Bernd Merbitz. ›Wir ermitteln aber in alle Richtungen.‹ […] Um 0.43 Uhr war ein Notruf bei der Polizei eingegangen. ›Uns wurde eine Schläge-rei gemeldet‹, so Polizeihauptkommissar Peter Kampnik. Was genau im und am Zelt auf dem Mügelner Rathausplatz passiert war und von wem die ersten Provokationen
5 Im Rahmen des Forschungsprojekts haben wir in den Jahren 2007 und 2008 724 Berichte, Pressein-terviews, Kommentare und Reportagen über einzelne Ereignisse rechter Gewalt, über politische Reaktionen, staatliche Programme, über Islamophobie, Zuwanderung, über rechte Parteien und die Diskussionen um Parteiverbote etc. gesammelt, erfasst und analysiert. Für das vorliegende Paper ha-ben wir uns exemplarisch auf ein Diskursereignis konzentriert und es einer Feinanalyse unterzogen.
Verwaltung politischer Devianz 199
ausgingen, schilderten Beobachter ganz unterschiedlich. Mehrere Augenzeugen be-richteten von einer anfänglichen Auseinandersetzung zwischen Deutschen und In-dern. Von einer Messerstecherei war die Rede. An einigen Stellen in der Mügelner Altstadt waren Blutspuren zu sehen. […] Auch Mügelns Bürgermeister Gotthard Deuse ging gestern von einer Straftat mit fremdenfeindlichem Hintergrund aus. Durch den Jugendclub habe es im Vorfeld des Festes eine Information gegeben, ›dass Rechte zum Altstadtfest etwas vorhaben. Und das ist nun tatsächlich eingetreten‹. Nach Informationen des Stadtchefs seien ausländerfeindliche Parolen zu hören gewesen. Das bestätigte auch ein Augenzeuge. ›Ausländer raus‹ und ›Hier regiert der nationale Widerstand‹ hätten einige der Betei-ligten gerufen« (LVZ 2007a).
Dieser Beitrag in der regionalen Tageszeitung gibt so ziemlich alle Kernfakten wieder, das heißt jene Erzählungen, die a) in den meisten Beiträgen über das Ereignis konsensual waren und b) zunächst einmal am plausibelsten erscheinen. Es muss also auf einem sommerlichen Stadtfest in Mügeln zu einer Schlägerei in einem Bierzelt gekommen sein, an der mehrere Menschen beteiligt gewesen sind, unter anderem acht Mügelner, die ursprünglich aus Indien stammen. Letzte-re flohen über den Marktplatz in eine Pizzeria, in der sie sich vor den Verfolgern – die Rede war von zwanzig bis fünfzig Männern – verbarrikadierten. Die Ver-folger versuchten, in das Lokal einzudringen, was zwei Polizisten weitestgehend verhindern konnten. Sie hielten aus, bis Verstärkung aus einem Nachbarort ein-traf. Währenddessen versuchten einige Jugendliche, über die Hintertür in das Lokal einzudringen, die sie mit einem Eisengitter zerstörten. (Einer von ihnen wurde nach umfangreichen Ermittlungen angeklagt und zu einer Haftstrafe von acht Monaten wegen Sachbeschädigung und Volksverhetzung verurteilt; vgl. Süddeutsche 2007). Am Ende gab es mehrere Verletzte auf allen Seiten – und ein gewaltiges Problem für die Stadt, ihre Einwohnerinnen und Einwohner, ein-schließlich ihres Bürgermeisters.
Akteure und Wahrheiten Wir wollen versuchen zu zeigen, wie die verschiedenen Akteure in dem nach diesem Vorfall eingetretenen Medienereignis präsentiert wurden oder wie sie sich selbst präsentierten und welche speziellen, mitunter widersprüchlichen Wahrheiten dabei produziert wurden. Dabei fokussieren wir: 1. Journalisten respektive Massenmedien selbst; 2. den Bürgermeister; 3. die Einwohnerinnen und Einwohner; 4. politische Akteure (jenseits des Bürgermeisters).
200 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
1. Journalisten/Massenmedien Es waren vermutlich drei Faktoren, die dazu beigetragen haben, »Mügeln« zu einem Thema werden zu lassen, das so außerordentlich intensiv und lange disku-tiert worden ist: 1. Nachrichtenarme Zeit: Im August gibt es überhaupt relativ wenige Nach-
richten, sodass jedes Ereignis besonders aufmerksam rezipiert und interpre-tiert wird.
2. Kognitive Resonanz: Der Fall bestätigte bestimmte Erwartungen und Voran-nahmen a) über Kleinstädte in ländlichen Gegenden Ostdeutschlands mit b) einem massiven Problem mit rechtsextrem eingestellten, gewaltbereiten Ju-gendlichen sowie c) einer latent oder manifest rassistischen oder wenigstens indifferenten Einwohnerschaft (die die »Hetzjagd« eben nicht verhindert hat).
3. Visualisierung: Anders als in vielen anderen Fällen gab es Fotos und Film-aufnahmen der Opfer, also jener Menschen, die sich in der Pizzeria ver-schanzt hatten; insbesondere ein gewisser Herr Singh wurde mit brutalen Wunden und Hämatomen im Gesicht der Medienöffentlichkeit präsentiert.
Unmittelbar in den ersten Tagen danach produzierten verschiedene Zeitungen, Zeitschriften und ihre Online-Ableger äußerst starke Schlagzeilen, die in ihrer Wortwahl die vom Bürgermeister geäußerte Hypothese vom rechtsradikalen Überfall auf das Stadtfest aufnahmen und zuspitzten:
»Hetzjagd auf Inder: ›Hier gibt es keine Rechtsextremen‹« (Faz.net 2007a).
»Eskalation auf Dorffest: Rasender Mob jagt Inder – Mügeln unter Schock
Brutales Ende eines Dorffestes: Unter Nazi-Parolen soll ein rasender Mob am Wo-chenende acht Inder durch das sächsische Mügeln gehetzt haben – ein gezielter Überfall von Rechtsradikalen? Klar ist bisher nur: Eine Rempelei auf der Tanzfläche artete zu einer Gewaltorgie aus« (SPIEGEL-ONLINE 2007a).
»Reflexe nach der Hetzjagd von Mügeln: An der Schwelle zum Progrom« (taz.de 2007b).
Viele dieser Formulierungen haben wertenden Charakter und lassen wenig Raum für Alternativen zur Schilderung, Einordnung und Erklärung des Vorgefallenen. Die Hypothese vom »Mob« oder vom »Nazi-Überfall« präformierte die Interpre-tationen aller weiteren Aussagen und Stellungnahmen: Eine Polizei, die nicht in
Verwaltung politischer Devianz 201
diese Richtung ermittelte, wäre dann ›auf dem rechten Auge blind‹, ein Bürger-meister, der zu relativieren versuchte, würde ›verharmlosen‹, und Bürgerinnen der Stadt, die sich Interviews mit dutzendweise angereisten Journalisten verwei-gerten, bildeten die ›schweigende Mehrheit‹, die bei solchen Exzessen wegsehe.
Bei der Analyse der Berichte fällt auf, dass einige Redaktionen – hier SPIEGEL-ONLINE und taz.de – sehr schnell, sehr vehement und sehr moralisie-rend die These vom rechtsextremen Überfall und vom rassistischen Mob stark gemacht und eifrig nach Belegen für ihre Bestätigung gesucht haben. Andere überregionale Zeitungen beziehungsweise ihre Onlineportale – etwa die Frank-furter Allgemeine, FAZ.net und sueddeutsche.de – haben immer wieder auch die Rolle der Medien reflektiert und an frühere Fälle erinnert, in denen unisono gan-ze Gemeinden zu Unrecht (wie sich später herausstellen sollte) verurteilt worden waren und die deshalb als Fanale des deutschen Journalismus’ gelten: »Von einer Hetzjagd auf Inder, von ausländerfeindlichen Parolen und einem applaudie-renden Mob ist da die Rede. Was wirklich vorgefallen ist, soll eine Sonderkom-mission der Polizei klären. […] Wie schnell der Ruf einer ganzen Gemeinde durch ungeprüfte Meldungen in Misskredit gebracht werden kann, davon kann eine andere sächsische Stadt ein Lied singen: Sebnitz« (FAZ 2007a).6
Regionale sächsische Zeitungen haben dagegen differenziert verschiedene Erklärungsversuche diskutiert und sich nicht auf ein einzelnes Deutungsmuster zu Mügeln festgelegt.7
Die selektive Funktionsweise der Medien wird übrigens durch den Umstand belegt, dass nach dem Mügeln-Wochenende in den meisten Zeitungen eine ganz andere Begebenheit, die doch große Parallelen aufwies, nur beiläufig gemeldet wurde: Im rheinland-pfälzischen Guntersblum wurden am selben Tag ebenfalls bei einem Stadtfest »zwei Afrikaner« »überfallen«. Anders als in Mügeln konnte die Polizei sehr schnell zwei mutmaßliche Täter festnehmen, die bereits zuvor als rechtsextrem bekannt gewesen waren. (Sächsische Zeitung 2007a, SPIEGEL-ONLINE 2007e) Dieser Vorfall war die Zeitungen jedoch nur eine kurze Mel-dung wert. Man hat öffentlich nie wieder davon gehört. 6 In Sebnitz, einer Kleinstadt in der Sächsischen Schweiz, war 1997 ein Junge in einem Freibad ertrunken. Die Eltern erhoben Ende 2000 öffentlich den Vorwurf, eine Gruppe von Jugendlichen habe ihren Sohn aus rassistischen Motiven ertränkt, und die anderen Badegäste hätten nicht einge-griffen. Diese Hypothese wurde von den meisten deutschen Medien so übernommen, dass sie als Tatsache galt. Bis der gewaltsame Tod des Jungen durch die Obduktion seines Leichnams ausge-schlossen werden konnte. 7 Diese qualitative Differenzierung der Presseberichte haben wir nicht – etwa durch eine Auszählung – überprüft. Es wäre durchaus möglich, dass wir aus der großen Zahl der Beiträge unintendiert selek-tiv ausgewählt und archiviert haben. Allerdings liegen uns Artikel von allen der oben angegebenen Medien aus den ersten drei bis vier Tagen nach den Ereignissen vor; und allein darauf bezieht sich diese Qualifizierung.
202 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
2. Der Bürgermeister Journalisten, die idealerweise versucht haben, a) herauszufinden, ›was wirklich passiert ist‹, b) diesen Gewaltausbruch zu erklären und c) die Ereignisse in den größeren Zusammenhang eines generellen gesellschaftlichen Problems einzu-ordnen, trafen dabei zuerst auf den Mügelner Bürgermeister Gotthard Deuse, der bis dato wohl noch keine Erfahrungen mit einer kritisch nachfragenden Presse gemacht hatte. Nachdem er zunächst offenbar selbst – wie in dem LVZ-Artikel oben gezeigt – erklärt hatte, dass es im Vorfeld Ankündigungen von »Rechten« gegeben habe und dass, während die »Inder« in die Pizzeria flüchteten, »auslän-derfeindliche Parolen zu hören gewesen« seien, muss er sehr bald bemerkt ha-ben, dass es in den Berichten und Reportagen nicht nur um eine Schlägerei zwi-schen irgendwelchen Leuten ging, sondern dass die Gemeinde Mügeln insgesamt dabei war, zum Synonym für ostdeutsche rechtsextreme Gewalt zu werden. Also versuchte er, seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen, indem er zwei neue Hypothesen in Anschlag brachte. Die erste macht eine interessante Unterschei-dung auf zwischen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit; die zweite interpretiert die Ereignisse als Schicksal. In den Worten des SPIEGEL-ONLINE-Korrespondenten:
»Deuse hat Angst um den Ruf seines Städtchens. Heftig schüttelt er den Kopf und versucht sich mit einer Erklärung des Gewaltexzesses: ›Ganz, ganz, ganz schwierig‹ sei das alles. ›Möglicherweise war es Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus war es nicht.‹ Der Bürgermeister will da einen feinen Unterschied machen. Die ›Ausländer raus‹-Rufe sind nach etlichen Zeugenaussagen nun einmal nicht von der Hand zu weisen. Aber rechtsextreme Strukturen, eine Szene, die gibt es hier nicht, da ist sich Deuse noch immer sicher« (SPIEGEL-ONLINE 2007b).
Ähnlich äußerte er sich in der Leipziger Volkszeitung:
»Mügelns Bürgermeister Gotthard Deuse (FDP) dagegen bleibt trotz massiver Kritik an seinen Äußerungen dabei, dass es keine rechtsextreme Szene gibt – ›weil keine organisierten rechten Strukturen existieren‹. Allerdings, so schiebt er im Gespräch mit dieser Zeitung nach: ›Wenn Sie mich fragen, ob es hier Rechte gibt, ist das et-was anderes. Aber die gibt es überall. Das ist kein Thema der Stadt Mügeln‹« (LVZ 2007b).
Demnach käme also sogenannte Ausländerfeindlichkeit spontan zum Ausdruck, eben in der Bierzeltschlägerei, die von fremdenfeindlichen Rufen begleitet wird, sofern Personen fremder Herkunft involviert sind. Rechtsextremisten dagegen seien organisiert und verübten ihre Taten planvoll. Diese Distinktion wird bei
Verwaltung politischer Devianz 203
genauer Untersuchung nicht aufrecht zu halten sein, weder von der einen, noch von der anderen Seite her.8 Immerhin aber konnte das Stadtoberhaupt die Dis-kussion damit für kurze Zeit auf die Frage lenken, ob und wie diese beiden Phä-nomene zu unterscheiden seien.9 Die Ermittlungen der Polizei schienen sich denn auch zunächst darauf zu konzentrieren, ob es sich um eine gezielte »organi-sierte rechtsextremistische Aktion« gehandelt habe. Nach zehn Tagen konnte Entwarnung gegeben werden (LVZ 2007c).
In einer zweiten Strategie interpretierte der Bürgermeister das Ganze als Schicksal. »Bürgermeister Deuse wiegelt ab«, stellte die tageszeitung fest und zitierte ihn mit den Worten: »Es kann auf jedem Volksfest mal so etwas geben, und Mügeln hat es eben mal getroffen.« In dem Beitrag wird er noch vom Poli-zeisprecher sekundiert: »Der Alkohol hat um diese Zeit eine Rolle gespielt – und außerdem war plötzlich mal was los« (taz.de 2007c). All diese Erklärungsmuster – fremdenfeindliche Gewalt als entweder etwas Normales, das überall vorkom-me, oder etwas Außerordentliches, das gleichsam wie ein Blitz jeden treffen könne, wenn auch nur selten – wurden letztlich nicht im Sinne des von Pressean-fragen überforderten Lokalpolitikers interpretiert, sondern in den Kontext von »Verharmlosung« und »Abwiegeln« gestellt.
Mit zwei weiteren Äußerungen gelang es Deuse, diese Deutungen zu un-termauern und zu einer Gewissheit werden zu lassen. Einmal sagte er, als er in einem Interview der Financial Times Deutschland auf die »Ausländer raus«-Rufe angesprochen wurde: »Solche Parolen können jedem mal über die Lippen kom-men« (taz.de 2007d). Und eine Woche später ließ er sich dazu hinreißen, der rechtskonservativen Zeitung »Junge Freiheit« ein Interview zu geben, in dem er geäußert haben soll:
8 Sie ist gleichwohl keine Erfindung Deuses, sondern beruht auf gängigen Definitionen durch Wis-senschaft und Verfassungsschutz. Demzufolge sind extremistische Bestrebungen »Aktivitäten mit der Zielrichtung, die Grundwerte der freiheitlichen Demokratie zu beseitigen. Dazu gehören Vorberei-tungshandlungen, Agitation und Gewaltakte. [...] Verhaltensweisen von Einzelpersonen, die nicht in einem oder für einen Personenzusammenschluss handeln, sind Bestrebungen, wenn sie auf Anwen-dung von Gewalt gerichtet sind oder auf Grund ihrer Wirkungsweise geeignet sind, ein Schutzgut des Bundesverfassungsschutzgesetzes oder eines Landesverfassungsschutzgesetzes erheblich zu beschä-digen« (BfV (2009): 9). 9 Offenbar waren nicht wenige Journalisten sehr bemüht, vor Ort auf rechtsextreme Strukturen zu stoßen. Allerdings suchten sie vergeblich. Immerhin fanden sie zum Beispiel den Vize-Chef des Mügelner Jugendklubs »Free Inn«, der zu Protokoll gab, er sei überzeugt, dass es eine rechte Szene in Mügeln gebe und dass diese Szene »derzeit wieder erstarke«. Und: »Der Jugendklub selbst sei bis 1999 von Rechtsextremen dominiert worden. Inzwischen beteilige sich die Einrichtung aktiv an der Prävention gegen Rassismus und unterstützt Aussteiger aus der Szene« (LVZ 2007b).
204 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
»Warum können wir Deutsche eigentlich nicht – so wie das doch 2006 zur WM sehr schön gelungen ist – unverkrampft zu uns selbst stehen? … Ich zum Beispiel bin stolz darauf, Deutscher zu sein … In anderen Ländern, etwa in Frankreich, ist man wie selbstverständlich von rechts bis links stolz darauf, Franzose zu sein. Das ist doch schön« (zit. nach FAZ 2007b).
In jeder anderen Situation wären diese Sätze nicht sonderlich aufgefallen. Sie gehören zum Standardrepertoire der »Schlussstrich«-Diskurse. Im Kontext von Mügeln jedoch hatte der Bürgermeister sich und seine Stadt genau dahin gestellt, wo er eigentlich heraus wollte: In die rechte Ecke. Er »bewies« damit die Hypo-these von latent rechtsextremen Einstellungen einer »schweigenden Mehrheit« in der Kleinstadt und also von einer gesellschaftlichen Struktur, die das, was auf dem Stadtfest geschehen war, möglich gemacht hat.
3. Die Bürgerinnen und Bürger Dieser Eindruck wurde umso manifester, als es vielen Journalisten offenbar nicht gelungen war, Interviews von Einwohnerinnen und Einwohnern zu bekommen. »Im Ort herrscht das große Schweigen« (SPIEGEL-online 2007c). Auf dem Stadtfest, hieß es, seien fast alle gewesen. Wenn sie nicht selbst zum Mob gehört haben, der die »Inder« verfolgt hat, dann hätten sie es wenigstens mitbekommen müssen – und seien nicht eingeschritten. Vielleicht auch um dieser Narration entgegenzutreten, gab es eine Woche nach den Ereignissen eine öffentliche Po-diumsdiskussion, ein Friedensgebet und einen Kerzenmarsch. Regionalzeitungen berichteten: »Eine Woche nach den Übergriffen steht Mügeln noch immer unter Schock« und »Mügeln sucht seinen Frieden« (LVZ-online 2007; Sächsische Zeitung 2007b).
4. Politik Die Mügelner standen auch im Zentrum der einsetzenden politischen Diskussion (jenseits des lokalen Bezugs). Neben taktischen Scheingefechten (etwa der Rücktrittsforderungen gegen Deuse, Versuche der Inschutznahme des Partei-freunds durch den FDP-Vorsitzenden Westerwelle und darauffolgende Angriffe gegen diesen selbst) gab es vor allem zwei interessante diskursive Figuren: a) Fremdenfeindlichkeit als ökonomisches Standortproblem; b) staatlich geförderte Aktionsprogramme gegen Rechts.
Die Standortfrage bezieht sich sowohl auf die Anwerbung von ausländi-schen Fachkräften für die Industrie als auch auf die Attraktivität beispielsweise Sachsens für die Ansiedlung von Großunternehmen. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Thierse warnte in der Berliner Zeitung u.a. vor den Gefahren für die
Verwaltung politischer Devianz 205
wirtschaftliche Prosperität: »Je schlechter der Ruf Deutschlands ist, umso weni-ger werden die Leute, die wir brauchen können für unseren Fortschritt und Wohlstand, kommen« (Faz.net 2007b). Und der sächsische Ministerpräsident Georg Milbradt erklärte auf die Frage eines Interviewers, ob Mügeln angesichts des Fachkräftemangels nicht »verheerend für das Bild Deutschlands« sei:
»Auf jeden Fall, das gilt natürlich auch für Sachsen. Wir haben ja gerade bei uns im Freistaat in der boomenden Chipindustrie sehr viele Ausländer beschäftigt. Wir sind in dieser Branche in einem regen Austausch mit Indien, China, Taiwan, den USA und vielen anderen Staaten. Wir brauchen gerade im Bereich der Spitzentechnologie und Spitzenforschung internationale Kooperation. Das ist überlebenswichtig für uns. (SPIEGEL-ONLINE 2007d).
Nun spielen bei diesem Fall möglicherweise besondere Assoziationen mit hinein. Als Opfer wurden in Mügeln acht Inder präsentiert – Menschen, die irgendwann aus Indien in die Bundesrepublik migriert sind und von denen wenigstens einer einen Pizzaservice betreibt. In den migrationspolitischen Diskursen der vergan-genen Jahre tauchten Inder immer wieder als eine sehr spezifische Gruppe auf, nämlich als Computerspezialisten. Im Zusammenhang mit der Green-Card-Debatte Ende der Neunzigerjahre und dem »Kinder statt Inder«-Wahlkampf von Jürgen Rüttgers in Nordrhein-Westfalen wurden sie als Fachkräftepotenzial für die in Deutschland heimische »Spitzentechnologie« präsentiert. Das Problem mit solchen Narrationen – Gewalt gegen Ausländer beschädigt Deutschlands Ruf als Wirtschaftsstandort – ist freilich, dass sie eine Logik bedienen, in der der Schutz der Menschenwürde und das Recht auf körperliche Unversehrtheit hinter öko-nomischen Begründungszusammenhängen zurückstehen. Die Opfer werden standortpolitisch instrumentalisiert, zumal wenn sie zwar Inder, aber keine Com-puterspezialisten, sondern Pizzabäcker sind. Fraglich ist außerdem, ob sich mit diesem Argument xenophobe Einstellungen ändern lassen, denn es transportiert implizit Distinktionen zwischen »uns« und den »Anderen«, verknüpft mit Nütz-lichkeitserwägungen.
Ein zweiter wichtiger Punkt in der politischen Diskussion war die Frage nach den Gegenmaßnahmen. Dabei tauchten zwei in der bundesdeutschen Politik bewährte Reaktionsmuster auf: Erstens die Idee, ein neues NPD-Verbotsver-fahren einzuleiten (obwohl nicht annähernd ein Zusammenhang zwischen der Partei und der »Hetzjagd von Mügeln« konstruiert werden konnte) und zweitens die Forderung, Programme zur Unterstützung zivilgesellschaftlicher Initiativen aufzustocken oder neu aufzulegen. Im konkreten Fall kam es zu einem kleinen Scharmützel zwischen dem seinerzeitigen Ostbeauftragten der Bundesregierung, Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee, und seiner Kabinettskollegin Ursula von der Leyen (Familie, Senioren, Frauen und Jugend), die für solche Programme
206 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
zuständig ist. Offenbar hatte der Landkreis Torgau-Oschatz, zu dem Mügeln gehört, keine Fördermittel aus dem Bundesprogramm mehr akquirieren können. Von der Leyen jedenfalls kündigte an, »den Hilfsorganisationen des Landes fünf Millionen Euro zusätzlich für Programme zur Bekämpfung des Rechtsextremis-mus zur Verfügung zu stellen« (freiepresse.de 2007).10
Ein Fall von Moral Panics? Förderprogramme, von denen lokale oder regionale Initiativen, die sich in der Demokratieerziehung an Schulen, in der Opferberatung oder in der Gewaltprä-vention engagieren, abhängig sind, werden nicht selten durch solche Mediener-eignisse wie im Fall Mügeln induziert. Sei es, dass Menschen anderer als weißer Hautfarbe angegriffen, geschlagen oder getötet werden, sei es, dass rechtsextre-me Parteien wie die NPD im Parteienwettbewerb reüssieren können und in Wah-len Parlamentssitze gewinnen können.11 Politik reagiert auf »moral panics«.
Dieser Begriff ist in den Siebzigerjahren von dem Soziologen Stanley Co-hen geprägt worden. Das Medienereignis »Hetzjagd von Mügeln« kann als ein Element in einem Komplex von moral panics charakterisiert werden: 1. Die Medien berichteten und kommentierten – verglichen mit ähnlichen tag-
täglichen Vorkommnissen – außergewöhnlich intensiv und ausführlich. 2. Das »objektive« Wissen, also die konsensualen und plausiblen Wissensbe-
stände, über die Situation oder das, was eigentlich vorgefallen ist, war, je-denfalls in der ersten Woche, viel zu widersprüchlich und unübersichtlich, als dass man hätte zu eindeutigen Deutungen, Erklärungen und Konsequen-zen kommen können.
3. Deshalb haben verschiedene Akteure Wissenslücken mit moralisierenden Spekulationen aufgefüllt und wirkmächtige Metanarrationen produziert.12
10 Das wiederum erboste offenbar den sächsischen Staatskanzleiminister, der sagte, »es dürften nicht nur die Regionen Geld bekommen, in denen es Krawalle gegeben habe und die anderen nicht« und vorschlug »die Firmen finanziell zu unterstützen, die junge Menschen einstellen«. Hinter dieser Argumentation steht wohl die schon oben erwähnte Deprivationsthese, der zufolge junge Menschen ohne Aussicht auf eine berufliche Zukunft besonders anfällig für Rechtsextremismus seien. 11 Diese Hypothese müsste freilich noch systematischer untersucht werden. Eine Schwierigkeit besteht darin, dass zwischen politischer Rhetorik direkt nach solchen Ereignissen und der Auflage eines Förderprogramms meistens eine geraume Zeit vergeht. Außerdem spielt bei der Programmie-rung eine Reihe anderer Faktoren mit hinein, etwa Lokalinteressen von Bundestagsabgeordneten oder -ministern (siehe vorige Fußnote). 12 »A condition, episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to socie-tal values and interests; its nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass
Verwaltung politischer Devianz 207
Einer der Effekte war, dass sich offenbar ein großer Teil der Bürgerschaft Mü-gelns diffamiert, in Kollektivhaftung genommen fühlte, zu Unrecht von den Medien an den Pranger gestellt, weil sie an der »Hetzjagd« entweder beteiligt gewesen seien (der »Mob«) oder doch zugelassen hätten, dass in ihrer Stadt so etwas passiert. Es wäre nicht verwunderlich, wenn sie deshalb jegliche Koopera-tion mit den Journalisten eingestellt hätten, weshalb es dann wiederum ein Leichtes war, die »schweigende Mehrheit« zu konstatieren – für manche Rah-menbedingung oder Indikator für aufkommenden Faschismus.
Solche Assoziationen werden in ähnlichen Fällen immer wieder bedient, um aufzurütteln und den Zeitungslesern, Fernsehzuschauern und Politikern die grundlegende Gefahr, die von solchen Vorfällen für das Gemeinwesen ausgehe, drastisch zu verdeutlichen. An diesem Deutungsspiel beteiligen sich mitunter auch Vertreterinnen und Vertreter der Initiativen und Vereine, die von den Re-daktionen als Experten angefragt werden. In einem ansonsten relativ differen-zierten Gastkommentar für die Online-Ausgabe der tageszeitung schrieb David Begrich, Referent der Arbeitsstelle Rechtsextremismus des Vereins Miteinander e.V. in Sachsen-Anhalt:
»Die besorgten Fragen nach dem Ruf des Standorts Sachsen verstellen den Blick auf lokale Eliten und Polizeibehörden, denen offenbar keine rhetorische Verrenkung zu peinlich ist, um das Kind nicht beim Namen nennen zu müssen; dass nämlich die Hetzjagd von Mügeln keine normale alkoholisierte Massenschlägerei unter Sauf-kumpanen war, sondern eine fremdenfeindlich motivierte Tat, an der Schwelle zum Pogrom« (taz.de 2007e).
In der deutschen Sprache ist das Wort »Pogrom« fest mit dem 9. November 1938 verbunden, der sogenannten »Reichsprogromnacht«. Begrich deutete also Mügeln in einer sehr spezifischen Weise aus: Als organisierte Aktion von gleichsam natio-nalsozialistischen Schlägertruppen, die – unter dem Beifall oder mit Billigung der Bevölkerung – gegen Angehörige einer bestimmten Gruppe vorgingen.13
media; the moral barricades are manned by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited experts pronounce their diagnoses and solutions; ways of coping are evolved or (more often) resorted to; the condition then disappears, submerges or deteriorates and becomes more visible« (Cohen 2002: 1). Cohens Konzept ist freilich differenzierter und weitgehen-der. Man müsste nicht nur die Wissensproduktion in Bezug auf ein einzelnes Ereignis soziologisch untersuchen, sondern beispielsweise überprüfen, ob Diskurse um Rechtsextremismus und Fremden-feindlichkeit in Ostdeutschland ein bestimmtes Phänomen mitproduziert oder verfestigt haben. Damit könnte man eventuell erklären, warum die NPD 2009 in den sächsischen Landtag wiedergewählt worden ist. Mehr dazu an anderer Stelle. 13 So ähnlich funktionierte auch die politische Rhetorik gegen die Ansiedlung eines »Wahlkreisbü-ros« der NPD in Leipzig. Auf einer Kundgebung 2009 bekräftigte der Ordnungsbürgermeister der
208 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
»No-Go-Areas« und »National befreite Zonen« Zusätzlich zu dieser Dramatisierung kann es geschehen, dass diese unmittelbare Reaktivität auf einzelne medienrelevante Ereignisse, verbunden mit moralischen Ansprüchen, dazu beiträgt, nicht nur komplexe soziale Situationen unzulässig zu reduzieren, sondern auch in einen Diskurs einzutreten, der von denen vorstruktu-riert wird, die man eigentlich bekämpfen will. Dadurch werden im Effekt be-stimmte Metanarrationen übernommen und reproduziert. Ein taugliches Beispiel dafür ist der Topos der Verräumlichung von Rechtsextremismus und Fremden-feindlichkeit. In den Neunzigerjahren proklamierten rechtsextreme Gruppen, meist lokal organisierte sogenannte »freie Kameradschaften«, in einigen Gegen-den der östlichen Bundesländer »national befreite Zonen«. Gemeint war damit, dass man alle »Ausländer«, linksalternative Jugendliche etc. aus den betreffen-den Gemeinden erfolgreich vertrieben hätte oder dass man das wenigstens vor-habe.
Im Mai 2006 prägte der vormalige Regierungssprecher und Vorsitzende der von ihm gegründeten Stiftung Gesicht zeigen! e.V., Uwe-Karsten Heye, die Bezeichnung »No-Go-Areas« für Gegenden in Ostdeutschland, die »Ausländer« nicht ohne Gefahr für Leib und Leben betreten könnten. In der Mügeln-Debatte war es der Zentralrat der Juden, der vor diesen »No-Go-Areas« warnte. General-sekretär Kramer sprach in der Netzeitung
»von einer ›offensichtlichen Gefährdungslage‹ für Ausländer. Daher ›sollte man da-vor warnen in bestimmten ostdeutschen Landstrichen und Städten, sich als Auslän-der oder erkennbar Fremder niederzulassen‹. Das sei ›keine Hysterie‹, sondern eine ›bittere Tatsache‹, betonte Kramer. Der Vorfall in Mügeln habe dies erneut bestätigt. ›Gestern Farbige, heute Ausländer, morgen Schwule und Lesben oder vielleicht Ju-den‹« (zit. nach sueddeutsche.de 2007b).
Und die oben zitierte Anetta Kahane von der Amadeu-Antonio-Stiftung verwen-dete im zitierten Interview gleich synonym die originalen Raumcodes der »freien Kameradschaften«: »Natürlich gibt es diese No-go-Areas, die so genannten nati-onal befreiten Zonen. Nichtarische Menschen wissen, warum sie nicht dorthin fahren.«
Der Raum wurde schließlich auch zu einer Kategorie im sächsischen Lan-desprogramm »Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz«, ein Ergeb-nis der Verabredungen von CDU und SPD im Koalitionsvertrag 2004 nach dem
Stadt sein Engagement gegen die Partei mit den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs, die seine Vorfahren gemacht hätten.
Verwaltung politischer Devianz 209
Einzug der NPD in den sächsischen Landtag. Als eines der Ziele wurde genannt: »Zudem soll erreicht werden, die bestehenden Organisationstrukturen der NGO’s zu straffen, Dopplungen in der Trägerlandschaft zu verhindern, aber auch Gebie-te ohne entsprechende Strukturen zu verhindern.«
Aber was ist das Problem daran? Nun, ein wesentlicher Nachteil der Ver-räumlichung oder der Lokalisierung »des Rechtsextremismus«, dessen grundle-gende Elemente einer populären These zufolge »in der Mitte der Gesellschaft« angekommen seien, ist, dass die so deklarierten Räume (zum Beispiel »die Säch-sische Schweiz«, »einige Gegenden Brandenburgs«, »die ländlichen Gebiete östlich von Leipzig« usw.) alle Menschen einschließen, die in ihnen leben. Ein so geführter Diskurs könnte eminente sogenannte Labeling-Effekte zur Folge haben, das heißt, die Menschen in jenen Gebieten werden in toto moralisch de-klassiert, und diese Deklassierung könnte dann entweder gleichgültige oder gar widerständige Reaktionen erzeugen. Und alle gut gemeinten Programme und lokalen Initiativen würden ins Leere laufen.
Konsequenzen Im Fall Mügeln haben wir gesehen, wie ein singuläres, gewalttätiges Ereignis sehr schnell reduziert und ausgedeutet worden ist. Wir haben gesehen, dass es unterschiedliche und auch widersprüchliche Erzählungen und Interpretationen gab, aber auch, wie sehr vorgängige Deutungsmuster und Stereotype (»Pogrom«, »Ausländer«, Jugendgewalt, Bierzeltschlägerei, »schweigende Mehrheit«) in die mediale Berichterstattung eingeflossen sind. Letztlich konnte nur die Rechtsext-remismus-These, mithin jene Vermutung, die die größte generalisierbare Gefahr heraufbeschwor, politisch anschlussfähig gemacht werden.
Auch wenn es etwas verwegen ist, aus diesem Einzelfall generelle Konse-quenzen abzuleiten – für lokale und regionale zivilgesellschaftliche Vereine und Initiativen ergeben sich mindestens zwei Lehren: Man sollte berücksichtigen, dass zwischen der eventualistischen politischen
Logik der Programmierung von Zivilgesellschaft mittels Fördergeldern und den konkreten langfristigen Ansprüchen und Erfordernissen vor Ort ent-scheidende Differenzen bestehen können. Es sollte versucht werden, durch eine sorgfältige und tiefgründige Darstellung der lokalen und regionalen Si-tuationen die Programmgestaltung so zu beeinflussen, dass diese Differen-zen wenigstens minimiert werden.
Als Expertinnen und Experten beteiligen sich Vertreterinnen und Vertreter der Initiativen im konkreten Umfeld eines Ereignisses an der diskursiven
210 Daniel Schmidt, Rebecca Pates, Susanna Karawanskij
Wahrheitsproduktion. Man sollte überlegen, welche Kommunikationsstra-tegien in solchen Situationen zielführend sein könnten und dabei sowohl be-rechtigte Eigeninteressen der jeweiligen Organisation im Blick haben, als auch die eigene Expertise herausstreichen, selbst wenn diese sich von den gängigen politischen Erklärungsmustern unterscheidet.
Literaturverzeichnis BfV (2009): Glossar der Verfassungsschutzbehörden, Bundesamt für Verfassungsschutz:
Köln Cohen, Stanley (2002): Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and the
Rockers, London, New York: Routledge. FAZ (2007a): »Gruß aus Sebnitz«. In: FAZ vom 21.08.2007, S. 10. FAZ (2007b): »Deuse: Mügeln wird vorverurteilt«. In: FAZ vom 31.08.2007, S. 2. FAZ.net (2007a): FAZ.net vom 20.08.2007, http://www.faz.net/s/Rub61EAD5BEA1EE
41CF8EC898B14B05D8D6/ Doc~E0E80A, 27.08.2007. Faz.net (2007b): In: FAZ.net vom 21.08.2007, http://www.faz.net/s/Rub61EAD5BEA
1EE41CF8EC898B14 B05D8D6/Doc~E81C57, 27.08.2007. freiepresse.de (2007): »Experte: Vorfälle in Mügeln keine Seltenheit«. In: freiepresse.de
vom 27.08.2007, http://www.freiepresse.de/ NACHRICHTEN/SACHSEN/1011 431.html, 27.08.2007.
Heitmeyer, Wilhelm (1992): Rechtsextremistische Orientierungen bei Jugendlichen. München: Juventa.
Koopmans, Ruud/Staham, Paul/Guigni, Marco/Passy, Florence (2005) Contested Citizen-ship: Immigration and Cultural Diversity in Europe. Minneapolis/London: Universi-ty of Minnesota Press.
LVZ (2007a): »Dutzende Jugendliche schlagen auf Inder ein«. In: LVZ vom 20.08.2007, S. 5.
LVZ (2007b): »Rechte gibt es überall«. In: LVZ vom 22.08.2007, S. 5. LVZ (2007c): »Ermittler: Überfall nicht organisiert«. In: LVZ vom 29.08.2007, S. 5. LVZ online (2007): LVZ-online vom 27.08.2007, http://www.lvz-online.de/aktuell/
content/37536.html, 27.08.2007 und Sächsische Zeitung vom 27.08.2007, S. 8. Mouffe, Chantal (1994): »For a politics of nomadic identity«. In: Travellers’ Tales: Narra-
tives of home and displacement, hg. v. George Robertson/Melinda Mash/Lisa Tich-ner/Jon Bird/Barry Curtis/Tim Putnam, London, New York: Routledge, S. 102-110.
Rydgren, Jens (2005): »Is extreme right-wing populism contagious? Explaining the emer-gence of a new party family«. In: European Journal of Political Research 44/3, S. 413-437.
Sächsische Zeitung (2007a): »Bewährungsstrafen nach rassistischem Überfall in Gunters-blum« . In: Sächsische Zeitung vom 27.08.2007, S. 8, daserste.ndr.de/panorama/ archiv/2007/panoramaguntersblum4.html, 19.11.2010.
Spiegel Online (2007a): SPIEGEL ONLINE vom 20.08.2007, http://www.spiegel. de/politik/deutschland/0,1518, 500884,00.html, 03.09.2007.
Verwaltung politischer Devianz 211
Spiegel Online (2007b): »Hetzjagd in Mügeln: Wegsehen, schönreden, abtauchen«. In: Spiegel Online vom 21.08.2007, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ 0,1518,druck-501138,00.html, 22.08.2007.
Spiegel Online (2007c): Spiegel Online vom 21.08.2007, http://www.spiegel. de/politik/deutschland/0,1518,druck-500964, 00.html, 22.08.2007.
Spiegel Online (2007d): »Hetzjagd auf Ausländer: ›Viele im Osten sind durch dumpfe Parolen mobilisierbar‹«. In: SPIEGEL ONLINE vom 21.08.2007, http://www. spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,druck-501005,00.html, 22.08.2007.
Spiegel Online (2007e): »Haftbefehl nach Angriff auf Afrikaner«. In SPIEGEL ONLINE vom 22.08.2007, http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,501991,00.html, 12.11.2010.
Strauss, Anselm/Corbin, Juliet (1997): Grounded Theory in Practice, London: Sage. Süddeutsche Zeitung (2007): »Es war der Anfang eines Progroms«. In: Süddeutsche
Zeitung vom 6.12.2007, S. 10. sueddeutsche.de (2007a): »Da hat sich was hochgeschaukelt« .In: sueddeutsche.de vom
22.08.2007, http://www.sueddeutsche.de/ deutschland/artikel/57/128841/print.html, 22.08.2007.
sueddeutsche.de (2007b): sueddeutsche.de vom 22.08.2007, http://www.sueddeutsche.de/ deutschland/artikel/332/129115/print.html, 22.08.2007.
Taz.de (2007a): »Der Mob ist der gleiche«. In: taz.de vom 21.08.2007, http://www. taz.de/1/politik/deutschland /artikel/1/der-mob-ist-der-gleiche.html, 6.03.2008.
Taz.de (2007b): taz.de vom 22.08.2007, http://www.taz.de/index.php?id=kommentar-artikel&art =3489&no_cache=1&type=98, 30.08.2007.
Taz.de (2007c): »Übergriffe in Sachsen: ›Da haben Glatzen gewartet‹«. In: taz.de vom 21.08.2007, http://www.taz.de/ index.php?id=deutschland-artikel&art=3428&no_ cache=1&type=98, 27.08.2007.
Taz.de (2007d): »›Ausländer raus‹-Sprechchöre: Bürgermeister verharmlost Hassparo-len«. In: taz.de vom 22.08.2007, http://www.taz.de/index.php?id=deutschland-artikel&art=3491&no_cache=1&type=98, 27.08.2007.
Taz.de (2007e): »Reflexe nach der Hetzjagd von Mügeln: An der Schwelle zum Pogrom«. In: taz.de vom 22.08.2007, http://www.taz.de/index.php?id=kommentar-artikel&art =3489&no_cache=1&type=98, 27.08.2007.
Tilly, Charles (1978): From Mobilization to Revolution. Reading, MA: Addison-Wesley.