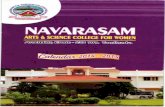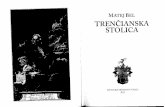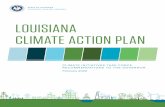»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della...
Transcript of »Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della...
Kolumnentitel 21
sen ist, um 1470 für die Kapelle von Francesco Sassettis Landsitz ge-schaffen. Der Altar zeigt neben der Madonna mit Kind die HeiligenFranziskus und Cosmas, die als Namenspatrone des Hausherrn undCosimo il Vecchios auftreten. Die enge Bindung an die Medici äußertsich in verwandter Form in Francesco Sassettis ebenfalls bei Andrea dellaRobbia in Auftrag gegebenen Altar für die Badia Fiesolana, auf dem mitCosmas und Damian zwei Familienheilige der Medici dargestellt sind.Die beiden Sassetti-Altäre sind aber nicht allein Demonstrationen derTreue zu den Medici, sondern auch Ausdruck des Selbstbewußtseins ih-res Stifters, der sich zum Zeitpunkt ihrer Entstehung auf dem Höhe-punkt seines Erfolges befand. Als ein Jahrzehnt später sein Stern sankund die von ihm geleiteten Medici-Banken dem Bankrott entgegentau-melten, beharrte Francesco Sassetti im Medium des Bildes auf seinemPlatz an der Seite der Medici. Im Programm seiner Familienkapelle in S. Trinita steht er neben Lorenzo il Magnifico – so wie sich auf im Ber -liner Altar die Heiligen Franziskus und Cosmas, Francescos Namens -patron und der seines Förderers Cosimo, gleichrangig gegenüberstehen.Der folgende Beitrag versucht, von der Ermittlung des ursprünglichenAufstellungsorts des ›Varramista-Altars‹ ausgehend, dessen Gestaltung,Ikonographie und Funktion sowie den Kontext seiner Entstehung neuzu bestimmen.
1 Aby Warburg, Bildniskunst und Florentinisches Bürgertum. Domenico Ghirlandajo in
Santa Trinita. Die Bildnisse des Lorenzo de’ Medici und seiner Angehörigen, Leipzig 1902.
2 Aby Warburg, Francesco Sassettis letztwillige Verfügung, in: Kunstwissenschaftliche Beiträ-
ge. August Schmarsow gewidmet von A. Warburg u.a., Leipzig 1907; auch in: Aby Warburg,
Francesco Sassettis letztwillige Verfügung, in: Die Erneuerung der heidnischen Antike. Kul-
turwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance, hrsg. von Horst
Bredekamp und Michael Diers, Berlin 1998, S. 127–158.
3 U.a. Eve Borsook, Johannes Offerhaus, Francesco Sassetti and Ghirlandaio at S. Trinita, Flo-
rence. History and Legend in a Renaissance Chapel, Doornspijk, 1981. – Ernst Gombrich, The
Sassetti Chapel revisited: Santa Trinita and Lorenzo de’ Medici, in: I Tatti Studies 7 (1997),
S. 11–35. – Michael Rohlmann, Bildernetzwerk. Die Verflechtung von Familienschicksal und
Heilsgeschichte in Ghirlandaios Sassetti-Kapelle, in: Domenico Ghirlandaio. Künstlerische
Konstruktion von Identität im Florenz der Renaissance, hrsg. von Michael Rohlmann, Wei-
mar 2003, S. 165–243.
4 Amanda Lillie, Florentine Villas in the Fifteenth Century. An architectural and social histo-
ry, Cambridge 2005.
5 Heute als Villa La Pietra Teil des Florentiner Campus der New York University an der Via
Bolognese im Nordosten von Florenz.
6 Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 241 ff.
Since the Bode-Museum reopened in 2006, the Madonna altar by And -rea della Robbia, purchased by Wilhelm von Bode in Florence in 1885,was placed once more in the basilica of the Bode-Museum; the piece un-doubtedly numbers among the most significant works of glazed terracot-ta in the Berlin collection. While the Florentine banker and acolyte ofMedici, Francesco Sassetti, has long been known as the commissioner, theexact provenance of the altar was unknown until now. Hereafter, start-ing with the clarification of the original site of the altar, we will attemptto reassess its design, iconography and function. Bode’s suggested datingback to ca. 1470, to be confirmed here, grants the Berlin altar a specialplace in the development of sculptured altar images in quattrocento-eraFlorence.
In seinem 1902 erschienenen Aufsatz »Bildniskunst und Florentini-sches Bürgertum« widmete sich Aby Warburg der bis dahin kaum er-forschten und, wie Warburg kritisch vermerkte, nicht einmal ordentlichfotografierten Sassetti-Kapelle in der Florentiner Kirche S. Trinita.1 Indiesem berühmten Text gelang es dem Hamburger Gelehrten, auf Basisder Identifizierung der Porträts in Ghirlandaios Freskenzyklus ein an-schauliches Bild des engen sozialen Netzwerkes zu entwerfen, dessenKern die Medici-Familie bildete und zu dem mit Francesco Sassettiauch der Stifter der Kapelle gehörte. Der fünf Jahre später veröffentlich-te Aufsatz »Francesco Sassettis letztwillige Verfügung« (Leipzig 1907)führte die begonnene Untersuchung fort, stellte aber ausgehend vondem in einer Abschrift überlieferten Vermächtnis die PersönlichkeitFrancesco Sassettis stärker in den Mittelpunkt.2 Auf diese Weise ent-deckte Warburg den in Vergessenheit geratenen Florentiner Kaufmannund Medici-Bankier für die Forschung wieder. Die Texte leiteten eineintensive, bis in die Gegenwart reichende Auseinandersetzung mit derCappella Sassetti ein,3 regten aber auch zur weiteren Beschäftigung mitder Familie Sassetti selbst an. Hervorzuheben ist hier vor allem AmandaLillies Buch »Florentine Villas in the Fifteenth Century. An Architectu-ral and Social History« (Cambridge 2005),4 das sich ausführlich mit derSassetti-Villa in Montughi bei Florenz befaßt.5 In ihre Untersuchungbezog sie die bekannten, mit Francesco Sassetti verbundenen Kunst-werke ein; neben der Kapelle in S. Trinita sind dies vor allem seine Mar-morporträt im Bargello und ein Altar für die Badia Fiesolana.6 EinWerk allerdings, das seit langem schon als Sassetti-Auftrag identifiziertist, blieb von der Forschung bislang unberücksichtigt: der ›Varramista-Altar‹ von Andrea della Robbia (Abb. 1) in der Skulpturensammlungdes Bode-Museums. Er wurde, wie im folgenden Beitrag zu nachzuwei-
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums
Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz
Andreas Huth
22 Andreas Huth
Der Sassetti-Altar: Beschreibung und Zustand
Der Altar besteht aus einem querrechteckigen, von einer Pilasterord-nung gerahmten Altarbild und einer dreiteiligen Predella.7 Er wurdeaus 21 einzeln geformten und glasierten Stücken zusammengesetzt undist, von einigen Rissen und Fehlstellen in der Glasur sowie Beschädi-gungen im rechten Predellenbild (Abb. 2) abgesehen, sehr gut erhal -ten.8 Lediglich der Zustand der Blattgoldauflagen ist bei den meisten
7 Madonnen-Altar von Andrea della Robbia, glasierte Terrakotta, 178×183 cm, Skulpturen-
sammlung der Staatlichen Museen Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Inventar-
Nummer 127.
Zum Ankauf durch Wilhelm von Bode: Gutachten Bode für die Generalverwaltung vom
23.11.1885, Staatliche Museen Berlin – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Zentralarchiv, I/GG
201, Nr. 2629.85. – Amtliche Berichte aus den königlichen Kunstsammlungen, Nr. 3 (Juli
1886), S. XXXV. –Wilhelm von Bode, Mein Leben, hrsg. von Thomas W. Gaehtgens und Bar-
bara Paul, Berlin 1997, Bd. 1, S. 193; Bd. 2, S. 190.
8 Schadensbeschreibung und -kartierung in der (unveröffentlichten) Restaurierungsdoku-
1 Andrea della Robbia, Sassetti-Altar, glasierte Terrakotta, um 1470, 178×183 cm, SMB-SPK/Skulpturensammlung im Bode-Museum, Berlin, Inventar-Nr. 127
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 23
Stücken beeinträchtigt; anhand der erhaltenen Reste ist jedoch die ur-sprüngliche Gestaltung nahezu vollständig ablesbar.9
Das Altarbild zeigt vor einem blauen Hintergrund eine von zweiHeiligen begleitete Madonna mit Kind. Die Madonna sitzt auf Wolken-bänken, die im Fußbereich geradezu in den Betrachterraum hinein-quellen. Maria und ihr Sohn bilden das Zentrum der Komposition; dasKind steht auf dem rechten Oberschenkel seiner Mutter und schmiegtsich an sie, die Jungfrau umfaßt den Sohn mit ihrer Rechten, währendsie mit der linken Hand seinen Fuß ergreift. Dessen Hand wiederumhält lose einen Zipfel des Schleiers. Links und rechts von den Köpfender Madonna und des Kindes verneigen sich, in flacherem Relief gege-ben, betende Engelpaare vor den beiden. Von den Engeln sind nur dieaus schmalen Wolkenstreifen herausragenden geflügelten Oberkörperzu sehen. Die zentrale Gruppe übertrifft auch die beiden Begleitfigurenan Plastizität, dasselbe gilt auch für den Größenmaßstab, wenngleichder geringe Unterschied eher subtil die Hierarchie zwischen der Gottes-mutter und den zwei Heiligen betont. Bei ihnen handelt es sich, wienoch näher zu begründen ist, um Franziskus und Cosmas. Im Unter-schied zur der auf Wolken sitzenden Madonna stehen beide fest aufdem unteren Bildrand und ihre Füße überragen leicht dessen Kante.
Die Köpfe aller Figuren sind von vergoldeten Nimben hinterfan-gen. In allen anderen Bereichen des Altars, bildlichen wie architektoni-schen, finden sich ebenfalls Spuren einer großzügigen Verwendung vonGold; so beispielsweise am Gebälk, an den Pilastern und auf dem Trage-kreuz des Franziskus. Bei der Betrachtung aus der Nähe fällt die Fein-
heit der zarten goldenen Linien an den Wolkenbänken der adorieren-den Engel, an den Gewandsäumen der Madonna (Abb. 3) und des hl.Cosmas und in den Darstellungen der Predella ins Auge (Abb. 4). Ihreüberraschende Kleinteiligkeit korrespondiert mit den ebenso feinenhellblauen Konturen in der Glasur, die zur besonderen Akzentuierungvon Pupillen und Augenbrauen (im Altarbild) und Gesichtszügen, Haa -ren und Details der Kleidung (in der Predella) dienen (ebenfalls Abb. 4).
Die Predella wird durch schmale Lisenen in drei Bildfelder geteilt,deren äußere Seiten mit schildförmigen Wappen der Florentiner Fami-lie Sassetti versehen sind; sie bestehen aus einem blauen Querbalkenund zwei begleitenden gelben Streifen auf weißem Grund.10 Das mittle-re der Bildfelder (Abb. 5), etwas breiter als die übrigen, zeigt in flachem,polychrom glasierten Relief eine Anbetung des Kindes mit Maria undJoseph vor einer baumbestandenen Landschaft. Das auf einem Gras-
mentation, Jan Hamann u.a., Dokumentation zur Restaurierung des Varramista-Altars, Res-
taurierung am Oberbaum, Berlin 2003/2004, Archiv der Skulpturensammlung im Bodemu-
seum, S. 2–5; siehe auch Bodo Buczynski, The Restoration of Two Retables by Andrea della
Robbia and Workshop in the Bode Museum, in: Della Robbia. Dieci anni di studi/Dix ans
d’études, hrsg. von Anne Bouquillon, Marc Bormand, Alessandro Zucchiatti, Genf 2011,
S. 108–117, zum hier besprochenen Werk: S. 113–117. Wilhelm von Bode hatte beim Sassetti-
Altar Risse beobachtet, die wahrscheinlich während des ersten Brennens der Stücke entstan-
den waren und in die die danach aufgetragene Glasur hineinlief; Amtliche Berichte 1886 (wie
Anm. 7), S. XXXV. – Bode, Wilhelm von, Neue Erwerbungen für die Abteilung der christ -
lichen Plastik in den königlichen Museen – Glasierter Thonaltar von Andrea della Robbia, in:
Jahrbuch der königlichen Kunstsammlungen, 7 (1886), S. 206. Gleiches stellt Paul Hofmann
bei der Restaurierung des Auferstehungsaltars Andrea della Robbias fest, der ebenfalls in der
Basilika des Bodemuseums aufgestellt ist; Paul Hofmann, Die Auferstehung Christi’ von An-
drea della Robbia, Teil I in: Restauro, 6 (September 2007), S. 380–385 und Teil II in: Restauro,
7 (Oktober/November 2007), S. 382.
9 Die in die Sowjetunion verbrachten Teile des Altars wurden offensichtlich unsachgemäß
gereinigt, so daß hier von den Vergoldungen nur noch bescheidene Reste erhalten sind. Bei
den drei in Berlin-Dahlem aufbewahrten Stücke hingegen sind die Goldauflagen in einem
vergleichsweise guten Zustand, scheinen jedoch in der Vergangenheit schon einmal ausgebes-
sert worden zu sein. Zum Erhaltungszustand der Vergoldungen siehe auch Dokumentation
2003/04 (wie Anm. 8), S. 2 und 4.
10 Allan Marquand, Robbia Heraldry, Princeton University Press 1919, S. 14/15, wiederholt
in: ders., Andrea della Robbia and his atelier, Princeton 1922, S. 21 ff. Vorher galten die Wap-
pen als Zeichen »einer Florentiner Familie« bzw. wurden dem Bologneser Geschlecht der Al-
bergatti zugeordnet; Bode 1886 (wie Anm. 8), S. 206. – Frida Schottmüller, Die italienischen
und spanischen Bildwerke der Renaissance und des Barocks in Marmor, Ton, Holz und Stuck,
Berlin 1913, S. 42. Marquands Zuschreibung fand in der wissenschaftlichen Auseinanderset-
2 Sassetti-Altar, Berlin, Enthauptung des hl. Cosmas, Detail aus der Predella 4 Sassetti-Altar, Berlin, Konturierung des Gesichts Christi in der Glasur und Goldauflagen
3 Sassetti-Altar, Berlin, Gold-Ornamentik am Gewandsaum der Madonna
24 Andreas Huth
fleck liegende Kind wendet sich, die linke Hand am Mund, zum Be-trachter. Im linken Feld ist die Stigmatisation des hl. Franziskus in ber-giger Umgebung zu sehen (Abb. 6), während auf der rechten Seite dieEnthauptung eines Heiligen dargestellt ist (Abb. 2). Diese Szene hält einen Augenblick höchster Dramatik fest; ihr akklamierender Charak-ter wird durch das dem Betrachter zugewandte Knien und die gefalte-ten Hände des Märtyrers noch gesteigert, so als wäre es noch möglich,das Herabfallen des bereits erhobenen Schwertes zu verhindern.
Den oberen Abschluß des Altarretabels bildet ein reichverziertesGebälk mit plastischen, farbig glasierten Lilien- und Rosensträußen inder Frieszone. Es wird von Pilastern mit profilierter Basis und Kompo-sitkapitellen gestützt, deren Schaft mit Rosensträußen bemalt ist. Teileder weiß glasierten Architekturelemente, u.a. die Pilasterbasen, die Ka-pitelle und die Schmuckprofile des Gebälks, sind ebenfalls mit Goldauf-lagen versehen.
Provenienz
Der Altar stammt aus der Villa Francesco Sassettis in Montughi bei Flo-renz, wo er zur Ausstattung der Erdgeschoß-Kapelle gehörte (Abb. 7).Auf Sassettis Auftraggeberschaft verweisen seine beiden Wappen in derPredella; den ursprünglichen Aufstellungsort in der Kapelle der Villabelegen ein Inventareintrag von 1828 (»Nella Cappella a Terreno [...]Un Quadro all’Altare di Terra della Robbia rappresentante la Madon-na.«)11 und eine Beschreibung Guido Caroccis in seinem 1906 in eineraktualisierten Auflage erschienenen Band I dintorni di Firenze.12 Dortschreibt Carocci zur Villa Il Sassetto già il Palagio:
»Il 7 aprile 1460 Francesco di Tommaso Sassetti comprava da Za-nobi ed altri Macinghi il Palagio (...) Piero di Gino Capponi acquis-tava la villa da Teodoro di Francesco Sassetti il 19 ottobre del 1546.(...) La villa appartenne ai Capponi fino alla metà del secolo scorsoed il Marchese Gino, vendendola, fece transportare nell’altra suavilla di Varramista un bel dossale Robbiano che ne adornava la cap-pella.« 13
In Varramista, einem winzigen, ein paar Kilometer abseits der Straßevon Florenz nach Pisa liegenden Ort, besaß die Florentiner Familie
zung mit der Familie Sassetti keine Berücksichtigung; vgl. Paul Wescher, Großkaufleute der
Renaissance, Frankfurt am Main 1941. – Elder de Roover, Florence, Francesco Sassetti and the
Downfall of the Medici House, in: Bulletin of the Business Historical Society, 17/4 (1943),
S. 65–80. – Albinia de la Mare, The Library of Francesco Sassetti, in: Cultural Aspects of the
Italian Renaissance: Essays in Honour of Paul Oskar Kristeller, hrsg. von Cecil H. Clough,
Manchester 1976, S. 160–201. – Amanda Lillie, Francesco Sassetti and his Villa at La Pietra, in:
Oxford, China and Italy – Writings in Honour of Sir Harold Acton on his Eightieth Birthday,
hrsg. von Edward Chaney und Neil Ritchie, Florenz 1984, S. 83–93. – Lillie 2005 (wie Anm. 4).
Zu Wappen in der Predella als üblichster Form familiärer Repräsentation vgl. Susanne Mäd-
ger, Florentiner Predellen von 1400 bis 1530. Form, Inhalt und Funktion, Dissertation Uni-
versität Bonn 2007, Bd. I, S. 181.
11 Archivio Capponi, Patrimonio Vecchio, 53, LIIII. Den zitierten Absatz hat dankenswerter-
weise Amanda Lillie aus ihrer aktuellen (2015) Transkription des Capponi-Inventars von
1828 zu Verfügung gestellt.
12 Guido Carocci, I Dintorni di Firenze, Florenz 1881. – Guido Carocci, I Dintorni di Firenze
(Ed. completamente rinnovata), Florenz 1906–07.
13 Carocci 1906 (wie Anm. 12), S. 183.
14 Die Familie Sassetti hatte keine Besitzungen in und um Varramista; zum Besitz der Sasset-
ti-Familie vgl. Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 159 passim.
15 Im Zusammenhang mit dem 1831 verstorbenen General und Historiker Pietro Colletta
heißt es in Reumonts Biographie: »In der durch ein Terrakotta-Relief der Della Robbia gezier-
ten Kapelle der Villa Varramista ist die Grabstätte des Verbannten.« Alfred von Reumont,
Gino Capponi – Ein Zeit- und Lebensbild, Gotha 1880, S. 151. Reumont war selbst mehrfach
in Varramista und kannte daher die Kapelle aus eigener Anschauung; zu seinen Aufenthalten
in Varramista vgl. ebd., u.a. S. 278, 363, 373, 441.
16 Das Werk wurde der Berliner Sammlung von Stefano Bardini für 105.000 Lire angeboten;
Bode 1997 (wie Anm. 7), Bd. 2, S. 190. Im Briefwechsel Bodes mit Bardini wird der Altar
mehrfach erwähnt; vgl. Valerie Niemeyer-Chini, Stefano Bardini e Wilhelm Bode –mercanti e
connaisseur fra Ottocento e Novecento, Florenz 2009. In seinem Tagebuch schreibt Bode über
den Ankauf: »Andere Erwerbungen, wie die der Marmormadonna von Mino und des schö-
nen Altars des Andrea della Robbia aus Pontremoli konnte ich so weit vorbereiten, daß mir
der Abschluß dieser Käufe (zu 15.000 und 75.000 Mark) im Laufe des Winters gelang.«; Bode
1997 (wie Anm. 7), Bd. I, S. 193.
Capponi einen Landsitz, der sich bis zum Tod des von Carrocci genann-ten italienischen Gelehrten und Politikers Marchese Gino Capponi(1792–1876) in Familienbesitz befand.14 In seiner 1880 erschienenenBiographie Gino Capponis erwähnt dessen Freund und Kollege Alfredvon Reumont die Kapelle der Villa, die »durch ein Terrakotta-Relief derDella Robbia geziert« sei,15 bei dem es sich um den Berliner Altar han-deln muß. Wenige Jahre später wurde der Altar aus der Capponi-Villain Varramista über den Kunsthändler Stefano Bardini an die könig -lichen Sammlungen in Berlin verkauft,16 wo sich wegen dessen unmit-
6 Sassetti-Altar, Berlin, Stigmatisation des hl. Franziskus, Detail aus der Predella5 Sassetti-Altar, Berlin, Anbetung des Kindes, Detail aus der Predella
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 25
telbarer Herkunft die Bezeichnung ›Varramista-Altar‹17 etablierte. Wil-helm von Bodes Stolz auf diese Erwerbung äußerte sich in der 1904 er-folgten Aufstellung des Stücks in der so genannten Basilika des Kaiser-Friedrich-Museums.
Wenngleich Caroccis Nachricht die bislang fehlende Verbindungzwischen dem ursprünglichen Aufstellungsort und dem späteren inVarramista herstellt, so ist doch ein wichtiger Punkt zu korrigieren: Beider erwähnten Villa Il Sassetto già il Palagio handelt es sich nicht um daszu Caroccis Zeit Villa Martini Bernardi-Moniuszko genannte Anwesen,sondern, wie der amerikanische Kunsthistoriker und damalige BesitzerHarold Acton 1948 nachwies,18 um die nahe Villa La Pietra.19 Im Jahr1460 hatte Francesco Sassetti das schon damals als palagio bezeichneteGebäude erworben und es zwischen 1466 und Anfang der 1470er Jahrezur Familienresidenz ausbauen lassen.20 1463 kaufte Francesco Sassettidas benachbarte Anwesen – CaroccisVilla Martini Bernardi-Moniuszko –hinzu.21 Beide Objekte wurden 1545 von Francescos Sohn Teodoro anPiero Capponi verkauft.22 Die Villa La Pietra blieb im Besitz dieser Fa-milie bis der Marchese Gino Capponi 1876 ohne männliche Nachkom-men starb und das Erbe in Montughi an eine Verwandte fiel;23 nach de-ren Familie wiederum hieß das Gebäude Villa Incontri und wurde vonCarocci unter diesem Namen in seinem Buch aufgeführt.24 Das Wissenum die exakte Herkunft des bereits Jahre zuvor aus dieser Villa abtrans-portierten Della-Robbia-Altars war zu diesem Zeitpunkt bereits verlo-rengegangen.
Der Altar ist seit der Wiedereröffnung des Bode-Museums im Jahr2006 an seinem alten Platz in der Basilika aufgestellt. Nach dem Zweiten
17 Gutachten Bode an die Generalverwaltung vom 23.11.1885, Nr. 2629.85, SMB-SPK, ZA,
I/GG 201 und Bode 1997 (wie Anm. 7), Bd. II, S. 190. Allein Bode hatte mit einem rein stilis-
tisch motivierten Hinweis auf Arezzo Nachforschungen zu einem möglichen früheren Aufstel-
lungsort angeregt; Amtliche Berichte 1886 (wie Anm. 7), S. XXXV. In seinem Artikel im Jahr-
buch der Preußischen Museen, in dem er die Neuerwerbung vorstellt, geht Bode auf die Prove-
nienz nicht ein; Bode 1886 (wie Anm. 8), S. 206 ff. Die Bezeichnung als Varramista-Altar u.a.
bei Marcel Reymond, Les Della Robbia, Florenz 1897, S. 204/205. – Maud Cruttwell, Luca and
Andrea della Robbia and their Successors, London/New York 1902, S. 186. – Paul Schubring,
Luca della Robbia und seine Familie, Bielefeld/Leipzig 1905, S. 103. – Schottmüller 1913 (wie
Anm. 10), S. 42. – Oscar Doering-Dachau, Die Künstlerfamilie della Robbia, in: Die Kunst dem
Volke, Nr. 14 (1913), S. 33. – Schubring, Paul, Die italienische Plastik des Quattrocento, Berlin-
Neubabelsberg 1919 (Handbuch der Kunstwissenschaft), S. 89. In Michael Knuths Artikel zum
Altar wird eine »Privatkirche in Varramista (Palaia)« als Provenienz angegeben; die Informati-
onstafel am Objekt selbst nennt eine »Villa Sassetti in Varramista«; Skulpturensammlung im
Bode-Museum, hrsg. von Janet Kempf, Antje-Fee Köllermann und Katharina Christa Schüp-
pel, München u.a. 2006, S. 133.
18 Harold Acton, Memoirs of an Aesthete, London 1948, S. 3.
19 Vgl. Lillie 1984 (wie Anm. 10), S. 86. Caroccis inkorrekte Identifizierung übernimmt Aby
Warburg in dem Glauben, bei der Villa Martini Bernardi-Moniuszko handele es sich um den
in Francesco Sassettis Libro Segreto genannte Landsitz; Warburg 1907 (wie Anm. 2), S. 133,
Anm. 1. – Francesco Sassetti, Libro segreto, Archivio di Stato Firenze (ASF), Carte Strozziane,
Serie II, Nr. 20.
20 Beschreibung der Villa in der Kaufurkunde: ASF, Carte Strozziane, V, 1750, c. 182 des. Zum
Begriff palagio für einen privaten Palast bzw. eine Villa vgl. Isabelle Hyman, Fifteenth Century
Florentine Studies: The Palazzo Medici and a Ledger for the Church of S. Lorenzo, New York,
1977, S. 8–19. Zum Umbau der Villa und dessen Dauer: Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 186/187.
21 Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 180/181.
22 ASF, Notarile antecosimiano 12480, fol. 275 r. – v. In späteren Dokumenten wird das Jahr
1556 genannt. Angaben nach Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 322, Anm. 25.
23 Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 182.
24 Carocci 1906 (wie Anm. 12), S. 185.
7 Villa La Pietra, Florenz, Kapelle im Erdgeschoss
26 Andreas Huth
Weltkrieg war das in seine Einzelteile zerlegte Retabel bis auf drei Stücke in die Sowjetunion verbracht worden, wo es bis zur Rückgabe1957 verblieb.25 Im Anschluß an eine umfassende Restaurierung zu Be-ginn der 1970er Jahre wurde das Werk in der Skulpturensammlung aufder Museumsinsel gezeigt. Die drei im Depot der Skulpturensammlungin Berlin-Dahlem aufbewahrten Teile – zwei Gesimsstücke und eineEngelgruppe – konnten im Zuge der Restaurierung des Altars im Jahr2003/04 wieder in das Werk integriert werden, so daß er heute wiedervollständig zu sehen ist.26 Zur aktuellen Präsentation gehört eine unterEinbeziehung von vermutlich aus Norditalien stammenden Stücken re-konstruierte Altarmensa und eine marmorne Altarschranke.27
Die Kapelle der Sassetti-Villa
Wie sich dem Inventareintrag von 1828 entnehmen läßt, befand sichder Altar ursprünglich in der »Cappella a Terreno« (Abb. 8). Neben dergenannten Kapelle existierte im ersten Obergeschoß ein Oratorium,28
das jedoch wegen seiner geringen Größe als Aufstellungsort für den Al-tar nicht in Betracht kommt. Das ungewöhnliche Vorhandensein zwei-er privater Kapellen bereits zu Sassettis Lebzeiten belegt ein undatierter,wohl Ende 1477/Anfang 147829 in Latein verfaßter Brief Marsilio Fici-nos an Francesco Sassetti, in dem er seinen Freund ausdrücklich für»gemina [sacella]« in seiner »aedes amplissima« lobt.30
»Ut autem ita res existimare possumus, ideoque feliciter vivere,sola nobis potest prestare religio. Praestabit autem id tibi quando-que plus duplo, quam caeteris, mi Francisce, si tantum ipse religio-ne alios superabis, quantum haec tuae aedes amplissimae alias su-perant. Duplo tibi Saxette, religiosor domus est, quam caeteris,
25 Hans Werner Grohn, Report on the Return of Works of Art from the Soviet Union to Ger-
many, in: Burlington-Magazin, 101/671 (1959), S. 56–62. – Feist, Peter, Florentinische Früh -
renaissance-Plastik in den Staatlichen Museen zu Berlin, Leipzig 1959, S. 20 f.
26 Dokumentation 2003/04 (wie Anm. 8), S. 2. Abbildung des Altars im Zustand vor der letz-
ten Restaurierung in: Giancarlo Gentilini, I Della Robbia e l’arte nuova della scultura invetria-
ta, hrsg. von Giancarlo Gentilini [Katalog zur Ausstellung in Fiesole, 29. Mai – 1. November
1998], Florenz 1998, S. 170.
27 Jan Hamann, Die Konservierung und Wiederherstellung von baugebundenen Exponaten
in der Basilika des Bode-Museums, in: Das Bode-Museum. Projekte und Restaurierungen,
hrsg. von Dieter Köcher und Bodo Buczynski, Berlin 2011, S. 70–81.
28 Vgl. Philipp Emerson Mattox, The Domestic Chapel in Renaissance Florence, 1400–1550,
(Diss.), Yale University 1996, S. 187–194. – Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 216–219. – Lillie,
Amanda: The patronage of villa chapels and oratories near Florence: a typology of private
religion, in: With an Without the Medici – Studies in Tuscan Art and Patronage 1434–1530,
hrsg. von Eckart Marchand und Alison Wright, Aldershot (u.a.) 1998, S. 19–46, S. 29. Das
Ora torium ist durch einen Vertrag zwischen Francesco Sassettis Söhnen Galeazzo, Cosimo
und Teodoro von 1499 zu identifizieren. Eine Raumfolge auf der Ostseite des Gebäudes wird
dort wie folgt beschrieben: »camera in su quella e l’anticamera et oratorio che si chiama la ca-
mera di Francesco«. Der Vertrag ist in einer Kopie von 1522 erhalten: ASF Notarile anticosi-
miano 12482, Testamenti (Ser Pierfrancesco Maccari, 1509–45), fol. 449 r.-453 v; abgedruckt
in: Lillie 2005 (wie Anm. 4), Appendix C, S. 285–287.
29 Datierung nach: Paul Oskar Kristeller, Supplementum Ficinianum, Florenz 1937, Bd. 1,
S. ci.
30 Marsilo Ficino, Opera Omnia, I, Abschnitt 2, Buch V, S. 799-800. Der Brieftext zu den Ka-
pellen findet sich im Original und in Übersetzung in Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 327, Anm. 50
und bei Warburg 1907 (wie Anm. 2), S. 139. Während Warburg die zwei Kapellen nur allge-
mein als »Hauskapellen« bezeichnet, bezieht André Chastel Ficinos Text auf Montughi;
André Chastel, Art et Humanisme a Florence au temps de Laurent le Magnifique, Paris 1959,
S. 170–171, S. 170 und 171. –Warburg 1907 (wie Anm. 2), S. 139 und Anm. 2. Unter Berufung
auf Warburg bringt Martin Wackernagel den Text mit dem Stadtpalast Sassettis in Verbin-
dung; Martin Wackernagel, Der Lebensraum des Künstlers in der Florentinischen Renais-
sance, Leipzig 1938, S. 272. Die Existenz zweier im Gebäude liegender Kapellen war selten,
findet sich aber in ähnlicher Konstellation auch in der Medici-Villa in Cafaggiolo und im Pa-
lazzo Medici in Florenz. Die zwei Kapellen in der Sassetti-Villa sind jedoch das früheste be-
kannte Beispiel; Lillie 1998 (wie Anm. 28), S. 29.
31 Zit. nach Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 327, Anm. 50.
32 Dort heißt es: »per havere cavato dua licenzie dal Arcivescovo di Firenze di potere fare ce-
lebrare la messa nella capelle di Firenze e di Montui«, Biblioteca Nazionale Firenze (BNF),
Capponi 91, fol. 75, zit. nach: Lillie 1998 (wie Anm. 28), Anm. 56.
33 Wolfger A. Bulst, Die ursprüngliche innere Aufteilung des Palazzo Medici in Florenz, in:
Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz, 14/4 (1970); S. 382–385. Brenda
Preyer geht auf die besondere Rolle von Kapellen als Empfangsräume nicht ein; Brenda Prey-
er, Planning for visitors, in: Renaissance Studies, 12/3 (1998), S. 357–374. In den römischen
Palästen hatten die Kapellen gleichfalls repräsentative Funktion; vgl. Christoph Luitpold
Frommel, Der römische Palastbau der Hochrenaissance (Römische Forschungen der Biblio-
theca Hertziana, 21), Tübingen 1973, Bd. I, S. 74 f.
aliae certe sacellum vix unum habent, tua vero gemina et illa qui-dem speciosissima continet. Vivem [sic, eigentlich vive] religiosorduplo, quam caeteri, mi Francisce vale duplo felicior.«31
Rückschlüsse auf die jeweilige Nutzung lassen sich lediglich durch ihreLage ziehen, sieht man von einer erzbischöflichen Lizenz für Meßfeiernaus dem Jahr 1615 ab, die sich höchstwahrscheinlich auf die Erdge-schoß-Kapelle bezieht.32 Diese wird aber nicht nur ein sakraler, son-dern auch und vor allem ein Repräsentationsraum gewesen sein, indemder Hausherr seine Gäste empfing bevor er sie ins Gebäudeinnere führ-te. Der Zugang zur Kapelle direkt neben dem Haupteingang der Villaspricht ebenso für eine solche Funktion wie eine vergleichbare, für denPalazzo Medici belegte Praxis.33 Das kleine, an die Folge der privatencamere Francesco Sassettis anschließende Oratorium war wohl dagegenausschließlich dem pater familias bzw. engen Angehörigen vorbehalten;Nutzung und Funktion der beiden Kapellen unterschieden sich also.
8 Villa La Pietra, Florenz, Grundrißplan mit den Bezeichnungen der Räume in den Inventa-
ren von 1657 (Blau) und 1828 (Rot) (Amanda Lillie, Zeichnung: Steve Allan)
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 27
Die Aufgaben einer im Erdgeschoß liegenden Kapelle beschreibt LeonBattista Alberti im fünften Buch seines zu Beginn der 1450er Jahre ent-standenen Architekturtraktats:
»Aderitque primario obtutu religioni dicatum sacrarium cum arapropalam, quo loci ingressus hospes religionem ineat amiciciae, etdomum pater familias repetens, pacem a superis et suorum tran-quillitatem poscat: istoc salutantes amplexabitur; si qua erunt arbi-tria, de consilio pensitabit amicorum, et istiusmodi.«34
Im Mittelpunkt steht bei Alberti die Rolle der Kapelle als Empfangs-raum, der sakrale Aspekt tritt dahinter deutlich zurück, der Altar dientgar in vage antiker Tradition der »religio amiciciae«,35 was in Bezug aufden Berliner Altar noch von Interesse ist.
Die Einrichtung einer von außen zugänglichen Kapelle im Erdge-schoß der Villa ist möglicherweise in Zusammenführung zweier Kapel-lentypen – der externen Villenkapelle (wie beim Castello del Trebbioder Medici)36 und der Hauskapelle (wie in vielen Florentiner Palazzi)37
– entstanden.38 Unabhängig davon sind allein ihr Vorhandensein undihre exponierte Lage ein demonstratives Bekenntnis des Hausherrn zurchristlichen pietas. Die Rolle der Kapelle für die familiäre Repräsenta -tion wird weiter unten noch näher zu beleuchten sein. Ihre besondereBedeutung für die famiglia bestätigt jedoch deren Nutzung nach Fran-cesco Sassettis Tod: Während der übrige Palast, das private Oratoriumim Obergeschoß eingeschlossen, unter den Söhnen aufgeteilt wurde,blieb die Kapelle im Erdgeschoß gemeinsam genutztes Eigentum.39
Die Kapelle besteht aus einem etwas unregelmäßigen, aber annäh -ernd rechteckigen, etwa sieben Meter langen und ca. dreieinhalb Meterbreiten Raum.40 Er ist von außen durch eine links neben dem Haupt-eingang der Villa befindliche Tür zu betreten; eine weitere, wahrschein-lich jüngere Türöffnung verbindet die Kapelle mit einem heute als por-tineria genutzten Nachbarraum.41 Der Raum hat keine Fenster.42 Diezwei hintereinander angeordneten Joche des Raumes werden von Kreuz -gratgewölben überfangen. Die Wände sind durch Lisenen und ein pro-filiertes Gesims gegliedert; das östliche Joch ist als Altarbereich durcheine aufwendigere Gestaltung mit Altar-Mensa, differenzierteren Putz-flächen und Vergoldungen an Wänden und Decke abgesetzt. Unter halbder Mensa erinnert eine Weihinschrift an die Renovierung der Kapelleim Jahr 1723, was eine Datierung der Stuckarbeiten erlaubt.43 Baude-tails aus dem Quattrocento44 sind hier im Unterschied zu anderen Räu-men der Villa nicht sichtbar, wenngleich die Grundform des Raumseinschließlich des Gewölbes weitgehend unverändert zu sein scheint.45
Da der Altar noch 1828 im Inventar als Teil der Raumausstattungin der Erdgeschoß-Kapelle aufgeführt ist, ist anzunehmen, daß die aufden Umbau von 1723 zurückgehende Gestaltung der Kapelle zumin-dest auf der Ostseite des Raumes auf den Altar Bezug nahm. Die heuteetwas unbeholfen wirkende Anordnung der seitlichen Putzfelder mitihrem breiten Abstand in Gesimshöhe läßt sich mit der Berücksichti-gung der hohen Gebälkzone des Altars erklären; aus dem gleichenGrund setzt sich das Gesims auf der Ostwand nicht fort. Die Vergol-dungen von Teilen des Gesimses und der Rahmungen an Wänden undDecken greifen dezidiert die Kombination aus weißen Architekturglie-dern und den goldenen Akzentuierungen des Altars auf. Das mittlere,über dem doppelten Postament auf der Mensa befindliche Feld wird al-lerdings erst nach dem Mitte des 19. Jahrhunderts erfolgten Abtrans-port des Altars an die übrige Wandgestaltung angepaßt worden sein.
Anders als heute in der Basilika des Bode-Museums muß der Altarin der kleinen Kapelle sehr imposant gewirkt haben. Das über der Altar-mensa angebrachte Werk überragte die Köpfe der Gläubigen; die thro-nende Madonna und die beiden Heiligen konnten wegen der geringenGröße des Raumes nur in nobilitierender Untersicht wahrgenommenwerden. Gleichzeitig erzeugte das in der fensterlosen Kapelle notwendi-ge Kerzenlicht auf der glänzenden Oberfläche der glasierten und mitgoldenen Verzierungen versehenen Oberfläche der Terrakotta zahllosefeine und bewegliche Reflexe – eine effektvolle Inszenierung, die diebildrhetorische Funktion der Darstellung unterstützte. In seiner Dispo-sition erinnert dies an die etwa ein Jahrzehnt zuvor fertiggestellte, eben-falls quasi fensterlose Kapelle des Palazzo Medici mit Fra Filippo Lippis
34 Zit. nach: Leon Battista Alberti, L’architettura/De re aedificatoria, hrsg. von Giovanni Or-
landi und Paolo Portoghesi, Mailand, 1966, Libro V, Cap. XVII, S. 419; in Giovanni Orlandis
Übertragung: »Seguirà, ben visible anche a una prima occhiata, una cappella dedicata al culto
divino, con un altare: quivi forestieri verranno introdotti al culto dell’amicizia; quivi il capo-
famiglia, tornando nella propria dimora, si offermerà ad invocare dagli dei pace e serenità per
la famiglia; quivi abbracerà i convenuti per fargli visita, e si consulterà con gli amici in merito
a decisioni da prendersi e ad altre questioni«; ebd. S. 418. Cosimo Bartoli übersetzt die Passa-
ge etwas abweichend: »Et nel primo risco[n]tro siaui un luogo dedicato a Dio con l’altare, ac-
cio chè i forestieri che verranno incomincino l’amicitia co[n] la religione.«; Leon Battista Al-
berti, L’architettura, übers. von Cosimo Bartoli, Florenz 1550, S. 153. An Bartoli wiederum
orientiert sich Mattox’ Übersetzung ins Englische; Mattox 1996 (wie Anm. 28), S. 309.
35 Bulst verweist auf eine entsprechende Cicero-Stelle; Bulst 1970 (wie Anm. 33), S. 384. In
Albertis Bemerkung spiegelt sich, wenn auch nicht als unmittelbares Zitat faßbar, die ihm aus
den antiken Schriften gewiß bekannte Wertschätzung von Männerfreundschaften bzw. von
Gastfreundschaft.
36 Vgl. Lillie 1998 (wie Anm. 28), S. 24.
37 Zur Palastkapelle grundlegend Mattox 1996 (wie Anm. 28).
38 Die Kapelle könnte allerdings schon im Vorgängerbau der Macinghi existiert und nur ihr
Patrozinium verändert haben; vgl. Lillie 1998 (wie Anm. 28), S. 22 ff.
39 Dies zumindest kann aus der Nichterwähnung der Kapelle im Teilungsdokument von
1499 geschlossen werden; Lillie 2005 (wie Anm. 4), Appendix C, S. 285–287.
40 Zur Lokalisierung der Kapelle sei noch auf einen von Giorgio Vasari d. J. stammenden
Plan des Erdgeschosses der Villa, etwa um 1600 entstanden, verwiesen. Er zeigt die Kapelle in
der Nord-West-Ecke des Gebäudes, während sie heute einen Raum weiter südlich liegt. Da,
wie Amanda Lillie ausführt, Vasari d. J. auch in vielen anderen Details des Plans ungenaue
bzw. sogar nachweislich falsche Angaben macht, ist anzunehmen, daß sich die Kapelle immer
noch an ihrem ursprünglichen Platz befindet; Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 188. Plan Vasari
d. J.: Uffizien, Gabinetto Disegni e Stampe 4914, abgebildet in: Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 189
und S. 216. Auch ein Inventar der Familie Capponi von 1828 belegt die Kapelle an ihrem aktu-
ellen Platz; Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 216 und 324, Anm. 104. Capponi-Inventar: Archivio
Capponi, Patrimonio Vecchio, 53, LIII.
41 Zur Nutzung und Gestalt des Raums zur Zeit der 1499 erfolgten Aufteilung der Villa vgl.
Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 194.
42 Ob das heute vorhandene Oberlicht über der Tür schon Teil der Sassetti-Gestaltung war,
ist unbekannt.
43 Der Text der Widmungsinschrift lautet vollständig: D.O.M./SCIPIO MARIA CAPPO -
NIUS/ALEXANDRI MARCHONIS F./AVITUM SACELLUM INSTAURATUM/D./ANN.
M.D.CC.XXIII.
44 Zu den erhaltenen Baudetails, zum Teil mit Sassetti-Wappen und Impresen: Acton 1948
(wie Anm. 18), S. 4 und 5. – Harold Acton, Tuscan Villas, London 1973, S. 143. – Lillie 2005
(wie Anm. 4), S. 199–219 und 220–240.
45 Eine restauratorische Untersuchung könnte analog zu den Sgraffito-Dekorationen im
ehemaligen Innenhof unter den späteren Putzen Hinweise auf die ursprüngliche Gestaltung
zutage fördern, müßte hierzu aber in den barocken Bestand eingreifen. Zu den Sgraffito-De-
korationen siehe Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 202 und 228. – Andreas Huth, Grauer Putz, sil-
berne Fassade. Zur Rolle der Kunst in den Sgraffito-Dekorationen des Florentiner Quattro-
cento, in: Die Farbe Grau, hrsg. von Magdalena Bushart und Gregor Wedekind, Berlin 2015
(im Erscheinen).
28 Andreas Huth
Altarbild »Anbetung im Walde« (1458/59),46 dessen zentrale Gruppeim mittleren Predellenbild von Andrea della Robbias Alter wiederzuer-kennen ist.47 Auf Lippis Tafel verleihen feine goldene Strahlen, Flämm-chen, Sterne und Punkte der Waldszene einen mystischen Glanz undtragen gleichzeitig zur Pracht des reich dekorierten Raumes bei. Einevergleichbare Wirkung ist, trotz bescheidenerer Ausstattung, auch fürdie Francesco Sassettis Kapelle anzunehmen, lobt sie doch Marsilio Ficino gemeinsam mit dem Oratorium im Obergeschoß ebenfalls als»höchst prachtvoll« (»speciosissima«).48
Ikonographie
Auf dem Altar stehen neben der Madonna zwei Männer, deren Identifi-zierung für jede weitere Interpretation des Werks entscheidend ist. Derauf der linken Seite befindliche Heilige (Abb. 9) ist durch seine Kutteund die Wundmale unschwer als Franziskus zu identifizieren. Mit derKlärung der Herkunft des Altars aus Francesco Sassettis Villa in Mon-tughi ist gesichert, daß es sich bei ihm um den Namenspatron des Auf-traggebers handelt. Die Stigmatisation des Heiligen am Berg von LaVerna ist unterhalb der Figur in der Predella (Abb. 6) dargestellt: DerHeilige empfängt durch ein von sechs Seraphenflügeln getragenes Kru-zifix die Wundmale, die ihn als Nachfolger Christi auszeichnen; sein Be-
46 Zur Kapelle vgl. La Cappella del Palazzo Medici, hrsg. von Cristina Acidini Luchinat, Mai-
land 1993; zu Fra Filippos ‚Anbetung im Walde‘ vgl. u.a. Anja Brug, Fra Filippo Lippi: Maria
das Kind verehrend - Anbetung im Walde (Der Berliner Kunstbrief), hrsg. von Till Meinert,
Berlin 2001. – Jeffrey Ruda, Fra Filippo Lippi. Life and Work, London (u.a.) 1993, S. 224–230.
47 Eine noch genauere Adaption dieses Motivs findet sich auch in Andrea della Robbias Re-
tabel mit der ›Anbetung des Kindes‹ (ca. 1475–1480) in La Verna; vgl. Ruda 1993 (wie Anm.
46), S. 228, Abb. S. 231. Bezüge zur zeitgenössischen Malerei und vor allem dem Werk Filippo
Lippis sind im Œuvre der Della-Robbia-Werkstatt häufiger zu finden; vgl. Andrea De Marchi,
»Ancora che l’arte fusse diversa«, in: Gentilini 1998 (wie Anm. 26), S. 17–30.
48 Vgl. Anm. 30.
49 Vgl. Mädger 2007 (wie Anm. 10), S. 91.
50 Rohlmann 2003 (wie Anm. 3), S. 184.
51 LCI, hrsg. von Wolfgang Braunfels, Bd. 7 – Ikonographie der Heiligen, Rom (u.a.) 1974,
Kosmas und Damian, S. 337. – Marie-Louise David-Danel, Iconografie des Saint médecins
Côme et Damien, Lille 1958, S. 71 ff.
52 Vor allem für Cosimo il Vecchio spielten die beiden Heiligen eine wichtige Rolle. Cosimo
war laut Machiavelli im Jahr 1389 am Tag der hll. Cosmas und Damian (27. September) gebo-
ren worden; Niccolò Machiavelli, Opere, hrsg. von Mario Bonfantini, Mailand/Neapel 1963,
Bd. III: Istorie fiorentine, 7. Buch, Kap. 7, S. 882. 1429 stifteten Cosimo und Lorenzo de’ Medi-
ci Geld für ein Fest zu Ehren der Familienheiligen in San Lorenzo; Ilaria Ciseri, Scenari festivi
a San Lorenzo. Apparati, cerimonie, spettacoli, in: San Lorenzo. I documenti e i tesori nascos-
ti [Katalog zur Ausstellung im Complesso di San Lorenzo, Florenz: 25.9.–12.12.1993], hrsg.
von Marco Assirelli, Venedig 1993, S. 75, Kat.-Nr. 2.16. Bereits 1427 entstand im Auftrag Cosi-
mos für den Florentiner Dom ein Altarretabel, dessen Gemälde von Lorenzo di Bicci geschaf-
fen wurde. Es zeigt die beiden Heiligen als Ärzte mit Arzneidosen und Pinzetten; in der Pre-
della sind die Bein-Operation und die Enthauptung der Heiligen dargestellt; vgl. David-Da-
nel 1958 (wie Anm. 51), passim.
gleiter schirmt angesichts der Erscheinung erschrocken mit seiner rech-ten Hand die Augen ab. Dieses Ereignis aus der Franziskus-Legende istin Florentiner Predellen das mit Abstand am Häufigsten dargestellte;49
deshalb steht es hier als Chiffre für die besondere Heiligkeit des Ordens-gründers, dessen christiformitas und Auszeichnung durch Gott. Fran-cesco Sassetti bekennt sich auf diese Weise zur franziskanischen Demutim Glauben, ein Bekenntnis, das nicht im Widerspruch zur Pracht sei-nes Palastes und zu seinen Geldgeschäften steht, sondern im Gegenteilsein weltliches Handeln rechtfertigt. Da die Stigmatisation, wie MichaelRohlmann im Zusammenhang mit der Ausmalung der Sassetti-Kapellein S. Trinita dargelegt hat,50 in seiner Bedeutung dem Leiden andererHeiliger im Martyrium entspricht, korrespondiert das Bildfeld nichtnur formal durch seine Anordnung, sondern auch in seinem ikonogra-phischen Gehalt mit der Martyriumsdarstellung auf der rechten Pre-della-Seite.
Der hl. Cosmas
Schwieriger gestaltet sich die Identifizierung des auf der rechten Seitestehenden Heiligen (Abb. 10). Er wird als bärtiger Mann mit bis auf denNacken herab reichendem lockigen Haar gezeigt; über seinem langenGewand trägt er einen Mantel. In seinen Händen hält der Heilige einenschmalen grünen Palmzweig als Märtyrerzeichen und eine kleine Arz-neidose. Diese Attribute entsprechen der üblichen Ikonographie derbeiden Ärzte-Heiligen Cosmas und Damian.51 Deren Verehrung war inFlorenz erst wenige Jahrzehnte zuvor von Giovanni di Bicci, der die hei-ligen medici zu den Namenspatronen seiner Familie erwählte, etabliertworden,52 weshalb keine lokale Bildtradition, die eine bestimmte Dar-
9 Sassetti-Altar, Berlin, hl. Franziskus
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 29
stellung der beiden Heiligen erforderte, existierte. Etwa ab der Mitte des15. Jahrhunderts, konkret seit der Pala di San Marco von Fra Angelico(um 1440) begann sich für die Medici-Heiligen ein fester Darstellungs-typus durchzusetzen. Cosmas wird nun meist mit Bart und langem Lockenhaar und etwas älter als Damian gezeigt,53 was die Annahme er-laubt, daß es sich bei der rechten Figur im Berliner Altar um den hl.Cosmas handelt.54 Allerdings werden die Heiligen fast ausnahmslos ge-meinsam dargestellt, weshalb die Abweichung vom üblichen ikonogra-phischen Schema nach einer Begründung verlangt. Neben dem Altardes Bode-Museums findet sich in der Florentiner Kunst nur ein weite-res Bild, in dem Cosmas ohne seinen Mitheiligen Damian auftritt. Eshandelt sich hierbei um das Fresko (Abb. 11) im Vorraum zu Cosimode’ Medicis Zelle im Laien-Dormitorium von San Marco, das ein Mitar-beiter Fra Angelicos um 1450 schuf.55 Es zeigt neben dem hl. Cosmasdie Gottesmutter, den Evangelisten Johannes und Petrus Martyr unterdem Kreuz kniend. Die Rolle des hl. Cosmas, Cosimos Namensheiligen,als Stellvertreter und Fürbitter des prominenten Zellenbewohners istunübersehbar.
Da es sich also bei dem Heiligen mit einiger Wahrscheinlichkeit umden hl. Cosmas handelt, stellt sich die Frage, ob er wie der hl. Franziskusals Namensheiliger auf eine konkrete Person verweist. Im Zuge der kor-rekten Identifizierung der Wappen schlug Allan Marquand bereits 1919vor, die Heiligen als »the patronymic saints of Francesco Sassetti and of
his son Cosimo« anzusprechen und vermutete wegen der zeitlichen Ko-inzidenz und der Geburtsszene in der Predella die Geburt Cosimo Sas-settis im Jahr 1465 als Anlaß für die Beauftragung des Altars.56 Aller-dings entspricht die Anbetung im Zentrum der Predella einem imQuattrocento sehr oft anzutreffenden Typus: Nach dem Schmerzens-mann ist die Anbetung das häufigste im Mittelteil von Predellen gezeig-te Bildmotiv.57 Die Darstellung ist dementsprechend nicht als Geburts-bild zu lesen, sondern eher als konventionelles Inkarnationsbild, dasallgemein auf das Wunder der Fleischwerdung des Gottesworts und
53 So z. B. in Filippo Lippis Pala del Noviziato (1445, Florenz, Uffizien), auf der die beiden
durch Inschriften identifizierten Heiligen zu seiten der Madonna mit Kind stehen. An den
Außenseiten sind Franziskus und der hl. Antonius von Padua zu sehen; Pesellinos Predella
zeigt u.a. eine Stigmatisierung des hl. Franziskus, die Anbetung des Kindes und die Enthaup-
tung von Cosmas und Damian.
54 Maud Cruttwell sah in dieser Figur den hl. Giuliano, Cruttwell 1902 (wie Anm. 17),
S. 186–187, S. 226–227. Trotzdem Francesco Sassetti wegen seiner Tätigkeit für die Medici-
Bank in Lyon gewiß die beiden wichtigsten, mit dem Kult des französischen Heiligen verbun-
denen Pilgerstätten in der Nähe der Stadt Lyon kannte, ist wegen deutlicher ikonographischer
Unterschiede diese Identifizierung unwahrscheinlich.
55 William Hood, Fra Angelico at San Marco, New Haven/London 1993, S. 248 f.
56 Marquand 1919 (wie Anm. 10), S. 14–15.
57 Mädger 2007 (wie Anm. 10), S. 183.
10 Sassetti-Altar, Berlin, hl. Cosmas 11 Fra Angelico-Werkstatt, Kruzifix mit Heiligen, Fresko, um 1440, Vorraum zur Zelle Cosi-
mo de’ Medicis im Laien-Dormitorium von S. Marco, Florenz
30 Andreas Huth
konkret auf die Transubstantiation während der Meßfeier verweist.Statt in dem eindeutig der Madonna zugeordneten Predellenbild ist einErklärungsansatz in der Darstellung unterhalb der Figur des hl. Cosmaszu suchen. Sie zeigt die Enthauptung des Heiligen während der Chris-tenverfolgungen unter Kaiser Diokletian; allerdings fehlen auch hierder hl. Damian bzw. weitere Leidensgenossen.58 Die Darstellung des To-des des Namensheiligen auf einem anläßlich der Geburt beauftragtenAltars ist wenig wahrscheinlich; eher als Cosimo Sassettis Geburt istwohl Cosimo Il Vecchios Tod mit dem Predellenbild zu verbinden.Dementsprechend stehen sich auf dem Altar nicht die Patrone von Vater und Sohn gegenüber, sondern die des erfolgreichen Bankiers(und Medici-Kompagnons) Francesco Sassetti und seines prominentenFreundes und Förderers Cosimo il Vecchio. Es handelt sich hierbei alsoum einen Altar, der in gewisser Weise tatsächlich Leon Battista AlbertisVorstellung einer »religio amiciciae« entsprach.59 Darüber hinaus wur-
58 Vgl. Predella-Bilder mit der Enthauptung von Cosmas und Damian (und weiteren Märty-
rern) auf mit den Medici verbundenen Tafeln: Pala d’Annalena und Pala di San Marco, Museo
di San Marco, Florenz; Pala del Noviziato, Uffizien, Florenz.
59 Vgl. Anm. 33 und 34.
60 Der Altar befand sich bis 1812 in der Badia, dann ging er in den Besitz der Misericordia in
de so die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Männernsowohl den Familienangehörigen als auch den in der Kapelle empfan-genen Gästen in konzentrierter Form in Erinnerung gehalten.
Francesco Sassetti und die Medici
Eine auf die Medici bezogene Interpretation stützt ein anderes, eben-falls von Francesco Sassetti bei Andrea della Robbia in Auftrag gegebe-nes Werk: der so genannte ›Misericordia-Altar‹ (Abb. 12).60 Er wurde,
12 Andrea della Robbia, Sassetti-Altar für die Cappella Sassetti in der Badia Fiesolana, glasierte Terrakotta, um 1466,
217×180 cm, Museo dell’ Arciconfraternità della Misericordia, Florenz
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 31
wie ein Eintrag in seinem Libro segreto vermuten läßt,61 1466 für die aufCosimo Il Vecchios Anregung neu gestaltete Badia Fiesolana bestelltund zeigt eine von Cosmas und Damian begleitete Madonna mit Kindin einer Mandorla aus Cherubim.62 Gerahmt wird die Darstellung voneiner Pilasterordnung, die hier erstmals bei Andrea della Robbia bei ei-nem Altarretabel in Form einer tavola quadrata all’antica zur Anwen-dung kommt.
Es ist naheliegend, daß sich in der Darstellung der beiden Heiligendie Verehrung Francesco Sassettis für die Medici manifestiert, denn sei-ne Karriere war eng mit der führenden Florentiner Familie verknüpft.Seit seinem 19. Lebensjahr hatte Francesco mit Erfolg für die Medici-Banken in Genf, Lyon und Avignon gearbeitet und war 1458 mit 38 Jah-ren nach Florenz zurückgekehrt.63 Dort heiratete er und stieg dank seines engen Kontakts zu Cosimo innerhalb weniger Jahre zu einer dereinflußreichsten Persönlichkeiten der Stadt auf.64 Francesco Sassetti ver-dankte Cosimo aber nicht nur Ansehen und Reichtum, sondern war ihmoffenbar auch freundschaftlich verbunden; Cosimos Tod am 1. August1464 war für ihn deshalb ein schwerer Schlag. Zur privaten Betroffenheitkam in den folgenden Jahren die Sorge vor einem politischen Umsturz.Der Tod des in antiker Tradition als pater patriae65 gerühmten Stadt-herrn hatte die gesamte Anhängerschaft der Medici in große Unruheversetzt. Cosimos ältestem Sohn und Nachfolger Piero trauten selbst dieMedici-Gefolgsleute nicht zu, daß er die Vorrangstellung ihrer Partei inFlorenz gegen die Ambitionen ihrer Gegner verteidigen könne,66 zudemstarb Piero bereits 1469. Um so mehr mußte Cosimo il Vecchio in einerArt spätrepublikanischer Apotheose zu einem Ideal werden,67 dessenVerehrung nicht nur eine öffentliche Aufgabe, sondern vor allem fürFrancesco Sassetti auch ein individueller Loyalitätsbeweis war.68 Er hattealso durchaus Grund, die bereits in der Ikonographie etablierte Identifi-zierung der Medici mit den beiden Ärzte-Heiligen für den privaten Altarin seiner Villa aufzugreifen und, ähnlich wie in S. Marco, auf CosimosPerson zuzuspitzen. Die Huldigung galt hier folglich weniger der Medi-ci-Familie insgesamt, sondern eher ihrem für Francesco Sassetti wich-tigsten Mitglied. Die gleiche Intention liegt der – früheren – Entschei-dung zugrunde, seinen am 2. März 1465 geborenen Sohn nach dem nurwenige Monate zuvor verstorbenen Cosimo zu benennen.69
Datierung
Entstehung und Aufstellung des Altars lassen sich auf einen engen Zeit-raum um 1470 eingrenzen. Zu dieser Zeit standen die Umbauarbeitenan der Villa kurz vor ihrem Abschluß und es gibt wenig Grund anzu-nehmen, daß die Ausstattung der Kapelle mit einem Retabel erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt ist. Zudem reflektiert das Bildpro-gramm, wie beschrieben, noch den Tod Cosimo il Vecchios und dieHochzeit seiner posthumen Verehrung. Im Dezember 1469 war Fran-cesco Sassetti zum Leiter des gesamten Medici-Bankhauses ernanntworden; sein Status hatte sich also noch einmal deutlich verbessert. Inseinem Libro segreto, in dem die finanziellen Aufwendungen von 1462bis 1469 vermerkt sind, findet sich allerdings kein Hinweis auf einen Altarauftrag, so daß hieraus ein – wenngleich nicht sehr sicherer – ter-minus post quem abzuleiten ist.70
Weitere Eckdaten lassen sich aus der Einordnung des Altars insŒuvre Andrea della Robbias gewinnen. Der Künstler hatte seine Aus-
bildung in der Werkstatt seines Onkels Luca erfahren und 1471 nachdessen Rückzug aus dem Geschäft die Leitung übernommen.71 Die ers-te dokumentarisch belegte und erhaltene Arbeit ist die so genannte Ma-donna degli Architetti von 1475 (Abb. 13);72 deren Madonnenmotivdem des Berliner Altars eng verwandt ist. Das wegen seiner anrühren-den Intimität und Natürlichkeit erfolgreiche und oft variierte Motivhatte Luca della Robbia bereits 1455 in der so genannten Madonna Bliss(Metropolitan Museum, New York) entwickelt,73 Andrea nutzte es inden folgenden Jahrzehnten weiter. Weitere, vor der Madonna degli Ar-chitetti entstandene Arbeiten lassen sich aufgrund stilistischer Eigen-
Florenz über. Er befindet sich heute im Museo dell’ Arciconfraternità della Misericordia; La
Misericordia di Firenze. Archivio e raccolta d’arte, hrsg. von M. Bietti-Favi, G. Gentilini und F.
Niccolai, Florenz 1981, Katalog von Giancarlo Gentilini, Kat. Nr. 39, S. 228–231.
61 In Sassettis Libro Segreto ist für den 8. November 1466 eine Ausgabe von 200 Florin ver-
zeichnet: »E’ ragionò avere debito per la cappella della Badia fiorini – 200«, wobei unklar
bleibt, ob mit der Summe der Preis des Altarretabels oder die mit dem Patronatsrecht verbun-
denen Kosten gemeint sind; zit. nach Warburg 1907 (wie Anm. 2), S. 134. Zur Diskussion um
die Datierung Bietti-Favi/Gentilini/Nicolai 1981 (wie Anm. 60), S. 228–231, Anm. 39.
62 Das unter Cosimo il Vecchio begonnene Projekt führte nach dessen Tod sein Sohn Piero
de’ Medici zu Ende; der Architekt ist nicht mit Sicherheit zu identifizieren; Isabelle Hyman,
Antonio di Manetto Ciaccheri and the Badia Fiesolana, in: Architectura, 25 (1995), S. 181–
193. – Amadeo Beluzzi, La Badia Fiesolana, in: Filippo Brunelleschi. Le sue opere e il suo tem-
po (Atti del Convegno Internazionale di Studi Brunelleschiani, Firenze, 16–22 ottobre 1977),
Bd. II, Florenz 1980, S. 495–502. – Ugo Procacci, Cosimo de’ Medici e la costruzione della
Badia Fiesolana, in: Commentari, N.S. 19 (1968), S. 80–97. Zu der Ausstattung der Seiten -
kapellen vgl. Paula Nuttall, The patrons of chapels at the Badia of Fiesole, in: Studia di storia
dell’arte, 3 (1992), S. 97–112.
63 Vgl. Wescher 1941 (wie Anm. 10), S. 51; Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 181.
64 Die Heirat ist in der Gabella-Liste (BNF, A 110-1459-129) dokumentiert; Warburg 1907
(wie Anm. 2), S. 131, Anm. 4.
65 Den Titel pater patriae hatte die Stadt Cosimo am 16. März 1465 (bzw., wie Matthias Win-
ner meint, bereits am 20. August 1464) verliehen, weil Cosimo »cum summa atque amplissi-
ma beneficia in rem publicam florentinam bello et pace contulerit, semperque patriam suam
omni pietate conservaverit, adiuverit, auxerit eique magno usui et glorie fuerit, atque usque
ad supremum virum ac civem optimum decent, non secus ac pater familias propriam do-
mum omni cura, studio, diligentiaque gubernarit pro eius maximis virtutibus beneficia et
pietas«; Archivio di Stato di Firenze, Provvisioni, Registri, 155, cc. 261v-263v; Angaben nach
Dale Kent, Cosimo de’ Medici, DBI, Bd. 73, 2009. Zum Datum der Verleihung: Karla Lange-
dijk, The Portraits of the Medici, Florenz 1981–1987, Bd. I (1981), S. 15–16. – Matthias Win-
ner, Cosimo il Vecchio als Cicero. Humanistisches in Franciabigios Fresko zu Poggio a Caiano,
in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 33 (1970), S. 261–297, hier S. 273 und 293, Anm. 58.
66 Machiavelli 1521/1963 (wie Anm. 52), Bd. III, 7. Buch, Kap. 7, S. 884.
67 In diesem Zusammenhang ist auch die Bestattung Cosimos in der Florentiner Kirche San
Lorenzo in einem sonst Heiligen vorbehaltenen Bereich unterhalb des Hauptaltars zu sehen.
Das Grab wurde mit der Inschrift ›Vater des Vaterlands‹ versehen, vgl. hierzu Machiavelli
1521/1963 (wie Anm. 52), 7. Buch, Kap. 7, S. 885.
68 Sandro Botticellis etwa zeitgleich entstandenes Bildnis eines jungen Mannes mit Cosimo-
Medaille (zwischen 1469–1475, Florenz, Uffizien) ist wie die Medaille selbst Ausdruck der
posthumen Verehrung Cosimos de’ Medicis; vgl. hierzu u.a. Frank Zöllner, Botticelli, Mün-
chen 2009, Kat.-Nr. 22, S. 196 f. – Hans Körner, Botticelli, Köln 2006, S. 75–76. – Ronald W.
Lightbown, Sandro Botticelli. Leben und Werk, München 1989, S. 54–56.
69 Giovanni Rucellais 1468 geborener Enkel wurde ebenfalls nach Cosimo il Vecchio be-
nannt: »per memoria di Chosimo di Govanni de’ Medici, suo bisavolo«; zit. nach Giovanni
Rucellai ed il suo Zibaldone, Bd. I, hrsg. von Alessandro Perosa, London 1960, S. 35.
70 Libro segreto (wie Anm. 19).
71 Vgl. Giancarlo Gentilini, I Della Robbia. La scultura invetriata nel Rinascimento, Florenz
1992, Bd. I, S. 138–139.
72 La raccolta delle robbiane [Katalog zur Ausstellung La raccolta delle robbiane im Museo
nazionale del Bargello], hrsg. von Beatrice Paolozzi Strozzi und Ilaria Ciseri, Florenz 2012,
Kat.-Nr. 11, S. 58.
73 Madonna Bliss, 1445/50, New York, Metropolitan Museum, vgl. auch Gentilini 1992 (wie
Anm. 71), Bd. I, S. 201–202.
32 Andreas Huth
heiten Andrea della Robbia zuordnen. Aufgrund solcher Charakteristi-ka war der Berliner Altar von Wilhelm von Bode als »Frühwerk« Andreadella Robbias bezeichnet worden.74 Wenngleich eine sichere Chronolo-gie der nicht dokumentarisch zu fassenden Werke Andrea della Robbiasnur schwer zu erstellen ist, so deuten doch verschiedene Faktoren aufeine frühe Entstehungszeit des Altars hin.
So liefern die Pilaster des Berliner Altars Anhaltspunkte für die Da-tierung. Während die Pilaster bei allen nach 1475 entstandenen Altärendurchgängig flach reliefierte weiße Ornamente bzw. plastische Blumen-oder Fruchtsträuße aufweisen, sind die frühen Pilaster entweder glatt/weiß (Santa Fiora-Triptychon, um 1464, Abb. 16)75 oder glatt und mitgemalten Rosensträußen geschmückt (Berliner Altar, Abb. 14).76 Offen-sichtlich wurde hier noch mit Schmuckformen experimentiert bevorsich ab etwa 1475 die genannten anderen Gestaltungstypen durchsetz-ten. Dagegen sind die mit Glasurfarben gemalten Rosensträuße desBerliner Altars in nahezu identischer Form in der Predella des S. Fiora-Triptychons zu finden, während sie bei späteren Werken nicht mehrbzw. in anderer Form (z.B. als Rosenstrauß in einer Vase) anzutreffensind.77 Dies stützt eine Datierung auf eine Entstehungszeit um 1470.Über einen deutlich längeren Zeitraum hinweg wurden dagegen die
74 Die Einordnung des Altars als Frühwerk Andrea della Robbias teilt von Bode bis in die Ge-
genwart nahezu die gesamte Forschung, lediglich Marcel Reymond und Maud Cruttwell hiel-
ten ihn für eine späte Arbeit; Reymond 1897 (wie Anm. 17), S. 204; Cruttwell 1902 (wie Anm.
17), S. 163 (Anm.) und 186. Andrea war zum Zeitpunkt der Entstehung des Altars allerdings
bereits etwa Mitte Dreißig.
75 Andrea della Robbia, Santa Fiora-Altar, glasierte Terrakotta, um 1464, Pieve di Santa Fiora
e Lucilla, Santa Fiora; Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 171
76 Die Ädikula-Pilaster in Impruneta (1464/69) weisen zwar ebenfalls flache weiße Palmet-
ten-Ornamente auf, sind aber farbig unterlegt. Diese Dekorform ist erst in den Werken Gio-
vanni della Robbias wieder zu finden, vgl. auch Francesco Quinterio, Natura e architettura
nella bottega robbiana, in: Gentilini 1998 (wie Anm. 26), S. 76–77.
77 So z.B. in den Predellen des ca. 1474 geschaffenen Altars mit der Krönung der Jungfrau
und Heiligen (Siena, Osservanza) oder des Madonnen-Altars aus Gradara (1480).
plastischen und polychromierten Rosen/Lilien-Sträuße der Frieszonedes Berliner Altars in der Della-Robbia-Werkstatt verwendet. Zwischen1460 und 1480 gibt es eine große Zahl von Tondi, Andachtsbildern undAltären, die diese Schmuckform aufweisen. Zu ihnen zählt wiederumdie von Rosensträußen umgebene Madonna degli Architetti, auf derenmotivische Verwandtschaft zum Berliner Altar bereits hingewiesenwurde.
13 Andrea della Robbia, ›Madonna degli Architetti‹, glasierte Terrakotta, ca. 1475,
134×96 cm, Museo nazionale del Bargello, Florenz
14 Sassetti-Altar, Berlin, Detail vom rechten
Pilaster
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 33
Die Pala-Form
Von der Form – ein Retabel all’anticamit rahmenden Pilastern, Gebälkund Predella – und dem Motiv der Madonna mit Kind und Heiligen hergehört der Berliner Altar zu der großen Gruppe von Arbeiten, an derenAnfang der Altar für die Badia Fiesolana (um 1466) steht.78 Doch auchdieses Werk ist Ergebnis einer Entwicklung,79 die sich über einen Zeit-raum von etwa fünfzehn Jahren verfolgen läßt: Ihren Beginn markiertdie 1450/51 von Luca della Robbia für S. Domenico in Urbino geschaf-fene Lünette mit der Madonna mit Kind, zu deren Seiten jeweils zweidominikanische Heiligen stehen.80 Dieses ikonographische Schema isthier erstmalig anzutreffen, wenn auch noch nicht als Altarbild. Als sol-ches taucht es wenige Jahre später beim S. Biagio-Altar (Abb. 15) von1455/60 auf, an dem Luca und Andrea della Robbia gemeinsam arbeite-ten.81 Auch wenn hier ein abschließendes Gesims mit antikischen Or-namenten wie Zahnschnitt und Eierstab das all’antica-Vokabular be-dient, so ist doch die Bildzone noch durch eine strenge Dreiteilung ge-prägt. Im Unterschied zur klassischen Renaissance-Pala gibt es hier statteiner Predella einen mit Blättern und Früchten verzierten Sockel. An-dreas ca. 1464 entstandenes S. Fiora-Triptychon (Abb. 16) zeigt dann
zwei neue Elemente: die Predella und die Pilaster-Gebälk-Rahmung.82
Allerdings teilen die Pilaster das Retabel in drei voneinander unabhän-gige Bilder, deren narrative Intention durch eine Vielzahl von plasti-
78 Bei dem etwa zeitgleich für die Cappella del Crocifisso in der Kirche S. Maria in Imprune-
ta von Luca und Andrea della Robbia gemeinsam ausgeführten Tabernakel sind zwar die glei-
chen architektonischen Elemente festzustellen, nur bilden sie hier (wie auch beim Peretola-
Tabernakel Luca della Robbias; Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 94 f.) die bei Hostien-
schreinen häufig anzutreffende Ädikula-Form; ebd., S. 116 f. Gentilini meint, daß sich die An-
tiken-Bezüge mit Francesco Sassettis engen Beziehungen zu Mitgliedern des humanistisch
geprägten Kreises um Piero de’ Medici erklären lassen; ebd., S. 170.
79 Vgl. auch Gentilinis Zusammenschau der frühen tavole quadrate, in der er auch auf zum
Teil frühere Beispiele aus Padua bzw. Norditalien verweist; Giancarlo Gentilini, Sulle prime
tavole d’altare in terracotta, dipinta ed invetriata, in: Arte cristiana, 80 (1992), S. 439–450. Die
im Folgenden verwendeten Datierungen orientieren sich in der Regel an den Angaben Gian-
carlo Gentilinis; Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 169–267.
80 Vgl. Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 108.
81 S. Biagio-Altar, heute in der Kapelle des Palazzo Vescovile in Pescia; Gentilini 1992 (wie
Anm. 71), Bd. I, S. 131. – Gentilini/Arte cristiana 1992 (wie Anm. 79), S. 440. – John Pope-
Hennessy, Luca della Robbia, Oxford 1980, S. 261–262.
82 Zur Bedeutung des S. Fiora-Triptychons als eine der ersten eigenhändigen Arbeiten An-
drea della Robbias siehe Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 171.
15 Luca und Andrea della Robbia, Madonnen-Altar mit San Biagio und San Jacopo, vermutlich für S. Jacopo in Altopascio, glasierte Terrakotta, um 1455/60, Palazzo Vescovile, Pescia
34 Andreas Huth
schen und polychromen Details betont ist. Der so erzeugte malerischeEffekt und das Ringen um räumliche Tiefe in einem nachvollziehbarenBildraum belegen ebenso die Vorbildwirkung der zeitgenössischen Palawie die Orientierung an deren Rahmenform. Wenngleich Andreas ›Misericordia-Altar‹ das Malerische zugunsten einer stärker plastischenAuffassung zurücknimmt, so ist doch mit diesem Werk die endgültigeDurchsetzung des klassischen Pala-Typus im Repertoire der Della-Rob-bia-Werkstatt zu konstatieren. Bildformat, Pilaster-Gebälk-Rahmungund Predella entsprechen nun den seit der Mitte des Quattrocento beigemalten Altarretabeln gängigen Formen,83 die ihrerseits auf die neue,von Brunelleschi geprägte Architektur reagieren.84 Für das bekrönendeTympanon mit Gottvater und Engeln85 griff Andrea möglicherweiseauf ältere Vorbilder wie den hölzernen Altarrahmen mit Tympanon fürein für den Dom von Arezzo geschaffenes Verkündigungsrelief (1433,Altar aus der 1561 abgetragenen Kathedrale)86 zurück; es sollte, so istanzunehmen, durch seine antikisierende Formen den Altar FrancescoSassettis in der Badia vor den Stiftungen der konkurrierenden Medici-Anhänger besonders auszeichnen. Der nur wenige Jahre darauf ent-standene Altar für die Villa nutzt, vom Tympanon abgesehen, für dieRahmung die gleichen Komponenten. Die beiden Retabel sind somitdie frühesten Arbeiten aus der Della-Robbia-Werkstatt, die dem Typusder Renaissance-Pala entsprechen. Das ist um so bemerkenswerter alsdie beschriebene Übertragung der die Quattrocento-Pala konstitu -
83 Eine zeitgenössische Definition der all’antica-Rahmung liefert Neri di Bicci in seinen Ri-
cordanze: »fatta formata al’anticha, c[i]oè predella da pie’ e quando di sopra e da lato cholon-
ne a chanali e di sopra chornic[i]one chon dentegli«, Neri di Bicci, Le Ricordanze (10 marzo
1453 – 24 aprile 1475), hrsg. von Bruno Santi, Pisa 1976, Nr. 446, S. 227 f.
84 Vgl. Christa Gardner von Teuffel, Lorenzo Monaco, Filippo Lippi und Filippo Brunelle-
schi: die Erfindung der Renaissancepala, in: Zeitschrift für Kunstgeschichte, 45/1 (1982),
S. 1–30; Hubert Locher, Das gerahmte Altarbild im Umkreis Brunelleschis, in: Zeitschrift für
Kunstgeschichte 56 (1993), 487–507.
85 Architektonische Rahmung und Tympanon sind 1928/29 durch das Opificio delle Pietre
Dure in gefaßtem Holz rekonstruiert worden; die ursprüngliche Gestaltung war 1812 im
Zuge des Verkaufs an die Arciconfraternità della Misericordia zerstört worden; Bietti-Favi/
Gentilini/Niccolai 1981 (wie Anm. 60), S. 228.
86 Meister Ludovicus, Verkündigungsaltar, Terrakotta, Rahmenwerk aus gefaßtem Holz,
Inschrift: »Mariottus Angeli Canonicus Aretinus Pro Anima Sua Et Suorum Anno DNI
MCCCCXXXIII (Rest unleserlich)«; zit. nach: Gentilini/Arte cristiana 1992, S. 441–442. Das
Werk wurde früher Bernardo Rossellino zugeschrieben; vgl. Carl v. Fabriczy, Ein Jugendwerk
Bernardo Rossellinos und spätere unbeachtete Schöpfungen seines Meissels, in: Jahrbuch der
ierenden Elemente in die Plastik eine singuläre Entwicklung ist, dereneinziger wirklicher Vertreter Andrea della Robbia ist. Zugleich fällt auf,daß sich die beiden vor dem ›Misericordia-Altar‹ entstandenen Altärenicht in Florenz, sondern in kleinen Provinzstädtchen (Pescia und S. Fiora) befanden. Francesco Sassetti beauftragte also nicht nur die ers-ten beiden Terrakotta-Altäre in Pala-Form, sondern etablierte mit ih-nen in seiner Heimatstadt Florenz einen neuen Retabeltyp.
16 Andrea della Robbia, Santa Fiora-Altar, glasierte Terrakotta, um 1464, Pieve di Santa Fiora e Lucilla, Santa Fiora
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 35
Der Berliner Sassetti-Altar und der ›Misericordia-Altar‹
Der Vergleich mit dem ›Misericordia-Altar‹ gestattet es, die zeitlicheNähe beider Werke klarer zu fassen. Die Altäre sind – ohne Einbezie-hung des Tympanons87 – fast exakt gleich groß88 und in der grundsätz-lichen Organisation sehr ähnlich: Über einer dreiteiligen Predella be-findet sich das Altarbild mit einer thronenden Madonna mit Kind undzwei Heiligen; gerahmt wird die Darstellung von zwei Pilastern, derenKapitelle ein Gebälk aus Architrav, Fries und Gesims tragen. Unter-schiedlich ist die Plastizität der Reliefs: Während der Altar für die Badiain seiner kräftigen Plastizität offenbar den weiten Kapellenraum in derKlosterkirche berücksichtigt, reagiert das flachere Relief des Villa-Altarsauf die bescheideneren Dimensionen der Kapelle. Der ›Misericordia-Altar‹ zeigt die Heiligen Cosmas und Damian, deren Attribute – Palm-zweige und Arzneidosen – denen des Berliner Cosmas entsprechen. Er-staunlicher als die Übereinstimmung der üblichen Attribute ist die derKragen: die Männer auf der linken Seite tragen einen unterhalb derSchultern waagerecht abgeschnittenen Mantelkragen (Damian) bzw.eine solche Kapuze (Franziskus), bei den Heiligen auf der rechten Seite(Cosmas) endet der Mantel rund. Unterschiedlich ist dagegen die übri-ge Gestaltung der Heiligen, die beim früheren ›Misericordia-Altar‹ ein -ander zwillingshaft ähneln und blockhaft steif in fast symmetrischerHaltung zu seiten der Madonna stehen. Ihre Gewänder fallen breit undin regelmäßigen Falten herab. Die Heiligen im Berliner Altar mit ihremkontrapostischen Schwung wirken dagegen lebendiger; sie sind etwasschmaler und in der Kontur bewegter, ihre Gewänder fallen weicherund besitzen eine natürlichere Stofflichkeit. Die größere Lebendigkeitist vor allem in der Ausarbeitung der Gesichter der Heiligen zu erken-nen, die beim ›Misericordia-Altar‹ eher idealisiert als innerlich bewegtwirken. Erklären läßt sich der unterschiedliche Charakter mit der engenZusammenarbeit zwischen Andrea und Luca della Robbia, die geradefür die 1460er Jahre in einer Reihe von gemeinsam ausgeführten Pro-jekten nachweisbar ist.89 In der Gestaltung der Heiligen beim ›Miseri-cordia-Altar‹ ist eine deutliche Verwandtschaft zu Luca della Robbiaseinige Jahre früher entstandenen Altar für S. Biagio (1455/60, Abb. 15)in Pescia festzustellen, an dem Andrea bereits beteiligt war.90 Zeitlichenger an der Entstehung der zwei Sassetti-Altäre ist der Kreuzigungs -altar in Impruneta von 1464/69, an dem ebenfalls beide Künstler gemein-sam arbeiteten.91 Hier ist insbesondere die Figur des Täufers zu nen-nen, die in erkennbarer Beziehung zu den Cosmas-Darstellungen derbeiden Altäre steht, allerdings auch den Unterschied zwischen dem›Misericordia-Altar‹ und dem Berliner Altar vor Augen führt: Luca della Robbias ruhiger Klassizismus wird von Andreas expressivererHandschrift abgelöst. Dementsprechend klingt im Berliner Altar schonAndreas eigenständiger Stil der ab Mitte der 1470er Jahre geschaffenenArbeiten für La Verna und Arezzo an; seine neue Qualität und die Be-deutung für Andreas gesamtes späteres Œuvre sind bei näherer Be-trachtung unbestreitbar. Die Zurückhaltung der Forschung gegenüberdem Altar, vor allem aber Giancarlo Gentilinis auf eine Fußnote be-schränkte Erwähnung des Werks als »Arbeit Andreas unter Beteiligungeines Mitarbeiters« in seinem umfangreichen Werk zur Della-Robbia-Werkstatt (Florenz 1992) sind deshalb nicht nachzuvollziehen.92
Der Auftraggeber Francesco Sassetti
Mit der Auftragsvergabe an Andrea della Robbia hatte sich FrancescoSassetti für ein Material entschieden, das nicht mit dem wertvollerenMarmor oder gar dem Bronzeguß konkurrieren konnte, sondern alleindurch die Hand des Künstlers und die besondere Glasurtechnik zumKunstwerk wurde. Arbeiten aus der Della-Robbia-Werkstatt waren da-her nicht einfach eine kostengünstige Alternative zu »richtigen« (bei-spielsweise marmornen) Reliefs, sondern galten bei florentinischen Pa-triziern wie ihre unmittelbaren Verwandten, die polychrom gefaßtenTerrakotta-Plastiken, als einem hohen gesellschaftlichen Rang durch-aus angemessene Kunstwerke. Unter den Auftraggebern finden sichdementsprechend viele der einflußreichsten Florentiner Familien, diezur Ausgestaltung ihrer Familienkapellen, Stiftungen und Paläste in derWerkstatt Madonnen-Tabernakel, Bauschmuck sowie Bild- und Wap-pen-Tondi in Auftrag gaben.93 Auftraggeberin der beiden ersten in die-ser Technik gefertigten Werke war die Florentiner Dom-Opera, die beiLuca della Robbia zwei große Lünetten für die Sakristei-Türen im DomS. Maria del Fiore bestellte.94 Der Ruhm von Luca della Robbias Glasur-technik und seine Kunstfertigkeit sorgten dafür, daß seine Arbeiten zueuropaweit gefragten ›Markenprodukten‹ wurden;95 Andrea konnte an
Preußischen Kunstsammlungen, 21 (1900), S. 33–54, 99–113. – Gerald S. Davies, A sidelight
on Donatello’s Annunciation, in: The Burlington Magazine for Connoisseurs, 13 (1908), S. 222
und 227, Tafel 1, S. 223. Die von Vasaris als Frühwerk erwähnte Arbeit Andrea della Robbias
an einem Marmorrahmen für S. Maria delle Grazie in Arezzo ist, wie ein mittlerweile ent-
deckter Vertrag bezeugt, erst nach 1487 erfolgt, kann also nicht Grund für eine mögliche
Kenntnis des Tympanon-Motivs am Verkündigungsaltar gewesen sein; Giorgio Vasari, Le vite
de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori nelle redazioni del 1550 e 1568, hrsg. von Ro-
sanna Bettarini und Paola Barocchi, Bd. III – Testo, Firenze 1971, Vita di Luca della Robbia
Scultore, S. 56. – Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 218 und 270, Anm. 5.
87 Für den Berliner Altar läßt sich die frühere Existenz einer Bekrönung in Form eines Tym-
panons oder einer voltarella ausschließen; vgl. hierzu auch das Foto der Oberseite des linken
Gebälkstücks in der Dokumentation 2003/2004 (wie Anm. 8), S. 18.
88 Der ›Misericordia-Altar‹ ist (mit Tympanon) 217 cm hoch und 180 cm breit; der Berliner
Altar ist mit 178 cm Höhe und 183 cm Breite beinahe genauso groß.
89 Zum deutlichen Einfluß Luca della Robbias auf die Gestaltung des ›Misericordia-Altars‹
vgl. u.a. Magnolia Scudieri, I Della Robbia a Fiesole, in: Gentilini 1998 (wie Anm. 26), S. 131–
141, hier S. 132. – Nuttall 1992 (wie Anm. 62), S. 101. – Bietti-Favi/Gentilini/Niccolai 1981
(wie Anm. 60), S. 229–330. Die Zusammenarbeit ist auch in der Steuerabrechnung Luca della
Robbias von 1469 dokumentiert; vgl. Pope-Hennessy 1980 (wie Anm. 81), S. 80. Einige größe-
re Projekte Luca della Robbias, an denen sein Neffe wahrscheinlich mitwirkte, waren der Ma-
donnen-Altar für S. Biagio in Pescia, das Tabernakel für die Cappella del Crocifisso in S. Maria
in Impruneta und die Decke mit den vier Kardinaltugenden in der Cappella del Cardinale del
Portogallo in S. Miniato; Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 131 ff.
90 Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 131, Abb. S. 121/122; Pope-Hennessy 1980 (wie
Anm. 81), S. 75–76, Katalog Nr. 48.
91 Andrea dell Robbias Anteil beschränkt sich laut Gentilini auf die bewegtere der beiden
Engelgruppen in der Sockelzone; Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 133.
92 Gentilini schreibt, der Altar sei »realizzata da Andrea, con l’intervento di un qualche colla-
boratore«; Gentilini 1992 (wie Anm. 71), Bd. I, S. 268. Da dies gerade bei Architekturelemen-
ten und Verzierungen wohl für alle Arbeiten aus der Della-Robbia-Werkstatt gilt, ohne daß
Gentilini dies bei jedem Werk verzeichnet, bezieht sich sein Urteil hier wohl auf die Figuren
der Heiligen. Die Entstehungszeit gibt Gentilini nicht an.
93 Stellvertretend seien hier die Medici und die Pazzi genannt; vgl. u.a. Allan Marquand,
Luca della Robbia, Princeton 1914. – Marquand 1919 (wie Anm. 10). – Marquand 1922 (wie
Anm. 10). – Pope-Hennessy 1980 (wie Anm. 81). – Gentilini 1992 (wie Anm. 71). – Fiamma
Domestici, Die Künstlerfamilie della Robbia, Florenz 1992.
94 Vasari/Bettarini/Barocchi (wie Anm. 86), S. 53.
95 In der Edition von 1568 heißt es: »La fama delle quali opere spardengosi non pure per Ita-
36 Andreas Huth
den Erfolg seines Onkels anknüpfen.96 Die Wertschätzung der Arbeitenaus terracotta invetriata äußert sich möglicherweise auch in dem hohenPreis des Altars für die Badia Fiesolana, der mit 200 Florin das preislicheNiveau sehr gut bezahlter Retabel mit gemaltem Altarbild und all’anti-ca-Rahmung erreicht haben könnte.97 Falls sich die im Libro Segretoverzeichnete Ausgabe tatsächlich allein auf das Retabel bezöge, würdees sich bei ihm um den teuersten (dokumentierten) Terrakotta-Altaraus Andrea della Robbias Produktion überhaupt handeln,98 auch wennsich hieraus leider keinerlei Rückschlüsse auf den Preis des Villa-Altarsziehen lassen.
Die Villa Sassetti in Montughi
Den vielen Verbindungslinien zwischen den beiden Altären ist nocheine weitere hinzuzufügen: Die Badia Fiesolana liegt nur etwa zwei Kilo-meter von der Villa entfernt; der Weg von Florenz nach Fiesole führteüber die Via Bolognese unmittelbar an Francesco Sassettis Anwesenvorbei. Dessen Besuchern können die zahlreichen Analogien also kaumentgangen sein, zumal die Kapelle sehr wahrscheinlich der Raum war,in dem Gäste empfangen wurden. Unter ihnen werden sich viele Perso-nen befunden haben, die sich auf dem Weg von oder zur Badia bzw. denzahlreichen Villen der Gegend um Fiesole befanden, wo auch die Medi-ci einen von Michelozzo zwischen 1453 und 1457 errichteten Landsitzbesaßen.99 Pracht und Ansehen der vermutlich ab den frühen 1470erJahren von Francesco Sassetti bewohnten Villa illustrieren die Lobprei-sungen der Humanisten Bartolomeo Fonzio,100 Ugolino Verino101 undMarsilio Ficino,102 und auch der Hausherr selbst schreibt in seiner ›Letzt-willigen Verfügung‹, »daß der Palast »seinem Namen und Geschlechtgroße Ehre und Reputation (...) durch ganz Italien hin eingetragenhabe«.103 Selbst wenn in den Lobpreisungen einiges an topischer Über-treibung steckt, so wird das Anwesen zu den berühmtesten und präch-tigsten im Umland von Florenz gezählt haben. Die Ausstattung der Kapelle hatte daran gewiß Anteil.
Francesco Sassetti als homo novus
Bei den Altären von Montughi und Fiesole waren für Francesco Sassettidrei Aspekte wichtig: Sie betonten die Treue zu den Medici, sie demon -strierten seinen Rang in deren engstem Umfeld (und damit in der ge-sellschaftlichen Elite der Stadt) und sie bezeugten mit ihrer exzeptionel-len Form Bildung, Reichtum und Kunstverstand ihres Auftraggebers.Auch wenn sich Francesco Sassetti hierin kaum von anderen Mitglie-dern der Florentiner Oberschicht unterschied, so waren doch vielleichtbei ihm Herkunft und Lebenslauf zusätzliche Motoren in seinem Bemühen, seinen Zweig der Sassetti-Familie im Kreis der führendenGeschlechter der Stadt zu etablieren. Im Unterschied zu anderen tradi-tionell eng mit den Medici verbündeten Familien waren die SassettiAnfang des 15. Jahrhunderts nicht besonders reich oder mächtig,104
auch wenn sie noch im Trecento zur Oberschicht gezählt hatten.105
Francesco Sassetti hatte achtzehn Jahre im Ausland gelebt; bei seinerRückkehr nach Florenz im Jahr 1458 war er quasi ein homo novus. Dienoch vorhandenen Restbestände der familiären Tradition – wie das an-gestammte Wohnviertel im Pfarrbezirk von S. Pier Buonconsiglio und
lia, ma per tutta l’Europa, erano tanti coloro che ne volevano, che i mercatanti fiorentini, fa-
cendo continuamente lavorare a Luca con suo molto utile, ne mandanavo per il tutto il mon-
do.«; zit. nach Vasari/Bettarini/Barocchi 1971 (wie Anm. 86), S. 54.
96 Vasari/Bettarini/Barocchi 1971 (wie Anm. 86), S. 56 f.
97 Vgl. Susanne Kubersky-Piredda, Kunstwerke-Kunstwerte. Die Florentiner Maler der Re-
naissance und der Kunstmarkt ihrer Zeit, Norderstedt 2005. – Andrew C. Blume, Botticelli
and the cost and value of altarpieces in late fifteenth-century Florence, in: The art market in
Italy: 15th – 17th centuries, hrsg. von Marcello Fantoni, Louisa C. Matthew und Sara F. Mat-
thews-Grieco, Modena 2003, S. 151–161. – Michelle O’Malley, Commissioning Bodies, Allo-
cation Decisions and Price Structures for Altarpieces, ebd., S. 163–180; siehe u.a. Tabellen
S.175–178. – Wackernagel 1938 (wie Anm. 30), S. 346–353. - Hanna Lehmkuhl-Lerner, Zur
Struktur und Geschichte des florentinischen Kunstmarktes im 15. Jahrhundert, Wattenscheid
1936, S. 28–40.
98 Zum Vergleich: Luca della Robbias Himmelfahrtslünette (1446–51) für S. Maria del Fiore
kostete wenig mehr als 110 Florin und die Madonna degli Architetti (1475) zehn Florin; für
den (marmornen) Tabernakelrahmen für S. Maria delle Grazie in Arezzo (1487–1493) wur-
den dagegen 260 Florin bezahlt; Bruno Santi, Una bottega per il commercio. Repertori, vendi-
te, esportazioni, in: Gentilini 1998 (wie Anm. 26), S. 87–96.
99 Die ursprünglich für Giovanni de’ Medici erbaute Villa übernahm Lorenzo il Magnifico
im Jahr 1469, also etwa gleichen Zeit, in der die Umbauarbeiten in Sassettis Anwesen ihrem
Abschluß entgegengingen; zur Medici-Villa in Fiesole vgl. Donata Mazzini, Simone Martini,
Villa Medici a Fiesole. Leon Battista Alberti e il prototipo di villa rinascimentale, Florenz
2006. – James Ackerman, The Medici Villa in Fiesole, in: »Il se rendit en Italie«, Rom 1987,
S. 49–56. – Christoph Luitpold Frommel, Villa Medici a Fiesole e la nascità della villa rinasci-
mentale, in: Colloqui d’architettura, 1 (2006), S. 20–59. - Lillie, Amanda, Giovanni di Cosimo
and the Villa Medici a Fiesole, in: Piero de’ Medici »il Gottoso«. Kunst im Dienste der Medi -
cäer/Art in the Service of the Medici, Berlin 1993, S. 189–205. – Lillie, Amanda, The humanist
villa revisited, in: Language and images of Renaissance Italy (1995). – Lapi Ballerini, Isabella,
Le ville medicee. Guida completa, Florenz 2003.
100 Fonzio, Sassettis Freund, Bibliothekar und Haushumanist, schreibt 1473 in einem Brief
an Niccolò Michelozzi: »Ciu dic, Montugia me culta expectet in aula/Nil collata valet Gallia
Montugio.«; Fontius, Carmina I, 3, S. 2–3, vgl. Lillie 1984 (wie Anm. 10), S. 85.
101 Ugolino Veroni nennt das Gebäude als »Werk eines Königs«: »Quid si Montughuas Sa-
xetti videris aedes/Regis opus credes«, Ugolino Verino, … de illustratione urbis Florentiae
(verfaßt zwischen 1480–87), Paris 1583, Liber II, S. 18; erstmalig zitiert in Francesco di Gio-
vambattista Sassettis Familienchronik Notizie dell’Origine e Nobiltà della Famiglia della Sas-
setti; Warburg 1907 (wie Anm. 2), S. 130–134; Lillie 1984 (wie Anm. 10), S. 83.
102 Vgl. Anm. 30.
103 Zit. nach Wackernagel 1938 (wie Anm. 30), S. 272. Italienischer Originaltext bei Warburg
1907 (wie Anm. 2), S. 143.
104 Francesco Sassettis Bruder Federigo (ca. 1405–1463) floh wegen seiner immensen Schul-
den nach Rimini; Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 160. Bartolomeo, sein zweiter Bruder, arbeitete
für die Medici und war zeitweise Prior, hatte jedoch vergleichsweise bescheidenen wirtschaft-
lichen Erfolg; vgl. ebd., S. 163 ff.
105 Lillie 2005 (wie Anm. 4), S. 159.
106 Borsook/Offerhaus 1981 (wie Anm. 3), S. 13; Ronald G. Kecks, Domenico Ghirlandaio
und die Malerei der Florentiner Renaissance (Italienische Forschungen des Kunsthistorischen
Institutes in Florenz, 4/2), München (u.a.) 2000, S. 95–96; Rohlmann 2003 (wie Anm. 3),
S. 175.
107 Marmorbüste Francesco Sassettis, Höhe 52 cm, Florenz, Museo Nazionale del Bargello,
Inv.-Nr. 64 s, auf Unterseite Inschrift: FRANC. SAXETTUS FLORENT. CIVIS. ANN. XLIIII;
das Patronat der Hautptchorkapelle von S. Maria Novella106 – botenwenig Spielraum, also bemühte er sich mit hohem Aufwand um die Be-gründung einer eigenständigen Familientradition. Der Umbau der Vil-la in Montughi zur Familienresidenz, der Kauf eines neuen Stadtpalas-tes und die Einrichtung der Familienkapelle in S. Trinita in unmittelba-rer Nähe zum Palast waren Schritte auf diesem Weg. Francesco SassettisWille, seinem Familienzweig dauerhaft hohes Ansehen zu sichern, ma-nifestiert sich auch in den von ihm beauftragten Kunstwerken. Hierfürist die 1464 von Andrea del Verrocchio geschaffene Marmorbüste imBargello ein hervorragendes Beispiel (Abb. 17).107 Sie zeigt Sassetti alsMittvierziger in schlichter antikischer Gewandung, Bartstoppeln über-
»Un bel dossale Robbiano« in der Basilika des Bode-Museums. Der Madonnen-Altar von Andrea della Robbia für Francesco Sassettis Villa bei Florenz 37
ziehen seine Wangen, sein Blick verrät wache Intelligenz. Statt Zur-schaustellung von gesellschaftlichem Status und Reichtum, wie sie dieMarmorbüsten anderer Florentiner Patrizier prägt, hat sich ihr Auf-traggeber für die Selbstinszenierung als einfacher Bürger entschieden,was die Inschrift FRANC. SAXETTUS. FLORENT. CIVIS. auf der Un-
terseite der Büste unterstreicht. Allein jedoch der Auftrag zu einer sol-chen Büste ließ ausreichend erkennen, daß es sich bei dem einfachenBürger um einen bedeutenden Mann handelt: Form, Material und In-schrift erheben nach dem Vorbild antiker Büsten Anspruch auf eine dieZeiten überdauernde Memoria. Eine vergleichbare Komplexität zeich-net auch den Berliner Altar aus. In ihm mischen sich christliche Demutmit persönlichem Stolz, patrizische Repräsentation mit demonstrati-vem Glaubensbekenntnis, private Memoria mit öffentlich bekundeterLoyalität zu den Medici. So erweitert der Altar in der Kapelle der Villadie familiären Aspekte um ein dezidiert politisches Bekenntnis: DieSassetti stehen an der Seite der Medici, ihnen verdanken sie ihren Wohl-stand und ihr Ansehen. Im Altar für die Kapelle in der Badia Fiesolanaist das Bekenntnis sogar noch pointierter: Die Medici-Heiligen tretenals die himmlischen Interzessoren der Sassetti auf; die Medici sind de-ren Patrone in der irdischen Welt. Die von Michael Rohlmann in derSassetti-Kapelle in S. Trinita beobachtete »ungewöhnliche, neue, zu -gespitzte Personalisierung des Sakralen«108 ist in den beiden Altären bereits in aller Deutlichkeit formuliert. Während in Ghirlandaios Fres-ken die Mitglieder der Familien Sassetti und Medici gleichzeitig auto-nomer wie integraler Bestandteil einer Heiligen-Vita sind, verschmelzenbeim Berliner Altar die heiligen Namenspatrone mit der Person des Auf-traggebers und der seines verehrten Freundes, Förderers und Stadtherrn.
Abbildungsnachweis
1: Staatliche Museen zu Berlin, Skulpturensammlung. – 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 14, 16: Andreas
Huth. – 7: Andreas Huth © New York University, Acton Collection, Villa La Pietra, Florence. –
8: Amanda Lillie, Zeichnung: Steve Allan – 11: Magnolia Scudieri, The frescoes by Angelico at
San Marco, Florenz 2004, S. 109. – 12, 13, 15, 16: Giancarlo Gentilini, I Della Robbia, Florenz
1992, Bd. 1, 183, 187, 123. – 17: La primavera del Rinascimento: la scultura e le arti a Firenze
1400 – 1460, hrsg. von Beatrice Paolozzi Strozzi und Marc Bormand; [Florenz, Palazzo Stroz-
zi, 23. März – 18. August 2013; Paris, Musée du Louvre, 26. September 2013 – 6. Januar 2014],
Florenz, 2013, S. 505.
vgl. John Pope-Hennessy, The Study and Criticism of Italian Sculpture, Princeton 1980,
S. 31–35. – Andrew Butterfield, The Sculpture of Andrea del Verrocchio, New Haven/London
1997, S. 16, 203. – Dario A. Covi, Andrea del Verrocchio. Life and Work, Florenz 2005, S. 260. –
Renaissance Faces: Van Eyck to Titian, hrsg. von Lorne Campbell, Miguel Falomir, Jennifer
Fletcher und Luke Syson [Katalog zur Ausstellung Renaissance Faces: Van Eyck to Titian in
der National Gallery in London, 15.10.2008–18.01.2009], London 2008, Kat.-Nr. 8, S. 96. Die
Büste wird gelegentlich auch Antonio Rossellino zugeschrieben.
108 Zit. nach Rohlmann 2003 (wie Anm. 3), S. 177.
17 Andrea del Verrocchio, Porträtbüste des Francesco Sassetti, Marmor, 1464, Inschrift
auf Unterseite: FRANC. SAXETTUS FLORENT. CIVIS. ANN. XLIIII, Museo nazionale
del Bargello, Florenz1