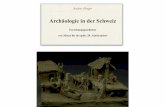2015-Fouad-Der Militärputsch in Ägypten aus der Sicht deutscher Salafisten
Skepsis und Desinteresse. Der Élysée-Vertrag aus Sicht der Schweiz
Transcript of Skepsis und Desinteresse. Der Élysée-Vertrag aus Sicht der Schweiz
La Suisse dans les relations franco-allemandes
1945 – 1963 – 2015
Die Schweiz in den deutsch-französischen Beziehungen
Patronat: Neue Helvetische Gesellschaft-Treffpunkt Schweiz Publikation 2014 Nouvelle Société Helvétique-Rencontres Suisses Publication 2014
Diese Publikation schliesst an die Reihe der Jahrbücher an, die 1930 von der Neuen Helvetischen Gesellschaft unter dem Titel «Die Schweiz» begründet wurde. Als erster Band der neuen Schrif-tenreihe erschien im Jahr 2013 «50 Jahre Engagement der Schweiz im Europarat 1963–2013. Die Schweiz als Akteur oder Zaungast der europäischen Integra-tion?».
Die Herausgabe dieses Buches wurde fi nanziell unterstützt durch den deutsch-französischen Kulturfonds, die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland und die französische Botschaft in Bern sowie durch den Bereich Europastudien des Departements für Historische Wissenschaften an der Universität Freiburg.
© Somedia Buchverlag
Edition Rüegger, Zürich / Chur 2015
Alle Rechte vorbehalten
www.somedia-buchverlag.ch
ISBN: 978-3-7253-1028-9
Gestaltung und Druck: Somedia Production, Chur
Umschlagbild: Unicom (UniFR) & B. Altermatt
Bernhard Altermatt, Cécile Blaser, Gilbert Casasus (Hg./éd.)
La Suisse dans les relations
franco-allemandes
1945 – 1963 – 2015
Die Schweiz in den deutsch-
französischen Beziehungen
Edition Rüegger
Impressum
Herausgeber : Bernhard Altermatt, Cécile Blaser, Gilbert CasasusAdministr. Overhead: Bereich (Master) Europastudien, Universität Freiburg Domaine (master) Études européennes, Univ. de Fribourg
Les contributions de ce livre reprennent les interventions du colloque « La Suisse, actrice ou spectatrice de la relation franco-allemande ? » qui s’est déroulé le 11 et 12 octobre 2013 à l’ Université de Fribourg. Seule manifestation soute-nue en Suisse par « le Fonds culturel franco-allemand » à l’occasion du 50e anni-versaire du traité de l’ Élysée, il a réuni de nombreuses personnalités issues du monde politique, diplomatique et universitaire. Les éditeurs tiennent à remer-cier très chaleureusement l’ Ambassade de France en Suisse et et l’ Ambassade d’ Allemagne auprès de la Suisse et du Lichtenstein à Berne. Ils se félicitent plus particulièrement de l’ aide apportée d’une part par le « Service de coopération et d’ action culturelle », représenté par Monsieur Michel Tarpinian, Conseiller de coopération et d’ action culturelle, ainsi que par Madame Salomé Acoca, à l’ époque chargée de mission culturelle à l’ Ambassade de France en Suisse, d’autre part par le « Service de Presse et de la Culture », dirigé en 2013 par Mon-sieur le Conseiller d’ambassade Otto Schneider, assisté par Madame Claudia Stolte, attachée auprès dudit service. Ce colloque a également bénéficié du soutien de la Fondation Jean Monnet à Lausanne dont le Directeur, Monsieur Gilles Grin, a eu l’obligeance de diriger l’une des tables-rondes de la journée. Par ailleurs, les organisateurs comptent souligner l’excellence des rapports qu’ils ont entretenus avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Ils remercient Madame l’ Ambassadeur Florence Tinguely Mattli pour sa pré-sence, Madame Manuela Leimgruber pour son écoute et Monsieur le Consul Général Marzio Tartini pour sa présentation de la coopération transfrontalière à l’exemple du « Dreieckland ». Les organisateurs du colloque ont également pu compter sur une subvention accordée par le Rectorat et par la Faculté des lettres de l’ Université de Fribourg. Il fut aussi très heureux d’ avoir pu accueillir une délégation du magazine romand L’ Hebdo. Enfin, le domaine des Études européennes s’est réjoui de la rencontre trinationale qui, grâce au soutien et à l’engagement de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ), a réuni des étudiants de l’ IEP de Bordeaux, de la Katholische Universität Eichstätt-Ingols-tadt et de Fribourg. Ces remerciements ne seraient pas complets s’ ils oubliaient la grande qualité du travail fourni, en amont et aval, par les collaboratrices et collaborateurs du domaine des Études européennes parmi lesquelles il y a lieu de mentionner tout particulièrement Madame Anna Jörger, ancienne assistante diplômée, Madame Lilian Daum, secrétaire, et Monsieur Raphaël Bez, étudiant en master. Grâce à cet esprit d’équipe, ce colloque trinational a, de l’ avis géné-ral, connu le succès qu’il méritait. G. C.
InhaltsverzeichnisTable des matières
Jean-Jacques de Dardel | Berne« La Suisse, solidaire et solitaire sur la scène internationale et européenne ? » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Michel Duclos | Paris« La Suisse, partenaire incontournable pour ses voisins en Europe » . . . . 19
Otto Lampe | Berlin«Die deutsch-französische Zusammenarbeit – ein epochales Werk der Annäherung, in dem auch die Schweiz Platz hat» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
I. Zur Geschichte und Gegenwart der deutsch-französischen Beziehungen
Robert Belot | BelfortDe Gaulle, le traité de l‘Élysée et l’Europe : « renversement de l’histoire » ou avatar du « solipsisme gallican » ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Régis Clavé | LausanneWilly Brandt, le SPD et le traité de l’Élysée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Frédérique Bugnon | FribourgARTE, une chaîne de télévision franco-allemande ou européenne ? . . . . 77
Béatrice Angrand & Markus Ingenlath | Paris & BerlinDie Südosteuropa-Initiative als Beispiel für die tri- und multilateralen Austauschprogramme des DFJW. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Gilbert Casasus | FreiburgPlädoyer für eine zeitgemässe Interpretation und neue Ausrichtung der deutsch-französischen Beziehungen in Europa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Pierre-Yves Le Borgn’ | Paris« Pour une Europe des résultats et des réalisations » . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
II. La Suisse et les Suisses – acteurs et observateurs des relations franco-allemandes
Georg Kreis | BaselDie Schweiz und der Élysée-Vertrag 1963. Ein einführender Blick auf eine distanzierte und differenzierte Wahrnehmung . . . . . . . . . . . . . . . 127
Rainer Hudemann | SaarbrückenEngagierte Beobachter. Zur Bedeutung der Schweiz für die deutsch- französischen Annäherungen in den Nachkriegsjahren . . . . . . . . . . . . . . . 135
Claus W. Schäfer | Erlangen«Beispiel und Brücke». Die Schweiz und die Schweizer im Nachkriegseuropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Birgit Schwelling | EssenDie Rolle schweizerischer Intellektueller in der Etablierung deutsch- französischer Gesellschaftsbeziehungen nach dem 2. Weltkrieg . . . . . . . . 161
Cécile Blaser | Bern & FreiburgSkepsis und Desinteresse. Der Élysée-Vertrag aus Sicht der Schweiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Manuel Friesecke | Basel50 Jahre grenzüberschreitende Zusammenarbeit am schweizerisch- deutsch-französischen Oberrhein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Gilbert Casasus | FribourgL’ engagement européen franco-allemand versus la Suisse désengagée . . 219
Christa Markwalder | Burgdorf«Die Schweiz als isolierte Insel der Glückseligkeit?» . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
Luzius Wasescha | Chailly-sur-Montreux« Nous sommes tous des Européens ! » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
III. «La Suisse face à l’ avenir – Schicksalsfragen eines kleinen Landes» (1963)
Bernhard Altermatt | FreiburgInnere Wahrnehmung und äussere Vermittlung der schweizerischen Aussenpolitik im «europäischen Jahr» 1963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
179
Cécile Blaser
Skepsis und Desinteresse
Der Élysée-Vertrag aus Sicht der Schweiz
ZusammenfassungDie Schweiz hätte aufgrund ihrer eigenen Geschichte und Beschaffenheit als Modell für die deutsch-französische Verständigung im Kleinen und Europa im Grossen dienen können. Sogar der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer sprach kurz nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags 1963 explizit von der Schweiz als Inspirationsquelle und Orientierungspunkt. Trotzdem nahm weder die offizielle, noch die öffentliche Schweiz diese Chance wahr. Sie bevorzugte es, «nicht führend» in die Geschehnisse einzugreifen, wie die Landesregierung an einer Pressekonferenz im Januar 1963 unterstrich. Gemäss der damaligen politi-schen Auffassung galt es, weder mit der kontinentalen Konzeption Europas, der sogenannt «alten Welt» von de Gaulle, noch mit der atlantischen Konzeption, der sogenannt «neuen Welt» zu sympathisieren. Diese politische Neutralität hielt die Schweiz jedoch nicht davon ab, sich auf wirtschaftlicher Ebene eindeutig Richtung Grossbritannien und USA auszurichten: durch ihre Mitgliedschaften bei der OEEC / OECD, der EFTA, im Europarat und durch ihre Mitarbeit in der Kennedy-Zollsenkungsrunde im Rahmen des GATT.
RésuméPour de nombreux intellectuels, la Suisse a – par son histoire ou sa composition – fait figure de modèle pour la construction européenne et à petite échelle pour la coexistence de l’ allemand et du français. Quelque temps après avoir signé le traité de l’ Élysée, le chancelier Konrad Adenauer, lui-même, avoua que la Suisse avait été une source d’ inspiration, voire un point d’ orientation. Néanmoins, ni la Suisse officielle, ni son opinion publique ne surent saisir la chance qui s’ offrait à elles. Telle la déclaration de son gouvernement, lors d’ une conférence de presse en janvier 1963, elle ne souhaitait pas intervenir « de manière décisionnelle » dans ce dossier. Pour la pensée politique dominante de l’ époque, il convenait ni de favoriser l’ idée continentale de l’ Europe, celle de « l’ ancien monde », incarnée par de Gaulle, ni de sympathiser avec celle pro-atlantique du « nouveau monde ». Pourtant, cette attitude neutre de la Suisse ne la priva pas de privilégier clai-rement les choix économiques de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Ainsi
Cécile Blaser180
adhéra-t-elle à l’ OEEC / OECD, à l’ AELE, au Conseil de l’ Europe et participa aux travaux du Kennedy Round dans le cadre du GATT.
* * *
Als der französische Präsident Charles de Gaulle und der deutsche Bun-deskanzler Konrad Adenauer am Abend des 22. Januar 1963 gemeinsam im Élysée-Palast den Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik über die deutsch-französische Zusammenarbeit unter-zeichneten, begegnete die schweizerische Presse diesem Ereignis äusserst skeptisch: Die Neue Zürcher Zeitung bezeichnete den Pariser Vertrag bereits im Vorfeld, in ihrer Sonntagsausgabe vom 20. Januar 1963, dem Ankunftstag Adenauers in Paris, lediglich als «ein Papier», das einige «solenne Formulie-rungen» zur Überwindung alter Feindschaft, zur neu gegründeten Freund-schaft, zur gegenseitigen politischen Koordinierung und zu Europa enthalten solle, «damit man etwas für künftige Geschichtsbücher» habe.1 Dies sei zwar ein «historisch gemeinter Akt», auf den jedoch «ein kaltes und ernüchterndes Licht» falle, weil sich de Gaulle in seiner Pressekonferenz vom 14. Januar 1963, eigenmächtig und ohne Adenauer vorher zu informieren oder gar zu konsul-tieren, für ein Doppel-Nein ausgesprochen hatte: ein Nein zum Beitritt Gross-britanniens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie ein Nein zur amerikanischen Konzeption einer multilateralen Nato-Atommacht. «Die feierliche Proklamation einer Verpflichtung zu enger gegenseitiger politischer Konsultation wird als Phrase abgestempelt sein, bevor sie noch geschrieben wird», so die Einschätzung der Neuen Zürcher Zeitung.
Trotz dieser geäusserten Skepsis sollte das «Papier», diese zeremonielle «Phrase», dieser «historisch gemeinte Akt» als so genannter Élysée-Vertrag in die Geschichte eingehen und für die beiden Nachbarländer künftig Anlass bieten, seine runden Geburtstage mit «viel Symbolik», «Pomp» und «noch mehr Show» zu feiern.2 Mit diesen Worten wurden zumindest die Feierlichkei-ten zum 50-jährigen Jubiläum des Vertrages im Jahr 2013 von den Schweizer Medien vermittelt. Es mag Zufall sein oder nicht: Aber auch 50 Jahre später scheinen die Schweizer Medien dem Élysée-Vertrag mit Skepsis und Miss-trauen zu begegnen. Aber wieso? Ist nicht gerade die Schweiz ein Paradebei-
1 Adenauers Reise nach Paris, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 228, 20. Januar 1963.2 Vgl. Zeitungsstimmen: Christof Münger: Die Frucht einer «Liebesaffäre zwischen zwei alten Männern»,
in: Der Bund, 23. Januar 2013, S. 6; Ulrich Schmid: Pariser Charme in Berliner Luft. Merkel und Hollande feiern den Elysée-Vertrag und proklamieren die Vertiefung der EU, in: Neue Zürcher Zeitung, 23. Januar 2013, S. 5; David Nauer: Mit viel Symbolik und noch mehr Show. Am 22. Januar 1963 haben Deutschland und Frankreich den Elysée-Vertrag unterzeichnet. Mit grossem Aufwand haben sie gestern ihre 50-jährige Freundschaft gefeiert, in: Der Bund, 23. Januar 2013, S. 6.
181Skepsis und Desinteresse
spiel für die friedliche und konstruktive Kooperation und Koexistenz der fran-zösischen und deutschen Kultur? Stellt nicht die Schweiz im Kleinen genau das dar, was die deutsch-französische Versöhnung, Freundschaft und Koope-ration im Grossen ist und sein will? «L’ Europe se fera comme la Suisse», hat Adenauer gemäss eines Berichts der Gazette de Lausanne vom 24. Januar 1963 nach seiner Rückkehr von Paris an einer Pressekonferenz in Bonn gesagt.3 Ein Europa nach schweizerischem Modell also, wie es sich auch Winston Churchill in seiner Rede vom 19. September 1946 in Zürich gewünscht hatte.4
Der vorliegende Beitrag stützt sich auf die Masterarbeit Der Élysée-Vertrag aus Sicht der Schweiz und nimmt sich der Frage an, was 1963 als Reaktion auf den Vertragsabschluss in der Schweiz passierte: Wie reagierte die öffentliche und vor allem auch die offizielle Schweiz darauf, dass sich ihre beiden Nach-barländer Deutschland und Frankreich nach einer jahrhundertelangen Erb-feindschaft plötzlich freundschaftlich verbündeten, enger zusammenrückten, sich austauschten und kooperierten? Nahm sie diese Einladung an, für Europa im Allgemeinen und Deutschland und Frankreich im Besonderen Modell zu stehen? Erkannte sie darin eine Chance für sich, für Europa? Oder stand sie einfach – «typisch Schweiz» – unbeteiligt daneben?5 In einem ersten Teil des Beitrags wird auf die bereits oben angedeutete These eingegangen, dass die öffentliche und offizielle Schweiz kaum auf das Ereignis vom 22. Januar 1963 reagierte. Typisch schweizerisch blieb sie nur soweit aktiv, wie sie sich nicht in eine Isolation gedrängt sah. Der zweite Teil widmet sich der These, wonach sich die Schweiz damals lieber Richtung Grossbritannien und den USA orientierte, statt mit ihren direkten Nachbarländern Frankreich und Deutschland oder gar der EWG zu kooperieren.
Die Schweiz als Modell der deutsch-französischen Freundschaft? «Wir Schweizer brauchen die deutsch-französische Freundschaft», sagte SRG-Generaldirektor Roger de Weck in seiner Rede anlässlich der gemeinsamen Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags am 22. Januar 2013 im Yehudi Menuhin Forum in Bern.6 Doch während in
3 Vgl. L. N.: «L’ Europe se fera comme la Suisse», in: Gazette de Lausanne Nr. 19, 24. Januar 1963.4 Dazu mehr weiter unten. Vgl. Winston Churchill: Europa-Rede in der Universität Zürich am 19. Septem-
ber 1946 (http://www.europarl.europa.eu/brussels/website/media/Basis/Geschichte/bis1950/Pdf/Churchill_Rede_Zuerich.pdf [17.03.2014]).
5 Ob dieses Verhalten tatsächlich typisch schweizerisch ist, kann hier nicht weiter ausgeführt werden. Inte-ressierte Leser vgl. dazu bitte die diesem Beitrag zugrundeliegende Abschlussarbeit: Der Élysée-Vertrag aus Sicht der Schweiz. Le Traité de l’ Élysée vu de Suisse, Masterarbeit in Europastudien der Universität Freiburg / Schweiz 2014.
6 Roger De Weck: Mitschrift der freien Rede anlässlich der gemeinsamen Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags im Yehudi Menuhin Forum Bern, 22. Januar 2013, in: Ambassade de France en Suisse & Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Bern (Hg.), Broschüre zur Festveranstaltung, S. 12.
Cécile Blaser182
deutschen und in französischen Städten die deutsch-französische Versöhnung ein ganzes Jahr lang gefeiert, daran erinnert und sich gegenseitig dazu gratu-liert wurde, blieb es in der Schweiz das gesamte Jubiläumsjahr über sehr still. Nur eine Kleinzahl von Veranstaltungen wie jene in Bern, organisiert von der deutschen und französischen Botschaft, und das Kolloquium, das der Fachbe-reich Europastudien der Universität Freiburg, ebenfalls mit der Unterstützung der beiden Botschaften, am 11. und 12. Oktober 2013 zum Thema Die Schweiz, Akteurin oder Zuschauerin der deutsch-französischen Beziehungen? veranstal-tete, boten Anlass dazu, der deutsch-französischen Versöhnung zu gedenken und sie von einem Schweizer Standpunkt aus zu betrachten. Trotz dieser Stille sieht Roger de Weck im Élysée-Vertrag auch für die Schweiz ein wichtiges Ereignis: «[Wir] dürfen dankbar sein über diese deutsch-französische Freund-schaft», sagt er in seiner Rede und erinnert daran, wie die Schweiz während des Ersten Weltkrieges durch den Krieg zwischen den beiden Nachbarländern fast auseinandergerissen worden ist.7 «Diese Zeiten sind vorbei, nicht zuletzt dank deutsch-französischer Freundschaft».8 Aber darf die Schweiz nicht mehr, als ihren beiden Nachbarländern einfach dankbar dafür zu sein, dass sie sich – 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg – im Kriegsfalle nicht mehr für eine Seite entscheiden müsste? In seiner über die Schweiz verfassten Studie, Die Schweiz, eine Verwirklichung der Demokratie, staunte der Soziologe und Vater der französischen Politikwissenschaft André Siegfried 1949 jedenfalls über die integrative Leistung der Schweiz: «Die Schweiz ist als Nation das Ergebnis des Gleichgewichts zwischen einer dreifachen zentrifugalen kulturellen und einer dreifachen zentripetalen politischen Anziehung. Drei Rassen, drei oder sogar vier Sprachen und zwei Religionen einander in einer Ordnung gesellt, welche weder ethnische, noch sprachliche, noch religiöse, noch kulturelle Einheit sein will, und doch die geeinteste Nation, die nationalste, wie konnte dieses paradoxe Programm verwirklicht werden?»9
7 In der Westschweiz herrschte damals die Neigung, den sogenannten Pangermanismus pauschal mit der Deutschschweiz gleichzusetzen, die zu Beginn den deutschen Marsch in den Krieg in euphorischer Stim-mung begleitet hatte. Der Feldzug in der Romandie gegen alles, was man als Deutschtum empfand, nahm solche Dimensionen an, dass etliche Beobachter, wie etwa der französische Schriftsteller Romain Rolland, mit Erstaunen feststellten, dass der Deutschenhass der Westschweizer jenen der Franzosen sogar noch über-treffen würde und dabei oftmals nicht einmal die Deutschen an sich, sondern stellvertretend die Deutsch-schweizer gemeint seien. Der Graben zwischen den Romands und Deutschschweizern soll so gross gewesen sein, dass der Nationalrat und Journalist der Gazette de Lausanne, Edouard Secretan, in einem Gespräch, dem Rolland beiwohnte, gesagt haben soll, dass es keine «innere Gemeinschaft zwischen den Schweizern auf dem einen und dem anderen Ufer der Aare» geben könne – und dass sich Carl Spitteler im Dezember 1914 dazu veranlasst sah, in seinem Vortrag Unser Schweizer Standpunkt klar Stellung zur Schweizer Neu-tralität zu beziehen und damit vor allem die Deutschschweizer dazu aufzufordern, ihr nationales Verhalten zu überdenken (vgl. Max Mittler: Der Weg zum Ersten Weltkrieg: Wie neutral war die Schweiz? Kleinstaat und europäischer Imperialismus, Zürich 2003, S. 653–661).
8 Vgl. Roger De Weck: Mitschrift der freien Rede vom 22. Januar 2013, S. 12.9 André Siegfried: Die Schweiz. Eine Verwirklichung der Demokratie, Zürich 1949, S. 113.
183Skepsis und Desinteresse
Noch vor der Idee der europäischen Integration oder der deutsch- französischen Versöhnung hat die Schweiz in Siegfrieds Perspektive ein Gleich-gewicht zwischen verschiedenen Religionen, Sprachen, Kulturen und Denkan-sätzen geschaffen. Sie dürfte also selbstbewusst mit der Tatsache umgehen, dass sie der deutsch-französischen Aussöhnung das Zusammenbringen des deutschen und französischen Denkmusters, durch das Zusammenbringen des Welschen und des Deutschschweizerischen, vorweggenommen hat.10 Wenn Bundesrat Didier Burkhalter an der Festveranstaltung im Yehudi Menuhin Forum am 22. Januar 2013 also sagte «Unser Land wurde von der deutsch-fran-zösischen Freundschaft und der damit verbundenen Befriedung Europas stark beeinflusst», fügte er richtigerweise hinzu: «Die Schweiz lebt aber nicht nur von der Stabilität, die ihre Nachbarn schaffen. Sie trägt auch selber zu dieser Stabilität bei».11 Die Schweiz tue dies unter anderem – und damit verweist Bun-desrat Burkhalter auf das Buch des US-libanesischen Intellektuellen Nassim Taleb Der Schwarze Schwan –, indem sie ein Paradebeispiel für Antifragilität sei.12 Doch auch wenn Roger de Wecks Satz nicht nur in die von ihm genannte, eindimensionale Richtung gelten sollte, sondern auch im Umkehrschluss – die Schweiz braucht nicht nur die deutsch-französische Freundschaft, sondern die deutsch-französische Freundschaft braucht auch die Schweiz – bleibt die Frage offen, ob und inwiefern die Schweiz um 1963 eine Rolle als Modell für die deutsch-französische Beziehung oder gar für Europa gespielt hat.
Die öffentliche Schweiz wartet abNach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Schweiz als Modell für den Wie-deraufbau Europas verstanden: In seiner Rede vor der akademischen Jugend am 19. September 1946 in Zürich bezog sich Winston Churchill explizit auf die Schweiz. Er wünsche sich ein Europa «so frei und glücklich [...], wie es die Schweiz heute ist». Ein Europa in Form der Vereinigten Staaten Europas, deren erster Schritt eine Partnerschaft zwischen Frankreich und Deutschland
10 Um diese unterschiedlichen Denkmuster zu verdeutlichen, zeigt Roger de Weck in seiner bereits zitierten Rede auf, wie sich die Deutschen mit ihrem klaren pragmatischen Denken in «Rahmenbedingungen» von dem französischen Denken im Voluntarismus bereits von der Struktur ihrer Sprache her fundamental unter-scheiden. Ein Franzose sagt, «j’ ai pris conscience», ich habe Bewusstsein erlangt, wohingegen der Deutsche sagt, «mir ist es bewusst geworden», im Sinne von «es ist mir einfach gekommen». Schon in der Sprache sei ein unterschiedliches Verständnis von Politik angelegt, so de Weck. «Das Deutsche mit dem Passivum und Neutrum birgt eine andere politische Sicht als das Französische mit dem kartesianischen Ego» (Roger de Weck: Mitschrift der freien Rede vom 22. Januar 2013, S. 9).
11 Didier Burkhalter: Rede anlässlich der gemeinsamen Festveranstaltung zum 50-jährigen Jubiläum des Élysée-Vertrags im Yehudi Menuhin Forum Bern, 22. Januar 2013, in: Ambassade de France en Suisse & Botschaft der Bundesrepublik Deutschland Bern (Hg.), Broschüre zur Festveranstaltung, S. 16.
12 Taleb schreibt: «Die Schweiz ist der antifragilste Ort unseres Planeten». Und zwar nicht obwohl, sondern weil sie keine Zentralregierung habe, von unten nach oben strukturiert sei und sich ihre Kantone als nahezu souveräne Mini-Staaten in einem Bündnis zusammengeschlossen hätten (vgl. Nassim Nicholas Taleb: Anti-fragilität. Anleitung für eine Welt, die wir nicht verstehen, München 2013, S. 130).
Cécile Blaser184
sei, weil es kein Wiederaufleben Europas geben könne «ohne ein geistig gros-ses Frankreich und ein geistig grosses Deutschland». 13 Auch der weiter oben zitierte André Siegfried war sich in seiner 1949 veröffentlichten Studie des Modellcharakters der Schweiz bewusst, als er schrieb, es bestehe kein Zweifel, dass «die Schweiz Europa und der Zivilisation einen Dienst erwiesen hat. [...] Sie gibt uns eine Lehre des praktischen und gleichzeitig freiheitlichen Geis-tes. Sie beweist uns, dass sehr verschiedene Menschen zusammen leben und gedeihen können, sobald sie ihrer gemeinsamen Interessen bewusst geworden, welche sie viel mehr einigen, als ihre Unterschiede sie trennen».14
Siegfried mass der Schweiz alleine durch ihre Existenz eine wichtige Rolle bei: Die Tatsache, dass es eine politische Einheit wie die Schweiz überhaupt gäbe, mache sie quasi zur Lehrerin für Europa. Die Schweiz war nach ihm der lebendige Beweis dafür, dass ein (prosperierendes) Zusammenleben von unterschiedlichen Kulturen möglich ist. Kurz nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags im Januar 1963 berief sich auch Bundeskanzler Adenauer in seiner Bonner Pressekonferenz auf das erfolgreiche und stabile Modell Schweiz, als er nach seiner europäischen Idee, seiner Vorstellung von Europa gefragt wurde: «J’ espère seulement que nous lui resterons fidèles et qu’ elle [l’ Europe] se fera un jour comme la Suisse s’ est faite».15 Die Schweiz wurde also nicht nur in der zweiten Hälfte der 1940er Jahre, sondern auch zum Zeit-punkt der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags als Modell wahrgenommen.
Die offizielle und die öffentliche Schweiz reagierte auf solche Vergleiche aber kaum und blieb dem Élysée-Vertrag gegenüber sehr kritisch. Der Bund schreibt in der Sonntagsausgabe vom 27. Januar 1963 in einem relativ langen Artikel auf der Frontseite über den Vertrag, dass für ein geistiges und kul-turelles «Sichfinden» der beiden Völker, noch die nährende Erde fehle: «Das gegenseitige Verstehen zwischen Deutsch und Welsch, das wissen wir Schwei-zer, ist nicht leicht, setzt aufgeschlossene Bereitschaft und ein Näherrücken während Generationen voraus».16 Achtzehn Jahre – die Zeit, die seit Ende des Zweiten Weltkrieges verstrichen war – sei allenfalls also zu kurz, so die Mei-nung des Bund-Autors. Tatsächlich war das Tempo im Vergleich zum Schwei-zer Modell sehr hoch. In seiner Studie über die Schweiz schrieb Siegfried, dass eine Koexistenz, wie sie in der Schweiz zwischen den unterschiedlichen Kul-turen gelebt werde, Jahrhunderte brauchte, um zu entstehen und zu reifen.17
13 Winston Churchill: Europa-Rede an der Universität Zürich am 19. September 1946 (Internetquelle s. oben).14 André Siegfried: Die Schweiz, 1949, S. 187.15 L. N.: «L’ Europe se fera comme la Suisse», in: Gazette de Lausanne Nr. 19, 24. Januar 1963.16 C. C.: Der Zweibund, in: Der Bund Nr. 38, 27. Januar 1963.17 «Die heute verwirklichte Lösung hat Jahrhunderte gebraucht, um zu reifen: Die prächtige Toleranz, welche
sie ausdrückt, ist nicht natürlich [...]. Das erzielte Ergebnis ist die Wirkung eines gemeinsamen Willens zum Zusammenleben und, wenn nicht immer zum Verstehen, so doch wenigstens zum sich Vertragen» (André Siegfried: Die Schweiz, 1949, S. 129).
185Skepsis und Desinteresse
Zwar bereite der «Pariser Vertrag», so der Bund, wichtige Voraussetzungen für dieses Zusammenwachsen, wenn etwa der Französischunterricht in Deutsch-land und der Deutschunterricht in Frankreich gefördert sowie der Austausch von Schülern und Studenten von Land zu Land erleichtert werden solle. «Aber es braucht mehr als nur Fertigkeiten des Lesens und Schreibens, wenn die neue Bindung über die Grenzen lebendig sein soll: es braucht Beteiligung und Bereitschaft von innen her». Diese sei zu dem Zeitpunkt nicht gegeben, weil sich Deutschland und Frankreich in Bezug auf den EWG-Beitritt Grossbri-tanniens nicht einig seien. Der Autor spricht zwar von einem «Wendepunkt» und einem «Neubeginn von geschichtlicher Tragweite», da der Vertrag den radikalsten Bruch mit einer dunklen Vergangenheit datiere und fixiere: «mit einem Federstrich erklären die Regierenden alte Feindschaft und Rivalität für überwunden, schaffen [...] Bindung und künftige Freundschaft». Doch leider eben nicht nur das, sondern auch «neue Probleme». Es bleibe nichts anderes übrig – und damit stützt der Bund-Autor exakt die erste These –, als abzuwar-ten und zu schauen, was die Zeit zeigen werde. Er schreibt: «Die Zeit erst wird zeigen, ob der Beifall, ob die Skepsis am Platze war oder ob – auch das ist nicht auszuschliessen – für eine neue Generation Regierender der Vertrag von Paris nur ein farbiges Zwischenspiel darstellt, über das der politische Alltag seine eigenen Wege ging».18
Auch wenige Tage später, nachdem am 29. Januar die Verhandlungen über einen Beitritt Grossbritanniens zur EWG nicht einmal eine Woche nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags gescheitert waren, fragte sich Der Bund in seiner Abendausgabe vom 31. Januar 1963, was diese «neuen Entwicklun-gen» für die Schweiz nun zu bedeuten hätten. Zwar schreibt der Autor gerade zu Beginn des Artikels, dass der Zusammenbruch der EWG-Verhandlungen mit Grossbritannien im Hinblick auf die wirtschaftlichen und politischen Aus-wirkungen für Europa und die Weltpolitik noch nicht überblickbar, jedoch «ohne Zweifel von allergrösster Bedeutung» seien und auch «die Schweiz in mehrfacher Hinsicht» berührten. Jedoch fügt der Journalist weiter unten an, dass die «öffentliche Meinung» die Entwicklungen momentan «unter der augenblicklichen Wirkung des de-Gaull’ schen Schocks» zu sehen pflege. Und auch er kommt zum Schluss, dass man sich bewusst werden müsse, dass von Seiten der Schweiz «kein Grund zum Drängen vorliege und es besteht [...] auch kein Anlass, die Dinge zur Stunde nicht ruhig und besonnen zu verfol-gen». Denn, so der Autor, «für die Schweiz hat sich im Verhältnis zur EWG offiziell nichts geändert. Sie ist und bleibt in Brüssel zur Prüfung einer Asso-
18 Alle Zitate C. C.: Der Zweibund, in: Der Bund Nr. 38, 27. Januar 1963.
Cécile Blaser186
ziierungsmöglichkeit angemeldet und wartet auf die Einladung zur Aufnahme von Verhandlungen».19
Die offizielle Schweiz wartet abAbwarten und schauen, was die Zeit zeigen wird. Dies scheint im Januar 1963 auch die Strategie oder zumindest die Devise der politischen und diploma-tischen Entscheidungsträger der Schweiz gewesen zu sein. Zwar schickt der schweizerische Botschafter in Paris, Agostino Soldati, als Reaktion auf den deutsch-französischen Vertrag am 28. Januar 1963 einen vertraulichen politi-schen Bericht an Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen, den damaligen Chef des Eidgenössischen Politischen Departements, mit dem Titel des ersten Kapitels: Le Traité franco-allemand, du 22 janvier 1963. Und am 4. Februar reagiert auch Rudolf Hartmann, Schweizer Botschaftsrat in Köln, mit einem Brief über die Auswirkungen des deutsch-französischen Vertrages.20 Soldati und Hartmann berichten in ihren Schreiben ausführlich über den Inhalt des Vertrages, die Situation, die Reaktionen und Meinungen in ihren jeweiligen Gastländern sowie über die möglichen Gründe des Zusammenschlusses – z. B. das Scheitern der Politischen Union zu sechst (Fouchet Pläne), die de Gaulle zu zweit kompensieren wolle, die Kontrolle Deutschlands durch Frankreich anhand einer noch engeren Zusammenarbeit oder das vertragliche Binden des künftigen Bundeskanzlers an eine Zusammenarbeit mit Frankreich.21 Eine Einschätzung der Ereignisse aus schweizerischer Sicht oder gar eine Prog-nose, was dies für die Schweiz zu bedeuten habe, bleibt jedoch aus. Von einer Anleitung darüber, wie die Schweiz auf das Ereignis reagieren oder sich gar einbringen könnte, ganz zu schweigen.22 Erst in einem weiteren Rapport vom 13. Februar 1963 mit dem Titel Après la rupture ist in einem Satz ein Anzeichen einer Meinung zu lesen, wenn Soldati schreibt: «Ce traité [est] inopérant dès le début puisque, à Bruxelles comme à l’ OTAN, l’ Allemagne ne s’ est pas rangée aux côtés de la France!»23 Dieser Satz zeigt im Speziellen, dass Soldati dem
19 Alle Zitate W. E.: Die Schweiz und die EWG-Krise. Die Rolle der EFTA, in: Der Bund Nr. 46, 31. Januar 1963.
20 Die Schweizer Botschaft befand sich bis 1977 in Köln (vgl. Dodis, Schweizer Botschaft in Bonn, http://db.do-dis.ch/organization/1208 [31.07.2014]).
21 In Deutschland war eine Mehrzahl der Beamten mit dieser engeren politischen Kooperation überhaupt nicht einverstanden und betrachtete den Vertragsabschluss zwischen de Gaulle und Adenauer lediglich als coup de théâtre de Gaulles (vgl. Rudolf Hartmann: Politischer Brief an F. T. Wahlen, Auswirkungen des deutsch-französischen Vertrages, Köln, 4. Februar 1963, S. 2, in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 2300 (-)1000/716/ 195, Berichterstattung. Köln, http://db.dodis.ch/document/30576 [18.03.2014]).
22 Vgl. ebd. und Agostino Soldati: Rapport politique, Conversation avec M. de la Grandville (X), Chef du Service des Pactes au Quai d’ Orsay, Paris 28. Januar 1963 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 2300 (-)1000/716/ 356, Berichterstattung: Paris, http://db.dodis.ch/document/30307 [18.03.2014].
23 Agostino Soldati: Rapport politique, Après la rupture, Paris 13. Februar 1963, S. 2 (in: Schweizerisches Bun-desarchiv, E 2300(-)1000/716/ 356, Paris, https://db.dodis.ch/document/30702 [18. März 2014]).
187Skepsis und Desinteresse
Élysée-Vertrag wenig Gewicht und Wirkung beimisst, indem er ihn – keinen Monat nach der Unterzeichnung – als «inopérant dès le début» bezeichnet. Im Allgemeinen weist er ein wichtiges Merkmal im Umgang der Schweiz mit dem Élysée-Vertrag auf; und zwar dass auf den Vertrag alleine kaum eingegangen wird. Der deutsch-französische Vertrag wird, was die Konsequenzen für die Schweiz betreffen, von der offiziellen wie auch von der öffentlichen Schweiz fast ausschliesslich im Kontext von de Gaulles Nein gegen die NATO und vor allem in Zusammenhang mit dem Nein gegen den Beitritt Grossbritanniens in die EWG betrachtet – angefangen bei der Pressekonferenz vom 14. Januar bis zum Scheitern der Verhandlungen am 29. Januar. Dies zeigt auch der Kom-mentar des Bund-Korrespondenten in Bonn, der in der Sonntagsausgabe vom 27. Januar 1963 unter dem Titel Bonn und der Vertrag von Paris: Ja für die Aus-söhnung – Nein gegen Sonderbündelei schreibt, dass «nicht allein der Gedanke an die deutsch-französische Versöhnung den Vertrag von Paris hervorgebracht [hat]; weitaus mehr ist er das Produkt der anti-britischen Haltung: Grossbri-tannien soll auf dem Kontinent nicht mitbestimmen».24
In diesem Sinne sind auch die Reaktionen seitens des Bundesrats zu den Ereignissen im Januar 1963 zu werten. Während eine direkte Reaktion auf den Élysée-Vertrag ausblieb, besprach sich der Bundesrat am 18. Januar 1963 in seiner ordentlichen Sitzung, wie er sich in Bezug auf die Pressekonferenz de Gaulles verhalten soll. Bundesrat Wahlen lobte dabei gemäss des von den beiden Staatssekretären verfassten Protokolls die zurückhaltende und abwar-tende Haltung der offiziellen Schweiz: «Après la conférence de Gaulle, le Con-seil fédéral a été à peu près le seul pays à ne pas prendre position. Cela a été une bonne chose».25 Am gleichen Tag, im Anschluss an die ordentliche Bun-desratssitzung, nahm die Regierung auch öffentlich zu den Entwicklungen seit der Pressekonferenz vom 14. Januar 1963 von General de Gaulle Stellung: Der Bundesrat nehme von dieser Entwicklung Kenntnis, «die für die Idee eines grossen europäischen Marktes von enormer Tragweite ist, und zwar vor allem in negativem Sinne», so der Bundesrat in der Pressekonferenz gemäss dem Bericht im Bund.26 Es stehe dem Bundesrat aber nicht an, Werturteile über das Vorgefallene abzugeben. Er hoffe, so die NZZ in ihrer Berichterstattung des gleichen Ereignisses, «dass nach der Krise eine Lösung gefunden werde, welche auf die Dauer eine handelspolitische Spaltung Europas in zwei Blöcke zu ver-
24 T. Z.: Bonn und der Vertrag von Paris. Ja für die Aussöhnung – Nein gegen Sonderbündelei, in: Der Bund Nr. 38, 27. Januar 1963.
25 Charles Oser & Felix Weber: Protokoll der internen Besprechung des Bundesrats, Procès-verbal interne de la 4ème séance, Bern 18. Januar 1963, S. 1 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 1003(-)1994/26/ 2, Verhand-lungsprotokolle des Bundesrats, http://db.dodis.ch/document/30308 [19.03.2013]).
26 Der Bundesrat zur Krise der EWG-Verhandlungen, in: Der Bund Nr. 27, 20. Januar 1963.
Cécile Blaser188
hindern vermöge».27 Dem Bundesrat scheine es richtig, dass die Schweiz «nicht führend» in die Entwicklung eingreifen werde. Wichtig sei die Entschlossen-heit im Innern, das eigene Haus in Ordnung zu halten und die Kaufkraft des Frankens durch gemeinsame Anstrengungen zu erhalten, um nicht die starke wirtschaftliche Stellung zu verlieren.28
Zu dieser Einschätzung kam auch der damalige Bundespräsident Hans Schaffner, Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Nach dem Scheitern der Beitrittsverhandlungen mit Grossbritannien machte er sich in einer persönlichen und vertraulichen Aktennotiz vom 7. Februar 1963 Gedanken über die Rückwirkungen der Ereignisse auf das Assoziationsgesuch, das die Schweizer Regierung im Rahmen der Solidaritätserklärung der sieben Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) und gestützt auf den umstrittenen Artikel Nr. 238 des Römer Vertrages am 15. Dezember 1961 bei der EWG eingereicht hatte.29 In diesem Gesuch schlug sie der Euro-päischen Wirtschaftsgemeinschaft vor, mit der Schweiz in Verhandlungen zu treten, um eine Beteiligung an der «Schaffung eines integrierten europäischen Marktes» zu erwirken.30 Durch den Abbruch der britischen Verhandlungen sei nun, so Schaffner, eine neue Situation entstanden, in der der Schweiz drei Möglichkeiten offen stünden: Erstens ein Rückzug des Verhandlungsgesuches, zweitens eine zuwartende Haltung und drittens eine Aktivierung des Verhand-lungsgesuches. Dabei kommt auch der Bundespräsident zum Schluss, dass sich «die zweite Variante», also die Variante des Abwartens, aufdränge.31 Dies gelte unter anderem aus folgenden Überlegungen: Erstens habe die Schweiz mit dem Assoziationsgesuch bereits einen Schritt Richtung EWG getan, und nun sei es an ihr, auf die Schweiz zuzukommen: «Der nächste Schritt liegt bei der
27 Die Schweiz und die europäische Integration. Eine Aussprache im Bundesrat, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 210, 18. Januar 1963.
28 Vgl. ebd. und: Der Bundesrat zur Krise der EWG-Verhandlungen, in: Der Bund Nr. 27, 20. Januar 1963.29 Die EFTA-Solidaritätserklärung London Pledge beinhaltete die Übereinkunft, «dass die Europäische
Freihandelsassoziation die durch das Übereinkommen geschaffenen gegenseitigen Verpflichtungen und die Integrationsbewegung innerhalb der Sieben mindestens so lange aufrechterhalten werde, bis befriedigende Lösungen zur Wahrung der legitimen Interessen aller Mitgliedstaaten der EFTA in Verhandlungen ausgear-beitet worden sind, die es allen ermöglichen, sich vom gleichen Zeitpunkt an am integrierten Europamarkt zu beteiligen» (Integrationsbüro: Brief an die Schweizerischen Botschaften in den EWG-Ländern, in den EFTA-Ländern, Washington, Moskau, Schweizerische Mission bei den Europäischen Gemeinschaften, Brüs-sel und Schweizerische Delegation bei der EFTA, Genf, Vertraulich, Bern 17. Dezember 1962, S. 2, in: Schwei-zerisches Bundesarchiv, E 2001(E)1976/17/ 211, Beitritt GB zur EWG, http://db.dodis.ch/document/30305 [19.03.2014]).
30 Vgl. Friedrich Traugott Wahlen: Brief an den Präsidenten des Ministerrats der Europäischen Wirtschafts-gemeinschaft (EWG), Die Schweiz ersucht die EWG um Verhandlungen zur Beteiligung am integrierten europäischen Markt, Bern 15. Dezember 1961 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 2804(-)1971/2/ 105, Europäische Integrationsbewegung, http://db.dodis.ch/document/30145 [19.03.2014]).
31 Vgl. Hans Schaffner: Persönliche und streng vertrauliche Aktennotiz, Erste Überlegungen zu den Rückwir-kung des Scheiterns der England-Verhandlungen auf die Schweiz, Bern 7. Februar 1963, S. 2 (in: Schweize-risches Bundesarchiv, E 7001(C)1975/52/ 14, EFTA-EWG und die Schweiz, 1963, http://db.dodis.ch/docu-ment/30314 [30.06.2014]).
189Skepsis und Desinteresse
EWG, nicht bei uns, da bekanntlich die Antwort auf unser Verhandlungsgesuch noch offen steht», so Schaffner. Zweitens solle die Schweiz keinesfalls riskie-ren, dass man den Eindruck erhalte, ihre Annäherungsversuche an die EWG seien nicht echt: «Durch unnötigen spektakulären Widerruf unseres Assozia-tionsgesuches würden wir den Eindruck erwecken, dass unsere Bemühungen nicht ernst gemeint waren [...]».32 Drittens – und damit kommt Schaffner auf die Frage der Isolation zu sprechen – wolle die Schweiz sich wirtschaftlich auf der Ebene des Zollabbaus nicht durch eine unüberlegte Handlung zusätzlich selbst diskriminieren und in eine wirtschaftliche Isolation geraten. Da diese Gefahr jedoch bestehe, hätten die Schweizer «kein Interesse, von uns aus eine Initiative zu ergreifen, um eine bestimmte Lösungsmöglichkeit von vornherein auszuschliessen».33
Die Äusserungen der Bundesräte Wahlen und Schaffner entsprechen der ersten These, in der vermutet wird, dass die Schweiz kaum auf das Ereignis vom 22. Januar 1963 reagierte, und sie nur soweit aktiv wurde, wie sie sich nicht in eine Isolation gedrängt sah. Klar muss hier angefügt werden, dass es sich bei diesen Aussagen und Überlegungen des Bundesrats um Reaktionen auf den 14. Januar 1963 und das Scheitern der Verhandlungen der EWG mit Gross-britannien handelt und nicht direkt auf den Élysée-Vertrag vom 22. Januar 1963. Jedoch wurde weiter oben gezeigt, dass die beiden Ereignisse (das Nein de Gaulles gegen England und der Vertragsabschluss zwischen Deutschland und Frankreich) für die Schweiz untrennbar sind: Sie beide sind wichtige Eck-pfeiler im Narrativ des verhärteten und bestimmteren aussenpolitischen Kur-ses Frankreichs unter de Gaulle, weg von der atlantischen, supranationalen Konzeption Europas eines Jean Monnet hin zum Konzept des kontinentalen, konföderalen Europas der Sechs oder im Zweifelsfalle eben der Zwei. Zudem existiert tatsächlich keine direkte, öffentliche Reaktion des Bundesrats zum
32 Die gleiche Skepsis, die Schweiz könne es mit ihrem Assoziationsgesuch möglicherweise nicht ernst meinen, zeigt sich bereits in einem früheren Dokument, welches das Integrationsbüro im Dezember 1962 verfasst und an die Schweizer Botschaften der EWG- und EFTA-Länder, in Washington und Moskau sowie an die Schweizerische Mission bei den Europäischen Gemeinschaften in Brüssel und die Schweizerische Delega-tion bei der EFTA in Genf geschickt hatte. Das Integrationsbüro hält darin fest, dass die Aufrechterhaltung der EFTA-Solidarität bedinge, «dass keines der Partnerländer in Verzug gerät». Es mahnt die entsprechen-den Diplomaten, dass, obwohl zurzeit kein Anlass bestehe, das Verfahren zu beschleunigen, auf keinen Fall der Eindruck erweckt werden dürfe, als ob die Schweiz eine allfällige Beschlussfassung seitens der EWG zu verzögern wünsche. «Gerade wegen der Rückwirkungen auf die EFTA-Solidarität muss die Verantwortung für den Zeitplan bei der EWG liegen, und wir dürfen uns nicht dem Vorwurf aussetzen, mangelnde Bereit-schaft zu zeigen» (Integrationsbüro: Brief an die Schweizerischen Botschaften…, 17. Dezember 1962, S. 7 f.).
33 Hans Schaffner: Aktennotiz vom 7. Februar 1963, S. 2. Zur Gefahr einer Isolation, falls keine geeignete Lösung gefunden würde, schreibt Schaffner zudem: «Isolierung wäre sicher nicht anzustreben, aber wohl während einiger Zeit wirtschaftlich zu ertragen, wenn wir unsere bisherige Wettbewerbsfähigkeit aufrecht-erhalten können» (ebenda, S. 7). Interessanterweise erwägt Schaffner in seinem Dokument bereits die Mög-lichkeit eines bilateralen Handelsvertrags mit der EWG. Diese Variante wäre seines Erachtens im Sinne einer Übergangslösung denkbar, jedoch sollte die Initiative dafür von der EWG kommen, quasi als Gegen-vorschlag zur von der Schweiz angestrebten Assoziation.
Cécile Blaser190
deutsch-französischen Vertrag, was wiederum als Zeichen gewertet werden kann, dass die deutsch-französische Versöhnung für die offizielle Schweiz in der damaligen Wahrnehmung keine grosse Bedeutung hatte. Sowohl die öffentliche wie auch die offizielle Schweiz nahm die Rolle des Landes als mög-liches Modell für die deutsch-französische Freundschaft zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses also in keinster Weise wahr. Im Gegensatz zu den Schwei-zer Medien, zog die offizielle Schweiz in ihren Mitteilungen, Pressekonferen-zen und Protokollen nicht einmal einen Vergleich zwischen der Schweiz und der neu beschlossenen deutsch-französischen Freundschaft.
Die Schweiz als Sympathisantin der angelsächsischen Konzeption Europas?«Die Politik Washingtons [ist] für uns wichtiger als diejenige von Paris, und die Schweiz sollte mehr Anstrengungen unternehmen, um möglichst viele Kreise in Amerika von der Begründetheit unserer Haltung zu überzeugen».34 Dieses Zitat von Max Weber, dem Ende 1953 zurückgetretenen Bundesrat (ehem. Vor-steher des Eidg. Finanz- und Zolldepartements) und späteren SP-Nationalrat, entstammt dem Protokoll der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung».35 Diese vom Bundesrat unmittelbar nach dem Einrei-chen des Schweizer Assoziationsgesuches an die EWG ins Leben gerufenen Arbeitsgruppe, hatte zur Aufgabe, eine «Menge von bedeutungsvollen Einzel-fragen [zu beantworten], auf welche die Landesregierung gerne eine Antwort hätte», so Bundesrat Wahlen, der an der ersten Sitzung am 18. Dezember 1961 persönlich anwesend war, um die Wichtigkeit dieser Arbeitsgruppe zu unter-streichen und die für die Gruppe auserlesenen Schweizer Experten – Minister, Botschafter, Professoren, Nationalräte und Militärs – darüber zu informieren, was der Bundesrat von ihnen erwartete: Und zwar die Klärung von Fragen wie etwa, ob hinter den Einigungsbestrebungen in Europa ein staatsformen-der und politischer Wille stecke, und ob die deutsch-französische Versöh-nung Ausdruck dieses Willens oder in erster Linie einfach ein realpolitisches Moment sei, das sich aus der Resignation, dass die Grossmachtstellung vorbei ist, ergebe. 36 Auf den Einwand des Gruppenleiters Minister Albert Weitnauer, dass die eigentliche «politische Standortbestimmung» selbstverständlich dem Bundesrat vorbehalten bleibe, reagierte Wahlen mit der Feststellung, dass die «Differenz in den Etiketten ‚historisch’ oder ‚politisch’ gewissen Spitzfindig-
34 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1961, Bern 18. Dezember 1961, S. 9 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E9500.225#1996/436#1*, Protokolle, vol. I, http://db.dodis.ch/document/34183 [28.06.2014]).
35 Vgl. Urs Altermatt (Hg.): Die Schweizer Bundesräte. Ein Biografisches Lexikon, Zürich 1991, S. 613.36 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1961, S. 2.
191Skepsis und Desinteresse
keiten» entspreche.37 «Die Geschichte ist das Resultat politischer Entschei-dungen, und dies gilt auch für die Zukunft. Geschichte und Politik fliessen ineinander über, sie sind ‚interdigitated’. Die Gruppe sollte sich deshalb in dieser Beziehung keine Begrenzungen auferlegen».38 Nebst dem interessanten Fakt, dass Bundesrat Wahlen in seiner Ausführung den Anglizismus interdigi-tated verwendet, gibt sie eine Vorstellung davon, wie wichtig der Bundesrat die Arbeitsgruppe bewertete und welches Gewicht der Aussage von alt Bundesrat Max Weber beigemessen werden kann: Sie ist ein ernst gemeinter Vorschlag, eine feste Überzeugung eines Experten und ehemaligen Mitglieds der Lan-desregierung gegenüber dem Bundesrat. Doch was ist daran, an diesem Zitat? Widerspiegelte dieser Vorschlag tatsächlich die Sicht der damaligen offiziellen Schweiz? Wurde aus dieser Überzeugung, dass sich die Schweiz mehr Richtung Washington richten sollte, tatsächlich Politik und Geschichte? Orientierte sich die Schweiz, wie es in der zweiten These vermutet wird, um 1963 tatsächlich lie-ber Richtung Grossbritannien und USA, anstatt mit ihren direkten Nachbar-ländern Frankreich und Deutschland – oder gar der EWG – zu kooperieren?
Die kontinentale und atlantische Konzeption Europas: Alte und neue Welt?De Gaulle — Exponent der Vergangenheit und Kennedys Blick in die Zukunft sind die Untertitel des Artikels Alte Welt und Neue Welt in der Sonntagsaus-gabe des Bunds vom 20. Januar 1963. Der Autor vergleicht darin die Rede der Pressekonferenz von de Gaulle mit der Rede von Kennedy vor den Parlamen-tariern der beiden Häuser des amerikanischen Kongresses in Washington: «Der Zufall will es, dass in der gleichen Woche, am gleichen Tag, zwei der Einfluss-reichsten Politiker je einem bestimmten Auditorium ihr Credo verkündeten».39 Anhand einer Gegenüberstellung der beiden Reden vom 14. Januar 1963 zeigt der Autor auf, wie sich die beiden Konzeptionen Europas – auf der einen Seite die kontinentaleuropäische Konzeption de Gaulles als «alte Welt» und auf der anderen Seite die atlantische Konzeption Kennedys als «neue Welt» – unter-schieden. Aus heutiger Sicht erinnert diese Unterteilung an die Aussage des späteren US-Aussenministers Donald Rumsfeld und deutet somit eine gewisse Kontinuität an, wie in Amerika die Europapolitik betrachtet wird.40
37 Weitnauer wurde 1979 erster schweizerischer Staatssekretär (vgl. Dodis: Albert Weitnauer, http://db.dodis.ch/people/2132 [17.07.2014]).
38 Beide Zitate Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1961, S. 4.
39 P. P.: Alte Welt und neue Welt. Versuch einer Analyse der grossen Reden de Gaulles und Kennedys, in: Der Bund Nr. 27, 20. Januar 1963. Die folgenden direkten und indirekten Zitate beziehen sich alle auf diese Quelle.
40 Mit der Unterscheidung einer neuen und alten Welt resp. eines atlantischen (neuen) oder eben nicht- atlantischen (alten) Europas nimmt der Journalist quasi eine amerikanische Denkweise vorweg, die 40 Jahre später – zufälligerweise ebenfalls am 22. Januar, im Jahr 2003 – der amerikanische Verteidigungsminis-
Cécile Blaser192
«[De Gaulle] ging eindeutig darauf aus, den nach seiner Ansicht geographisch und historisch bedingten Graben zwischen dem kontinentalen Europa und dem insularen England aufzuzeigen und herauszustreichen», schreibt der Journalist in seinem Artikel. Nach de Gaulle gäbe es innerhalb der EWG-Ländern keine Rivalität in politischen Fragen, in Problemen der Grenzziehung und in der Machtpolitik. Die Länder fühlten sich solidarisch durch die Tatsache, dass sie kontinental sind. «Und nun», zitiert Der Bund den französischen Präsidenten, «kommt Grossbritannien mit seinem Gesuch um Aufnahme, nachdem es sich bei Beginn geweigert hatte, gemeinsame Sache zu machen und nachdem es selber eine Freihandelszone [die EFTA] errich-tet hatte». Anhand der Tatsache, dass England ein Inselstaat und mit seinen Märkten und seinen Versorgungsverpflichtungen mit den verschiedensten und entferntesten Ländern verknüpft sei, schlussfolgere de Gaulle, dass sich die britische Art an sich, die Struktur und die Konjunktur grundlegend von den Gegebenheiten der kontinentalen Länder unterscheiden und dass ein Beitritt Englands die EWG zur «kolossalen atlantischen Gemeinschaft, in Abhängig-keit Amerikas» machen würde.41 Dies sei nicht, was Frankreich wolle, näm-lich eine wirkliche europäische Konstruktion. Der Bund-Autor ist davon überzeugt, dass de Gaulles Rede «ein rhetorisches Meisterstück» sei, das ihm kein Staatsmann so schnell nachmache. Es beruhe aber auf «soziologischen, psychologischen und politischen Voraussetzungen, die der heutigen Zeit nicht mehr entsprechen, ihr auf alle Fälle nicht mehr genügen». Der Journalist nennt de Gaulle in seiner Gegenüberstellung Karl der Grosse, der denke, es genüge, wie in der belle époque, dass zwei Herrscher sich gegenseitig ihrer immerwäh-renden Freundschaft versichern – und schon entstehe aus dieser Deklaration ein monolithischer Block. Zudem denke de Gaulle, «der angebliche Euro-päer par excellence», keineswegs europäisch, geschweige denn weltweit. Zwar überwinde er die Nation, wenn es gelte, über andere Staaten zu verfügen, er
ter Donald Rumsfeld bestätigen sollte. An der Pressekonferenz des US-Verteidigungsministeriums sprach Rumsfeld in Bezug auf die Unterstützungswilligkeit der europäischen Staaten für die USA im Irakkrieg von einem «new and old Europe» – und meinte mit dem «old Europe» u.a. Deutschland und Frankreich.
41 Was der Bund-Reporter anhand de Gaulles Rede beobachtet, nämlich die Strategie des französischen Präsi-denten, den kulturellen und strukturellen Unterschied zwischen Frankreich und Grossbritannien hervorzu-heben, wurde bereits in einem Gespräch vom 29. März 1962 zwischen Botschafter Soldati und André Gros, Professor für Politologie und damals Rechtsberater des französischen Aussenministeriums in Paris, deutlich und von Soldati nach Bern rapportiert. Gegenüber Soldati zitierte Gros den Engländer Lord Gladwyn, der sich in London stark für einen Beitritt Grossbritanniens einsetzte. Er soll ihm gegenüber gesagt haben: «Que voulez-vous, en Angleterre nous nous sentons plus proche d’ un Ghanéen qui parle anglais que d’ un Français». Soldati gibt sich in seinem Schreiben an F. T. Wahlen diesem Zitat gegenüber sehr kritisch und meint: «Je ne sais pas si Lord Gladwyn a vraiment prononcé une boutade de cette nature, mais le fait que le jurisconsulte du Quai d’ Orsay la cite d’ emblée au début de la conversation montre bien qu’ on prépare les voies d’ une retraite» (Agostino Soldati: Schreiben, Insuccès probable des négociations du Royaume-Uni et la position des neutres, Paris 29. März 1962, S. 1, in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 2001(E)1976/17/ 210, Beitritt GB zur EWG, http://db.dodis.ch/document/30195 [28.06.2014]).
193Skepsis und Desinteresse
vermöge aber nicht übernational zu denken, wenn es darum gehe, dass sich historisch verschiedenartig Gewachsenes zu höherer Synthese emporläutere.
Der Vergleich mit Karl dem Grossen gibt eine Vorstellung davon, wie de Gaulle Anfang der 1960er Jahre in der Schweiz wahrgenommen wurde: Seit Beginn seiner Rückkehr in die Politik im Mai 1958 wurde General de Gaulle als äusserst charismatischer Staatsmann empfunden, dem die Schweizer Dip-lomaten grossen Respekt zollten. Dies belegen unzählige offizielle Doku-mente, worin de Gaulle mal als «Louis XIV matiné de Louis XI» und – hin-sichtlich seiner Allianzbestrebungen – mal als «eine Art Kreuzung zwischen Jeanne d’ Arc und Clemenceau» bezeichnet wird.42 Auch die Tatsache, dass die Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» ihre Sitzung vom 25. März 1963, also die Sitzung unmittelbar nach der Unterzeichnung des Élysée- Vertrags und dem Scheitern der Beitrittsverhandlungen mit Grossbritannien, ganz ins Zeichen de Gaulles stellte, zeigt wie sehr die Ereignisse vom Januar 1963 für die Schweiz untrennbar vom Subjekt de Gaulle waren und wie viel Gewicht die Schweiz dem General beimass. Im Rahmen dieser Sitzung der Arbeitsgruppe, hielt der Professor für Geschichte an der ETH Zürich, Jean Rudolf von Salis, einen Vortrag mit dem Titel De Gaulle face à l’ histoire. Darin bezeichnete er ihn unter anderem als «personnalité hors du commun» und sprach von einem «mystischen» Vertrauen, das de Gaulle vom französischen Volk geniesse: «la confiance presque mystique que le général de Gaulle porte à ce que lui-même appelle ,le peuple’ ».43 Tatsächlich muss General de Gaulle eine unglaublich schillernde und charismatische Persönlichkeit gewesen sein, die Macht und zugleich Ruhe ausstrahlte. Dies zeigt auch ein Bericht des Schweizer Botschafters von 1957 bis 1961 in Paris, Pierre Micheli: Verfasst im Oktober 1958, also nach de Gaulles Präsidentschaftswahl, beschreibt Micheli de Gaulles physische Erscheinung, seine Persönlichkeit und seine Wirkung detailreich. Er zeigt sich fasziniert von der Macht und patriarchalen Autorität, die von de Gaulle ausging – sowie von seinen guten alten Manieren («Il se leva pour me recevoir»).44 Doch neben all der Bewunderung und Faszination für de Gaulle und dessen Macht hatte die Schweiz gleichzeitig auch Angst vor eben diesem Karl dem Grossen – Angst, dass man als kleines Land unter die Räder kommen könnte. «J’ ai eu l’ impression que mes arguments se heurtaient à un
42 Vgl. Jean Rudolf von Salis: Referat «De Gaulle face à l’ histoire», Bern 25. März 1963, S. 9 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E9500.225#1000/1190#1*, Protokolle der Arbeitsgruppe); Arbeitsgruppe «Historische Stand-ortbestimmung: Protokoll der Sitzung vom 25. März 1963, Bern 25. März 1963, S. 12 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E9500.225#1000/1190#1*, Protokolle der Arbeitsgruppe, http://db.dodis.ch/document/34190 [17.07.2014]).
43 Jean Rudolf von Salis: De Gaulle face à l’ histoire, 1963, S. 5 f.44 Vgl. Pierre Micheli: Politischer Bericht Nr. 96, Entretien avec le Général de Gaulle, Paris 24. Oktober 1958
(in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 2300(-)1000/716/ 353, http://db.dodis.ch/document/15014 [17.07.2014]).
Cécile Blaser194
mur», schreibt Micheli, als er mit de Gaulle über die Vor- und Nachteile des 1958 aktuellen Plans Grossbritanniens diskutieren wollte, eine grosse Freihan-delszone zu schaffen.
Die Feststellung, dass die formulierten Ideen und Bedürfnisse der Schweiz, falls sie nicht denjenigen Frankreichs entsprechen, an General de Gaulle komplett abprallen, mag – gerade im Hinblick auf die Schweizer Psyche der petite Suisse – dazu geführt haben, dass sich die Schweiz nicht zu einer engeren Kooperation mit de Gaulle inspiriert sah. Diese Annahme stützt eine spätere Aussage von Bundesrat Schaffner im Rahmen einer Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung». Schaffner sagt 1963, dass es nicht Starr-köpfigkeit war, die den Bundesrat bezüglich eines EWG-Beitritts zur Zurück-haltung bewog, sondern das Bewusstsein, «dass sich Frankreich der EWG lediglich als Wegbereiter zu einer Vormachtstellung bedienen will» und «dass sich die Schweiz durch den Beitritt zur EWG in die Abhängigkeit der Gross-machtpolitik begeben würde».45
Man war in der Schweiz also einerseits fasziniert von de Gaulles Grösse, andererseits war man sich aber nicht einig darüber, ob de Gaulle mit seinem hegemonialen Machtanspruch und seiner Weltansicht überhaupt in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts passte. In seinem Vortrag sagt von Salis: «[...] son langage ne semble pas être celui des contemporains. Ce langage est plutôt celui d’ un gentilhomme d’ ancien régime qui aurait emprunté un certain nombre d’ idées à la Révolution française, au romantisme et au socialisme d’ État».46 Es gäbe jedoch eine Vorstellung, die de Gaulles Denkweise ständig dominiere: «C’ est l’ idée que tout doit concourir pour rendre la France grande et forte».47
Genau da, in der Idee, die eigene Nation wieder zu stärken und zur Geltung zu bringen, unterscheidet sich die Konzeption de Gaulles von der atlantischen Konzeption Europas in Form der Vereinigten Staaten Europas, die mit der supranationalen Idee eines Jean Monnet einhergeht. Und diese Überzeugung der Stärkung des Nationalen ist es, die Anfang der 1960er Jahre generell eher als veraltete Denkweise angesehen oder zumindest abgetan wurde – auch wenn von Salis in seinem Vortrag schliesslich eindeutig mit de Gaulle zu sympathi-sieren scheint. Man fürchtete sich davor, dass durch die Haltung de Gaulles der Nationalismus wieder Aufwind bekommen würde. Dazu schrieb Der Bund im Artikel Der Zweibund: «Indem de Gaulle Deutschland die Freundschaft anbot, überwand er eine Spannung, die seit vierhundert Jahren zum tragischen Schicksal Europas geworden ist; indem er diese Freundschaft so eng und so ausschliesslich als dauernde Bindung zweier Nationen auffasst, bleibt er eben
45 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 25. März 1963, S. 8.46 Jean Rudolf von Salis: De Gaulle face à l’ histoire, 1963, S. 7 f.47 Ebenda, S. 6.
195Skepsis und Desinteresse
jenem Denken zugewandt, dem die nationalen Konflikte entstammen und das gerade jetzt mit dem Aufbau eines vereinigten Europas überwunden wer-den soll».48 Auch ein Teil der Experten der erwähnten Arbeitsgruppe sah in der deutsch-französischen Aussöhnung vom Januar 1963 die Gefahr, dass ein natio nales und nach Hegemonie strebendes Frankreich auch Deutschland wie-der «anstecken» könnte. Minister Peter Anton von Salis – nicht zu verwech-seln mit Professor Jean Rudolf von Salis – dazu: «L’ ,Europe des patries’ […] ne sert aujourd’ hui plus qu’ à étayer l’ hégémonie française. Cette hégémonie pourrait d’ ailleurs céder le pas, dans quelque temps, à une hégémonie franco- allemande, voir même, dans un avenir plus lointain, à une hégémonie alleman-de».49 Die dominierende schweizerische Meinung zu de Gaulles Politik war im Januar 1963: De Gaulle ist auf Isolationskurs und nicht mehr zeitgemäss, allenfalls sogar gefährlich. Und so fragt Der Bund in der Morgenausgabe vom 24. Januar 1963: Wieso sollte sich die Schweiz also für ein Europa entscheiden, in dem möglicherweise «den anderen eine französisch-deutsche Konzeption aufgenötigt werden soll?»50
Vielversprechender mag da in den Ohren der Schweizer die Rede Kennedys vor den Parlamentariern der beiden Häuser des amerikanischen Kongresses in Washington am 14. Januar 1963 geklungen haben, in der sich der amerika-nische Präsident gemäss dem Bund dafür aussprach, «die althergebrachten abendländischen Glaubensinhalte mit einem ‚neuen Humanismus’ zu verbin-den». Kennedy sprach nicht lediglich von deutsch-französischer Versöhnung, sondern von «weltweitem Frieden», von «freiheitlicher Einigkeit», die aber niemals «Uniformität der Ansichten» bedeute.51 Damit, so der Bund-Reporter, zeigte Kennedy «seiner Nation und der Welt, dass er um die Strukturen und Konstellationen weiss, welche das Zusammenleben der Menschheit bestim-men». Wahrscheinlich klinge dies «so herausgegriffen, etwas kaleidoskopartig», entschuldigt sich der Verfasser des Artikels. Vielleicht werde aber dennoch offenbar, dass Kennedy zweierlei fernstehe: einerseits das ominöse «L’ Etat c’ est moi» der französischen Monarchen, hiessen sie nun Louis oder Charles, anderseits das ebenso bedenkliche «Nabel-der-Welt-Denken», das im Zeitalter der weltweiten Interdependenzen immer zwangsläufiger Ausdruck von Kirch-turmpolitik werde: «Es sind also zwei Welten, mit denen wir uns konfrontiert sehen, gewissermassen eine alte und eine neue».
48 C. C.: Der Zweibund, in: Der Bund Nr. 38, 27. Januar 1963.49 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 25. März 1963, S. 6. Gerade
im Hinblick auf heute ist diese Aussage von Minister von Salis besonders interessant. Bestimmt doch heute ein Grossteil der Europapolitik eben dieses starke Deutschland.
50 M. G.: Der Vertrag, in: Der Bund Nr. 34, 24. Januar 1963.51 P. P.: Alte Welt und neue Welt, in: Der Bund Nr. 27, 20. Januar 1963.
Cécile Blaser196
Doch was bedeutete diese «neue Welt» eines Kennedy im Konkreten? Wie stellten er und andere Vertreter der atlantischen Konzeption Europas, wie beispielsweise Paul-Henri Spaak oder Jean Monnet, sich Europa vor, und wie reagierten sie auf die Ereignisse vom 22. Januar 1963? War für die Schweiz das Denken eines de Gaulle tatsächlich veraltet, und sympathisierte sie eher mit der «neuen Welt», die die Konzeption eines Kennedy vorsah?
«Wir haben uns die deutsch-französische Versöhnung gewünscht, aber nie angenommen, dass sie auf Kosten Grossbritanniens erfolgen würde», sagte der belgische Ministerpräsident und Aussenminister Spaak in einem Artikel vom 25. und 26. Januar im Bund als Reaktion auf die Ereignisse.52 Spaak hatte sich als Vorsitzender des intergouvernementalen Ausschusses, der durch seinen Bericht die Verträge von Rom vorbereitete, stets für die supranationale Idee eingesetzt sowie für ein Europa unter Einschluss Grossbritanniens.53 Durch diese Prinzipien war er gerade zu Zeiten der Fouchet-Pläne zu einem der grössten Widersacher de Gaulles geworden.54 Während sich Spaak öffentlich sehr schnell und sehr deutlich gegen de Gaulles Politik aussprach, bemühte sich die US-amerikanische Regierung zu Beginn der Verhandlungen zwischen Adenauer und de Gaulle um Zurückhaltung, um, wie es der Korrespondent der NZZ in seinem Artikel schildert, kein «Öl ins Feuer zu giessen».55 Zwar hätte Washington in seiner Strategie der Festigung der bipolaren Weltordnung nichts gegen ein Europa als einen zweiten Pol in einer geschlossenen westli-chen Allianz auszusetzen gehabt – dies zeigten etwa die beiden Vorhaben der Kennedy-Administration, eine grosse europäisch-atlantische Gemeinschaft anhand der amerikanischen Trade Expansion Act oder des Grand Design zu
52 Spaak bezeichnet Frankreichs Methode als «unzulässig», in: Der Bund Nr. 37, 25./26. Januar 1963, S. 32.53 Vgl. Sylvain Kahn: Histoire de la construction de l’ Europe depuis 1945, Paris 2011, S. 78-81.54 In einem Bericht der Schweizer Mission in Brüssel vom Februar 1961 steht dazu: «Les Pays-Bas voient
dans les plans de [de] Gaulle la reconstruction d’ une hégémonie continentale et napoléonienne, alors que leur intérêt est de voir s’ établir une Europe forte, mais large, où les grandes puissances s’ équilibrent les uns les autres. Pour cette seule raison, la présence du Royaume-Uni est indispensable» (Paul Henri Würth : Aktennotiz, Note sur la réunion du «sommet européen» à Paris les 10 et 11 février 1961, Brüssel 23. Februar 1961, S. 2, in: Das Schweizerische Bundesarchiv, E 2001(E)1976/17/ 200, http://db.dodis.ch/document/16511 [28.06.2014]). In einem späteren Gespräch zwischen Botschafter Soldati und General de Gaulle über die Schwierigkeiten der Bildung einer Politischen Union, sagt de Gaulle ganz klar: «Le cas de la Belgique est différent. Là il n’ y a qu’ un problème: Spaak. Spaak n’ est d’ accord avec rien [...]» (Agostino Soldati: Berich-terstattung / Aufzeichnung (CR), Entretien avec le Président de la République, le 1er mars 1962, à 15.30 heures, Paris, 1. März 1962, S. 5, in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 2300(-)1000/716/ 356, Berichterstattung: Paris, http://db.dodis.ch/document/30280 [25.07.2014]).
55 Der Auslandkorrespondent der Neuen Zürcher Zeitung berichtet über die «zwiespältigen Gefühle in Washington»: «Nichts hat man hier seit Jahren sehnlicher gewünscht als eine in soliden, unverbrüchlichen Absprachen kulminierende deutsch-französische Annäherung – und nichts fürchtet man heute so sehr wie ein exklusives Paris-Bonn-Arrangement kleineuropäischer Konzeption. [...] Die Überzeugung ist hier tief verwurzelt, dass die weiter umspannende Konzeption ,in der Logik der Geschichte’ liege und sich des-halb früher oder später durchsetzen werde. [...] Jedenfalls gibt man die Vorstellungen von einem geeinten Europa in Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten nicht leicht preis» (vgl. W. I.: Die deutsch-französische Zusammenarbeit, in: Neue Zürchre Zeitung Nr. 270, 23. Januar 1963).
197Skepsis und Desinteresse
schaffen. Eine Abkehr eines kontinentalen Europas als so genannte Dritte Kraft von der Atlantischen Gemeinschaft und somit der US-amerikanischen Dominanz, wie es de Gaulle beabsichtigte, galt es jedoch zu verhindern.56 Jean Monnet hielt am 23. Januar 1963 im Rahmen der Entgegennahme des Freedom House-Award eine Rede, in der er gezielt scharf gegen de Gaulles kontinentale Konzeption Stellung nahm und sie als altmodisch und statisch abtat: «Nous devons nous rappeler, comme l’ ont prouvé les deux guerres mondiales, que lorsqu’ on en arrive aux questions fondamentales[,] la Grande-Bretagne fait partie de l’ Europe. En Angleterre et sur le continent, nous devons nous libérer de la conception périmée et statique que la Grande-Bretagne, parce qu’ elle est une île, est vouée à être insulaire, qu’ elle n’ appartient pas à l’ Europe et que sa politique commerciale et ses intérêts la tiendront toujours à l’ écart de la ten-dance naturelle qui conduit l’ Europe à s’ unifier».57 Unterstützt wurde Monnet in seiner Meinung von seinem langjährigen Freund und Vertrauten, dem ame-rikanische Unterstaatssekretär George Ball. Der Standpunkt der Vereinigten Staaten und der «Atlantiker» war somit absolut klar. Erstens: «Wir wollen ein vereinigtes Europa», so auch der amerikanische Botschafter Charles E. Bohlen in Paris.58 Und dies bedeute eben auch den Beitritt Grossbritanniens in die EWG. An diesem Standpunkt hätten auch die dramatischen Verhandlungen in Brüssel nichts geändert, so der US-Botschafter. «Il est plus qu’ important, il est indispensable, que la Grande-Bretagne se joigne à notre Communauté européenne», so auch Monnet in seiner Rede an der Feedom House-Gala, denn «nous démontrerons à la fois à nous-mêmes, à l’ Union soviétique et au reste du monde, par l’ unité de l’ Europe et par son association sur un pied d’ égalité avec les États-Unis, que l’ Occident ne peut pas être divisé».59
Als Gründervater der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der einzigen wirklich supranationalen Organisation, sieht Monnet auch für die Einigung Europas eine supranationale Lösung. Damit vertritt er die bekannte amerikanische Auffassung, die der stellvertretende Leiter des Policy Planning Board im amerikanischen Staatsdepartement auch noch einige Monate später, am 23. Juli 1963 in einem Gespräch in Washington gegenüber
56 Vgl. Corine Defrance & Ulrich Pfeil: Der Élysée-Vertrag und die deutsch-französischen Beziehungen: Eine Einleitung, in: Corine Defrance & Ulrich Pfeil (Hg.): Der Élysée-Vertrag und die deutsch-französischen Beziehungen. 1945–-1963-2003, München 2003, S. 9–46 und 15 f.
57 Lorsqu’ on en arrive aux questions fondamentales la Grande-Bretagne fait partie de l’ Europe déclare le fondateur de la C.E.C.A., in: Le Monde, 25. Januar 1963. Die Auszeichnung wurde Jean Monnet, dazu-mal Präsident des Aktionskomitees für die Vereinigten Staaten von Europa von der amerikanischen Non-Profit-Organisation Freedom House für sein Wirken im Dienste der Schaffung eines geeinten Europas zuerkannt (vgl. S. W.: Die Krise der europäischen Integration in amerikanischer Sicht, Die Europakonzep-tion Jean Monnets, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 285, 24. Januar 1963).
58 Schwere Besorgnis hüben und drüben, in: Basler Nachrichten Nr. 29, 21. Januar 1963, S. 2.59 Lorsqu’ on en arrive aux questions fondamentales la Grande-Bretagne fait partie de l’ Europe, déclare le
fondateur de la C.E.C.A., in: Le Monde, 25. Januar 1963.
Cécile Blaser198
dem Chef des schweizerischen Integrationsbüros, Paul Rudolf Jolles, äussert, und zwar, dass «das Nationalstaatentum in Europa historisch überholt» sei und eine «politische Einigung unvermeidlich» erscheine, falls Europa weiterhin in der Weltpolitik eine Rolle spielen wolle.60 Die politische Zukunft Europas sieht in den Köpfen der Vertreter der atlantischen Konzeption supranational aus. Diese Überzeugung der Supranationalität äussert Monnet auch in einem Gespräch mit dem Pariser Botschafter Soldati. In der Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» vom 25. März 1963 berichtet der Schweizer Botschafter: «Interrogé sur les raisons véritables de l’ ,allergie’ des Six à l’ égard d’ une association des pays neutres, M. Monnet a exprimé l’ avis qu’ il fallait admettre […], que pour arriver à l’ échelon supranational, les décisions devaient être prises par une autorité supranationale». Diese Aussage, so Soldati, «révèle l’ incompatibilité fondamentale des conceptions de M. Monnet et de celle du Général [de] Gaulle».61 Sie zeigt aber im Grunde viel mehr als das, nämlich auch die Inkompatibilität bzw. die Unvereinbarkeit der Schweiz mit der atlan-tischen Konzeption Europas eines Jean Monnet. In der Sitzung vom 25. März kommt Soldati deswegen zum Schluss: «Pour la Suisse, le nationalisme peut donc être tout aussi dangereux que le supranationalisme». Und auch Bundesrat Hans Schaffner pflichtet Soldati bei, dass der Schweiz «sowohl der Nationalis-mus als auch der Supra-Nationalismus gefährlich werden können». Ganz nach dem Motto «Wenn Zwei sich streiten, freut sich der Dritte» fügt Schaffner an, dass in diesem Sinne die Politik de Gaulles der Schweiz nicht «völlig ungele-gen» komme. Der Bundesrat habe sich in einer schwierigen Lage befunden, so Schaffner: «Immer wieder wurde ihm vorgeworfen, den europäischen Eini-gungsbestrebungen nicht offen genug gegenüberzustehen».62 Auch National-rat Karl Wick ist der Meinung, dass der Abbruch der Brüsseler Verhandlun-gen durch de Gaulle der Schweiz eine «willkommene Atempause» gebracht habe. De Gaulle bekämpfe den europäischen Dirigismus, den auch die Schweiz bekämpfe. In diesem Sinne sei die Pressekonferenz de Gaulles eine «Götter-dämmerung der Ideologie», so der Volkswirtschaftsprofessor und Berater des Bundesrats, Eugen Böhler. Sie habe die politischen Lügen blossgestellt, zu wel-chen in der jüngsten Vergangenheit wie nie zuvor Zuflucht genommen wurde: «Wir wohnen einem Aufstand der realen politischen Kräfte gegen einen Kon-formismus bei, welcher letzten Endes aus den Vereinigten Staaten kommt».63
60 Paul Rudolf Jolles: Note, Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter des Policy planning board des amerika-nischen Staatsdepartementes über die europäische Integration in Washington am 23. Juli 1963, Washington 23. Juli 1963, S. 1 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E 7001(C)1975/52/ 14, EFTA-EWG und die Schweiz, 1963, http://db.dodis.ch/document/30356 [27.07.2014]).
61 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 25. März 1963, S. 3.62 Ebenda, S. 7 und 8.63 Ebenda, S. 13.
199Skepsis und Desinteresse
Minister Weitnauer schliesst die Sitzung der Arbeitsgruppe und resümiert: «De Gaulle kommt das Verdienst zu, die Integrationsbestrebungen auf rea-listischere Voraussetzungen zurückgeführt und eine Atempause geschaffen zu haben». Selbst in der Schweiz sei es in den letzten zwei bis drei Jahren schwer gewesen, auf gewisse Tatsachen hinzuweisen: «In dieser Beziehung brachte der Zusammenbruch der Brüsseler Verhandlungen eine heilsame Ernüch-terung».64 Eine Ernüchterung, so scheint es, auch für die Schweiz, und zwar in dem Sinne, dass für sie – entgegen der vermuteten These, wonach sich die Schweiz eher Richtung Grossbritannien und Vereinigten Staaten orientierte – weder die kontinentaleuropäische, noch die atlantische politische Konzeption Europas ein attraktiver und für die Zukunft zu begehender Weg darstellte.
Der Weg der Schweiz: Wirtschaftliche vor politischer IntegrationSowohl die Integration in ein supranationales System wie auch einen Rückfall in den Nationalismus – wie man es anhand des Beispiel Frankreichs verurteilte – widerstrebte der Schweiz. Doch was wollte sie, und wie orientierte sie sich um 1963, wenn es ihr erklärtes Ziel war, sich in Bundesrat Wahlens Worten «nicht in eine Isolation gedrängt sehen» zu wollen?65 Als Reaktion auf die Pressekonfe-renz von Präsident de Gaulle hatte sich der Bundesrat soweit geäussert, dass die Entschlossenheit im Innern wichtig sei, «das eigene Haus in Ordnung zu halten» und die Kaufkraft des Frankens durch eine gemeinsame Anstrengung zu erhal-ten, um nicht die relativ starke wirtschaftliche Stellung zu verlieren. Dies sei umso wichtiger, so der Berichterstatter im Bund «als rund 50 Prozent unserer Exporte nach den EWG-Staaten gehen und mit diesen also auf irgendeine Weise ein ‚modus vivendi’ gefunden werden kann».66 Grundsätzlich galt es für die Schweiz stets, einen Weg bzw. eine Lösung zu finden, die es ihr erlauben würde, an ihren drei, immer wieder in folgender Rangordnung genannten Prinzipien festhalten zu können: an der bewaffneten und immerwährenden Neutralität, an der Refe-rendumsdemokratie sowie am Föderalismus.67 Minister Weitnauer stellte in der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» fest: «Die schweizerische Aussenpolitik kreist um den Begriff der Neutralität. Darunter verstehen wir im Grunde dasselbe wie Unabhängigkeit».68
64 Ebenda, S. 17.65 Friedrich Traugott Wahlen: Aktennotiz, Gespräch mit dem Präsidenten de Gaulle vom 17. November 1961,
Bern 22. November 1961, S. 2 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E2804#1971/2#446*, Besuche von Persön-lichkeiten, http://db.dodis.ch/document/30270 [29.06.2014]).
66 Vgl. Der Bundesrat zur Krise der EWG-Verhandlungen, in: Der Bund Nr. 27, 20. Januar 1963. 67 Vgl. Georg Kreis: Kleine Neutralitätsgeschichte der Gegenwart, Ein Inventar zum neutralitätspolitischen Dis-
kurs in der Schweiz seit 1943, Bern 2004, S. 96.68 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1961, S. 4.
Cécile Blaser200
Als eigentliche Leitlinie für die Handhabung der Neutralität gelten die im Jahre 1954 vom Eidgenössischen Politischen Departement zum internen Gebrauch erlassenen Grundsätze zur Neutralitätspolitik – die so genannte Bindschedler- oder Petitpierre-Doktrin, nach der insbesondere zwischen poli-tischem und technischem Engagement unterschieden wird. Daraus schliesst der Bundesrat, dass sich die Schweiz aus Neutralitätsgründen von politischen und militärischen Zusammenschlüssen fernhalten müsse und aus Solidaritäts-gründen nur in Organisationen wirtschaftlicher, humanitärer und technischer Natur aktiv mitarbeiten könne.69 Vor diesem Hintergrund ist also die Neutra-litätsdebatte zu sehen, die Anfang der 1960er Jahre geführt wird. Und so über-rascht es nicht, dass Minister Weitnauer in der Arbeitsgruppe darauf beharrt, dass «eine gewisse freundliche Distanz geboten» sei, soweit es sich um «politi-sche Tatbestände» handle, obwohl es der Schweiz tatsächlich darum ging, sich eben nicht gänzlich zu isolieren, sondern «eine Dauerform des Zusammenle-bens mit der EWG zu finden». Die Überlegungen, welche die offizielle Schweiz zum Schluss kommen lässt, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft gegen-über eine skeptische Haltung einzunehmen, fasst Minister Weitnauer wie folgt zusammen: «Die EWG ist ein Wirtschaftsunternehmen, welches aber zu einem fortschreitenden politischen Zusammenschluss der Mitgliedstaaten führen soll».70 Die Kombination dieser beiden Integrationsebenen – die wirtschaftli-che mit der politischen – betrachtet Bundesrat Wahlen, dann auch als Grund für die «aktuelle Krise», in der sich Europa nach dem Scheitern der Beitritts-verhandlungen mit England befand. In einer Aktennotiz zu einem Gespräch mit dem amerikanischen Botschafter in Bern, Robert Moody McKinney, vom 31. Januar 1963 steht: «Pour M. Wahlen, la conclusion à tirer de la crise actuelle est qu’ on ne peut pas combiner une union économique et une union politique. Pour sa part, la Suisse a toujours trouvé qu’ il fallait séparer les deux choses». Aus Wahlens Sicht würde die westliche Welt alleine dadurch gestärkt, indem sie sich in einer grossen Freihandelszone zusammentäte: «L’ occident serait renforcé par une large zone de libre-échange. Cette solution aurait l’ avan-tage de laisser la petite Europe des Six poursuivre sa voie tout en permettant une participation des Anglais et des neutres au Marché Commun». Denn, so
69 Die Leitsätze galten seit ihrer Publikation im Jahr 1957 im Schweizerischen Jahrbuch für Internationales Recht als «offizielle Schweizer Konzeption der Neutralität» (vgl. Jon A Fanzun. & Patrick Lehmann: Die Schweiz und die Welt. Aussen-und sicherheitspolitische Beiträge der Schweiz zu Frieden, Sicherheit und Sta-bilität, 1945–2000, Reihe «Zürcher Beiträge zur Sicherheitspolitik und Konfliktforschung», Bd. 57, Zürich 2000, S. 66. Vgl. ebenfalls den Artikel im Bd. 2013 der vorliegenden Schriftenreihe: Bernhard Altermatt: Debatten über die schweizerische Aussen- und Europapolitik im Spannungsfeld zwischen Krieg und Frie-den, zwischen Neutralität und Kooperation, in: Bernhard Altermatt & Gilbert Casasus, 50 Jahre Engagement der Schweiz im Europarat 1963–2013, Zürich/Chur 2013, S. 263–279.
70 Vgl. Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 18. Dezember 1961, S. 5 und 9.
201Skepsis und Desinteresse
Wahlen, «[...] ceux qui veulent faire l’ unité politique de l’ Europe sont toujours trop pressés. C’ est l’ unité économique qui renforcera l’ Europe».71
Die Überzeugung Wahlens, dass sich Europa durch einen wirtschaftlichen Zusammenschluss und eine wirtschaftliche Kooperation verfestigen könne, ist in ihrem Ansatz atlantisch. Bereits mit der Verkündung des Marshallplans hatte die USA die europäischen Staaten dazu aufgefordert, untereinander zu kooperieren und eine Form des Zusammenschlusses zu finden, der die Vertei-lung der in Aussicht gestellten 13 Milliarden Dollar in Form von Entwicklungs-geldern für den Wiederaufbau Europas regeln sollte. Das führte am 16. April 1948 zur Bildung der Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammen-arbeit (Organisation for European Economic Co-operation OEEC), nach ame-rikanischer Auffassung eine Art Idealtyp der europäischen Integration.72 Auch wenn es in der OEEC nicht darum ging, Zollschranken abzubauen und eine Freihandelszone zu bilden – im Unterschied zu den Plänen der Schweiz Ende der 1950er und Anfang der 1960er Jahre –, so war die Idee dahinter doch die gleiche: ein durch wirtschaftliche Kooperation gestärktes Westeuropa. Denn, obwohl der Marshallplan theoretisch auch an die Sowjetunion sowie andere kommunistische Länder gerichtet war, und es sich demzufolge auch um eine dem Osten offenstehende Organisation handelte, lehnte die Sowjetunion ein Mitwirken an der OEEC ab und reagierte stattdessen mit dem Molotow-Plan und der Gründung des Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW).73
Nach dem Scheitern der englischen Idee einer grossen, industriellen Freihandelszone, die aus allen europäischen Mitgliedstaaten der OEEC beste-hen sollte im November 1958, wirkte die Schweiz an der Schaffung einer klei-nen Freihandelszone, der EFTA, mit, die zum Ziel hatte, die Zölle für die von den Mitgliedstaaten produzierten Waren stufenweise aufzuheben – parallel zum internen Zollabbau der EWG.74 Mit der Gründung der EFTA Anfang 1960
71 Pierre Micheli: Aktennotiz, Viste de M. McKinney, Ambassadeur des Etats-Unis d’ Amérique, chez le Chef du Département, Bern 31. Januar 1963, S. 2 und 3 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E2804#1971/2#310*, USA, http://db.dodis.ch/document/18942 [06.08.2014]).
72 «Elle [l’ OEEC] témoigne ainsi de ce qu’ aurait pu être une construction européenne de type idéalisme à l’ américaine: une association fondée sur la libéralisation des échanges, privilégiant le point de vue des acteurs économiques et leur intégration», so Sylvain Kahn in seinem Buch zur europäischen Integration (Sylvain Kahn: Histoire de la construction de l’ Europe, 2011, S. 46).
73 Ebenda, S. 39–43. Neutralitätspolitisch hat die offizielle Schweiz bzw. Aussenminister Petitpierre den politi-schen Willen, sich an der OEEC zu beteiligen, übrigens mit dem Hauptmotiv der «Solidarität mit dem aufbau-bedürftigen Europa» und eben diesem Hinweis, dass es sich bei der OEEC um eine auch nach Osten offene Organisation handle, gerechtfertigt (vgl. Georg Kreis: Kleine Neutralitätsgeschichte der Gegenwart, 2004, S. 264).
74 Insbesondere der spätere Bundesrat Schaffner, damals Direktor der Eidg. Handelsabteilung, kam im Zuge der EFTA-Gründung eine federführende Rolle zu. Er war es, der in enger Zusammenarbeit mit Gross-britannien und Schweden die Verhandlungen in Genf organisierte, welche schliesslich dazu führten, dass die sieben Nicht-EWG-Staaten Grossbritannien, Schweden, Norwegen, Dänemark, Österreich, Portugal und die Schweiz am 4. Januar 1960 die Konvention von Stockholm (EFTA-Konvention) unterschrieben, welche die EFTA begründete (vgl. Claude Altermatt: La politique étrangère de la Suisse. Pendant la guerre froide, Lausanne 2003, S. 64).
Cécile Blaser202
als Alternativorganisation zur EWG waren für die Schweiz die Probleme, die durch das ambitiösere Wirtschaftsprojekt der Sechs aufgeworfen waren, nicht gelöst. Es mussten Mittel und Wege gesucht werden, die Mauer des EWG- Aussenzolls zu senken oder gar zu beseitigen, weswegen die EFTA-Staaten bald darauf, mehr oder weniger orchestriert durch die EFTA-Solidaritätser-klärung, ihre Beitritts- oder Assoziationsgesuche an die EWG stellten.75 Die Schweiz war mit der EFTA grundsätzlich jedoch sehr zufrieden. Sie sah darin einen Weg, sich durch die Funktion der Brückenschlag-Politik am europäi-schen Einigungsprozess zu beteiligen, «ohne darin aufzugehen», so der ETH- Geschichtsprofessor Herbert Lüthy in der Sitzung der Arbeitsgruppe «Histo-rische Standortbestimmung» vom 20. März 1962.76
Als die britischen Beitrittsverhandlungen Ende Januar 1963 scheiterten, war dies für den liberalen Nationalrat Olivier Reverdin auch ein Zeichen dafür, dass de Gaulle vor allem eines zum Ziel hatte: die wirtschaftliche Spal-tung Europas. In der Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestim-mung» vom 25. März 1963 sagte er: «L’ étude de la conférence de presse du 14 janvier n’ admet qu’ une conclusion: de Gaulle veut le schisme économique de l’ Europe».77 Doch weder die Bestrebungen de Gaulles, Westeuropa in zwei wirtschaftliche Teile zu spalten, noch das Scheitern der England-Verhandlun-gen würden an der «grundsätzlichen schweizerischen Haltung [etwas ändern], Mittel und Wege zu einer Überwindung dieser Spaltung und einer Erhaltung des wirtschaftlichen Integrationsgrades zu finden», so der Chef des Integra-tionsbüro Jolles in einer Notiz vom 15. Januar 1963 an die Bundesräte Wahlen und Schaffner. Als ein möglicher Weg, um dieses Vorhaben zu realisieren – allenfalls in Form einer «Alternativlösung durch einen Zusammenschluss EFTA / Commonwealth / USA» – verweist Jolles auf die anstehende Zolltarif-konferenz im Rahmen des Allgemeine Zoll- und Handelsabkommens (GATT): die nach dem US-amerikanischen Präsident benannte Kennedy-Runde.78 Dass der Bundesrat mit den Vorstellungen Jolles einig ging, zeigt die Berichterstat-tung der NZZ. In der Abendausgabe vom 18. Januar schreibt die Zeitung nach einer Pressekonferenz, dass der Bundesrat den Grundsatz verfolge, eine «han-delspolitische Spaltung Europas in zwei Blöcke zu verhindern». Es sei dies der Grundsatz, den der Bundesrat in seiner ganzen Politik verfolge, nämlich, «das Streben nach einem einheitlichen Handelsraum, der auch nach aussen, also
75 Vgl. Georg Kreis: Kleine Neutralitätsgeschichte der Gegenwart, 2004, S. 96 sowie weiter oben.76 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll, Protokoll der Sitzung vom 20. März 1962,
Bern 20. März 1962, S. 5 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E9500.225#1996/436#1*, Protokolle, vol. I, http://db.dodis.ch/document/34187 [04.08.2014]).
77 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 25. März 1963, S. 4.78 Paul Rudolf Jolles: Aktennotiz vom 29. Mai 1963, S. 2 und 3.
203Skepsis und Desinteresse
über den europäischen Kontinent hinaus, geöffnet wäre».79 Tatsächlich betei-ligte sich die Schweiz danach aktiv an der Kennedy-Runde. Bei der ersten Ministerkonferenz des GATT zur Vorbereitung der Kennedy-Runde im Mai 1963 in der Genfer Villa Le Bocage hatte Bundesrat Schaffner sogar das Prä-sidium inne. «Im praktischen Bereich ist die Kennedy-Runde die eklatanteste Verwirklichung der atlantischen Partnerschaft», so Weitnauer in der Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» vom 30. November 1963, also sechs Monate nach der ersten Ministerkonferenz.80 Nach zähen und lang andauernden Verhandlungen, am 30. Juni 1967 – dem allerletzten Tag, bevor die Bewilligung für die Zollsenkungsrunde durch den amerikanischen Trade Expansion Act abgelaufen wäre – kamen die fast 70 beteiligten Län-der zu einer Übereinkunft, wodurch die Zölle auf industrielle Erzeugnisse um durchschnittlich 38 Prozent gesenkt und die wirtschaftlichen Interessen der Schweiz somit im Rahmen eines atlantischen Organs gelöst werden konnten.81
Die Beispiele der OEEC, der EFTA und der Kennedy-Zollrunde innerhalb des GATT zeigen, dass die Schweiz trotz politischer Neutralität eine äusserst aktive Aussenwirtschaftspolitik führte – eine Politik, die im Ergebnis zur «wirt-schaftlichen Integration ohne politische Partizipation» führte.82 In Bezug auf die zweite These des vorliegenden Beitrags gilt es demnach festzuhalten, dass die Schweiz auf der Ebene der wirtschaftlichen Integration eindeutig mit der atlantischen Konzeption sympathisierte.83 Dies zeigen exemplarisch auch die Ausführungen von alt Bundesrat Max Weber, der in der Sitzung der Arbeits-gruppe «Historische Standortbestimmung» vom 30. November 1963 sagte: «Im politischen Bereich kann die Schweiz an einer atlantischen Konzeption nicht mitarbeiten»; die EFTA aber könne «vor allem in den GATT-Verhand-lungen» den amerikanischen Standpunkt unterstützen.84 Als einer der sieben EFTA-Mitgliedstaaten war damit auch die Schweiz gemeint.
Unmittelbar zum Zeitpunkt der deutsch-französischen Ministerkonferenz, die zum Élysée-Vertrag führte, veröffentlichte die Schweizer Regierung am
79 Die Schweiz und die europäische Integration. Eine Aussprache im Bundesrat, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 210, 18. Januar 1963.
80 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung, Die Schweiz und die Probleme der westlichen Welt, Bern 30. November 1963, S. 11 (in: Schweizerisches Bundesarchiv, E9500.225#1000/1190#1*, Protokolle der Arbeitsgruppe, https://db.dodis.ch/document/34192 [18.03.2014]).
81 Vgl. die synthetische Darstellung: Kennedy-Runde, Geier überm Busch, in: Der Spiegel Nr. 22, 22. Mai 1967, S. 122–126.
82 Diese vielzitierte Formulierung wurde vom Schweizer Politikwissenschaftler Alois Riklin Anfang der 1970er Jahre in seinen grundlegenden Werken zur schweizerischen Aussenpolitik geprägt (vgl. Jon A Fanzun & Pat-rick Lehmann: Die Schweiz und die Welt, 2000, S. 83).
83 Zu einer Annäherung an die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft kam es erst 1972 in Form des Freihandels-abkommens mit der EWG (vgl. ebenda, S. 69; Georg Kreis: Kleine Neutralitätsgeschichte der Gegenwart, 2004, S. 123). Vgl. auch Bernhard Altermatt & Gilbert Casasus: 50 Jahre Engagement der Schweiz im Europarat, 2013.
84 Beide Zitate: Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 30. November 1963, S. 3.
Cécile Blaser204
22. Januar 1963 die angekündigte Botschaft des Bundesrats für die endgültige Beschlussfassung über den Beitritt der Schweiz zum Europarat.85 Diese ebnete den Weg, damit die Schweiz am 6. Mai 1963 als Vollmitglied dem Europarat beitreten konnte. Obwohl der 1949 gegründete Europarat keine wirtschaftliche Organisation war, sondern im Gegenteil auf die Rede Winston Churchills vom 19. September 1946 in Zürich und seine Idee der Vereinigten Staaten Europas zurückging – und somit ursprünglich klar politisch motiviert war –, stand für die offizielle Schweiz 1963 der Europaratsbeitritt scheinbar nicht im Widerspruch mit der schweizerischen Neutralitätspolitik. Diese Kurswende begründete der Bundesrat damit, dass der Europarat ein anderer geworden sei, insbesondere weil gewisse Bereiche von den inzwischen entstandenen Europäischen Gemein-schaften übernommen worden seien. Die Schweiz gelangte 1963 zum Schluss, dass der Europarat zwei für sie wichtige Funktionen übernehmen könnte, so Georg Kreis: «Das gewachsene Interesse der Schweiz an Europa ergab sich vor allem aus zwei Umständen: zum einen, weil der Europarat nach der Spaltung in die Blöcke der EWG- und der EFTA-Staaten eine wichtige Klammerfunktion enthielt, und zum anderen, weil er für die Schweiz jene Forumsfunktion über-nehmen musste, welche die von der OECD abgelöste OEEC zuvor für sie erfüllt hatte».86 Damit war der Beitritt zum Europarat also wiederum wirtschaftlich motiviert, indem er für die Schweiz einerseits ein Verbindungsglied zwischen zwei Wirtschaftsorganisationen und anderseits ein Ersatz für eine Wirtschafts-organisation darstellte. Zwar bildete der Europarat Anfang der 1960er Jahre, wie es Nationalrat Reverdin in einer Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung» äusserte, «un organe d’ importance secondaire».87 Trotz-dem waren sich sowohl die offizielle wie auch die öffentliche Schweiz bewusst, dass der Europarat nach dem Ideengut Jean Monnets ausgerichtet war oder er zumindest die Institution war, die dem Gedankengut der Anhänger der Verei-nigten Staaten von Europa ein Forum bot – und somit primär eine atlantische
85 Vgl. Der Beitritt der Schweiz zum Europarat, in: Neue Zürcher Zeitung Nr. 258, 22. Januar 1963.86 Wer oder was sich genau geändert hatte, wurde in der Literatur oft diskutiert und soll hier nicht weiter
besprochen werden (vgl. Georg Kreis: Kleine Neutralitätsgeschichte der Gegenwart, 2004, S. 110 f.; Rudolf Wyder: Die Schweiz und der Europarat 1949–1971. Annäherung und zehn Jahre Mitarbeit in der Parlamenta-rischen Versammlung, Bern/Stuttgart 1984).
87 Die Klammer- und Forumsfunktion des Europarats trat ebenfalls in den Äusserungen von alt Bundesrat Max Weber und Nationalrat Olivier Reverdin in der Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbe-stimmung» vom 20. März 1962 zu Tage. So sah Weber in der Mitarbeit im Europarat die für die Schweiz ungemein wichtige Möglichkeit, ihre Kontakte «mit den massgebenden Kreisen der EWG auszubauen» (Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 20. März 1962, S. 14). Reverdin war der Meinung, dass die Schweiz, durch Personen mit einer gewissen Ausstrahlung repräsentiert werden sollte: «Il faudrait que nous soyons représentés par des individus doté d’ un certain rayonnement spirituel et qui, au lieu de s’ isoler comme c’ est bien souvent le cas, sachent nouer des contacts utiles à notre pays» (ebenda, S. 8).
205Skepsis und Desinteresse
Konzeption Europas vertrat.88 Indem die Schweiz der Organisation im Mai 1963 trotzdem beitrat, bezog sie einmal mehr Stellung.
Schlussfolgerung: Skepsis und DesinteresseObwohl die Schweiz mit ihrer eigenen Geschichte und kulturellen Beschaf-fenheit als Modell für die deutsch-französische Aussöhnung im Kleinen und die europäische Integration im Grossen betrachtet werden kann, und obwohl sie 1963 – das zeigt die Aussage Konrad Adenauers an einer Pressekonferenz in Bonn, kurz nach der Unterzeichnung des Élysée-Vertrags in Paris – auch als solches wahrgenommen wurde, nahm sie diese Einladung, für die deutsch- französische Versöhnung und für Europa Modell zu stehen, nicht an.89 Sie tat dies einerseits aus einer gewissen Skepsis bezüglich dem Erfolg des Vertrages heraus; so war im Bund beispielsweise zu lesen: «das gegenseitige Verstehen zwischen Deutsch und Welsch, das wissen wir Schweizer, ist nicht leicht, setzt aufgeschlossene Bereitschaft und ein Näherrücken während Generationen vor-aus».90 Deswegen sei es angebracht, vorerst einmal nichts zu tun und abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln würden. Andererseits wurde der Élysée- Vertrag aus Sicht der Schweiz – und damit war sie auf dem internationalen Parkett nicht alleine – direkt in Zusammenhang mit dem de Gaull’ schen Nein gegen-über einem EWG-Beitritt Grossbritanniens und somit mit dem vermeintlichen Coup de Gaulles gegen die atlantische Konzeption Europas betrachtet. Da sich die offizielle Schweiz Anfang 1960, koordiniert mit den anderen EFTA-Staaten, selbst für eine Assoziation mit der EWG interessierte und somit einen aktiven Schritt Richtung EWG getan hatte, sah sie nach der durch Frankreich verschul-deten Zäsur im Hinblick auf die Assoziationsgesuche keinen Grund, zu han-deln. Sie entschied sich explizit «nicht führend» in die Ereignisse einzugreifen – als Modell oder in welcher Form auch immer.91 Die Schweiz reagierte also tatsächlich kaum auf die Unterzeichnung des Élysée-Vertrags.
Entgegen der vermuteten These, dass sich die Schweiz um 1963 lieber Rich-tung Grossbritannien und USA orientierte, statt mit Deutschland und Frank-reich zu kooperieren, muss nach der Untersuchung der Akten festgestellt wer-den, dass auf den ersten Blick auf der politischen und diplomatischen Ebene
88 In einem Bericht über die 14. Session des Europarats, an der auch die Schweiz teilnahm, schreibt der Bund am 21. Januar 1963, dass man «in den Wandelgängen feststellen [konnte], dass die nicht zur EWG gehörenden Delegationen wieder den Gedanken an eine atlantische Partnerschaft, bestehend aus England und seinen EFTA-Partnern, dem Commonwealth und den Vereinigten Staaten erwogen» (vgl. Gestärktes Europabewusstsein in Strassburg, in: Der Bund Nr. 29, 21. Januar 1963, S. 2).
89 Konrad Adenauer sagte: «J’ espère seulement que nous lui resterons fidèles et qu’ elle [l’ Europe] se fera un jour comme la Suisse s’ est faite» (vgl. L. N.: «L’ Europe se fera comme la Suisse», in: Gazette de Lausanne Nr. 19, 24. Januar 1963).
90 Siehe weiter vorne: C. C.: Der Zweibund, in: Der Bund Nr. 38, 27. Januar 1963.91 Vgl. Der Bundesrat zur Krise der EWG-Verhandlungen, in: Der Bund Nr. 27, 20. Januar 1963.
Cécile Blaser206
keine solche Präferenz festgestellt werden kann. Weder die von de Gaulle inspirierte kontinentale, noch die von einem Kennedy oder Monnet vertre-tene atlantische Konzeption Europas schienen für die Schweiz um 1963 ein attraktiver und begehbarer Weg der Kooperation. Aufgrund der Neutralitäts-doktrin, wonach streng zwischen politischem und technischem Engagement unterschieden wurde, ist dies nicht verwunderlich. Betrachtet man also anstatt die politische die handelspolitische Kooperationsebene der Schweiz, so ist zu erkennen, dass die Schweiz durch ihre Mitgliedschaft in der OEEC / OECD und der EFTA, durch ihre aktive Mitarbeit in der Kennedy-Zollsenkungs-runde innerhalb des GATT sowie durch ihren Beitritt zum Europarat dennoch einer atlantischen Orientierung folgte. Auf der wirtschaftlichen Ebene kann die zweite These demnach bestätigt werden.
Was passierte also 1963 als Reaktion auf die Vertragsabschlüsse in der Schweiz? Nicht viel: Der Vertrag führte lediglich zu etwas Skepsis und sowohl in der öffentlichen wie in der offiziellen Schweiz zu etwas Angst vor einem starken de Gaulle. Der Élysée-Vertrag – als Teil eines französischen Coup gegen die Atlantiker – führte aber gerade bei der offiziellen Schweiz intern zu einer gewissen Erleichterung. Sogar der amtierende Bundespräsident Hans Schaffner sagte in der Sitzung der Arbeitsgruppe «Historische Standortbe-stimmung» unmittelbar nach dem Élysée-Vertrag, dass seitens der Schweiz der Pressekonferenz de Gaulles «eine gewisse befreiende Wirkung nicht abgespro-chen werden» könne.92 Durch den Zusammenprall der beiden Lager konnte die Schweiz, quasi im Windschatten der Ereignisse, unbehelligt ihren Sonderweg weitergehen. Indem es keinen eindeutigen Weg mehr gab, der darin bestand, dass man der EWG als Vollmitglied oder als assoziiertes Mitglied beitreten musste, entfielen für die Schweiz auch die akuten Fragen: Mitmachen oder nicht? Kooperieren oder nicht? Solange ein konzeptioneller Streit zwischen einem Europa nach de Gaulle und einem Europa nach atlantischer Konzeption bestand, konnte die Schweiz getrost, so wie sie dies gerne tut, abwarten. Und so stand die Schweiz 1963 tatsächlich «typisch Schweiz» unbeteiligt daneben. «Nicht an Mut fehlt es ihr», schrieb der französische Soziologe André Siegfried in seiner Studie 1949 verständnisvoll über die Schweiz, «denn kein Volk hat mehr davon, aber diese Haltung [abseits zu stehen] ist die logische Folge einer Politik, der sich zu entziehen der Schweiz nicht ansteht, da sie unweigerlich aus den Prinzipien hervorgeht, welche die Grundlage ihrer Existenz bilden».93
92 Arbeitsgruppe «Historische Standortbestimmung»: Protokoll der Sitzung vom 25. März 1963, S. 7.93 André Siegfried: Die Schweiz, 1949, S. S. 184 f.