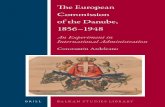Frauen und Männer im Kampf um Leib, Ökonomie und Recht, 1992
Peripherisierung der Ökonomie, Ethnisierung der Gesellschaft: Galizien zwischen äußerem und...
Transcript of Peripherisierung der Ökonomie, Ethnisierung der Gesellschaft: Galizien zwischen äußerem und...
37
Klemens Kaps
Peripherisierung der Ökonomie, Ethnisierung der Gesellschaft : Galizien zwischen äußerem und innerem Konkurrenzdruck (1856–1914)1
Die wirtschaft liche Entwicklung Galiziens in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhun-derts wird sowohl in den zeitgenössischen Diskursen der polnisch-galizischen Elite im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert2 als auch in der Forschung3 als Aufh olprozess beschrieben. Insbesondere ab den 1880er Jahren gelang die Grün-dung von Industrieunternehmen durch externe Investitionen. Der Aufb au einer nachhaltigen Infrastruktur, die dadurch ermöglichte Marktintegration sowie die einsetzende Transformation der bestehenden sozioökonomischen Strukturen legten die Basis für die nachhaltige Wohlstandssteigerung.4 Vergleicht man Schät-zungen des Nationaleinkommens für die Jahre 1841 und 1911/13, so wird hingegen deutlich, dass sich das Wohlstandsniveau zwischen Galizien und den westlichen, großteils industrialisierten Regionen der Habsburgermonarchie nicht angegli-chen hat. Kamen 1841 auf jede in Galizien lebende Person 94 Kronen, betrug der Durchschnitt der westlichen Regionen je nach Schätzung 192–215 Kronen. Nur bei der Annahme des Maximalwerts von 215 Kronen hätte sich Galizien 1911/13 den westlichen Regionen geringfügig angenähert. Zu diesem Zeitpunkt betrug das Pro-Kopf-Einkommen in Galizien 257, in Cisleithanien (Galizien inklusive) 565 Kronen.5
Diese Schätzungen verweisen einerseits auf die starke Kontinuität in der inter-regionalen Arbeitsteilung zwischen Galizien und den Industriezentren in den böh-mischen und österreichischen Ländern. Zugleich machen sie indirekt auf jene De-industrialisierungs- und Prekarisierungsprozesse aufmerksam, die die galizische Gesellschaft seit dem Anschluss an das Eisenbahnnetz der westlichen Regionen der Habsburgermonarchie im Jahr 1856 erfassten.6 Hierbei wirkten zwei unter-schiedliche Prozesse zusammen: Erstens weitete sich das Ausmaß der Warenwirt-schaft (Kommodifi zierung) in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts beträchtlich aus. Der Anteil der über den Markt gehandelten Produkte und Dienstleistungen (Kommerzialisierung)7 nahm zu, wodurch die Eigenproduktion insbesondere bäuerlicher Haushalte zurückging. Dies veränderte die soziale Struktur der Ge-sellschaft nachhaltig, da bisher ausgeübte wirtschaft liche Tätigkeiten zunehmend obsolet und durch neue ersetzt wurden. Neben dieser qualitativen Veränderung von Produktion und Handel verstärkten die Eisenbahnverbindungen den Waren-austausch zwischen den Regionen und lösten dabei Peripherisierungsprozesse aus:8
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 374851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 37 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
38
Eine Reihe sozioökonomischer Aktivitäten wurde in andere Räume verlagert, wo-mit die Schaff ung von Mehrwert bei der Herstellung dieser Güter und Dienstleis-tungen in Galizien ersatzlos verdrängt wurde.
In Galizien verschränkten sich diese beiden Prozesse in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts, indem die zunehmenden Markttransaktionen oft den Absatz von nicht in der Region erzeugten Waren beinhalteten. Für die in Handwerk und Heimarbeit beschäft igte Bevölkerung gingen die ökonomischen Ressourcen dras-tisch zurück, was ab den 1870er Jahren zu einer starken Auswanderung sowie zu sozialen Konfl ikten um die Abwicklung des Warenhandels führte. Diese Konfl ikte richteten sich verstärkt entlang konfessioneller, ethnischer und zunehmend natio-naler Grenzziehungen aus.9 Konkurrenz zwischen verschiedenen räumlichen Ein-heiten mündete schlussendlich in einen Konfl ikt zwischen verschiedenen Gruppen innerhalb eines Raumes. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese ethnischen und nationalen Gruppenidentitäten im Zuge dieses Konfl ikts gefestigt und oft erst de-fi niert wurden.10 Im Folgenden werden die bislang ungenügend erforschten11 öko-nomischen Verdrängungsprozesse nachgezeichnet und anschließend am Beispiel des Hausierhandels aufgezeigt, wie die galizischen Behörden die von den überregi-onalen Fertigwarenlieferungen ausgelöste Konkurrenz um die Warenvermittlung in einen ethnischen Konfl ikt umdeuteten.
Verdichtung von Handelsbeziehungen – Vertiefung von Austauschmustern
Die Handelsbeziehungen zwischen Galizien und den Gewerbe- bzw. Industriezen-tren in den böhmischen und österreichischen Ländern waren seit der Annexion und Etablierung Galiziens durch den habsburgischen Staat 1772 durch ein weit-gehend konstantes Austauschmuster geprägt.12 In letzteren wurden dabei jene Fer-tigwaren (allen voran Metallwaren und Textilien) erzeugt, die in Galizien verkauft wurden. Umgekehrt bedienten sich die böhmischen, mährischen, schlesischen und niederösterreichischen Betriebe galizischer Rohstoff e (wie Industriesalz, Schmiere, Pottasche) und Vorprodukte (Garn, Wachs).13
War dieser Handel in seinem Umfang durch die weiten geografi schen Dis-tanzen, die langen Reisezeiten und die mangelhaft en Verkehrsverbindungen in seinem Ausmaß beschränkt, so nahm die Einbindung Galiziens in den überregi-onalen Warenaustausch durch die Eisenbahnanschlüsse in den Jahren 1847 (mit Preußen) und 1856 (mit dem Teschener Schlesien, Mähren und Niederösterreich) stark zu.14 Über die 1861 in Betrieb genommene Galizische Karl-Ludwig-Bahn, die Wien, Mähren und Schlesien mit Galizien von Krakau im Westen bis Lemberg ver-band, lieferten böhmische und österreichische Fabriken u.a. Maschinen, Textilien, Metall-, Porzellan- und Glaswaren nach Galizien, wo diese aufgrund der gesunke-nen Transportkosten auf eine breite Nachfrage stießen.15 Über den gleichen Weg wurden preußische, englische und französische Textilien importiert, was durch die Senkung der Außenzölle, die der Handelsvertrag zwischen Preußen und der Habs-burgermonarchie von 1853 einleitete, erleichtert wurde.16
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 384851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 38 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
39
Ohne Eisenbahnstrecken wäre die Wirkung der Zollsenkungen allerdings viel schwächer ausgefallen, da gesunkene Transportkosten und reduzierte Fahrzeiten ökonomische Räume miteinander verstärkt in Beziehung setzten. Interregionale Austauschbeziehungen wurden neu defi niert. Die Verdichtung des Eisenbahnnet-zes innerhalb Galiziens wurde in den folgenden Jahrzehnten fortgesetzt: 1869 wur-de die Linie Lemberg–Czernowitz–Suczawa eröff net, 1873–75 die Teilstrecke der Ungarisch-Galizischen Eisenbahn von Przemyśl nach Łupków sowie die Erzherzog-Albrecht-Bahn von Lemberg nach Stanislau in Betrieb genommen. 1885 folgte die wichtige Transversalbahn von Żywiec nach Husiatyn und in den 1890er Jahren die Linien Jasło–Rzeszów und Stanislau–Woronienka. Zahlreiche Nebenlinien integ-rierten zunehmend auch abgelegene Gegenden.17
Unter den mit der Eisenbahn nach Galizien gelieferten Waren befanden sich laut den Angaben des galizisch-polnischen Erdölindustriellen und Politikers Stanisław Szczepanowski im Jahr 1869 78% Halbfertig- und Fertigwaren, 1883 stieg dieser Anteil auf 88%. Der absolute Geldwert dieser Güterkategorie erhöhte sich in dieser Zeit von fast 11 auf 73,3 Millionen Gulden.18 Ordnet man Nahrungs-mittel ebenfalls den Kategorien von Rohstoff en sowie Halbfertig- und Fertigwa-ren zu, machten Industrie- und Gewerbeprodukte 1869 98% und 1883 99% aus. Szczepanowskis Daten erscheinen jedoch als lückenhaft und tendenziös, wenn man sie mit späteren Jahren vergleicht, auch wenn sie in der Tendenz richtig sind.19 1890–92 betrug der Fertigwarenanteil der mit der Eisenbahn nach Galizien einge-führten Halbfertig- und Fertigwaren 75%, 1913 (nur für Westgalizien) 91%.20
Dies macht den Umfang der Wertschöpfung deutlich, den der über die Eisen-bahn vermittelte Fertigwarenabsatz in Galizien einnahm. Zugleich waren die Ex-porte aus Galizien in den Jahren 1869 und 1883, die fast ausschließlich aus unver-arbeiteten Agrargütern und Rohstoff en bestanden, in ihrem Wert jeweils höher. Hingegen waren sowohl 1890–92 als auch 1913 die Außenhandelsbilanzen Galizi-ens bzw. Westgaliziens negativ.21
Die durch die Eisenbahn hergestellte Marktverdichtung mit den Industriezentren brachte der Region in Summe somit keinen Gewinn. Allerdings erwirtschaft eten die Agrargüter- und Rohstoff produzenten beachtliche Profi te, wodurch jene Kaufk raft geschaff en wurde, die den Absatz externer Fertigwaren in Galizien ermöglichte. Dies erklärt die positive Beurteilung des Eisenbahnanschlusses durch die drei galizischen Handelskammern in Brody, Lemberg und Krakau sowie die galizischen Grundbe-sitzer, von denen sich manche fi nanziell am Konsortium der Karl-Ludwig-Bahn be-teiligten. Ab Beginn der 1880er Jahre wurden die Verdrängungsprozesse zu einem Th ema des öff entlichen Diskurses. Die diskutierten Lösungsvorschläge beschränkten sich auf eine Verbesserung der Ausbildung von Handwerkern und Gewerbetreiben-den. Weitergehende Maßnahmen oder eine strukturelle Industrieförderungspolitik wurden erst nach der Jahrhundertwende schrittweise angedacht.22
Die regionale Führungsschicht Galiziens hielt somit an der überregionalen Arbeitsteilung zwischen Peripherie und Zentren fest. Davon profi tierten ein Teil des Agrarsektors und damit die fruchtbaren Gegenden Galiziens (beispielsweise Podolien).23 Hingegen fanden die von ihren gewerblichen Produktionstätigkeiten verdrängten Gruppen nur einen begrenzten Erwerbsersatz.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 394851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 39 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
40
Marktintegration als Verdrängungsprozess
Die von den nach Galizien kommenden Industriewaren ausgelösten Verdrängungs-prozesse betrafen – abgesehen von der großbetrieblich organisierten Eisenproduktion – besonders das Kleingewerbe in der Textil- und Schuherzeugung. Die vorwiegend jüdischen Schuster und Schneider wurden durch böhmische und niederösterrei-chische Warenlieferungen verdrängt und konnten sich aufgrund der beschränkten Nachfrage der bäuerlichen Bevölkerung keinen neuen Absatzmarkt erschließen.24 Die Herstellung von gewöhnlichem Leinen war als wichtige Einkommensquelle vor allem der ruthenischen und polnischen Landbevölkerung in der ganzen Region weit verbreitet.25 Zentren der qualitativ hochwertig orientierten, heimgewerblich organi-sierten Textilerzeugung waren die westgalizischen Bezirke Biała, Myślenice, Wado-wice, Dukla, Jasło, Krosno und Przemyśl.26 Auch wenn diese Form der Leinenerzeu-gung in den 1830er und 1840er Jahren den Anschluss an die sich mechanisierende Textilindustrie in Niederösterreich und den böhmischen Ländern verloren hatte, und in Folge dessen in den östlichen Bezirken Galiziens die Konkurrenz externer Textilien eine gewisse Rolle spielte,27 so verstärkte erst der Eisenbahnanschluss in der ersten Hälft e der 1860er Jahre den Konkurrenzdruck in Ostgalizien.28 Im Bericht der Lemberger Handelskammer für die Jahre 1860–1865 heißt es:
Die Leinenindustrie, welche in den früheren Jahren, besonders in den stär-keren Gattungen, einen ausgedehnten Massstab hatte […], hat seit einigen Jahren allmälig abgenommen und ist auf ein sehr kleines Minimum gesun-ken. Die Ursache hiervon ist der Umstand, dass durch die Besteuerung der Hausindustrie in dieser Branche die Anzahl der Weber sich verringerte, ferner die Flachsspinnereien in Böhmen und Mähren unseren Rohstoff um gute Preise beziehen, was die Leinenindustrie bei uns herabmindert, übrigens auch die Handgespinnste mit den Maschinen Gespinnsten nicht concurriren können.29
Ein Vergleich der Produktionsdaten, die die Handelskammer für die Leinenher-stellung in den Berichtszeiträumen 1861–65 sowie 1866–70 angibt, zeigt allerdings, dass in der zweiten Hälft e der Jahrzehnts 1860/70 das Flachs- und Hanfspinnen in Zentral- und Ostgalizien im Vergleich mit den fünf Jahren zuvor wieder zunahm.30 Dies steht nur scheinbar im Widerspruch zum Boom, den die Leinenerzeugung in den böhmischen Industriezentren durch die Krise der Baumwollindustrie 1864/66 kurzfristig durchlief.31 In dieser Phase wirkte sich nämlich die überregionale Kon-kurrenz mit den Industriezentren in den böhmischen Ländern am stärksten aus. Die dort situierten mechanischen Flachs- und Hanfspinnereien weiteten infolge der verstärkten Nachfrage nach einem Substitutionsprodukt für Baumwollwaren ihre Produktion stark aus, wodurch sich auch die Preise für Flachs und Hanf erhöhten, wie es die Lemberger Handelskammer in ihrem Bericht konstatierte. Daher war es für die Grundbesitzer vorteilhaft er, den Rohstoff für die Leinenerzeugung nicht zur Weiterverarbeitung in der Region zu belassen, sondern zu exportieren, wodurch ein Verarbeitungsschritt aus Galizien in die böhmischen Länder verlagert wurde.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 404851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 40 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
41
Erst nach der Weltwirtschaft skrise von 1873 scheint es zu einer graduellen Ver-drängung der galizischen Garnherstellung durch die böhmischen und mährischen Flachsspinnereien gekommen zu sein. 1882 berichtete der Textilhändler Stanisław Markiewicz, dass die Leinenweber von Korczyna Garn aus Böhmen bezogen.32 Diese Beobachtung stimmt mit dem Anstieg der aus Galizien per Eisenbahn ex-portierten rohen Flachs- und Hanfmengen zwischen 1869 (30.000 Zentner) und 1883 (37.000 Zentner) überein.33 Dies lässt umgekehrt den Schluss zu, dass zumin-dest bis in die 1880er Jahre, als das Eisenbahnnetz eine erneute Verdichtung erfuhr, Flachs- und Hanfspinnerei noch großteils in Galizien betrieben wurde.
Zu berücksichtigen ist die strukturelle Verdrängung von Leinen durch Baum-wolltextilien in der Habsburgermonarchie ab den 1880er Jahren. Während die Baumwollpreise nach der kurzfristigen Versorgungskrise 1864/66 sanken, stie-gen die Leinenpreise stark an, was letzteres zu einem Luxusprodukt machte.34 Erst die Verbindung der billigen Baumwollwaren und des sich verdichtenden Eisenbahnnetzes führte daher in den 1880er Jahren zu einer großfl ächigen Ver-drängung des Leinenheimgewerbes in Galizien. Laut der Landeskommission für industrielle Angelegenheiten sank die Zahl der Weber in ganz Galizien zwischen 1889 und 1902 von 30.000 auf 16.000.35 Diese strukturelle Krise konnte bis zum Ersten Weltkrieg nicht überwunden werden, da die sich ab den 1880er Jahren formierende moderne Textilindustrie in Galizien relativ wettbewerbsschwach war und erst spät (1908) und punktuell mit der Mechanisierung ihrer Produkti-onsanlagen begann.36 Somit konnten diese Betriebe den vorher mit der Heimar-beit befassten Regionen und Bevölkerungsschichten, insbesondere den ehemali-gen Spinnerinnen und Webern in den Dörfern Zentral- und Ostgaliziens, keinen Ersatz bieten.37
Von den durch die Eisenbahnverbindungen bewirkten Umstrukturierungen waren auch andere Gewerbe sowie eine Reihe von Dienstleistungen betroff en, die vorwiegend bzw. ausschließlich von galizischen Juden betrieben wurden. Laut jü-discher Zeitungen aus dem Jahr 1904 verloren 200.000 galizische Juden durch die Eisenbahn ihren Erwerb. Darunter waren 20.000 Wirte und 5.000 Fuhrleute. Sie wurden von ihren erlernten Berufen in prekäre Beschäft igungsfelder verdrängt. Dazu zählten verschiedene Formen des Klein- und Wanderhandels, wie der Stra-ßenhandel, „Dorfgehen“ oder Hausieren. Hausierer gehörten zu den ärmsten Schichten des galizischen Judentums, zu den so genannten „Luft menschen“. Mit-telloser als sie waren nur noch Bettler, wobei sich Betteln mit den anderen prekä-ren Beschäft igungsformen temporär überschneiden konnte.38
Sozialer Protest gegen den Verlust von Arbeit und Lebensunterhalt wurde in den 1860er Jahren von Handwerkern formuliert, blieb aber wirkungslos. Damit werden auch die rechtlich-politischen Beschränkungen der so genannten „Gali-zischen Autonomie“39 deutlich, die den galizischen Behörden eine eigenständige Steuerung überregionaler Austauschprozesse unmöglich machten. Nachdem die Deindustrialisierung die ländlichen Textilheimgewerbe erfasste, setzte in den 1870er Jahren die Erwerbsmigration der polnischen und ruthenischen Landbevöl-kerung ein, die sich im darauff olgenden Jahrzehnt verstärkte. Zu diesem Zeitpunkt begann auch die starke Abwanderung der galizischen Juden.40
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 414851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 41 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
42
Es zeigt sich somit deutlich, dass alle drei hauptsächlichen in Galizien lebenden ethnischen Gruppen – Juden, Polen, Ruthenen – von den Verdrängungsprozes-sen erfasst wurden. Ein Teil der dadurch ausgelösten Konfl ikte richtete sich ab den 1880er Jahren entlang ethno-religiöser Linien aus, wobei der zeitgenössische Dis-kurs eine Polarisierung zwischen „Juden“ und „Christen“ diagnostizierte. Konfl ikt-feld war insbesondere der ländliche Warenhandel, der überwiegend von galizisch-jüdischen Händlern betrieben wurde. Die in den frühen 1880er Jahren entstehende christlich-soziale Genossenschaft sbewegung begann mit der Gründung von Han-delsunternehmen jüdische Agrargüterhändler, Geschäft einhaber und Hausierer aus der ökonomischen Sphäre zu verdrängen.41 Wollte die polnische und ruthenische Landbevölkerung sich damit vor allem jene Handelsprofi te aneignen, die in der Ver-mittlung der von ihnen erzeugten Agrarprodukte lag,42 so ging es zugleich auch um den Absatz der aus den Industriezentren gelieferten Fertigwaren, die vor Ort von jü-dischen Geschäft en und Kleinhändlern verkauft wurden. Die konstruierte Ethnizität der Händler wurde auch auf die gehandelten Waren übertragen: So druckte die ru-thenische, nationalistische Zeitung Bat’kivščyna (Батькôвщина) am 26. März 1886 einen Korrespondentenbericht aus dem zentralgalizischen Bezirk Sambor ab, in dem von „jüdischen Waren“ zu lesen ist.43 Dies demonstriert die Ethnisierung des sozio-ökonomischen Alltags in den galizischen Dörfern in den 1880er Jahren.
Bis zur Jahrhundertwende wurden hingegen jüdische Großhändler, die diese Waren aus den westlichen Regionen bezogen und an die galizischen Detailhändler weiterverkauft en, als Vermittler nicht in Frage gestellt. Erst nach 1900 entstanden vereinzelt auch Großhandelsgenossenschaft en, die aber gegenüber den jüdischen Großhändlern eine marginale Rolle spielten.44 Der mit antijüdischen Vorurteilen und Stereotypen operierende Diskurs der ‚christlichen‘ Genossenschaft sbewegung in den Dörfern richtete sich somit vorwiegend gegen die lokalen Vermittler der Fertigwaren. Die Intention der Verdrängung einer ethno-sozialen Gruppe wurzelt in der begrenzten räumlichen Wahrnehmung von wirtschaft licher Konkurrenz. Der von der überregionalen Makroebene ausgehende Konkurrenzdruck wurde über Händler an lokale Akteure vermittelt. Diese formulierten ihren Protest, in-dem sie die greif- und sichtbaren Vermittler zurückzudrängen versuchten. Dieser Konfl ikt wurde von soziokulturellen Mustern beeinfl usst, defi nierte diese zugleich neu und verstärkte die ethno-sozialen Abgrenzungen innerhalb der Gesellschaft . Peripherisierung mündete somit in Ethnisierung – als Reaktion auf sozioökonomi-schen Wandel und die dadurch beschränkten Ressourcen.
Der Hausierhandel: Wandernde Warenvermittlung zwischen Zentren und Peripherie
Dass der Konfl ikt um den von der Fabrikindustrie ausgehenden Konkurrenzdruck in der Produktionssphäre zu Widerständen gegen die Vermittler dieser Waren führte, wird auch beim Hausierhandel deutlich. Hausierer spielten auf der untersten Ebene der Warendistribution im späten 19. Jahrhundert in Galizien eine Doppel-rolle. Einerseits war der Hausierhandel eine marginale ökonomische Tätigkeit, deren
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 424851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 42 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
43
starke Zunahme ab den 1860er Jahren bereits eine Folge der beschriebenen Periphe-risierungsprozesse war.45 Zugleich stand der Hausierhandel selbst im Spannungsfeld der Beziehungen zwischen Peripherie und Zentren, was ihn zu einem wichtigen Schauplatz von Peripherisierungsprozessen werden ließ, da Hausierer Waren aus anderen Regionen in Galizien verkauft en. Der Hausierhandel war damit Teil des allgemeinen Warenaustauschmusters zwischen Peripherie und Zentren. An dieser Doppeldeutigkeit des Hausierhandels wird die Verknüpfung von Peripherisierung und Ethnisierung, von innerer und äußerer Konkurrenz besonders deutlich.
Hausieren war im späten 19. Jahrhundert ein Relikt des Wanderhandels, der bis zur Entstehung der Eisenbahn die dominierende Form des Großhandels gewesen war und bis ins 20. Jahrhundert in den von der Eisenbahn nicht erschlossenen und entlegenen Gebieten eine wichtige Versorgungsfunktion erfüllte. Bei den Kunden der Hausierer handelte es sich um die weniger bemittelten Schichten auf dem Land und in den Vorstädten.46 Die Besonderheiten des Hausierhandels in Bezug auf die Bezie-hungen von Peripherie und Zentren lagen darin, dass seine Ausführung auf Staats-bürger der Habsburgermonarchie beschränkt war. Ebenso durft en nur innerhalb der Staatsgrenzen erzeugte Waren von Hausierern verkauft werden. Diese Bestimmun-gen, auch wenn sie mitunter umgangen wurden, beschränkten den Hausierhandel auf die überregionalen Beziehungen innerhalb der Habsburgermonarchie.
In den 1860er Jahren weitete sich die überregionale Reichweite des Hausier-handels aus. Der nach der Aufh ebung der Binnenzollgrenze zwischen den unga-rischen und westlichen Regionen der Habsburgermonarchie 1851 verbilligte Wa-rentransport ließ in den frühen 1860er Jahren zahlreiche Hausierer aus Ungarn zum Handel nach Galizien kommen. Insbesondere die Lemberger und Tarnopoler Kreisbehörden sahen dies in den frühen 1860er Jahren mit wachsender Skepsis. Ein Erlass der galizischen Statthalterei aus dem Jahr 1864 ermahnte die ihr unter-stehenden Behörden zur genauen Einhaltung jener Vorschrift , wonach aus Ungarn kommende Hausierer innerhalb von zehn Tagen Aufenthalt ihren Pass bei einer politischen Behörde vidieren mussten.47 Umgekehrt machte das Handelsministe-rium im Jahr 1865 die Galizische Statthalterei auf zahlreiche Rechtsverstöße von Hausierern aufmerksam – wie fehlende Steuerleistungen oder Hausiergenehmi-gungen („Hausierpässe“ oder „Hausierbücher“) – und ermahnte die galizischen Behörden, auf die Einhaltung der bestehenden Hausiergesetze zu achten.48
Selbst das liberale Hausierpatent von 1852 beinhaltete zahlreiche Beschränkun-gen des Hausierhandels. So durft en gewisse Waren nicht verkauft und zum Güter-transport keine Wägen oder Pferde verwendet werden. Mit diesen Vorschrift en sollte die Konkurrenz zu lokal ansässigen Händlern begrenzt werden, indem Hausierer nur kleine Warenmengen direkt zu den Konsumenten bringen konnten.49 Der Hausier-handel war somit von behördlicher Kontrolle und Beschränkungen nicht befreit, auch wenn die lockere rechtliche Praxis der Behörden den Hausierern zusätzlichen Handlungsspielraum verschafft e. Der Grund für das Misstrauen, das die staatlichen Organe dem Hausierhandel entgegenbrachten, lag in den Befürchtungen, Hausierer könnten Schmuggel treiben, Diebstähle begehen, betteln, staatsfeindliche Propaganda oder Krankheiten verbreiten.50 Somit waren es ursprünglich vorwiegend Sicherheits-bedenken, die die Behörden zu einer Kontrolle des Hausierhandels veranlassten.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 434851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 43 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
44
Sesshaft igkeit versus Mobilität: Der Reformdiskurs der Behörden 1877–1885
In der dem Börsenkrach von 1873 folgenden Wirtschaft skrise mündeten diese Vorbehalte gegenüber Hausierern im Verband mit der protektionistischen Wende in der staatlichen Wirtschaft spolitik erstmals in Bestrebungen, den Hausierhandel einzuschränken. Diese waren im Unterschied zum bisherigen Diskurs ausschließ-lich wirtschaft lich motiviert. Anlass dazu gaben Klagen lokaler Handelsunterneh-men über das Hausierwesen in Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg, Schlesien und Böhmen. Aus Galizien sind aus dieser Zeit hingegen keine Beschwerden bekannt. Das Handelsministerium führte daraufh in per Erlass vom 9. Jänner 1877 die 1855 aufgehobene Überprüfung („Vidierung“) der Hausierpässe auch innerhalb einzel-ner Bezirke wieder ein und begründete diesen Schritt mit der raschen Ausweitung des Hausierhandels auf der Grundlage des Patents von 1852. Das Ministerium sah dadurch die Interessen sowohl der Konsumenten als auch des örtlichen Gewerbe- und Handelsstandes als bedroht an. Mit Verweis auf die zahlreichen Rechtsver-stöße von Hausierern, aber auch die Nachlässigkeit der Behörden forderte das Ministerium die Galizische Statthalterei auf, bis Ende Februar 1877 alle Bezirks-hauptmannschaft en darüber zu befragen, ob das Hausierwesen auf dem jetzigen rechtlichen Stand belassen werden sollte oder ob es einzuschränken sei.51
Die galizischen Behörden reagierten darauf zögerlich. Bis die angeordneten Be-richte tatsächlich einliefen, vergingen weitere vier Jahre. In dieser Zeit machte sich jedoch die vom Ministerium verordnete genaue Beachtung der bestehenden Geset-ze bereits bemerkbar: In den Akten der Galizischen Statthalterei fi nden sich für das Jahr 1879 die ersten Belege, dass galizische Bezirkshauptmannschaft en Hausier-pässe nicht mehr verlängerten sowie jene Hausierer zu Geld- und Haft strafen ver-urteilten, die ohne Genehmigungen oder mit nicht zugelassenen Waren handelten. Berufungen („Rekurse“) gegen diese Entscheidungen wurden von der zweiten und dritten Instanz – der Galizischen Statthalterei und dem Innenministerium in Wien – stets abgewiesen. Die Zahl der Bestrafungen und Rekurse nahm 1880 noch zu.52 Allerdings macht ein Erlass des Innenministeriums an die Galizische Statthalterei vom 4. Jänner 1881 deutlich, dass viele galizische Bezirkshauptmannschaft en die neuen Anordnungen in den Augen des Ministeriums dennoch nur ungenügend umsetzten.53 Zugleich verbat in den Jahren 1879 und 1880 eine Reihe von Städten in den ungarischen Ländern den Hausierhandel – darunter waren Bratislava, So-pron, Temesvár, Györ, Szegedin und Pécs.54 Dies drängte ungarische Hausierer zu-nehmend in andere Regionen. Insbesondere aus den nördlichen Komitaten kamen viele Hausierer, vorwiegend Slowaken, nach Galizien.
Die 1877 verordnete Anfragebeantwortung wurde von den galizischen Behör-den erst nach einer neuerlichen Erinnerung des Innenministeriums vom März 1881 beantwortet.55 Die galizischen Bezirkshauptmannschaft en sowie die Handels-kammern von Brody, Lemberg und Krakau bewerteten in ihrer überwiegenden Mehrheit den Hausierhandel als negativ – einerseits für den lokalen Handelsstand, dem sie eine unliebsame Konkurrenz bereiteten, aber auch für die Konsumenten, denen sie unnötige Waren von schlechter Qualität brachten. Es waren somit expli-
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 444851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 44 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
45
zit wirtschaft liche Gründe, die den Hausierhandel für die Bezirksverwaltungen und Handelskammern als problematisch erscheinen ließen. Allerdings unterschieden sich die Stellungnahmen bei den Details sehr stark. Mehrere Institutionen, wie die Krakauer Handelskammer und die Bezirkshauptmannschaft en von Horodenka, Przemyśl, Skałat und Rohatyn, forderten die Einführung einer zeitlich begrenzten Aufenthaltsdauer für Hausierer. Andere, wie die Bezirkshauptmänner von Nisko, Stanislau, Brzozów und Jaworów, wünschten sich weitreichende Kompetenzen zur Einschränkung des Hausierhandels.56 Nur die Bezirkshauptmannschaft en von Li-manowa und Wadowice stuft en den Hausierhandel als positiv ein, da er die Gewer-betätigkeit unterstütze und Monopolpreisen entgegenwirke. Umgekehrt sahen es die Bezirkshauptmannschaft en von Żywiec und Nowy Targ: Die Waren der Hau-sierer seien von schlechter Qualität und könnten in jedem Geschäft zu den gleichen Preisen gekauft werden. Die Lemberger Handelskammer sprach sich als einzige für die Gewerbefreiheit aus, die auch für Hausierer gelten müsse. Die Handelskammer Brody wollte den Hausierhandel in den Städten einschränken, am Land hingegen erfülle er eine nützliche Funktion und sollte nicht eingeschränkt werden.57
Die überwältigende Mehrheit der Bezirkshauptmannschaft en gab in diesem innerhalb der staatlichen Verwaltung geführten Diskurs die Beschwerden der lo-kalen Händler und Krämer weiter. Diese Geschäft sinhaber verkauft en ebenso wie die Hausierer Fertigwaren, die sie vorwiegend aus den außerhalb Galiziens gelege-nen Industriezentren bezogen. Das Konkurrenzverhältnis zwischen Handelsstand und Hausierern ist ein die Stellungnahmen fast aller Bezirkshauptmannschaft en durchziehendes Argument. Nur vier Stellungnahmen versahen die von den Hau-sierern ausgehende Konkurrenz mit zusätzlichen Kategorien. Drei davon, die Be-hörden von Tarnopol und Horodenka in Ost- sowie von Nisko in Westgalizien, thematisierten die Konkurrenz, die den galizischen Handelsunternehmen durch Hausierer aus anderen Regionen entstünde.58
In der hiesigen Gegend, wie sicherlich auch anderswo, geschieht es, dass sich die Handelsagenten der größeren Städte besonders aus den Fabrikor-ten anderer Provinzen gleichzeitig mit der Ausnützung des Hausierhandels beschäft igen, unter dem Vorwand die Nachfrage nach einer Ware oder einem Produkt bei den hiesigen Händlern zu decken, was schwierig zu kontrollieren ist […],
schrieb die Bezirkshauptmannschaft Nisko in ihrem Bericht an die Statthalterei vom 21. März 1881.59 Zugleich wies das Schreiben auf die durch die Eisenbahn-verbindungen zurückgegangene Bedeutung des Hausierhandels hin. Zeitgleich schrieb die Bezirkshauptmannschaft in Horodenka:
Der in Rede stehende und sich im hiesigen Land vorwiegend in den Händen verarmter Israeliten befi ndliche Handel beeinfl usst zweifellos sehr unvorteil-haft die Verhältnisse des Umsatzhandels der fest ansässigen Händler und Krä-mer in den Städten und Märkten, und oft sind in dieser Hinsicht Beschwerden von der Seite der besteuerten Gewerbetreibenden dieser Branche zu hören,
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 454851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 45 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
46
weil das Landvolk und sogar ein bedeutender Teil der Stadtbewohner schein-bar billige Waren von den Hausierern kauft , ohne Rücksicht, dass diese letztere, mit schlechten Waren versorgt und größtenteils von unterrangigen Fabriken kolportiert, solche billiger verkaufen als sie die örtlichen Händler und Krämer, die in Hinsicht der Qualität unvergleichlich bessere Waren besitzen, zur Auf-rechterhaltung ihrer Firma verkaufen können.60
Deutlich wird hier, wie Hausierhändler die Produktions- und Konsumptions-sphäre der böhmisch-österreichischen Zentren und der galizischen Peripherie verknüpft en. In der Tat setzten seit den 1860er Jahren Fabriken und Großhändler Hausierer gezielt zum Fertigwarenabsatz ein, da sie sich dadurch eine Umsatzstei-gerung erhofft en: Die prekär lebenden Hausierhändler61 verkauft en die Waren zu niedrigen Preisen zumeist direkt bei den Abnehmern, da sie nur geringe Gewinn-spannen verlangten.62 Der oben erwähnte Bezirkshauptmann von Horodenka sprach deutlicher als sein Kollege in Nisko die Vermittlungstätigkeit von Hausie-rern für Fabriken an, wobei hier im Unterschied zu der Stellungnahme aus Nisko unklar bleibt, wo die genannten „unterrangigen Fabriken“ angesiedelt waren. Der Mangel an Fabriken in Galizien zu diesem Zeitpunkt63 macht deutlich, dass es sich hier mehrheitlich um außerhalb von Galizien angesiedelte Fabriken handeln mus-ste. Zudem ist bekannt, dass Fabriken in den böhmischen und österreichischen Ländern eigens Produkte niedriger Qualität für den galizischen Markt herstellten, um der geringen Kaufk raft der galizischen Landbevölkerung zu entsprechen.64
Da laut der Behörde in Horodenka die sesshaft en Geschäft e und Krämer diese Fabrikwaren off ensichtlich nicht verkauft en, bedeutet dies, dass diese Unterneh-men entweder hochwertige Fabrikprodukte aus den Industriezentren der Habsbur-germonarchie bezogen oder Produkte aus der gewerblichen Produktion in Galizi-en selbst verkauft en. Besteht im ersten Fall ein Konfl ikt in der Zirkulationssphäre, also dem Verkauf der Waren, handelt es sich im zweiten Fall um eine Konkurrenz zwischen den Produktionssphären von Peripherie und Zentren, welche durch die Hausierer vermittelt wurde. Daher stellten für die galizischen Gewerbetreibenden besonders Hausierer aus anderen Kronländern eine Konkurrenz dar, da sie ver-gleichsweise billigere Produkte vertrieben. Dieser zweite Interessenskonfl ikt wird in der zitierten Stellungnahme jedoch nicht explizit genannt.
Deutlich markiert die Bezirkshauptmannschaft Horodenka den Hausierhandel als ‚jüdische‘ Domäne, wobei sie den offi ziellen, konfessionell konnotierten Begriff „Israeliten“ verwendete. Nichtsdestotrotz wurde damit eine berufl iche Kategorie ethnisch kodiert. Wird hier noch Verständnis für die prekäre Lage der jüdischen Hausierer signalisiert, so reduziert sich die Stellungnahme der Bezirkshauptmann-schaft von Stanislau vom 21. März 1881 auf eine antijüdische Argumentation:
Mit einer kleinen Ausnahme beschäft igen sich mit dem Hausierhandel im Land ausschließlich Juden. Wirksam wäre nachzuweisen, was für ein geringes bürgerliches Gefühl diese Menschenkaste besitzt und wo sie nur irgendeinen Nutzen für ihr eigenes Interesse sieht, schreckt sie vor keinen Überschreitungen und Missbräuchen zurück.65
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 464851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 46 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
47
Die aus dem Diskurs des ökonomischen Antisemitismus bekannten Ausbeutungsto-poi wurden auf jüdische Hausierer übertragen. Im Gegensatz zu dem Bericht aus Horodenka werden hier externe Hausierer oder Fertigwaren aus anderen Regi-onen nicht erwähnt, ein Bedrohungspotential ausschließlich in „Juden“ gesehen, die räumlich in Galizien verortet werden. Trotz der Unterschiede zwischen den behördlichen Äußerungen aus Horodenka und Stanislau sind sie die eindeutigsten Stellungnahmen von Bezirkshauptmannschaft en im Jahr 1881, in denen eine sozi-oökonomische Gruppe ethnisch kodiert wurde. Dabei handelte es sich keineswegs um einen ethnischen, sondern einen sozioökonomischen Konfl ikt, da es auch viele jüdische Geschäft sinhaber gab, die sich vom Hausierhandel bedroht fühlen konn-ten. Die Stellungnahme der Handelskammer Brody ist ein Beispiel dafür. Umge-kehrt gab es auch ruthenische und polnische Hausierer.
Noch deutlicher verknüpft e der Landesausschuss (wydział krajowy), das Legis-lativorgan des galizischen Landtags, in einer Denkschrift vom 20. November 1885 überregionale Konkurrenz mit einer ethnisierenden Konfl iktlösungsstrategie:
Es ist ausreichend zu sagen, dass Niederösterreich im Jahr 1882 10.185 Hau-sierer hatte, Oberösterreich 3345, die Steiermark 5761, Kärnten 1004, Krain 2595, Tirol mit Vorarlberg 6480, Böhmen 11347, Mähren 5244, Schlesien 871, während in Galizien im Jahr 1882 nur 1885 [Hausierer] waren und man muss erst herausfi nden, wie viele darunter Einheimische und wie viele fremde Hausierer waren; Slowaken, die Glas, Porzellan, Steingut und Drahtwaren brachten [...], wie viele mit Galanteriewaren von den Wiener Basaren, mit Wiener und Prager Bildern, Litografi en und Öldrucken. Es bleibt ein kleiner Teil für unsere Töpferei und Weberei. Wenn man bedenkt, welchen Schaden die Gleichstellung der Jahrmärkte mit den Messen der Landesindustrie hinsichtlich der Kramerwaren gebracht hat, wodurch in etwa 10–12.000 Messetage (von 15.336 Messetagen im Land) dem Absatz fremder Industriewaren dienten, vorwiegend den Weberzeugnissen sowie der fertigen Kleidung […], dann kann man verstehen, wie lebendig unsere Weberei sein muss, sofern sie noch nicht verschwunden ist. Daher müssen wir auch dieses Hausierwesen für die Weberzeugnisse verteidigen, das heute noch eine Stütze der Weberei ist. […] Darin liegt ein großer Unterschied zwischen dem gewöhnlichen unbestreitbar schädlichen Hausierhandel und dem durch unsere Weber unterhaltenen Hausierhandel.66
Die von führenden galizischen Amtsträgern besetzte Institution hatte wesentlichen Einfl uss auf die Gesetzgebung im galizischen Landtag,67 weshalb ihrer Meinung bedeutendes politisches Gewicht zukam. Der Landesausschuss verortete die Kon-kurrenz zwischen Galizien und den anderen Regionen in der Produktionssphäre, die durch den Hausierhandel vermittelt wurde. Daher sei dieser auch „schädlich“. Der Ausschuss forderte allerdings den Schutz jener galizischen Hausierer, die den Absatz der in Heimarbeit erzeugten Textilien organisierten. Dies betraf besonders das Textilgewerbe im Bezirk Biała, wo innerhalb Galiziens zwischen 1882–1886 die meisten Hausierer tätig waren. Zugleich beklagte der Landesausschuss in die-
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 474851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 47 02.11.2009 12:40:1502.11.2009 12:40:15
Arbeits
kopie
48
sem Bericht den zunehmenden Verfall des Textilheimgewerbes und meinte, dieses sei „in die wucherischen Hände der Vermittler, der jüdischen Faktoren und Ver-leger gefallen, die ganze Weberdörfer unseres Landes ins endgültige Elend getrie-ben haben.“68 Daher forderte der Landesausschuss die Galizische Statthalterei auf, Maßnahmen zum Schutz dieser „ehrlichen“ Hausierer zu treff en, was die einzige Überlebenschance für die Textilheimproduktion sei.69
In der Diagnose des Landesausschusses verschränken sich zwei Ebenen der Peripherisierungsprozesse, nämlich jene des Groß- und des Hausierhandels. Im Gegensatz zu dem Diskurs der Bezirkshauptmannschaft en, die die Hausierer als schädlich für die galizischen Geschäft einhaber ansahen, schrieb ihnen der Landes-ausschuss eine rettende Funktion zum Erhalt eines wichtigen regionalen Produk-tionssektors, der Textilerzeugung, zu, der durch die mit der Eisenbahn gelieferten Fertigwaren aus den böhmischen und österreichischen Industriezentren massiv unter Druck geraten war. Der Landesausschuss sah nun aber als entscheidende Ur-sache für diesen Verdrängungsprozess nicht nur die Konkurrenz zwischen der ga-lizischen Peripherie und den böhmischen sowie österreichischen Zentren an, son-dern machte primär lokale, jüdische Händler und deren angebliche ‚Ausbeutung‘ der ländlichen Bevölkerung dafür verantwortlich. Erneut wurde somit ein sozio-ökonomischer Konfl ikt zwischen verschiedenen Interessensgruppen mit antijüdi-schen Vorurteilen in Zusammenhang gebracht. Dies wird auch in der Forderung nach dem Schutz „ehrlicher Hausierhändler“ deutlich, die die Textilerzeugnisse der Heimproduzenten absetzten. Diesen Teilbereich des Hausierhandels betrieben fast ausschließlich nicht-jüdische Hausierer, während das Hausieren mit Industriewa-ren vorwiegend jüdische Hausierer übernahmen.70 Akzentuiert wurde dies mit der Formulierung von „unseren Webern“, die selbst mit ihren Produkten hausierten. Somit wurde verklausuliert gefordert, ‚christliche‘ Hausierer zum Schutz des Textil-gewerbes vor ‚jüdischen‘ Faktoren und Vermittlern, aber auch vor ‚jüdischen‘ Hau-sierern einzusetzen. Hingegen wurden keine Maßnahmen zum Schutz galizischer Hausierer gegenüber jenen aus anderen Regionen erwähnt, obwohl gerade diese zu Beginn der Analyse des Hausierhandels als problematisch eingestuft wurden. Deut-licher noch als in den Stellungnahmen der Bezirkshauptmannschaft en Horodenka und Stanislau schrieb eines der wesentlichsten legislativen Organe der galizischen Landesinstitutionen bei der Analyse eines sozioökonomischen Phänomens ethno-soziale Binnengrenzen innerhalb der galizischen Gesellschaft fest, die wesentlicher erschienen als räumliche, regionale Grenzen.
Diese Trennlinien hatten für die Behörden implizit bereits vor der Abfassung der Denkschrift des Landesausschusses Gültigkeit. Dies belegen die Fälle von zwei galizischen Hausierern, die sich um einen Hausierpass für das Hausieren mit Textilien des galizischen Heimgewerbes bemühten. So verweigerten die Bezirks-hauptmannschaft Krosno, die Statthalterei in Lemberg und das Innenministeri-um in Wien in der zweiten Jahreshälft e 1883 dem langjährig aktiven jüdischen Hausierer Majer Rosshändler aus der 5.000 Einwohner umfassenden Gemeinde Korczyna eine Hausiergenehmigung zum Handel mit Leinenwaren, die dort in Heimarbeit hergestellt wurden. Über ein Jahr später, im April 1885, genehmigte die Bezirkshauptmannschaft Wadowice dem polnischen Hausierer Antoni Prus
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 484851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 48 02.11.2009 12:40:1602.11.2009 12:40:16
Arbeits
kopie
49
aus Andrychów anstandslos einen Hausierpass für den Handel mit Leinen- und Baumwollwaren in Galizien und der Bukowina.71 Dies macht deutlich, wie die dis-kursive Ethnisierung des Hausierhandels seitens der Behörden die soziale Praxis beeinfl usste.
Hausierer und die Konkurrenzbeziehungen zwischen Peripherie und Zentren
Inwieweit das Argument der prekären Geschäft slage der Handelsunternehmen mit der Wahrnehmung von Konkurrenz durch die Behörden übereinstimmt, lässt sich anhand der von den Bezirkshauptmannschaft en angegebenen Erwerbssteuerdaten der Handelsunternehmen in den einzelnen galizischen Bezirken im Schnitt der Jahre 1882–1886 eruieren (Tabelle 1).
In ganz Galizien zahlte über die Hälft e der Geschäft e den niedrigsten Steu-ersatz unter 3 Gulden (fl .) 50 Kreuzer (kr.), über zwei Drittel gehörte den beiden untersten Steuerklassen an und entrichtete nicht mehr als 4 Gulden 20 Kreuzer jährlich an den Fiskus. Bei dieser prekären Ertragslage bedeutete jede zusätzliche Konkurrenz eine existenzielle Bedrohung dieser Läden.
Tabelle 1: Verteilung der Steuerleistungen der Handelsunternehmen im Durchschnitt der Jahre 1882–1886
unter 3 fl . 50 kr.
bis 4 fl . 20 kr.
bis 5 fl . 25 kr.
bis 8 fl . 40 kr.
über 8 fl . 40 kr.
Galizien 50% 26% 9% 8% 7%Ostgalizien 50,1% 27,4% 9,2% 7,3% 7,0%Westgalizien 49,6% 22,6% 8,8% 8,2% 8,5%Biała 18% 31% 7% 20% 24%Wadowice 47% 2% 23% 3% 24%Limanowa 79% 5% 13% - 4%Krosno 43% 14% 27% 9% 8%Nisko 68% 13% 5% 9% 4%Stanislau 13% 38% 13% 21% 14%Lisko 75% 4% 16% 0% 5%Horodenka 44% 42% 7% 6% -
Quelle: СДІАЛ, 146-68-2936/2943.
Die regionale Verteilung der Steuerleistungen zeigt keinen markanten Unterschied zwischen West- und Ostgalizien, auch wenn in den westlichen Bezirken etwas weniger Unternehmen in der vorletzten, aber mehr Geschäft e in der höchsten Steuerklasse aufscheinen. Von den Bezirken, deren behördliche Stellungnahmen analysiert wurden, weisen Limanowa und Nisko eine besonders starke Konzentra-tion von Unternehmen in der unteren Steuerklasse auf. Hingegen liegt der Bezirk Stanislau bei den unteren beiden Steuerklassen deutlich unter dem ostgalizischen
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 494851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 49 02.11.2009 12:40:1602.11.2009 12:40:16
Arbeits
kopie
50
Durchschnitt, bei den drei oberen Steuerklassen stark darüber. Die bessere mate-rielle Lage der Geschäft e im Bezirk Stanislau ist wohl auch der Grund, warum explizite Hinweise auf ein Konkurrenzverhältnis zwischen Handelsunternehmen und Hausierern im Bericht der Bezirkshauptmannschaft fehlen. Die antijüdische Stellungnahme der Bezirkshauptmannschaft scheint hier viel stärker ideologisch motiviert gewesen zu sein. Umgekehrt wurde in Limanowa trotz einer prekären Lage der Geschäft e der Hausierhandel durch die Bezirkshauptmannschaft befür-wortet. In Nisko und Horodenka stimmte die Wahrnehmung von Konkurrenz mit einer prekären Geschäft slage der Handelsunternehmen überein.
Die meisten Hausierer waren in den Jahren 1882–1886 in den eher wohlhaben-den Bezirken wie Biała, Krosno, Tarnów, Wadowice und Żywiec aktiv und mieden somit jene Bezirke mit einer prekären Situation im Detailhandel. Dies belegt das Verhältnis von Geschäft en und Hausierern in den Bezirken mit tendenziell um-satzärmeren Geschäft en, welches stark ungleich war, d.h. es gab unverhältnismäßig mehr Handelsunternehmen als Hausierer. Gerade dies lässt jedoch die Konkurrenz zwischen Hausier- und Einzelhandel als ökonomisches Phänomen zweifelhaft er-scheinen. Im zeitgenössischen öff entlichen Diskurs wurde mehrfach darauf hin-gewiesen, dass die Hausierer einen Absatzmarkt erschlossen, der ansonsten nicht bestanden hätte.72 Dies bestätigt ein Blick auf die amtliche Statistik des Jahres 1882, wonach durchschnittlich auf zehn stabile Handelsunternehmen in Galizien ein, und pro 10.000 Einwohner drei Hausierer kamen. In beiden Fällen ist dies mit Abstand der niedrigste Wert Cisleithaniens.73 Ein Jahrzehnt später war dieses Ver-hältnis weiter gesunken: Auf 10 stabile Handelsunternehmen in Galizien entfi elen statistisch 0,009 und pro 10.000 Einwohner 0,9 Hausierhändler.74
Zudem waren die Umsätze der Hausierer bescheiden, weshalb Zygmunt Gar-gas die Konkurrenz zwischen Hausierern und Handelsunternehmen in Galizien als sehr gering einstuft e. Allgemein betraf diese Konkurrenz nur Kleinhändler, Krämer und jene Handwerker, die ihre Produkte selbst verkauft en.75 Diese jedoch verfügten kaum über einfl ussreiche Lobbys in Behörden und Handelskammern. Insofern erscheinen Hausierer eher als diskursive Repräsentation für Konkurrenz, denn als deren tatsächliche Verursacher.
Einen Einblick in die Aktivität galizischer und externer Hausierer sowie die von ihnen gehandelten Waren erlauben die im Fonds der galizischen Statthalterei aufb ewahrten Listen über die in Galizien in den Jahren 1886 und 1893–95 tätigen Hausierhändler.76 Auch wenn diese Daten große Lücken aufweisen,77 vermitteln sie dennoch ein Bild von der überregionalen Mobilität der Hausierer sowie der dadurch bewirkten Konkurrenz mit den lokalen Geschäft en. Wie die Auswertung der Daten belegt, gab es in den untersuchten Jahren eine bedeutende Aktivität aus-wärtiger Hausierhändler in Galizien (Abbildung 1). Die galizischen Hausierer, in ihrer großen Mehrheit Juden, stellten in allen quellenmäßig erfassten Jahren die Mehrheit.78 Dieser Befund, wonach die aus Galizien stammenden Hausierer in etwa die Hälft e aller in Galizien tätigen Hausierer stellten, wird durch die Zahlen der Volkszählung von 1890 bestätigt. Dort betrug die Anzahl der in Galizien an-wesenden Hausierer mit 1.145 etwas weniger als das Doppelte der in diesem Jahr in Galizien gültigen Hausierpässe (617).79
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 504851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 50 02.11.2009 12:40:1602.11.2009 12:40:16
Arbeits
kopie
51
Von den externen Hausierern waren jene aus Ungarn, Böhmen, Dalmatien und Mähren am stärksten vertreten. Die Sogwirkung des galizischen Hausierhandels reichte jedoch bis nach Tirol, Wien, dem Küstenland und Bosnien. Überraschend schwach waren hingegen Hausierer aus den an Galizien grenzenden Kronländern Schlesien und der Bukowina vertreten.
Die externen Hausierer handelten vergleichsweise mehr mit Metall- und Por-zellanwaren, dafür waren die galizischen Hausierer bei Textil- und Galanteriewaren stärker vertreten (Abbildung 2), wobei zu beachten ist, dass es sich hier um keine Mengenangaben, sondern die Anzahl der Warennennungen pro Hausierer handelt. Dies entsprach auch den Produktionsstrukturen der jeweiligen Herkunft sländer und verweist auf das trotz aller Peripherisierungsprozesse an einigen Standorten in Gali-zien (wie Biała, Andrychów, Krosno und Jasło) etablierte Textilgewerbe, das durch den Hausierhandel seine Absatzchancen noch bewahrte. Umgekehrt gab es eine Reihe von galizischen Hausierern, die ihrerseits in anderen Regionen handelten. In diesem Sample beträgt ihr Anteil 25%. Sie bewegten sich vorwiegend in den angrenzenden Bezirken Ungarns, der Bukowina und der böhmischen Länder. Zudem waren Wien und Dalmatien wichtige Zielorte galizischer Hausierer. Diese überregional aktiven ga-lizischen Hausierer handelten vor allem mit Textilien, Metall- und Galanteriewaren.
Die Vermutung liegt nahe, dass sie diese aus den ungarischen, böhmischen, mährischen, niederösterreichischen und Wiener Industriezentren bezogen und nach Galizien exportierten. Insofern wurden nicht nur von externen Hausierern, sondern
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
Galizien
Ungarn
Böhmen
Mähren
Dalmatien
Schlesien
Küstenland
Tirol
Bukowina
Wien
Bosnien
andere Länder Cisleithaniens
keine Angabe
Abbildung 1: Hausierer in Galizien nach ihrer regionalen Herkunft in den Jahren 1886, 1893–95
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 514851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 51 02.11.2009 12:40:1602.11.2009 12:40:16
Arbeits
kopie
52
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Galizische Hausierer Auswärtige Hausierer
SchreibzubehörKramerwarenWachswarenGlas- und PorzellanwarenHolzwarenchemische ArtikelBilder, FotografienNürnbergwarenOptikerwarenKleinigkeitenReligiöse WarenMetallwarenTextilien, BekleidungGalanteriewarenKurzwaren
Abbildung 2: Warenhandel von galizischen und auswärtigen Hausierern im Vergleich (1886, 1893–95)
auch von galizischen Hausierern Fertigwaren aus den böhmischen und österreichi-schen Industriezentren nach Galizien zum Verkauf gebracht. Dass zumindest die in Wien tätigen Hausierer viel zahlreicher als in dem hiesigen Sample waren, belegen Daten der Stadt Wien. Zwischen 1877 und 1885 nahm die Zahl der in Wien tätigen galizischen Hausierer, die zumeist einen jüdischen Hintergrund hatten, von 158 auf 301 zu. Nachdem mit 503 galizischen Hausierern im Jahr 1895 der Höhepunkt er-reicht wurde, sank die Zahl bis 1913 kontinuierlich auf 326.80 Die Migration nach Wien war ein Weg, den die galizischen Juden ab den 1880er Jahren verstärkt ein-schlugen.81 Zumindest ein Teil der in Wien tätigen Hausierer verband somit die ost-jüdischen Gemeinden in Galizien mit den Auswanderern in der Wiener Metropole.82 Im Sample der Statthaltereiakten scheinen mehrere galizisch-jüdische Hausierer auf, die entweder in Wien aktiv waren oder dort wohnten. Letztere unterhielten mit ihren Herkunft sregionen weiterhin Handelsbeziehungen und brachten Textil- und Galan-teriewaren vor allem nach Ostgalizien (in die Bezirke Brody, Czortków, Stanislau), aber auch nach Biała in Westgalizien.
In Summe zeigt sich, dass galizische wie externe Hausierer einen guten Teil an externen Fertigwaren nach Galizien zum Verkauf brachten, wobei deren Menge oder Wert nicht bestimmbar ist. Dies bestätigt die Befunde mehrerer Bezirkshaupt-mannschaft en sowie des Landesausschusses hinsichtlich der Bedeutung externer Hausierer als Verkäufer von Fertigwaren aus den böhmisch-österreichischen und ungarischen Industriezentren. Zugleich erklärt sie die Absenz von Schutzmaßnah-men gegenüber galizischen Hausierern, da auch sie als Vermittler von überregio-naler Konkurrenz wahrgenommen wurden.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 524851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 52 02.11.2009 12:40:1602.11.2009 12:40:16
Arbeits
kopie
53
Die Verdrängung der Hausierer
Der Reformdiskurs der galizischen Bezirkshauptmannschaft en entfaltete eine – beschränkte – Wirkung auf die cisleithanische Gesetzgebung. Mit dem Gesetz vom 21. März 1883 entzog das Handelsministerium den Finanzbehörden die Kompe-tenz von Strafverfahren bei Gesetzesübertritten gegen das Hausiergesetz und wies diese Agenden den Bezirkshauptmannschaft en zu.83 Allerdings blieben die Wün-sche vieler galizischer Bezirkshauptmannschaft en nach weitergehenden Kompe-tenzen zur Einschränkung des Hausierhandels wie auch nach zentralstaatlichen Restriktionen unerfüllt. Erneut zeigt sich die rechtliche Beschränkung der galizi-schen Landesinstitutionen, die den geltenden Normen der in Wien angesiedelten Zentralstellen unterworfen waren.
Der Reformdiskurs der Jahre 1877–1885 spielte sich innerhalb der politischen und administrativen Institutionen sowie zwischen Hausierern und den Behörden ab und hatte keinen unmittelbaren Einfl uss auf die Wahrnehmung in der öff entlichen Sphäre. Er prägte jedoch ganz entscheidend die Wahrnehmung der Behörden und die davon ausgehende Auslegung der rechtlichen Normen, bei der die Bezirkshaupt-mannschaft en über einen beachtlichen Spielraum verfügten.84 Durch die restriktive Handhabung der Kriterien bei der Erteilung von Hausierpässen, der Genehmigung von Gehilfen oder Wägen sowie durch die Festsetzung von Geld- und Arreststrafen bei Gesetzesübertritten wurden zahlreiche jüdische Hausierer in die Illegalität getrie-ben und vom Hausierhandel ausgeschlossen. In den 1880er Jahren stiegen die Be-rufungen wegen der vermehrten Ablehnung von Hausiergenehmigungen durch die Behörden. Zugleich nahmen die Bestrafungen von Hausierern für illegale Formen des Hausierhandels zu.85 Die meisten rekurrierenden Händler waren galizische Ju-den. Akzeptiert man die von Gargas zitierte Vermutung der niederösterreichischen Landesregierung, wonach auf einen Rekurs zehn illegale Hausierer kämen, so lag diese Zahl in Galizien im Jahr 1886 bei 700.86 Dies macht deutlich, dass mit der fort-schreitenden Verdrängung jüdischer Akteure aus anderen Berufsfeldern auch der Andrang in prekäre Beschäft igungsfelder wie dem Hausierhandel zunahm.
Dass die Entscheidungen der Behörden über formalrechtliche Aspekte hinaus-gingen, belegt der Antrag des galizischen Hausierers Tobiasz Hechel aus Ustrzyki dolne auf Ausstellung eines Hausierpasses, den die Bezirkshauptmannschaft Lisko am 10. Jänner 1882 ablehnte. Auch Hechels Rekurs bei der galizischen Statthalterei blieb erfolglos. Im Rahmen dieses Verfahrens schrieb der Bezirkshauptmann von Lisko in seiner Begründung am 7. April 1882, er sehe keinen Bedarf „einer Ver-mehrung des Hausierwesens sowohl in gewerblicher Hinsicht wie auch [in Hin-sicht] auf die von den ununterbrochen umher streichenden Hausierern ausgebeu-tete arme Gebirgsbevölkerung […].“87
Dass die galizisch-jüdischen Hausierer diese administrativen Regulierungen als Diskriminierung aufgrund ihres ethnisch-konfessionellen Hintergrunds emp-fanden, machte der Lemberger Hausierer Leiser Mandelberg in seinem Schreiben an den Kaiser vom 21. Februar 1886 deutlich, in dem er eine Begnadigung von der Bestrafung für den Verkauf von Altwaren in Lemberg ohne Genehmigung forder-te.88 Mandelberg schrieb, er hatte nie einen ordentlichen Beruf erlernt, sondern
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 534851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 53 02.11.2009 12:40:1702.11.2009 12:40:17
Arbeits
kopie
54
sich 28 Jahre lang seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Altwaren verdient. Damals war dazu keine Bewilligung notwendig, vor kurzem hatte der Lember-ger Magistrat jedoch eine Genehmigungspfl icht für diese Art von Hausierhandel eingeführt. Mandelberg meinte, diese Verordnung könnte sich nur auf neu in das Gewerbe eintretende Personen beziehen, noch dazu liege gegen ihn kein Beweis für den Verkauf von Altwaren vor. Zudem verwies Mandelberg auf seine prekären Lebensumstände: Ohne Hausiergewerbe könnte er seine Ehefrau und vier Kinder nicht versorgen. „Allein seit der eingeführten erweiterten Autonomie hat hier zu Lande ein Israelite wenig Hoff nung auf die Gewährung seiner noch so gerechten Bitte“, schrieb Mandelberg. Dies blieb ihm auch dieses Mal verwehrt – vom cisleit-hanischen Innenministerium, das Mandelbergs Rekurs am 21. März 1886 zurück-wies. Somit musste Mandelberg die Strafe von 10 Gulden oder zwei Tagen Arrest ableisten und war fortan von seinem Gewerbe ausgeschlossen.
Der Fall Mandelbergs demonstriert, dass die behördlichen Restriktionen in so-zialer Hinsicht dramatische Folgen hatten: Die Hausierenden, deren Erwerbslage ohnehin prekär war, verloren rechtmäßigen Erwerb sowie Einkommen, ohne dass sie beim Wechsel in ein anderes Berufsfeld auf Unterstützung hätten hoff en können. Dadurch beendeten die Behörden abrupt langjährige Erwerbsbiografi en und entzo-gen Hunderten von Händlern89 ihre Lebensgrundlage. Den meisten Hausierenden standen – außer der Emigration – kaum andere Erwerbsmöglichkeiten off en, da sie zumeist über keine oder nur geringe Qualifi kationen verfügten, die ihnen die Aus-übung eines anderen Berufes ermöglicht hätten. Gerade darin lag die Prekarität des Hausiergewerbes als letztem Ausweg für marginalisierte gesellschaft liche Gruppen.
Frauen waren hierbei in doppelter Weise betroff en – als Partnerinnen von Hausie-rern, die ihren Erwerb verloren sowie selbst als aktive Hausiererinnen. Laut den Hau-sierlisten der Jahre 1886 und 1893–95 waren 6% der Hausierenden weiblich. Von den aus Galizien stammenden Hausierern waren 5%, von den galizisch-jüdischen Hau-sierern 3% Frauen. Bei Polen und Ruthenen lag der Anteil von Hausiererinnen etwas höher. Trotz ihres geringen Anteils spielten Frauen bei Strafverfahren und Rekursen gegen abgelehnte Anträge auf Hausierbücher eine überproportional große Rolle. Wa-ren Frauen auch stärker von Verdrängungen betroff en, so wurden ihre Berufungen vergleichsweise stärker berücksichtigt. So erreichte die Witwe Marjem Rachel Rührer aus Sokal mit ihrem Rekurs bei der Statthalterei am 30. November 1886 die Erteilung der von der Bezirkshauptmannschaft Sokal verweigerten Hausiergenehmigung.90 Die von der Verdrängung aus dem Hausiergewerbe betroff enen Frauen waren nur teilwei-se Witwen. Viele von ihnen waren verheiratet und hatten Kinder, weshalb das Hausier-gewerbe einen wichtigen Bestandteil des Haushaltseinkommens darstellte. Auch Ehe-frauen von Hausierern spielten in den behördlichen Prozessen durchaus eine Rolle. Im Sommer 1886 erreichte Elie Sara Tager aus Kolomea bei der Statthalterei in Lemberg die Genehmigung eines Pferdewagens für ihren Mann:
Vor einigen Wochen hat mein Mann Moses Mechel Tager ein Gesuch an die k.k. Bezirkshauptmannschaft in Kolomea um Bewilligung zur Beförde-rung seiner Waaren von Ort zu Ort und sein Begehren gesetzlich motivirt, welches Gesuch der hohen k.k. Statthalterei vorgelegt wurde. Mein Mann
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 544851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 54 02.11.2009 12:40:1702.11.2009 12:40:17
Arbeits
kopie
55
schreibt mir von seiner Gegend, daß er nicht im Stande ist die Waare weiter am Buckel zu tragen, das weitere Tragen der Waare am Buckel ist mit sei-nem Tode bedroht, wodurch ich mit meinen unversorgten 8 Kindern dem Eltern und Hungerstode Preis gegeben bin.91
Deutlich wird in diesem Schreiben nicht nur die dramatische soziale Lage einer kinderreichen galizisch-jüdischen Hausiererfamilie, sondern auch, dass jüdische Ehefrauen im traditionellen galizischen Milieu in der öff entlichen Sphäre eine aktive Rolle einnahmen, wenn es um die Sicherung des Haushaltseinkommens ging. Der Fall Tager steht paradigmatisch für viele ältere galizische Hausierer, die aufgrund ihrer körperlichen Gebrechen nach jahrelanger Tätigkeit ihren Beruf ohne Hilfsmittel nicht mehr ausüben konnten. Die Behörden schränkten den sozio-ökonomischen Handlungsspielraum der Hausierer folglich nicht nur dadurch ein, indem sie neue Hausierpässe verweigerten, sondern auch durch Restriktionen bei der Genehmigung von Gehilfen oder Pferdewägen für ältere Hausierer, die auf-grund ihrer körperlichen Verfassung die Waren nicht mehr selbst von Ort zu Ort tragen konnten.
Im Frühjahr 1887 suchte beispielsweise der Hausierer Eliasz Broder aus Brzes-ko in Westgalizien bei der dortigen Bezirkshauptmannschaft um einen Pferdewa-gen zum Warentransport an:
Geboren im Jahr 1825, derzeit 62 Jahre zählend – und kein Vermögen besit-zend, beschäft ige ich mich seit 32 Jahren mit dem Hausierhandel, um mich und meine Familie zu erhalten, die aus drei Personen besteht, von denen zwei noch minderjährig sind und sich nicht aus eigenen Kräft en ernähren kön-nen. Die so lange, weil 32-jährige Ausübung des Hausierhandels zum Unter-halt verbunden mit dem Tragen der Waren auf dem Rücken hat mich sämt-licher Kräft e zum weiteren Heben der Lasten beraubt, zudem zog ich mir Krankheiten wie Asthma und Krämpfe in den Beinen zu, die mir das weitere Heben der schweren Waren wie Leinen, Seife und Textilwaren auf jeden Fall verunmöglicht – jener Verkauf, den ich ausschließlich betreibe. Da der Hau-sierhandel derzeit vollkommen verfallen ist – bin ich nicht einmal im Stande einen Helfer zum Tragen der Waren von Ort zu Ort zu beschäft igen – und wollte ich ihn beschäft igen, würde ich meinen eigenen Kindern die Lebens-mittel entziehen. Im Verlauf der vergangenen 32 Jahre meines Hausierhan-dels innerhalb der Grenzen des gesamten Österreichischen Staats habe ich niemals ein Verbrechen begangen – weder in moralischer noch in materieller Hinsicht – zudem kann ich mir selbst schmeicheln, dass ich einer der sel-tenen Hausierer bin, die im Lauf so vieler Jahre nicht bestraft wurden.92
Broder betonte abschließend, er hätte kein Gewerbe erlernt, daher wäre er auf den Hausierhandel als Erwerbsquelle angewiesen. Diese Argumente vermochten jedoch weder die Bezirkshauptmannschaft in Brzesko noch die Statthalterei in Lemberg zu überzeugen, die beide Broders Antrag ablehnten. Bemerkenswert ist, dass die Behörden trotz Broders auff allend guter Lebensführung das Ansuchen ablehnten.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 554851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 55 02.11.2009 12:40:1702.11.2009 12:40:17
Arbeits
kopie
56
Umgekehrt genehmigte die Statthalterei auf Antrag der Bezirkshauptmannschaft Brzesko nur wenige Wochen später Eliasz Hausübler einen solchen Wagen, nach dem dessen Antrag auf einen Gehilfen ein Jahr zuvor abgelehnt worden war.93
Dies macht erneut den Wandel deutlich, den die Regulierung des Hausierwesens zwischen den späten 1870er und den frühen 1880er Jahren durchlief: Sicherheits-bedenken und somit auch gute Lebensführung spielten als Argumente bei Anträ-gen von Hausierern keine Rolle. Die Wahrung der wirtschaft lichen Interessen der Geschäft sinhaber stand im Vordergrund. In den Augen der Behörden gefährdete der Einsatz von Pferdewägen oder Gehilfen zum Warentransport die Interessen sess-haft er Kaufl eute, weshalb mit solchen Genehmigungen deutlich zurückhaltender als vor 1873 umgegangen wurde. Neben der möglichsten Reduzierung der Anzahl und Mobilität von Hausierern bestimmten auch die zum Hausierhandel zugelas-senen Waren die Erwerbsmöglichkeiten von Hausierern. Seit Beginn der 1880er Jahre nahmen die Strafverfahren gegen Hausierende zu, die mit nicht erlaubten Waren handelten. Besonders oft wird in den Quellen Petroleum genannt, das von jüdischen Hausiererinnen illegal verkauft wurde.94 Aber auch andere Waren, wie Nürnberger- und Altwaren, waren betroff en. Der Anstieg der Strafverfolgungen auf diesem Gebiet belegt die zunehmend restriktive rechtliche Praxis und damit die Einschränkung des tatsächlichen Erwerbsraums der Hausierer.
Die hier in qualitativen Belegen sichtbare Zurückdrängung von Hausierern durch die Behörden ist in den statistischen Zahlen so eindeutig nicht erkennbar, wohl aber in der Tendenz der gültigen Hausierpässe in Cisleithanien, deren Zahl nach 1882 kontinuierlich sank.95 Die Zahlen der erteilten und verlängerten Hausier-pässe in Galizien blieben relativ konstant und stiegen in den 1880er Jahren sogar leicht an (Abbildung 3). Im Vergleich dazu nahm die Anzahl der Vidierungen massiv zu, was auf die strengere Kontrolle durch die Behörden sowie die verstärkte Mobilität von Hausierern verweist. Zugleich stieg die Zahl der externen Hausierer in Galizi-en. Dies lässt sich vom Anstieg der anwesenden Hausierer in Galizien ablesen, der
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1882 1883 1884 1885 1886 1890 1892 1893 1894 1896
erteilteverlängertegültigevidierteanwesende Hausierer
Abbildung 3: Hausierpässe in Galizien 1882–1896
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 564851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 56 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie
57
im Vergleich zu den erteilten und verlängerten Hausierpässen zumindest bis Mitte der 1880er Jahre unverhältnismäßig größer war. Allerdings scheint diese Zahl zu hoch zu sein (sie übersteigt sogar die Zahl der Vidierungen). Diese Angaben stehen zudem im Widerspruch mit den in der Denkschrift des Landesausschusses genann-ten Daten, wobei deren ursprüngliche Quelle unbekannt ist. Laut der Volkszählung von 1890 sank die Zahl der in Galizien anwesenden Hausierer, allerdings sind diese Zahlen aufgrund von Mehrfachzählungen nur sehr begrenzt vergleichbar.96 Den-noch beträgt die Zahl der anwesenden Hausierer auch nach der Volkszählung von 1890 fast das Doppelte der in Galizien gültigen, d.h. dort erteilten und verlängerten Hauspässe. Dies scheint darauf hinzudeuten, dass in den 1880er Jahren die externen gegenüber den galizischen Hausierern zunahmen. In absoluten Zahlen ging in dieser Zeit die Zahl der Hausierer in ganz Cisleithanien zurück.
Nach der Jahrhundertwende stieg die Zahl der von galizischen Behörden ausge-stellten Hausierpässe erneut stark an.97 Dies wiederum veranlasste das Handelsminis-terium im Jahr 1904 alle Bezirkshauptmannschaft en auf eine restriktive Vergabepra-xis von Hausierbüchern hinzuweisen.98 Ein Jahr später begründete das Ministerium die Ablehnung eines Hausierpasses für den Lemberger Meilech Pims damit, dass
[…] die gegenwärtigen Handels- und Kommunikationsverhältnisse des Landes dem Publikum den Bezug besserer und billiger Waren bei sesshaft en Geschäft sleuten ermöglichen und eher für die gänzliche Abschaff ung des Hau-sierhandels als für die Vermehrung der Zahl der Hausierer sprechen […].99
Verlangte nun das politische Zentrum in Gestalt des Ministeriums die Einschrän-kung der Zahl der Hausierer, zeigte die Unentschlossenheit des Polenklubs in der Debatte des cisleithanischen Abgeordnetenhauses um die Verabschiedung eines restriktiven Hausiergesetzes im Februar 1911, dass Galiziens politische Entschei-dungsträger auf der obersten Ebene letztendlich vor einer zu starken Zurückdrän-gung des Hausiergewerbes zurückschreckten.100
Laut Berufsstatistik nahm das Hausiergewerbe unter der galizisch-jüdischen Bevölkerung von 1900 bis 1910 aufgrund des Wegfalls von Märkten deutlich ab.101 Stärker als die Regulierungen der Behörden war es der ökonomische Strukturwan-del, der den Hausierhandel im frühen 20. Jahrhundert an den Rand drängte. Damit blieb als letzter Ausweg die Emigration.
Konklusion
Das analysierte Material belegt, wie lokale Wirtschaft streibende im Verband mit den Behörden ihre Interessen gegen eine über- und intraregional mobile Händlergruppe zu verteidigen versuchten. Dass in diesem Diskurs entscheidende Institutionen in offi ziellen Dokumenten zu unterschwelligen bis explizit antijüdischen Vorurteilen griff en, zeigt eine legitimatorische Strategie. Aus dem allgemeinen Diskursstrang ‚jüdischer Händler‘ bekannte Vorurteile wurden auf das konkrete Feld des ohnehin suspekten Hausierhandels übertragen, um dessen Einschränkung zu rechtfertigen.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 574851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 57 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie
58
Es verschränkten sich Vorurteile gegenüber einer sozialen Randgruppe mit jenen gegenüber einer ethnischen bzw. konfessionellen Minorität, der man wechselweise zu große Macht oder Unterentwicklung vorwarf. Diese Stereotype existierten aller-dings nicht unabhängig von den dargestellten Konkurrenzprozessen, sondern wur-den durch diese mobilisiert und (neu) defi niert. Damit wurden jene Abgrenzungen (re)produziert und oft erst etabliert, die die Grundlage nationaler Identitäten bil-deten. Wenn auch räumliche Konkurrenz thematisiert und problematisiert wurde, überwog am Ende dennoch die zwischenethnische Wahrnehmung innerhalb der Region Galizien. Insofern überrascht es nicht, dass die Behörden weder die vor-handenen legislativen Kompetenzen ausschöpft en, um den überregionalen Hau-sierhandel nach ihren Erwägungen zu steuern, noch dass keine einzige galizische Stadt bis zum Ersten Weltkrieg um ein generelles Hausierverbot ansuchte – wie es zahlreiche ungarische, aber auch eine Reihe cisleithanischer Städte taten. Insofern ist die von verschiedenen galizischen Behörden und Institutionen insbesondere in den 1880er Jahren belegbar wahrgenommene Bedrohung durch Hausierer ein dis-kursives Konstrukt, das Konkurrenzprozesse dort ortete, wo sie regional und lokal an einer mobilen sozialen Gruppe, von der ein Großteil ethno-kulturell als fremd defi niert wurde, festgemacht werden konnten. Auf diese Art wurde überregionale ökonomische Konkurrenz zu einer ethnischen umkodiert.
Anmerkungen1 Ich bedanke mich bei Kai Struve, Christoph Augustynowicz, Andrea Komlosy, Angélique Leszczawski-
Schwerk, Roman Dubasevych und Simon Hadler für ihre Anmerkungen zu früheren Versionen dieses Beitrags.
2 Siehe z.B. Wirtschaft liche Zustände Galiziens in der Gegenwart. Sechs Vorträge gehalten aus An-lass der Studienreise der Wiener freien Vereinigung für staatswissenschaft liche Fortbildung nach Krakau und Galizien (2.-11.Juni 1912), Wien – Leipzig 1913. Der Befund zieht sich durch alle Vorträge der Publikation.
3 Z.B. Kargol, Tomasz, Wirtschaft liche Beziehungen zwischen Galizien und den Ländern der österrei-chisch-ungarischen Monarchie in der ersten Hälft e des 19. Jahrhunderts, in: Augustynowicz, Chris-toph – Kappeler, Andreas (Hg.), Die galizische Grenze 1772–1867: Kommunikation oder Isolation? (= Europa Orientalis Band 4), Wien 2007, S. 33–50, hier: S. 48. Madurowicz-Urbańska, Helena, Die Industrie Galiziens im Rahmen der wirtschaft lichen Struktur der Donaumonarchie, in: Hanausek, Stanisława – Wyrozumski, Jerzy – Buszko, Józef – Leitsch, Walter – Bruchnialski, Janusz, Studia Austro-Polonica 1, Kraków – Warszawa 1978, S. 157–173. Für die Landwirtschaft : Hryniuk, Stella, Peasants with Promise. Ukrainians in South-Eastern Galicia 1880–1900, Edmonton 1991.
4 Madurowicz-Urbańska, Industrie, S. 160–162.5 Kool, Leslie, Economic Development on the Periphery. A Case Study of East Galicia, Ph.D. diss
Temple University (Ann Arbour, Michigan), 1994, S. 201.6 Himka, John-Paul, Socialism in Galicia. Th e Emergence of Polish Social Democracy and Ukrainian
Radicalism (1860–1890), Cambridge 1983, S. 14. Kargol, Beziehungen, S. 47. Madurowicz, Indust-rie, S. 172f.
7 Zu den Konzepten von Kommodifi zierung und Kommerzialisierung, insbesondere ihren Unter-schieden siehe: Hopkins, Terence K. – Wallerstein, Immanuel, Grundzüge der Entwicklung des modernen Weltsystems. Entwurf für ein Forschungsvorhaben, in: Senghaas, Dieter (Hg.), Kapi-talistische Weltökonomie. Kontroversen über ihren Ursprung und ihre Entwicklungsdynamik, Frankfurt 1979, S. 151-200, hier: S. 169.
8 Wallerstein, Immanuel, Der historische Kapitalismus, Berlin 1984, S. 25–27.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 584851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 58 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie
59
9 Struve, Kai, Peasant Emancipation and National Integration. Agrarian Circles, Village Reading Rooms and Cooperatives in Galicia, in: Lorenz, Torsten (Hg.), Cooperatives in Ethnic Confl icts: Eastern Europe in the 19th and early 20th Century (= Frankfurter Studien zur Wirtschaft s- und Sozialgeschichte Ostmitteleuropas, Bd.15), Frankfurt/Oder 2006, S. 229–250, hier: S. 236.
10 Zur Ethnisierung von sozialen Konfl ikten vgl. Ost, David, Th e Defeat of Solidarity. Anger and Politics in Postcommunist Europe, Ithaca/N.Y. u.a. 2005, S. 67f. Es wird hier von der Konstruiert-heit ethnischer wie nationaler Gruppen ausgegangen. Moderne Nationen entstanden durch die kommunikative und infrastrukturelle Aufl ösung isolierter Dorfgemeinden. Vormoderne kulturelle Gruppenmarker wie Religion und/oder Sprache dienten als Elemente für die Konstruktion na-tionaler Identitäten. Diese verstanden sich als überregional wirksame Kollektive, wodurch lokal verwurzelte Identitätszuschreibungen abgelöst wurden. In Galizien setzte dieser Prozess in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts ein. Struve, Bauer und Nation, S. 12–14.
11 Vgl. Kulczykowski, Mariusz, „Deindustrializacja“ w procesach uprzemysłowienia Galicji w XIX wieku. Problemy badawcze, in: Kozłowska-Sabatowska, Halina (Hg), Struktury, ruchy, ideologie XVII–XX wieku (= Zeszyty Naukowe UJ DCCLIII), Kraków 1986, S. 75–87, hier: S. 75f. Ders., Pro-toindustrializacja i deindustrializacja Galicji w latach 1772–1918. Problemy badawczy, in: Rocz-niki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, t. 50 (1989), S. 105–118. Zwar führen viele Arbeiten die Fertigwarenlieferungen aus anderen Regionen nach Galizien an, allerdings sind Bemerkungen über dadurch ausgelöste Verdrängungsprozesse allgemeiner Natur und in keiner Arbeit systema-tisch erforscht. Siehe z.B. Madurowicz-Urbańska, Industrie, S. 171. Buszko, Józef, Zum Wandel der Gesellschaft sstruktur in Galizien und in der Bukowina, Wien 1978, S. 14. Himka, Socialism, S. 14f. Kool, Development, S. 99, 219.
12 „Galizien“ gab es als territoriale Einheit vor der Ersten Polnischen Teilung nicht und wurde von der habsburgischen Bürokratie unter Rekurs auf fragwürdige völkerrechtliche Ansprüche als Region aus verschiedenen territorialen Einheiten konstituiert. Magocsi, Paul Robert, Galicia: A European Land, in: Hann, Christopher – Magocsi, Paul Robert (Hg.), Galicia. A Multicultured Land, Toronto – Buff alo – London 2005, S. 3–21, hier: S. 4–6.
13 Kargol, Beziehungen, S. 35–38, 40–42, 44.14 Bachinger, Karl, Das Verkehrswesen, in: Wandruszka, Adam – Urbanitsch, Peter (Hg.), Die Habsbur-
germonarchie 1848–1918, Bd. I: Die wirtschaft liche Entwicklung, Wien 1973, S. 278–322, hier: S. 278.15 Himka, John-Paul, Galician Villagers and the Ukrainian National Movement in the Nineteenth
Century, Basingstoke 1988, S. 167. Lipp, Adolf, Verkehrs- und Handelsverhältnisse in Galizien, Prag 1870, S. 282f., 285f., 288, 295f.
16 Andlauer, Teresa, Die jüdische Bevölkerung im Modernisierungsprozess Galiziens (1867–1914), Frankfurt/Main – Wien 2001, S. 159. Kaps, Klemens, Gescheitertes Aufh olen in Zentraleuropa. Der Abstieg der Habsburgermonarchie zu einem semiperipheren Wirtschaft sraum im Spiegel ih-rer Außenhandelsstruktur 1791-1880, in: Zeitschrift für Weltgeschichte Nr.9/1 (2008), S. 103–122, hier: S. 117. Lipp, Verkehrs- und Handelsverhältnisse, S. 288.
17 Bachinger, Verkehrswesen, S. 288f., 297.18 Eigene Berechnungen nach den korrigierten Daten in Szczepanowski, Stanisław, Nędza Galicyi w
cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego, Lwów 1888, S. 47. Dabei sind die Zahlen für Fertigwaren etwas zu hoch, da die Rubrik Eisen und Eisenwaren sich nicht in Rohstoff e, Halbfertig- und Fertigwaren aufschlüsseln lässt. Ohne diese Rubrik würde der Fertigwarenanteil 1869 53% und 1883 71% betragen. Die bei Tokarski, Slawomir (Ethnic Confl ict and Development. Jews in Galician Agriculture (1868 – 1914), Warszawa 2003, S. 191) angeführten Berechnungen des Fertigwarenanteils der Eisenbahnimporte, die sich ebenfalls auf Szczepanowskis Angaben stützen, scheinen die Fehler der Originalquelle zu übernehmen, weshalb die Werte für 1869 zu hoch, jene für 1883 zu niedrig sind.
19 Zu Szczepanowskis politischer und ökonomischer Rolle sowie seinen diskursiven Absichten und Wirkungen siehe: Frank Fleig, Alison, Oil Empire. Visions of Prosperity in Austrian Galicia, Cambridge 2007, S. 79–108. Śliwa, Michał, Nędza Galicyjska. Mit i rzeczywistość, in: Bonusiak, Włodzimierz – Buszko, Józef (Hg.), Galicja i jej Dziedzictwo, Tom 1: Historia i Polityka, Rzeszów 1994, S. 145–155.
20 Eigene Berechnungen nach: Biegeleisen, Leon Władysław, Stan ekonomiczny Małopolski na pod-stawie bilansu handlowego, Warszawa 1921, S. 273f. Pączewski, Leon, Bilans handlowy Małopolski, in: Kempner, Stanisław Aleksander (Hg.), Dzieje Gospodarcze Polski Porozbiorowej w zarysie, Band 2, Warszawa 1922, S. 372–391, hier: S. 385–391.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 594851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 59 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie
60
21 Szczepanowski, Nędza, S. 46. Pączewski, Bilans handlowy, S. 391.22 Siehe beispielsweise: Markiewicz, Stanisław, Memorandum w sprawie podniesienia krajowego
przemysłu domowego szczególniej tkackiego w Galicji, skierowane do Wydziału Krajowego we Lwowie, Lwów 1882. Rutowski, Tadeusz, Rocznik Statystyki Przemysłu i Handlu Krajowego wyda-ny przez Krajowe Biuro Statystyczne, Zeszyt XII: Przemysł domowoy i rękodzielniczy, Lwów 1889, S. 1–4. Anczyc, Stanisław, O przemyśle tkackim w Galicyi, Kraków 1903. Głąbinski, Stanisław, Stosunki społeczne i ekonomiczne w Galicyi, in: Polska Obrazy i Opisy (Wydawnictwo Macierzy Polskiej Nr.83 z fundacji im. Tadeusza Kościuszkiego Nr. 4), Tom II, Lwów 1909, S. 819–857, hier: S. 822–824, 839f.
23 Vgl. dazu Hryniuk, Peasants, S. 115–162.24 Tokarski, Ethnic Confl ict, S. 191f.25 Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Lemberg an das hohe k.k. Ministerium für Handel,
Gewerbe und öff entliche Bauten über die Zustände des Handels und der Industrie in ihrem Kam-merbezirke in den Jahren 1854, 1855 und 1856, Lemberg 1859, S. 45–47.
26 Bericht der Handels- u. Gewerbekammer in Krakau 1851, S. 11.27 Kulczykowski, Deindustrializacja, S. 79f. Bericht der Brodyer Handels- und Gewerbekammer
1851, S. 7, 11f.28 Andlauer, Bevölkerung, S. 161.29 Bericht der Lemberger Handels- und Gewerbekammer über den Handel und die Industrie, so wie
deren Beförderungsmittel in ihrem Kammerbezirke für die Jahre 1861 in 1865 an das hohe k.k. Ministerium für Handel und Volkswirthschaft , Lemberg 1867, S. 268.
30 Bericht der Handels- und Gewerbekammer in Lemberg über den Handel und die Industrie, so wie deren Beförderungsmittel im Kammerbezirke für die Jahre 1866 in 1870, erstattet an das hohe k.k. Handels-Ministerium, Lemberg 1873, S. 504f.
31 März, Eduard, Österreichs Industrie- und Bankenpolitik in der Zeit Franz Joseph I., Wien 1968, S. 102f.
32 Markiewicz, Memorandum, S. 3.33 Szczepanowski, Nędza, S. 46.34 Lauss, Josef, Wachstum und Krise der österreichischen Leinenindustrie im 19. Jahrhundert, Diss.
Univ. Wien 1977, S. 23–28.35 Tokarski, Ethnic Confl ict, S. 157. Andlauer, Bevölkerung, S. 178. Anczyc, O przemyśle, S. 10f., 14.
Im Gegensatz zu Anczycs Daten gibt der Wirtschaft shistoriker Jan Rutkowski einen Anstieg der Weber Galiziens von 16.000 auf 23.000 zwischen den Jahren 1862 und 1890 an. Dennoch wäre dies mit einem deutlichen Rückgang der Weber nach 1890 kompatibel. Rutkowski, Jan, Historia gospodarcza Polski do 1864 r., Warszawa 1953, S.358.
36 Kulczykowski, Deindustrializacja, S. 87.37 Tokarski, Ethnic Confl ict, S.157. Andlauer, Bevölkerung, S. 179f. Siehe den Beitrag von Angélique
Leszczawski-Schwerk in diesem Band.38 Hödl, Klaus, Galician Jewish Migration to Vienna, in: Bartal, Israel – Polonsky, Antony (Hg.), Fo-
cusing Galicia: Jews, Poles and Ukrainians, 1772–1918, Polin Band 12, Studies in Polish Jewry, London 1999, S. 147–163, hier: S. 149-151.Tokarski, Ethnic Confl ict, S. 146f.
39 Zum Begriff und seiner Problematisierung siehe: Binder, Harald, „Galizische Autonomie“ – ein streitbarer Begriff und seine Karriere, in: Lukás Fasora u.a. (Hg.), Moravské vyrovnání zroku 1905 / Der Mährische Ausgleich von 1905, Brünn/Brno 2006, S. 239–266.
40 Pilch, Andrzej, Migrations of the Galician Populace at the Turn of the Nineteenth and Twentieth Centuries, in: Bobińska, Celina – Pilch, Andrzej (Hg.), Employment-seeking Emigrations of the Poles World-wide XIX and XX c. (=Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CCCCXVII, Prace Polonijne, Zeszyt 1), Kraków 1975, S. 77–101, hier: S. 84–86. Himka, Socialism, S. 14–16.
41 Mahler, Raphael, Th e Economic Background of Jewish Emigration from Galicia to the USA, in: YIVO – Annual of Social Science 7 (1952), S. 255–267, hier: S. 260.
42 Struve, Kai, Bauern und Nation in Galizien. Über Zugehörigkeit und soziale Emanzipation im 19. Jahrhundert, Göttingen 2005, S. 420, 432.
43 Батькôвщина, 12 (26. März 1885), S. 77.44 Tokarski, Ethnic Confl ict, S. 151, 173, 175.45 Zwischen 1862 und 1881 stieg die Zahl der Hausierer in ganz Cisleithanien von 12.805 auf 22.964.
Schwiedland, Eugen, Die Hausierfrage in Österreich, Leipzig 1899, S. XXXIV.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 604851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 60 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie
61
46 Tremel, Ferdinand, Der Binnenhandel und seine Organisation. Der Fremdenverkehr, in: Wandrus-zka – Urbanitsch, wirtschaft liche Entwicklung, S. 369–402, hier: S. 369. Gargas, Zygmunt, Handel obnośny a państwo, Kraków 1900, S. 56, 169f.
47 Центральний державний історичний архів України м. Львів (Zentrales Staatliches Histori-sches Archiv der Ukraine in Lemberg; in weiterer Folge: СДІАЛ), Фонд 146 – Опіс 68 – Справа 2936 (in weiterer Folge 146-68-2936), 71653/1861, No. 6989, Fol. 17–18. Gargas, Handel obnośny, S. 40, 45–47, 57f.
48 СДІАЛ, 146-68-2936, Z. 51383, Fol. 33–36.49 СДІАЛ, 146–68–2936, Z.7419, Fol. 45–46.50 Gargas, Handel obnośny, S. 194f. Tremel, Binnenhandel, S. 370.51 СДІАЛ, 146-68-2936, Z. 45485 ex 1876, Fol. 108–111.52 СДІАЛ, 146-68-2936, 14151, Z. 1447, Fol. 148-149, Z. 33754, Fol. 157–158, Z. 38526, Fol. 159, Z.
42309, Fol. 163–164, 60906, Fol. 180–182.53 СДІАЛ, 146-68-2936, 1257, Fol. 187–188.54 СДІАЛ, 146-68-2936, Z. 19148, Fol. 134, Z. 62329, Fol. 138, Z.5715, Fol. 151, Z. 10630, Fol. 174.55 СДІАЛ, 146-68-2936, 12733, No. 5782, Fol. 202–203.56 СДІАЛ, 146-68-2936 und 2937.57 Ebenda.58 СДІАЛ, 146-68-2936.59 СДІАЛ, 146-68-2936, 15634, Fol. 248–249. Diese und die folgenden Übersetzungen stammen vom
Autor, sofern nicht anders ausgewiesen.60 СДІАЛ, 146-68-2936, L.23/12, Fol. 300–301.61 Laut Schätzungen verdiente ein Hausierhändler in den 1890er Jahren 75 Kreuzer pro Tag, und
zumeist nicht mehr als zwischen 100 bis 300 Gulden, nur in seltenen Fällen höchstens 7.000 Gul-den jährlich. Gargas, Handel obnośny, S. 146f. Zucker, Ignaz, Der Hausir- und Ratenhandel. Eine Volkswirtschaft liche Studie, Wien 1892, S. 11.
62 Gargas, Handel obnośny, S. 122f., 130. Lipp, Verkehrs- und Handelsverhältnisse, S. 283.63 Buszko, Wandel, S. 14.64 Tokarski, Ethnic Confl ict, S. 157.65 СДІАЛ, 146-68-2936, L. 3717, Fol. 244–245.66 СДІАЛ, 146-68-2940, L[iczba] 48067, Wydział Krajowy do Świetnego Namiestnictwa we Lwowie.
We Lwowie, dnia 14 Listopada 1885. Podano 20 Listopada 1885, Fol. 243–254, hier: Fol. 249.67 Chwalba, Andrzej, Historia Polski 1795-1918, Kraków 2005, S. 496.68 СДІАЛ, 146-68-2940, L.48067, Fol. 247.69 Ebenda, Fol. 253.70 Gargas, Handel obnośny, S. 185.71 СДІАЛ, 146-68-2938, Z. 80973, Fol. 133–138. Ebenda, 146-68-2939, Z.24769/5227, Fol. 197.72 Gargas, Handel obnośny, S. 137f. Zucker, Ratenhandel, S. 10.73 Th aa, Georg Ritter von, Das Hausirwesen in Oesterreich, Wien 1884, S. 122-124.74 Eigene Berechnung nach Schwiedland, Hausierfrage, S. XXXV, XXXVII.75 Gargas, Handel obnośny, S. 136–138.76 СДІАЛ, 146-68-2941, 2942, 2943.77 Die Listen erfassten ein Siebtel (1886) bzw. ein Drittel (1893–95) der in Galizien tätigen Hausierer.
Daher werden die Daten dieser Jahre aggregiert analysiert, um repräsentative Tendenzen des Hau-sierhandels herauszuarbeiten.
78 Bei 7% der in den Listen angeführten Hausierer konnte die regionale Herkunft nicht ermittelt wer-den, was das Ergebnis allerdings kaum beeinfl ussen würde.
79 Schwiedland, Hausierfrage, S. XXXV, XXXVII.80 Tremel, Binnenhandel, S. 370.81 Hödl, Migration, S. 151.82 Hödl, Klaus, „Vom Shtetl an die Lower East Side“. Galizische Juden in New York, Wien – Köln –
Weimar 1991, S. 45f.83 Reichsgesetzblatt XI. Stück, 37. Gesetz vom 21. März 1883.84 Gargas, Handel obnośny, S. 73.85 Als Beispiel wurden die Jahre 1886–1887 systematisch analysiert: СДІАЛ, 146-68-2941, 2942.86 Gargas, Handel obnośny, S. 121.87 СДІАЛ, 146-68-2937, L.2273, Fol. 132.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 614851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 61 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie
62
88 СДІАЛ, 146-68-2940, Z.4790, Fol. 266–267 (Deutsch im Original).89 In den Akten der Statthalterei fi nden sich für das Jahr 1886 allein 70 solcher Fälle. СДІАЛ, 146-68-
2941.90 СДІАЛ, 146-68-2941, Z. 77799/85, Fol. 213–214.91 СДІАЛ, 146-68-2941, Nr. 43476, Fol. 60–62 (Deutsch im Original).92 СДІАЛ, 146-68-2941, Z. 23020/1887, Fol. 343–344.93 СДІАЛ, 146-68-2940, 34656, Fol. 335.94 СДІАЛ, 146-68-2940, Z. 3745/1886, Fol. 177; 15005/1886, Fol. 223; Z. 20519, Fol. 270; Z.
34256/4384, Fol. 366.95 Schwiedland, Hausierfrage, S. XXXIV.96 Gargas, Handel obnośny, S. 113f. Th aa, Hausirwesen, S. 121.97 Andlauer, Bevölkerung, S. 263.98 Archiwum Państwowe we Krakowie (APK), StCH I 71, C.k. Namiestnictwo, L.4297/4/III D/40,
Lwów, 6 lipca 1904.99 Archiwum Głównych Akt Dawnych we Warszawie (AGAD), c.k. Ministerstwo Przemysłu i Hand-
lu, Nr. 26: K.K. Handelsministerium, P.Z. 69.787, ddo. 4., präs. 11. Dezember 1905, Z.638/3 III D/40.
100 Binder, Harald, Galizien in Wien. Parteien, Wahlen, Fraktionen und Abgeordnete im Übergang zur Massenpolitik, (Studien zur Geschichte der Österreichisch-Ungarischen Monarchie, Band XXIX), Wien 2005, S. 453.
101 Tokarski, Ethnic Confl ict, S. 160.
4851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 624851_Doktorratskolleg-Galizien_innen_156x234.indd 62 02.11.2009 12:40:1802.11.2009 12:40:18
Arbeits
kopie