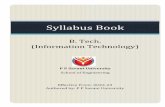P. Sänger, Einleitung, in: P. Sänger (Hrsg.), Minderheiten und Migration in der...
-
Upload
uni-muenster -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of P. Sänger, Einleitung, in: P. Sänger (Hrsg.), Minderheiten und Migration in der...
STUDIEN ZUR HISTORISCHEN MIGRATIONSFORSCHUNG
(SHM)
herausgegeben von
Jochen Oltmer
BAND 31
Wissenschaftlicher Beirat: Detlef Brandes, Pieter C. Emmer, Andreas Fahrmeir,
Ulrich Herbert, Walter D. Kamphoefner, Jan Lucassen
Patrick Sänger (Hg.)
Minderheiten und Migration in der griechisch-römischen
Welt
Politische, rechtliche, religiöse und kulturelle Aspekte
Ferdinand Schöningh
Redaktionsanschrift: Universität Osnabrück Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) Neuer Graben 19/21 49069 Osnabrück Tel.: +49 541 969 43 84 Fax: +49 541 969 43 80 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.imis.uni-osnabrueck.de Umschlagabbildung:
Relief des ›Römischen Reisewagens‹ an der südlichen Außenseite des Maria Saaler Domes (Kärnten, Österreich) © Photo: Patrick Sänger Für die Übertragung der Bildrechte sei dem Herrn Stiftspfarrer Kanonikus Mag. Klaus-Josef Donko herzlich gedankt Gedruckt mit Unterstützung der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung, Frankfurt a.M. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlags nicht zulässig. © 2016 Ferdinand Schöningh, Paderborn (Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Jühenplatz 1, D-33098 Paderborn) Internet: www.schoeningh.de Druckvorbereitung und Satz: Kristina Jäger und Jutta Tiemeyer, IMIS Einbandgestaltung: Evelyn Ziegler, München Printed in Germany Herstellung: Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG, Paderborn ISBN 978-3-506-76635-9
5
INHALT
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Allgemeine Hinweise zur Benutzung des Bandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Einleitung. Von Patrick Sänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Minderheiten und Migration als Politikum
Das politeuma in der hellenistischen Staatenwelt: Eine Organisationsform zur Systemintegration von Minderheiten. Von Patrick Sänger . . . . . . . . . . 25
Romanos mores inficere – zu den Problemen der jüdischen Gemeinde in Rom in der späten Republik und frühen Kaiserzeit. Von Ernst Baltrusch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Weibliche Diplomatie zwischen Gesandtschaften und Erziehung: Zum Verhältnis von Juden und römischen Kaiserinnen. Von Kerstin Sänger-Böhm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Rechtliche Normen und Grauzonen im Kontext von Minderheiten und Migration
The Nothoi Come of Age? Illegitimate Sons and Political Unrest in Late Fifth-Century Athens. By Elizabeth Irwin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Judean Marriage Custom and Law in Second-Century BCE Egypt: A Case of Migrating Ideas and a Fixed Ethnic Minority. By Robert Kugler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Migranten vor Gericht: Die Debatte um antikes Kollisionsrecht aus dem Blickwinkel von Internationalem Privatrecht und europäischer Privatrechtsvereinheitlichung. Von Nadine Grotkamp . . . . . . . . . . . . . . . 141
Barbarian Immigration and Integration in the Late Roman Empire: The Case of Barbarian Citizenship. By Ralph Mathisen . . . . . . . . . . . . . . 153
Inhalt
6
Minderheiten und Migrationsphänomene: Religiöse und kulturelle Aspekte
Religion und Mobilität bei den frühen Christen nach dem Zeugnis der Apostelgeschichte. Von Hans Förster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Greek Poetry in a Post-Greek Milieu: The Epigram for Sophytos from Kandahar Contextualized. By Julia Lougovaya . . . . . . . . . . . . . . . . 185
›Dominante Immigranten?‹ Germanische Eliten in den völkerwanderungs-zeitlichen Königreichen im Spiegel der archäologischen Forschung: Das Beispiel der Ostgoten. Von Roland Prien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Die Autorinnen und Autoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Quellenregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Sachregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
7
Vorwort
Der vorliegende Band stellt das Ergebnis des von Dr. Rodney Ast und mir veranstalteten Hengstberger-Symposiums zum Thema ›Minderheiten und Migrationsphänomene‹ dar, das vom 6. bis zum 9. Juli 2011 im Internationa-len Wissenschaftsforum Heidelberg (IWH) stattfand und insgesamt 25 Wis-senschaftlerInnen verschiedener geisteswissenschaftlicher Disziplinen aus Deutschland, Großbritannien, Österreich und den USA zusammenbrachte. Ermöglicht wurde die Konferenz durch den seit dem Jahr 2004 jährlich verge-benen Hengstberger-Preis, der durch eine Stiftung von Klaus-Georg und Sigrid Hengstberger finanziert wird und jungen WissenschaftlerInnen der Universität Heidelberg die Ausrichtung einer Tagung ermöglichen soll. Der Preis wurde den Veranstaltern am 23. Oktober 2010 nach einem kompetitiven Bewerbungsverfahren zusammen mit drei Tagungsprojekten aus den Natur-wissenschaften verliehen, wofür dem Vergabegremium der Universität Hei-delberg und allen voran Herrn Dr. Klaus-Georg Hengstberger recht herzlich gedankt sei.
Das dem vorliegenden Sammelband zugrunde liegende Hengstberger-Symposium trug dem aktuellen medialen und wissenschaftlichen Interesse an ›Minderheiten und Migrationsphänomenen‹ Rechnung und näherte sich dieser Thematik, die freilich auch Integrations- und Ethnizitätsfragen berührt oder in den Fokus stellt, von einer interdisziplinären Seite. Die Fragestellung wurde bewusst sehr allgemein gehalten, um eine vielfältige methodische Zugangs-weise zu gewährleisten. Als Mitarbeiter des Heidelberger Instituts für Papyro-logie war es den Veranstaltern daher ein Anliegen, verschiedene fachliche Zugänge in der Beschäftigung mit der Antike, seien sie numismatisch, philo-logisch, althistorisch, archäologisch, rechtshistorisch, theologisch oder eben papyrologisch, sowie auch historische oder sprachwissenschaftliche For-schungsbereiche, die mit anderen Epochen befasst sind, im Rahmen ausge-wählter Fallstudien zu präsentieren und in einen fachlichen Diskurs zu brin-gen.
Den epochenübergreifenden fachlichen Austausch zu suchen, erschien zum einen deswegen als wünschenswert, um zu zeigen, dass es gewinnbringend sein kann, die Debatte um ›Minderheiten und Migrationsphänomene‹ um die Antike und ihre vielfältigen Quellen zu erweitern. Zum anderen braucht an dieser Stelle nicht näher erläutert werden, dass gerade in der mit dem (Früh)Mittelalter oder der Neuzeit und Gegenwart befassten Forschung die Beschäftigung mit Migration, Integration, Minderheiten und Ethnizität einen der wichtigsten wissenschaftlichen Schwerpunkte darstellt – ein exemplari-scher Blick auf die Aktivitäten und Publikationen des Instituts für Mittelalter-forschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück und des übergeordneten interdisziplinären europäischen Projekt-verbundes ›International Migration, Integration and Social Cohesion in Euro-
Vorwort
8
pe‹ (IMISCOE) genügen, um dies zu verdeutlichen.1 Angesichts der großen Fortschritte, die bei der Erforschung von ›Minderheiten und Migrationsphä-nomenen‹ im Kontext von Mittelalter und Neuzeit gerade erzielt werden, konnte sich eine Vernetzung und ein Austausch mit den in den genannten Be-reichen arbeitenden Experten, vor allem was die methodischen Ansätze und die entwickelten Fragestellungen anbelangt, auf die Beschäftigung mit ver-wandten, antiken Sachverhalten nur bereichernd auswirken und vielleicht so-gar neue Wege in der historischen Analyse weisen.
Wie bereits angedeutet, wollte das Hengstberger-Symposium allerdings nicht nur Diskurse zwischen Historikern mit unterschiedlichen Epochen-schwerpunkten anregen. Vielmehr bot die Themenstellung Gelegenheit, oder genauer gesagt: brachte das Erfordernis mit sich, auch Wissenschaftler aus an-deren geisteswissenschaftlichen Disziplinen in die Diskussion miteinzubezie-hen. Denn schließlich sind die Erforschung von Migration und Minderheiten Bereiche, die nicht nur historische, sondern etwa auch rechtliche, religiöse oder sprachwissenschaftliche Fragen aufwerfen, die es fachspezifisch zu be-antworten gilt. Die Zielsetzung des Symposiums war somit kein auf Vollstän-digkeit ausgerichteter chronologischer Gesamtüberblick über ›Minderheiten und Migrationsphänomene‹, der freilich (auch ohne angestrebte Interdiszipli-narität) nicht einmal im Ansatz zu leisten ist. Die Veranstaltung bot aber die Chance, ein möglichst breites Forum und damit eine solide Basis für eine ver-gleichende Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ansätzen und Problem-stellungen zu schaffen, um daraus gegebenenfalls Impulse für die jeweils ei-gene Arbeit zu erhalten. Dass dieses ›Experiment‹ zwanglos geglückt ist, mag jeder Teilnehmer des Symposiums bestätigen. All jenen, die sich mit einem Vortrag an der Veranstaltung beteiligten, sei jedenfalls ein herzliches Danke-schön ausgesprochen.
Das Gelingen der Konferenz wäre nicht ohne das bereitwillige Entgegen-kommen einer Reihe an Personen möglich gewesen. Stellvertretend für die MitarbeiterInnen des Veranstaltungsortes, des IWH, sei dem Direktor Herrn Professor Dr. Peter Comba, der Geschäftsführerin Frau Dr. Ellen Peerenboom und Frau Gudrun Strehlow, die mit der Tagungsorganisation betraut ist, ge-dankt. Sie sorgten für eine reibungslose Vorbereitung sowie Durchführung der Veranstaltung und begegneten Fragen und Problemen immer mit großer Hilfs-bereitschaft. Für ihr Engagement zu danken ist an dieser Stelle auch Frau Mag. Rebekka Müller, die als (damals noch) studentische Hilfskraft des Insti-
1 Verwiesen sei auch auf die Projektgruppe zur epochenübergreifenden Erforschung von
›Trans-European Diasporas: Migration, Minorities, and Diasporic Experience in East/Central Europe and the Eastern Mediterranean 500–1800‹, der der Verfasser angehörte. Es handelte sich um eine auf die Jahre 2012 und 2013 beschränkte Kooperation zwischen der Universität Heidelberg und der Central European University Budapest (CEU), die vom Deutschen Aka-demischen Austauschdienst (DAAD) und ›Hungarian Scholarship Board‹ (MÖB) finanziert wurde.
Vorwort
9 9
tuts für Papyrologie die Veranstalter in den Tagen des Symposiums organisa-torisch unterstützt hat.
Der vorliegende Sammelband bietet eine Auswahl der Tagungsbeiträge. Um der inhaltlichen Geschlossenheit der Darstellung Rechnung zu tragen, wurde der behandelte Kulturkreis auf die griechisch-römische Welt be-schränkt, dem im Übrigen die meisten Vorträge galten. Bezüglich der Heraus-gabe des Sammelbandes sei zunächst ein Dankeswort an diejenigen Teilneh-merInnen des Symposiums gerichtet, die sich mit einem Artikel an der Publi-kation beteiligt haben. Für die Aufnahme des Bandes in die Reihe ›Studien zur Historischen Migrationsforschung‹ (SHM) sei überdies ein großes Danke-schön an den Herausgeber, Herrn Prof. Dr. Jochen Oltmer, gerichtet.
Für die genaue Prüfung der englischen Beiträge ist meinem Kollegen Rodney, Terrie Bramley und Julia Bernstein, für die tatkräftige Unterstützung bei der redaktionellen Betreuung der Manuskripte meiner Frau Kerstin recht herzlich zu danken.
Fertiggestellt wurde der Band im Rahmen des APART-Stipendiums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und einer ›Membership‹ an der ›School of Historical Studies‹ des ›Institute for Advanced Study‹ in Princeton, die ›The Herodotus Fund‹ finanziert hat. Auch diesen Institutionen sei an dieser Stelle Dank für die vertrauensvolle Unterstützung ausgesprochen. Wien/Princeton, Dezember 2014 Patrick Sänger
10
Allgemeine Hinweise zur Benutzung des Bandes
Althistorische und -philologische Zeitschriften folgen dem Abkürzungsver-zeichnis der ›Année Philologique‹, http://www.annee-philologique.com/aph/files/sigles_fr.pdf.
Antike literarische Quellen werden immer als Kurzzitate gemäß der in den Al-tertumswissenschaften gebräuchlichen Standards angeben (vgl. z.B. die Ab-kürzungsliste in dem Fachlexikon ›Der Neue Pauly‹, Bd. 1. 1996, S. XXXIX–XLVII). Patristische Autoren folgen in der Regel dem Index von Geoffrey W.H. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, S. xi–xlv.
Papyruscorpora werden immer abgekürzt angegeben; die Zitierweise richtet sich nach Joshua D. Sosin u.a., Checklist of Greek, Latin, Demotic and Coptic Papyri, Ostraca and Tablets, http://library.duke.edu/rubenstein/scriptorium/papyrus/texts/clist.html.
Die für Inschriftencorpora verwendeten Abkürzungen orientieren sich an François Bérard u.a., Guide de l’épigraphiste. Bibliographie choisie des épi-graphies antiques et médiévales (Guides et inventaires bibliographiques, Bd. 6), 3. Aufl. Paris 2000, sofern dort eine Abkürzung angegeben wird.
Falls nicht genauer präzisiert, beziehen sich alle Jahresangaben auf unsere Zeitrechnung.
11
Einleitung
VON PATRICK SÄNGER
Die Menschheitsgeschichte ist seit ihrem Anbeginn, d.h. seit der Verbreitung der Hominiden über unseren Erdball, von Migration geprägt.1 Ebenso sind das Entstehen und Vorhandensein von Minderheiten – Prozesse, die freilich nicht immer ein Ergebnis von Migrationsbewegungen sein müssen – und ein even-tuelles Mobilitätsverhalten von Vertretern dieser Gruppen Themenfelder, die sich mit jeder historischen Epoche verknüpfen lassen. Die genannten Aspekte, die in ihrer Ausprägung von politischen, ökonomischen und sozialen Faktoren beeinflusst werden, scheinen daher von jeher mit der ›Natur‹ des Menschen verbunden zu sein, und aufgrund ihrer anhaltenden Aktualität ist ein Bezugs-punkt zur Gegenwart stets gegeben. Somit eröffnet die Beschäftigung mit Minderheiten und Migrationsphänomenen einen unkomplizierten Zugang zu weit zurückliegenden Perioden der Menschheitsgeschichte, die dadurch in ih-rer gesamten Komplexität ohne große Umwege nachvollzieh- und erlebbar wird. Hintergrundwissen ist nicht Voraussetzung für das Verständnis des Phä-nomens an sich, dessen Konstanz bzw. longue durée die historische Wissens-vermittlung und die Vernetzung von unterschiedlichen Inhalten begünstigt.
Auch der griechisch-römischen Welt waren Minderheiten und Migrations-phänomene freilich nicht fremd: Der Mittelmeerraum und die angrenzenden Gebiete erlebten kleinere und größere Bevölkerungsbewegungen, die mitunter zu der Festlegung von Epochengrenzen innerhalb der Alten Geschichte heran-gezogen werden. Die bekanntesten Beispiele bieten in diesem Zusammenhang zum einen das Zeitalter der Großen Griechischen Kolonisation (8. bis 6. Jahr-hundert v.Chr.), in dem sich die Griechen aus ihren Kerngebieten in Griechen-land und dem westlichen Kleinasien aufmachten, um Pflanzstädte bzw. Kolo-nien an den Küsten des Mittelmeeres und des Schwarzen Meeres zu gründen, und zum anderen der Hellenismus (Ende 4. bis 1. Jahrhundert v.Chr.), dessen Beginn mit Alexander dem Großen und der Ausbreitung des Griechentums in den Nahen und Mittleren Osten angesetzt wird, sowie schließlich das in das Jahr 476 fallende Ende des Weströmischen Reiches in der Völkerwande-rungszeit (4. bis 6. Jahrhundert), das in Westeuropa den Übergang zum (Früh)Mittelalter markiert.
Sucht man im Kontext des griechisch-römischen Kulturraumes nach Bei-spielen für Minderheiten bzw. ihre Situation, wird man zuerst an das in der
1 Vgl. den Überblick bei Jochen Oltmer, Globale Migration. Geschichte und Gegenwart, Mün-
chen 2012, S. 8–14.
Patrick Sänger
12
hellenistischen und römischen Zeit gut sichtbare Diaspora-Judentum und an das frühe Christentum denken. Es gibt aber noch viel mehr zu entdecken, und dafür legt das griechisch-römische Ägypten ein lebhaftes Zeugnis ab: Dort können aufgrund der auf Papyrusfunde (Papyrus war das Papier der Antike) zurückzuführenden besonderen Quellenlage Einwanderung und Binnenmigra-tion sowie die Herausbildung von ethnischen Rechtskategorien und von Min-derheiten so genau wie sonst in keinem Raum untersucht werden.2 Wirft man einen gezielten Blick auf das römische Weltreich in der Kaiserzeit, darf hier ein Hinweis auf die geopolitische Bedeutung dieser Reichsbildung nicht feh-len. Die römischen Kaiser vereinten unter ihrer Herrschaft den vormals aus mehreren Staatsgefügen bestehenden Mittelmeerraum, was folglich auf über-regionaler Ebene Einfluss auf die Migrationsformen hatte.3 Zudem konnte et-wa die römische Bürgerrechtspolitik integrativ, gleichzeitig aber auch aus-grenzend wirken – Aspekte, die auch Angehörige einer Minderheit oder Per-sonen mit Migrationshintergrund betrafen.
Kurz gesagt: In der griechisch-römischen Welt gehörten Minderheiten und Migrationsphänomene selbstverständlich zum Alltag. Damit verbundene In-halte wurden auch in der Mythologie rezipiert, wie – um nur die prominentes-ten Beispiele zu nennen – die dem griechischen Autor Homer zugeschriebenen Epen Ilias und Odyssee sowie das aus der Feder des römischen Dichters Ver-gil stammende Epos Äneis beweisen. Die Fülle an Informationen, die die anti-ke Literatur und dokumentarische Texte – Inschriften auf Stein oder anderen Materialien sowie auf Papyrus überlieferte Dokumente – für die Erforschung von Minderheiten sowie die Ursachen und Auswirkungen von Migration bie-ten, eröffnen daher ein reichhaltiges Forschungsfeld, wie bereits drei umfang-reiche Sammelbände, die aus dem Mobilitätsfragen gewidmeten 7., 8. und 11. ›Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums‹ hervor- 2 Vgl. etwa Fritz Heichelheim, Die auswärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich (Klio Beihefte,
Bd. 18), Leipzig 1925; Horst Braunert, Die Binnenwanderung. Studien zur Sozialgeschichte Ägyptens in der Ptolemäer- und Kaiserzeit (Bonner historische Forschungen, Bd. 26), Bonn 1964; Joseph Mélèze-Modrzejewski, Le statut des Hellènes dans l’Égypte lagide. Bilan et perspectives des recherches, in: Revue des études grecques, 96. 1983, S. 241–268; Koen Goudriaan, Ethnicity in Ptolemaic Egypt (Dutch Monographs on Ancient History and Ar-chaeology, Bd. 5), Amsterdam 1988; Csaba A. La'Da, Foreign Ethnics in Hellenistic Egypt (Studia Hellenistica, Bd. 38 = Prosopographia Ptolemaica, Bd. 10), Leuven 2002; Dorothy J. Thompson, Hellenistic Hellenes. The Case of Ptolemaic Egypt, in: Irad Malkin (Hg.), Ancient Perceptions of Greek Ethnicity (Center for Hellenic Studies Colloquia, Bd. 5), Cambridge (MA)/London 2001, S. 301–322; dies., Ethnic Minorities in Hellenistic Egypt, in: Onno M. van Nijf/Richard Alston (Hg.), Political Culture in the Greek City after the Classical Age, Leuven 2011, S. 101–117; Christelle Fischer-Bovet, Counting the Greeks in Egypt: Immigra-tion in the First Century of Ptolemaic Rule, in: Claire Holleran/April Pudsey (Hg.), Demog-raphy and the Graeco-Roman World: New Insights and Approaches, Cambridge 2011, S. 135–154 und Mary Stefanou, Waterborne Recruits: The Military Settlers of Ptolemaic Egypt, in: dies./Kostas Buraselis/Dorothy J. Thompson (Hg.), The Ptolemies, the Sea and the Nile. Studies in Waterborne Power, Cambridge 2013, S. 108–131.
3 Vgl. etwa Jochen Bleicken, Verfassungs- und Sozialgeschichte des Römischen Kaiserreiches, Band 2, 3. Aufl. Paderborn 1994, S. 142f.
Einleitung
13
gegangen sind, und Linda-Marie Günther (Hg.) mit der Veröffentlichung ›Migration und Bürgerrecht in der hellenistischen Welt‹ verdeutlicht haben.4
Der vorliegende Sammelband möchte an diese Vorbilder aus der deutsch-sprachigen Wissenschaft anknüpfen, vor dem Hintergrund der historischen Migrationsforschung den Fokus der Untersuchung jedoch auf Minderheiten und deren Vertreter richten und sich anhand politischer, rechtlicher, religiöser und kultureller Aspekte mit Migrations- und Integrationsfragen beschäftigen. Um eine methodische Vielseitigkeit zu erreichen, sollen im Rahmen der Ana-lyse unterschiedliche Quellengattungen herangezogen werden. Dementspre-chend illustrieren die in dem Sammelband zusammengestellten Beiträge die Arbeit bzw. den kritischen Umgang mit literarischem, archäologischem und dokumentarischem Quellenmaterial. Im Übrigen ist auch der von den ver-schiedenen Fallstudien abgedeckte geographische und chronologische Rah-men alles andere als einseitig. Behandelt werden das Klassische Athen im 5. Jahrhundert v.Chr., das hellenistische Ägypten, die Geschichte eines Reisen-den aus der Stadt Kandahar (im heutigen Afghanistan) an der Wende vom 1. Jahrhundert v.Chr. zum 1. Jahrhundert n.Chr. und das römische Reich in der Epoche der Kaiserzeit und der Spätantike. Damit werden dem Leser nicht nur die der Klassischen Altertumswissenschaft zugrundeliegenden Quellen, son-dern auch die zeitliche und örtliche Erstreckung dieser der Erforschung des griechisch-römischen Kulturraumes gewidmeten Disziplin in wünschenswer-ter Breite vor Augen geführt.
Bei der Konzeption des Bandes stehen weder chronologische noch geogra-phische Aspekte im Vordergrund. Die Gliederung orientiert sich vielmehr an bestimmten Themenbereichen, denen sich die Studien zuordnen lassen und die unabhängig von Epochengrenzen sind. Lediglich innerhalb der einzelnen Ab-schnitte wurde der Einfachheit halber eine chronologische Reihung der Artikel vorgenommen. Zudem sei erwähnt, was dem Leser ohnehin ins Auge fallen wird: Einige Artikel beschäftigen sich mit den Juden, der wohl bekanntesten Minderheit, deren Diaspora-Gemeinden von der Antike bis in die Gegenwart zu verfolgen sind. Da es der Konzeption des Bandes widersprochen hätte, wurden sie keiner eigenen Sektion, sondern den einzelnen Themenbereichen zugeordnet.
4 Eckart Olshausen/Holger Sonnabend (Hg.), Zu Wasser und zu Land – Verkehrswege in der antiken
Welt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Altertums 7, 1999 (Geogra-phica Historica [GH], Bd. 17), Stuttgart 2002; dies. (Hg.), »Troianer sind wir gewesen« – Migrationen in der antiken Welt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geographie des Al-tertums 8, 2002 (GH, Bd. 21), Stuttgart 2006; Eckart Olshausen/Vera Sauer (Hg.), Mobilität in den Kulturen der antiken Mittelmeerwelt. Stuttgarter Kolloquium zur Historischen Geo-graphie des Altertums 11, 2011 (GH, Bd. 31), Stuttgart 2014; Linda-Marie Günther (Hg.), Migration und Bürgerrecht in der hellenistischen Welt, Wiesbaden 2012. Das Potential eines epochenübergreifenden historischen Ansatzes, der die Antike berücksichtigt, haben die acht Bände bewiesen, die in der Reihe ›Stuttgarter Beiträge zur Historischen Migrationsforschung‹ (Münster 1991; Stuttgart 1995, 1997, 1998, 2001, 2006, 2010, 2011) erschienen sind.
Patrick Sänger
14
Am Beginn des Bandes stehen Fallstudien, durch die sich explizit aufzeigen lässt, wie politische Systeme mit Minderheiten und Migration umgingen, diese Phänomene für eigene Zwecke einsetzten oder auf sie reagierten. Patrick Sän-ger behandelt das Zeitalter des Hellenismus und thematisiert eine spezifische, als politeuma (›Gemeinwesen‹) bezeichnete Organisationsform im Königreich der Ptolemäer (Ende 4. bis Ende 1. Jahrhundert v.Chr.), dessen Kernland Ägypten war. Diese Organisationsform ist für Gemeinschaften belegt, deren Bezeichnung auf eine auswärtige Herkunft Bezug nahm – in Ägypten sind po-liteumata von Böotiern, Kilikiern, Kretern, Idumäern, Juden, Lykiern und Phrygern belegt. Weitere Charakteristika dieser Gruppen sind, dass sie in ei-nem bestimmten Viertel einer Stadt konzentriert waren und in gewisser Hin-sicht im Dienst der Regierung standen – wahrscheinlich insofern, als ein Teil der jeweiligen Mitglieder als Soldaten diente. Die Organisationsform politeu-ma dürfte diesen Gruppen, die alle zu der privilegierten Bevölkerungskatego-rie der ›Griechen‹ bzw. Hellenes gezählt wurden, eine Stellung als semi-auto-nome administrative Einheiten ermöglicht haben: Sie verfügten zur Kultaus-übung über einen eigenen Tempel oder Tempelbezirk und hatten die Aufsicht über ein eigenes Territorium, wo ihre Funktionäre die allgemeine Ordnungs-macht dargestellt haben dürften. Es lässt sich argumentieren, dass die als poli-teumata konstituierten Gemeinschaften vermutlich auf Söldnerverbände zu-rückzuführen sind, die in den jeweiligen namengebenden Regionen rekrutiert wurden. Die Gründung eines politeuma in einem bestimmten Stadtviertel könnte in machen Fällen direkt im Anschluss auf die Zuweisung des Stationie-rungsortes, in anderen nach einer gewissen Phase der Anwesenheit erfolgt sein, während der die betreffende Gruppe ihre ›Eigenart‹ vielleicht auf der Grundlage von landsmannschaftlichen Vereinigungen bewahrt oder entwickelt hatte. Die Organisationsform politeuma kann daher als politischer Reflex auf das Vorhandensein von ethnisch definierten und räumliche Einheiten bilden-den Gruppen angesehen werden. Mit ihr wurden entsprechende Gemeinschaf-ten und ihre Strukturen in das System der Landesverwaltung integriert. Migra-tion und die dadurch in Gang gebrachten sozialen Entwicklungen und Erfor-dernisse hatten auf institutioneller Ebene also zur Einrichtung einer spezifi-schen, auf diese bestimmte Situation zugeschnittenen Organisationsform ge-führt. Deren Untersuchung liefert als Mikrostudie ein Paradebeispiel für die innen- und außenpolitisch einsetzbare administrative Reaktion auf ein Migra-tionsphänomen, das in der Politik der Ptolemäer begründet lag.
Nachdem Sänger ein integratives Moment antiker Politik im Kontext von Migration und Minderheiten herausgestellt hat, widmet sich Ernst Baltrusch einer Episode, die das Konfliktpotential verdeutlicht, das in der Beziehung zwischen staatlicher Autorität und einer Minderheit liegen konnte. Die Rede ist vom römischen Staat in der späten Republik und frühen Kaiserzeit und der großen jüdischen Gemeinde in Rom. Ein Schlaglicht auf dieses Verhältnis zu werfen, ist insofern lehrreich, als sich an diesem Beispiel zeigt, dass eine allzu einseitige Sicht der Dinge der Sachlage nicht gerecht wird. Zwar wird man in der von Staatsinteressen geprägten römischen Literatur mit handfesten antijü-
Einleitung
15
dischen Tendenzen konfrontiert, und auch die von Baltrusch im einzelnen er-läuterten Ausweisungen von Juden aus Rom in den Jahren 139 v.Chr., 19 und 49 n.Chr. scheinen dieses Bild zu bestätigen. Doch ist die in der Literatur zum Ausdruck gebrachte antijüdische Stimmung in der Bevölkerung nicht ohne weitere Differenzierung auf die hinter den Ausweisungen stehenden Motive und deren Auswirkungen zu übertragen: Sie wandten sich in den Jahren 139 v.Chr. und 19 n.Chr. weder gegen alle in Rom ansässigen Juden noch gegen sie alleine, sondern ebenso gegen andere religiöse und philosophische Rich-tungen, die die Römer als Bedrohung der Staatsordnung wahrnahmen. Unter Kaiser Claudius im Jahr 49 richtete sich die Maßnahme explizit gegen Juden, allerdings waren die vorangehenden Unruhen von Christen innerhalb der jüdi-schen Gemeinde ausgelöst worden, was die Römer nicht erkannt hatten. Bal-trusch betont außerdem, dass die jüdische Gemeinde in Rom, die sich im 2. Jahrhundert v.Chr. durch Immigration formiert hatte, als separierte Gruppe wahrgenommen wurde. Zwar scheinen Juden in Rom eher auf Latein und Griechisch als auf Hebräisch oder Aramäisch kommuniziert zu haben und mitunter auch römische Bürger geworden zu sein. Dennoch bewahrten sie sich ihre religiöse Besonderheit bzw. Identität, was nach Baltrusch verhinderte, dass sie vollständig in die römische Mehrheitsgesellschaft integriert wurden. In Krisenzeiten wurde, wie erläutert, ein Teil der Juden mit anderen, der römi-schen Ideologie entgegenstehenden Gruppen zum Wohl des Staates in die Pflicht genommen; das Aufkommen des Christentums gefährdete schließlich die gesamte jüdische Gemeinde in Rom.
Verglichen mit Baltrusch betrachtet Kerstin Sänger-Böhm das römisch-jüdische Verhältnis aus einer ganz anderen Perspektive. Sie bietet zunächst eine Analyse des politischen Handlungsspielraumes der römischen Kaiser-frauen. Der Fokus der Untersuchung liegt aber speziell auf der diplomatischen Ebene, wo die Kaiserfrauen neben repräsentativen Aufgaben als Bindeglied zwischen Kaiser und Bittstellern fungierten. Dieser Aspekt lässt sich deutlich anhand der Interaktion aufzeigen, die zwischen den Kaiserfrauen und der jüdi-schen Aristokratie sowie religiös motivierten Gesandtschaften aus Judäa herrschte. Sänger-Böhm zieht als maßgebliche Quelle den jüdischen Schrift-steller Flavius Josephus heran und verdeutlicht, dass trotz politischer Span-nungen, die das Verhältnis von Rom und Judäa seit augusteischer Zeit an prägten, weiterhin ein reger diplomatischer Austausch stattfand. Dieser gipfel-te sogar darin, dass am kaiserlichen Hof unter der Obhut der weiblichen Mit-glieder des Kaiserhauses Söhne des jüdischen Königshauses unterrichtet und in die römische aristokratische Gesellschaft eingeführt wurden. Weiters spie-gelt sich der Einfluss der Kaiserfrauen auch bei Gesandtschaften aus Judäa wider, die gezielt die Fürsprache der weiblichen Vertreterinnen des Kaiser-hauses suchten und diese wegen ihres diplomatischen Geschickes auch lobten. Dass es gerade die Frauen des Kaiserhauses waren, die Kontakte mit jüdischen Aristokraten und Gesandtschaften pflegten, und diese als Kontaktpersonen von jüdischer Seite auch gezielt ausgewählt wurden, zeigt anschaulich ihre von kaiserlicher Seite tolerierte Selbstständigkeit im Bereich der Diplomatie.
Patrick Sänger
16
Gerade die Obsorge über die diplomatischen Beziehungen mit einer Minder-heit des römischen Reiches, die zahlenmäßig bedeutsam war und einen sensib-len Umgang erforderte, dürfte ein Bereich gewesen sein, in dem die Kaiser-frauen ihre Stärken voll ausspielen konnten. Offensichtlich war man in Bezug auf die politischen und religiösen Konflikte innerhalb der Provinz Judäa eher bemüht, deeskalierend zu agieren, während die jüdische Gemeinde in Rom selbst aufgrund ihrer Religion gelegentlich römische Anfeindungen und Strafmaßnahmen hinnehmen musste.
Weitere Fragestellungen, die sich, vor allem anhand dokumentarischer Tex-te, gezielt untersuchen lassen, sind rechtshistorischer Natur. Von Interesse sind etwa Einblicke in das Rechtsleben und in die Rechtspraxis von Minder-heiten mit Migrationshintergrund und in das gegenseitige Verhältnis zwischen Gesetzgebung und derartigen Gruppen sowie – damit verbunden – die Analyse von juristischen Weichenstellungen oder Systemen, mit denen politische Ent-scheidungsträger integrative oder ausgrenzende Wirkung erzielten. Diesen Aspekten ist der Abschnitt ›Rechtliche Normen und Grauzonen im Kontext von Minderheiten und Migration‹ gewidmet. Eine in diesen Kontext passende entscheidende Episode der politischen Geschichte des Klassischen Athen ar-beitet Elizabeth Irwin in ihrem umfassenden Aufsatz auf, und zwar das Bür-gerrechtsgesetz des Perikles aus dem Jahr 451/50 v.Chr. Irwin zeigt anhand einer Vielzahl von Quellen, dass dieses von der athenischen Volksversamm-lung verabschiedete Gesetz in seiner sozialen und politischen Wirkung kaum zu unterschätzen ist. Da Perikles durch seine Anordnung den Anspruch auf das athenische Bürgerrecht an die Abstammung von Eltern band, die zu bei-den Teilen im Besitz des athenischen Bürgerrechts sein mussten, kam es zur Herausbildung einer Gruppe von nothoi (›Bastarde‹), die aus ›gemischten‹ Verbindungen hervorgegangen waren. Den Angehörigen dieser Minderheit wurde durch das Gesetz der Weg versperrt, vollwertige Bürger zu werden: sie waren von vornherein von der politischen Teilhabe ausgeschlossen. Irwin ver-anschaulicht mit ihrer Studie, wie sich Athen, zum Teil wahrscheinlich aus Profitgier, durch das Perikleische Bürgerrechtsgesetz von einer offenen in eine geschlossene Gesellschaft verwandelte. Zwar wurde durch diese Maßnahme nicht die Einwanderung nach Athen unterbunden, die die Stadt nach der sieg-reichen Beendigung der Perserkriege wachsen ließ. Der Erwerb des begehrten Bürgerrechts von Athen, das als Zentrum des attischen Seebundes damals auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, wurde allerdings auf eine kleine Gruppe beschränkt. Irwin macht deutlich, dass dieser politische Schritt ein fataler Feh-ler war und verknüpft ihn mit politischen und sozialen Unruhen in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v.Chr. Eine Änderung der Bürgerrechtspolitik wur-de dadurch aber nicht herbeigeführt: Im Jahr 403/2 v.Chr., also ca. ein Jahr nach dem verlorenen Peloponnesischen Krieg, wurde das Perikleische Bürger-recht (leicht modifiziert) erneut bestätigt. Irwin liefert durch ihre historische Untersuchung der Ursachen und Auswirkungen des Perikleischen Bürger-rechtsgesetzes ein Exempel für eine nur auf den Moment ausgerichtete, wenig vorausschauende Politik, die einen längerfristigen sozialen Unruhefaktor
Einleitung
17
schuf: Ein gesetzgeberischer Akt ließ eine Minderheit entstehen, die sich selbst entgegen ihrer Abstammung, die ja zu einem Teil athenisch war, in ei-ner unzutreffenden rechtlichen Grauzone wähnte – ihren Spuren geht Irwin anhand von Beispielen in der griechischen Literatur nach. Zudem weist sie darauf hin, wie eine allzu objektive historische Bewertung dieses Gesetzes die negativen Folgen desselben verdecken kann, und plädiert in diesem Fall für einen moralisierenden Ton in der modernen Geschichtsschreibung.
Robert Kugler führt uns in das hellenistische Ägypten (Ende 4. bis Ende 1. Jahrhundert v.Chr.) zurück und untersucht die Praxis des jüdischen Rechts-lebens. Dafür zieht er Papyri heran, die über eine jüdische Gemeinde in der mittelägyptischen Bezirkshauptstadt Herakleopolis Auskunft geben und be-reits Sänger als wesentliche Untersuchungsgrundlage dienten. Bei besagten Quellen handelt es sich um Petitionen, die in Rechtsstreitigkeiten an die lei-tenden Funktionäre der Gemeinde, die als politeuma organisiert war, gerichtet waren. Kugler, der die in Ägypten ansässigen Juden als etablierte ethnische, aber nicht religiöse Minderheit ansieht und für ihre Bezeichnung den Aus-druck ›Judäer‹ (griechisch Iudaios) bevorzugt, legt dar, dass deren Rechtsge-pflogenheiten keineswegs ausschließlich von jüdischen (religiösen) Vorstel-lungen geprägt waren, sondern auch ägyptische und griechische Elemente ent-hielten; ein besonders eindringliches Beispiel dafür liefert das Eherecht. Damit argumentiert Kugler, zumindest auf der Basis der von ihm untersuchten Papy-ri, für ein Judentum, das sich den Einflüssen seiner Umgebung nicht entzog, sondern wahlweise ›fremde‹ Ideen und Gepflogenheiten in die eigene Vorstel-lungswelt integrierte. Das, was jüdische Identität war, war also nicht statisch, sondern unterlag einem stetigen Wandel und konnte immer wieder modifiziert werden, wobei diese Prozesse von Individuum zu Individuum, von Gemeinde zu Gemeinde sowie abhängig von der untersuchten Zeit jeweils verschieden sein konnten. Im Bezug auf das aus den Petitionen abzuleitende jüdische Rechtsleben der Gemeinde in Herakleopolis ist jedenfalls keine von alters her begründete Norm festzustellen, sondern eher eine Grauzone, in der sich jüdi-sche Prinzipien mit ägyptischen und griechischen Rechtsvorstellungen ver-mischten.
Wie problematisch eine formale Sicht auf juristische Sachverhalte sein kann, verdeutlicht auch Nadine Grotkamp. Sie beleuchtet eine Debatte, die von Rechtshistorikern darüber geführt wurde, ob es in der Antike etwas mit dem Internationalen Privatrecht (IPR) Vergleichbares gegeben habe. Beim IPR handelt es sich um ein für gewöhnlich vom nationalen Gesetzgeber erlas-senes Kollisionsrecht, das in einem Kollisionsfall, also einem ausländisches Recht berührenden Sachverhalt, regelt, ob inländisches oder ausländisches Recht anzuwenden ist, sofern dies mit inländischen Wertvorstellungen vertret-bar ist. Die angezeigte Diskussion hinsichtlich einer Übertragbarkeit dieses Rechtsmodells auf die Antike wurde vor allem vor dem Hintergrund von zwei Papyri aus dem hellenistischen Ägypten geführt: In dem einen werden ver-schiedene Rechtsschichten angesprochen, die vielleicht auch ›ausländisches‹ Recht betrafen. In dem anderen wird im Zusammenhang mit Vertragsstreitig-
Patrick Sänger
18
keiten eine gerichtliche Zuweisung erwähnt, die sich nach der ethnischen Ein-gruppierung der Parteien und der Sprache des zugrunde liegenden Vertrages (Griechisch oder Ägyptisch) richtete. Grotkamp stellt kritisch in Frage, in-wieweit es sinnvoll ist, diese Quellen kollisionsrechtlich oder eben nicht zu deuten, sich dem antiken Rechtssystem also aus der Perspektive der modernen und eurozentristischen Vorstellung von abgegrenzten Rechtsordnungen zu nähern. Sie überlegt, ob nicht vielleicht andere Rechtsmodelle sinnvollere Anknüpfungspunkte für einen Vergleich mit dem Rechtssystem des hellenisti-schen Ägypten liefern würden, wie etwa eine rechtsethnologische Herange-hensweise, die im Kontext postkolonialer Rechtswirklichkeiten auf die Beschreibung eines Rechtspluralismus (gleichzeitiges Nebeneinander von Rechtssystemen oder -traditionen) abzielt. Wie schwer es letztendlich ist, das Modell des IPR zu überwinden, zeigt Grotkamp anhand der Europäischen Kommission, die trotz Ansätzen, ein einheitliches europäisches Vertragsrechts zu erarbeiten, im Bereich des Kaufrechts aktuell wieder zu einem kollisions-rechtlichen Schema, und zwar dem Gemeinsamen Europäischen Kaufrecht (GERK), tendiert.
Ein (bis zu einem gewissen Grad) frei zugängliches, von ›nationaler‹ bzw. ›ethnischer‹ Zugehörigkeit losgelöstes Rechtssystem führt Ralph Mathisen in seiner Studie über das römische Bürgerrecht in der Spätantike vor Augen. Er stellt die Frage, wie sich die römische Bürgerrechtspolitik nach der so genann-ten Constitutio Antoniniana gestaltete, mit der Kaiser Caracalla im Jahr 212 allen freien Bewohnern des Imperium Romanum das römische Bürgerrecht verlieh. Dies war freilich für die Vielzahl an Personen von Relevanz, die nach besagter Verordnung in das römische Reich einwanderten und sich dort ansie-delten. Dabei handelte es sich zu einem großen Teil um Angehörige ›barbari-scher‹ Stämme; von denen, die Rom Kriegsdienst leisteten, hielten sich viele nach Beendigung ihrer Dienstzeit weiterhin auf römischem Reichsgebiet auf. Wie sah die Rechtsstellung dieser Immigranten aus? Mathisen kommt zu dem Schluss, dass das römische Bürgerrecht nach 212 nicht mehr verliehen wurde, weil sich die Wirkung der Constitutio Antoniniana fortsetzte: Alle freien, von auswärts kommenden und auf römischem Staatsgebiet siedelnden Personen, die die Verpflichtungen und die Identität eines Bürgers (civis) einer römischen Stadtgemeinde oder Provinz übernahmen, konnten als potentielle römische Bürger gelten. Das römische ius civile stand jedem freien Einwohner des Rei-ches offen, der sich seiner bedienen wollte – auch ›ausländischen Barbaren‹. Entscheidend für einen vollen Zugang zum ius civile war, dem Status nach ei-ne freie Person zu sein; andere Kriterien, etwa ethnische, spielten dafür keine Rolle. Gemäß Mathisen war es für einen freien Immigranten demnach die Anwendung des ius civile, die diesen zu einem römischen Bürger machte. In-sofern war das römische Bürgerrecht ein Ausdruck von Partizipation und Selbstzuschreibung. Dieses Prinzip hatte eine integrative Wirkung, die wohl kaum zu unterschätzen ist. Sie spiegelt sich möglicherweise auch darin wider, dass sich Personen als ›barbarische Bürger‹ bezeichnen konnten: Ein civis Francus etwa betonte seinen Bürgerstatus und gleichzeitig seine ethnische
Einleitung
19
Zugehörigkeit – diese Identität war keine Fiktion, sondern konnte aufgrund der spätantiken Bürgerrechtspolitik tatsächlich gelebt werden.
Minderheiten, deren Migrationsbewegungen und damit verbundene religiö-se und kulturelle Fragestellungen möchte der abschließende Abschnitt be-leuchten. Ein permanenter Motor für Migration, sei sie erzwungen oder frei-willig, und für die Herausbildung von Minderheiten ist Religion. Ein anschau-liches Beispiel hierfür liefert das frühe Christentum und seine ambivalente Geschichte: Waren seine Anhänger zunächst eine Minderheit, die oftmals ver-folgt wurde, wurde das Christentum am Ende des 4. Jahrhunderts als römische Staatsreligion anerkannt; Christen vermochten nun, Politik in eigener Sache zu betreiben. Wie sehr das Christentum in seiner Anfangsphase, also noch zu Lebzeiten der Apostel in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts, von einer staatstragenden Position entfernt war, dokumentiert Hans Förster mit seinem Beitrag. Er führt uns die Lebenswelt der ersten christlichen Gemeinden an-hand der Apostelgeschichte vor Augen und macht deutlich, dass diese Le-benswelt von Migration geprägt war. Sie konnte aufgrund von Verfolgung oder Repressalien erzwungen sein, konnte, wie im Fall von Wanderpredigern und Missionaren, allerdings auch Ausdruck einer freiwillig gewählten Lebens-führung sein. Erscheinen diese Aspekte des Neuen Testamentes vielleicht als selbstverständlich, weil sie sich dem Leser sofort erschließen können, so ist ein weiterer Punkt nur implizit zu fassen, und zwar die aktive Ausrichtung der christlichen Lebensweise auf die Erfordernisse von Migration. Förster betont, dass Obsorge für in Not geratene Gemeinden sowie aufopfernde Hilfsbereit-schaft und Gastfreundschaft gegenüber flüchtenden und reisenden Glaubens-brüdern und -schwestern ein Charakteristikum des frühen Christentums dar-stellten, das auch heidnischen Zeitgenossen nicht verborgen blieb. Somit konnten Christen bereits kurz nach Jesu Tod auf ein solidarisches und starkes grenzüberschreitendes Netzwerk zurückgreifen, das etwa auch weit gereisten und mobilen Personen wie dem Apostel Paulus von Nutzen war. Folglich prä-sentiert sich das Christentum bereits zum Zeitpunkt seiner Entstehung als gut organisierte religiöse Minderheit: Sie hatte sich rasch an Anforderungen ange-passt, die einerseits äußere Umstände wie politische Gegebenheiten sowie an-dererseits ihre Mitglieder und die christliche Lehre selbst an sie stellten.
Selbstverständlich können nicht nur aus einem literarischen Textzeugnis In-formationen über eine Minderheit und deren Migrationsbewegungen gewon-nen werden. Auch archäologische oder dokumentarische Quellen bieten hier-für eine ausgezeichnete Ausgangsbasis, die, wie die nächsten beiden Beiträge verdeutlichen, ganz grundsätzliche Beobachtungen zu der kulturellen Identität von Einzelpersonen und Gruppen ermöglicht. Den Anfang macht Julia Lougovaya, die eine griechische Inschrift aus Kandahar (in Afghanistan) einer philologischen und historischen Neubewertung unterzieht. Die Versinschrift erzählt die Lebensgeschichte des Sophytos, Sohn des Narratos, der offenbar aus einer indischen Familie stammte, die durch die Zerstörung ihres Hauses einen Schicksalsschlag hinnehmen musste. Nach seiner Ausbildung fasste er schließlich den Entschluss, sich auf Handelsreisen zu begeben, um zu Reich-
Patrick Sänger
20
tum zu gelangen. Nach Jahren der Abwesenheit kehrte er als wohlhabender Mann in seine Heimat zurück und baute das Haus und das Grabmal seiner Vorfahren wieder auf. Der Autor der Inschrift dürfte aber nicht Sophytos selbst gewesen sein, sondern vielmehr ein Dichter, der mit der Abfassung des poetischen Textes beauftragt worden war. Ferner hält es Lougovaya für wahr-scheinlich, dass Sophytos mit einer besonderen Art griechischer Inschriften in Berührung gekommen war, die auf autobiographische, in ägyptischer Traditi-on wurzelnde Inschriften zurückzuführen ist. In der Tat ist es leicht möglich, dass seine Handelsreisen Sophytos zunächst nach Nord-West-Indien und von dort per Schiff nach Ägypten geführt haben, wo er einen Dichter mit dem Ver-fassen der Inschrift beauftragt haben könnte. Lougovayas Datierung der In-schrift in das Ende des 1. Jahrhunderts v. oder den Beginn des 1. Jahrhunderts n.Chr. modifiziert das Motiv für die Setzung der Inschrift: Sollte der Datie-rungsansatz zutreffen, hätte das Gebiet von Arachosia, wo Kandahar liegt, zu dem Zeitpunkt, als Sophytos’ Inschrift errichtet wurde, nicht unter dem Ein-fluss des Gräko-Baktrischen Königreiches (wie früher angenommen) gestan-den; vielmehr könnte ein Zusammenhang mit dem aufstrebenden Indo-Parthischen Königreich angenommen werden. In diesem Fall hätte der Um-stand, dass Sophytos eine griechische Inschrift setzen ließ, nicht darauf abge-zielt, eine Verbindung zu einer Griechisch sprechenden und herrschenden Eli-te anzuzeigen, sondern wäre vielleicht eher als Zeichen für eine einfache Hin-wendung zu einem nach wie vor existenten hellenisierten Personenkreis und für eine bestehende Verbindung mit dem Mittelmeerraum zu deuten, wo Grie-chisch die lingua franca war.
Erzählt Lougovaya mittels der Person des Sophytos eine ganz individuelle ›Migrationsgeschichte‹, die dort endete, wo sie begann, befasst sich Roland Prien mit einer äußerst prominenten Wanderungsbewegung und lenkt das hi-storische Interesse von der Mikro- auf die Makroebene: Anhand eines Bei-spiels aus der Völkerwanderungszeit legt er dar, dass all zu einseitige Modelle zum Verständnis von ›Volksgenese‹ und ›Ethnizität‹ zu kurz greifen. Als Un-tersuchungsobjekt dient der aus dem Baltikum stammende Stammesverband der Ostgoten. Diese waren als römische Foederaten (›barbarische‹ Truppen, die Rom Kriegsdienst leisteten) in Pannonien angesiedelt worden und mar-schierten im Jahr 489 unter ihrem Heerführer Theoderich in Italien ein, been-deten die dortige Herrschaft des germanischen Königs Odoaker, der den letz-ten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus im Jahr 476 abgesetzt hatte, und errichteten das Ostgotenreich, das bis zur Mitte des 6. Jahrhunderts be-stand. Prien übt in seinem forschungsgeschichtlichen Beitrag Kritik an jener archäologischen Methode der Frühgeschichtsforschung, die darin besteht, die aus den schriftlichen Quellen zu erschließende Wanderung bzw. Migrations-bewegung der Ostgoten (sowie auch anderer völkerwanderungszeitlicher Stammesverbände bzw. gentes) im archäologischen Befund nachzuweisen. Dieser Ansatz birgt die Gefahr, vorschnelle Schlüsse zu ziehen und Unter-schiede im Fundmaterial als Ausdruck verschiedener ›ethnischer‹ Gruppen, etwa als ›römisch‹ bzw. ›romanisch‹ oder ›gotisch‹, zu deuten. Diese Proble-
Einleitung
21
matik lässt sich am Fall der Ostgoten gut aufzeigen. Nach Prien könnte näm-lich allein auf der Basis des archäologischen Fundmaterials, also ohne schrift-liche Quellen, keine ›ostgotische‹ Einwanderung nach Italien konstatiert wer-den. Eine Analyse der Grabausstattung und -sitte lässt grundsätzlich zwei Schlüsse zu: Entweder waren die Ostgoten, die nach Italien kamen bereits stark romanisiert und glichen sich der einheimischen Bevölkerung weiter an, oder es gab keine typisch ostgotische materielle Kultur; die zum Vorschein kommende Trachtausstattung ist überregional und an bestimmte Eliten gebun-den, jedoch kein Hinweis auf ›ethnische‹ Charakteristika. Prien plädiert daher dafür, im Bereich der archäologischen Migrationsforschung die ›prähistori-sche‹ Methode anzuwenden, die sich ausschließlich auf die Auswertung der Funde konzentriert. Erst nach deren Bearbeitung und Deutung ist in einem ab-schließenden Arbeitsschritt zu prüfen, ob die Ergebnisse mit den schriftlichen Quellen in Einklang zu bringen sind oder nicht.
Der Artikel von Prien hat gezeigt, wie schwierig es in der archäologischen Forschung sein kann, materielle Hinterlassenschaften einer bestimmten, aus den Schriftquellen her bekannten wandernden und schließlich als Minderheit über ein bestimmtes Gebiet herrschenden Gruppe zuzuweisen. Nicht nur hier ist erkennbar, dass man bei der Untersuchung von Minderheiten und Migrati-on in der griechisch-römischen Welt mit einem äußerst sensiblen historischen Problem konfrontiert ist. Aus dem Blickwinkel der Politik zeigt sich deutlich, dass auf institutioneller oder diplomatischer Ebene, mittels Gesetzgebung und der Gestaltung von Rechtssystemen Strategien entwickelt werden konnten, um Migrationsphänomene zu (be)nutzen und/oder Minderheiten in das Staatsge-füge zu integrieren. Politische Entscheidungen, sei es, dass sie undifferenziert oder wenig vorausschauend getroffen wurden, konnten gleichzeitig aber auch eine Missstimmung erzeugen oder soziale Spannungen hervorrufen. Minder-heiten mit Migrationshintergrund selbst wiederum reagierten auf ihre Umwelt und passten sich, wie die Juden im hellenistischen Ägypten, an ihr soziales Umfeld an, ohne auf gewisse Eigenheiten zu verzichten. Eine andere Minder-heit, und zwar die frühen Christen, sah sich oftmals zu Migration gezwungen, um überleben zu können, und nicht nur dieser Aspekt, sondern auch das Wan-derleben von christlichen Predigern und Missionaren führte dazu, dass räumli-che Mobilität zu einem prägenden Element frühchristlicher Lebensführung wurde. In anderen Fällen wirkte Migration als Motor für die Übernahme oder Festigung einer kulturellen Identität, die der vermeintlichen ›ethnischen‹ Her-kunft der Akteure widersprach.
Subsumierend verdeutlichen die in diesem Sammelband zusammengestell-ten Beiträge einerseits, wie sehr die Politik und die Gesetzgebung im Umgang mit Minderheiten und Migration gefordert sind: Sie können integrative Struk-turen schaffen wie auch einschränkende Maßnahmen setzen. Andererseits sind Fragen nach der Identität von Personen, die einer Minderheit angehören, die aus Migration entstand oder für die Mobilität alltäglich ist, alles andere als monokausal zu behandeln. Diesbezüglich präsentiert sich die griechisch-römi-sche Welt nicht anders als andere Epochen der Menschheitsgeschichte. Viel-
Patrick Sänger
22
leicht kann daher auch die in diesem Rahmen eröffnete Perspektive unseren heutigen Blick für die Gegenwart und Zukunft schärfen. Das Erfahrungspoten-tial unserer (Alten) Geschichte und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ge-ben Aufschluss über Anfang und Ende gewisser Prozesse und bieten Beispie-le, an denen wir (wenn auch subjektiv) gute und weniger gute Weichenstel-lungen oder Konstellationen beobachten können. Ciceros berühmte Aussage historia […] magistra vitae (est) (»Geschichte [ist] Lehrmeisterin des Le-bens«; orat. 2,9,36) gilt auch für die Auseinandersetzung mit Minderheiten und Migration. Wie vielseitig diese Auseinandersetzung im Bezug auf den griechisch-römischen Kulturkreis sein kann und wie zeitlos die Fragestellung an sich ist, vermögen auch die Beiträge des vorliegenden Sammelbandes – so bleibt zumindest zu hoffen – lebhaft vor Augen zu führen.



























![P-omission under sluicing, [P clitic] and the nature of P-stranding](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/632111e6f2b35f3bd10fb543/p-omission-under-sluicing-p-clitic-and-the-nature-of-p-stranding.jpg)