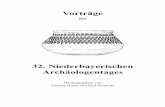Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung.
-
Upload
uni-erlangen -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung.
Handbuch Methoden der Bibliotheks-und Informationswissenschaft
Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse
Herausgegeben von Konrad Umlauf, Simone Fühles-Ubach und Michael Seadle
Redaktion: Petra Hauke
DE GRUYTER SAUR
ISBN 978-3-11-025553-9
e-ISBN 978-3-11-025554-6
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar
© 2013 Walter de Gruyter GmbH, Berlin/Boston
Druck und Bindung: Hubert & Co. GmbH & Co. KG, Göttingen
9 Gedruckt auf säurefreiem Papier
www.degruyter.com
D FSC _,,.„
MIX Pllpler •u• v.,..ntwortungsvallmn QuellM
FSC" C016439
Ursula Rautenberg
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung
1 Methoden der historischen Buchforschung
Die universitäre Buchwissenschaft versteht sich als Disziplin, die das Buch als Medium der Schriftkommunikation in kultureller, ökonomischer und soziologischer Dimension behandelt. Die aus diesem Programm abzuleitenden trans- und interdisziplinären Zugänge sind nur in integrativer Forschung und unter entsprechender methodischer Anpassung und Differenzierung zu bearbeiten. Die akademische Etablierung der Buchwissenschaft als Forschungs- und Lehrfach mit eigenen Studiengängen ist eine neuere Entwicklung; wenig konturiert ist daher das spezifisch buchwissenschaftliche Problemlösungspozential, das dem skizzierten Anspruch gerecht würde. Kennzeichnend für die Buchwissenschaft sind - dieser Ausgangslage entsprechend -ein methodischer Pluralismus und die Übernahme und Anpassung von Methoden und Modellen aus anderen disziplinären Umgebungen, wobei die Wahl der Methode von der Konzeptualisierung der jeweiligen Forschungsfragestellung ausgeht. Eine Darstellung des zur Verfügung stehenden Methodenkatalogs buchwissenschaftlicher Forschung fehlt bisher.
Die Forschungsgeschichte ist stark von der historischen Buchforschung geprägt, wobei das Buch und seine Materialität, die Buchhandelsgeschichte und die historische Lese- und Leserforschung im Zentrum stehen. 1 Die thematisch und historisch vielfältigen Forschungsansätze greifen auf die geisteswissenschaftliche Hermeneutik, die historische Quellenkritik und die quellenbasierte, auch historisch-empirische Analyse sowie statistische Verfahren zurück. Genuin ,buchwissenschaftliche' Methoden sind überwiegend im Kontext der materiellen, physischen Erschließung und hier besonders für das gedruckte Buch der Handpressenzeit entwickelt worden. Auf diesen liegt der Schwerpunkt der folgenden Ausführungen.
2 Typenanalyse
Die Entstehung der Buchwissenschaft als eigenes Forschungsgebiet ist seit dem 18. Jahrhundert eng mit der Erfassung, bibliografischen Beschreibung und Katalogisierung der typografisch erzeugten Druckwerke des 15. Jahrhunderts (Inkunabeln)
1 Rautenberg 2010; Saxer 2010.
462 - Rautenberg
verbunden. Im 19. und frühen 20. Jahrhundert entwickelten zunächst Henry Bradshaw (1831-1886), dann besonders Robert Proctor (1886-1904) und Konrad Haebler (1857-1946) die Typenkunde als Methode, die Vielfalt der Inkunabeldruckschriften systematisch zu erfassen und zu klassifizieren.2 Ziel ist es, die von den Druckern verwendeten Typen in ein formales System zu bringen und darüber hinaus ein Verfahren zu entwickeln, das es erlaubt, Inkunabeln ohne oder nur mit unvollständigem Impressum zu erschließen. Von 34.459 in der Berliner Arbeitsstelle des Gesamtkatalogs der Wiegendrucke erfassten (aber nicht vollständig überprüften) Einträgen einschließlich der Einblattdrucke sind 52,5 o/o ohne Drucker, 51,1 o/o ohne Druckort und 43,5 o/o ohne Datierung. 3
Grundannahme der Typenanalyse ist, dass jede Offizin über einen von anderen Offizinen deutlich unterscheidbaren Vorrat an Schriften und Typen verfügte, also Stempelschnitt, Matrizenherstellung und Schriftguss zur Typenherstellung in der Offizin selbst erfolgten. Die Bestimmung unfirmierter Ausgaben kann dann über den Vergleich von signifikant ähnlichen Typen anhand datierter bzw. einer Werkstatt sicher zugewiesener Druckwerke und Druckschriften erfolgen. Folgende Verfahrensschritte sind zentral für die Methode: (1) Die Bestimmung der Schriftgröße bzw. Kegelhöhe der Type, indem das Maß von
20 Zeilen, gemessen von Basislinie der 1. Zeile zu Basislinie der 21. Zeile, ermittelt wird; die Kegelhöhe der Type ergibt sich aus der Teilung dieses Maßes durch 20;
(2) Eine systematische Klassifizierung der Buchstabenformen nach qualitativen Merkmalen. Während Proctor4 dieses Messverfahren eingeführt hatte, aber lediglich mit ,Ähnlichkeit' der zur vergleichenden Typen arbeitete, wurde die Schriftklassifikation von Haebler auf eine wissenschaftliche Grundlage gestellt: Ausgangspunkt für die gotischen Schriften ist das Majuskel-Mals konturenreicher Buchstabe, aus dessen tatsächlichem Vorkommen Haebler ein Schema von 258 M-Formen entwickelte; für Antiqua-Alphabete wählte er das Qu. In seinem Typenrepertorium der Wiegendrucke5 werden ca. 4.000 Druckschriften der Inkunabelzeit nach diesem Schema klassifiziert. Jede Schrift einer Werkstatt erhält in chronologischer Folge eine Nummer. Die Proctor-Haeblersche-Methode der Typenbestimmung wurde zur Grundlage für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW)6, der nach seiner Fertigstellung Beschreibungen aller weltweit exis· tierenden Inkunabelausgaben enthalten wird. Die Formel innerhalb der Kollationszeile z.B. lautet für einen nicht firmierten Druck aus der Nürnberger Werkstatt des Hans Folz: Typ. 2:96G, 3:ca.100G. Das Werk ist also aus Folz' Typen 2 und 3
2 Vgl. Fußnote 5 sowie Ohly 1931.
3 Ich danke Dr. Oliver Duntze, Berlin, für die Angaben.
4 Vgl. Ohly 1931. S Halle a. S. 1905-1924. Abt. 1-5.
6 Leipzig [u.a.) 1925ff.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 463
nach der Zählung Haeblers gesetzt, die jeweils über 20 Zeilen gemessen 96 bzw. 100 mm hoch sind, G. steht für gotische Schrift (Hans Folz: Von Buhlern ... [Nürnberg: Hans Folz, um 1483/88). GW 10103). Ergänzend zur Haeblers Typenrepertorium können die 2.460 Tafeln, herausgegeben von der Gesellschaft für Typenkunde, herangezogen werden, auf denen eine Probeseite und ein Alphabet jeder Schrift und ihrer Varianten abgebildet sind.7
Nach wie vor wird das oben beschriebene Verfahren für die Bestimmung unfirmierter Drucke herangezogen. Allerdings reicht dieses in schwierigen Fällen allein nicht aus, sondern sollte durch weitere Indizien gestützt werden, z.B. die Wasserzeichenanalyse des verwendeten Druckpapiers (s. Abschnitt 3), die Satztechnik (s. Abschnitt 2), die Untersuchung des Buchschmucks (Leisten und Initialen), der Buchillustrationen (Holzschnitte), der Drucker- und Verlegermarken etc.8
Eine exakte Datierung der Drucke ist über die Typenanalyse nur sehr begrenzt möglich. Der Verwendungszeitraum einer Schrift in der Offizin lässt sich nur ungefähr bestimmen. Zudem befindet sich der Typenvorrat einer Schrift, aus dem in der Offizin gesetzt wurde, in steter Veränderung. Typen nutzen sich ab, werden (aus neuen Matrizen) nachgegossen, oder es werden unterschiedliche Schriften gemischt. Der Setzkasten befindet sich in ständiger Bewegung. Wenn bestimmte Stadien der Entwicklung einer Type anhand genau datierter Drucke festzulegen sind, lassen sich undatierte Drucke mit gleichem Typenbestand ungefähren Zeiträumen ihrer Benutzung zuordnen.9
Die dynamische Veränderung des Typenmaterials und seiner Verwendung im Druckprozess dokumentieren Lotte und Wytze Hellinga beispielhaft in The fifteenthcentury printing types of the Low Countries.10 Sie beziehen auch einen möglichen Schriftenhandel bereits für das 15. Jahrhundert ein, womit die Grundvoraussetzung der Typenanalyse eines eindeutigen Zusammenhangs von Schrift und Offizin relativiert wird. Zudem neigen die Drucker seit dem späten 15. Jahrhundert dazu, die Schriften anderer Drucker und deren individuelle Eigenheiten detailgenau zu kopieren, und die regionalen und lokalen Eigenheiten der Schriftgestaltung werden mit zunehmender Ablösung von den handschriftlichen Vorbildern zurückgenommen. Für die spätere Inkunabelzeit und erst recht das 16. Jahrhundert ist die Methode der Typenanalyse daher nur eingeschränkt nutzbar. Die Frage, wann gewerblicher Typenhandel einsetzte, ist von Bedeutung, denn man muss in Betracht ziehen, dass die Arbeitsschritte von Stempelschnitt, Matrizenherstellung und Schriftguss mehr und mehr zum Ausgangspunkt spezialisierter Unternehmen werden, auch wenn dazu externe Zeugnisse
7 Veröffentlichungen der Gesellschaft für Typenkunde des 15. Jahrhunderts. Leipzig [u.a.] 1907-1939. 8 Amelung 1981. 9 Juchhoff 1959: 126f. 10 Bd. 1-2. Amsterdam: Hertzberger 1966.
464 - Rautenberg
fehlen. Von der formalen Beschreibung einer Schrift bleibt nur noch die Maßangabe der Kegelhöhe übrig. Dass dennoch eindrucksvolle und stichhaltige Ergebnisse erzielt werden können, zeigt neuerdings die vorbildliche Untersuchung des Druckmaterials der Straßburger Offizin des Matthias Hupfuff (1497/98-1520) durch Oliver Duntze. Er geht nicht mehr von einer Singularität der Typen aus, sondern von signifikanten Kennzeichen und bezieht auch das Ziermaterial ein.11
Type213
2l'MJDlt.fc&.,f, J"kl"'"4Plt0'1:".0'\1''5.u'4' AiBccfbWciffflritfflttltraiiaW&.-flf lfJ Aaulii"'!'-f l'&rbnale: M..; Obnrheinischc Bamrda; D mit doppclccm Schaft; L mit Schnörhl; Mi-
nusl..:lobcrliingen mit Schlingen; Punkt und Doppelpunkt lcreuzflirmig Größe: ~mm Verwc:ndung: 150~1507 Vorlage: Tnelbllchlein. Straßburg: HupfutT 1504 (Nr. 77, Exemplar Philadelphia UB)
Type2b
21lS~JC5.f\:J1<tln4l''ll6"C'OY01f·· •iiBcc8'&kiffffl_.itHrmmnWpriefft"ff8~uaü&fi"fW!1s Mcrbnale: M..; Oberrhcinischc &starda; sackig-es D; gefieder11et L; Minuskcloberlingen
mit Schlingen; Punkt mittig in der Zeile; Virgcl und Divis lang und steil Größe: 9Jl94 mm Vccwrndung: (ISOS-1509], 1510-1511 Ähnliche typen:
Flach 6 Anmerkung: Z. T. ein umgedrehtes S als D; 1510/1511 parallel zu Type ;i<I vcrwc:ndet Vorlage: Lucicbrius. Straßburg; HupfutT 1511 (Nr. 168, Exemplar Nürnberg SB)
Abbildung 1: Zwei Zustände der Type 2 des Druckerverlegers Matthias Hupfuff.12
3 Analytische Druckforschung
Die Analytische Druckforschung hat ihren Ursprung in der Descriptive Bibliography,
die im 20. Jahrhundert besonders von englischen Bibliografen entwickelt worden ist. Die sog. ,angelsächsische Schule' wird vertreten u.a. von Ronald Brunlees McKerrow (1872-1940), Walter Wilson Greg (1875-1959), Fredson Bowers (1905-1991) und Afred W. Pollard (1859-1944). Eine eigenständige, tiefbeschreibende Bibliografie, die über ein bibliothekarisches Titelverzeichnis in Bücherkatalogen hinausgeht, wurde von Fredson Bowers 1949 in seinem grundlegenden Werk Principals of Bibliographi
cal Description erstmals methodisch systematisiert. Ziel ist es, das gedruckte Buch
11 Duntze 2007: Abbildung 1. 12 Quelle: Duntze 2007: 488.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 465
der Handpressenzeit (16./18. Jahrhundert) und das maschinell hergestellte Buch (19./20. Jahrhundert) nach den Kennzeichen seiner materiellen Erscheinungsform („physical, material object") umfassend und detailliert zu beschreiben. Es handelt sich um eine mit zahlreichen Beispielen unterlegte Anleitung der formalen Anlage einer Quellenbibliografie nach Titelblatt, Impressumsvermerk, Kopftitel und Kolumnentitel, Format, Kollationsformel, Paginierung und Foliierung, Signaturen, Kustoden, Indizes, Typografie etc. 1972 legte Philipp GaskellA new lntroduction to Bibliography vor, der die technischen Vorgänge des Produktionsprozesses von Letternmaterial, Satz und Druckform, Druck, Papier und Bindung zum Ausgangspunkt für die Druckanalyse nahm. Während Bowers13 die deskriptive Bibliografie noch als „pure scolarship" bezeichnete, erweiterte Gaskell diese um die „textual" bzw. „critical bibliography": Beschreibung und Analyse des Produktionsprozesses sollen, kombiniert mit Methoden der Textkritik, die Druck- und Ausgabengeschichte literarischer Werke in schwierigen Fällen erhellen. Sie trägt damit zur Lösung von Problemen bei, die sich mit literaturwissenschaftlicher Methodik nicht angehen lassen („textual bibliography"; „the transmission of texts by explaining the process of book production"14).
Prominentes Beispiel ist die Druckgeschichte der Werke Shakespeares. Auf der Grundlage einer Papier- und Wasserzeichenanalyse konnte nachgewiesen werden, dass die Dramenausgaben in Quarto bereits 1600 und 1608 gedruckt worden sein müssen und nicht, wie auf den Titelblättern angegeben, erst 1609.
Die Analytische Druckforschung geht von den Erkenntnissen der „critical bibliography" aus, beschränkt sich aber weitgehend auf Drucke der Handpressenzeit, deren Produktionszirkel dem typografischen Kreislauf aus Satz und Lagenplanung, Korrektur nach Probeabzug von der gesetzten Form, Abdruck der Form unter der Presse auf den Bedruckstoff und Ablegen des Satzes für die erneute Verwendung des Typenmaterials unterlag. Boghardt15 unterscheidet drei voneinander zu trennende methodische Schritte der Analytischen Bibliografie:
(1) Die bibliografische Erfassung des typografischen Befundes mit Hilfe einer genauen Analyse der handwerklich-technischen Entstehung,
(2) die bibliogenetische Erklärung auf der Grundlage der Rekonstruktion des Druckprozesses und
(3) die Interpretation des typografischen Befundes und die Sicherung der Druckgeschichte (textbezogene Deutung).
Methodische Grundlage ist der Vergleich möglichst vieler Exemplare eines Drucks (Auflage, Ausgabe), die als satzidentisch vorausgesetzt werden. Alle Abweichun-
13 Bowers 1994: 3.
14 Gaskell 1995: IX.
15 Boghardt 1977: 18.
466 - Rautenberg
gen, z.B. textliche Veränderungen und solche von Typen und Satz, werden sorgfältig registriert. Minutiös ist dies von Charlton Hinmann 1963 an 80 Exemplaren der ersten Folio-Ausgabe Shakespeares (The Printing and Proof reading of the First Folio of Shakespeare) durchgeführt worden, der anhand schadhafter Typen und Neusatz von textgleichen Kolumnentiteln fünf unterschiedliche Setzer und Setzkästen feststellen und die Korrekturvorgänge während des Druckprozesses erhellen konnte. Zu diesem Zweck hatte er ein optisches Gerät konstruiert, das es ermöglichte, die gleichen Seiten von jeweils zwei Exemplaren aufeinander zu projizieren, sodass partielle Satzabweichungen unmittelbar zu erkennen waren.16 Der Satz in Formen hatte die Textgestalt der First Folio-Ausgabe beeinflusst.
Diese zeitaufwändige und mühsame Methode des Vergleichs möglichst vieler erhaltener Exemplare und der Dokumentation unterschiedlicher Zustände ist wohl nur in besonderen Fällen anzuwenden. Sie wurde in Deutschland vor allem von Martin Boghardt (1936-1998) an der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel an Ausgaben Klopstocks und Lessings betrieben.17 Er hat die vorkommenden Phänomene grob klassifiziert. Satzinterne Varianten bei sonst satzidentischer Umgebung entstehen aus Veränderungen des Satzes im Druckprozess (Pressvarianten) oder nachträglichen Korrekturen bereits ausgedruckter Bogen, indem die fehlerhaften Einzel- oder Doppelblätter neu gesetzt (Cancellantia) und, auf einen Falz geklebt, vom Buchbinder in die Lage integriert wurden (Kartons).
Eine Sonderform ist die Titelauflage (Titelausgabe), wobei Titelblatt oder Titelbogen neu gesetzt (Titelblattneuauflage) und mit vorhandenen Drucken oder Teilen von Ausgaben kombiniert werden. Der Neusatz von Drucken oder Teilen18 lässt sich unterscheiden nach Zwitterdruck (partieller Mehrfachsatz von Bogen bzw. Lagen, wobei Teile der Ausgabe aus unterschiedlichen Satzvorgängen stammen), Gesamtneudruck mit veränderter Satzeinrichtung (Type oder Umfang), mit unveränderter Satzeinrichtung (seitengleich, nicht zeilengleich) und zeilen- und seitengetreuen Neudrucken (Doppeldruck). Die Analytische Druckforschung registriert diese Phänomene; welche Gründe jeweils zu satzinternen Varianten und Neusatz führten - Druckfehlerkorrektur, Ersetzung abgenutzten Materials, fehlendes Schriftmaterial für den parallelen Satz mehrerer Formen, Erhöhung der Auflage während des Satzvorgangs, Raubdruck oder Zensur-, bedarf im Einzelfall der Interpretation unter Berücksichtigung weiterer druckexterner Indizien und Quellen.
Ein lohnendes Anwendungsfeld ist die Inkunabel- und Frühdruckforschung, besonders der frühesten Ausgaben aus den ersten Jahrzehnten nach der Erfindung der Typografie, die viele Rätsel aufgeben. Die ältere deutsche Inkunabelkunde, verbunden mit Namen wie Paul Schwenke (1903-1921), Adolf Schmidt (1857-1935) und
16 Ebd.: 14f.
17 Boghardt 2008. 18 Ebd.: 50-74.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 467
Carl Wehmer (1903-1978) ist daher ebenso den Gründerfiguren der Analytischen Bibliografie zuzurechnen wie die angelsächsische Schule.19 Neben dem bereits genannten Boghardt haben in den letzten Jahrzehnten vor allem Lotte Hellinga und Paul Needham mit Methoden der Analytischen Bibliografie die lnkunabelkunde bereichert. In der Phase der frühen Erprobung der neuen Technologie, nicht zuletzt auch aus externen Gründen der Auflagenplanung für einen noch unscharf konturierten Markt, sind Varianten ausgesprochen häufig. Exemplarspezifische („copy-specific") Besonderheiten, die an den Satz gebunden sind, entstehen regelmäßig unter den frühen Pressen und sind Hinweise auf „how type works". 20
Die Analytische Druckforschung bedient sich neben Beobachtungen, die aus den Produktionstechniken und -prozessen in der Druckwerkstatt resultieren, weiterer Hilfswissenschaften wie der Papier- und Wasserzeichenforschung (s. Abschnitt 4), der Einbandforschung (s. Abschnitt 5) und der Provenienz- und Makulaturforschung (s. Abschnitt 6). Lotte Hellinga21 hat die unterschiedlichen Verfahren am Beispiel der berühmten Catholicon-Debatte einer Methodenkritik unterzogen. Das lateinische Wörterbuch des Johannes Balbus ist unter Angabe des Druckorts Mainz und des Druckjahrs 1460, aber ohne Druckernennung erschienen. Neben der Frage der Werkstattzuweisung ist die Datierung problematisch, da die Wasserzeichenanalyse auf drei unterschiedliche Ausgaben (1460, um 1468 und 1472) hinweist. Rätsel geben auch Abweichungen im nahezu identischen Satz auf, die stets in zwei Doppelzeilen auftreten. Das Problem gilt bis heute als nicht gelöst. Hellinga weist kritisch darauf hin, dass die Analytische Druckforschung auf einzelnen Beobachtungen am jeweiligen Objekt beruht. Rückschlüsse werden über den Vergleich mit anderen Beobachtungen, die im Kontext als geeignet erscheinen, gezogen, obwohl die Relevanz des Vergleichsmaterials möglicherweise nach Ansprüchen (wissenschaftlich-)empirischer Methodik nicht tragfähig ist. Zur Interpretation werden wiederum Hypothesen unterschiedlichster Art gebildet, so zum Beispiel Vorannahmen über den konkreten Werkstattbetrieb, Vorwissen über die Biografie eines Druckers und seine Produktionsgewohnheiten.
Ungeachtet der methodischen Diskussionen im Einzelnen stellt die Analytische Druckforschung ein differenziertes Instrumentarium für unterschiedliche Fragenstellungen der Text-, Werk- und Überlieferungsgeschichte bereit. Sie wird in jüngster Zeit auch von der historischen Sprachwissenschaft genutzt. Akihiro Fujii22 wählte für seine linguistische Analyse zur Druckersprache der Produktion des Augsburger Druckers Zainer Textabschnitte, die von unterschiedlichen Setzerhänden stammen. Das repräsentative Material basiert auf der Einsicht in die Arbeitsabläufe in der Offizin
19 Needham 2010: 19f. 20Ebd.:11. 21 Hellinga 1989. 22 Fujii 2007.
468 - Rautenberg
und der Annahme, dass druckersprachliche Unterschiede durch die sprachliche Heimat der Setzer beeinflusst sein können.23
Abschließend lässt sich sagen, dass die Analytical Bibliography als Methode, unabhängig von ihren konkreten Anwendungsfeldern, das Bewusstsein für die variable typografische Gestalt von Drucken der Handpressenzeit und der von ihnen gebotenen Texte geschärft hat. Die auf antike und mittelalterliche Handschriften gestützte Textkritik und Überlieferungsgeschichte hat stets jeden einzelnen Textzeugen in seiner Individualität gesehen. Demgegenüber galt der Druck, Vorstellungen der modernen Buchherstellung voraussetzend, im Zusammenhang der gesamten Auflage bzw. Ausgabe als identisch und die Druckausgabe als endgültige Fixierung der Werkgestalt. Die Analytische Handschriftenforschung untersucht daher in Anlehnung an Kodikologie und Analytische Druckforschung bes. an literarischen Werken des 19. und 20. Jahrhunderts die gesamte schriftliche Überlieferung (u.a. Entwürfe, Druckmanuskripte, Korrekturabzüge), um die Genese eines Werkes bis zum Druck zu dokumentieren.24
4 Papier- und Wasserzeichenanalyse
Die Papierforschung hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zu einem eigenständigen Wissenschaftszweig entwickelt, der Papiergeschichte, Technikgeschichte der Papierherstellung und naturwissenschaftlich-technische Methoden zur Papieranalyse verbindet. Papier ist nicht nur Trägermaterial für die schriftliche Überlieferung in Handschrift und Druck, sondern wird als Werkstoff für Verpackung, Buchbinderei und in der bildenden Kunst verwendet. 25 Die Erforschung der Materialität des Buches greift insbesondere für kodikologische Untersuchungen26 sowie für die Bestimmung unfirmierter (d.h. wegen fehlenden Impressums keiner Druckwerkstatt zugeordneter) oder nicht datierter Drucke auf die Wasserzeichenforschung zurück.
Die Papierforschung geht vom individuellen Papierbogen bzw. dem Bogen-SiebVergleich aus.27 Die Merkmale des Schöpfsiebs (Kett- und Rippdrähte, Wasserzeichen), mit dem der Bogen geschöpft wurde, prägen sich unverwechselbar als hellere, lichtdurchlässigere Stellen bei der Blattbildung ein, da hier der Faserbrei dünner zum Auftrag kommt. In der Blattdurchsicht sind diese Stellen gut erkennbar. Die Größe des handgeschöpften Papierblatts wird durch die Siebgröße bedingt. Alle von einem Sieb bzw. einem Siebpaar für Schöpfer und Gautscher hergestellten Bögen werden in einer
23 Künast 2010. 24 Löffler u. Milde 1997: 22-25. 25 Tschudin 2002: 3-12. 26 Löffler u. Milde 1997: 57-64. 27 Tschudin 2002: 31-39; Neuheuser [u.a.] 2005.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 469
Gruppe zusammengefasst, die zeitlich über die Lebensdauer des Siebs einzugrenzen und einer Mühle zuzuweisen ist. Eine relative Binnenchronologie ist bei genügendem Vergleichsmaterial über die Abnutzungsspuren und Reparaturen im Verwendungszeitraum des Siebs möglich, denn die Siebe waren wohl über mindestens anderthalb Jahre, oft länger, in Gebrauch. Alle Merkmale, das Wasserzeichen ebenso wie die umgebende Struktur aus Ripp- und Kettdrähten, werden in einer Beschreibung des Bogens erfasst. In einem weiteren Schritt müssen Indizien für die Zuweisung und Datierung - da primäres Quellenmaterial aus den Mühlen bzw. über den Vertrieb nur selten erhalten ist - erfolgen. Als sekundäre Quellen werden Bögen derselben Gruppe herangezogen, die z.B. in Drucken mit einem Impressum verwendet oder von der Hand des Schreibers oder Lesers mit Zeit- und Ortsangaben versehen wurden.
Die Methode der Datierung und Zuweisung mit Hilfe der Wasserzeichenkunde als Vergleichs- und Referenzverfahren setzt große, methodisch einheitlich angelegte Korpora voraus, in denen Wasserzeichen gesammelt und katalogisiert werden. Die Erfassung der Bilder (Zeichnung, Durchreibung, optische Verfahren) und die den Wasserzeichenpapieren zugeordneten Informationen über Herstellung und Überlieferung bestimmen die Qualität der Sammlung und sind entscheidend für die Validität der Ergebnisse. Das nach wie vor wichtige, umfassende Korpus, die von Gerard Piccard im Hauptstaatsarchiv Stuttgart seit 1951 zusammengetragene Wasserzeichenkartei beruht auf Zeichnungen auf Karteikarten, die inzwischen digitalisiert zur Verfügung stehen.28 Die Sammlung Watermarks in Incunabula Printed in the Low Countries29
stellt digitalisierte Durchreibungen und elektronenradiografische Aufnahmen zur Verfügung. Im Aufbau befindet sich das Wasserzeichen-Informationssystem (WZIS), das die digitalisierten Bestände von Wasserzeichen in mittelalterlichen Handschriften zusammenführt.30
Die zeitliche Einordung der überwiegend undatierten Blockbücher ist weitgehend auf die Papier- und Wasserzeichenanalyse angewiesen. Letztere wird erschwert durch die spezielle Produktionstechnik der Blockbücher: Die weißen Rückseiten von zwei xylografisch erzeugten Abdrucken werden aneinandergeklebt, weshalb die Wasserzeichen schwer erkennbar sind. Die jüngste technische Weiterentwicklung nutzt Wärmediffusion und -transmission, um Wasserzeichen und Papierstrukturen sichtbar zu machen. 31 Das thermografische Verfahren wurde für die Dokumentation der Wasserzeichen aller Blockbücher in bayerischen Sammlungen herangezogen32 und liefert erstmals exakte Wiedergaben der Wasserzeichen in Blockbuchpapieren (Abbildung 2).
28 www.piccard-online.de (22.10.2012).
29 http://watermark.kb.nl (23.10.2012).
30 www.wasserzeichen-online.de/wzis/index.php (23.10.2012).
31 Neuheuser [u.a.) 2005: 272-275.
32 www.bayerische-landesbibliothek-online.de/xylographa (23.10.2012); Wagner 2012: 22f.
470 - Rautenberg
Abbildung 2: Ausschnitt einer Seite aus einem Blockbuch und entsprechende Thermografie.
Aufnahme mit sichtbarem Wasserzeichen: Biblia Pauperum. [Nürnberg: Hans Sporer 1471), BI. 2
(Bayerische Staatsbibliothek München, Xylogr. 24).
Gerard Piccard (1909-1987) gilt als Begründer der wissenschaftlich exakten Wasserzeichenforschung. Die Methode war in der Inkunabelkunde lange umstritten. 33
überzeugend war die Lösung des umstrittenen Missale speciale-Problems, einer nicht datierten, seltenen Inkunabel in der Psalter-Type der Werkstatt der Gutenberg-Nachfolger Johann Fust und Peter Schöffer. Ober den Wasserzeichenvergleich kamen drei Forscher, u.a. Piccard, unabhängig voneinander und unter unterschiedlichen theoretischen Vorannahmen zum selben Ergebnis, dass das Missale 1473 gedruckt worden sein muss.
Inzwischen hat sich ein Konsens herausgebildet, wonach die Analyse des verwendeten Papiers im Verbund mit anderen Indizien zur relativ genauen Datierung von Drucken mit einem Spielraum bis zu+/- vier Jahren beitragen kann, wobei -zahlreichen Beobachtungen folgend - die maximale Lebensdauer des Siebs für die Bestimmung dieses Zeitraums angenommen wird. Eine räumliche Einordnung von Drucken ohne Impressum ist nur sehr begrenzt möglich, da Papier als Ware und gefragtes Handelsgut weiträumig, auch über die Messeplätze, gehandelt worden ist. Der Buchdruck hatte einen bis dahin unbekannten Bedarf an Druckpapier, der von heimischen Mühlen in der Nähe oft nicht oder nicht in ausreichender Menge und der
33 Überblick bei Amelung 1991: 104-107.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 471
gesuchten Qualität befriedigt werden konnte. Externe Quellen berichten für die Zeit des frühen Buchdrucks verschiedentlich über den Bezug von Papier aus oberitalienischen Mühlen; so z.B. hat der Ulmer Papierhändler Hans Harscher dem Druckerverleger Peter Drach Mailänder Papier angeboten. 34 Hier kann man über die Wasserzeichenanalyse, basierend auf dem Vergleich mit firmierten Drucken, in denen identische Zeichen vorkommen, lediglich vom Verbreitungsraum der Papiersorte, aber nicht von ihrem Produktionsort auf den möglichen Druckort schließen.
In der Praxis ist die Wasserzeichenanalyse für buchwissenschaftliche Zwecke der Datierung und Firmierung von Druckwerken schwierig. Bei kleinformatigen, eng gebundenen Drucken sind Wasserzeichen im Falz bzw. Bund manchmal nicht hinreichend erkennbar. Zudem haben Druckpapiere nicht immer ein Wasserzeichen, sodass der Vergleich lediglich auf dem Muster der Kett- und Rippdrähte basiert. Hohe Expertise erfordern die Zuordnung eines vorgefunden Zeichens zu identifizierten Zeichen in vorliegenden Repertorien und die Einschätzung des Befundes. Da für möglichst belastbare Ergebnisse Identität der Zeichen Voraussetzung ist, andererseits die tatsächlichen Bogen Abnutzungsspuren des Siebs in sich tragen, gibt es einen Interpretationsspielraum. Möglicherweise führt die digitale Zukunft hier zu einer leichteren Anwendung durch die Digitalisierung vieler Bogen in einem schonenden und preiswerten Verfahren und der Möglichkeit, unterschiedliche Bögen aufeinander zu projizieren. 35
Papier- und Wasserzeichenuntersuchungen werden in der Buchwissenschaft auch als Instrument der Analytischen Druckforschung genutzt. Die Verwendung unterschiedlicher Papiersorten innerhalb eines Exemplars bzw. für den Druck einer Ausgabe kann Rückschlüsse auf die Arbeitsprozesse in der Offizin ermöglichen, bis hin zu einer relativen Chronologie der Druckproduktion in einer Offizin anhand der Papiervorräte. Needham36 hat die zeitliche Abfolge der frühen Drucke William Caxtons in Westminster korrigieren können, indem er das Muster der Verwendung unterschiedlicher Papiervorräte im Druckprozess rekonstruiert hat.
Auch für den antiquarischen Zweig der Buchwissenschaft und für die Verlagsgeschichte ist die Papiergeschichte ein wichtiges Hilfsmittel. Seit dem 18. Jahrhundert und dem Aufkommen der an äußeren Qualitätsmerkmalen des Buchs orientierten Bibliophilie werden Ausgaben für unterschiedliche Kundenkreise auf verschiedenen Papierqualitäten abgesetzt, für Luxusausgaben auf feinem Velinpapier und mit kaum hervortretender Rippung. Typografische Reformer wie Giambattista Bodoni37 forder-
34 Mäkeler 2005: 48f. 35 Neuheuser [u.a.J 2005: 275. 36 Needham 1981. 37 Manuale Typografico. Parma 1818. www.rarebookroom.org/Control/bodtip/index.html (25.10. 2012).
472 - Rautenberg
ten für einen gelungenen Druck glattes Papier, auf dem die Lettern und besonders die feinen Serifen einer klassizistischen Antiqua deutlich hervortreten.
5 Einbandforschung
Die Einbandkunde als eigenständiges Forschungsgebiet beschäftigt sich mit der Zuweisung von Einbänden an bestimmte Werkstätten oder Binder, der Beschreibung und Verzeichnung von Hand- und Maschineneinbänden, den Bindetechniken und einer künstlerisch-stilistischen Einordung. Sie ist aus der bibliothekarischen Arbeit gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden. 38
Von Beginn an wurde der methodische Nutzen für die Buchforschung in der Lokalisierung von Handeinbänden gesehen und besonders an Einbänden des 15. und 16. Jahrhunderts erprobt. Die Lederdecken romanischer und gotischer Bucheinbände wurden mit Blindprägungen von Einzelstempeln, im 16. Jahrhundert auch Plattenund Rollenstempeln, verziert. Diese tragen individuelle Bilder, Symbole und Dekore, die als Werkzeuge bestimmten Buchbindereien und Buchbindern zugeordnet werden können. Voraussetzung für die Bestimmung von Einbänden ist der Stempelvergleich, für den - ähnlich wie bei der Wasserzeichenanalyse -, umfassende Repertorien notwendig sind. Die Stempel werden vom Original mit einem Bleistift auf Papier durchgerieben und, soweit möglich, datiert und identifiziert. Eine der ersten großen Sammlungen ist die des Privatgelehrten Ernst Kyriss (1881-1974), dessen Lebenswerk Verzierte gotische Einbände im alten deutschen Sprachgebiet in vier Bänden 1951-1958
erschien. Seine Dokumentation von über 50.000 annotierten Stempelabreibungen wurde 1960/61 an die Württembergische Landesbibliothek Stuttgart verkauft. Seit 2002 befindet sich die Einbanddatenbank (EBDB) historischer Bucheinbände als Verbundprojekt mehrerer großer deutscher Bibliotheken im Aufbau, in der neben der Sammlung Kyriss die von Ilse Sehunke, Paul Schwenke und Anna Marie Floerke, ergänzt durch Abreibungen aus den beteiligten Bibliotheken, zugänglich sind.39
Neben den digitalisierten Abreibungen und einigen digitalen Bildern der Einbände können Informationen zu den Werkstätten, Stempeln und über die buchbinderische Einheit (Inhalt, Provenienzen) abgerufen werden.40
Die zeitliche und räumliche Bestimmung von Einbänden ist neben der Möglichkeit, undatierte und unfirmierte Bände im Verein mit anderen Indizien genauer zu bestimmen, ein Instrument der Provenienzforschung (s. Abschnitt 6), wobei hier von der zeitgenössischen Bindung („Einband der Zeit") ausgegangen wird.
38 Überblick über die Forschungsgeschichte bei Schmidt-Künsemüller 1987. 39 www.hist-einband.de/(23.10.2012). 40 Ebd.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 473
Die Makulaturforschung als Untergebiet der Einbandforschung untersucht makuliertes Material (zerlegte Pergament- oder Papierhandschriften, überzählige Druckbögen, Fehldrucke etc.), das vom Buchbinder als Einlage für Einbandrücken und -decke verwendet bzw. in die inneren Spiegel geklebt wurde. Nicht selten werden so Fragmente unbekannter Textfassungen oder Ausgaben gefunden.
Noch in Anfängen steht die Erhellung der komplexen Geschäftsbeziehungen und Arbeitszusammenhänge zwischen den Druckerverlegern, Buchbindern und Buchhändlern der Inkunabel- und Frühdruckzeit mit Methoden der Einbandforschung. Vera Sack hat 1973 eine Verbindung zwischen Schöffer-Drucken oder Drucken aus anderen Offizinen, mit denen Peter Schöffer gehandelt hat, und Einbänden aus Mainzer Werkstätten hergestellt. Diese von Sack sog. „Verlegereinbände" können ein Indiz für die Bemühungen der buchhandelnden Druckerverleger sein, den Kunden nicht nur Rohbogen zu liefern, die diese selbst binden ließen, sondern ein Fertigprodukt, das in enger Zusammenarbeit mit einigen ortsansässigen Buchbinderwerkstätten hergestellt wurde. Auch die Makulaturforschung kann hier herangezogen werden. So konnte Claire Bolton41 in einer neueren Untersuchung enge geschäftliche Verbindungen zwischen den Ulmern Johann Zainer und Konrad Dinckmut mit Hilfe der Einband- und Makulaturforschung nachweisen. In zahlreichen Einbänden Dinckmuts, der nicht nur Buchbinder, sondern auch Drucker und Buchhändler war, findet sich Makulatur der Jahre von 1473-1490 aus der Werkstatt Zainers, wobei Einbände auf Zainer-Drucken mit über 20 o/o den prozentual größten Teil gegenüber Drucken anderer Offizinen ausmachen.
6 Provenienzforschung
Die Provenienzforschung, die idealerweise die Besitzgeschichte einer Handschrift, eines Drucks bzw. einer buchbinderischen Einheit lückenlos dokumentiert, hat eine ihrer Wurzeln in der Bibliophilie und im bibliophilen Antiquariat. Ein bedeutender Vorbesitzer oder die Zugehörigkeit zu einer berühmten Sammlung heben das Exemplar aus der Menge heraus und steigern den Marktwert eines Buchs; Antiquariatsund Auktionskataloge verzeichnen daher in aller Regel auch Provenienzen. Für die Buchforschung ist die Erschließung der Provenienz hingegen für die Überlieferungsgeschichte von Werken sowie die qualitative Leserforschung von großer Bedeutung. Für die Bibliotheksgeschichte lassen sich aus Provenienzeinträgen Sammlungen bzw. Bibliotheken rekonstruieren, die im Lauf der Zeit auseinandergerissen worden sind
41 Bolton 2010.
474 - Rautenberg
oder sich nicht vollständig im ursprünglichen Bibliothekskontext erhalten haben.42
Die Buchhandelsgeschichte nutzt Provenienzeinträge, um Aufschluss über Handelsräume und Warenströme des frühen Buchhandels sowie die Wanderung von Exemp· laren zu gewinnen.43 Voraussetzung für eine quantitative Provenienzforschung ist die Sammlung großer Datenmengen.
Provenienzen werden im Rahmen von ausführlichen Beschreibungen von Handschriften erfasst, bei Drucken als Teil der exemplarspezifischen Besonderheiten. Am Buch selbst sind Herkunfts- und Besitzvermerke zu erschließen durch:
Handschriftliche Einträge des Namens eines privaten Besitzers und/oder einer Institution bzw. Körperschaft (Bibliothek), meist im vorderen Spiegel, auf dem fliegenden Vorsatz oder am Beginn der ersten Einheit in einem Sammelband. Sollte es sich um eine spätere Bindung handeln oder sollten Handschriften oder Drucke auch aus Vorbesitz zu einer Bindeeinheit zusammengestellt worden sein, kann u.U. jedes Werk einen eigenen Vermerk enthalten; Exlibris, die als gedruckte, oft grafisch aufwändig gestaltete Buchzeichen den Besitzer ausweisen, meist im Zusammenhang einer umfangreicheren privaten Büchersammlung; Bibliotheksstempel; da die Stempel im Laufe der Zeit variieren, können diese als Indiz für eine ungefähre Zeitspanne dienen, in der das Buch in den Besitz der Bibliothek gelangt ist; Widmungen z.B. des Autors sowie Schenkungsvermerke; Einbandanalysen mit Hilfe von Supralibros (geprägte, meist heraldische Besitzerzeichen) und/oder über die Zuweisung an spezielle Binder und Bindewerkstätten (s. Abschnitt 5); Annotierungen, Marginalien etc.; Hinweise, die zu einem Besitzer führen, sind prinzipiell an jeder Stelle des Buchs zu finden (Abbildung 3).
Zu den externen Quellen gehören Nennungen von Buchtiteln in (historischen) Bib· liotheks- und Bücherkatalogen, Akzessionsjournalen, Antiquariatskatalogen, Tes· tamenten, Archivalien etc. Voraussetzung hier ist, dass die Zuweisung im Fall von gedruckten Werken an ein bestimmtes Exemplar, bzw. bei bibliografisch lückenhaften Angaben an eine Ausgabe erfolgen kann.
42 Vgl. neuerdings die vorbildliche Rekonstruktion von frühneuzeitlichen Privatbibliotheken in der Bibliothek des Halleschen Waisenhauses, Klosterberg 2012. 43 Ford 1999. 44 Nach dem Exemplar Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Inc. 410; vgl. Thüring von Ringoltingen: Melusine (1456). Nach dem Erstdruck: Basel: Bernhard Richel [um] 1473/74 hrsg. von A. Schnyder in Verb. mit U. Rautenberg. Wiesbaden: Reichert 2006. Bd. 2: 84, Abb.11. Vgl. ebd.: 83f. die ausführliche Provenienzanalyse.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 475
·~~'b:)ftr~~lil1'tkambatl rm l:t-~l:pr ~b einmt11~ ~~imn*7ortii 111mi tli11'unlJ er vall Brifn wlin aorm1r wart
Abbildung 3: Gezeichnetes
Wappen und Eintrag in einem
Holzschnitt, der zur Adelsfamilie
Hoymb im Herzogtum Braun
schweig führt (Th Uring von Ringol
tingen: Melusine. Basel: Bernhard
Richel 1473/74. BI. 53v).44
Besonders bei privaten Besitzern ist die Identifizierung einer konkreten Person, ihrer Lebensdaten, Berufszugehörigkeit oder sozialen Einordnung, die für die Leserforschung von Interesse ist, oft nur über die aufwändige Recherche biografischer Nachschlagewerke und archivalischer, auch unpublizierter Quellen möglich. Über die Altbestandskatalogisierung von Handschriften und Drucken ist bereits eine Fülle von maschinenlesbaren Daten vorhanden, und die Bibliotheken sehen inzwischen die Provenienzerschließung als eine ihrer Kernaufgaben an. Eine Arbeitsgruppe des Deutschen Bibliotheksverbandes Provenienzforschung und Provenienzerschließung arbeitet an der Vereinheitlichung von Normdatensätzen für die Provenienzerschließung in Online-Katalogen nach dem Weimarer Modell.45 Die Datenbank Material Evidence in lncunabula (MEI) bietet bereits Recherchemöglichkeiten auf einer umfangreichen Datenbasis 46
45 Scheibe 2010; Fabian u. Kuttner 2011. 46 http://incunabula.cerl.org/cgi-bin/search.pl (23.10.2012).
476 - Rautenberg
7 Marginalienforschung
Ebenfalls exemplarspezifisch zu erforschen sind Glossen, Marginalien oder Annotationen, die der Leser im Buch anbringt. Die Leseforschung möchte aus der Untersuchung dieser Spuren individueller Leser auf die tatsächliche Lektüre und die Textrezeption schließen. Die Anmerkungen sind von unterschiedlicher Art. Zu den einfachen und häufig vorkommenden Spuren gehören Unterstreichungen, Einklammerungen, Wiederholungen von Wörtern, Nota-Bene-Symbole wie die zeigende Hand, die lediglich auf ein besonderes Interesse an einer Stelle verweisen. Extensive Annotationen, wie ergänzende Informationen zum Text, ausführliche Kritik etc., sind dagegen selten. Die große Menge der Leser, die Spuren hinterlässt, bleibt anonym. In Verbindung mit Provenienzvermerken, die dem annotierenden Leser zugeordnet werden können, kann die Lesereaktion einem sozialen Umfeld zugeordnet werden.
Die Marginalienforschung ist in den letzten Jahren methodisch erweitert worden, indem über die Interpretation von einzelnen Einträgen hinaus große Korpora systematisch untersucht werden. In der Regel steht ein Werk im Vordergrund, von dem möglichst viele erhaltene Exemplare autoptisch nach Leserspuren überprüft werden. Anspruchsvoll ist dies von Jonathan Green47 am Beispiel der Eintragungen in 112 Exemplaren von 5 deutschen und lateinischen Inkunabelausgaben der Sehedelsehen Weltchronik durchgeführt worden. Die zum Teil ausführlichen Annotationen lassen sich individuellen Schreibern zuordnen. Die inhaltliche Erschließung weist auf Stellen, die besonders kommentierenswert erschienen, so zur Päpstin Johanna. Die Langzeitrezeption eines Werks ist über Jahrhunderte hinweg zu beobachten, wenn die Einträge aufgrund von Schriftmerkmalen oder Lebensdaten erschlossener Kommentatoren zeitlich eingeordnet werden.
8 Statistische Methoden in der historischen Buchforschung
Grundfragen der allgemeinen Buchhandelsgeschichte bzw. der Buchwirtschaftsgeschichte sind häufig quantitativ ausgerichtet. Im Mittelpunkt stehen Leitfragen nach Buchproduktionszahlen insgesamt (Ausgaben, Exemplare), dem zeitlichen Verlauf der Buchproduktion, der Zahl erhaltener Exemplare, der Bereitstellung und der Ver· breitung von Lektüre, Leseinteressen etc. Hier sollen Trends und Muster in der Langzeitbetrachtung ermittelt werden. Topografisch ergeben sich Differenzierungen u.a. nach Ländern, Regionen und Städten, betriebsspezifisch nach Geschäftsgrößen und -typen, Produktionsprofilen sowie Handelsräumen und dem quantitativen Verlauf
47 Green 2006.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 477
von Warenströmen regional und überregional. Inhaltlich werden quantitative Fragen korreliert mit Anteilen von Programmbereichen oder Warengruppen an der Gesamtproduktion in einem gegebenen Zeitraum, mit durchschnittlichen Bücherpreisen bzw. dem Zusammenhang von Lesestoffen und Lesergruppen oder -schichten.
Quantitative statistische Verfahren sind in der Buchforschung möglich geworden, als umfangreiche Gesamttitelkataloge erstellt wurden, erstmals seit A. W. Pollards Initiative eines Short-title Catalogue of Books Printed in England, Scotland and Ireland 1475-1640 (STC).48 Seit den 1950er Jahren ist die quantitative Buchforschung von der französischen Schule der L'Histoire du livre aufgenommen worden; zu nennen ist das richtungweisende Buch L'apparition du livre von Luden Febvre und Henri-Jean Martin.49 Neuere Buchhandelsgeschichten wie The Cambridge History of the Book in Britain50 oder die Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert51
stützen sich auf Ergebnisse vielfältiger, statistisch erzielter Aussagen. Der methodische Zugriff beschränkt sich meist auf einfache Analyseverfah
ren deskriptiver Statistik, die quantitativ ausgewertet werden. Ein grundlegendes Problem historischer Statistik ist die Qualität der verfügbaren Daten. Nicht selten ist unklar, wie die Aufzeichnungen zustande kamen und was genau diese erfassen.52
Zudem sind verwertbare Quellen umso seltener und weniger verlässlich, je weiter sie in die Geschichte zurückreichen. In jedem Fall muss einer statistischen Auswertung eine sorgfältige Beurteilung dessen vorausgehen, welche Fragen an die Datenbasis überhaupt gestellt werden können. Für die deutsche Buchhandelsgeschichte hat Horst Meyer 1987 dies an einem berüchtigten, gleichwohl prominenten Beispieldeutlich gemacht: die statistisch-geografische Auswertung der Frankfurter und Leipziger „Meßkataloge" 1564-1846 durch Gustav Schwetschke.53 Die Messkataloge werden als Ersatz für fehlende nationalbibliografische Quellen herangezogen, allerdings verzeichnen sie die halbjährliche, auf den Messen gehandelte Buchproduktion nur sehr lückenhaft und eignen sich nicht für allgemeine Aussagen zur Buchproduktion. Dennoch sind Schwetschkes Ergebnisse in jüngere buchhandelsgeschichtliche Arbeiten übernommen werden, teils verschlimmert durch mangelnde Beherrschung der statistischen Interpretation.54
48 London: The Bibliographical Society 1926ff. 49 Febvre u. Martin 1958. SO Bd.1-6. Cambridge: Cambridge Univ. Press 1999-2009. 51 Berlin [u.a.]: De Gruyter 200lff.; vgl. bes. Kastner 2003 u. Kastner 2007. 52 Weedon 2009: 39. 53 Codex nundinarius Germaniae literarae bisecularis. Halle 1850-18n. 54 Meyer 1987: 206 u. 212.
478 - Rautenberg
Mit den großangelegten Katalogisierungsprojekten retrospektiver Nationalbibliografien für das 16., 17. und 18. Jahrhundert (VD 1655, VD 1?6 , VD 1857) sowie dem (Welt-) Gesamtverzeichnis der Inkunabeln (ISTC58, USTC59) ist eine einigermaßen sichere Basis für weit reichende Gesamt- und Teilanalysen der deutschen Buchproduktion gelegt, die zudem die elektronischen Recherchemöglichkeiten nutzen können. Allerdings bedarf es auch hier einer sorgfältigen Beachtung der jeweiligen Entstehungskontexte und der Erhebungsgrundlage der Gesamtverzeichnisse sowie der Aufzeichnung und Erschließung der bibliografischen Einträge. Jürgen Beyer hat für das VD 16 und VD 17 die Probleme am Beispiel der dort erfassten Produktion von Lübecker und Rigaer Druckern gezeigt. Nach seinen Schätzungen enthalten die beiden Bibliografien nur rund zwei Drittel der erhaltenen Ausgaben, da Buchbestände in Archiven ausländischer Bibliotheken nicht berücksichtigt sind, zudem verzeichnet das VD 16 keine Einblattdrucke.60
Eine Kombination quantitativ-statistischer Erhebungen mit qualitativen Vergleichsuntersuchungen hat ein Forschungsprojekt zur Entstehung und Entwicklung des frühen Buchtitelblatts gewählt.61 Für die quantitative Übersicht wurde auf der Basis einer großen Stichprobe von zehn Bänden des GW, ergänzt durch weitere Bibliografien, hochgerechnet, wie viele Inkunabeln ein Titelblatt haben. Für drei Fallstudien zu Oberzentren des Buchdrucks (Augsburg, Köln, Nürnberg) wurden umfassende Korpora u.a. auf der Grundlage autoptischer Einzelanalysen von Drucken gebildet und mit statistischen Methoden strukturiert und ausgewertet. Angestrebt wurde keine Stichprobenanalyse, sondern eine qualitative Vollerfassung, deren Ergebnisse gegenüber Stichprobenerhebungen allgemeine Gültigkeit beanspruchen können.
Die umfangreiche Studie von Uwe Neddermeyer Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse im Mittelalter und in der frühen Neuzeit beruht größtenteils auf Methoden quantitativer Statistik, ergänzt durch Hochrechnungen. 62 Bereits die umfassende Gegenstandsformulierung deutet die Schwierigkeit präziser Hypothesenbildung an. Schriftlichkeit wird definiert über die Gesamtzahl von Drucken bzw. Handschriften und einem Leseinteresse zugeordnet. Die Ergebnisse weitgehend deskriptiver Statistik beruhen auf einer stark variierenden, inhomogenen
55 Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des 16. Jahrhunderts. www. vd16.de (23.10.2012). 56 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts. www.vd17. de/(23.20.2012). 57 Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 18. Jahrhunderts. http:// vd18.de/(23.10.2012). 58 Incunabula Short Title Catalogue. www.bl.uk/catalogues/istc/(23.10.2012). 59 Universal Short Title Catalogue. www.ustc.ac.uk/(23.10.2012). 60 Beyer 2011. 61 Rautenberg 2008: bes. 18-22. 62 Neddermeyer 1998: bes. 47-162 Methodik.
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 479
Quellenbasis (u.a. zahlreiche moderne und historische Bibliothekskataloge, unterschiedliche historische Quellen). Neddermeyer arbeitet mit absoluten Zahlenwerten zur Manuskript- und Buchproduktion, von denen ausgehend er Buchverfügbarkeit, Publikum und Leseinteresse beschreibt. Die nötigen Schätzungen der mittelalterlichen Manuskriptproduktion sowie der Auflagenhöhe der Inkunabelausgaben beruhen auf Hochrechnungen mit geschätzten Verlustraten, wobei die zugrunde liegenden Faktoren nach hypothetischen Annahmen bestimmt werden.63
Eine neue Studie The Shape of Incunable Survival and Statistical Estimation of Lost Editions64 nutzt Methoden der analytischen Statistik. Die Ausgangsfrage ist, wie viele Inkunabelausgaben nicht bekannt sind, weil kein einziges Exemplar in modernen Katalogen verzeichnet ist. Die Autoren gehen zunächst von den bekannten Ausgaben und den jeweils erhaltenen Exemplarzahlen aus. Eine Auswertung des ISTC zeigt, dass ein sehr großer Teil der verzeichneten Ausgaben nur in sehr wenigen oder in einem Exemplar erhalten ist, was auf eine hohe Verlustrate von mehreren Tausend (unbekannten) Ausgaben schließen lässt. Um diese genauer zu quantifizieren, nutzen die Autoren die negative Binomialverteilung aus der Wahrscheinlichkeitstheorie. Das Modell passt am besten zu den beobachteten Daten und legt nahe, dass ungefähr so viele oder sogar mehr Ausgaben verschollen sind erhalten (ca. 29.000). Zum Vergleich: Neddermeyer geht von einer ca. 5 o/oigen Verlustrate aus. Die neuen Berechnungen Greens [u.a.] haben weit reichende Konsequenzen für die bisher üblichen Annahmen über die Produktion der frühen Druckwerkstätten, die Aufnahmekapazität des Buchmarkts und die Nachfrage der Leser. In Frage zu stellen wäre auch die These, dass erst die Reformation dem Buchdruck zur massenmedialen Kommunikationstechnik verholfen habe.
Die Nutzung komplexer statistischer Methoden für die geisteswissenschaftliche historische Buchforschung ist zurzeit noch die Ausnahme; diese werden aber in der modernen Buchmarktforschung und der Medienökonomie sowie der empirischen Lese- und Leserforschung65 eingesetzt.
63 Görz u. Rautenberg 2001. 64 Green [u.a.) 2011. 65 Siehe den Beitrag Methoden der modernen Lese- und Leserforschung von S. Rühr, M. Mahling u. A. Kuhn in diesem Band.
480 - Rautenberg
9 Ausblick
Der Überblick zeigt, dass die hier vorgestellten Methoden historischer Buchforschung und ihre Anwendung in den letzten Jahrzehnten von der Digitalisierung von Altbeständen66 erheblich profitieren konnten. Die digitale Bereitstellung von Handschriften und Drucken über großangelegte Digitalisierungsprojekte macht die Autopsie des Originals zwar nicht in allen Fällen überflüssig, stellt aber eine bisher nicht gekannte, leicht zugängliche Fülle von Vergleichsmaterial bereit. Aber auch hier ist die Validität der Ergebnisse abhängig von der qualitativen Erschließung der Digitalisate und den ihnen zugeordneten Metadaten. Die elektronische Erschließung von Katalogen und Verzeichnissen, nicht zuletzt der Nationalbibliografien, hat die Datenbasis für quantitative Fragen erheblich verbessert und ermöglicht unterschiedliche Suchanfragen. Diese Instrumente werden zukünftig die Formulierung von Problemstellungen und die Methoden ihrer Bearbeitung verändern.
10 Literatur- und Quellenverzeichnis
Amelung, P.: Methoden zur Bestimmung und Datierung unfirmierter Inkunabeln. In: Buch und Text
im 15. Jahrhundert. Hrsg. von L. Hellinga u. H. Härte!. Hamburg: Hauswedell 1981. 5. 89-129.
Beyer, J.: How Complete are the German National Bibliographies for the 5ixteenth and 5eventeenth
Centuries. In: The Book Triumphant. Print in Transition in the 5ixteenth and 5eventeenth
Centuries. Hrsg. von M. Walsby u. G. Kemp. Leiden [u.a.): Brill 2011. 5. 57-77.
Boghardt, M.: Analytische Druckforschung. Ein methodischer Beitrag zu Buchkunde und Textkritik.
Hamburg: Hauswedell 1977.
Boghardt, M.: Archäologie des gedruckten Buches. Hrsg. von P. Needham in Verb. mit J. Boghardt.
Wiesbaden: Harrassowitz 2008.
Bolton, C.: Links Between a Fifteenth-Century Printer and a Binder. ln: Early Printed Books as
Material Objects. Hrsg. von B. Wagner u. M. Reed. Berlin [u.a.): De Gruyter 5aur 2010.
5.177-189.
Bowers, F.: Principles of Bibliographical Description. Repr. [der Ausg. 1949). Princeton: Univ. Press
1994.
Duntze, 0.: Ein Verleger sucht sein Publikum. Die 5traßburger Offizin des Matthias Hupfuff
1497 /98-1520. München: 5aur 2007.
Fabian, C. u. K. Kuttner: Die Zukunft der Herkunft. Provenienzen als Herausforderung der
Bibliotheken. In: Bibliotheksforum Bayern 5 (2011) 2. 5.112-115. www.bibliotheksforum-bayern.
de/index.php?id=105 (23.10.2012).
Febvre, L. u. H.-J. Martin: L'apparition du livre. Paris: Michel 1958. [Neuaufl. 1999 (Bibliotheque de
!'Evolution de l'Humanite 33)).
Ford, M. L.: lmportation of Books into England and 5cotland. In: The Cambridge History of the Book
in Britain. Cambridge: Univ. Press 1999. Bd. 3: 1400-1557, 5.179-201.
66 U.a. Verteilte Digitale Inkunabelbibliothek, http://inkunabeln.ub.uni-koeln.de (23.10.2012); Wol·
fenbütteler Digitale Bibliothek, www.hab.de/bibliothek/wdb (23.10.2012).
Methoden der buchwissenschaftlichen Forschung - 481
Fujii, A.: Günther Zainers druckersprachliche Leistung. Untersuchungen zur Augsburger
Druckersprache im 15. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer 2007.
Gaskeil, P.: A New lntroduction to Bibliography. New Castle: Oak Knoll 1995.
Görz, G. u. U. Rautenberg: Medienwechsel bibliometrisch. In: IASL online (2001) 5/6. S.1. wwwdh.
i nfo rmati k. uni-erlangen .de/ IMM DB/ staff f Goerz/ nedderm. pdf (15.11. 2012).
Green, J.: Marginalien und Leserforschung. Zur Rezeption der „Sehedelsehen Weltchronik". In:
Archiv für Geschichte des Buchwesens 60 (2006). S.184-261.
Green, J., F. Mclntyre u. P. Needham: The Shape of lncunable Survival and Statistical Estimation of
Lost Editions. In: Papers ofthe Bibliographical Society of America 105/2 (2011). S.141-175.
Hellinga, L.: Analytical Bibliography and the Study of Early Printed Books with a Case-Study of the
Mainz Catholicon. In: Gutenberg-Jahrbuch 64 (1989). S. 47-96.
Juchhoff, R.: Aus der Werkstatt der Frühdruckforschung. ln: Libris et Litteris. Festschrift Hermann
Tiemann. Hamburg: Maximilian-Ges.1959. S.119-129.
Kastner, B.: Statistik und Topographie des Verlagswesens. In: Geschichte des deutschen
Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von G. Jäger. Bd.1: Das Kaiserreich 1871-1918,
T. 2. Frankfurt am Main: MVB 2003. S. 300-367.
Kastner, B.: Statistik und Topographie des Verlagswesens. In: Geschichte des deutschen
Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert. Hrsg. von E. Fischer [u.a.). Bd. 2: Die Weimarer
Republik 1918-1933, T. 1. München: Saur 2007. S. 341-378.
Klosterberg, B.: Zur Rekonstruktion frühneuzeitlicher Privatbibliotheken in der Bibliothek der
Franckeschen Stiftungen. In: Archiv für Geschichte des Buchwesens 67 (2012). S.108-124.
Künast, H.-J.: Günther Zainers druckersprachliche Leistung [Rezension). In: Archiv für Geschichte des
Buchwesens 65 (2010). S. 232-235.
Löffler, K. u. W. Milde: Einführung in die Handschriftenkunde. Stuttgart: Hiersemann 1997.
Mäkeler, H.: Das Rechnungsbuch des Speyerer Druckherrn Peter Drach d. M. um 1450-1504.
St. Katharinen: Scripa Mercaturae 2005.
Meyer, H.: Buchhandel. In: Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland.
Hrsg. von W. Arnold, W. Dittrich u. B. Zeller. Wiesbaden: Harrassowitz 1987. S.189-260.
Neddermeyer, U.: Von der Handschrift zum gedruckten Buch. Schriftlichkeit und Leseinteresse in der
frühen Neuzeit. Quantitative und qualitative Aspekte. Bd.1-2. Wiesbaden: Harrrassowitz 1998.
Needham, P.: Bibliographical Evidence from Paper Stocks of English lncunabula. In: Buch und Text
im 15. Jahrhundert. Hrsg. von L. Hellinga u. H. Härtel. Hamburg: Hauswedell 1981. S. 79-87.
Needham, P.: Copy-specifics in the Printing Shop. In: Early Printed Books as Material Objects. Hrsg.
von B. Wagner u. M. Reed. Berlin [u.a.]: De Gruyter Saur 2010. S. 9-20.
Neuheuser, H. P., V. Märgner u. P. Meinlschmidt: Wasserzeichendarstellung mit Hilfe der
Thermographie. In: ABI-Technik 25 (2005) 4. S. 266-278.
Ohly, K.: Die Proctor-Haeblersche Methode und der Versuch ihrer Widerlegung. Vortrag bei der
Wiegendruck-Gesellschaft am 5. Oktober 1930 in Stuttgart. Berlin: Wiegendruck-Ges.1931.
Rautenberg, U.: Die Entstehung und Entwicklung des Buchtitelblatts in der lnkunabelzeit in
Deutschland, Venedig und den Niederlanden. Quantitative und qualitative Studien. In: Archiv
für Geschichte des Buchwesens 62 (2008). S.1-105.
Rautenberg, U.: Buchwissenschaft in Deutschland. Einführung und kritische Auseinandersetzung.
In: Buchwissenschaft in Deutschland. Ein Handbuch. Hrsg. von U. Rautenberg. Berlin [u.a.): De
Gruyter Saur 2010. Bd. l, S. 3-64.
Sack, V.: Über Verlegereinbände und Buchhandel Peter Schöffers. In: Archiv für Geschichte des
Buchwesens 23 (1973). Sp. 249-288.
Saxer, U.: Buchwissenschaft als Medienwissenschaft. In: Buchwissenschaft in Deutschland. Ein
Handbuch. Hrsg. von U. Rautenberg. Berlin [u.a.]: De Gruyter Saur 2010. Bd.1, S. 65-104.
482 - Rautenberg
Scheibe, M.: The "Biography of Copies". Provenance Description in Online Catalogues. In: Early
Printed Books as Material Objects. Hrsg. von B. Wagner u. M. Reed. Berlin [u.a.]: De Gruyter
Saur2010.S.269-303.
Schmidt-Künsemüller, A.: Hundert Jahre Einbandforschung. Eine auswählende Retrospektive. In:
Die Erforschung der Buch- und Bibliotheksgeschichte in Deutschland. Hrsg. von W. Arnold,
W. Dittrich u. B. Zeller. Wiesbaden: Harrassowitz 1987. S.156-166.
Tschudin, P. F.: Grundzüge der Papiergeschichte. Stuttgart: Hiersemann 2002.
Weedon, A.: The Uses of Quantifications. In: A Companion to the History ofthe Book. Hrsg. von
S. Eliot u. J. Rose. Chichester: Wiley-Blackwell 2009 (Blackwell Companions to Literature and
Culture 48). S. 33-47.