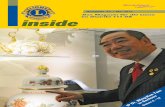Bewertung von Innovationen in der klinischen Forschung: Stärken und Verbesserungspotenziale des...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Bewertung von Innovationen in der klinischen Forschung: Stärken und Verbesserungspotenziale des...
Available online at www.sciencedirect.com
Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ) 104 (2010) 738–743
Schwerpunkt
Bewertung von Innovationen in derklinischen Forschung: Stärken undVerbesserungspotenziale desForschungsstandortes DeutschlandHorst Christian Vollmar1,2, Peter Georgieff1, Bernhard Bührlen1,∗
1Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung (ISI), Karlsruhe2Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE), Standort Witten
ZusammenfassungDie klinische Forschung ist ein zentrales Glied in der Entwicklungsketteneuer Therapiemethoden. Wissenschaftlich steht sie zwischen Grundlagen-und Versorgungsforschung, sie umfasst die erste Anwendung eines Wirk-stoffs am Menschen sowie die wichtigsten Nachweise seiner Wirksam-keit und Sicherheit. Ökonomisch erfordert sie ca. die Hälfte des Ge-samtaufwands für Forschung und Entwicklung eines Arzneimittels undbedeutet einen nicht unerheblichen Faktor für den Arbeitsmarkt. KlinischeStudien erlauben es Patienten, durch die Teilnahme frühzeitig Zugang zuneuen Behandlungsmethoden zu erhalten, setzen sie jedoch auch einemerhöhten Risiko aus. Die Politik hat wichtige Schritte unternommen, umdie klinische Forschung in Deutschland zu stärken, die Industrie beklagtjedoch weiterhin Wettbewerbsnachteile am Standort Deutschland. Trotz
international anerkannter und weitgehend gesetzlich kodifizierter Richt-linien bestehen national deutliche Unterschiede in deren Umsetzung. Dietraditionellen Verfahrensweisen in der klinischen Forschung werden zu-sätzlich durch neuartige, meist biotechnologische Therapiemethoden in-frage gestellt, zu denen das existierende Wissen noch relativ gering ist unddie deshalb besondere Risiken für Patienten und Studienteilnehmer ber-gen können. Der vorliegende Beitrag fasst einen Bericht für das Büro fürTechnikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag (TAB) zusammen.Auf der Basis der geltenden Regulierung, der wissenschaftlichen Litera-tur und Experteninterviews werden die aktuellen Herausforderungen undLösungsansätze für die klinische Forschung im internationalen Vergleichanalysiert.
Schlüsselwörter: Biomedizinische Innovationen, klinische Studien, Regulierung, internationaler Vergleich, translationale Forschung, Versorgungsforschung
Assessment of innovations in clinical research: Strengths and potentials for improvemento
SCm
7
f research in Germany
ummarylinical research is a central link in the developmentent methods; scientifically, it belongs between bas
∗Korrespondenzadresse. Dr. Bernhard Bührlen, FraunhofeE-Mail: sekretariat [email protected]: http://www.isi.fraunhofer.de/t.
38
chain of new treat-ic science and health
services research. It spansor device in humans to
r Institut für System- und Innovationforschung (ISI), Breslau
Z. Evid. Fo
from the first application of a new substancethe main proofs of its efficacy and safety.
er Str. 48 76139 Karlsruhe. Tel.: +0721-6809-189.
rtbild. Qual. Gesundh. wesen (ZEFQ)doi:10.1016/j.zefq.2010.10.001
Economically speaking, it absorbs almost half of the total expendituresfor the research and development of a new drug and represents a signi-ficant factor in the labour market for researchers and study personnel.Also, through participation in clinical trials, patients gain early access tonew treatment methods, while on the other hand they are placed at high-er risk for undesired side effects. Politics have taken significant steps tostrengthen clinical research, but the pharmaceutical industry continues tocomplain about competitive disadvantages. Despite internationally recog-nised and, to a large extent, legally codified guidelines there are still
significant national differences in implementation. In addition, traditionalpractices in clinical research are challenged by novel, mainly biotechnolo-gical therapeutic methods for which our current knowledge base is ratherlimited and which therefore entail a higher risk for patients or trial parti-cipants. The following paper summarises a report for the Office of Tech-nology Assessment at the German Federal Parliament (TAB). Based on cur-rent regulations, scientific literature and expert interviews, current challen-ges and solution strategies for clinical research will be analysed in terms ofan international comparison.
K ls, regulation, international comparison, translational research, health services research
EHkDDlAtAsMwVsreaTwlUtcdevstsuEttkswS,atilhw
Tabelle 1. Phasen klinischer Studien.
Phase Zweck und Vorgehen
I Eine neue Intervention wird in einer kleinen Gruppe (z. B. 20–80 Personen) vongesunden Probanden zum ersten Mal eingesetzt, um ihre Sicherheit zu bewerten(z. B. um den sicheren Dosierungsbereich zu ermitteln und Nebenwirkungen zuidentifizieren).
II Die biomedizinische oder Verhaltensintervention wird in einer größeren Gruppe vonPatienten (bis zu mehreren Hundert Personen) eingesetzt, um ihre Wirksamkeit zubestimmen und die Sicherheit weiter zu evaluieren.
III Die Studien untersuchen die Wirksamkeit der biomedizinischen oderVerhaltensintervention in großen Gruppen von Patienten (zwischen mehrerenHundert bis mehreren Tausend Personen), indem die Intervention mit anderenStandard- oder experimentellen Interventionen verglichen wird, auch umunerwünschte Wirkungen zu analysieren und Informationen für den sicherenGebrauch der Intervention zu sammeln.
IV Diese Studien werden durchgeführt, nachdem die Intervention auf den Marktgekommen ist. Sie bezwecken, die Wirksamkeit der zugelassenen Intervention in derRoutineversorgung zu beobachten und Informationen über Nebenwirkungen zusammeln, die sich aus dem breiten Gebrauch ergeben. Hierunter fallen z. B. die oben
chtu
uTAk[
MV
KdSiTSosgw
ey words: biomedical innovations, clinical tria
inleitung: Aktuelleerausforderungenlinischer Forschung ineutschlandie klinische Forschung ist ein zentra-
er Bestandteil der Entwicklung neuerrzneimittel und anderer Therapieme-
hoden. Sie macht etwa die Hälfte desufwands an Zeit und Kosten der For-chung und Entwicklung eines neuenedikaments aus und ist deshalb so-ohl für die Industrie als auch für dieersorgung von großer Bedeutung. Sietellt zudem die ,,externe Evidenz‘‘ be-eit, die seit David Sackett als ein Grund-lement der evidenzbasierten Medizinngesehen wird [8].rotz international anerkannter undeitgehend gesetzlich geregelter Richt-
inien bestehen international deutlichenterschiede in deren Umsetzung. Zen-
rale Aspekte, die u. a. die Veröffentli-hung von Studienergebnissen, Anfor-erungen an die Sicherheit der Studi-npatienten oder die Zusammenarbeiton öffentlicher und industrieller For-chung betreffen, sind zwischen Indus-rie, akademischer Forschung, Gesell-chaft und Gesundheitspolitik teilweisemstritten. Die Politik hat u. a. mit derinrichtung der Koordinierungszen-ren für klinische Studien (KKS) wich-ige Schritte unternommen, um dielinische Forschung in Deutschland zutärken, die Industrie beklagt jedocheiterhin Wettbewerbsnachteile amtandort Deutschland. Zudem ist ein,Abwandern‘‘ der klinischen Forschungus Deutschland in dem Sinn zu kons-atieren, dass die klinische Forschung
n einigen anderen Ländern in denetzten Jahren stärker zugenommenat als in Deutschland, welches Aus-irkungen auf die Beschäftigung vonZ. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (www.elsevier.de/zefq
beschriebenen Anwendungsbeoba
Quelle: WHO; Schwarz 2005 [11,13].
Forschern und Studienpersonal sowieauf die Versorgung der Patienten mitneuen Medikamenten haben könnte.Neben den klassischen Arzneimittel-wirkstoffen, den sogenannten ,,kleinenMolekülen‘‘, gewinnen neuartige, aufBiotechnologie basierende Therapie-verfahren immer mehr an Bedeutungfür Wirtschaft und Krankenversorgung.Genannt seien hier z. B. Biopharma-zeutika und Biosimilars, therapeutischeAntikörper, Gen- und Zelltherapie bzw.regenerative Medizin, Tissue Enginee-ring sowie nanoskalige Medikamen-tentransporter. Durch ihre neuen Wir-kungsweisen können diese Therapie-verfahren teils neuartige Risiken undHerausforderungen mit sich bringen.Aus diesem Grund führte dasFraunhofer-Institut für System- und In-
novationsforschung (ISI) eine Studie fürden Deutschen Bundestag durch, wel-che die Bedingungen der klinische For-schung in Deutschland im AllgemeinenwdFl
ZEFQ) 104 (2010) 738–743
ngen (AWB) oder auch Registerstudien.
nd im Hinblick auf die neuartigenherapieverfahren untersuchen undnsätze für die Weiterentwicklung derlinischen Forschung entwickeln sollte1].
ethodisches Vorgehenerwendete Definition
linische Studien der Phasen I bis III,ie klinische Forschung im engereninn, stellen ein wichtiges Bindegliedm Prozess der Generierung und desransfers neuen Wissens dar (Tab. 1).chrappe und Scriba ergänzten die Ein-rdnung der klinischen Forschung, wieie durch die Deutsche Forschungs-emeinschaft im Jahre 1999 definierturde, und entwickelten das Konzept
eiter [2,10]. Klinische Forschung wirdabei präzisiert als ,,klinisch-evaluativeorschung‘‘, welche zwischen Grund-agen- bzw. translationaler und739
Innovations-transfer
Problem/ Fragestellung
Patientenversorgung im Alltag(Klinik/Praxis)
Krankheits-orientiert-
translationaleForschung
Grundlagen-forschung
Klinisch-evaluativeForschung
Versorgungs-forschung
AQ
V(GEdwdmpwfdFuteg
L
UleDDvvzVnGtkiZdiuvsa
nÜcrlrsw
E
ZwtlnbmIEdEb
AB
Dtk2asbvs
7
bb. 1. Verortung der klinischen Forschunguelle: Schrappe und Scriba [10].
ersorgungsforschung angesiedelt istAbb. 1). Die klinische Forschung alsenerierung von wissenschaftlichervidenz kann also nicht getrennt voner Nutzung dieser Evidenz betrachteterden. Dieses neue Forschungspara-igma findet sich auch in der Road-ap für das Gesundheitsforschungs-rogramm der Bundesregierungieder [4]. Entsprechend der unschar-
en Definition, welche Dimensionenes Innovationsprozesses zur klinischenorschung gezählt werden müssen,nd der Notwendigkeit, auch unerwar-ete Aspekte zu identifizieren, wurdein gemischter methodischer Ansatzewählt.
iteraturrecherche
m die aktuelle Situation und die re-evanten Bereiche erfassen zu können,rfolgte eine umfangreiche Literatur-,okumenten- und Datenbankanalyse.ie Literatur diente zur Erfassungon Problembereichen und Lösungs-orschlägen sowie dazu, Vergleichewischen Deutschland und wichtigenergleichsländern vornehmen zu kön-en, insbesondere im Hinblick aufood-Practice-Ansätze. Weiterhin soll-
en relevante Akteure der (nicht-ommerziellen) klinischen Forschungn Deutschland und Daten über dieahl nichtkommerzieller klinischer Stu-ien ermittelt werden. Zunächst wurde
n den Datenbanken Pubmed/Medline
nd Embase sowie im Internet mit Hilfeon Google (Scholar) und Metager ge-ucht, wobei der Terminus ,,clinical tri-ls‘‘ mit weiteren Suchbegriffen kombi-Oiws
40
iert wurde. Der Schwerpunkt lag aufbersichtsarbeiten und Länderverglei-hen. Um ein umfassendes Bild zu er-eichen, wurden zudem Internetquel-en und Berichte (,,graue Literatur‘‘) be-ücksichtigt. Weiterhin wurden stati-tische Datenquellen verwendet (z.B.ww.clinicaltrials.gov).
xpertenbefragung
ur Ergänzung der Literaturanalyseurden 18 leitfadengestützte Exper-
eninterviews mit Vertretern aus Regu-ierungsbehörden, öffentlicher und kli-ischer Auftragsforschung, Patienten-zw. Verbraucherschutzverbänden,edizinischen Fachverbänden und der
ndustrie geführt. Bei der Auswahl derxpertinnen und Experten wurde aucheren internationale Erfahrung undinbindung in die Patientenversorgungerücksichtigt.
bschlussworkshop zurewertung der Ergebnisse
ie Ergebnisse wurden auf einem in-erdisziplinären Expertenworkshop dis-utiert und validiert, der im November008 stattfand. Die Zwischenergebnisseus Literatur– und Dokumentenanaly-en sowie aus der empirischen Erhe-ung wurden präsentiert. Im Konsens-erfahren wurden besonders bedeut-ame Ergebnisse ausgewählt und dazu
ptimierungsvorschläge formuliert. Diem Folgenden berichteten Ergebnisseurden auf diesem Workshop als be-
onders relevant identifiziert.
Z. Evid. Fortbild. Qual.
Ergebnisse
Die klinische Forschung in Deutsch-land ist in den letzten Jahren durcheine große Zahl gezielter Maßnahmenseitens der Politik gefördert worden,sodass die Infrastruktur in Deutsch-land (KKS, Exzellenzzentren, Kompe-tenznetze etc.) als gut zu bezeichnenist, auch wenn die Aufwendungen ins-besondere in den USA dafür wesentlichhöher sind. Ein gemeinsames Förderpro-gramm von DFG und BMBF zur Unter-stützung von Projekten der klinischenForschung wurde seitens der befragtenExperten positiv konnotiert, die Förder-volumina reichten aber bei weitem nichtaus.Die Fördermaßnahmen haben zu Ver-besserungen der Rahmenbedingungen,der Infrastruktur, der Qualität und zu ei-ner Erhöhung der Studienaktivitäten ge-führt, sodass Deutschland jetzt im inter-nationalen Vergleich auf einem ange-messenen Niveau agieren kann.
Rahmenbedingungen klinischerForschung in Deutschland
Die klinische Forschung in Deutschlandhat – im Vergleich mit anderen euro-päischen Ländern – von der Einführungder GCP-Richtlinie 2001/20/EG eherprofitiert, weil Deutschland in der Lagewar und ist, die hohen Anforderungenzu erfüllen, während andere Länder mitschlechteren Ausgangspositionen anBoden verloren haben. Die Umsetzungin nationales Recht wird generell alsgünstiger als im europäischen Auslandbetrachtet. Es wird allerdings nicht nurin Deutschland, sondern internationaldiskutiert, inwiefern die hohen Anfor-derungen Studien verhindern, die we-niger stark reguliert sein müssten, dasie ein geringeres Risiko für Probandenoder für die öffentliche Gesundheit auf-weisen. Hinsichtlich der deutschen Be-hörden wird kritisiert, dass die Erlaubnisfür die Herstellung der Substanzen überunterschiedliche Bundesländer und aufeine größere Zahl von Gebietskörper-schaften verteilt ist. Diese stellen teil-
weise noch zu heterogene Anforderun-gen, was den Aufwand für die Spon-soren erhöht. Darüber hinaus kann dasBundesamt für Strahlenschutz (BfS) we-Gesundh. wesen 104 (2010) 738–743www.elsevier.de/zefq
gtzswbunEdssegsvd
Qki
IBidrbV(nEzwj1dtnd2dtLdnbgnlatJsJd
io. Euf w
vSfsPz
P
IntwzwRdaVgRPdvIdtZfdtAw
en einer zu geringen Personalausstat-ung klinische Studien oft nur mit Ver-ögerung bewerten. Die Ethikkommis-ionen in multizentrischen Studien be-erten – trotz bereits verbesserter Ar-eitsteilung zwischen federführendernd weiteren Kommissionen – teilweiseoch Punkte im Studienplan, die ausffizienzgründen nur der federführen-en Ethikkommission vorbehalten seinollten. Der Arbeitskreis der medizini-chen Ethikkommissionen arbeitet aniner Vereinheitlichung der arbeitsteili-en Praxis so, wie sie im AMG vorge-ehen ist, im Moment schränken aberermeidbare Verzögerungen im Ablaufie Attraktivität des Standorts noch ein.
uantitative Entwicklunglinischer Forschung imnternationalen Vergleich
m allgemeinen Verständnis steigt deredarf nach klinischer Forschung, da
mmer mehr Substanzen geprüft wer-en müssen, um ein neues Präpa-at erfolgreich auf den Markt zuekommen, und da Strategien zurorauswahl mittels Computeranalysen,,In-silico-Strategien‘‘) sich bisher alsicht sehr erfolgreich erwiesen haben.ine generelle Steigerung der Studien-ahlen ist also zu erwarten. Die Ent-icklung der klinischen Forschung muss
edoch nach den Studienphasen (Tab.) getrennt betrachtet werden. Wegenes großen Aufwands und der Bedeu-ung für die Marktzulassung neuer Arz-eimittel kommt der Phase III beson-ere Bedeutung zu. Zwischen 1995 und005 war in Deutschland ein Anstieger präklinischen Forschung in absolu-en Zahlen und im Vergleich zu anderenändern zu beobachten, gleichzeitig je-och nur eine geringe Zunahme der kli-ischen Forschung (Phasen I bis III), wo-ei hier der relative Anteil Deutschlandsegenüber anderen Ländern sogar ab-ahm [3,5]. In der klinischen Entwick-
ung (Phasen I bis III) spielte Deutschlandls Standort somit eine weniger wich-ige Rolle (Platz 4 nach USA, UK und
apan) als in der präklinischen For-chung (Platz 3 nach USA und UK).e nach Indikationsgebiet schwankteer Anteil Deutschlands 2004/2005 imZ. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (www.elsevier.de/zefq
Abb. 2. Anzahl aktiver klinischer Studien pro. MQuelle: eigene Darstellung nach [14], basierend a
Bereich der klinischen Phasen I bis IIIzwischen 5,3 % (Atmungssystem) und10,7 % (Haut und Unterhaut) [6]. NachZahlen der EudraCT-Datenbank, in derbei der EMEA alle in der EU ange-meldeten klinischen Studien registriertwerden, hat Deutschland nach einemWachstum in den Jahren 2004 bis 2006im Jahr 2007 mehr klinische Studien an-gemeldet als Großbritannien [12]. EineAnalyse der (US-amerikanischen) Da-tenbank ,,clinicaltrials.gov‘‘ zeigte eben-falls eine Zunahme Bild (Abb. 2).
Standortfaktoren
Die aufstrebenden Wettbewerber wieChina, Indien und einige osteuropäi-sche Länder verfügen über bestimmteStandortvorteile, insbesondere gerin-gere Kosten und die Verfügbarkeit ei-ner großen Zahl von potenziellen Pro-banden. Eine Verlagerung klinischer For-schung in Schwellenländer (v. a. nachOsteuropa, China, Indien, aber auchnach Afrika) findet zwar statt, allerdingsnur in begrenztem Umfang. Ein we-sentlicher Teil der klinischen Forschungwird aus vielen Gründen auch künf-tig in Deutschland bleiben: Es müs-sen Daten erhoben werden, die fürdie deutsche Bevölkerung repräsenta-tiv sind, um einen Zugang zum deut-
schen Markt zu erhalten. Die Qualitätder Studien in Deutschland ist hoch,die Daten sind zuverlässig, währendDaten aus Schwellenländern teils nichttcFn
ZEFQ) 104 (2010) 738–743
inwohnerww.clinicaltrials.gov (Stand: 12.4.2007).
ertraut wird. Die hohen deutschentandards machen die Durchführungür den Sponsor gut planbar. Zudemind sie für die Industrie hilfreich, um dasrodukt frühzeitig im Zielmarkt bekanntu machen (Abb. 3).
atientensicherheit
n klinischen Studien werden die Teil-ehmer/Probanden engmaschig kon-rolliert, um auf diese Weise uner-ünschte Ereignisse rasch identifizieren
u können. Die befragten Experten be-erteten die existierenden deutschenegulierungen zum Schutz von Proban-en in klinischen Studien überwiegendls positiv, insbesondere da es strengeorgaben für die Einwilligungsfähigkeitebe und der Datenschutz heute in deregel gewährleistet sei. Teilweise sei dieatientenbetreuung innerhalb von Stu-ien besser als die reguläre Patienten-ersorgung.n der klinischen Forschung gewinnenie neuartigen biologischen Arzneimit-el an Bedeutung. Tabelle 2 weist dieahl der Anträge auf klinische Prü-ung seit August 2004 (Inkrafttretener 12. AMG-Novelle) aus. Die bei Wei-em größte Gruppe bilden monoklonalentikörper. Die befragten Experten be-erteten die in Deutschland kodifizier-
en Regularien als mittlerweile hinrei-hend für neuartige Arzneistoffe. Derall des Wirkstoffs TGN1412, der in ei-er Studie der Phase I bei den Proban-
741
Abb. 3. Wachstumsrate klinischer Studien in ausgewählten LändernQ auf w
dstfdmdghPStkpL
DDdlarradtaW
7
uelle: eigene Darstellung nach [14], basierend
en schwere Nebenwirkungen auslö-te, hatte zur Folge, dass die interna-ionalen Regulierungsbehörden die An-orderungen an Medikamentenkandi-aten mit unbekanntem Wirkmechanis-us deutlich erhöhten [9]. Zudem wur-en auf europäischer Ebene eigene Re-eln für Wirkstoffkandidaten mit ho-em Risiko eingeführt. Das deutscheaul-Ehrlich-Institut ging noch einenchritt weiter, definierte spezifische Kri-erien für die Beurteilung von mono-lonalen Antikörpern und rief eine Ex-ertengruppe zu deren Bewertung inseben [9].
Tabelle 2. Anträge auf klinische Prüfungvon Biologika zwischen 2004 und 2008 beimPaul-Ehrlich-Institut.
Produktgruppe AnzahlAnträge
monoklonale Antikörper 415Impfstoffe 144Allergene 65somatische Zelltherapeutika 36Tumorimpfstoffe/Peptide 33Gerinnungsfaktoren 31Gentransferarzneimittel/GVO 27Immunglobuline, normal 17Blutzubereitungen 14Immunglobuline, spezifisch 4Serum, polyklonal 1gesamt 787
Quelle: Paul-Ehrlich-Institut, August 2004 bis 1.Januar 2009 (kumuliert) [7].
L
Dn
•
•
•
Literatur
42
ww.clinicaltrials.gov (Stand: 12.4.2007).
iskussionie Ergebnisse der Analysen zeigen,ass die klinische Forschung in Deutsch-
and im internationalen Vergleich gutufgestellt ist, wenngleich es Verbesse-ungspotenzial gibt. Neben einer aus-eichenden Finanzierung spielt aberuch die akademische Anerkennunger klinischen Forschung eine wich-ige Rolle, um den dringenden Bedarfn hoch qualifizierten (Nachswuchs-)issenschaftlern decken zu können.
imitationen
ie zugrunde liegende Studie weist ei-ige Limitationen auf [1]:
Es erfolgte eine zwar umfangreiche,aber keine systematische Literaturre-cherche, was potenziell zu Verzer-rungen durch fehlende Publikationenführen könnte.Insgesamt war es schwierig an verläs-sliche Daten zu kommen, insbeson-dere für die Schwellenländer Chinaund Indien.Die Auswahl der Experten erfolgtenach pragmatischen Überlegungen(z.B. terminliche Verfügbarkeit) undnicht anhand einer systematischenAuswahl. Gleichwohl bestand der
Anspruch, Experten aller für die kli-nische Forschung relevanter Gruppeneinzubeziehen.Z. Evid. Fortbild. Qual.
Fazit
Aufgrund der demografischen Entwick-lung in Deutschland und den anderenIndustrienationen wird der Bedarf fürinnovative Arzneimittel und Medizin-produkte weiter steigen; hierzu kanndie klinische Forschung einen wichtigenBeitrag leisten. Nach den vorliegendenErkenntnissen könnte insbesondereeine Förderung der kompletten Inno-vationskette, von der Grundlagenfor-schung über die translationale und klini-sche Forschung bis zur Versorgungsfor-schung einen Wettbewerbsvorteil fürDeutschland darstellen und gleichzeitigeinen Beitrag für ein noch leistungsfä-higeres Gesundheitswesen liefern [10].Die vorliegende Studie untersuchte dieHerausforderungen an die klinische For-schung in Deutschland im internationa-len Vergleich unter besonderer Berück-sichtigung innovativer Therapieverfah-ren. Hierbei fand auftragsgemäß eineFokussierung statt; wichtige Fragen ins-besondere hinsichtlich der nichtkom-merziellen klinischen Forschung muss-ten ausgespart werden und wurden ineiner weiteren Studie für den Bundestagbearbeitet.
FinanzierungDie zugrunde liegende Studie wurdevom Fraunhofer ISI im Auftrag des Bürosfür Technikfolgen-Abschätzung beimDeutschen Bundestag (TAB) durchge-führt (http://www.tab-beim-bundestag.de/pdf/publikationen/berichte/TAB-Arbeitsbericht-ab132.pd) [1]. Die vor-liegende Publikation gibt die Meinungder Autoren wieder und nicht die desAusschusses oder des Bundestages.
DanksagungWir danken allen Experten, die sichfür ein Interview zur Verfügung ge-stellt haben; ebenso den Teilnehmerndes Abschluss-Workshops, der am 14.November 2008 in Frankfurt am Mainstattfand.
[1] Bührlen B, Vollmar HC. BiomedizinischeInnovationen und Klinische Forschung– Wettbewerbs- und Regulierungsfra-
Gesundh. wesen 104 (2010) 738–743www.elsevier.de/zefq
gen. Innovationsreport, TAB-Arbeitsbericht132, (TAB) BfT-AbDB, Editor. Büro fürTechnikfolgen-Abschätzung beim Deut-schen Bundestag (TAB): Berlin. 2009. p.129.
[2] Deutsche Forschungsgemeinschaft, Hrsg.Klinische Forschung. Denkschrift Wein-heim, 1999.
[3] Gaisser S, Nusser M, Reiß T. Stärkung desPharma-Innovationsstandortes Deutsch-land. Abschlussbericht im Rahmen desForschungsvorhabens »Stärkung desPharma-InnovationsstandortesDeutschland« der Hans-Böckler-Stiftung.Fraunhofer-Institut für System- und Inno-vationsforschung (ISI): Karlsruhe. 2005.
[4] Gesundheitsforschungsrat des Bundesmi-nisteriums für Bildung und Forschung.Roadmap für das Gesundheitsforschungs-programm der Bundesregierung. BMBF:Bonn/Berlin. 2007. p. 123.
[5] Nusser M, Tischendorf A. Innovative Phar-maindustrie als Chance für den Wirtschafts-
standort Deutschland – Abschlussbericht.Fraunhofer Institut für System- und Innova-tionsforschung (ISI): Karlsruhe/Berlin. 2008.
[6] Nusser M, Wydra S, Hartig J, GaisserS. Forschungs- und wissensintensive Bran-chen: Optionen zur Stärkung ihrer in-ternationalen Wettbe-werbsfähigkeit. In-novationsreport, TAB-Arbeitsbericht. Bürofür Technikfolgen-Abschätzung beim Deut-schen Bundestag (TAB): Berlin. 2007; 116.
[7] Paul-Ehrlich-Institut. Anträge auf klinischePrüfung von Biologika 2004-2008, BührlenB, Editor. Bonn. 2009.
[8] Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, Hay-nes RB, Richardson WS. Evidence based me-dicine: what it is and what it isn’t. Brit MedJ 1996;312(7023):71–2.
[9] Schneider CK, Kalinke U. Nach demTGN1412-Zwischenfall. Prinzipien der Be-wertung von First-in-Man-Studien mitmonoklonalen Antikörpern durch das
Paul-Ehrlich-Institut. Bundesgesundheits-blatt - Gesundheitsforschung - Gesund-heitsschutz 2007;50:1213–20.
[10] Schrappe M, Scriba PC. Versorgungs-forschung: Innovationstransfer inder klinischen Forschung. ZAeFQ2006;100:571–80.
[11] Schwarz JA, Hrsg. Leitfaden Klinische Prü-fungen von Arzneimitteln und Medizinpro-dukten. Aulendorf: Editio Cantor (ECV),2005; 676.
[12] Steffen C. Clinical trials authorisation: theGerman situation. Paris. 2008.
[13] Sunderland T, Hill JL, Mellow AM, LawlorBA, Gundersheimer J, Newhouse PA, Graf-man JH. Clock drawing in Alzheimer’s di-sease. A novel measure of dementia seve-rity. J Am Geriatr Soc 1989;37(8):725–9.
[14] Thiers FA, Sinskey AJ, Berndt ER. Trends inthe globalization of clinical trials. Nat RevDrug Discov 2008;7:13–4.
ZEFQ-Service:Literatur undRezensionen
Zahlenspiele in der MedizinEs ist soweit - das Buch ,,Zahlenspiele inder Medizin - Eine kritische Analyse‘‘ istnun erschienen. Anhand von sehr unter-schiedlichen Themenbereichen (wie z.B. derSchweinegrippe, neuen Onkologika oderder HPV-Impfung), die aus dem Arbeitspro-gramm des Ludwig-Boltzmann-Institut-HTA,Wien stammen, wird aufgezeigt, wie undwozu Zahlen in der Medizin eingesetzt wer-den. Die konkreten Beispiele stehen dabeistellvertretend für immer wiederkehrendeMechanismen.,,Dieses Buch will - so Claudia Wild, Mither-
mehr’ ist, zwangsläufig Fortschritt bedeutenmuss‘‘.Weiters wird versucht, einen Beitrag zur Stei-gerung der Gesundheitskompetenz der Bevöl-kerung (PatientInnen, aber auch MedizinerIn-nen und EntscheidungsträgerInnen) zu leisten,da wir in unserer Informationsgesellschaft täg-lich mit Zahlen konfrontiert werden und unsjene Werkzeuge, die es uns ermöglichen, Zah-len richtig interpretieren zu können, meistnoch fehlen.,,Wir sollten uns bewusst sein, wie Zahlen zuStande kommen und wie sie zu lesen sind,um sinnvolle Aussagen treffen bzw. abgelei-
das Buch Anregungen zur Diskussion überzukünftige gesellschaftliche Prioritäten unddamit zu einer (Um)verteilungsdebattegeben.
Korrespondenzadresse:Claudia Wild, Brigitte Piso (Hrsg.)Zahlenspiele in der MedizinEine kritische Analyse224 SeitenFormat 13,5 x 21,5 cmEfalin, SchutzumschlagD (A,D) 19,90; SFr 34,90
ausgeberin des Buchs - bei allem Respekt vortatsächlichen Innovationen und jenen Men-schen, die sich tagtäglich für die Gesundheitder Menschheit einsetzen - kritisches Bewusst-sein schaffen, dass nicht alles was ’neu und
Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (www.elsevier.de/zefq
tete Schlussfolgerungen verstehen und kritischhinterfragen zu können‘‘, betont Brigitte Piso,Mitherausgeberin.Da der Fortschritt in der Medizin auch mit(enormen) Kosten verbunden ist, möchte
I
ZEFQ) 104 (2010) 738–743
SBN: 978-3-7015-0523-4
743