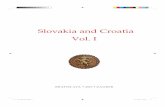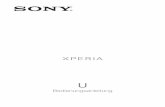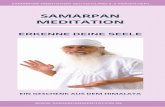Kijk, dit is Louis hij is nieuw in de familie - De Friesland
Diversität von Familie in Deutschland
Transcript of Diversität von Familie in Deutschland
Diversität von Familie in Deutschland
Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
1 Einleitung
Familien in Deutschland haben vielfältige Erscheinungsformen. Für eine Ana-lyse der Diversität von Familie gilt es entsprechend zunächst den Familienbegriff abzugrenzen. Auff ällig ist, dass es keine einheitliche Defi nition des Begriff s „Fa-milie“ gibt (Nave-Herz 2013, S. 34; Träger 2009, S. 18). Verschiedene Begriff sklä-rungen weisen jedoch eine Überschneidung hinsichtlich der Reproduktions- und Sozialisationsfunktion von Familie auf (Hill und Kopp 2013; Huinink und Ko-nietzka 2007; Marbach 2008; Träger 2009). Dies bedeutet, dass innerhalb einer Familie mindestens ein Kind vorhanden und damit eine Elternschaft sbeziehung vorliegen muss. Damit ist gleichzeitig das Merkmal der Generationendiff eren-zierung innerhalb von Familien erfüllt. Denn nur über eine Diff erenzierung zwischen Ein- und Zweigenerationenhaushalten lassen sich Veränderungen im familialen Sektor analysieren (Wagner und Cifuentes 2014, S. 92). In der Vergan-genheit war Familie weiterhin durch die Verbindung von biologischer und sozia-ler Elternschaft geprägt (König 2002, S. 57; Nave-Herz 2012, S. 15). In der Gegen-wart scheint sich diese strikte Verbindung von biologischer und sozialer Ebene zu entkoppeln (Peuckert 2012, S. 404). Damit erweitert sich der Familienbegriff über die Blutsverwandtschaft hinaus. Neben der klassischen Zwei-Eltern-Fami-lie und der Ein-Eltern-Familie, welche biologische und soziale Elternschaft ver-einen, können alternative Familienformen beobachtet werden, die ausschließlich auf einer sozialen Elternrolle basieren oder bei denen die biologische Elternschaft nur für einen Elternteil besteht. Neben Pfl ege-, Adoptiv- und Stieff amilien kann dies auch auf „Inseminationsfamilien“ (Peuckert 2012, S. 389) zutreff en. Neuere
A. Steinbach et al. (Hrsg.), Familie im Fokus der Wissenschaft, Familienforschung, DOI 10.1007/978-3-658-02895-4_3, © Springer Fachmedien Wiesbaden 2014
42 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin ermöglichen eine teilweise bis voll-ständige Entkopplung von sozialer und biologischer Elternschaft . Der rechtliche Rahmen für Deutschland gestattet bisher lediglich die Samenspende, sodass, rein rechtlich gesehen, nur eine teilweise Entkopplung von biologischer und sozialer Elternschaft möglich ist. Würden Ei- und Samenspende zusammenfallen, wäre die resultierende Familie aus biologischer Perspektive mit einer Adoptionsfamilie vergleichbar (Peuckert 2012, S. 401). Hauptursache für die Entkopplung sozialer und biologischer Elternschaft stellt aber eher die zunehmende Zahl von Trennun-gen und Scheidungen dar.
Für die Betrachtung der Diversität von Familie ist insbesondere die Lebens-verlaufsperspektive relevant. Auf der einen Seite verweist die Individualisie-rungsdebatte auf den Lebensverlauf, der off ener und gestaltbarer geworden ist (Beck-Gernsheim 1994, S. 136) und eine Aufweichung des traditionellen „Fami-lienzyklus“ 1 mit sich gebracht hat (Klein 1999, S. 471). Partnerschaft s- und Fa-milienbiographien werden dadurch komplexer (Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 234), denn ein und dieselbe Person kann verschiedene Partnerschaft s- und Fa-milienformen im Laufe ihres Lebens durchlaufen (Geissler 1996, S. 111). Auf der anderen Seite stehen Familienformen in Bezug zu diversen Statusübergängen, die häufi g an ein bestimmtes Lebensalter gebunden sind (Lengerer und Klein 2007, S. 434). Ausbildungszeiten verlängern sich, sodass Partnerschaft s- und Familien-gründung in ein höheres Alter aufgeschoben werden (Peuckert 2012, S. 231). Mit fortschreitendem Lebensverlauf werden damit Familienbiografi en komplexer, wenn man mögliche Trennungen, Neu-Verpartnerungen und Familienerweite-rungen einbezieht.
Neben der biologisch-sozialen Komponente und der Lebensverlaufsperspek-tive ist der Familienbegriff zusätzlich durch eine räumliche Dimension geprägt. Familie lässt sich zum einen als soziale Gruppe defi nieren, die in einem Haus-halt zusammen lebt (Huinink und Konietzka 2007, S. 25). Zum anderen existieren Familienstrukturen, die sich durch enge Verwandtschaft sbeziehungen und über Haushaltsgrenzen hinweg defi nieren (Verwandtschaft sfamilie). Der hier vorlie-gende Beitrag nähert sich dem komplexen Begriff „Familie“ über die Existenz von (minderjährigen) Kindern auf Haushaltsebene an. Familie ist da, wo mindestens ein Kind im Haushalt lebt und ein Elternschaft sverhältnis besteht (Huinink und Konietzka 2007, S. 31; Klein 1999, S. 470). Frühere Defi nitionsversuche haben neben Kindern als Voraussetzung von Familie auch eine gemeinsame Haushalts-
1 Der „Familienzyklus“ mit seinen unterschiedlichen Phasen stellt einen zentralen As-pekt der Lebensverlaufsforschung in der Familiensoziologie dar. Für eine ausführliche Darstellung dieses Konzepts siehe Glick (1947).
43Diversität von Familie in Deutschland
führung sowie eine auf Dauer angelegte Beziehung zwischen Frau und Mann her-angezogen (Hill und Kopp 2013, S. 10). Abbildung 1 verdeutlicht, dass heutige Fa-milienformen vielfältiger sind und über die klassische Form Vater-Mutter-Kind (Kernfamilie) hinausgehen.
Abbildung 1 Abgrenzung des Familienbegriff s auf Basis der Haushaltsebene
Quelle: Krieger und Weinmann (2008, S. 27)
Die Existenz von Kindern als zentrales Merkmal von Familie heranzuziehen, erlaubt es, sowohl alleinerziehende Elternteile als auch homosexuelle Partner-schaft en, die ein Kind aufziehen, zu berücksichtigen. Paare und Alleinstehende ohne Kinder werden nicht als Familie defi niert, da kein Elternschaft sverhältnis im Haushalt vorliegt. Die Elternschaft sbeziehung bildet aus unserer Sicht die zentrale Perspektive, um Familienformen schlüssig zu systematisieren. Eine El-ternschaft sbeziehung charakterisiert die soziale Beziehung zwischen Elternteil und Kind, die auf biologischer Abstammung beruhen kann, aber nicht zwingend muss (Adoption, Pfl egekindschaft ) (Huinink und Konietzka 2007, S. 31). Damit können auch Familienformen berücksichtigt werden, die teilweise oder vollstän-dig auf sozialer Elternschaft beruhen (Stief- bzw. Adoptionsfamilien). Dennoch weist die Betrachtung der Haushaltsperspektive, wie sie auch in der amtlichen Statistik verwendet wird, einige Schwächen auf. Haushaltsübergreifende Fami-
44 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
lienformen, die beispielsweise in Folge von Trennung entstehen, können in ihrer Komplexität nicht angemessen abgebildet werden (Feldhaus und Huinink 2011, S. 78; Huinink und Konietzka 2007, S. 36). Der Fokus beruht immer auf dem Haushalt, in dem das Kind (die meiste Zeit) lebt. Hält sich ein Kind die meiste Zeit im Haushalt der Mutter auf und ist nur zeitweise beim Vater, wird die Fa-milie im Haushalt der Mutter verortet.2 Der Vater würde in diesem Fall unter den Begriff „Verwandtschaft sbeziehungen“ fallen und nicht direkt berücksichtigt. Damit scheinen Familienformen weniger einem Defi nitions- als einem empiri-schen Operationalisierungsproblem zu unterliegen. In der Konsequenz liegt die-sem Beitrag ein weiter Familienbegriff zugrunde, der sich an den Dimensionen Elternschaft und Partnerschaft sform orientiert, wie Abbildung 1 dokumentiert, und sich der Familie damit aus „forschungspragmatischer Sicht“ (Marbach 2008, S. 22) nähert.3
Dieser Beitrag befasst sich mit der Diversität vorhandener Familienformen in Deutschland. Nachdem die für diese Arbeit geltende Defi nition des Familienbe-griff s im vorangegangenen Abschnitt 1 dargestellt wurde, gibt Abschnitt 2 einen Überblick über die wichtigsten Argumente der Individualisierungs- und Plurali-sierungsdebatte und zeigt auf, inwiefern diese Th esen für Deutschland zutreff en. Im Anschluss daran wird in Abschnitt 3 auf die Entwicklung der Familienstruk-turen eingegangen. Dabei werden zuerst verfügbare Datensätze vorgestellt, die sich für die Analyse der Verteilung von Familienformen eignen (Abschnitt 3.1). In einem weiteren Schritt werden dann die vorhanden Familienformen vorgestellt, defi niert und mit empirischen Ergebnissen der vorhandenen Forschungsliteratur zu Häufi gkeit, Anzahl der Kinder im Haushalt und der Erwerbsbeteiligung der Elternteile beschrieben (Abschnitt 3.2). Der Beitrag endet mit einer Zusammen-fassung der wichtigsten Erkenntnisse zur Diversität von Familie in Deutschland
2 Beim Wechselmodell – eine Lebens- und Betreuungsform von Kindern, in der sich die getrennt lebenden Eltern abwechselnd um die Kinder kümmern – ist die Zuordnung der Kinder zu einem Haushalt allerdings nicht mehr so einfach möglich, da die Kinder zu einem substantiellen Anteil bei beiden Elternteilen leben (Sünderhauf 2013, S. 61). Diese Form der Betreuung ist, anders als ein gemeinsames Sorge- oder Umgangsrecht, an einer gleichberechtigten und gleichverpflichtenden Betreuung der Kinder orien-tiert. Damit müssten eigentlich auch beide Haushalte der Eltern als Familienhaushalte erfasst werden. Da das Wechselmodell jedoch noch relativ selten in Deutschland ist (Sünderhauf 2013, S. 198), bleibt es hier zunächst unberücksichtigt.
3 Eine ausführlichere Diskussion zur wissenschaftlichen Bedeutung und theoretischem Gehalt des Familienbegriffs findet sich unter anderem in Marbach (2008) und eine familienpsychologische Perspektive bei Schneewind (2010).
45Diversität von Familie in Deutschland
und gibt einen Ausblick auf mögliche zukünft ige Entwicklungen im Bereich der Familienformen (Abschnitt 4).
2 Die Individualisierungs- und Pluralisierungsdebatte in Deutschland
Vor dem Hintergrund von Individualisierung (Beck 1986, 1990; Beck und Beck-Gernsheim 1990) und Pluralisierung wird in den letzten Jahren in der Bundes-republik eine angeregte Debatte zum Wandel von Lebens- und Familienformen geführt. Die Individualisierungsthese rückt allgemeine gesellschaft liche Ent-wicklungen und ihre Konsequenzen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die In-dividualisierung einzelner Lebensbereiche wird als Folge einer fortschreitenden Modernisierung gesehen. Familien werden dabei als Beispiel für diese Entwick-lungen herangezogen, da sie soziale Beziehungen repräsentieren (Hill und Kopp 2013, S. 261, 266); es werden aber auch andere Lebensbereiche beeinfl usst. Aus-gangspunkt der Debatte um die Individualisierung ist die Aufl ösung von norma-tiv geprägten, sozialen Strukturen (Beck-Gernsheim 1994, S. 136; Brüderl 2004, S. 7). Der Modernisierungsprozess sorgt dafür, dass Personen nun eigenständig handelnde Akteure sind, aber gleichzeitig auch die Verantwortung des Einzelnen für die angemessene „Biografi sierung des eigenen Handelns“ (Huinink und Ko-nietzka 2007, S. 106) steigt. In der Vergangenheit haben normative und institutio-nelle Bindungen die Handlungsoptionen des Einzelnen stark beschränkt, heute bestimmen und regulieren andere Zwänge, wie die des Arbeitsmarktes, das Leben des Einzelnen. Als Folge der individualisierten Lebensumstände und gestiegenen Gestaltungsmöglichkeiten hat sich dabei vor allem die Biografi e von Frauen ver-ändert (Hill und Kopp 2013, S. 265; Nave-Herz 2010, S. 40). Durch das Ablegen traditioneller Rollenmuster und Abhängigkeitsverhältnisse gehen auf der einen Seite soziale Sicherheiten verloren (Huinink und Konietzka 2007, S. 107). Auf der anderen Seite stehen Veränderungen im Bildungs- und Qualifi kationsniveau (Bil-dungsexpansion), die eine verstärkte Erwerbsbeteiligung von Frauen befördern und so ihre fi nanzielle Unabhängigkeit ermöglichen (Brüderl und Klein 2003, S. 210; Hill und Kopp 2013, S. 265).
Mit steigendem Wohlstand gehen außerdem demografi sche Entwicklungen wie sinkende Heirats- und Geburtenziff ern sowie steigende Scheidungshäufi g-keiten einher, die verstärkt zu Abweichungen vom institutionellen Lebenslauf und damit zu mehr Vielfalt bei den Verlaufsmustern im Bereich Familie führen (Brüderl 2004, S. 8; Huinink und Konietzka 2007, S. 107). Gleichzeitig geht mit der Individualisierungsthese eine Diskussion um die Aufgabe des theoretischen
46 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Konstruktes „Familie“ einher, welche zugleich die Pluralität von Familienfor-men unterstreicht (Nave-Herz 2010, S. 41). Die Diskrepanz zwischen dem Stre-ben nach Selbstverwirklichung und dem Wunsch nach persönlichen (familialen) Bindungen impliziert einen Bedeutungsverlust von Familie in der Gegenwartsge-sellschaft (Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 234; Nave-Herz 2010, S. 40). Diese Entwicklungen können damit als Grundlage der Debatte zur Pluralisierung von Familien- und Lebensformen gesehen werden.
Die Pluralisierungsdebatte postuliert zwei unterschiedliche Th esen: Einerseits wird von einer Zunahme der zu beobachtenden Lebensformen gesprochen, d.h. es wird davon ausgegangen, dass die Vielfalt tatsächlich zugenommen hat und neue Lebensformen entstanden sind (Brüderl 2004). Andererseits wird eine Ver-schiebung der Anteile vorhandener Lebensformen diskutiert (Klein 1999; Nave-Herz 2010). Dies bedeutet, dass nicht die Anzahl an Formen zugenommen hat, sondern lediglich die Anteile bereits vorhandener Lebensformen gewachsen oder geschrumpft sind und dementsprechend deren gesellschaft liche Wahrnehmung, auch wenn von einer Gleichverteilung noch lange nicht gesprochen werden kann.
Empirische Untersuchungen der 1990er Jahre sehen Pluralisierungstenden-zen vorrangig im Bereich nicht-familialer Lebensformen; familiale Lebensfor-men unterliegen hingegen eher starren Strukturen (Nave-Herz 1997; Strohmeier 1993). Zusätzlich wird von einem Bedeutungsverlust der Familie gesprochen, der sich auch in schrumpfenden Anteilen familialer im Vergleich zu nicht-familia-len Lebensformen widerspiegelt. In einer Querschnittsbetrachtung der Haushalte scheint dies zuzutreff en. So sind die Anteile von Ein- und Zweipersonenhaushal-ten im Zeitverlauf von 1990 bis 2005 deutlich angestiegen (Dorbritz et al. 2008, S. 62). Gleiches gilt für die Zahl der Alleinstehenden zwischen den Jahren 1996 und 2006 (Krieger und Weinmann 2008, S. 31). Diese Entwicklung könnte da-hingehend interpretiert werden, dass gegenwärtig weniger Familien gegründet werden (Nave-Herz 2010, S. 43). Mit Blick auf den oben erwähnten „Familien-zyklus“ und damit auf die Lebensverlaufsperspektive lässt sich diese „Schrump-fung“ der Mehrpersonenhaushalte auch anders deuten. Untersuchungen zeigen, dass die Familiengründung in Deutschland nicht aufgehoben, sondern eher auf-geschoben wird. Frauen und Männer gründen zu einem späteren Zeitpunkt im Lebensverlauf, aber doch immer noch überwiegend, eine Familie, auch wenn die Anteile Kinderloser über die letzten Jahrzehnte angestiegen sind (Dorbritz und Ruckdeschel 2007; Kreyenfeld und Konietzka 2007; Ruckdeschel und Nade-ri 2009). Durch die Zurückstellung der Familiengründung entsteht eine Phase, in der junge Menschen allein oder als Nichteheliche Lebensgemeinschaft en in Zweipersonenhaushalten leben, die statistisch zu einem Anstieg dieser Haushalte führen (Dorbritz et al. 2008, S. 62; Nave-Herz 2010, S. 43). Zur Erhöhung der
47Diversität von Familie in Deutschland
Zweipersonenhaushalte trägt ebenso die Zunahme der Lebenserwartung bei, wel-che eine verlängerte „nachelterliche Phase“ begünstigt (Nave-Herz 2010, S. 44). Die Anzahl an Familienhaushalten (mit minderjährigen Kindern) ist deshalb in den letzten Jahren, vor allem in Ostdeutschland deutlich zurückgegangen (Dor-britz et al. 2008, S. 63; Krieger und Weinmann 2008, S. 33), dennoch gründet die überwiegende Mehrheit der in Deutschland lebenden Personen im Verlauf ihres Lebens eine Familie (Nave-Herz 2010, S. 45). Das Aufschieben bestimmter Übergänge trifft nicht nur auf die Familiengründung zu. Da Eheschließungen in der persönlichen Beziehungsbiographie später stattfi nden, entstehen vor allem in den neuen Bundesländern mehr Nichteheliche Lebensgemeinschaft en mit Kind. Diese Entwicklungen unterstreichen eher eine Verschiebung der Anteile von Fa-milienformen als eine Zunahme der Vielfalt (Wagner und Cifuentes 2014, S. 90).
In Bezug auf die Pluralisierungsdebatte gilt es, zwischen verschiedenen Le-bensformen – im vorliegenden Beitrag begrenzen wir uns auf die Familienformen – zu diff erenzieren. Dabei wird deutlich, dass die Zwei-Eltern-Kind-Familie, der eine biologische Elternschaft zugrunde liegt, im Vergleich zu Alleinerziehenden-, Stief-, Adoptions- und Pfl egefamilien dominant ist. Rund 72 Prozent der Haus-halte mit Kindern unter 18 Jahren stellen Kernfamilien dar (Steinbach 2008, S. 165). Darüber hinaus leben gut 75 Prozent der Kinder unter 18 Jahren mit ihren beiden leiblichen Eltern zusammen (Steinbach 2008, S. 170).
Die Debatte zur Pluralisierung wird weiterhin um den Aspekt des zeitlichen Referenzrahmens ergänzt. Eine Beurteilung der Veränderung von Anteilen hängt stark vom historischen Vergleichspunkt ab (Nave-Herz 2010, S. 48). Befürworter der Pluralisierungsthese orientieren sich an den Entwicklungen der 1960er und 1970er Jahre. Ein Zeitrahmen, der besonders viele Ehen, wenige Scheidungen, relativ hohe Kinderzahlen hervorbrachte und in dem Nichteheliche Lebensge-meinschaft en wenig verbreitet waren (Nave-Herz 2010, S. 47). Zu anderen Zeit-punkten in der Geschichte, wie der vorindustriellen Phase, waren die Anteile von Alleinerziehenden-, Stief-, Adoptions- und Pfl egefamilien stärker besetzt, auch wenn die Entstehungsgründe andere waren (Nave-Herz 2010, S. 47). Während gegenwärtig eher Trennungen und Scheidungen Ursache für eine Vielzahl von Familienformen sind, waren es in vorindustrieller Zeit eher Verwitwungen und außereheliche Geburten (Nave-Herz 2010, S. 48; Peuckert 2012, S. 382; Schwarz 1995, S. 274). Alleinerziehende waren vor allem in der Nachkriegszeit (Kriegs-witwen), den 1950er Jahren, weit verbreitet und stellen damit auch keine neue Familienform dar (Bach 2002, S. 83ff .; Bertram 2002, S. 524; Peuckert 2012, S. 345). Ähnliches gilt für Stieff amilien, die nur eingeschränkt als neue Familien-form bewertet werden können. Ihr Anteil an allen Familienformen scheint über
48 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
die letzten Jahre jedoch infolge gehäuft auft retender Trennungen und Scheidun-gen gewachsen zu sein.
Als eigentlich einzig neue Familienform können gleichgeschlechtliche Lebens-gemeinschaft en mit Kindern angesehen werden. Diese Gruppe ist jedoch recht klein. Laut Daten des deutschen Mikrozensus aus dem Jahr 2008 leben lediglich 7.200 Kinder in Haushalten mit gleichgeschlechtlichen Partnern (Eggen und Rupp 2010, S. 27). Trotz ihres geringen Anteils wird diese Familienform mitt-lerweile gesellschaft lich akzeptiert sowie rechtlich gestärkt und hat damit in der Öff entlichkeit eine größere Sichtbarkeit erlangt (Eggen und Rupp 2010, S. 34).
Die Pluralisierungsdebatte kann auch aus einem anderen Blickwinkel betrach-tet werden. Ein Beitrag von Huinink (2011) sieht die Veränderungen im Bereich Familie weniger aus Perspektive der Individualisierung und dem damit verbun-denen Bedeutungsverlust von Familie. Er interpretiert die Veränderungen als an-gepasste Handlungsstrategien von Familien und ihren Mitgliedern, um familiale Strukturen – auch vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen – zu gewährleisten (Huinink 2011, S. 29). Familien haben demnach lediglich ihre All-tagsorganisation an eine spätmoderne Gesellschaft angepasst. Um den gegenwär-tigen Anforderungen gerecht zu werden, bedarf es möglichst fl exibler Reaktions-muster und Organisationsformen, auch wenn diese, im Vergleich zur klassischen Organisationsform von Familie, prekärer ausfallen (Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 235). Ziel der Alltagsorganisation ist es, befriedigende Familienbeziehun-gen aufrecht zu erhalten, indem Umwelteinfl üsse zielgerichtet reguliert werden. Die unterschiedlichen Strategien, Familienstrukturen aufrecht zu erhalten, füh-ren dann auf Makroebene zu einer messbaren Diversifi zierung von Familienfor-men (Huinink 2011, S. 24). Unterstrichen wird damit der unveränderte Wunsch nach Familie, Partnerschaft und Kindern (Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 235; Kuhnt 2013, S. 374; Kuhnt und Trappe 2013, S. 21).
Die angeführten Th esen zur Pluralisierung, Zunahme der Vielfalt und Ver-schiebung der Anteile vorhandener Lebensformen, treff en also beide zu, jedoch in unterschiedlichem Ausmaß. Abhängig vom zeitlichen Referenzrahmen haben sich die Anteile vorhandener Familienformen verändert. Eine Veränderung der Anteile lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass eine Zunahme der familiären Viel-falt stattgefunden hat. Gegenwärtig ist noch immer die Zwei-Eltern-Kind-Familie die am weitesten verbreitete Familienform. Eine Zunahme der Vielfalt kann des-halb nur eingeschränkt bestätigt werden. In Deutschland scheinen nur homo-sexuelle Paare mit Kind als neue Familienform entstanden zu sein, auch wenn sie quantitativ einen äußerst geringen Anteil ausmachen. Damit kann weder die
49Diversität von Familie in Deutschland
Th ese zum Bedeutungsverlust von Familie, noch die Th ese zur Pluralisierung der Familienformen zweifelsfrei überzeugen (Bertram 2002, S. 524).4
3 Entwicklung der Familienstrukturen in Deutschland
3.1 Verfügbare Datensätze für die Analyse der Verteilung von Familienformen in Deutschland
Daten, welche die Identifi kation verschiedener Familienformen in Deutschland erlauben, sind sehr begrenzt. Dies liegt vorrangig an den komplexen Strukturen nicht-konventioneller Familien und dem damit verbundenen Informationsbe-darf, der adäquaten Daten zugrunde liegen muss (Feldhaus und Huinink 2011, S. 81; Steinbach 2008, S. 155). Um Familienformen sicher bestimmen zu können, müsste die vollständige Partnerschafs- und Fertilitätsbiografi e eines Individu-ums vorliegen. Dies würde Informationen zum Kohabitationsstatus, Familien-stand und dem Zusammenwohnen mit leiblichen und nicht leiblichen Kindern erfordern. Selbst aufwendige Matching-Verfahren von Fertilitäts- und Partner-biografi en erlauben nicht immer eine zweifelsfreie Zuordnung von Kindern zu den angegebenen Partnern (Klein 2003, S. 509) Die Anforderungen an das Daten-material sind entsprechend umfassend und gegenwärtig verfügbare Datensätze weisen eine Vielzahl von Defi ziten auf. Grundsätzlich kann zwischen amtlichen Daten und Survey-Daten diff erenziert werden.
Der Mikrozensus bietet die einzige Möglichkeit mit amtlichen Daten Familien-formen zu identifi zieren. Trotz Umstellung auf das Lebensformenkonzept im Jahr 1996 und der damit einhergehenden Verbesserung des Analysepotentials (Lenge-rer et al. 2005, S. 34ff .), ist eine diff erenzierte Erfassung von Familienformen noch immer problematisch (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 8). Zum einen bleibt unklar, ob ein Kind, das im Haushalt lebt, ein leibliches, Stief-, Pfl ege- oder Adoptionskind ist (Lengerer et al. 2005, S. 5). Zum anderen werden Kinder, die nicht (mehr) im Haushalt leben, im Mikrozensus gar nicht berücksichtigt, da es sich um eine Haushaltsstichprobe handelt (Bayer und Bauereiss 2003, S. 286; Len-gerer und Klein 2007, S. 435). Darüber hinaus können keine vollständigen Fertili-tätsbiographien erstellt werden, da retrospektive Informationen fehlen (Feldhaus
4 Auch wenn sich die Pluralisierung der Familienformen nicht eindeutig bestätigen lässt, finden sich empirische Belege für die Diversifizierung von Lebensformen ohne Kind. Detailliertere Ausführungen dazu findet sich unter anderem bei Brüderl (2004), Wag-ner (2008), Brüderl und Klein (2003) sowie Hill und Kopp (2013).
50 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
und Huinink 2011, S. 81). Die Erfassung der Gesamtkinderzahl von Frauen und Männern, und damit auch von Kinderlosigkeit, ist somit nicht möglich (Kreyen-feld und Huinink 2003, S. 45; Kreyenfeld et al. 2009, S. 278; Lengerer et al. 2005, S. 34). Weiterführend sind Aussagen zu Stieff amilien nur auf Basis von Schätzungen möglich (Steinbach 2008, S. 155). Allerdings können mit dem Mikrozensus (mit einigen Einschränkungen) auch gleichgeschlechtliche Partnerschaft en mit Kind erfasst werden. In einem zusätzlichen Schritt wird seit 2006 bei der Erfassung von Lebensgemeinschaft en auch nach eingetragenen Partnerschaft en gefragt (Eggen und Rupp 2010, S. 25).
Neben den amtlichen Daten existieren eine Reihe Survey-Daten, die in unter-schiedlichem Maße für die Analyse von Familienstrukturen geeignet scheinen. Eine Datenquelle, welche regelmäßig zur Analyse von Lebens- und Familien-formen herangezogen wird, ist der DJI-Familiensurvey. Insgesamt stehen drei Wellen dieses Surveys aus den Jahren 1988, 1994 und 2000 zur Verfügung. Das DJI-Familiensurvey setzt sich aus einer Querschnittskomponente (replikative Stichprobe) und einer Panelstichprobe für die alten Bundesländer zusammen (Infratest 2000, S. 4ff .). Der Familiensurvey erhebt detaillierte Informationen zu allen Kindern, also auch zu denen, die bereits nicht mehr im Haushalt leben (Kreyenfeld und Huinink 2003, S. 47). Es wird erfasst, ob Kinder leibliche, Stief-, Pfl ege- oder Adoptivkinder (des aktuellen Partners) sind, wenn diese gegenwärtig im Haushalt leben oder einmal dort gelebt haben. Kinder des aktuellen Partners, die nie im Haushalt gelebt haben, werden jedoch in diesem Survey nicht berück-sichtigt. Informationen zum externen Elternteil des im Haushalt lebenden Kindes fehlen ebenfalls, weswegen keine Analysen zu sekundären Stieff amilien mit die-sen Daten vorgenommen werden können bzw. diese Familienform im DJI-Fami-liensurvey unterschätzt wird (Feldhaus und Huinink 2011, S. 82; Steinbach 2008, S. 155). Als Weiterführung des DJI-Familiensurveys existiert inzwischen das inte-grierte Survey Aufwachsen in Deutschland: Alltagswelten (AID:A) des Deutschen Jugendinstituts, welches die bisherigen Studien – Familiensurvey, Jugendsurvey, Kinderpanel und Kinderbetreuungsstudie – zusammenfasst (Rauschenbach und Bien 2012). Im Fokus steht die gesamte Phase des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen im Kontext ihrer Familien und deren Haushalte. Dabei handelt es sich jedoch nicht um eine individuell-biographische Perspektive und auch nicht um einen individuellen Längsschnitt (Rauschenbach und Bien 2012, S. 14). Durch die Informationen zu den Partnerschaft s- und Kindschaft sverhältnissen können jedoch im Querschnitt konventionelle und nicht-konventionelle Familienformen bestimmt werden.
51Diversität von Familie in Deutschland
Der Generations- and Gender-Survey (GGS) aus den Jahren 2005 und 2009/10 stellt eine weitere Option dar, Familienformen in Deutschland zu analysieren.5 In diesem Datensatz werden alle im Haushalt lebenden Personen und deren Be-ziehungen zueinander erhoben. Dies beinhaltet auch die Information über den Elternschaft sstatus. Es wird unterschieden, ob Kinder biologische Kinder des ak-tuellen Partners der Ankerperson im Haushalt oder aber biologische Kinder eines früheren Partners sind (Feldhaus und Huinink 2011, S. 82). Durch die diff eren-zierte Erfassung der Beziehung des Kindes zur Ankerperson (leibliches Kind eines früheren Partners bzw. Stiefk ind) können auch Stieff amilien korrekt bestimmt werden (Steinbach 2008, S. 163). Darüber hinaus werden im GGS die Kinder der Ankerpersonen und ihrer aktuellen Partner erfasst, die nicht mehr im gemein-samen Haushalt leben (Ruckdeschel et al. 2006, S. 11). Dies ermöglicht die Be-stimmung von Familien, in denen Erwachsene Kinder aus früheren Beziehungen haben, die sich jedoch nicht überwiegend im aktuellen Haushalt aufh alten (Stein-bach 2008, S. 173).6 Eine Bestimmung dieser Familienform ist mit den Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) nicht möglich (Feldhaus und Huinink 2011, S. 83). Im SOEP werden zwar die Kinder des Haushaltsvorstandes und anderer im Haushalt lebender Personen erfragt, unabhängig davon, ob diese Kinder noch im Haushalt leben. Da für den Haushaltsvorstand jedoch keine vollständige Partner-schaft sbiographie vorliegt, ist eine eindeutige Zuordnung aller Kinder (die nicht mehr im Haushalt leben) nicht möglich. Durch den Längsschnittcharakter des SOEP und die lange Laufzeit des Panels können mittlerweile allerdings Phasen des Alleinerziehens und das Zusammenlebens in Stieff amilien bestimmt werden.
Familienformen lassen sich ebenfalls auf Basis der Daten der Deutschen Le-bensverlaufsstudie ermitteln, die seit 1983 erhoben wird. Im Rahmen der Lebens-verlaufsstudie, welche den Fokus auf Bildungs- und Arbeitsverläufe legt, werden u.a. die Partnerschaft s- und Familienbiographien verschiedener Geburtskohor-ten in Ost- und Westdeutschland erhoben (Solga 1996, S. 30; Wagner 1996, S. 23). Die Erfassung der Daten erfolgte dabei retrospektiv. Ein weiteres aktuelles Panel, welches ebenfalls die Analyse verschiedener Familienformen ermöglicht, ist das Beziehungs- und Familienpanel (pairfam), welches seit 2008/09 jährlich durchgeführt wird (Huinink et al. 2011). Es bietet eine diff erenzierte Erfassung
5 Der GGS ist die Weiterführung des Family and Fertility Survey (FFS) aus dem Jahr 1992. Da diese Daten aufgrund des weit zurückliegenden Erhebungszeitraums weniger aktuell sind, werden sie an dieser Stelle nicht genauer vorgestellt.
6 Es liegen für den deutschen GGS einige methodische Probleme hinsichtlich der Erfas-sung der Fertilitätsbiographien vor, die bei Kreyenfeld et al. (2013) kritisch reflektiert werden.
52 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
der Partnerschaft s- und Kindschaft sbiographien. Dies bedeutet, dass Angaben zu Partnerschaft s-, Kohabitations- und Familienstatus vorliegen, ebenso wie An-gaben über leibliche, nicht im Haushalt wohnende Elternteile der Kinder eines Befragten. Dies ermöglicht eine diff erenzierte Darstellung von Familienformen und -verläufen (Feldhaus und Huinink 2011, S. 85). Einschränkend muss hier hinzugefügt werden, dass nur drei Geburtskohorten (1971-73, 1981-83 und 1991-93) betrachtet werden, sodass keine Repräsentativität für alle Altersgruppen in Deutschland vorliegt.
Die Zusammenschau der potentiell zur Verfügung stehenden Datensätze ver-deutlicht, dass mit amtlichen Daten nur begrenzt Analysen – gerade zu nicht-konventionellen Familienformen wie Stieff amilien – möglich sind. Repräsentative Survey-Daten bieten dagegen eine diff erenziertere Erfassung der Kindschaft sver-hältnisse und erlauben so die Identifi zierung relativ komplexerer Familienformen. Da diesen Studien unterschiedliche Stichproben zugrunde liegen, können zwar Anteile der einzelnen Familienformen ermittelt werden (Feldhaus und Huinink 2011, S. 84; Steinbach 2008, S. 166), aber ein direkter Vergleich der Ergebnisse ist nur eingeschränkt möglich. Ursache dafür können u.a. unterschiedliche Alters-stufen oder Kohortenspannen des jeweiligen Samples sein. Ein perspektivischer Blick in die Zukunft lässt erahnen, dass Survey-Daten mit Längsschnittcharakter (SOEP, pairfam, GGS) zu einem weiteren Wissensgewinn über den Verlauf von Familienbiographien und den damit verbundenen Phasen des Zusammenlebens in unterschiedlichen Familienformen beitragen werden. Mit fortschreitender Laufzeit der Surveys könnten bestimmte Verlaufsmuster (so denn vorhanden) deutlicher hervortreten.
3.2 Familienformen in Deutschland
Welche Familienformen können wir nun identifi zieren, wenn wir das Zusam-menleben mit Kindern in Deutschland betrachten? Eine erste Diff erenzierung kann zwischen konventionellen und nicht-konventionellen Familienformen vorgenommen werden. Als konventionelle Familienform wird die (1) klassische Form des Zusammenlebens als Familie, bestehend aus Frau und Mann mit min-destens einem gemeinsamen, leiblichen Kind, verstanden (Kernfamilie). Nicht-konventionelle Familienformen wie (2) Alleinerziehende, (3) Stieff amilien, (4) Adoptiv- und Pfl egefamilien und (5) gleichgeschlechtliche Paare mit Kind(ern), stellen alle anderen Formen familialen Zusammenlebens dar. Im Folgenden werden die einzelnen Familienformen genauer betrachtet und die Angaben zu deren Verbreitung in Deutschland zusammengefasst. Um die Verteilungen der
53Diversität von Familie in Deutschland
einzelnen aufgeführten Familienformen anschaulich zu gestalten, wurden die Er-gebnisse verschiedener Studien in Tabelle 1 zusammengetragen. Grundlage der Übersichtstabelle sind Studien, welche Familien auf Basis des Zusammenlebens mit Kindern unter 18 Jahren in einem Haushalt defi nieren.
Tabelle 1 Verteilung von Familienformen (Haushaltsebene, Kinder unter 18 Jahren), Angaben in Prozent*
Familienformen
Studien Kern-familien
Allein-erzie-hende
Stief-familien
Adoptiv- und
Pfl ege-familien
Gleichge-schlechtliche
Paare mit Kind
Teubner (2002b),Familiensurvey – – 7,0 – –
Steinbach (2008),GGS 71,5 14,8 13,6 0,1 –
Kreyenfeld und Heintz-Martin (2012), GGS 75,0 11,0 14,0 – –
Feldhaus und Huinink (2011), pairfam1 73,4 8,5 17,62 1,13 –
Kreyenfeld und Konietzka (2012), pairfam4 78,5 9,8 12,0 – –
Kreyenfeld und Heintz-Martin (2012), pairfam 81,0 10,0 9,0 –
Kreyenfeld und Heintz-Martin (2012), AID:A 79,0 10,0 11,0 – –
Eggen und Rupp (2010), Mikrozensus – – – – <0,05
* Da nicht alle Studien ihre Analysen auf Haushalte mit Kindern unter 18 Jahren begren-zen, stellt diese Tabelle nur eine Auswahl verfügbarer Studien zum Th ema Familienfor-men und ihrer Verteilung in Deutschland dar. Die hier aufgeführten Angaben basieren teilweise auf gewichteten Daten, was ggf. zu einer Einschränkung des Vergleichs der Anteile führen kann.
1 Es wurden die Ergebnisse der Geburtskohorten 1981-83 sowie 1971-73 zusammen-addiert.
2 Stieff amilien und Patchworkfamilien wurden hier zusammengezogen, da unserer Ansicht nach Patchworkfamilien ein Bestandteil von Stieff amilien sind.
54 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
3 Adoptiv- und Pfl egefamilien werden im Beitrag von Feldhaus und Huinink (2011) nicht extra ausgewiesen sondern unter „Sonstiges“ geführt.
4 Die Berechnung der Familienformen basiert auf Ergebnissen der Kohorte 1971-73, weshalb Abweichungen zu den Ergebnissen von Feldhaus und Huinink (2011) fest-zustellen sind, die ebenfalls auf den Daten von pairfam basieren, aber zusätzlich die Kohorte 1981-83 heranziehen.
Kernfamilien
Als Kernfamilie wird in der Familiensoziologie eine Konstellation bezeichnet, in der Mutter und Vater mit ihren gemeinsamen, leiblichen Kindern in einem Haushalt leben, also die konventionelle Familienform abbilden. Dabei spielt der Partnerschaft sstatus – ob verheiratet oder nicht – mittlerweile eine untergeord-nete Rolle. Neben der Begriffl ichkeit „Kernfamilie“ fi nden sich häufi g auch die Bezeichnungen Normal- oder Gattenfamilie (Peuckert 2012, S. 20). Mit diesen beiden Begriff en wird über den Umstand des Zusammenlebens mit leiblichen Kindern hinaus auch ein Familienleben mit lebenslanger, monogamer Ehe und dem Mann als Haupternährer assoziiert. Wegen der normativ geringeren Belas-tung, geben wir dem Begriff Kernfamilien hier den Vorzug. Darüber hinaus hat er sich in verschiedenen aktuellen Veröff entlichungen zum Th ema durchgesetzt (z.B. Feldhaus und Huinink 2011; Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012; Kreyen-feld und Konietzka 2012; Marbach 2008; Steinbach 2008; Wagner 2008).
Über die Verteilung dieser Familienform in Deutschland gibt Tabelle 1 Auskunft . Die Angaben zu Kernfamilien schwanken zwischen 72 Prozent (Stein-bach 2008) und 79 Prozent (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012), abhängig von den zugrunde gelegten Daten. Damit wird deutlich, dass die konventionelle Fa-milie noch immer die am weitesten verbreitete Familienform in Deutschland ist. Dies gilt ebenfalls für eine diff erenziertere Betrachtung getrennt nach Ost- und Westdeutschland. Allerdings ist die Lebensform der Kernfamilie in den alten Bundesländern weiter verbreitet als in den neuen Bundesländern (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 10; Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 244).
Ein weiterer Aspekt von Familie ist die Anzahl der Kinder, die im Haushalt leben.7 Trotz rückläufi ger Geburtenzahlen wächst die Mehrheit der minderjähri-gen Kinder in Deutschland mit mindestens einem weiteren minder- oder volljäh-
7 Aussagen über die Anzahl der Kinder im Haushalt lassen nicht zwingend Aussagen zur Gesamtkinderzahl zu, da Kinder bereits aus dem gemeinsamen Haushalt der Eltern/ Stiefeltern/ Elternteile ausgezogen sein können. Dies zeigt eine Schwäche des Familien-formenkonzeptes auf Basis der Haushaltsebene auf.
55Diversität von Familie in Deutschland
rigen Geschwisterkind im Haushalt auf (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 14; Krieger und Weinmann 2008, S. 36). Allerdings zeigen sich hier Unterschiede bei der Betrachtung des Partnerschaft sstatus. Verheiratete Paare leben mit deut-lich mehr Kindern in einem gemeinsamen Haushalt als unverheiratete Lebensge-meinschaft en. Im Jahr 2006 lebten nach Angaben des Mikrozensus in den Haus-halten verheirateter Paare mit Kind 79 Prozent der Kinder mit mindestens einem Geschwisterkind zusammen; bei den Lebensgemeinschaft en waren es lediglich 56 Prozent (Krieger und Weinmann 2008, S. 37). Diese Diff erenz könnte sich mit dem unterschiedlichen Institutionalisierungsgrad der verheirateten und unver-heirateten Partnerschaft en und einer damit einhergehenden Selektion erklären lassen.
Neben der Anzahl an Kindern, die im Haushalt leben, lassen sich auch Unter-schiede hinsichtlich der Erwerbstätigkeit zwischen verheirateten und unverhei-rateten Eltern fi nden. Der Mikrozensus 2006 weist für 76 Prozent der verheirate-ten Elternpaare eine traditionelle Form der Erwerbsbeteiligung aus (Krieger und Weinmann 2008, S. 39). Dies bedeutet, dass der Mann vollzeiterwerbstätig ist, während die Frau nicht oder in Teilzeit arbeitet. Nicht verheirate Paare folgen diesem Model zu 54 Prozent (Krieger und Weinmann 2008, S. 40). Bei den nicht verheirateten Eltern arbeiten in 38 Prozent der Haushalte beide Partner Vollzeit, bei den verheirateten Paaren mit Kindern sind dies nur 19 Prozent (Krieger und Weinmann 2008, S. 40).
Alleinerziehende
Als Alleinerziehende werden Elternteile defi niert, die mit ihren Kindern, aber ohne einen Partner in einem Haushalt leben (Nave-Herz 2012, S. 95; Steinbach 2008, S. 164). Das Alleinerziehen schließt dabei eine vorhandene Partnerschaft nicht aus. Eine Living-Apart-Together-Beziehung (LAT) kann bestehen, jedoch lebt der Partner nicht im gemeinsamen Haushalt von Elternteil und Kind(ern). Alleinerziehende fi nden sich in der Literatur auch unter dem Begriff der „Ein-Eltern-Familien“ (Peuckert 2012, S. 346). Da eine Ein-Eltern-Familie suggeriert, dass eine Trennung oder Scheidung – die häufi gsten Ursachen für das Entste-hen von alleinerziehenden Haushalten – die Beziehung zwischen Kind und zwei-tem Elternteil ebenfalls beendet (Peuckert 2012, S. 346), geben wir dem Begriff Alleinerziehende in diesem Beitrag den Vorzug. Dies entspricht dem aktuellen Forschungsstand, in dem die meisten Studien ebenfalls die Begriffl ichkeit des Alleinerziehens präferieren (z.B. Feldhaus und Huinink 2011; Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012; Kreyenfeld und Konietzka 2012; Steinbach 2008).
56 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Zur Anzahl der Alleinerziehenden in Deutschland gibt es unterschiedliche Befunde, wie Tabelle 1 darstellt. Abhängig von der Datengrundlage schwanken die Anteile zwischen 9 (Feldhaus und Huinink 2011) und 15 Prozent (Steinbach 2008). Eindeutig ist die Zunahme Alleinerziehender in Deutschland zu erkennen (Jurczyk et al. 2014, S. 25). Zwischen den Jahren 1996 und 2006 ist die Zahl allein-erziehender Mütter und Väter im Mikrozensus um 23 Prozent angestiegen (Krie-ger und Weinmann 2008, S. 30).8 Alleinerziehende sind dabei in Ostdeutschland stärker vertreten als in Westdeutschland (Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 244; Statistisches Bundesamt 2010, S. 8).
Relevant für diese Familienform ist die Unterscheidung zwischen alleinerzie-henden Müttern und Vätern. Die überwiegende Mehrheit der Alleinerziehenden sind Frauen, die Unterschiede zwischen alten und neuen Ländern fallen dabei eher gering aus (Kreyenfeld und Konietzka 2012, S. 244; Krieger und Weinmann 2008, S. 30). Im Jahr 2006 waren nach Angaben des Mikrozensus 89 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland Frauen mit mindestens einem Kind im Haus-halt (Krieger und Weinmann 2008, S. 30). Mütter kümmern sich dabei eher um jüngere Kinder und Väter leben eher mit älteren Kindern in einem Haushalt (An-dreß 2001, S. 20; Peuckert 2012, S. 349). Im Vergleich zu Kernfamilien lebt in den Haushalten von Alleinerziehenden häufi ger nur ein Kind (Krieger und Wein-mann 2008, S. 36). Der Anteil an Alleinerziehenden mit drei und mehr Kindern liegt bei 12 Prozent, wobei hier deutlich zwischen alleinerziehenden Müttern (11 Prozent) und Vätern (1 Prozent) diff erenziert werden muss (Pötzsch et al. 2013, S. 52). Der Anteil an Frauen, die ohne festen Partner ein erstes Kind bekommen, sich also bewusst für ein Alleinerziehen ab dem Zeitpunkt der Geburt entscheiden (Schneider et al. 2001, S. 99), liegt in Ostdeutschland bei 12 Prozent und in West-deutschland bei 8 Prozent (Bastin et al. 2013, S. 135).
Alleinerziehen ist gegenwärtig vermehrt ein Resultat von Scheidung und Trennung, während früher eher Verwitwung Ursache für die Bildung dieser Familienform war (Peuckert 2012, S. 345f.). Die Entstehungsbedingungen des Alleinerziehens nehmen auch Einfl uss auf die Erwerbsquoten in dieser Gruppe. Alleinerziehende Frauen sind im Vergleich zu allen anderen Familienformen am häufi gsten erwerbslos (Teubner 2002a, S. 104). Dies scheint mit dem Alter der Kinder zu korrelieren. Da sich alleinerziehende Frauen eher um jüngere Kinder kümmern, sinkt die Erwerbsquote mit dem Alter des jüngsten zu betreuenden Kindes (Andreß 2001, S. 20). Regionale Unterschiede zeigen sich auch beim zeit-lichen Umfang der Erwerbsbeteiligung: Alleinerziehende Mütter in Ostdeutsch-
8 Vor dem Jahr 1996 konnte im Mikrozensus nicht zwischen Personen mit und ohne Partner im Haushalt differenziert werden (Peuckert 2012, S. 346).
57Diversität von Familie in Deutschland
land sind zu 45 Prozent Vollzeit erwerbstätig; in Westdeutschland arbeiten mit 30 Prozent deutlich weniger alleinerziehende Frauen in Vollzeit (Teubner 2002a, S. 104). Die Erwerbsbeteiligung von alleinerziehenden Männern unterscheidet sich hingegen kaum von der verheirateter Väter (Andreß 2001, S. 20). Dadurch er-zielen sie ein höheres Einkommen als alleinerziehende Mütter. Dies unterstreicht die Heterogenität der Gruppe der Alleinerziehenden (Peuckert 2012, S. 355). Ab-hängig von Alter, Partnerschaft sbiografi e und Ausbildungsniveau ergeben sich sehr unterschiedliche Bedarfe, die auf den Erwerbsstatus und damit auf die Ein-kommensverhältnisse Alleinerziehender Einfl uss nehmen (Andreß 2001, S. 20; Peuckert 2012, S. 354; Schneider et al. 2001, S. 104).
Stieff amilien
Stieff amilien sind eine relativ schwer zu systematisierende Familienform, da es sich um sehr komplexe und heterogene Familienstrukturen handelt (Steinbach 2008, S. 160). Legt man den Haushalt zugrunde und stellt das Kind in den Fokus, kann diese Familienform wie folgt defi niert werden: Stieff amilien sind Haushal-te, in denen neben dem leiblichen Elternteil ein weiterer Erwachsener lebt, der zu mindestens einem Kind des Haushalts keine biologische Elternschaft aufweist (Steinbach 2008, S. 164). Das schließt Haushalte mit ein, in denen biologischer Elternteil und Stiefelternteil zusätzlich gemeinsame Kinder oder Adoptiv- und Pfl egekinder haben. Es muss nur die Voraussetzung bestehen, dass mindestens ein Stiefk ind im Haushalt lebt, was bedeutet, dass mindestens ein sozialer Eltern-teil hinzugekommen ist (Bien et al. 2002, S. 10). Eine Stieff amilie kann also erst entstehen, wenn ein leiblicher Elternteil eine neue Partnerschaft eingeht. Damit sind die Verwandtschaft sbeziehungen von Stieff amilien deutlich komplexer als die von Kernfamilien (Meulders-Klein und Th éry 1998, S. 27).
Das Kind defi niert durch seinen vorwiegenden Aufenthalt den Haushalt, der als Alltagsfamilie zählt. Darüber hinaus besteht häufi g noch der Haushalt des anderen leiblichen Elternteils, in dem sich das Kind zu Besuchszeiten wie an den Wochenenden oder in den Ferien aufh ält und der damit als Wochenendfamilie be-zeichnet werden kann (Bien et al. 2002, S. 11; Steinbach 2008, S. 160). Folgt man dem Ansatz der Haushaltsebene, gilt es zwischen primären und sekundären Stief-familien zu unterschieden. Wenn das Elternteil, bei dem sich das Kind überwie-gend aufh ält, eine neue Partnerschaft eingeht, stellt dies eine primäre Stieff amilie dar, wenn das außerhalb des Haushalts lebende Elternteil eine neue Partnerschaft eingeht, spricht man von einer sekundären Stieff amilie (Steinbach 2008, S. 160).
58 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Neben dem Aufenthaltsort des Kindes ergibt sich durch das Geschlecht des Stiefelternteils eine weitere Diff erenzierungsmöglichkeit nach Stiefmutter- und Stiefvaterfamilie (Bien et al. 2002, S. 11; Steinbach 2008, S. 160). Die Zusammen-setzung des Haushalts eröff net eine weitere Option, Stieff amilien zu unterschei-den (Steinbach 2008, S. 160): Bringt nur ein Partner Kinder mit in den Haushalt, handelt es sich um eine einfache Stieff amilie. Bringen beide Partner Kinder in den Haushalt ein, bezeichnet man diese Konstellation als zusammengesetzte Stieff a-milie. Leben neben den Stiefk indern gemeinsame leibliche Kinder (oder Adop-tiv- und Pfl egekinder) mit im Haushalt stellt dies eine komplexe Stieff amilie dar. Komplexe Stieff amilien können sowohl aus einfachen als auch aus zusammenge-setzten Stieff amilien entstehen, wenn ein gemeinsames Kind geboren wird. Kom-plexe Stieff amilien werden auch „Patchwork-Familien“ genannt (BMFSFJ 2013, S. 7; Burkart 2008a, S. 231; Nave-Herz 2013, S. 68).9 Unter Berücksichtigung des Partnerschaft sstatus der (Stief-)Eltern können zudem Stieff amilien im engeren Sinne (Ehen und Nichteheliche Lebensgemeinschaft en) sowie im weiteren Sinne (LAT-Beziehungen) unterschieden werden (Bien et al. 2002, S. 11). Darüber kann auch die Partnerschaft sbiographie und aus dieser der Grund des Aufl ösens einer Beziehung (Trennung/Scheidung oder Verwitwung) zur Diff erenzierung heran-gezogen werden (Ganong und Coleman 1984, S. 390).
Wie Tabelle 1 dokumentiert, schwanken die Angaben zu den Anteilen von Stieff amilien in Deutschland zwischen 8 und 18 Prozent. Dies lässt sich einer-seits mit den unterschiedlichen Datensätzen und den damit verbundenen Mög-lichkeiten der Identifi zierung von Stieff amilien erklären. Andererseits wird auf Verzerrungen der zugrunde gelegten Sample verwiesen (Steinbach 2008, S. 166). Betrachtet man die Verteilung von Stieff amilien diff erenziert nach Ost- und Westdeutschland, wird außerdem eine Tendenz zu mehr Stieff amilien in Ost-deutschland sichtbar (BMFSFJ; Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012; Steinbach 2008; Teubner 2002b). Mit den Daten des GGS wurde ein Anteil von 13 Prozent Stieff amilien in den alten Bundesländern im Vergleich zu 16 Prozent in den neuen Ländern ermittelt (Steinbach 2008, S. 167). Weitere Unterschiede zwischen bei-den Regionen Deutschlands werden bei der Betrachtung des Partnerschaft sstatus deutlich: Stiefeltern in Westdeutschland sind mit 82 Prozent deutlich häufi ger
9 Der Ausdruck „Patchwork-Familie“ mag populär sein, weil er im Vergleich zum Begriff „Stieffamilie“ weniger negativ konnotiert ist. Dennoch bietet er keine adäquate Alter-native, da (1) Patchwork-Familien letztlich eine spezielle Form der Stieffamilie sind und (2) für die einzelnen Familienmitglieder keine eigenen Begriffe vorliegen, sodass für eine eindeutige Zuordnung wieder auf die Begriffe Stiefeltern und Stiefkinder zu-rückgegriffen wird (Steinbach 2008, S. 155f., Burkart 2008a, S. 231, Meulders-Klein & Théry 1998, S. 7ff.).
59Diversität von Familie in Deutschland
verheiratet als Stiefeltern in Ostdeutschland (59 Prozent) (Steinbach 2008, S. 168). Die Daten der AID:A-Studie belegen zudem, dass 48 Prozent dieser Familienform Stiefvater-, 27 Prozent Stiefmutter- und 26 Prozent komplexe Stieff amilien sind (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 11). Mit dieser Datengrundlage wurde auch ermittelt, dass in Stieff amilienhaushalten vorrangig ein Kind lebt. Dies trifft mit 64 Prozent vor allem auf Haushalte von Stiefvaterfamilien zu (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 15).
Hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung wird deutlich, dass sich Stief- von Kern-familien dahingehend unterscheiden, dass in Stieff amilien häufi ger beide Eltern-teile in Vollzeit arbeiten (24 vs. 15 Prozent) (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 17). Ein Ost-West-Vergleich verweist auf deutliche regionale Unterschiede im Erwerbsarrangement von Stieff amilien (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 17; Teubner 2002a, S. 105). Während in den alten Ländern bei 19 Prozent der Stief-familien das Zweiverdienermodell verbreitet ist, sind dies in den neuen Ländern bei 45 Prozent der Fall (Kreyenfeld und Heintz-Martin 2012, S. 17). Hier fällt die stärkere Erwerbsneigung der Frauen in Ostdeutschland ins Gewicht (Teubner 2002a, S. 122).
Adoptiv- und Pfl egefamilien
Als Adoptiv- oder Pfl egefamilie werden Ehepaare oder alleinstehende Personen verstanden, die ein Kind angenommen haben und mit diesem in einem Haushalt leben (Peuckert 2012, S. 394). Pfl ege- unterscheiden sich von Adoptionsfamilien durch den rechtlichen Status. In Pfl egefamilien verbleibt das Sorge- und Verfü-gungsrecht über das Pfl egekind bei der Herkunft sfamilie oder dem Jugendamt (Peuckert 2012, S. 396). Durch eine Adoption wird dem Kind die rechtliche Stel-lung eines leiblichen Kindes zuteil, alle Beziehungen zur Herkunft sfamilie wer-den aufgegeben (Walper und Wendt 2011, S. 215). Rechtlich unterscheidet man zwischen drei Adoptionsverhältnissen: Fremd-, Verwandten- oder Stiefelternad-option (Peuckert 2012, S. 395). Letzteres führt zu Überschneidungen mit der De-fi nition der Kategorie „Stieff amilie“. Ähnliches gilt für Haushalte, in denen neben Stiefk indern auch adoptierte Kinder leben.
Adoptiv- und Pfl egefamilien stellen quantitativ eine sehr kleine Gruppe dar, wie Tabelle 1 belegt. Die Anzahl von Adoptionsfamilien lässt sich nur indirekt über die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Adoptionsverfahren schätzen (Peu-ckert 2012, S. 395). Ihre Zahl ist im Zeitverlauf gesunken, wie die Zeitreihe des Statistischen Bundesamtes zur Anzahl der Adoptionen in Deutschland doku-mentiert. Während im Jahr 1991 noch 7.124 Kinder adoptiert wurden, waren dies
60 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
im Jahr 2012 nur noch 3.886 (Statistisches Bundesamt 2014a). Die Anzahl der Adoptivkinder liegt dabei unter 1 Prozent an der Gesamtzahl Minderjähriger in Deutschland (Peuckert 2012, S. 395). Der Rückgang der Adoptionszahlen ist da-bei weniger auf ein sinkendes Interesse an Adoptionen zurückzuführen, als auf die geringe Anzahl zur Adoption stehender Kinder (Walper und Wendt 2011, S. 215). Kinder werden nach aktueller Politik der Jugendämter seltener dauerhaft aus ihren Familien herausgenommen. Dadurch liegt die Zahl der Adoptionsbewerber deutlich über der Zahl zur Adoption vorgemerkter Kinder (Peuckert 2012, S. 395).
Rückläufi g ist neben der Zahl der Adoptionen insgesamt auch die Zahl der Fremdadoptionen (Statistisches Bundesamt 2014a). Bei Fremdadoptionen liegt kein Verwandtschaft sverhältnis zu den Adoptionseltern vor. Im Jahr 2012 lag die Zahl der Fremdadoptionen deutlich unter der Zahl der Adoptionen durch Ver-wandte oder Stiefelternteile. Im Jahr 2012 wurden 3 Prozent der Kinder durch Verwandte, 57 Prozent durch Stiefelternteile und 40 Prozent durch Personen ad-optiert, bei denen kein Verwandtschaft sverhältnis bestand (Statistisches Bundes-amt 2014b). Bei 98 Prozent der Adoptiveltern verfügt mindestens ein Elternteil über eine deutsche Staatsbürgerschaft (Statistisches Bundesamt 2014b).
Die Zahl der Pfl egefamilien ist ebenfalls gering. Im Jahr 2008 wurden in Deutschland 14.500 Kinder in Pfl egefamilien untergebracht (van Santen 2010, S. 21). Ein Großteil der Pfl egeverhältnisse wird statistisch jedoch nicht erfasst, z.B. wenn die Kinder durch ihre Großeltern erzogen werden. Damit dürft e die tatsächliche Zahl der Pfl egschaft sverhältnisse deutlich unterschätzt werden. Die Verweildauer der Kinder in ihren Pfl egefamilien beträgt im Durschnitt 53 Mo-nate, also etwa viereinhalb Jahre, wobei die Aufenthaltsdauer mit zunehmendem Alter der Kinder sinkt (van Santen 2010, S. 22). Der Medianwert gibt Aufschluss darüber, dass die Hälft e aller Kinder ihr Pfl egschaft sverhältnis nach 22 Monaten wieder verlässt, wer nach dieser Zeit noch in seiner Pfl egefamilie lebt, bleibt deut-lich länger in diesem Pfl egschaft sverhältnis (van Santen 2010, S. 22). Damit wird deutlich, dass Kinder in ihren Pfl egefamilien oft kein dauerhaft es Zuhause fi nden.
Bei genauerer Betrachtung sind auch „Inseminationsfamilien“ (Peuckert 2012, S. 398) eine Art Adoptions- bzw. Stieff amilie. Als Inseminationsfamilien werden Paare bezeichnet, deren Kinder mit einer Samen- oder Eizellspende (oder bei-dem) gezeugt wurden (Peuckert 2012, S. 401). Biologische und soziale Elternschaft können dabei, je nach verwendeter Reproduktionstechnologie, teilweise oder voll-ständig auseinander fallen. Wird entweder eine Samen- oder Eizellspende hinzu-gezogen (heterologe Insemination), ähneln die Strukturen im Haushalt nach der Geburt des Kindes eher der von Stieff amilien. Es gibt einen biologischen Eltern-teil und einen, der keine biologische Verwandtschaft aufweist. Werden Samen- und Eizellspende für die Zeugung eines Kindes verwendet (doppelt-heterologe
61Diversität von Familie in Deutschland
Insemination), fallen biologische und soziale Elternschaft in der Familie gänzlich auseinander. Die Eltern entscheiden sich also bewusst für die Aufnahme eines nicht-verwandten Kindes und übernehmen die soziale Elternschaft (Peuckert 2012, S. 401). Das Kind hat dann den gleichen rechtlichen Staus wie ein leibliches Kind bzw. ein Kind, dass adoptiert wurde. Das deutsche Embryonenschutzgesetz erlaubt bisher lediglich die Samenspende, sodass letztere Form eher Einzelfälle darstellen, die sich im Ausland einer reproduktionsmedizinischen Behandlung unterzogen haben.
Über die Anteile von Inseminationsfamilien in Deutschland lassen sich nur schwer Aussagen treff en. Schätzungen gehen von etwa 1.000 künstlichen Befruchtungen aus, bei denen Paare auf Spendersamen zurückgegriff en haben (Walper und Wendt 2011, S. 221). Auf welcher Datenbasis diese Schätzungen basieren, bleibt jedoch unklar.
Gleichgeschlechtliche Paare mit Kind(ern)
Überschneidungen der Inseminationsfamilien gibt es auch mit der Familien-form gleichgeschlechtlicher Paare mit Kind(ern). Gleichgeschlechtliche Paare mit Kind(ern) können zudem Pfl egefamilien sein (Funcke 2010, S. 321). Eine Adop-tion ist bisher noch ausgeschlossen. Die Aufnahme eines Pfl egekindes ist aus ju-ristischer Perspektive die einzige Option gleichgeschlechtlicher Paare gemeinsam für ein Kind zu sorgen (Funcke 2010, S. 322).
Als gleichgeschlechtliche Paare mit Kind(ern) werden Haushalte defi niert, in denen homosexuelle Partner zusammen mit mindestens einem Kind leben. Da nicht in allen Befragungen nach der sexuellen Orientierung gefragt wird, blei-ben Zuordnungsprobleme bestehen und die Zahl dieser Familienform wird somit unterschätzt (Eggen und Rupp 2010, S. 25). Ein weiterer Aspekt der Unterschät-zung homosexueller Elternteile ist die Nicht-Berücksichtigung homosexueller Alleinerziehender (Eggen 2009, S. 13). Für sie besteht ebenfalls ein Identifi zie-rungsproblem in quantitativen Datenquellen.
Die Forschung zu gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kind(ern) steckt in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern wie die Vereinigten Staaten noch in den Kinderschuhen (Goldberg und Allen 2013). Dennoch liegen einige Schät-zungen vor, die Aufschluss über die Verteilung dieser Familienform geben (Eggen 2009; Eggen und Rupp 2010). In Tabelle 1 wird deutlich, dass die Zahl der gleich-geschlechtlichen Partnerschaft en mit Kind(ern) quantitativ sogar noch geringer ausfällt als die der Adoptiv- und Pfl egefamilien. Dies erschwert eine diff erenzierte Betrachtung dieser Familienform. Nach den Daten des Mikrozensus aus dem Jahr
62 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
2008 leben in Deutschland etwa 7.200 Kinder in 5.000 Haushalten mit gleichge-schlechtlichen Lebenspartnern (Eggen und Rupp 2010, S. 27). Selbst wenn man von einer deutlichen Unterschätzung dieser Zahl aufgrund der Defi zite bei der Identifi zierung von gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft en ausgeht, ist die Zahl dieser Familienform sehr gering und bildet eher eine Ausnahme.
Einige Informationen lassen sich dennoch zusammentragen: Die Anteile von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft en mit Kind ist zwischen 1996 (12 Prozent) und 2008 (7 Prozent) zurückgegangen (Eggen und Rupp 2010, S. 28). Eine Erklärung für diesen Rückgang könnte eine stärkere gesellschaft liche Akzep-tanz homosexueller Orientierung sein, sodass ein Coming-Out früher stattfi ndet und seltener eine heterosexuelle Beziehung eingegangen wird (Eggen 2009, S. 14), aus der dann Kinder entstehen können (Eggen und Rupp 2010, S. 29). Gegen-wärtig leben mehr als 90 Prozent der Kinder in gleichgeschlechtlichen Familien mit zwei Frauen in einem Haushalt (Eggen und Rupp 2010, S. 29). Dies könnte sich einerseits über die Vergabe des Aufenthaltsrechts erklären lassen, dass in der Vergangenheit Mütter bevorzugt hat. Andererseits ist es für männliche Lebens-gemeinschaft en deutlich schwerer eine Familienplanung tatsächlich umzusetzen. Darüber hinaus leben 67 Prozent der Kinder in diesen Haushalten mit Geschwis-tern zusammen (Eggen und Rupp 2010, S. 32). Die lässt darauf schließen, dass vor allem zwei und mehr Kinder in den Haushalten gleichgeschlechtlicher Paare leben. Die Kinder in homosexuellen Partnerschaft en sind nach einer Befragung durch das Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg (ifb ) zu 92 Prozent leibliche, zu 2 Prozent adoptierte und zu 6 Prozent Pfl egekinder (Rupp und Bergold 2009, S. 284). Die leiblichen Kinder stammen zu 51 Prozent aus einer vorherigen Partnerschaft und zu 49 Prozent wurden sie in die aktuelle Beziehung hinein geboren. Weitere Analysen des ifb dokumentieren, dass 39 Pro-zent der Kinder in Haushalten von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft en durch heterologe Insemination gezeugt wurden, wovon in der Hälft e der Fälle der Samenspender auch bekannt ist (Rupp und Bergold 2009, S. 285). Ein Drittel der bekannten Samenspender wird dann auch als biologischer Vater in das Geburten-buch eingetragen. Fast alle Kinder (96 Prozent), die auf diese Art entstanden sind, wurden in die aktuelle Partnerschaft hinein geboren (Rupp und Bergold 2009, S. 285).
Die Erwerbsbeteiligung gleichgeschlechtlicher Eltern unterscheidet sich von denen in Kernfamilien durch den höheren Anteil an Haushalten, in denen beide Elternteile erwerbstätig sind. In 60 Prozent dieser Familien sind beide Elterntei-le erwerbstätig (Eggen und Rupp 2010, S. 32). Dieses spezifi sche Erwerbsmuster scheint für Haushalte gleichgeschlechtlicher Partnerschaft en von Frauen und Männern zu existieren.
63Diversität von Familie in Deutschland
4 Schlussfolgerungen
Im Mittelpunkt dieses Beitrags stand die Systematisierung vorhandener Fami-lienformen auf Basis der Haushaltsebene. Familie defi niert sich nach unserer Auf-fassung über das Vorhandensein von Kindern im Haushalt, weswegen Kinder-lose in unseren Darstellungen nicht berücksichtigt wurden. Die Haushaltsebene stellt dabei eine forschungspragmatische Herangehensweise an den Begriff „Fa-milie“ dar, der gleichzeitig haushaltsübergreifende Familienformen ausblendet. Doch vor dem Hintergrund, dass beispielsweise das Modell, bei dem die Kinder zwischen den Haushalten der getrennten Elternteile wechseln (Sünderhauf 2013, S. 61) bisher noch wenig verbreitet ist, scheint dieser Ansatz gerechtfertigt. Die Erfassung konventioneller Familienstrukturen scheint im Vergleich zu nicht-konventionellen Familienformen deutlich einfacher, da sie weniger komplex sind. Amtliche und Survey-Daten bieten dennoch die Möglichkeit nicht-konventionel-le Familienstrukturen (ggf. mit Einschränkungen) zu identifi zieren und damit Aufschluss über ihre Zusammensetzung und sozio-demografi sche Faktoren zu geben. Analysen zu Familien, die von der konservativen Form Vater-Mutter-Kind(er) abweichen, leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Forschungsland-schaft und helfen das Familienleben in Deutschland in seiner Fülle abzubilden.
Quantitative Analysen konnten belegen, dass ein konventioneller Haushalt, bestehend aus Frau und Mann mit leiblichen Kindern, noch immer die vorherr-schende Familienform in Deutschland darstellt. Dies bedeutet, dass die über-wiegende Mehrheit der Frauen und Männer in Deutschland im Verlauf ihres Lebens eine Familie gründet. Diese Familien können allerdings deutlich von in der Vergangenheit existierenden Formen abweichen. Entscheidend ist jedoch der Referenzzeitpunkt, mit dem aktuelle Familienformen verglichen werden. In der Vergangenheit haben ebenfalls Stief-, Adoptiv- und Pfl egefamilien existiert, wenn auch unter anderen Entstehungsbedingungen (siehe auch Rosenbaum in diesem Band). Im Vergleich zu den 1960er Jahren nimmt der Anteil dieser nicht-kon-ventionellen Familienformen gegenwärtig zu, aber neu sind sie im historischen Kontext nicht. Nicht-konventionelle Familienformen gewinnen jedoch an gesell-schaft licher Relevanz, sodass eine intensivere Betrachtung dieser Familien für die zukünft ige Familienforschung bedeutsam(er) wird. Dabei scheint auf Forscher-seite auch ein sensibler Blick für die Einstufung einer „neuen“ Familienform ge-fragt zu sein. Durch das Hinzuziehen verschiedener Merkmale wie Institutionali-sierungsgrad der Beziehung, sexuelle Orientierung, Migrationshintergrund oder Erwerbstatus ist es möglich, eine größere Vielfalt zu generieren als sie tatsächlich vorliegt.
64 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Darüber hinaus ist auch ein politisches Interesse an Familien, die nicht in konventionellen Strukturen zusammenleben, gegeben, wie verschiedene Exper-tisen zu Stieff amilien (BMFSFJ 2013), Alleinerziehenden (Statistisches Bundes-amt 2010) und gleichgeschlechtlichen Partnerschaft en mit Kind(ern) (Familien-ministerium Baden-Württemberg 2013; Eggen 2009) belegen. Quantitativ stellen jedoch Alleinerziehende und Stieff amilien den größten Anteil an nicht-konven-tionellen Familienformen. Die Anteile von Adoptions- und Pfl egefamilien sowie gleichgeschlechtliche Partnerschaft en mit Kind(ern) an allen Familien fallen sehr gering aus.
Gesellschaft liche Entwicklungen bringen Veränderungen im Bereich Familie mit sich. So hat die Ehe als Legitimierung einer Familie einen großen Bedeu-tungsverlust hinnehmen müssen. Viele Paare leben inzwischen unverheiratet mit Kindern zusammen (Peuckert 2012, S. 696). Und auch wenn Familie noch im-mer einen hohen Stellenwert genießt, stehen Kinder in Konkurrenz zu anderen Lebenszielen. Der Strukturwandel, dem Familie gegenwärtig unterliegt, scheint noch nicht abgeschlossen zu sein. Damit steht nicht die Frage im Raum, was nach der Familie kommt, wie sie Beck-Gernsheim (1998, S. 18) formuliert und folge-richtig mit: „Die Familie!“ beantwortet hat. Vielmehr stellt sich die Frage, wie Fa-milie in Zukunft aussehen wird. Eine Frage die jede Epoche neu aufwirft (Burkart 2008b, S. 253), denn Familie scheint ein dynamischer Prozess zu sein, der aus einem Zusammenspiel verschiedener Akteure und den gegebenen (sich wieder-um verändernden) Rahmenbedingungen entsteht. Werden sich die Anteile in den vorhandenen Familienformen also weiter verschieben? Werden neue Familien-formen zu den bestehenden hinzukommen? Und wie werden Familien konkret auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren?
Dass Familien veränderte Rahmenbedingungen wahrnehmen und auf diese eingehen, um ein befriedigendes Familienleben aufrecht zu erhalten, wurde von Huinink (2011) beschrieben. Unsichere Erwerbsverläufe, fl exibilisierte Arbeits-zeiten und räumliche Mobilität stellen besondere Herausforderung für das fami-liale Zusammenleben dar (Schneider et al. 2009, S. 130f.). Familien reagieren (frei-willig oder unfreiwillig) durch eine „Marktformierung“ (Peuckert 2012, S. 697) auf diese Veränderungen, ohne dabei grundlegende Familienstrukturen endgül-tig aufzugeben. Dies führt zu veränderten Familienformen. Wie diese zukünft ig aussehen werden, ist nur schwer abzuschätzen.
Vor dem Hintergrund fl exibler Partnerschaft s- und Familienbiographien könnten sich die Anteile vorhandener Familienformen weiter verschieben. Fami-lienphasen im Lebensverlauf wechseln sich mit Phasen des Alleinlebens, des Zu-sammenlebens mit einem neuen Partner und der Familienerweiterung ab, sodass Familienstrukturen noch komplexer werden. Für diese Entwicklungen spricht
65Diversität von Familie in Deutschland
u.a. das „Wechselmodell“ (Sünderhauf 2013, S. 61), welches bisher in Deutsch-land noch wenig verbreitet ist. Im Rahmen dieses Modells kümmern sich die ge-trennt lebenden Eltern abwechselnd und gleichberechtigt um ihre Kinder. Dies bedeutet, dass die Kinder in zwei Elternhäusern leben. Anders als im Rahmen eines gemeinsamen Sorge- oder Umgangsrechts orientiert sich diese Familien-form an einer gleichberechtigten und gleichverpfl ichtenden Betreuung der Kin-der. Damit sind die Kinder in beiden Elternhaushalten zu Hause, weshalb hier die Perspektive eines Haushalts als Defi nitionsgrundlage für Familie obsolet wäre. Komplexere, haushaltsübergreifende Familienstrukturen infolge von Scheidung und Trennung scheinen damit eine Richtung zu sein, in die sich Familienstruk-turen künft ig entwickeln könnten.
Wenn Kinder in mehreren Haushalten zu Hause sind und von den (Stief-)El-tern Beruf und Familie vereinbart werden müssen, ist verstärkt eine „aktive Her-stellungsleistung“ (BMFSFJ 2006, S. 128) aller Familienmitglieder erforderlich, um ein Familienleben aufrecht zu erhalten. Unter dem Begriff „Doing Family“ (siehe auch Jurczyk in diesem Band) werden familial erbrachte Leistungen zu-sammengefasst, die im alltäglichen Handeln Familie als gemeinschaft liches Gan-zes fortwährend neu herstellen (Schier und Jurczyk 2007, S. 10). „Doing Family“ beinhaltet auch die Entwicklung von „being“ zu „doing“, die Familien gegenwär-tig durchlaufen. Aufgrund veränderter gesellschaft licher Rahmenbedingungen entwickelt sich Familie von einer selbstverständlichen Ressource zu einer zuneh-mend voraussetzungsvollen Tätigkeit. Physische Anwesenheit stellt eine Voraus-setzung für Interaktionsprozesse zwischen den einzelnen Familienmitgliedern dar, denn um Familie als Gemeinschaft zu leben, braucht es Gelegenheiten (Schier und Jurczyk 2007, S. 11). Nimmt die Mobilität einzelner Familienmitglieder auf-grund verschiedener Haushalte der Eltern oder berufl icher Mobilität der Eltern-teile zu, müssen diese Gelegenheiten aktiv geschaff en werden (Schier und Jurczyk 2007, S. 15f.). Je komplexer (haushaltsübergreifende) Familienstrukturen und je heterogener die Lebenslagen der Familienmitglieder werden, desto aktiver muss Familie dann auch gestaltet werden (Jurczyk und Szymenderski 2012, S. 99).
Darüber hinaus wäre es möglich, dass der Familienbegriff zukünft ig gänzlich neu defi niert wird. Die Familie der Zukunft bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit (BMFSFJ 2006). Verlässlichkeit kann auch außerhalb biologischer Strukturen wie in Freundschaft snetzwerken gefun-den werden (Burkart 2008b, S. 259). Möglicherweise wird der Familienbegriff sich auch auf Freundschaft snetzwerke ausweiten (die nicht zwingend Kinder berück-sichtigen) und damit wäre gleichzeitig eine neue Familienstruktur entstanden. Wie solche komplexen Familienformen dann empirisch erfasst werden sollen, muss vorerst off en bleiben.
66 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Literatur Andreß, H.-J. (2001). Die wirtschaft liche Lage Alleinerziehender. In: Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.), Dokumentation der Fachtagung Al-leinerziehen in Deutschland. Ressourcen und Risiken einer Lebensform (S. 8-24). Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Bach, A. (2002). Die Renaissance der Ein-Eltern-Familie? Eine demographische und so-zioökonomische Analyse der Entwicklung in Deutschland und Großbritannien. In: J. Dorbritz & J. Otto (Hrsg.), Familienpolitik und Familienstrukturen. Ergebnisse der ge-meinsamen Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft und der Johann-Peter-Süßmilch-Gesellschaft für Demographie, Berlin, 21. - 23. Juni 2001. Materialien zur Bevölkerungsfoschung, Heft 108. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevöl-kerungsforschung.
Bastin, S., Kreyenfeld, M., & Schnor, C. (2013). Diversität von Familienformen in Ost- und Westdeutschland. In: D. C. Krüger, H. Herma & A. Schierbaum (Hrsg.), Familie(n) heute. Entwicklungen, Kontroversen, Prognosen (S. 126-145). Weinheim/Basel: Beltz & Juventa.
Bayer, H., & Bauereiss, R. (2003). Haushalt und Familie in der amtlichen Statistik. In: W. Bien & J. H. Marbach (Hrsg.), Partnerschaft und Familiengründung. Ergebnisse der drit-ten Welle des Familien-Survey (S. 277-305). Opladen: Leske + Budrich.
Beck-Gernsheim, E. (1994). Individualisierungstheorie: Veränderungen des Lebenslaufs in der Moderne. In: H. Keupp (Hrsg.), Zugänge zum Subjekt. Perspektiven einer refl exiven Sozialpsychologie (S. 125-146). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Beck-Gernsheim, E. (1998). Was kommt nach der Familie? München: Beck. Beck, U. (1986). Risikogesellschaft : Auf dem Weg in eine andere Moderne. Frankfurt am
Main: Suhrkamp. Beck, U. (1990). Der Konfl ikt der zwei Modernen. In: W. Zapf (Hrsg.), Die Modernisierung
moderner Gesellschaft en. Verhandlungen des 25. Deutschen Soziologentages in Frankfurt am Main (S. 40-54). Frankfurt am Main: Campus.
Beck, U., & Beck-Gernsheim, E. (1990). Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Bertram, H. (2002). Die multilokale Mehrgenerationenfamilie. Berliner Journal für Sozio-logie 12, 517-529.
Bien, W., Hartl, A., & Teubner, M. (2002). Einführung: Stieff amilien in Deutschland. In: W. Bien, A. Hartl & M. Teubner (Hrsg.), Stieff amilien in Deutschland. Eltern und Kinder zwischen Normalität und Konfl ikt (S. 9-20). Opladen: Leske + Budrich.
BMFSFJ (2006). Siebter Familienbericht. Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit - Perspektiven für eine lebenslaufb ezogene Familienpolitik. Berlin: Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend.
BMFSFJ (2013). Stief- und Patchworkfamilien in Deutschland Bd. 31. Berlin: Bundesminis-terium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
Brüderl, J. (2004). Die Pluraliserung partnerschaft licher Lebensformen in Westdeutsch-land und Europa. Aus Politik und Zeitgeschichte 19, 3-10.
Brüderl, J., & Klein, T. (2003). Die Pluralisierung partnerschaft licher Lebensformen in Westdeutschland, 1960–2000. In: W. Bien & J. H. Marbach (Hrsg.), Partnerschaft und Familiengründung (S. 189-217). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft en.
Burkart, G. (2008a). Familiensoziologie. Konstanz: UKV.
67Diversität von Familie in Deutschland
Burkart, G. (2008b). Zukunft der Familie oder: Szenarien zukünft iger Lebens- und Fa-milienverhältnisse. In: N. F. Schneider (Hrsg.), Lehrbuch moderne Familiensoziologie. Th eorien, methoden, empirische Befunde. (S. 253-272). Opladen: Barbara Budrich.
Dorbritz, J., Ette, A., Gärtner, K., Grünheid, E., Mai, R., Micheel, F., Naderi, R., Pfaff , H., Roloff , J., Sauer, L., Scharein, M., Schulz, R., Sommer, B., & Swiaczny, F. (2008). Bevöl-kerung: Daten, Fakten, Trends zum demografi schen Wandel in Deutschland. Wiesbaden: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung.
Dorbritz, J., & Ruckdeschel, K. (2007). Kinderlosigkeit in Deutschland—Ein europäischer Sonderweg? Daten, Trends und Gründe. In: D. Konietzka & M. Kreyenfeld (Hrsg.), Ein Leben ohne Kinder (S. 45-81). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft en.
Eggen, B. (2009). Gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft en mit und ohne Kinder: Eine Expertise auf der Basis des Mikrozensus 2006. ifb -Materialien 1-2009. Bamberg: Staats-institut für Familienforschung.
Eggen, B., & Rupp, M. (2010). Gleichgeschlechtliche Paare und ihre Kinder: Hintergrund-informationen zur Entwicklung gleichgeschlechtlicher Lebensformen in Deutschland. Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft 7, 22-37.
Feldhaus, M., & Huinink, J. (2011). Multiple Elternschaft en in Deutschland - eine Analyse zur Vielfalt von Elternschaft in Folgepartnerschaft en. Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft 8, 77-104.
Funcke, D. (2010). Die gleichgeschlechtliche Pfl egefamilie: Eine Herausforderung für Th eorie und Praxis. In: D. Funcke & P. Th orn (Hrsg.), Die gleichgeschlechtliche Familie mit Kindern: Interdisziplinäre Beiträge zu einer neuen Lebensform. Bielefeld: Transcript.
Ganong, L. H., & Coleman, M. (1984). Th e eff ects of remarriage on children: A review of the empirical literature. Family Relations 33, 389-406.
Geissler, B. (1996). Arbeitswelt, Familie und Lebenslauf. Das Vereinbarungsdilemma und der Wandel im Geschlechterverhältnis. In: L. A. Vascovic & H. Lipinski (Hrsg.), Fami-liale Lebenswelten und Bildungsarbeit (S. 111-152). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwis-senschaft en.
Glick, P. C. (1947). Th e family cycle. American Sociological Review 12, 164-174. Goldberg, A. E., & Allen, K. R. (2013). LGBT-parent families: Innovations in research and
implications for practice. New York: Springer. Grünheid, E., & Scharein, M. G. (2011). On developments in the mean joint lifetimes of
three-and four-generation families in Western and Eastern Germany–a model calcula-tion. Comparative Population Studies 36, 41-76.
Hill, P. B., & Kopp, J. (2013). Familiensoziologie: Grundlagen und theoretische Perspektive. 5. Aufl age Wiesbaden: Springer VS.
Huinink, J. (2011). Die ‚notwendige Vielfalt‘ der Familie in spätmodernen Gesellschaft en. In: K. Hahn, & C. Koppetsch (Hrsg.), Soziologie des Privaten (S. 19-31). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft en.
Huinink, J., Brüderl, J., Nauck, B., Walper, S., Castiglioni, L., & Feldhaus, M. (2011). Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics (pairfam): Conceptual frame-work and design. Zeitschrift für Familienforschung 23, 77-100.
Huinink, J., & Konietzka, D. (2007). Familiensoziologie: Eine Einführung. Frankfurt am Main: Campus.
Infratest (2000). Familie und Partnerbeziehungen in der Bundesrepublik Deutschland (Fa-miliensurvey 2000). Methodenbericht. München: Infratest Burke Sozialforschung.
68 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Jurczyk, K., Klinkhardt, J., Entleitner, C., Heintz-Martin, V., Langmeyer, A., & Possinger, J. (2014). Vater, Mutter, Kind? Acht Trends in Familien, die Politik heute kennen sollte. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stift ung.
Jurczyk, K., & Szymenderski, P. (2012). Belastungen durch Entgrenzung. Warum Care in Familien zur knappen Ressource wird. In R. Lutz (Hrsg.), Erschöpft e Familien (S. 89-105). Wiesbaden: Springer VS.
Klein, T. (1999). Pluralisierung versus Umstrukturierung am Beispiel partnerschaft licher Lebensformen. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 51, 469-490.
Klein, T. (2003). Die Geburt von Kindern in paarbezogener Perspektive. Zeitschrift für So-ziologie 32, 506-527.
König, R. (2002). Zwei Grundbegriff e der Familiensoziologie. In: R. Nave-Herz (Hrsg.), Familiensoziologie - René König Schrift en Bd. 14 (S. 49-90). Opladen: Leske + Budrich.
Kreyenfeld, M., & Heintz-Martin, V. (2012). Stieff amilien in Deutschland. Ein soziodemo-graphischer Überblick. Berlin: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Kreyenfeld, M., Hornung, A., & Kubisch, K. (2013). Th e German Generations and Gender Survey: Some critical refl ections on the validity of fertility histories. Comparative Popu-lation Studies 38, 3-28.
Kreyenfeld, M., & Huinink, J. (2003). Der Übergang zum ersten und zweiten Kind. Ein Vergleich zwischen Familiensurvey und Mikrozensus. In: W. Bien & J. H. Marbach (Hrsg.), Partnerschaft und Familiengründung. Ergebnisse der dritten Welle des Familien-Survey (S. 43-64). Opladen: Leske + Budrich.
Kreyenfeld, M., & Konietzka, D. (2007). Die Analyse von Kinderlosigkeit in Deutschland: Dimensionen–Daten–Probleme. In: D. Konietzka & M. Kreyenfeld (Hrsg.), Ein Leben ohne Kinder: Kinderlosigkeit in Deutschland (S. 11-41). Wiesbaden: VS Verlag für Sozial-wissenschaft en.
Kreyenfeld, M., & Konietzka, D. (2012). Stieff amilien und die spätmoderne Vielfalt der Familie. In: P. Buhr & M. Feldhaus (Hrsg.), Die notwendige Vielfalt von Familie und Partnerschaft (S. 233-253). Würzburg: Ergon.
Kreyenfeld, M., Schmidtke, K., & Zühlke, S. (2009). Eignet sich das Mikrozensus-Panel für familiensoziologische Fragestellungen? Untersuchung am Beispiel der Frage nach den ökonomischen Determinanten der Familiengründung. Zeitschrift für Familienforschung 21, 264-285.
Krieger, S., & Weinmann, J. (2008). Familie, Lebensformen und Kinder. Auszug aus dem Datenreport 2008. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland. Bonn: Bundes-zentrale für politische Bildung.
Kuhnt, A.-K. (2013). Ja, nein, vielleicht? Der Einfl uss der Partnerschaft squalität auf die Übereinstimmung der Elternschaft sabsichten von Paaren. Zeitschrift für Familienfor-schung 25, 365-388.
Kuhnt, A.-K., & Trappe, H. (2013). Easier said than done: childbearing intentions and their realization in a short term perspective (WP2013-018). Rostock: Max Planck Institute for Demographic Research.
Lauterbach, W. (2004). Die multilokale Mehrgenerationenfamilie: zum Wandel der Fami-lienstruktur in der zweiten Lebenshälft e. Würzburg: Ergon.
Lengerer, A., Bohr, J., & Janßen, A. (2005). Haushalte, Familien und Lebensformen im Mik-rozensus–Konzepte und Typisierungen. ZUMA-Arbeitsbericht Nr. 2005/05. Mannheim: ZUMA.
69Diversität von Familie in Deutschland
Lengerer, A., & Klein, T. (2007). Der langfristige Wandel partnerschaft licher Lebensfor-men im Spiegel des Mikrozensus. Statistisches Bundesamt. Wirtschaft und Statistik 4, 433-447.
Marbach, J. H. (2008). Die Familie als Forschungsthema – ein Auslaufmodell? Zur Aktu-alität des Familienbegriff s in der Familienforschung und Ansätze zu einer Neufassung. In: W. Bien & J. H. Marbach (Hrsg.), Familiale Beziehungen, Familienalltag und soziale Netzwerke (S. 13-41). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft en.
Meulders-Klein, M.-T., & Th éry, I. (1998). Fortsetzungsfamilien. Neue familiale Lebensfor-men in pluridisziplinärer Betrachtung. Konstanz: UVK.
Familienministerium Baden-Württemberg (2013). Gleichgeschlechtliche Lebensge-meinschaft en und Familien. Familien in Baden-Württemberg. Stuttgart: Ministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Senioren Baden-Württemberg.http://www.statistik.baden−wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Fafo/Familien_in_BW/R20132.pdf. Zugegriff en: 14. Februar 2014.
Nave-Herz, R. (1997). Pluralisierung familialer Lebensformen - ein Konstrukt der Wissen-schaft ? In: L. A. Vaskovics (Hrsg.), Familienleitbilder und Familienrealitäten (S. 36-49). Opladen: Leske + Budrich.
Nave-Herz, R. (2010). Die Familie im Wandel. In: F. Faulbaum & C. Wolf (Hrsg.), Gesell-schaft liche Entwicklungen im Spiegel der empirischen Sozialforschung (S. 39-57). Wies-baden: VS Verlag für Sozialwissenschaft en.
Nave-Herz, R. (2012). Familie heute. Wandel der Familienstrukturen und Folgen für die Er-ziehung (5. überarbeitete Aufl .). Darmstadt: Wissenschaft liche Buchgesellschaft WBG.
Nave-Herz, R. (2013). Ehe-und Familiensoziologie: eine Einführung in Geschichte, theore-tische Ansätze und empirische Befunde (3. überabeitete Aufl .). Weinheim/Basel: Beltz & Juventa.
Peuckert, R. (2012). Familienformen im sozialen Wandel. Wiesbaden: Springer VS. Pötzsch, O., Weinmann, J., & Haustein, T. (2013). Geburtentrends und Familienentwick-
lung in Deutschland 2012. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt. Rauschenbach, T., & Bien, W. (2012). Aufwachsen in Deutschland. Weinheim/Basel: Beltz
& Juventa. Ruckdeschel, K., Ette, A., Hullen, G., & Leven, I. (2006). Generations and Gender Survey:
Dokumentation der ersten Welle der Hauptbefragung in Deutschland. Wiesbaden: Bun-desinstitut für Bevölkerungsforschung.
Ruckdeschel, K., & Naderi, R. (2009). Fertilität von Männern. Bevölkerungsforschung Ak-tuell 30, 2-9.
Rupp, M., & Bergold, P. (2009). Zusammenfassung. In: M. Rupp (Hrsg.), Die Lebenssitua-tion von Kindern in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaft en. Köln: Bundesanzeiger Verlag.
Schier, M., & Jurczyk, K. (2007). „Familie als Herstellungsleistung“ in Zeiten der Entgren-zung. Aus Politik und Zeitgeschichte 34, 10-17.
Schneewind, K. A. (2010). Familienpsycholgie (3. überarbeitete und erweiterte Aufl .). Stutt-gart: Kohlhammer.
Schneider, N. F., Krüger, D., Lasch, V., Limmer, R., & Matthias-Bleck, H. (2001). Alleiner-ziehen: Vielfalt und Dynamik einer Lebensform. Weinheim/Basel: Beltz & Juventa.
Schneider, N. F., Ruppenthal, S., & Lück, D. (2009). Beruf, Mobilität und Familie. In: G. Burkart (Hrsg.), Zukunft der Familie. Prognosen und Szenarien. (S. 111-136). Opladen: Budrich.
70 Anne-Kristin Kuhnt & Anja Steinbach
Schwarz, K. (1995). In welchen Familien wachsen die Kinder und Jugendlichen in Deutsch-land auf. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 20, 271-292.
Solga, H. (1996). Lebensverläufe und historischer Wandel in der ehemaligen DDR. ZA-Information 38, 28-38.
Statistisches Bundesamt (2010). Alleinerziehende in Deutschland. Ergebnisse des Mikrozen-sus 2009. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
Statistisches Bundesamt (2014a). Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland: Zeitreihe Adop-tionen. https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesellschaft Staat/Soziales/Sozial-leistungen/KinderJugendhilfe/Tabellen/Adoptionen.html;jsessionid=4A8B77521789C189BC93D586CAC11948.cae2. Zugegriff en: 12. Februar 2014.
Statistisches Bundesamt (2014b). Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland: Adoptierte Kin-der und Jugendliche 2012 nach persönlichen Merkmalen, Verwandtschaft verhältnis zu den Adoptiveltern und deren Staatsangehörigkeit. https://www.destatis.de/DE/Zahlen-Fakten/Gesellschaft Staat/Soziales/Sozialleistungen/KinderJugendhilfe/Tabellen/Adop-tionen2012.html. Zugegriff en: 13. Februar 2014.
Steinbach, A. (2008). Stieff amilien in Deutschland. Ergebnisse des „Generations and Gen-der Survey“ 2005. Zeitschrift für Bevölkerungswissenschaft 33, 153-180.
Strohmeier, K. P. (1993). Pluralisierung und Polarisierung der Lebensformen in Deutsch-land. Aus Politik und Zeitgeschichte 17, 11-22.
Sünderhauf, H. (2013). Wechselmodell: Psychologie-Recht-Praxis. Abwechselnde Kinderbe-treuung durch Eltern nach Trennung und Scheidung. Wiesbaden: Springer VS.
Teubner, M. (2002a). Die Erwerbsbeteiligung von Stieff amilien. In: W. Bien, A. Hartl & M. Teubner (Hrsg.), Stieff amilien in Deutschland. Eltern und Kinder zwischen Normalität und Konfl ikt (S. 99-130). Opladen: Leske + Budrich.
Teubner, M. (2002b). Wie viele Stieff amilien gibt es in Deutschland? In: W. Bien, A. Hartl & M. Teubner (Hrsg.), Stieff amilien in Deutschland. Eltern und Kinder zwischen Normali-tät und Konfl ikt (S. 23-50). Opladen: Leske + Budrich.
Träger, J. (2009). Familie im Umbruch: Quantitative und qualitative Befunde zur Wahl von Familienmodellen. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaft en.
van Santen, E. (2010). Pfl egekind auf Zeit. DJI Bulletin 91, 21-23. Wagner, M. (1996). Lebensverläufe und gesellschaft licher Wandel: Die westdeutschen Teil-
studien. ZA-Information 38, 20-27. Wagner, M. (2008). Entwicklung und Vielfalt der Lebensformen. In: N. F. Schneider
(Hrsg.), Lehrbuch Moderne Familiensoziologie: Th eorien, Methoden, empirische Befunde (S. 99-120). Opladen: Budrich.
Wagner, M., & Cifuentes, I. V. (2014). Die Pluralisiserung der Lebensformen - ein fortlau-fender Trend? Comparative Population Studies 39, 73-98.
Walper, S., & Wendt, E.-V. (2011). Die Bedeutung der Abstammung für die Identitätsfi n-dung und Persönlichkeitsentwicklung in der Adoleszenz: Adoption, Samenspende und frühe Vaterabwesenheit nach Trennung der Eltern. Zeitschrift für Familienforschung, Sonderheft 8, 211-237.